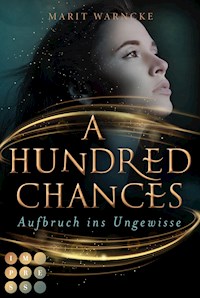9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
**Ein Kleid für die zukünftige Königin** »Einfach zauberhaft und toll geschrieben!« »Großartiges orientalisches Setting und viel Spannung« (Leser*innenstimmen) »Super spannende Geschichte in einer fantastischen Welt« (Leser*innenstimmen) Schon seit sie denken kann, träumt Naima von einer Zukunft, in der sie endlich Kleider schneidern darf. Ob Seide, Spitze oder Tüll, die Stoffe scheinen unter ihren Händen eine nahezu magische Kraft zu entwickeln. Doch erst als Naima sich in die Hauptstadt des Landes begibt, wird das wahre Ausmaß ihrer Kräfte enthüllt: Die junge Schneiderin ist in der Lage, Menschen in Stimmungen und Fähigkeiten zu kleiden. Und auch wenn Naima niemals damit gerechnet hätte, muss sie auf einmal für die Thronerbin höchstpersönlich eine Robe anfertigen. Hilfe bekommt sie dabei von dem geheimnisvollen Künstler Tarik. Doch Naimas Kreation erregt Aufsehen der falschen Art und verstrickt sie in einen Kampf, der über die Zukunft von ganz Melidiya entscheidet … Lass dich von der Magie der Stoffe bezaubern und begib dich in eine orientalische Welt, in der nichts ist, wie es scheint und eine uralte Prophezeiung über Krieg oder Frieden bestimmt! //Dies ist der Sammelband der magischen Dilogie »Woven Magic«. Die E-Box der Fantasy-Liebesgeschichte besteht aus: -- Die Magie der Mitternachtsrobe (Woven Magic 1) -- Der Fluch der Schicksalsrobe (Woven Magic 2) Diese Reihe ist abgeschlossen.//
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
www.impressbooks.de Die Macht der Gefühle
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung, können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich eventuell Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Carlsen Verlag GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Impress Ein Imprint der CARLSEN Verlag GmbH © der Originalausgabe by CARLSEN Verlag GmbH, Völckersstraße 14-20, 22765 Hamburg Text © Marit Warncke, 2022, 2023 Lektorat: Larissa Bendl Coverbild: freepik.com / © macrovector / © rawpixel.com / © user6096278 / ©keng_1980 / © beststudio / © starline / © volodymyr-t / shutterstock.com / © AlenaMorgana / © VolodymyrSanych / © nienora / © AlexAnnaButs / © agsandrew / © carpetpattern / © Ironika Covergestaltung der Einzelbände: formlabor Gestaltung E-Book-Template: Gunta Lauck / Derya Yildirim ISBN 978-3-646-61030-7carlsen.de
© privat
Marit Warncke, geboren 1995 in Hamburg, liebt es, sich in kreative Projekte zu stürzen. Nach ihrem Abschluss in Modedesign gründete sie ihre Firma »Make Ma!«, eine Onlineplattform für Näh- und Stickbegeisterte mit großer YouTube Community. Nebenbei produziert sie Imagefilme für Unternehmen, illustriert und schreibt leidenschaftlich. Romane zu veröffentlichen war von Kindheit an ihr größter Traum.
Wohin soll es gehen?
Vita
Woven Magic 1: Die Magie der Mitternachtsrobe
Woven Magic 2: Der Fluch der Schicksalsrobe
Vorbemerkung für die Leser*innen
Liebe*r Leser*in,
dieser Roman enthält potenziell triggernde Inhalte. Aus diesem Grund befindet sich hier eine Triggerwarnung. Am Romanende findest du eine Themenübersicht, die demzufolge Spoiler für den Roman enthält.
Entscheide bitte für dich selbst, ob du diese Warnung liest. Gehe während des Lesens achtsam mit dir um. Falls du während des Lesens auf Probleme stößt und/oder betroffen bist, bleib damit nicht allein. Wende dich an deine Familie, Freunde oder auch professionelle Hilfestellen.
Wir wünschen dir alles Gute und das bestmögliche Erlebnis beim Lesen dieser besonderen Geschichte.
Marit Warncke und das Impress-Team
Marit Warncke
Die Magie der Mitternachtsrobe (Woven Magic 1)
**Ein Kleid für die zukünftige Königin**
Schon seit sie denken kann, träumt Naima von einer Zukunft, in der sie endlich Kleider schneidern darf. Ob Seide, Spitze oder Tüll, die Stoffe scheinen unter ihren Händen eine nahezu magische Kraft zu entwickeln. Doch erst als Naima sich in die Hauptstadt des Landes begibt, wird das wahre Ausmaß ihrer Kräfte enthüllt: Die junge Schneiderin ist in der Lage, Menschen in Stimmungen und Fähigkeiten zu kleiden. Und auch wenn Naima niemals damit gerechnet hätte, muss sie auf einmal für die Thronerbin höchstpersönlich eine Robe anfertigen. Hilfe bekommt sie dabei von dem geheimnisvollen Künstler Tarik. Doch Naimas Kreation erregt Aufsehen der falschen Art und verstrickt sie in einen Kampf, der über die Zukunft von ganz Melidiya entscheidet …
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Danksagung
Zu jeder Kunst gehören zwei: einer, der sie macht,und einer, der sie braucht.
—Ernst Barlach
PROLOG
Wie Schatten huschten die Männer durch die Dunkelheit, kamen aus allen Winkeln des Bergdorfes hervorgekrochen. Sie liefen durch die Ruinenstadt in Richtung Palast. In den kleinen Gassen war der Boden immer nass und keiner wusste, warum. Obwohl der Krieg schon seit neunzehn Jahren vorbei war, lagen immer noch überall Schutt, Bretter und Steine verstreut. Viele Häuser waren zerstört, ihre Fassaden mit Einschusslöchern gesprenkelt. Wäscheleinen spannten sich zwischen den Fenstern, daran befestigte Tuniken trockneten in der staubigen Luft.
Die Verbitterung hing fast greifbar über dem Ort, genauso drückend wie die Wolkenfetzen.
Am Denkmal, das eine scharfkantige Bergkette zeigte, nahmen sich die vermummten Männer Zeit für eine tiefe Verbeugung, dann wandten sie sich nach links.
Hinter den Häusern des Dorfes ragte das Gebirge in die Luft. Davor ihr letzter und einziger Stolz. Der blanke Fels der Berge verschmolz mit einer Palastfassade, imposant und mächtig. Der Bergpalast war mit Magie errichtet worden und strahlte aus jedem einzelnen Winkel Macht aus. Er hatte eine hohe Eingangstür und vier Türme, die nahtlos in den roten Stein übergingen.
Als die Schatten durchs Portal ins Innere des Berges traten, ließ eine laute Stimme den bereits prall gefüllten Saal erzittern.
»Unser Schicksal ist noch nicht besiegelt«, donnerte ein bulliger Mann namens Kaplan über die Köpfe der Versammelten hinweg. »Wir haben unseren König verloren, aber wir haben nicht die Schlacht verloren.«
Die Menschen drückten sich bis in die hintersten Winkel, reckten die Köpfe, um einen guten Blick vom Podium und ihrem Anführer zu erhaschen. Da stand er, Kaplan, in seinem typischen mitternachtsblauen Umhang, in seiner gedrungenen Haltung, den Oberkörper leicht nach vorn gebeugt, wie ein Tiger zum Sprung bereit.
»Holen wir endlich, was uns zusteht«, sprach er weiter. »Wir lassen uns nicht länger herumschubsen. Die Königin hat ihr Versprechen gebrochen. Wie will sie als Nördliche unseren wunderschönen und stolzen Süden vertreten? Seit Aslans Tod ging es von Jahr zu Jahr bergab mit unserem Land. Jetzt schickt sie sogar Truppen in den Süden. In unseren Süden! Was will sie hier? Uns ausspionieren? Uns aus unserem Land vertreiben?« Er spuckte verächtlich aus. »Es reicht! Wir haben uns zurückgezogen, als unser Anführer die Königin geheiratet hat. Wir haben geschwiegen. Aber diese Verbindung ist nichts mehr wert. Wir werden nicht ruhen, bis die Taten des großen Krieges gerächt sind, bis unser Blut mit ihrem vergolten ist, bis keine Königin je wieder das Licht der Welt erblickt. Wir verdienen die absolute Macht. Und wir werden sie uns holen.«
Brüllende Zustimmung entbrannte und rauschte durch den Saal, hoch bis zur Decke, die aus scharfkantigen Felszähnen bestand.
Kaplan lachte und hob die Hände. »Meine Freunde, es kommt noch besser. Die Königin unternimmt einen armseligen Versuch, uns zu blenden, indem sie ihre Tochter zur Heirat freigibt. Sie soll hundert Edelmänner an den Hof eingeladen haben. Das schauen wir uns mal genau an, was meint ihr? Ich kann verraten, dass die Thronerbin ein langweiliges Ding ist. Aber wenn einer von euch Interesse an ihr hat, nur zu!«
Er lachte und bleckte die Zähne. Ein paar Männer fielen in sein Lachen ein.
»Ich sage, dass das ein Schrei um Erlösung ist! Die Königin bettelt förmlich darum, dass wir ihr Dasein beenden.«
Er zückte einen Dolch aus seinem Gürtel und zog eine Linie nahe seinem dicken Hals. Gackern ging durch die Reihen.
»Heute Nacht ist es so weit. Wir machen uns auf den Weg in die Hauptstadt und setzen die Mühle in Bewegung. Bald krönen wir den Mann, der eigentlich unser rechtmäßiges Oberhaupt sein sollte.«
Tosende Zustimmung barst durch die Luft und der Rote Block setzte sich in Bewegung. Stiefel polterten über den Steinboden, Fackeln wurden entzündet und Wut und Rache marschierten los in Richtung Arada.
1
Naima
Hastig zog ich die Tür hinter mir zu und presste mich dagegen. Ich lauschte einen Moment, aber außer dem Rauschen in meinen Ohren war es still. Niemand war mir gefolgt.
Erleichtert breitete ich das zerknautschte Kleid aus, das ich in den Händen trug, und presste es an meine Brust. Hier, im Vorraum von Herdas Büro, war der einzige Spiegel im ganzen Heim.
Schert euch um die Arbeit, nicht um eure hohlen Fratzen, sagte Herda immer, wenn jemand es wagte, das Thema anzuschneiden. Ich hatte mein eigenes Gesicht aus diesem Grund nur selten gesehen. Ein paarmal in Häusern, wo ich putzte und kurzfristig Zugang zu einem Spiegel hatte, oder hier, wenn wir Mutprobe gespielt hatten.
Auch jetzt fühlte es sich noch ungewohnt an, in meine grünen Augen zu sehen. Ich strich mir eine schwarze Strähne aus der Stirn. Mein geflochtener Zopf reichte mir bis zu meiner Hüfte. Mein Körper war noch immer mager und klein, fast schon kindlich, nicht so kurvig und erwachsen wie die der anderen siebzehnjährigen Mädchen hier.
Ich schüttelte den Gedanken ab und fokussierte mich wieder auf das, was mich eigentlich herbrachte: das Kleid, an dem ich seit Wochen arbeitete, immer nachts, wenn die Drecksarbeit des Tages erledigt war und die anderen Mädchen schliefen. Letzte Nacht war ich endlich fertig geworden.
Über Monate hatte ich jedes Stoffstück gesammelt, das ich zu fassen bekommen hatte: alte Lappen, eine zerrissene Uniform und Herdas ausrangierte Gardinen. Ich hatte alles in Streifen geschnitten und daraus einen neuen Stoff gewebt. Die verschiedenen Materialien ergänzten sich in ihrem moderigen Grau und ergaben eine gebrochene Struktur, die beinahe an Tweed erinnerte. Ich hatte ein schlichtes, geradliniges Kleid daraus zugeschnitten, mit eckigem Halsausschnitt und leicht gekräuselten Ärmeln. Es war das Aufwendigste, das ich je genäht hatte. Obwohl es nur aus altem Zeug bestand, sah es stimmig aus, als gehöre es genau so, wie es war.
Tiefe Zufriedenheit erfüllte mich und plötzlich spürte ich den starken Drang, es überzuziehen. Ehe ich wusste, was ich tat, streifte ich meinen grauen Pullover ab und hielt das Kleid um meine Taille. Wenn ich doch nur kurz hätte hineinschlüpfen können, nur einmal hätte sehen können, wie es getragen wirkte …
Bevor ich den Gedanken zu Ende bringen konnte, schlug hinter mir die Tür auf und ließ alles um mich herum gefrieren. Herdas kastiger Körper stand im Rahmen, den Kopf steif nach vorn gereckt, die Miene verkniffen. Ihre Augen weiteten sich, als sie mich sah, dann kippte ihr Blick innerhalb einer Sekunde von Entsetzen zu hämischer Zufriedenheit.
Das durfte doch nicht wahr sein. Wie konnte sie schon von ihrem täglichen Rundgang zurück sein?
»Naima«, zischte sie. »Was, bei der Sonne, hast du hier zu suchen?«
»Ich wollte nur kurz …«, stammelte ich. Mir schoss Hitze in die Wangen. Das war mal wieder typisch mein Pech! Unbeholfen versuchte ich das Kleid hinter meinem Rücken zu verstecken.
»Was ist das?«, blaffte Herda. »Was hast du da?«
»Gar nichts«, sagte ich etwas zu schnell.
Mit zwei stampfenden Schritten war Herda bei mir und riss mir mein Kleid aus den Händen. »Wo hast du das her?«
»Ich habe es selbst gemacht.«
Herda schnaubte. »Unsinn. Das hast du doch irgendwo geklaut. Du machst mir Kopfschmerzen, Gör, deine Fratze bedeutet nichts als Ärger.«
Langsam kochte Wut in mir auf, wie immer, wenn Herda den Mund aufmachte. Ich streckte die Hand nach meinem Kleid aus, doch die Heimleiterin wandte sich ruckartig ab.
»Und was suchst du auch noch hier oben? Meine Räume sind tabu, das weißt du genau.«
Ich versuchte meine Erregung herunterzukämpfen. »Ich habe das Kleid aus alten Lumpen gemacht, die niemand vermissen wird. Ich wollte es nur einmal ansehen –«
»Spar dir deine Geschichten!«
»Es sind keine …« Ich holte tief Luft, gab mir alle Mühe, einen sachlichen Ton anzuschlagen. »Bitte, Herda. Du weißt, dass ich mehr kann, als nur Böden zu schrubben. Gib mir doch die Chance, weiterzukommen.«
»Du nimmst dir ganz schön was raus, Naima.« Herdas Stimme klang so knarzend wie die Holzdielen auf der Treppe, wenn man darüber schlich. »Die Sonderbehandlung reicht dir nicht? Kriegst nie den Hals voll, was? Ich hab mich für dich verbogen ohne Ende. Als du meintest, dass du nähen willst, habe ich dir Uniformen zur Verfügung gestellt, die du flicken durftest, und Gardinen zum Umnähen. Habe ich dir nicht sogar erlaubt, diesen Tätigkeiten nachzugehen, anstatt in der Küche zu helfen?«
»Ich weiß und dafür bin ich auch dankbar, aber es geht immer nur ums Löcherstopfen und Knöpfeannähen. Ich will –«
»Ich will, ich will, ich will!«, äffte Herda mich nach. »Ich begreife es nicht, Gör. Verschwinde doch! Ich freu mich, wenn ich ein Maul weniger zu füttern habe. Niemand zwingt dich, meine Obhut zu genießen, das Essen, dein warmes Bett, die Arbeitsstelle.«
Der Ärger in mir brodelte heiß und stechend. Dass sie es wagte, meine Arbeitsstelle als eine Wohltat hinzustellen. Alle Heimkinder mussten für ein paar Münzen die Woche die Drecksarbeit für Herdas Kunden erledigen. Den eigentlichen Batzen strich sie sich ein. Dabei koordinierte sie nur die Dienste und entschied dabei, wer welche schmutzige Aufgabe erledigen musste.
»Das meinte ich nicht! Ich will eine zusätzliche Arbeit anfangen. Neben meinen Aufgaben fürs Heim. Zum Beispiel beim Schneider. Wenn ich nur ein paar Stunden die Woche freibekommen könnte …«
»Ach ja? Und was verdienst du beim Schneider?« Herda sah mich lauernd an wie ein Straßenköter.
Betreten wandte ich den Blick ab. »Solange ich noch nicht fertig ausgebildet bin, kann er mich nicht bezahlen, aber wenn ich erst eingearbeitet bin, dann bekomme ich einen guten Lohn.«
Herda gackerte, kehrte mir den Rücken zu und stampfte durch den Flur zu ihrem Büro. Sie wollte mich gar nicht verstehen. Das war das Schlimmste an der ganzen Sache.
Ich ballte meine Hände zu Fäusten. »Sieh dir mein Kleid doch wenigstens an«, startete ich einen letzten Versuch. »Ich bin doch viel nützlicher für dich, wenn ich mehr lerne.«
Zu meiner Überraschung blieb Herda tatsächlich stehen, verharrte kurz und breitete dann das Kleid vor sich aus. Für einen Moment vergaß ich zu atmen. Es war gut, das wusste ich. Vielleicht würde Herda es zugeben, vielleicht würde sie zum ersten Mal in ihrem Leben nicht aus Eigennutz handeln und …
Herda sah von meinem Kleid auf und kniff die Augen zusammen. In dem Moment, als unsere Blicke sich trafen, wusste ich, dass es keine Hoffnung mehr gab.
»Danke für den Putzlappen«, sagte sie hämisch, schloss ihre Bürotür auf und warf mein Kleid in ihren Mülleimer.
Es fühlte sich an, als würde etwas in mir zu Bruch gehen.
»Du kennst die Regeln, Naima. Entweder du lebst hier und arbeitest für die Gemeinschaft oder du gehst und baust dir deine Existenz auf. Es liegt bei dir. Ich kann dich nicht durchfüttern, ohne dass du das nötige Geld nach Hause bringst, wenn du stattdessen deine Zeit mit unnötigen Dingen verplemperst. Ich weiß wirklich nicht, wie du dir das vorstellst.«
Wütende Tränen schossen mir in die Augen. Ich hasste es, abhängig von Herda zu sein. Mit jedem Tag hasste ich es mehr. Ich wollte frei sein, die Welt sehen, Arbeit machen, die mich forderte. Nicht nur Toiletten schrubben, ausgerissene Hosentaschen schließen und Herdas Gardinen kürzen.
Aber unser Hafendorf war klein. Es gab kaum Arbeit, die nicht von Herda und ihrem Klüngel kontrolliert wurde. Wenn, dann musste ich weit weg, aber wohin? Und mit welchem Geld?
Ich hatte mir felsenfest geschworen, es bis zu meinem achtzehnten Geburtstag von hier weg zu schaffen. Inzwischen war nicht mehr viel Zeit bis dahin, mir blieb nur noch ein halbes Jahr. Aber jede meiner bisherigen Ideen war früher oder später zerschlagen worden. Es war, als würde mich das Pech verfolgen, gerade in den letzten Wochen. Bei jedem Gespräch mit Menschen und Händlern aus dem Ort hatte mich Herda erwischt. In den letzten Monaten hatte ich mehr Strafarbeiten abbekommen als in meinem ganzen Leben. Eigentlich hätte mir klar sein müssen, dass sie mich auch heute erwischen würde.
Wahrscheinlich würde ich enden wie die anderen Mädchen und Jungen, die das Heim nie verlassen hatten. Jetzt waren sie längst aus der Uniform herausgewachsen und standen bei der Essensausgabe auf der anderen Seite, auf der von Herda. Wenn Herda irgendwann alt und zahnlos war, würde jemand von ihnen das ganze Haus übernehmen. Vielleicht ich.
Die Wut zerfiel in Trübsal und ich starrte auf den Mülleimer.
»Ich kann doch nicht mein Leben lang Löcher stopfen«, flüsterte ich.
Herda seufzte, während ihr Blick langsam zurück zu mir glitt. »Genau genommen bist du sogar dafür da, Löcher zu stopfen. Du gehörst nirgends hin, du bist der Lückenfüller im Leben anderer. So ist das, wenn man in diesem Haus aufwächst.«
Ihre Worte fühlten sich an wie ein dumpfer Schlag in die Magengrube. Herda war immer gemein, wahrscheinlich, weil es ihr als Kind ähnlich wie uns ergangen war. Sie hatte ihre Eltern im Hundertjährigen Krieg verloren und, wie sie oft genug erzählte, barbarische Szenen ansehen müssen. Kein Wunder also, dass sie zu einem herzlosen Drachen geworden war. Trotzdem trafen mich ihre niedertrampelnden Worte jedes Mal aufs Neue.
Mit hängenden Schultern wandte ich mich ab und verließ den verwinkelten Flur.
»Ach, Naima?«, rief mir Herda hinterher. »Zur Strafe für deinen Einbruch in meine Privatsphäre übernimmst du ab heute meinen Gang zum Hafen. Beim Fischhändler stehen zwei Eimer für uns. Am besten gehst du gleich. Je früher, desto frischer ist der Fisch.« In Herdas Blick glomm beinahe so etwas wie Genugtuung.
»Natürlich«, sagte ich kraftlos und schloss die Tür hinter mir.
***
Auf den Treppenstufen vorm Heim saß Melda, ein kleines Mädchen von neun Jahren, den Kopf auf ihren knochigen Knien abgelegt.
Ich verlangsamte meinen Gang.
»Was ist denn mit dir los? Alles in Ordnung?« Ich strich ihr im Vorbeigehen über den Kopf.
Melda nickte in ihren Schoß. »Herda hat uns vorhin dabei erwischt, wie wir in der Küche gespielt haben, anstatt zu putzen«, sagte sie leise.
»Und nun?«, fragte ich.
»Wir müssen morgen zur Strafe eine doppelte Schicht in der Schänke einlegen«, piepste Melda.
Das Ohnmachtsgefühl in meinem Inneren dehnte sich weiter aus. Kinder sollten doch verflucht noch mal spielen dürfen und nicht den bierverklebten Boden von irgendwelchen Erwachsenen schrubben. Ich setzte mich zu Melda auf die Treppenstufen und drückte ihren Kopf an mich. Ich wollte ihr sagen, dass ich mich kümmern, dass ich mit Herda sprechen würde. Aber nach dem Gespräch eben war ich selbst zu niedergeschlagen, um auch nur einen Funken Kampfgeist aufzubringen.
»Wir verdienen Besseres als das hier«, flüsterte ich. »Und eines Tages werden wir das auch bekommen. Wir werden unser eigenes Leben führen, eine eigene Familie finden. Und dann werden wir niemals wieder an Herda denken, nicht einen Augenblick.« Ich rang mir ein Lächeln ab und stupste aufmunternd gegen ihre Nase.
Melda sah mich prüfend an und ich erkannte erschreckende Abgeklärtheit in ihren Augen. »Das sagst du immer«, seufzte sie. »Aber du bist ja auch noch hier. Immer noch.«
Ihre Worte versetzten mir einen Stich und ich dachte wieder an mein Kleid, welches Herda einkassiert hatte, an die Absage, in der Schneiderei arbeiten zu dürfen, und dieses elendige Heim, in das wir eingekerkert waren. Wie sollte ich da ein Vorbild für die Kinder sein? Wie konnten sie an irgendeine andere Zukunft glauben?
Ich straffte meine Schultern.
»Aber bald bin ich weg«, log ich. »Ich mach den ersten Schritt. Dann werdet ihr wissen, dass ich es geschafft habe und dass auch ihr es schaffen könnt.«
Zum ersten Mal trat etwas Waches in Meldas Blick. »Wirklich?«, fragte sie.
Ich zwang mir eine zuversichtliche Miene auf und nickte. »Alles schon geplant.«
***
Das Heim lag etwas außerhalb, deshalb war es immer ein Fußmarsch bis ins Ortszentrum. Die Nachmittagssonne brannte auf meinem Scheitel und ich fühlte mich innerlich wie äußerlich vertrocknet. Ich nahm einen Schluck aus meiner Tonflasche, die ich immer wie eine Tasche um die Schulter trug. Das Wasser konnte das Kratzen in meiner Kehle nicht vertreiben. Gedankenverloren strich ich über die Hülle aus Makramee und schraubte den Verschluss zu, während ich ins Zentrum bog.
Die Häuser waren vorwiegend aus hellem Stein, ebenso die krummen Straßen und schmalen Fußwege. Ich kannte jede Gasse in- und auswendig von meinen täglichen Diensten in verschiedenen Familien oder Schänken. In der Luft lag ein salziger Geschmack, der von den nahegelegenen Salzgärten herüberwehte. Salz war das einzig interessante Produkt dieser Gegend, der einzige Grund, in einem anderen Teil des Reiches überhaupt je von Tuzol, unserem Zipfel ganz im Osten, gehört zu haben.
Ich strich mir den Schweiß aus der Stirn, während ich nach rechts auf den Basar abbog. Heute war verhältnismäßig viel los. Es war Markt und die durchs Land ziehenden Wanderhändler hatten kleine Tische in der Mitte des Platzes aufgebaut und mit seltenen Waren beladen. Nüsse, Obst, feine Stoffe und Teppiche lagen in rauen Mengen aus. Eine Sehnsucht zerrte an mir, ein paar dieser Köstlichkeiten zu probieren, über die Teppiche zu streichen oder kleine Ansichtskarten auszusuchen und damit die Wände im Heim zu schmücken.
Hinter dem wuseligen Markt entdeckte ich ein größeres Schiff, das am Pier festgemacht war. Für ein paar Augenblicke verlangsamte sich mein Gang. Das Schiff trug das weiße Wappen von Arada. Was um alles in der Welt suchte jemand aus der feinen Hauptstadt hier, am Ende des Reiches? Ich fand keinen Anhaltspunkt und ging weiter, geradewegs auf den Fischhändler an der Ecke des Platzes zu.
Schon von Weitem drang mir der Gestank von in der Hitze gegorenem Fisch in die Nase. Ich unterdrückte ein Würgen und trat an den Stand heran.
Der Fischhändler war ein grober Mann mit Händen so groß wie die Doraden in seinen Metallkisten. Rund um den Stand stapelten sich die Kübel mit verschiedenen Fischen, die in halb geschmolzenem Eis dümpelten. Aus den unteren lief eine glibbrige Lache auf den Steinboden.
»Was kann ich für dich tun?«, grunzte der Fischhändler und nahm mich von oben bis unten unter die Lupe. »Herdas Heim?«
»Genau«, sagte ich und straffte die Schultern in meiner grauen Bluse.
»Wie jede Woche eine gute Tat«, sagte der Fischhändler. Ich war mir nicht sicher, ob er es zu sich selbst oder zu mir sagte. Dann wuchtete er zwei große Metalleimer hinter dem Tresen hervor und donnerte sie mir vor die Füße. Sie waren bis oben hin gefüllt mit Fischköpfen und Gräten. Die leeren Augen der Tiere starrten ins Nichts. Alles schwamm in einer roten Masse aus Innereien. Jetzt wurde mir wirklich schlecht und ich schlug mir die Hand vor den Mund.
»Sag Herda, ich will die Eimer zurück!«, befahl mir der Händler. »Ich warte immer noch auf die von letzter Woche.«
Konsterniert schaute ich von ihm zu den Fischen und wieder zurück. Das konnte doch nicht sein Ernst sein!
Mit angehaltenem Atem hievte ich die Eimer hoch und schleppte mich über den Marktplatz. Sofort schnitten die Griffe in meine Finger.
Kein Wunder, dass die Fischsuppe, die regelmäßig auf dem Speiseplan stand, so widerlich war, wenn sie nur aus diesem Abfall produziert wurde. Ich kämpfte gegen einen Würgereiz an und versuchte den hin und her schwappenden Glibber zu ignorieren.
Ich ging an der Hafenpromenade entlang und passierte das Geschäft des Schneiders. Wie immer entdeckte ich ihn in gebückter Haltung über seiner Nähmaschine, die Brille auf die Nasenspitze gerutscht. Um ihn herum lag ein Chaos aus Stoffen, Holzbügeln und Schleifen. An einer Kleiderstange hingen die Aufträge, die auf ihre Abholung warteten. Ein wehmütiges Gefühl stieg in mir auf. Ein weiterer zerplatzter Traum. Wahrscheinlich der größte von allen.
Plötzlich merkte ich, wie sich etwas um meinen Fuß schlang. Ehe ich einen klaren Gedanken fassen konnte, ging ein Ruck durch meinen Körper und ich fiel der Länge nach hin.
Der Fisch!, schoss es mir durch den Kopf. Und obwohl es schon zu spät war, versuchte ich die Eimer aufrecht zu balancieren. Doch die Henkel entglitten meinen Fingern und die stinkenden Fischinnereien stoben in alle Richtungen wie ein roter Platzregen. Ich landete hart auf dem Bürgersteig, spürte, wie meine Knie aufschlugen und gleichzeitig der Fischmatsch von oben bis unten auf mich klatschte und meine komplette Kleidung einweichte.
Ich hörte einen Schrei, realisierte aber einen Moment später, dass meine Lippen fest aufeinandergepresst waren. Erschrocken sah ich mich um und entdeckte ein paar Meter weiter eine junge Frau in einem orangefarbenen Kleid auf der Erde liegen. Anscheinend war ich über die lange Schleppe ihres Rockes gestolpert und hatte uns beide zu Boden gezogen.
Ich versuchte meine Füße aus dem Stoff zu befreien, und stutzte. Nein, die Schleppe hatte sich vielmehr wie eine Schlange um meine Knöchel gewickelt. Wie war das überhaupt möglich? Es sah aus, als hätte mich jemand an die Fremde angeknotet.
Ich schüttelte energisch den Kopf. Unsinn! Meine Zurechnungsfähigkeit musste beim Sturz gelitten haben.
Die Frau zeterte vor sich hin, als sie sich ziemlich ungalant aufrappelte.
»Es tut mir so leid! Ich weiß nicht, wie das passieren konnte«, stieß ich hervor und schaffte es endlich, meine Füße zu lösen. Hektisch sammelte ich ein paar Gräten von meiner Bluse und inspizierte das Ausmaß des Schadens. Um uns herum war ein Meer aus Fischteilen. Das Rinnsal lief die Straße hinab und der strenge Geruch war überall. Alle vorbeiziehenden Passanten rümpften die Nase und machten einen großen Bogen um uns, sodass ich mich wie auf einer Bühne der Blamage fühlte.
»Ist das eklig!«, quietschte die Frau und klopfte ihr Kleid aus. »Kannst du nicht gucken, wo du hinläufst?«
»Eure Schleppe hat mich …« Ich spürte, wie mir die Hitze in den Kopf schoss. »Habt Ihr etwas abbekommen?«
Fahrig betrachtete ich ihr feines Kleid, konnte glücklicherweise aber keine Spritzer entdecken. Den größten Anteil der Innereien hatte offenbar ich abbekommen.
»Du hast meine Schleppe abgerissen!«, fauchte die Fremde und drehte sich hektisch im Kreis wie ein Tier, das seinen Schwanz jagte.
»Darf ich mal sehen?« Vorsichtig trat ich näher.
»Warum, bist du etwa Schneiderin?« Die Fremde zog eine beleidigte Schnute und strich sich ihre feuerrote Mähne aus der Stirn. Erst jetzt sah ich, dass sie kaum älter war als ich.
»Sozusagen«, stieß ich hervor.
»Das Kleid war doch ganz neu«, maulte die Fremde weiter. »Gerade letzte Woche erst gekauft. Bei der Sonne, mein bestes Kleid! Und ausgerechnet jetzt.«
»Was ist denn jetzt?«, fragte ich, um irgendwas zu sagen.
Die Fremde funkelte mich an. »Ich habe eine Verabredung! Ein Abschiedstreffen, besser gesagt.«
Schweigend nahm ich den Rock unter die Lupe. Die Schleppe, die vorher wahrscheinlich glatt heruntergehangen hatte, war an der Seite eingerissen und offenbarte etwas vom glänzenden Unterrock.
»So was trägt man hier sowieso nicht, so eine lange Schleppe habe ich seit Jahren nicht gesehen.«
»Was war das bitte?« Die Fremde starrte mich an.
»Ich meine nur, dass so eine Schleppe doch völlig altmodisch ist, nicht wahr?« Ich biss mir auf die Zunge. Wieso konnte ich denn nicht einfach meine Klappe halten?
»Und das kannst ausgerechnet du beurteilen, Fischmädchen?«
Wieder spürte ich meine Wangen glühen. »Der Schneider wird das Gleiche sagen«, gab ich patzig zurück.
»Ich habe aber keine Zeit für einen Schneider. Ich habe sowieso nur noch eine Stunde, bis wir ablegen.«
Ich sah flüchtig zum Anleger. Natürlich gehört diese aufgetakelte junge Frau zum Schiff und in die Hauptstadt.
»Aber so kann ich meine Verabredung vergessen und ich werde ihn nie wiedersehen!« Ein Schluchzen brach plötzlich aus ihrer Kehle und wieder zippelte sie an ihrem Rock herum.
Ehe ich wusste, was ich tat, war ich in die Hocke gegangen und betrachtete den Riss. »Ich kann das vorübergehend ausbessern.«
Die Fremde beachtete mich nicht einmal, sondern jammerte in einem Redefluss vor sich hin. Mit spitzen Fingern griff ich nach dem Saum und legte den orangenen Stoff in Falten wie eine Treppe, Stück für Stück nach oben, sodass mehr vom glänzenden Unterrock sichtbar wurde. Ich pflückte eine saubere Fischgräte von meiner Manschette und steckte damit den gerafften Stoff fest. Das Gleiche wiederholte ich auf der anderen Seite, fixierte den Stoff, bis sich die Falten komplett symmetrisch um den Riss wanden und es wie ein raffinierter Schlitz im Kleid aussah.
Als ich mich aufrappelte, sah ich, dass sich die Fremde schmunzelnd in der Schaufensterscheibe des Schneiders betrachtete.
»Könnte gehen«, sagte sie nach einer gefühlten Ewigkeit. Ein Stein löste sich von meinem Herzen. »Glück gehabt. Ich werde dir deine Dussligkeit verzeihen.«
Sie strafte mich mit einem letzten unwirschen Stirnkräuseln und wandte sich ab, bevor ich noch etwas sagen konnte. Die gerafften Volants um den Schlitz in ihrem Kleid wackelten anmutig bei jedem Schritt.
Je weiter sie sich entfernte, desto mehr sackte ich in mich zusammen. Ich sollte dankbar sein, dass sie mir nicht den Kopf abgerissen oder eine Entschädigung gefordert hatte, die ich nicht hätte zahlen können. Aber ich war es nicht. Auch so hatte ich weniger als nichts. Ich hatte nicht mal mehr den Fisch.
Mühsam pulte ich ein paar Reste von der Straße und warf sie zurück in die Eimer. Der Fisch war dreckig und staubig und füllte nicht mal mehr eine der Tonnen. Das meiste der stinkenden Suppe klebte an mir oder war die Straße hinuntergelaufen.
Herda würde mich zerfetzen. Schlimmer noch, sie würde mich vor den Augen aller zur Schnecke machen. Meinetwegen gab es kein Abendessen fürs ganze Heim. Das schlechte Gewissen sackte mir in den Magen. Wenn die Konsequenzen wenigstens nur mich allein treffen würden. Ich fühlte mich wie eine Versagerin.
Ein dröhnendes Sirenengeräusch ertönte und ich zuckte zusammen. Ich brauchte einen Moment, um herauszufinden, dass es vom Schiff kam. Das Schiff, welches in einer Stunde ablegen und nach Arada fahren würde, in eine schillernde andere Welt. Was für ein Glück es wäre, einfach mitzufahren. Dieses ganze verkorkste Leben hinter sich zu lassen …
Wie ein Blitz durchzuckte es mich. Ich kam auf die Füße, ohne darüber nachzudenken.
»Das kann ich nicht machen«, flüsterte ich zu mir selbst. Aber warum eigentlich nicht?
Wie in Trance ließ ich die stinkenden Eimer los und lief über den Marktplatz. Erst langsam, dann immer schneller. Ich bremste erst direkt vor der Laderampe des großen Schiffes ab. Es dümpelte sorglos im Hafenbecken hin und her. An Deck erkannte ich zwei Soldaten, die zum Meer hinausblickten und diskutierten. Außer ihnen war das Schiff verlassen.
Ich drückte mich am Steg entlang und versuchte ein besseres Bild zu bekommen. Dort, wo die Rampe aufs Schiff traf, führte eine schmale Treppe nach oben zu den Soldaten und eine nach unten in den voluminösen Bauch des Schiffes. Es war ruhig, wahrscheinlich hatten sich alle Passagiere zurückgezogen oder waren noch im Ort unterwegs.
»Das kann ich nicht machen«, flüsterte ich erneut und dachte an Melda und die anderen Kinder im Heim. Ich konnte sie nicht allein lassen. Mein Herz setzte einen Moment aus, als mir einfiel, was ich Melda vorhin versprochen hatte. Ich musste gehen. Für sie. Mein Verschwinden würde ihr mehr Hoffnung geben als mein Bleiben. Vielleicht würde sie einen Hauch der Zuversicht zurückgewinnen, dass sie es auch schaffen konnte.
Das hier war meine letzte Chance. Und ich musste mich jetzt entscheiden. Solange der Steg verlassen war und Herda mich noch nicht vermisste. Sie würde sicher bald jemanden schicken, der nach mir sah. Oder vielmehr nach dem Fisch. An mir lag ihr schließlich nicht viel.
Ich versteifte bei dem Gedanken und ballte die Hände zu Fäusten. Plötzlich wirkte alles so klar. Ich wollte nicht zurück. Nie mehr. Und ohne noch einmal darüber nachzudenken, ergriff ich das Geländer der Rampe und huschte an Deck.
2
Shanini
»Warum tust du mir das an?«, flüsterte ich.
Meine Augen brannten. Ich verkrampfte am ganzen Körper, grub die Fingernägel in meine Handballen. Ich darf nicht weinen, mahnte ich mich in Gedanken. Nicht weinen. Bloß nicht weinen.
Warum, verflucht noch mal, schossen mir immer gleich die Tränen in die Augen, wenn ich wütend war? Ich hasste das an mir, mehr als alles andere. Das Weinen ließ mich schwach aussehen und ich konnte einfach nichts dagegen tun.
Mutter seufzte und drehte sich zum Fenster. Ich nutzte die Gelegenheit und rieb mir mit dem Handrücken über die Augen. Reiß dich endlich zusammen. Ich setzte mich auf, aber meine Nase kribbelte schon verräterisch.
»Shanini, Liebes. Du bist mit großer Macht geboren. Du kannst nicht ewig vor deinen Dämonen davonlaufen.«
Glaubte sie etwa, das wusste ich nicht? Glaubte sie, es machte mir Spaß, so verdammt unsicher zu sein? Ich wollte ihr all das entgegenschleudern. Aber ich blieb stumm. Wie immer.
Mutter sah ungerührt nach draußen, inspizierte irgendetwas in der Ferne. Die Sonne war gerade dabei unterzugehen und ein unwirklicher blutroter Himmel lag über Arada.
»Du wirst schon sehen. Es wird eine unglaublich traumhafte Zeit. Jede andere Frau im Land wäre neidisch! Hundert Verehrer, die um deine Gunst werben. Du kannst dir den prachtvollsten Mann aussuchen!« Mutter wandte sich wieder zu mir und musterte mich. Wie immer hatte sie einen besorgten Zug um die spitzen Lippen. Ich war ihr einziges Kind, ihr einziges Vermächtnis und gleichzeitig ihre größte Sorge.
Ich hasste es, so mitleidig angesehen zu werden, und ließ den Blick auf meine Hände fallen.
»Aber warum müssen sie denn gleich vier Wochen im Palast bleiben?«, stieß ich hervor. »Wieso können wir sie nicht nur für den Ball einladen?«
»Wie willst du denn hundert Anwärter an einem Abend kennenlernen?« Sie lachte leise. Es versetzte mir einen Stich. »So erfolglos, wie deine arrangierten Verabredungen bisher waren, müssen wir nun zu anderen Maßnahmen greifen. Du wirst dir innerhalb der vier Wochen jemanden aussuchen. Es wird höchste Zeit. Ich kenne doch meine liebe Tochter. Du wirst ein paar Anläufe brauchen, um dich für einen schönen Edelmann zu entscheiden. Es ist viel entspannter, wenn sie eine längere Zeit hier sind und dir den Hof machen. Vier Wochen sind gut für dich. So hast du Zeit, jeden in Ruhe kennenzulernen.«
»Aber ich will doch gar nicht heiraten«, sagte ich und meine Stimme war inzwischen so tonlos, dass ich mich selbst kaum noch hörte.
Mutter setzte sich zu mir auf das kleine Sofa neben meinen Bücherregalen. Sie strich mir eine Strähne aus der Stirn. Ich wollte zurückweichen, konnte mich aber nicht rühren.
»Es ist nicht leicht, Thronanwärterin zu sein. Glaub mir, das weiß ich. Als ich in deinem Alter war, hatte ich auch Angst vor dem Thron. Aber die Verantwortung liegt nun mal in unseren Händen. Wir können nicht nur danach entscheiden, was wir wollen. Wir müssen danach entscheiden, was unser Land braucht. Und was Melidiya braucht, das sind Gesten, Zeichen der Einigkeit. Ich habe dir schon ein halbes Jahr eingeräumt. Das Gesetz hätte verlangt, dass du den Thron gleich mit deiner Volljährigkeit übernimmst. Seit dein Vater gestorben ist, bin ich nur noch die Übergangsregentin. Ohne Partner aus dem Süden darf ich nicht mehr herrschen. Das weißt du. Wir brauchen ein neues Bündnis und viele neue Thronfolger, damit wir den Frieden noch lange sichern können.«
Thronfolger. Kinder. Meine Kehle schnürte sich zusammen. Ich wollte das alles noch nicht. Ich wollte nicht irgendeinen Fremden heiraten. Ich wollte nicht regieren. Ich wollte keine Kinder bekommen.
Mutter sprach unbeirrt weiter: »Der Süden wird jetzt schon unruhig. Wir müssen den Südlichen das Gefühl geben, gesehen zu werden. Wir müssen uns an das Gesetz halten.« Sie legte ihre Hand auf meine. »Shanini, Liebes, ich weiß, dass es nicht einfach ist, aber ich habe das Gleiche getan, indem ich deinen Vater geheiratet habe. Und schau, wie weit wir gekommen sind! Wir haben Waffenruhe, seit neunzehn wunderbaren Jahren. Nun bist du an der Reihe. In zwei Wochen kommen deine ersten Gäste.«
Ein Beben erfüllte meine Brust, eine unendliche Ohnmacht. Nicht weinen, ich werde nicht weinen.
Doch ich merkte schon längst, dass ich verloren hatte. Verloren gegen meinen eigenen Körper. Die Panik wallte in mir auf. So schnell ich konnte, sprang ich auf und stürzte aus dem Zimmer. Ich hörte Mutters Seufzen, spürte ihren Blick in meinem Rücken, spürte ihre Enttäuschung.
Egal. Das war alles zu viel. Ich konnte nicht mehr.
Ich schaffte es gerade noch bis in mein Badezimmer und sank nach Luft ringend zu Boden. Die Wände schienen näher zu kommen, meine Welt wurde ganz klein und die Angst zurrte sich um mich wie ein Seil.
3
Naima
Meine Beine taten weh. Ich kauerte hinter einem Berg aus Jutesäcken, rollte mich so eng zusammen, dass ich möglichst wenig Platz einnahm. Je weniger Fläche ich besetzte, umso unwahrscheinlicher würde ich auffallen. Zumindest malte ich es mir so aus.
Ich hatte es irgendwie geschafft, in den Lagerraum des Schiffes zu gelangen. Genau genommen war es so unwahrscheinlich einfach gewesen, dass ich mich fragte, warum ich nicht viel eher auf diesen Gedanken gekommen war. Der Lagerraum war bis oben gefüllt mit Holzkisten, Säcken und in Papier eingeschlagenen Skulpturen. Durch die Ritzen der Tür fiel spärliches Licht in den Raum und tauchte alles in mystische Farben. Es war heiß und stickig, sodass es meine Kehle ausdörrte. Am Anfang hatte mich das Warten beinahe wahnsinnig gemacht, insbesondere, als von überall an Bord dumpfe Schritte und Stimmen ertönt waren. Ich hatte damit gerechnet, jeden Moment entdeckt zu werden. Doch das war nicht passiert. Und jetzt fuhren wir. Seit ein paar Stunden pendelte das Schiff schwerfällig hin und her, Welle für Welle von Herda weg.
Ich war noch nie mit einem Schiff gefahren und es fühlte sich ungewohnt an. Ich hatte das Gefühl, dass auch in meinem Inneren alles von einer Seite zur anderen geschaukelt wurde. Von der Erleichterung, es fortgeschafft zu haben, schleuderte es mich zurück zur Panik, entdeckt zu werden.
Wir waren unterwegs nach Arada. Ins goldene Herz von Melidiya. Ein Ort, von dem ich nie zu träumen gewagt hatte. Ich kannte die Hauptstadt, die den hellen Norden und den bergigen Süden verknüpfte, nur aus Märchen. Ich kannte Geschichten über die pulsierenden Straßen, den Königshof aus Gold und die Königin, die Melidiya nach hundert Jahren endlich Frieden gebracht hatte. Doch was mich genau erwartete, wusste ich nicht. Ob ich es dort besser haben würde? Ob ich wieder würde hungern müssen? Ich hatte nichts bei mir außer der stinkenden Uniform an meinem Leibe, ein paar Münzen und meiner Flasche.
Ich teilte mein Wasser in Rationen. Die Hauptstadt war nicht mehr als drei Tage mit dem Schiff entfernt. Das wusste ich aus den Unterrichtsstunden, die eine alte Lehrerin uns Heimkindern ein paar Jahre lang gegeben hatte, während wir bei ihr putzten. Sie hatte ein unerschöpfliches Wissen über das Reich, den Hundertjährigen Krieg, brachte uns Lesen, Schreiben und Sticken bei. Die Dienste in ihrem kleinen schiefen Reihenhaus waren die Höhepunkte meiner Kindheit gewesen.
Drei Tage. Das würde nicht einfach werden, aber mit meinem Wasser würde ich hinkommen. Und drei Tage ohne etwas zu Essen hätten mir auch im Heim geblüht. Das war ich gewohnt. Der Trick war, auf dem Wasser zu kauen und möglichst viel Luft zu schlucken. Das gab wenigstes für den Moment das Gefühl von Sättigung.
Herda lag hinter mir, das Heim, mein ganzes Leben. Alles versank in der Ferne.
Ich malte mir aus, wie die anderen reagieren würden. Viele hatten mich gemieden, seit ich in letzter Zeit ständig mit Herda aneinandergeraten war. Wahrscheinlich hatten sie gefürchtet, mein Ruf könne auch auf sie überschwappen. Nur der Gedanke an Melda und die anderen ganz Kleinen versetzte mir einen Stich. Ich hatte immer das Gefühl gehabt, sie beschützen, ihnen ein bisschen Liebe an diesem finsteren Ort entgegenbringen zu müssen. Ich hoffte, dass sie ihren Weg gehen und Herda auch irgendwann verlassen würden.
Herda. Wie sie wohl reagieren würde, wenn sie mein Verschwinden bemerkte? Ein düsteres Grinsen wanderte auf mein Gesicht. Egal wo ich landen würde, es war mir ein Triumph, sie hinter mir gelassen zu haben.
Als mein Puls sich endlich etwas verlangsamte, wagte ich es, meine Beine auszustrecken und mich ein Stück in die Jutesäcke hinabsinken zu lassen. Bald darauf umhüllte mich der Schlaf wie ein schwerer Mantel.
***
Ein penetranter Geruch stieg mir in die Nase. Schweiß. Verschlafen kräuselte ich meine Nase, ehe ich die Augen aufschlug. Es dauerte einen Moment, bis mir wieder einfiel, wo ich war. Vorsichtig reckte ich meine tauben Glieder. Der Schweißgeruch war beißend und füllte den ganzen Raum. Bei der Sonne, das konnte doch nicht ich sein? Ich schnüffelte an meinen Achseln. Nein, ich stank zwar noch bestialisch, aber eindeutig nach Fisch.
Mit einem Mal traf es mich wie ein Schlag: Hinter den Jutesäcken räumte jemand. Wie vom Donner gerührt zog ich den Kopf ein. Nein, nein, nein.
Ich spähte an den Säcken vorbei in Richtung Tür. Im Chaos der gestapelten Waren stand ein mittelalter Mann. Er trug eine schmutzige Latzhose und suchte etwas in einem Stapel von Kästen. Schritt für Schritt kam er näher, betrachtete dabei die gekritzelten Markierungen. Er fluchte leise vor sich hin und sah sich um. Schnell verkroch ich mich wieder hinter den Säcken. Das konnte nicht sein. Er durfte mich einfach nicht finden! Nicht jetzt, kurz vor meinem Ziel!
Die Schritte und das Fluchen kamen langsam näher. Ich hielt die Luft an, presste mir dir Hände auf den Mund. Der Mann konnte nur noch ein paar Meter entfernt sein.
»Joe!«, donnerte plötzlich eine unbekannte Stimme. Vor Schreck hätte ich fast laut aufgeschrien.
»Was wird das?«
Von der anderen Seite der Jutesäcke kam ein Knurren. »Die Lady wünscht ihren neuen Armschmuck.«
»Jetzt?«, brummte die zweite Stimme.
»Natürlich jetzt. Sie hält uns auf Trab, wie immer«, entgegnete Joe.
»Na, wenn das so ist.«
Jede Faser meines Körpers war auf Höchstspannung, als Joe plötzlich einen der Jutesäcke beiseiteschob. Ich versuchte noch tiefer abzutauchen, machte mich so klein ich konnte. Mein Herz pochte gegen meine Brust. Joe hob den äußersten der Säcke aus der Mauer. Ich schnappte stumm nach Luft. Gleich würde er mich finden!
»Aber da werden sie nicht sein. Wenn, dann in den Kisten hier vorne.«
Joe verharrte in der Bewegung. Der Sack schwebte einen Moment in der Luft.
»Dahinter kommt doch nur noch Salz.«
»Stimmt«, sagte Joe und ließ den Sack langsam sinken.
Mein Herz machte einen Satz. Am liebsten hätte ich einen tiefen Seufzer ausgestoßen. Danke, unbekannter Mensch!
»So viel Salz, dafür die ganze Schufterei. Was, bei der Sonne, will man damit?«, brummte Joe. Genervt schleuderte er den Jutesack von sich.
Ich hatte es nicht kommen sehen. Der Sack fiel hinter die gestapelte Mauer und schmetterte gegen meinen Kopf. Ein erstauntes Keuchen drang aus meiner Kehle, ehe es mir das Gleichgewicht raubte und ich zur Seite kippte. Dabei riss ich einen Turm aus Kästen mit mir und ein ohrenbetäubendes Scheppern breitete sich im Lagerraum aus.
»Was war das?«
»Woher soll ich das wissen?! Was hast du gemacht, Joe?«
Ich spürte jemanden an mich herantreten und bevor ich auch nur zusammenzucken konnte, sah ich in zwei braune Augen, die sich vor Erstaunen weiteten.
»Was haben wir denn hier?«
Mein Herz setzte einen Schlag aus. Das war’s also. Ich hatte es verbockt. Mein Pech hatte mich wieder einmal eingeholt. Das Einzige, was ich von Arada sehen würde, war das Gefängnis. Wenn sie mich überhaupt so lange auf dem Schiff behalten würden und mich nicht kurzerhand den Haien zum Fraß vorwarfen! Kalter Schweiß bildete sich auf meiner Stirn. Ich hatte nicht einmal mehr genug Kraft, um mich zu verteidigen, um irgendeine Rechtfertigung vorzubringen.
Neben Joe tauchte der zweite Mann auf. Er war etwas älter und steckte in einer hochgeschlossenen Soldatenuniform. Er zog die buschigen Augenbrauen in die Höhe und betrachtete mich wie Ungeziefer.
»Das darf nicht wahr sein. Ein blinder Passagier?« Seine Stimme war leise und eindringlich.
»Was sollen wir jetzt machen?«, fragte Joe.
»Du weißt doch, was wir mit Dieben und Verrätern machen?« Im nächsten Moment packte der Soldat mich am Arm und riss mich auf die Füße. »Wir hacken ihnen die Hände ab.«
Ich stieß einen kehligen Laut aus.
»Aber General«, schaltete sich Joe ein. »Sie ist doch noch so jung.«
»Jugend schützt vor Strafe nicht.« Der Soldat schloss seinen Griff fester um meinen Arm, sodass es wehtat, und zerrte mich aus dem Lagerraum. »Ich bring sie zu Efendi Gould. Und du, Joe, räumst hier auf.«
Der Soldat brachte mich in einen kleinen Gemeinschaftsraum, wo mehrere üppig gekleidete Herrschaften über einem köstlich duftenden Frühstückstisch saßen. Mein Magen krampfte sich vor Hunger zusammen. Als der Soldat mich hineinzerrte, sahen die Menschen überrascht auf. Einem Mann, der ein rotes Samtgewand trug, fiel vor Schreck der Löffel aus der Hand.
»Wer ist das denn?«, rief er in einem vorwurfsvollen Ton.
»Efendi, wir haben diese Göre im Lagerraum entdeckt! Eine Kriminelle.« Der Soldat schubste mich noch ein Stück vorwärts.
Ich ließ den Kopf hängen, fühlte mich dumm und bloßgestellt. Wie hatte ich auch je denken können, dass ich es unbemerkt nach Arada schaffen würde?
»Was willst du denn hier?«, quietschte eine dritte höhere Stimme. Verwundert sah ich auf und erkannte das rothaarige Mädchen vom Vortag.
Der Mann in Rot schnappte nach Luft und sah von mir zum anderen Mädchen.
»Du kennst sie?«, rief er. »Wer ist das, Zoe?«
»Keine Ahnung. Ich glaube, eine Fischhändlerin.«
»Nein, ich …« Fieberhaft suchte ich nach einer Erklärung, nach einer plausiblen Ausrede, aber nichts klang richtig. Ich atmete tief durch. »Ich habe mich hier versteckt, als ich hörte, dass Ihr nach Arada fahrt. Es war meine einzige Chance, fortzukommen.«
Zoe musterte mich von oben bis unten. »Und warum? Steckst du in Schwierigkeiten?«
»Ich glaube es ja nicht«, keuchte der Mann in Rot. »Wir sind doch nicht die Wohlfahrt. Es kann nicht einfach jemand auf diesem Schiff mitfahren.«
»Wieso nicht? Es ist doch dein Schiff, Baba«, sagte Zoe schnippisch.
Die Augen ihres Vaters quollen aus den Höhlen.
»Bitte, verzeiht mir«, sagte ich. »Ich weiß, dass es nicht richtig war. Ich war verzweifelt. Ich zahle Euch das Geld für die Überfahrt zurück. Ich verspreche es. Ich kann auch nähen, ich kann flicken oder ausbessern, was auch immer Ihr braucht.«
»Flicken?« Der Mann runzelte die Stirn, als hätte er das Wort noch nie gehört.
»Wenn ich etwas dazu sagen darf, Efendi«, schaltete sich der Soldat hinter mir ein. Schon der Klang seiner Stimme ließ mich erschaudern. »Sie hat eine Straftat begangen. Straftaten verlangen Konsequenzen. Wir können sie nicht einfach davonkommen lassen, Efendi.«
Dieser nickte langsam. Mir schnürte es die Kehle zu.
Zoe warf ihrem Vater einen flüchtigen Blick zu, dann sprang sie auf. »Ach, komm. Es ist in Ordnung, Baba. Gestern hat sie mich gerettet. Ja, wirklich! Sie hat mir mit dem zerrissenen Kleid geholfen, hat verhindert, dass ich mich zum Gespött mache. Es wäre nur gerecht, wenn wir jetzt auch freundlich zu ihr sind.«
Atemlos sah ich zum hochrangigen Efendi, wartete fieberhaft auf sein Urteil. Die Finger des Soldaten gruben sich tiefer in meine Schulter.
Die Spannung im Raum schien zum Greifen nah. Es war so still, dass man eine Nadel auf dem Boden aufschlagen gehört hätte.
Schließlich setzte sich Zoes Vater auf. »In Ordnung«, presste er hervor und wedelte mit der Hand. »Aber sie soll sich nützlich machen. Und kein Wort nach außen.«
»Danke, Efendi, Euer Ehren«, keuchte ich. Mein ganzer Körper begann zu zittern.
»Komm mit, du kannst mit meiner Garderobe helfen«, verkündete Zoe und hakte sich bei mir ein, als wären wir die besten Freundinnen.
Ein Wirbelsturm der Erleichterung fegte durch meinen Körper. War das gerade wirklich passiert?
***
»Also los, erzähl, wovor läufst du weg?«, fragte Zoe, während wir ihre Koje betraten.
Alles in diesem Teil des Schiffes war prunkvoller als die wohlhabendsten Häuser meiner Heimatstadt. Boden und Wände waren mit Holz vertäfelt, überall standen feine Möbel und goldene Laternen. Zoes Zimmer trieb alles auf die Spitze: Obwohl die Koje klein war, war sie wunderschön und kostbar dekoriert. Das Bett war von einem hauchzarten Vorhang umsäumt, der mit einem unendlich feinen Ornament bestickt war. Auf dem Bett lagen Hunderte bunt geknüpfte Kissen. Eine Schiebetür führte in einen zweiten kleineren Raum mit Sitzgelegenheiten und drei monströsen Schrankkoffern. Ich fühlte mich mehr als fehl am Platz und wusste nicht, wohin mit mir. Ich wollte nichts berühren, um ja nichts kaputt oder schmutzig zu machen.
Zoe wedelte mit der Hand vor meinem Gesicht. »Hallo? Hast du mich verstanden?«
»Ich, ähm … Ich bin in einem Heim aufgewachsen«, sagte ich schnell. »Es war nicht immer einfach.«
»Zum Weglaufen schlimm?«, höhnte Zoe und warf sich auf ein Sofa.
»Ja«, sagte ich knapp. »Wenn ich gestern nach Hause gekommen wäre, hätte mir eine Abfallwoche bevorgestanden.«
Zoe sah mich unverständig an. »Eine was?«
Ich zögerte. »Eine Woche, in der man sich sein Essen aus den Abfällen zusammensuchen muss. Hungern war eine der häufigsten Strafen.«
»Das ist ja widerlich.« Zoe rümpfte die Nase. »Und was willst du in Arada?«
»Arbeiten. Leben.« Ich zuckte mit den Schultern. »Ich schätze, es ist überall besser als zu Hause.«
»Das ist so aufregend.« Zoes Augen leuchteten. »Du bist so rebellisch!«
»Na ja …«
»Erzähl mir noch was!«
»Da gibt es nicht viel …«
Zoe zog eine beleidigte Schnute. »Dafür habe ich dich aber nicht gerettet. Du musst mich schon ein bisschen unterhalten.«
Unangenehm berührt trat ich von einem Bein aufs andere. Zoe betrachtet mich eindringlich und ihr Blick blieb an meiner Tonflasche hängen, die ich noch immer um die Schulter trug. »Was ist das denn?«
»Meine Flasche.« Ich hielt sie völlig unnütz hoch. »Für Wasser«, schob ich hinterher.
Zoe verzog das Gesicht. »Sieht ziemlich alt aus.«
Meine Hand schoss zum Flaschenhals und legte sich schützend darum. »Ist sie auch. Sie ist das Einzige, was wirklich mir gehört.« Ich holte tief Luft. »Ich hatte sie dabei, als ich vor dem Heim ausgesetzt wurde.«
»Nicht ehrlich!« Zoe starrte mich an wie ein Fisch. »Das ist ja so dramatisch.«
»Ich habe versucht herauszufinden, woher sie stammt, aber in Tuzol waren die Mittel begrenzt.« Ich sah auf die kleine ovale Flasche. Sie war bis zur Hälfte in einem Netz aus Papiergarn eingewebt, das sich zu einem Träger formte. Ansonsten war sie schlicht und dunkelgrün, bis auf ein kleines Symbol am Hals. Lange hatte ich es für einen Schmetterling gehalten. Erst vor ein paar Jahren war mir aufgefallen, dass es ein Flügelpaar mit einer filigranen Nadel in der Mitte war. Ein seltsames Symbol, das weder Sinn ergab noch irgendwem in Tuzol bekannt vorgekommen war.
Ich stockte einen Moment. Aber was hatte ich zu verlieren?
»Wisst Ihr, was das heißt?«, wandte ich mich an Zoe.
Begierig stand sie auf und betrachtete das kleine Symbol. Zu meiner Enttäuschung zuckte sie bloß mit den Schultern. »Nie gesehen.« Sie ließ sich wieder auf das Sofa fallen. »Du weißt also nicht, wer deine Eltern sind? Ist das verrückt.«
»Ja«, sagte ich.
Einen Moment herrschte merkwürdiges Schweigen.
»Und Ihr seid in Arada aufgewachsen?«, lenkte ich von mir ab.
»Schön wär’s.« Zoe schüttelte überschwänglich den Kopf. »Ursprünglich komme ich aus Arada, aber ich glaube, die meiste Zeit meiner Kindheit habe ich auf diesem ollen Schiff verbracht. Mein Vater handelt mit Spezialitäten und ist ständig auf der Suche nach unbekannten Geschmäckern und kulturellen Seltenheiten. Er hat meine Mutter und mich durchs ganze Königreich geschleift, wir haben nirgends länger als ein halbes Jahr gelebt.«
»Wahnsinn«, seufzte ich.
Allein der Gedanke, dass Zoe so viel mehr von der Welt gesehen hatte, erfüllte mich mit Sehnsucht, ja fast Neid. »Wo seid Ihr denn schon gewesen?«
»Hmm, mal sehen. Zweimal waren wir in Aladag, hier im Norden. Das kann ich nur empfehlen: jeden Tag Feierlichkeiten, Musik und der beste Anisschnaps!« Sie leckte sich die Lippen. »Dann waren wir ein paar Jahre im Süden auf Durchreise, Korgun und Gürün, dann in vielen winzigen Bergdörfern. Komisch verschlossenes Volk da unten, nicht gerade gastfreundlich. Je weiter man in den Süden kommt, umso schlimmer wird es. Die verlieren wirklich kein Wort zu viel.«
Ich hing an ihren Lippen. »Man sagt ja, dass der Süden sehr traditionell geprägt ist.«
»Nett ausgedrückt. Ein Haufen Langweiler würde es auch treffen«, mokierte sich Zoe. »Die Wörter Abenteuer und Feiern haben sie im Süden wohl noch nie gehört. Es geht immer nur um das, was man sich erarbeitet hat, oder irgendwelche Familientraditionen. Und in den kleinen Dörfern ist es am schlimmsten. Ausgerechnet diese langweiligsten und abgelegensten Dörfer sucht sich mein Vater natürlich immer aus. Vor drei Jahren ist mir dann endgültig der Geduldsfaden gerissen. Wir waren seit Ewigkeiten mal wieder länger in der Hauptstadt, ich habe eine beste Freundin gefunden und mich zum ersten Mal richtig zu Hause gefühlt. Und dann wollte mein Vater urplötzlich wieder aufbrechen. Da habe ich mich geweigert.«
Überrascht zog ich die Augenbrauen in die Höhe. »Wie, geweigert?«
»Ich habe gesagt, dass ich nicht länger mitkomme. Dass ich in Arada bleiben will.« Sie zuckte die Schultern. »Meine Eltern konnten mich ja nicht zwingen. Und mal ehrlich, wozu haben wir diese herrliche Wohnung samt Dienerschaft in der Hauptstadt, wenn nie jemand dort ist? Seither ist mein Leben jedenfalls besser als je zuvor und ich fahre nur noch mit, wenn ich gerade Lust auf eine Reise habe.«
Ich seufzte leise. Was für ein traumhaftes Leben Zoe doch führen musste.
»Warum seid Ihr ausgerechnet mit nach Tuzol gekommen?«, fragte ich. Mein Heimatort war wirklich alles andere als ein spannendes Reiseziel.
»Das frage ich mich inzwischen auch«, sagte Zoe. »Mein Vater hat mich angelogen, mir versprochen, dass es ein Ort sei, in dem viel los ist und gefeiert wird. Aber ich fand es ehrlich gesagt ziemlich lahm.«
»Das Beste an Tuzol ist, es zu verlassen«, stimmte ich zu.
Zoes Augen funkelten amüsiert, dann drehte sie sich zu einem der Schrankkoffer. Mit einer flinken Handbewegung zog sie ihn auf und ein Meer aus bunten Stoffen quoll hervor. Ich sah eine ganze Farbpalette aus schrillen Tönen, ein glitzerndes gelbes Kleid, verschiedene Blautöne und ein grünes Federkostüm. Zoe ergriff das letzte und zerrte es hervor.
»Toll, oder?« Sie hielt sich das Kleid vor den Körper. Es war hochgeschlossen, hatte lange Ärmel und einen ausgestellten Rock, der über und über mit buschigen Federn verziert war. »Es ist brandneu. Ich habe es mir extra für die Reise machen lassen.«
»Es ist gewagt«, sagte ich, weil mir nichts anderes einfiel.
Zoe nickte zufrieden und schwenkte das Ungetüm von Kleid vor sich her. Die Federn zuckelten in alle Richtungen.
»Was wollte Euer Vater denn in Tuzol?«, fragte ich.
»Ach bitte, du musst mich nicht so förmlich anreden.« Sie wedelte mit der Hand. »Sag einfach Zoe zu mir.«
»Oh, d-danke«, stammelte ich. Eine kurze, merkwürdige Pause entstand. »War Euer, ich meine, dein Vater wegen des Salzes in Tuzol?«, fragte ich irgendwann.
Zoe schnappte nach Luft. »Ja! Woher weißt du das? Langweiliger geht es kaum noch. Er war den ganzen Tag in den Salzgärten und ich musste die Zeit in diesem Dorf totschlagen.« Trotz ihres genervten Tones huschte ein Glimmen über ihren Blick. »Das hat mich zu Beginn geärgert. Aber dann habe ich eine nette Beschäftigung gefunden. Fadri.« Verträumt lächelnd betrachtete sie sich in einem bodentiefen Spiegel.
Ihre Offenheit machte mich irgendwie nervös. »Ach … so?«
»Er war ein Handwerker. Dass es mit uns keine Zukunft hat, wussten wir beide. Aber diese Augen und seine kräftigen Arme … ich wollte mich darin verlieren.«
»Oh«, presste ich beschämt hervor.
»Dass es so schwer sein würde, ihn zu verlassen, hätte ich nicht gedacht.« Ihr Lächeln versiegte.
»Das tut mir leid. Vielleicht kannst du ihm schreiben?«
»Ach nein, das ist doch zwecklos.« Zoe wedelte mit dem Ärmel, stopfte das grüne Kleid dann wieder in den Koffer. »Und du? Gibt es bei dir jemanden?«
»Bei mir?«
»Wen würde ich sonst meinen?« Zoe musterte mich und rümpfte die Nase. »Na ja. Wohl eher nicht.«
Ich verschränkte die Arme vor der Brust.
»Du riechst«, stellte Zoe fest. »Du brauchst etwas anderes zum Anziehen.«
Wieder wandte sie sich ihrem Koffer zu und zog schließlich ein schlichtes dunkelblaues Kleid hervor.
»Das hier trage ich sowieso nicht«, sagte sie und streckte es mir entgegen. »Ist für mich zu langweilig. Du kannst es haben.«
»Das kann ich unmöglich annehmen«, sagte ich.
»Du musst. Ansonsten gehen alle an Bord ein.«
***
Den Rest des Tages plapperte Zoe in einem fort, erzählte mir Details von ihrer verflossenen Liebe, die ich nicht wissen wollte, und forderte meine Meinung zu diversen Kleidern ein. Ich wusste noch immer nicht, warum sie mir geholfen hatte, gewann mit der Zeit aber den Eindruck, dass sie mich schlichtweg als Beschäftigung sah. Mir sollte es recht sein und so gab ich mir große Mühe, sie die Entscheidung nicht bereuen zu lassen. Ich folgte geduldig ihren Themen und gab mich geselliger, als ich es sonst war.
Zu meiner Überraschung zeigte sie mir daraufhin eine Dienstbotenkammer mit einer kleinen Pritsche und einem Waschtisch, an dem ich mich frisch machen konnte. Zu allem Überfluss lud mich Zoe um die Mittagszeit zu einem Imbiss auf ihr Zimmer ein. Sie hatte ein Platte voller Köstlichkeiten kommen lassen, sodass mir fast die Augen aus dem Kopf fielen.
Zoe tat sich auf, als wäre es das Normalste der Welt, und bemerkte offenbar nicht einmal, dass ich vor Überforderung kaum einen Ton mehr herausbekam. Es gab frisches Obst, knusprige Blätterteigrollen gefüllt mit Spinat und Käse, dazu Feigen und Datteln. Mein Magen war so eine Fülle nicht gewohnt und mir wurde beinahe schlecht von diesem Genuss. Als ich am Abend in meine Dienstbotenkammer zurückkehrte, war ich erschöpft und dankbar zugleich.
Am übernächsten Mittag tauchte Arada am Horizont auf. Kaum hatte ich es gesehen, konnte ich mich vom Anblick nicht mehr losreißen. Mit jeder Meile, die wir uns näherten, fehlten mir mehr die Worte. Die Hauptstadt erstreckte sich über die komplette Küste. Bunte Häuser hangelten sich die hügelige Landschaft hinauf, schmale Straßen wandten sich in Serpentinen an ihnen vorbei. Hinter der Stadt entdeckte ich einen weiteren Zipfel Blau. Das Westmeer.
Ich sog den Anblick in mir auf. Von Landkarten wusste ich, dass Arada genau in der Mitte von Norden und Süden des Landes lag, auf der schmalen Landzunge, die Ostmeer von Westmeer trennte. Aber nie hätte ich mir ausmalen können, wie traumhaft der Anblick dieser quirligen Stadt umrahmt von zwei Meeren wirklich war.
Je näher wir kamen, umso mehr Details erkannte ich. Der Hafen war zehnmal so groß wie der meines Heimatortes und im Becken tummelten sich mächtige Schiffe, eines prachtvoller als das andere. Menschen schoben sich überall entlang, viele schrill gekleidet und in Gruppen unterwegs. Als die Besatzung das Schiff zum Anleger steuerte, hörte ich laute Musik, die aus dem Zentrum herüberwehte.
Ich bemerkte erst, dass mir der Mund offen stand, als Zoe sich zu mir gesellte. Sie trug ein gelbes Kostüm mit einem großen Hut und einer kleinen runden Handtasche, in die nicht mal ein halbes Brot gepasst hätte.
»Willkommen in Arada. Hübsch nicht?«, sagte sie. »Du hast dir für deinen Besuch den besten Tag ausgesucht, das Fest der Einigkeit.«
»Das Fest der was?«
»Bei der Sonne, das Fest der Einigkeit!« Zoe starrte mich schockiert an. »Das kennt doch wirklich jedes Kind in Melidiya. Der Feiertag, an dem wir das Ende des Krieges zwischen Norden und Süden feiern? Das Hochzeitsdatum von Königin Esme und Zauberer Aslan, ruhe er in Frieden. Heute sind es neunzehn Jahre! Unsere Königin kennst du aber schon?«
»Natürlich!«, protestierte ich. »Was ist denn das für eine Frage?«
»Na, wer das Fest der Einigkeit nicht kennt … Komisches Volk seid ihr auf dem Land.«
Einige Matrosen, unter ihnen Joe, waren auf den Steg gesprungen und machten das Schiff mit dicken Tauen fest. Mein Herz hüpfte, immer noch ungläubig darüber, wo ich jetzt war. Am Pier wimmelte es von Menschen, die Kisten und Fässer umherwuchteten. Dazwischen kleine Jungen, die Zeitungen verkauften, und einzelne Frauen und Männer in aufwendigen Kaftanen und Tuniken. Der Geräuschpegel war laut und verwirrend und rauschte wie ein Orchester in meinen Ohren.
Als ich mich endlich wieder Zoe zuwandte, merkte ich, dass sie mich hatte stehen lassen und zusammen mit ihrem Vater und den anderen vornehmen Menschen über die Planke an Land wanderte. Ich hastete ihr nach und holte sie auf dem Steg ein.
»Was passiert denn heute zum Fest der Einigkeit? Gibt es etwas, das man tun muss?«, fragte ich.
Zoe grinste und zum ersten Mal wirkte sie wirklich freundlich. »Spaß haben! Die ganze Stadt ist in Feierlaune.«
Ich folgte ihrer Gruppe durch den tummeligen Hafen. Die Stege spannten sich wie ein Gitter über das Hafenbecken und es dauerte, bis wir auf der Straße ankamen.
Die Gruppe steuerte auf eine wartende Kutsche zu und einer nach dem anderen nahm Platz. Ich schluckte, als mir klar wurde, dass ich von nun an auf mich allein gestellt war.
»Danke«, sagte ich zu Zoe. »Für alles. Wenn ich irgendetwas für dich tun kann …«
»Hab eine gute Zeit, Naima. Halt dich westlich, die größte Feier findet direkt vor dem Palast statt. Viel Glück.« Sie winkte mir noch einmal zu und nahm ebenfalls in der offenen Kutsche Platz.
Ich hatte das Gefühl, noch etwas sagen zu müssen, und wandte mich an den Efendi. »Danke, dass Ihr mich geduldet habt. Ich stehe für immer in Eurer Schuld.« Ich verbeugte mich tief vor ihm. Als ich mich wieder aufrichtete, sah ich ein Schmunzeln in seinem Gesicht.
»Die Sterne stehen gut für dich«, sagte er. »Auf Wiedersehen.«
Mit einem Peitschenknall setzten die Pferde sich in Bewegung und ich war allein.
4
Naima
Zoe hatte recht. Die Stadt war in Feierlaune. Jede Gasse war mit bunten Fahnengirlanden dekoriert, Ney-Flöten und Geigen verflochten sich zu wunderschönen Klängen und hallten über die Köpfe der gut gelaunten Menschen hinweg. Jedes Restaurant und jede Schänke waren brechend voll mit großen Gruppen, die schunkelten und durcheinanderlachten, daneben der geschäftige Tagesbetrieb. Menschen wimmelten um mich herum, trugen Körbe mit Lebensmitteln und hinterließen ein Meer aus köstlichen Gerüchen.
Ein Geschäft reihte sich an das nächste, jedes üppig behängt mit Teppichen, Lederwaren oder funkelnden Laternen. Es gab Stände mit Gewürzen und Nüssen, Barbiere, bei denen sich fein gekleidete Herren frisieren ließen und vor dessen Schaufenstern sich rot-blaue Spiralen drehten. Einige Läden boten Hamamtücher und dicke Stoffballen an.
Im Vorbeigehen strich ich mit den Fingerspitzen über ein hauchzartes Tuch, das über und über mit Perlen bestickt war. Der Stoff fühlte sich kostbar und wunderschön leicht an. Wie einmalig erst ein ganzes Kleid daraus wäre? Ich riss mich vom Anblick los, schob mich weiter durch die Gassen.