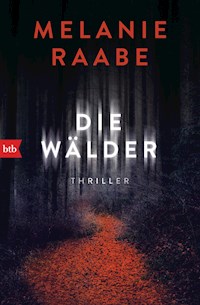9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
„Am 11. Februar wirst du am Prater einen Mann namens Arthur Grimm töten. Aus freien Stücken. Und mit gutem Grund.“ Gerade ist die junge Journalistin Norah von Berlin nach Wien gezogen, um ihr altes Leben endgültig hinter sich zu lassen, als ihr eine alte Bettlerin auf der Straße diese Worte förmlich entgegenspuckt. Norah ist verstört, denn ausgerechnet in der Nacht des 11. Februar ist vor vielen Jahren Schreckliches geschehen. Trotzdem tut sie die Frau als verwirrt ab, eine Irre ist sie, es kann gar nicht anders sein – bis kurz darauf ein mysteriöser Mann namens Arthur Grimm in ihrem Leben auftaucht. Bald kommt Norah ein schlimmer Verdacht: Hat sie tatsächlich allen Grund, sich an Grimm zu rächen? Was ist damals, in der schlimmsten Nacht ihres Lebens, wirklich passiert? Und kann Norah für Gerechtigkeit sorgen, ohne selbst zur Mörderin zu werden?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 475
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Zum Buch
»Am 11. Februar wirst du am Prater einen Mann namens Arthur Grimm töten. Mit gutem Grund. Und aus freien Stücken.« Gerade ist die junge Journalistin Norah von Berlin nach Wien gezogen, um ihr altes Leben endgültig hinter sich zu lassen, als ihr eine alte Bettlerin auf der Straße diese Worte förmlich entgegenspuckt. Norah ist verstört, denn ausgerechnet in der Nacht des 11. Februar ist vor vielen Jahren Schreckliches geschehen. Trotzdem tut sie die Frau als verwirrt ab, eine Irre ist sie, es kann gar nicht anders sein – bis kurz darauf ein mysteriöser Mann namens Arthur Grimm in ihrem Leben auftaucht. Bald kommt Norah ein schlimmer Verdacht: Hat sie tatsächlich allen Grund, sich an Grimm zu rächen? Was ist damals, in der schlimmsten Nacht ihres Lebens, wirklich passiert? Und kann Norah für Gerechtigkeit sorgen, ohne selbst zur Mörderin zu werden?
Zur Autorin
MELANIE RAABE wurde 1981 in Jena geboren. Nach dem Studium arbeitete sie tagsüber als Journalistin – und schrieb nachts heimlich Bücher. 2015 erschien ihr Debüt DIE FALLE, 2016 folgte DIE WAHRHEIT. Melanie Raabes Romane werden in über 20 Ländern veröffentlicht. DIE FALLE war international eines der heißumkämpftesten Bücher der letzten Jahre, TriStar Pictures sicherte sich die Filmrechte. Melanie Raabe lebt und schreibt in Köln.
MELANIE RAABE
DER SCHATTEN
Thriller
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
1. Auflage
Copyright © 2018 by btb Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: semper smile
Umschlagmotiv: © plainpicture/NaturePL/Pal Hermansen
Autorenfoto: Christian Faustus
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-21304-6V003www.btb-verlag.dewww.facebook.com/btbverlag
I’m a fountain of blood
In the shape of a girl
Björk – Bachelorette
In the desert
I saw a creature, naked, bestial,
Who, squatting upon the ground,
Held his heart in his hands,
And ate of it.
I said, »Is it good, friend?«
»It is bitter – bitter,« he answered;»But I like it
»Because it is bitter,
»And because it is my heart.«
Stephen Crane – In the Desert
Prolog
Sie würde einfach verschwinden. Das Eis würde krachend nachgeben unter ihren Füßen, sie würde mit Wucht hinabgerissen werden, kein verzweifeltes Strampeln und Plantschen, um an der Oberfläche zu bleiben, kein Kampf, nur hinab, hinab, hinab in die Dunkelheit, die Stille.
Als Kind war sie häufig auf dem zugefrorenen Teich herumgelaufen, der zwischen den letzten Häusern des Ortes und den Feldern lag. Die Möglichkeit, einzubrechen, war ihr damals noch nicht so klar gewesen.
Dass es einen solchen Ort gab. Ein kleiner See mitten im Wald, umstanden von Bäumen, deren Äste unter der Last des Neuschnees herabhingen wie in Trauer. Die Taubheit in den Fingerkuppen, der klirrende Schmerz in ihren Zehen. Sie schwenkte die Taschenlampe hin und her. Niemand außer ihr war hier. Sie waren nicht gekommen. Und doch waren da Spuren. Hatte sie die beiden verpasst? War sie zu spät? Sie warf einen Blick auf ihre Armbanduhr. Nein.
Sie schaltete die Taschenlampe aus. Als sie den Waldweg entlanggegangen war, langsam, Schritt für Schritt, da war der körnige Lichtstrahl unentbehrlich gewesen. Nun, wo sie aus dem Schatten der Bäume hervorgetreten war, brauchte sie die Taschenlampe nicht mehr.
Die Sterne waren so hell hier draußen, so fern von der Stadt. Das Geräusch gefrierender Blätter. Eine gleißende, nächtliche Welt. Kurz vergaß sie, warum sie mitten in der Nacht an diesen Ort gekommen war. Den Verrat, die Wut, die Schmerzen – alles.
Sie machte einen Schritt auf das Eis. Hielt inne, horchte. Es knackte. Ein schlafendes Lebewesen, das im Traum schwache Laute von sich gab.
Sie hörte genauer hin, richtete den Blick zum Himmel, schloss die Augen. Die Stille klang nach Gesang. Ein Choral.
Seltsam, dachte sie.
Wind kam auf, scharf wie eine Klinge, und trug den Geruch von Neuschnee herbei. Sie zog den Kopf ein, die Schultern hoch.
Der milchige Glanz der Sterne. Das Gefühl, dass sie nicht hier sein sollte.
Dann sah sie es. Ein Gegenstand, auf dem Eis. Sie zögerte, bückte sich, um das, was dort im Schnee lag, besser erkennen zu können. Streckte die Hand aus. Blinzelte, als ihr Gehirn begriffen hatte, was ihre Augen da sahen. Zog die Hand zurück. Ein toter Vogel, dunkel gegen den weißen Schnee, noch nicht gefroren.
Sie richtete sich auf – sie glaubte an Zeichen –, wandte sich jäh um. Ihr Atem ging plötzlich sehr laut.
Niemand. Da war niemand.
Sie drehte sich einmal um die eigene Achse. Nichts, niemand, nur sie und die Nacht selbst. Noch einmal blickte sie hinauf zu den Sternen, dann fasste sie ihren Entschluss.
Sie würde es tun. Sie würde sie zerstören. Sie alle. Aber vor allen Dingen sie. Norah.
1
Norah liebte Abschiede. Momente des Übergangs. Die Minuten auf der Schwelle zwischen Nacht und Tag, Winter und Frühjahr. Geburten, Hochzeiten, Silvesternächte. Ein neues Leben, eine zweite Chance. Wiedergeburten. Das Alte ausradieren, einen neuen Stift in die Hand nehmen.
Warum weinst du dann?
Die undurchdringliche Schwärze der Wälder. Der Himmel grün und blau geschlagen von der Nacht. Die Straße vor ihr endlos. Norah blickte der Dunkelheit entgegen, mit weit offenen Augen. Ihr altes Leben verschwand im Rückspiegel. Wurde kleiner und kleiner. Unwirklich fast. Ihre Arbeit. Der Mann. Ihr Zuhause. Der Hund.
Die Katastrophe.
Norah wischte die Tränen fort. Eines Tages würde sie verwinden, was in Berlin geschehen war. Das Leben war nicht fair, das hatte sie inzwischen gelernt. Sie würde es überleben. Die Wut und die Bitterkeit würden nie ganz verschwinden, doch sie würden an Schärfe verlieren wie ein vor langer Zeit gestochenes Tattoo.
Die Schwere, die in den letzten Wochen und Monaten auf ihr gelastet hatte, ließ schon jetzt mit jedem Kilometer nach, den sie sich von ihrem Berliner Zuhause entfernte, das nun nicht mehr ihr Zuhause war. Sie hatte die richtige Entscheidung getroffen, als sie gegangen war.
Vor ihr lagen noch mindestens sechs Stunden Fahrt. Norah drosselte die Geschwindigkeit, lenkte den Wagen um eine Kurve, zwang sich, sie nicht zu schneiden. Sie schaltete das Radio ein, und aus den kleinen Boxen drang elektronische Musik. Schon seit einer ganzen Weile war ihr kein anderes Auto mehr entgegengekommen. Das war schön so. Das Geräusch des Asphalts unter den Reifen, die leise Musik, die Wälder, die Ruhe, der Aufbruch. Das letzte Licht schwand. Der Nadelwald, durch den die gewundene Straße führte, schien sich zu verdichten. Sie lenkte den Wagen um eine weitere, lang gezogene Kurve, trat das Gaspedal durch, hob den Blick vom Asphalt – und dann waren da plötzlich die Sterne. Eine Handvoll, ein Dutzend, Tausende, zahllose, unendlich viele.
Ein Blick auf das Navigationsgerät zeigte ihr, dass sie immer noch fast fünfhundert Kilometer vor sich hatte. Egal. Sie drosselte die Geschwindigkeit, fuhr rechts ran, hielt. Starrte durch die Windschutzscheibe gen Himmel und schaltete schließlich Radio, Motor und Scheinwerfer aus.
Norah öffnete die Autotür, stieg aus, trat auf die Mitte der Straße, legte den Kopf in den Nacken. Dort! Die Gestirne mit feinstem Pinsel auf das Himmelszelt gesetzt. Sie lächelte. Einen Moment lang blieb sie so stehen. Spürte die Kälte zuerst auf ihren Wangen, dann in ihren Fingerspitzen, durch das dünne Material ihrer schwarzen Lederhandschuhe hindurch, schließlich in ihren Zehen, den Blick immer noch gen Himmel gerichtet. Sie hatte einmal gewusst, warum die Sterne funkelten, es jedoch wieder vergessen. Da, ein Knacken, sie drehte sich um, starrte ins Dunkel. Waldgeräusche. Sie lächelte über das plötzlich heftige Schlagen ihres Herzens.
Wälder. Ihr Atem. Eine schnurgerade Straße vor ihr – und über ihr der Himmel. Nichts, wovor es sich zu fürchten galt. Ohne Hast stieg sie wieder in ihren Wagen, schaltete die Scheinwerfer ein, startete den Motor. Auf dem Beifahrersitz lag ihre Handtasche, auf der Rückbank hatte sie ein paar persönliche Gegenstände gestapelt, sonst nichts. Die Umzugskartons, die sie so hastig gepackt hatte, warteten bereits in Wien auf sie. Alles neu, sie war frei. Norah schaltete das Radio ein. Wechselte den Sender. Und dann waren da nur noch sie und die Straße und die Musik.
2
Als Norah am nächsten Morgen erwachte und barfuß ans Fenster ihrer Wiener Wohnung trat, tauchte die Wintersonne die prächtigen Fassaden der Häuser gegenüber bereits in milchiges Licht. Sie öffnete das Fenster und genoss einen Augenblick lang die knackige Kälte, die ihr Gesicht traf und ihre Wangen rötete, während unter ihr die Stadt zum Leben erwachte wie ein einziger Organismus. Verkehrslärm drang herauf, der die Rufe einer Gruppe Schulkinder, die gerade die Straße überquerte, beinahe übertönte. Tief atmete Norah ein, dann schloss sie das Fenster wieder und sah sich um.
Wie klein ihr Leben war. Ihr Bett nur ein paar Stücke Holz, die neben dem eingerollten und zusammengebundenen Lattenrost auf dem Boden ihres neuen Schlafzimmers lagen, zufällig auf dem Parkett verteilt wie ein auseinandergefallenes Skelett. In der vergangenen Nacht hatte sie auf ihrer Isomatte geschlafen und dabei bei jeder Bewegung den harten Boden unter sich gespürt. Und dann waren da noch die Umzugskartons. Achtundvierzig Stück. Alles, was sie aus dem alten in ihr neues Leben herübergeschafft hatte.
Auf gut Glück öffnete sie eine der Kisten, die mit Kleidung beschriftet waren. Sommersachen, Flipflops, ihr weißer Bikini, den sie für den Urlaub auf Sardinien gekauft hatte, wo sie im letzten Jahr ihren vierunddreißigsten Geburtstag gefeiert hatten.
Sie hatte viel zu hastig gepackt, hatte nur noch weggewollt aus der Wohnung am Prenzlauer Berg. Alex hatte ihr fassungslos zugesehen, überrollt von den Ereignissen. Er fand keine Worte, und sie hätte sie auch gar nicht hören wollen.
Norah verschloss den Karton wieder, öffnete einen zweiten, dritten, vierten: Bettwäsche. Ihre Taucherausrüstung. Eine Wolldecke. Hemden und T-Shirts. Aber weit und breit kein warmer Pullover. Seufzend griff sie nach einer schwarzen Bluse und streckte sich. Die Kartons, die von den Mitarbeitern des Umzugsunternehmens in den verschiedenen Räumen ihrer neuen Wohnung aufgetürmt worden waren, wirkten zwischen den kahlen weißen Wänden und unter den hohen Decken wie Objekte in einem Museum für Moderne Kunst.
Nur wenige Dinge waren in ihrer neuen Wohnung bisher an ihrem Platz: ihr Schreibtisch im Arbeitszimmer, die Couch und der Fernseher davor, der in einer Ecke im Wohnzimmer stand und den Norah laufen lassen konnte, wenn ihr die Stille zu laut wurde – und die Kaffeemaschine in der Küche. Der Rest war Wüste. Nein, dachte sie. Keine Wüste. Ein weißes Blatt Papier, das sie bemalen konnte.
Plötzlich musste Norah lächeln.
Das Treppenhaus roch nach feuchtem Teppich und Filterkaffee, als sie wenig später die Wohnung verließ und abschloss. Gerade wollte sie die Stufen nach unten nehmen, da hörte sie etwas, ganz leise. Sie wandte sich um. Erst, als sie den Blick nach oben wandte, sah sie die kleine schwarze Katze, die unschlüssig auf der Treppe zwischen dem zweiten und dritten Stock des Mietshauses stand und Norah schüchtern ansah.
»Hallo«, sagte Norah. »Wo kommst du denn her?«
Instinktiv ging sie in die Hocke und streckte die Hand aus. Das Kätzchen starrte sie an. Schließlich setzte es sich in Bewegung, zögerlich erst, dann immer mutiger. Vorsichtig streichelte Norah ihm das Köpfchen. Als Kind hatte sie sich immer eine Katze gewünscht, doch ihre Mutter hatte keine Haustiere in der Wohnung haben wollen. Und als Norah alt genug war, um nicht mehr auf die Erlaubnis anderer angewiesen zu sein, arbeitete sie längst zwölf Stunden am Tag in der Redaktion und hatte keine Zeit mehr für eine Katze.
Das Tier hatte seine anfängliche Vorsicht vergessen, drückte den Kopf an Norahs Handrücken, bog mit geschlossenen Augen den Rücken durch und begann doch tatsächlich zu schnurren.
»Katinka?«, hörte Norah plötzlich eine Stimme von oben, aus dem Stockwerk über ihr. Die Katze hob den Kopf, offenbar unsicher, ob sie dem Ruf folgen oder sich lieber noch eine Weile von ihrer neuen Eroberung streicheln lassen sollte. Schließlich entschied sie sich für Letzteres und strich Norah, die sich wieder erhoben hatte, kokett um die Beine.
»Hallo«, rief Norah ins Treppenhaus hinein. »Falls Sie Ihre Katze suchen, die ist hier.«
Ein Lachen ertönte, dann waren da Schritte, und zwei Sekunden später eine Stimme, die sagte: »Na, Katinka? Belästigst du wieder die Nachbarn?« Und dann: »Sorry. Irgendwie ist sie mir ausgebüchst. Ich bin übrigens Theresa. Dritter Stock.«
Einen Augenblick war Norah wie gelähmt. Diese beinahe mandelförmigen blauen Augen mit den blonden Wimpern, der kleine, wie von einem Pinselstrich geschwungene Mund, die Sommersprossen …
»Geht’s Ihnen nicht gut?«, fragte die junge Frau, doch Norah hörte sie kaum.
Diese Ähnlichkeit …
»Alles klar mit Ihnen?«, fragte die Frau erneut.
Endlich schaffte Norah es, sich ein Lächeln abzuringen.
»Ich schlafe wohl noch«, meinte sie. »Entschuldigen Sie bitte.«
Sie schüttelte die Hand, die sich ihr entgegenstreckte.
»Norah«, fügte sie hinzu. »Zweiter Stock.«
»Cool«, sagte die Frau. »Freut mich.« Sie warf einen Blick über die Schulter. »Ich gehe jetzt wohl mal besser und fange den kleinen Teufel ein.«
Bedächtig nahm Norah die Stufen ins Erdgeschoss hinunter.
Geht’s Ihnen nicht gut?, hatte die Frau gefragt. Wie gut konnte es einem gehen, wenn man gerade einen Geist gesehen hatte?
3
Wien zeigte ihr die kalte Schulter. Als sie vor einigen Jahren mit Alex im Sommer in der Stadt gewesen war, da war sie ganz bezaubert gewesen von dieser eigensinnigen Metropole, die so anders war als jeder Ort, den Norah kannte. Das schien ewig her.
Nun wirkte alles so düster. Edvard Munchs Vision von einem Wien, ein Finsterwald aus Asphalt, verzerrt und bedrohlich. Norahs leere Wohnung, die Düsternis der Straßen. Die Passanten mit ihren Smartphones, die Melancholie, die wie ein schmieriger Film über allem lag, allumfassend und unsichtbar. Und die gottverdammte Kälte.
Im Kiosk schräg gegenüber kaufte Norah sich eine österreichische und eine deutsche Tageszeitung sowie eine Packung Zigaretten und setzte sich damit in das Eck-Bistro. Als sie den ersten Schluck Kaffee nahm, war die Wucht der Erinnerung, die sie beim Anblick von Theresa gestreift hatte, ein wenig geschwunden, und ihre Gedanken wandten sich wieder dem zu, was vor ihr lag.
Offiziell würde ihr neues Arbeitsverhältnis erst in zwei Wochen beginnen, doch Norah brannte darauf, endlich wieder an die Arbeit zu gehen. Weswegen sie auch begeistert gewesen war, als ihr neuer Chefredakteur sie vorab zu einem Gespräch in die Redaktion eingeladen hatte. Tatsächlich war es nach ausgiebigen Telefonaten das erste echte Kennenlernen. Ein wenig nervös war sie ja doch. Sie wusste, dass sie eine gute Journalistin war, sie hatte mit einigen ihrer Reportagen Preise gewonnen, und es hatte schon in der Vergangenheit Abwerbeversuche anderer Häuser gegeben. Aber das war alles vorher gewesen. Vor dem, was sie in ihrem Kopf nur die Katastrophe nannte. Danach war ihr das Jobangebot aus Wien wie ein grausamer Scherz erschienen. Es war viel zu gut, um wahr zu sein.
Dr. Mira Singh, die Verlegerin, hatte sie höchstpersönlich angerufen. Durch Norahs Reportage über Soldatinnen in Afghanistan sei sie auf sie aufmerksam geworden, habe anschließend alles gelesen, was sie in den letzten Jahren veröffentlicht habe und schätze ihre Arbeit sehr. Ihre Beobachtungsgabe, ihr Gespür für Themen. Man habe in Wien gerade ein neues Wochenmagazin gegründet und stelle sich eine top besetzte Redaktion vor, die sich – statt mit der Geschwindigkeit des Internets konkurrieren zu wollen – durch aufwändig recherchierte Geschichten von profilierten Autorinnen und Autoren von der Masse der Magazine absetzen wolle.
Für Norah hatte das regelrecht paradiesisch geklungen. Wo war der Haken? Sie hatte Singh gefragt, ob sie wisse, dass sie gerade eine Klage am Hals habe, und diese hatte nur gemeint, sie kenne den Text, um den es gehe. Sie suche eine Frau mit Haltung und glaube, sie in ihr gefunden zu haben. Einen Tag Bedenkzeit hatte sich Norah erbeten. Aus Prinzip. Dann hatte sie zugesagt. Was sonst hätte sie tun sollen?
Und nun war sie hier.
Die Redaktion befand sich unweit des Stephansdoms, im touristischsten Teil der Stadt, direkt an einer der riesigen Einkaufsmeilen mit ihren Fast-Food-Läden und Bekleidungsketten – ein Angebot, das in jeder größeren europäischen Stadt, die Norah bereist hatte, nahezu identisch war. Norah kannte die Gegend von einer ihrer früheren Reisen nach Wien. Von morgens bis abends war sie von Touristen und allen, die von ihnen lebten, bevölkert. Da waren die Reisegruppen auf dem Weg zum Stephansdom, die Trickdiebe, die Straßenmusiker, hier und da ein paar gestresste Städter, die versuchten, sich halbwegs effizient durch die Menschenmassen zu bewegen, die Teenager, die Selfies auf ihren iPhones machten. Und die Bettler. Die Obdachlosen. Wie Geister kamen sie ihr vor. Ihre Rufe hallten durch die Straßen, immer und immer wieder, wie die von Gespenstern. Hallo? Hallo? Und die Lebenden fröstelten, wenn sie ihre Stimmen vernahmen, und taten so, als hörten sie nichts. Vor vielen Jahren hatte sie einmal eine Reportage über minderjährige Obdachlose machen wollen, ihren damaligen Chef aber nicht dafür interessieren können. Vielleicht war jetzt die Zeit reif für so eine Story? Norah zündete sich eine Zigarette an und ging gedankenverloren die Straße hinunter. Mit der Zunge spielte sie an einem ihrer Backenzähne herum, auf dem ein seltsamer Druck lag, so, als sei der Zahn sich unsicher, ob er ihr nun wehtun wollte oder nicht. Das fehlte noch. Sie wollte am Abend einkaufen gehen, nicht zum Zahnarzt.
Vor dem H&M saß ein unscheinbares Mädchen. Höchstens Anfang zwanzig, kastanienbraunes Haar unter der schwarzen Wollmütze, Army-Parka, abgekaute Fingernägel, ein Schild vor sich. Ich habe Hunger. Daneben ihr Schäferhund. Ein Stück weiter: ein bebrillter Mann um die sechzig mit feinen Gesichtszügen. Dann war da noch der vermutlich psychotische Typ mit den blonden Dreadlocks, der die meiste Zeit über introvertiert vor sich hin murmelte und die Passanten anschnorrte, bisweilen aber ausfallend wurde und vorbeigehende Frauen mit erstaunlicher Phantasie und Ausdauer vulgär beschimpfte.
Und dann war da noch sie. Eine ältere Frau mit eindrucksvollen Falten und klaren, hellblauen Augen. Mit der Art von Gesicht, mit dem Fotojournalisten Preise gewannen, wenn sie es irgendwo in einem entlegenen Bergdorf entdeckten.
Sie saß oder kniete nicht auf dem Boden wie die meisten anderen Bettler. Sie stand, eine kleine, messingfarbene Schale vor sich, nicht etwa am Rand der Straße, die sich durch die Fußgängerzone zog, sondern genau in deren Mitte, völlig unbeeindruckt vom Gewühl um sie herum. Es war erstaunlich. Diese Frau, die Norah auf locker einen Meter und fünfundachtzig schätzte, stand im Weg, doch niemand rempelte sie an, die Hektik der Metropole umspülte sie wie das Wasser eine Flussinsel. Hin und wieder warf ihr ein Passant ein paar klimpernde Münzen in die Schale; sie bedankte sich nie. Stand einfach unbeweglich da, düster und aufrecht im stetigen Strom der Menschen. Ein Findling. Ein schwarzer Turm. Das Einzige an ihr, was sich bewegte, waren die Augen. Unwillkürlich fragte Norah sich, welche Geschichte diese Frau wohl zu erzählen hatte.
Sebastian Berger, Norahs neuer Chef, war ein großer, kräftiger Mann in den Fünfzigern, mit zurückgekämmtem, immer noch dunklem Haar. Er trug Jeans und ein braunes Jackett aus Tweed, das ihm, so fand zumindest Norah, etwas leicht Professorales verlieh. Vor allem aber trug er einen Gesichtsausdruck, der sagte: Sie habe ich mir aber ganz anders vorgestellt. Das war Norah gewohnt. Selbst mit Mitte dreißig wurde sie wegen ihres fein geschnittenen Gesichts und ihres zierlichen Körperbaus bei Terminen noch häufig für die Praktikantin gehalten. Als sie die Fotos von sich hatte anfertigen lassen, die auf verschiedenen Online-Portalen unter ihrem Autorenprofil auftauchten und die sicher auch Sebastian Berger gesehen hatte, hatte sie auf dunkle Kleidung und einen ernsten Gesichtsausdruck geachtet und letztlich die Bilder ausgesucht, auf denen sie am erwachsensten aussah. Im echten Leben standen ihr solche Tricks nicht zur Verfügung, und ihr war schon früh in ihrem Berufsleben klar geworden, dass sie härter arbeiten und tougher sein musste als die meisten, um sich Respekt zu verschaffen. Berger immerhin fing sich schnell, bot ihr einen Kaffee an, und sie setzten die Konversation über potenzielle Magazinthemen, die sie in den vergangenen Wochen bereits am Telefon begonnen hatten, fort. Als Norah gute zwei Stunden später im Aufzug nach unten fuhr, schwirrte ihr der Kopf vor lauter Ideen. Wie gut, zurück an die Arbeit zu gehen.
Draußen war es wärmer als am Morgen, die Temperaturen waren gestiegen. Norah wollte heute noch aufs Amt, ihr Auto ummelden, und falls die Wartezeit nicht den ganzen Tag in Anspruch nahm, konnte sie sich anschließend nach neuen Möbeln umsehen. Sie knöpfte den grauen Wintermantel auf, den sie über ihrem schwarzen Wollkleid trug, es war beinahe frühlingshaft mild, Sonnenschein, dunkelblauer Himmel. Keine Schatten in dieser Stadt, nirgendwo. Kurz hielt sie inne, als sie die Menschenmassen sah, die sich, vom herrlichen Wetter ins Freie gelockt, durch die Fußgängerzone walzten. Sog alles auf, was sich um sie herum tat.
Der Geruch von Frittierfett, Passanten, Touristen, Streifenpolizisten, Leuchtreklame, Tauben, Zigarettenkippen, Coffee-to-go-Becher, Absatzgeklapper. Ein Mann, der Touristen Rosen aufschwatzte, Hufgetrappel in der Ferne, Springbrunnen, Ballonverkäufer, Eistüten und Popcorn und Smartphone-Zombies und Trickdiebe. Norah wurde geschluckt, mit Haut und Haar, versuchte, schneller voranzukommen, vergebens. Wurde sogar ein Stück zurückgeworfen, als ihr eine riesige Reisegruppe entgegenkam. Norah ließ alle Höflichkeit fahren und kämpfte sich, die Tasche mit ihren Unterlagen für das Amt fest an den Körper gepresst, ohne Rücksicht auf Verluste voran. Sie war gerade so einem Rikschafahrer ausgewichen, der es aus unerfindlichen Gründen für eine gute Idee hielt, Fahrgäste durch dieses Gewimmel zu chauffieren, als ihr klar wurde, dass ihr Telefon klingelte. Sie fischte es aus der Tasche, warf einen Blick auf das Display, zuckte zusammen. Alex. Seit Norah erst ins Hotel und schließlich nach Wien gezogen war, hatten sie nicht mehr miteinander gesprochen. Keiner von ihnen hatte sich beim anderen gemeldet. Norah starrte auf das Display, ihr war kalt. Sollte sie den Anruf annehmen oder ihn auf die Mailbox laufen lassen? Und dann war es zu spät. Alex hatte aufgegeben. Norah ließ das Handy in die Manteltasche gleiten, hob den Blick.
Die alte Bettlerin von vorhin stand direkt vor ihr. Sie war so hochgewachsen, dass Norah zu ihr aufschauen musste. Instinktiv griff sie in ihre Handtasche und nach ihrem Portemonnaie, um der Frau ein paar Euro zu geben.
»Du bringst den Tod«, sagte die Frau.
Ihre Stimme klang ruhig und rau.
Stirnrunzelnd blickte Norah sie an.
»Was haben Sie gerade zu mir gesagt?«
Die Frau schien Norah gar nicht gehört zu haben.
»Blumen welken«, sagte sie. »Uhren bleiben stehen. Die Vögel fallen tot vom Himmel.«
Ihr ernster Blick ruhte weiter auf Norah. Die Haare der Frau waren dunkler, ihre Augen heller, die Falten tiefer, als Norah es aus der Ferne wahrgenommen hatte. Da waren rötliche Sprenkel im hellen Türkis ihrer Iris, wie die winzigen Partikel von Blut, die sich bisweilen im Dotter eines Hühnereis fanden.
Erst jetzt wurde Norah klar, dass sie es mit einer psychisch Kranken zu tun hatte.
»Am 11. Februar wirst du am Prater einen Mann namens Arthur Grimm töten«, fuhr die Frau fort. »Mit gutem Grund. Und aus freien Stücken.«
Kurz wusste Norah nicht, was sie sagen sollte. Sie öffnete gerade den Mund, als jemand oder etwas ihr einen harten Stoß in den Rücken versetzte. Norah taumelte, ließ die Mappe mit ihren Unterlagen fallen und sah, wie ein paar lose Blätter davonsegelten. Sie bückte sich, griff nach ihnen, richtete sich wieder auf.
Die Bettlerin war verschwunden. Irritiert sah Norah sich um. Eine Gruppe chinesischer Touristen drängte sich an ihr vorbei, dann ein junges Pärchen mit Kinderwagen. Wo war sie nur hin? Norah schob sich zwischen zwei Fußballfans mit Rapid-Wien-Schals hindurch, hielt Ausschau nach der Frau, die so groß gewesen war, dass sie eigentlich aus der Menge hätte herausragen müssen, doch nichts. Sie war wie vom Erdboden verschluckt. Dabei hätte sie bestimmt etwas zu erzählen gehabt, dachte Norah. Schade.
Und ein wenig unheimlich auch.
4
Ein Supermarkt. Eine Buchhandlung. Ein Universitätsgebäude, eine Drogerie, Restaurants, Antiquitätenläden. Eine Teddy-Klinik. Ein Waffengeschäft. Auf einer Häuserwand eine Reihe identischer Plakate mit riesigen Buchstaben: BISTDUSICHER? Norah versuchte, sich ihre Umgebung einzuprägen. Dieses Viertel hier – das war jetzt ihr Zuhause. Es würde noch eine Weile dauern, bis sie sich nicht mehr wie eine Touristin vorkam.
Ihr Blick wanderte nach oben. Die Kabel der Straßenbahnen durchschnitten das Blau des Himmels in schöne geometrische Formen. Glassplitter. Und dann die prächtigen Fassaden der Häuser in dieser Straße, ja, eigentlich in der ganzen Stadt. Wurde hinter dem Fenster da oben gerade gestritten? Ferngesehen? Gekocht? Wurden da Blumen gegossen, Ehepartner betrogen, jemand ermordet?
Als Kind hatte sie sich oft gewünscht, sie hätte einen Röntgenblick und könnte durch die Wände hindurchschauen, um sehen zu können, welche Geschichten sich dahinter verbargen. Welche Menschen. Wie sie lebten. Heute war sie manchmal froh darum, dass ihr das ganze Elend verborgen blieb. Dass sie nur die glanzvolle Fassade wahrnahm.
Die neue Wohnung war so groß, so leer. Kein Alex. Kein Hund. Nur Hall und Schatten und nackte Wände. Sie hatte versucht, Alex zurückzurufen – vergeblich. Ein Teil von ihr war froh darüber. Sie klappte ihren Laptop zu, konnte sich ohnehin nicht auf ihre Notizen konzentrieren. Es war ein alter, dunkler Gedanke, der sie im Laufe des Tages immer mal wieder gestreift hatte, und der sich nun kaum noch ignorieren ließ.
Sie würde ihre Freundin Sandra anrufen. Früher, in Berlin, war Norah in solchen Momenten einfach bei ihr vorbeigegangen, sie hatte ja nur ein paar Ecken weiter gewohnt. Noch früher hätte sie den Gedanken mit Drogen betäubt. Doch nun war sie schon so lange clean, dass dergleichen nicht mehr in Frage kam.
Der Anruf bei Sandra lief ins Leere. Norahs Blick wanderte über die hohen, stuckverzierten Decken, das makellose Parkett, die Umzugskartons, ihre wenigen Habseligkeiten, und plötzlich war da ein Summen. Sie spürte den Ton mehr, als dass sie ihn hörte, irgendwo zwischen Zwerchfell und Brustbein. Nein, es war kein Ton. Es war ein Gefühl, und sie brauchte einen Moment, bis sie es benennen konnte, weil sie es in den letzten Jahren, in denen sie praktisch nie allein gewesen war, beinahe vergessen hatte. Ihre Einsamkeit war ohrenbetäubend.
Sie musste raus, dringend. Das half immer, wenn ihr die Finsternis auf den Fersen war. Raus ins Leben. Norah betrachtete ihr Handy und überlegte, wen sie sonst noch anrufen konnte. In Berlin wäre es nicht schwer gewesen, jemanden zu finden, der mit ihr einen Drink nehmen würde, doch in Wien sah die Sache anders aus. Im Grunde waren da nur Max, ihr bester Freund, der entzückt gewesen war, als sie ihm unterbreitete, dass sie in »seine Stadt« ziehen würde, und dessen Mann Paul. Und natürlich Tanja, eine alte Bekannte, die sich allerdings gerade in Hamburg aufhielt. Norah probierte es bei Max. Mailbox.
Kurz erwog sie, alleine auszugehen, aber für die Sprüche, die eine Frau erntete, die sich alleine an eine Bar setzte, hatte sie heute nicht die Nerven. Als der Druck auf ihrer Brust unerträglich wurde, setzte sie sich, checkte ihr Facebook, ihren Twitter-Account. Schrieb ein kurzes Tweet.
Kann noch jemand da draußen nicht schlafen?
#sleeplessinvienna
Sie wartete ein paar Minuten, doch niemand antwortete.
Resigniert zappte sie durchs TV und fand schließlich eine Dokumentation über heimische Rotfüchse, die ihr gefiel.
Norah schreckte hoch. Sie konnte nicht lange geschlafen haben, denn im Fernsehen lief immer noch derselbe Tierfilm. Und doch empfand sie die Art leichter Verwirrung, die einen umfängt, wenn man aus tiefem Traum erwacht. Benommen setzte sie sich auf, stellte fest, dass ihr Schweiß auf der Stirn stand, wischte ihn fort. Über ihr knarrten die Dielen, die Nachbarin von oben war noch wach. Wie hatte sie noch gleich geheißen? Richtig, Theresa.
Wie merkwürdig das Leben doch manchmal war. Da hatte Norah alles hinter sich gelassen, war in ein fremdes Land gezogen, um noch einmal ganz von vorne zu beginnen, und gleich am ersten Tag in der neuen Stadt holte die Vergangenheit sie ein, und –
Nein, das war Unsinn. Es war nur ein dummer Zufall, dass die neue Nachbarin so aussah, wie sie eben aussah. Sagte man nicht, jeder habe auf dieser Welt einen Doppelgänger? Und wie oft war es in den vergangenen Jahren schon vorgekommen, dass Norah geglaubt hatte, sie zu sehen? In einer vorbeifahrenden Bahn, am Flughafen, in einem Straßencafé?
Doch es war nicht nur die Tatsache, dass Theresa ihr so ähnlich sah, die Norah dazu gebracht hatte, im Laufe des Tages immer und immer wieder an sie zu denken. Es war auch das gewesen, was die Bettlerin zu ihr gesagt hatte.
Am 11. Februar wirst du am Prater einen Mann namens Arthur Grimm töten. Aus freien Stücken. Und mit gutem Grund.
Ausgerechnet am 11. Februar …
Nachdenklich trat Norah ans Fenster und blickte auf die Straße hinab. Vor dem Wohnhaus gegenüber versuchte sich ein schwarzer Kombi gerade in eine viel zu kleine Parklücke zu quetschen. Das Gelächter eines vorbeigehenden Pärchens drang leise durch die Doppelverglasung des Fensters.
Nahm man einfach nur den Inhalt dessen, was die alte Frau gesagt hatte, dann musste man zu dem Schluss kommen, dass sie geisteskrank war. Norah kannte keinen Arthur Grimm. Und einen anderen Menschen töten würde sie natürlich auch nicht. Aber dieses Datum. Dieses verdammte Datum. Zufall natürlich.
Vermutlich war es die Diskrepanz zwischen dem Auftreten der Bettlerin und ihren Worten, die Norah so irritierte. Die Frau hatte nicht geisteskrank gewirkt – sondern klar und kontrolliert. Das war ihr so noch nicht untergekommen, das war interessant. Vielleicht verbarg sich da eine spannende Geschichte. Sie nahm sich vor, gleich morgen nach der Frau zu suchen und herauszufinden, wer sie war, woher sie kam und was es mit ihr auf sich hatte. Sie war Journalistin, sie konnte mit so etwas umgehen. Und in der Zwischenzeit konnte sie schon mal diesen Mann googeln, von dem die Bettlerin gesprochen hatte.
Arthur Grimm. Konzentriert kniff Norah die Augen zusammen. Nein, sie kannte niemanden, der so hieß. Und dennoch. Irgendetwas löste dieser Name in ihr aus. Oder kam es ihr nur so vor?
Es dauerte nur den Bruchteil einer Sekunde, dann spuckte die Suchmaschine die Ergebnisse aus. Und Norah starrte auf ein Gesicht, das so schön und gleichzeitig so beunruhigend war, dass es ihr kurz den Atem verschlug.
5
Norah hatte von einer leer gefegten Welt geträumt, auf der es niemanden mehr gab außer ihr, keine Anzeichen von Leben, bis auf einen vorbeiziehenden Vogel hier und da, unerreichbar fern.
Dann waren die Vögel gefallen.
Als sie aufgewacht war in der klammen Kälte ihrer Wohnung, auf dem Rücken liegend und schwer atmend, und die Augen aufgeschlagen hatte, hatte sie festgestellt, dass sich die Zimmerdecke über Nacht herabgesenkt hatte und sich gerade noch einen halben Meter über ihrem Gesicht befand. So kam es ihr jedenfalls vor. Der kalte Regen, der in der Nacht heruntergekommen und bereits wieder versiegt war, hatte den Asphalt dunkel gefärbt und einen Grauschleier über die ganze Stadt gelegt. Alle Konturen wirkten leicht verschwommen, so, als hätten Nässe und Kälte die Substanz der Dinge angegriffen, sie verwässert – schmutzige Aquarelle in Anthrazit und Braun.
Irgendwie hatte sie es aus dem Bett geschafft, hatte sich schlotternd ausgezogen und das Gefühl der Beklemmung anschließend mit einer heißen Dusche vertrieben.
Im Treppenhaus empfing sie der Geruch nach schimmligem Teppich; bei den Briefkästen war sie ihrem Nachbar aus dem Erdgeschoss begegnet, hatte den kleinen, dünnen Mann mit den misstrauischen Augen in dem zerknitterten Gesicht gegrüßt – aber keine Antwort erhalten.
Als sie im Eck-Bistro einkehrte, um sich mit einem Cappuccino für den Tag zu wappnen, war ihr schon wieder wohler.
Am Tisch direkt an der Fensterfront saß ein Trio, bestehend aus drei älteren Damen, beim ersten Kaffee und rauchte. Alle sicher jenseits der fünfundsechzig, abgenutzte Absätze, räudige Pelzmäntel, tiefes Wienerisch. Norah nippte an ihrem Cappuccino, leckte sich den Milchschaum von den Lippen, stierte durch die Scheibe nach draußen und lauschte den bissigen Kommentaren der Dreiergruppe am Fenster, die spitz den Verfall der Welt, der guten Sitten, das Rauchverbot – obgleich es für sie nicht zu gelten schien – und den scheußlichen Modegeschmack der Vorbeigehenden beklagte. Gerade wollte Norah die Kellnerin rufen und zahlen, als eine junge Frau am Fenster vorüberging, die ihre Aufmerksamkeit erregte. Sie hielt den Blick stur nach unten gerichtet, als ließe sich aller Unbill des Lebens entgehen, solange man nichts und niemanden direkt ansah. Ihr dunkelblondes Haar war zu einem Pferdeschwanz gebunden, und sie trug enge Jeans und eine rosafarbene Daunenjacke, die ihre enorme Körperfülle zusätzlich betonte. Sie sah seltsam schön und herzzerreißend traurig aus, und Norah hätte sie gerne porträtiert, wenn ihr dieses Talent gegeben gewesen wäre, ganz klassisch mit Öl auf Leinwand.
»Die Marie!«, rief eine der Damen. »Die habe ich ja seit einer Ewigkeit nicht gesehen!« Die anderen beiden nickten stumm.
Auch das Pärchen, das am Tisch hinter Norah saß, hatte von der jungen Frau Notiz genommen.
»Dass die überhaupt noch durch ihre Haustür passt«, sagte der Mann, und seine Begleiterin kicherte. Norah warf ihnen einen bösen Blick zu, doch die beiden achteten gar nicht auf sie. Spontan musste Norah an ihre Berliner Freundin Coco denken. Nicht, dass die junge Frau ihr ähnlich gesehen hätte, ganz im Gegenteil. Aber auch Coco starrten die Leute hinterher. Und mit diesem Gedanken kamen auch die Gedanken an Berlin und an die Katastrophe, und Norahs Laune war vollends dahin.
Als sie das Café verließ, hatte der Regen wieder eingesetzt. Die Häuser schienen sich schief gegen Wind und Wetter zu stemmen, die Straße, die Norah entlangging, wirkte beinahe feindselig mit ihren noch geschlossenen Geschäften und den herabgelassenen Gittern und den dunkel gekleideten Passanten mit ihren Regenschirmen. Norah blieb stehen, fischte ihr Smartphone aus ihrer Handtasche, öffnete Instagram und machte ein Foto. #winterinwien und #melancholia schrieb sie darunter und klickte auf Posten. Sie hatte ihre Social-Media-Kanäle und ihren Blog in den letzten Monaten ein wenig vernachlässigen müssen, zu sehr hatten die Geschehnisse sie beansprucht – kein Wunder, dass in der Nacht keiner reagiert hatte. Wurde Zeit, dass sie wieder regelmäßiger postete. Diese schöne, einsame Stadt bot Eindrücke genug.
Die U-Bahn-Station roch nach Traurigkeit und Beton. Von irgendwoher erklangen eine schwermütige osteuropäische Melodie, das feuchte Husten eines Obdachlosen und klackernde Absätze geisterhafter Passanten. Norah erwischte ihre Bahn, stand eingekeilt zwischen Fremden. Kopfhörer, gesenkte Blicke. Beschlagene Scheiben, dumpfes Räuspern, die Körper der Menschen um sie herum ganz nah, doch die Abstände zwischen ihnen unüberwindlich. Berlin war auch so gewesen. Auch kalt, auch abweisend und rau – und doch anders als das hier. Die Bahn hielt, die Türen öffneten sich, der Strom der Menschen wogte dem Ausgang entgegen, nahm Norah mit.
Die alte Bettlerin, nach der sie suchte, war weit und breit nicht zu sehen. Überhaupt schien das kalte, klamme Wetter die Bettler für den Moment von den Straßen vertrieben zu haben. Vielleicht hatte Norah später am Tag mehr Glück.
Sie musste einfach noch einmal mit ihr reden. Wahrscheinlich war die Sache mit dem Datum ein Zufall. Wahrscheinlich bildete Norah sich bloß ein, etwas mit dem Namen Arthur Grimm zu verbinden. Aber wahrscheinlich hatte ihr noch nie gereicht.
In der Redaktion fühlte sie sich wie ein Geist, der von den Anwesenden weitestgehend ignoriert wurde. Obwohl sie erst in zwei Wochen ihren offiziellen Einstand geben würde, hatte sie bereits eines der Zweierbüros bezogen, deren Fenster zur Kärntner Straße hinausgingen. Berger hatte sie kurz herumgeführt, um sie allen vorzustellen, und Norah hatte die Kolleginnen und Kollegen als höflich, aber distanziert erlebt. Ihr war das recht, sie hatte sich ihre sozialen Kontakte stets jenseits ihrer Arbeitsstätten gesucht, und abgesehen von ihrem alten Kumpel Werner, den sie noch aus Hamburger Zeiten kannte, fanden sich keine Journalisten unter ihren Freunden. Werner war nicht nur ein exzellenter Reporter, sondern hatte eine Zeit lang sogar noch mehr Drogen genommen als Norah. Kaum zu glauben, dass sie nun beide schon seit zehn Jahren clean waren. Sie hatten beide ihre zweite Chance bekommen. Und sie war entschlossen, sich in dieser Hinsicht nicht mehr auf Abwege führen zu lassen.
Ihr Zweierbüro in Wien teilte sich Norah mit Aylin, einer schweigsamen, drahtigen Frau Mitte vierzig, über deren Schreibtisch Drucke von Palmenstränden und inspirierende Sprüche hingen und die in der Mittagspause zum Yoga entschwand. Der Anti-Werner.
Norah brauchte dringend Koffein. Oder Nikotin. Oder beides. Sie hatte Berger davon überzeugt, dass sich eine Reportage-Reihe über die Wiener Obdachlosenszene lohne. Wie würde sie vorgehen? Norah beschloss wie immer, ihrer Intuition zu folgen – und das, was sie selbst interessierte, mit dem, was die Zeitung wollen würde, in Deckung zu bringen. Zudem würde sie, dank der Vermittlung eines alten Berliner Pressekontaktes, bereits in ein paar Tagen einen berühmten Filmschauspieler interviewen. Ihr neuer Chef war begeistert gewesen, als sie ihm davon erzählt hatte, kaum etwas war so gut für die Auflage wie ein waschechter Hollywoodstar, und auch Norah freute sich auf das Gespräch, obwohl der besagte Schauspieler als ausgesprochen schwierig galt. Es konnte nicht schaden, auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Norah war eine exzellente Interviewerin, die sich hervorragend auf ihre Gesprächspartner einzustellen vermochte. Sie begriff instinktiv, was es brauchte, damit sie sich öffneten. Ob sie provozieren oder schmeicheln oder sich aggressiv zeigen musste. Vor allem aber hatte sie früh begriffen, dass auch ein Interview – wie vielleicht alles im Leben – den Ausgleich brauchte. Dass auch sie etwas anbieten musste, um etwas zurückzuerhalten. Und so gab sie, wohldosiert natürlich, bei jedem Interview auch etwas von sich preis. Dem amerikanischen Popstar, der sie im Kempinski empfangen hatte, hatte sie das missglückte Tattoo auf ihrer Hüfte gezeigt, was für großes Gelächter gesorgt hatte. Dem neurotischen französischen Regisseur hatte sie von einem ihrer wiederkehrenden Alpträume erzählt. Und sie wusste sehr wohl, wie sie diesen Schauspieler dazu bringen würde, sich mit ihr zu identifizieren, ihr zu vertrauen. Lächelnd und in Gedanken versunken betrat sie die Büroküche.
Mario, der sie entfernt an Sandras Bruder erinnerte, und Anita, eine knabenhafte Frau mit platinblondem kurzem Haar, die aus der Steiermark stammte und die sie sofort gemocht hatte, wandten sich zu ihr um. Anita beklagte sich gerade bei Mario darüber, dass der Chef ausgerechnet sie darauf angesetzt hatte, den neuen Intendanten des Burgtheaters für ein Exklusivinterview zu gewinnen – und zwar nur, weil sie mit dessen Nichte befreundet war. Als ob das etwas nützen würde, der Mann gab doch grundsätzlich keine Interviews. Norah, die das Gespräch der beiden nicht stören wollte, nickte den Kollegen nur stumm zu – und hing ihren eigenen Gedanken nach, während sie sich an der Espressomaschine zu schaffen machte. Schade, dass sie Sandra nicht hatte erreichen können, zu gerne hätte sie ihr von ihrem kommenden Interviewpartner erzählt – ihre Freundin hatte jeden seiner Filme gesehen. Es war logisch, mit welchem Detail aus ihrem eigenen Leben sie ihn für sich einnehmen würde. Sie würde ihm, wenn es sich irgendwie ergab, von dem Stalker erzählen, der ihr eine Weile nachgestellt hatte und den sie erst losgeworden war, als sie damals nach Berlin gezogen war. Denn es war allgemein bekannt, dass ihr Interviewpartner seit Jahren von einer Stalkerin verfolgt wurde. Das war eine gute gemeinsame Basis. Norah würde das Gespräch völlig unverfänglich beginnen und Fragen zum aktuellen Film stellen, zu dessen Vermarktung ihr Gegenüber derzeit in Europa unterwegs war, und dann würde sie ganz vorsichtig –
»Arthur Grimm«, sagte Anita gerade. »Aber so ganz genau weiß das, glaube ich, keiner.«
Norah hielt in der Bewegung inne. Hatte sie das eben wirklich gehört? Langsam drehte sie sich um und schaute zu Anita, die gerade ihren Teebeutel aus der Tasse angelte und in den Mülleimer fallen ließ.
Norah musste sich verhört haben, solche Zufälle gab es nicht.
»Brauchst du Hilfe mit der Maschine?«, fragte Mario, und Norah wurde klar, dass sie instinktiv in der Bewegung erstarrt war.
Sie räusperte sich, drückte die An-Taste des Geräts, das gurgelnd und zischend zum Leben erwachte wie ein steinaltes Fabelwesen.
Kurz flammte ein Gedanke in ihrem Hirn auf. Ob die ganze Geschichte mit der Bettlerin ein elaborierter Scherz ihrer neuen Kollegen gewesen war, den sie nun in der Redaktion fortführten? Unsinn, dachte sie. So was macht doch keiner.
»Nein«, sagte sie leichthin. »Danke. Ich komme klar.«
ÜBER DIE FRAU
Meine schönste Kindheitserinnerung ist kein Campingausflug im Sommer und auch kein Weihnachtsfest, sondern ein Boxkampf. Mein Vater hatte mich mitgenommen, was damals ungewöhnlich war. Wir saßen direkt am Ring. Als Fleisch auf Fleisch traf, konnte ich das Geräusch hören, das es machte. Es roch nach Blut und nach Adrenalin, und jedes Mal, wenn ein Boxhandschuh auf Schädelknochen prallte, konnte ich sehen, wie Schweiß und Speichel in feinen Spritzern durch die Luft tanzten – wie Staubpartikel im Licht. Es ging um keine Meisterschaft oder dergleichen, und ich könnte nicht mehr mit Sicherheit sagen, welcher Gewichtsklasse die Boxer angehörten, aber für mich waren sie beide Riesen, und sie schenkten sich nichts.
Keiner von beiden schlug den anderen k.o., obwohl ich das sehr gehofft hatte – schlicht, weil ich das gerne mal gesehen hätte: wie so ein Riese zu Boden kracht wie ein gefällter Baum. Der Kampf ging über die volle Distanz und endete unentschieden, was mich irgendwie enttäuschte, obwohl ich mir bis zu diesem Punkt nicht darüber im Klaren gewesen war, welchem der beiden Kämpfer ich den Sieg gegönnt hätte. Vermutlich kam es mir schlicht unbefriedigend vor, dass etwas so Dramatisches wie dieser Kampf in etwas so Banalem wie einem Unentschieden enden konnte. Als mein Vater mir Tage später erzählte, dass einer der Boxer nach dem Kampf gestorben war, war ich fasziniert. In gewisser Weise, denke ich, war dieser Abend meine erste Begegnung mit dem Tod.
Aus irgendeinem Grund musste ich an diesen Abend denken, als ich sie zum ersten Mal sah. Unmöglich zu ergründen, warum. Ich werde nie verstehen, wie mein Gehirn auf die Assoziationen kommt, die es minütlich in schweren Salven auf mich abfeuert. Ich nehme alles, wie es ist.
Neulich ist sie in eine Bar gegangen, und ich bin ihr zwar nicht gefolgt, habe sie aber doch eine Weile beobachtet. Sie saß da, alleine, trank ein klares Getränk aus einem Glas mit dickem Boden, steckte sich eine Zigarette an, rollte mit den Augen, als der Kellner sie auf das Rauchverbot hinwies, drückte sie in dem Silberpapier aus, das sie aus der Packung riss. Bald darauf kam ein Mann an ihren Tisch, groß, kurze, dunkle Haare, Jeans-Hose, weißes Hemd – ich sah ihn nur im Profil. Natürlich konnte ich nicht hören, was er zu ihr sagte und was sie antwortete, der ganze Austausch dauerte lediglich ein paar Sekunden. Aber der Mann lächelte, als er an ihren Tisch trat, und er lächelte nicht mehr, als er ihn wieder verließ. Vielleicht sollte ich die Arroganz bewundern, mit der Frauen wie sie durchs Leben gehen. Aber es will mir einfach nicht gelingen.
Meiner Erfahrung nach gibt es Frauen, denen du beikommst, indem du ihnen schmeichelst, und Frauen, denen du beikommst, indem du sie beleidigst. Ich bin sicher, dass sie einem in beiden Fällen nur ins Gesicht lachen würde.
Ich habe lange darüber nachgedacht, was mich an ihr interessiert. Sie sieht fragil aus, aber sie bewegt sich, als gehörte ihr die Welt. Den einen Tag raucht sie Kette, den nächsten sehe ich sie joggen gehen. Sie hat etwas Zartes, beinahe Mädchenhaftes, und gleichzeitig spürt man sofort, dass man sich nicht mit ihr anlegen sollte. Sie ist auf seltsame Art und Weise schön, aber die Tatsache, dass sie selten lächelt, niemals den Kopf neigt, ständig unterbricht, dass sie zynisch ist und aggressiv, stößt mich ab.
Da ist etwas unbestreitbar Dunkles an ihr. Und etwas Verletzliches. Und das interessiert mich. Genau da will ich hin.
6
Klirrende Kälte, ein makellos blauer Himmel, im Osten eine kraftlose Sonne, von deren Strahlen noch keinerlei Wärme ausging. Geschäftsleute und Jogger, die der Kälte trotzten. Radfahrer, die Gesichter mit Schals vermummt.
Während sie, die Schultern hochgezogen, zur Arbeit ging, und der kalte Ostwind ihr um die Ohren pfiff, dachte Norah unwillkürlich an die Menschen, die bei diesem Wetter auf der Straße lebten. Sie hatte entschieden, dass sie ihre Serie über die Wiener Obdachlosenszene anhand von vier oder fünf besonders spannenden Schicksalen aufziehen würde. Das Ganze sollte jedoch kein reiner Reportage-Stil werden, sondern den Leserinnen und Lesern auch Informationen darüber vermitteln, wie sie am effektivsten helfen konnten. In den vergangenen zwei Tagen hatte sie sich regelrecht in diese Sache verbissen und gearbeitet wie eine Besessene. Nur diese Bettlerin hatte sie nicht auftreiben können. Es war wie verhext.
Obwohl es noch so früh und zudem bitterkalt war, befand das Mädchen mit dem Schäferhund sich bereits vor Ort. Norah holte einen Zwanziger aus ihrem Portemonnaie und legte ihn ihr in den Hut. Die Kleine ließ ihn sofort in der Tasche ihres Parkas verschwinden, als hätte sie Angst, Norah könnte es sich anders überlegen.
»Ich suche jemanden«, sagte Norah und ging in die Hocke. »Die Frau, die vor ein paar Tagen dort drüben stand mit ihrer Schale. Eine große Frau, bestimmt einen Meter und fünfundachtzig. Schon etwas älter. Dunkler Zopf, sehr, sehr helle Augen. Irgendwie unheimlich. Kennst du sie?«
»Glaub nicht.«
»Sie stand genau dort.«
Norah deutete mit dem Kinn auf die Stelle.
»Sie trug Schwarz«, fügte sie hinzu.
Schulterzucken.
Norah sah das Mädchen prüfend an. Wie konnte man hier den ganzen Tag sitzen und diese Frau nicht wahrnehmen? Norah richtete sich auf, wandte sich zum Gehen, hielt dann noch einmal inne.
»Es ist kalt«, sagte sie. »Und heute Nacht wird es noch kälter. Hast du was, wo du hinkannst?«
Das Mädchen zögerte kurz, nickte dann.
»Sicher?«
Erneutes Nicken.
Norah betrachtete sie prüfend, kramte dann in ihrer Handtasche nach ihrem Notizbuch, schrieb ihre Handynummer auf, riss die Seite heraus und hielt sie dem Mädchen hin.
»Wenn du mal keinen warmen Ort zum Schlafen hast, kannst du mich anrufen. Okay?«
Das Mädchen sah sie stirnrunzelnd an, ohne den Zettel jedoch zu nehmen, sodass Norah ihn schließlich auf ihre Decke legte.
»Und falls du die Frau sehen solltest oder jemanden auftreiben kannst, der sie kennt, dann lass es mich wissen. Ich muss sie dringend sprechen und würde mich das etwas kosten lassen. Okay?«
Dieses Mal antwortete das Mädchen.
»Okay.«
Als Norah davonging, meinte sie, einen stechenden Blick im Rücken zu spüren, doch als sie sich umwandte, kramte das Mädchen gerade konzentriert in einer Plastiktüte. Auch sonst konnte sie nichts Auffälliges entdecken. Und dennoch folgte ihr das Gefühl, beobachtet zu werden, bis sich die Türen des Bürogebäudes hinter ihr schlossen.
Am frühen Nachmittag verließ sie die Redaktion wieder, zum einen, weil sie hungrig war, und zum anderen, weil sie ein paar Bankgeschäfte zu erledigen hatte. Sie holte sich eine Portion scharfe Reisnudeln, aß im Gehen.
Das Essen brannte noch in ihrem Mund, als sie sich einfach am Schalter anstellte. Einen Termin hatte sie nicht vereinbart. Das klinisch-seriös wirkende Foyer der Bank war beinahe leer, ein Mann und eine Frau standen hinter den Schaltern, die Frau war mittleren Alters, der Mann – relativ klein, von zierlichem Körperbau, sodass er in seinem biederen Anzug wohl noch kurz vorm Rentenalter wie ein Konfirmand wirken würde – deutlich jünger. Vielleicht Ende zwanzig. Vor jedem Schalter warteten noch zwei Personen, und Norah stellte sich bei dem Jüngling an, der gerade einen weißhaarigen Herrn im karierten Anzug bediente. Der Herr bedankte sich höflich, wandte sich zum Gehen – und warf der Frau, die nun an der Reihe war, einen irritierten Blick zu. Auch der Knabe am Schalter schien mit Verwirrung auf die Dame zu reagieren, und so sah Norah sie sich genauer an. Hochgewachsen, die schlanken Beine in engen Jeans, langes schwarzes Haar, das über einen schicken, dunkelblauen Mantel fiel. Erst, als die Kundin am Schalter ihr Anliegen äußerte, und Norah ihre tiefe Stimme vernahm, wurde ihr klar, was die beiden Herren so irritierte. Die Dame war transsexuell. Verärgert sah Norah dem gaffenden Mann nach, der sich nun durch das Foyer entfernte. Ihre Freundin Coco kam ihr in den Sinn und der Spaziergang, den sie zuletzt miteinander unternommen hatten. Norah hatte sie zu einem nachmittäglichen Stadtbummel überredet, obwohl Cocos Gesicht übel zugerichtet war, und es bald bitter bereut, als sie feststellte, wie die Menschen ihre Freundin anstarrten.
Mit dem festen Vorsatz, Coco am Abend anzurufen, um zu hören, wie es ihr ging, kehrte sie ins Hier und Jetzt zurück und hörte, wie der Mitarbeiter am Schalter irgendwelche Kontounterlagen von der Kundin verlangte. Norah stellte irritiert fest, dass er dabei plötzlich viel lauter sprach als zuvor, ein bisschen so, als hätte er es mit einer Schwerhörigen zu tun.
»Herr Gruber«, las er laut von den Unterlagen ab.
Die Kundin entgegnete etwas, das Norah nicht verstand.
»Na, Sie müssen schon verzeihen«, antwortete der Mitarbeiter, immer noch betont laut, »aber hier steht eindeutig Herr, oder?«
Norahs Zahn fing an zu pochen.
Der Mann sah beifallheischend zu seiner Kollegin hinüber. Die unterdrückte ein Grinsen. Norah wurde heiß. Sie konnte nicht hören, was danach gesprochen wurde, aber angesichts der Körperhaltung der Kundin, die immer kleiner zu werden schien, ahnte sie, was vor sich ging. Nach und nach schnappte sie weitere Gesprächsfetzen auf und stellte fest, dass der Mann umfassende Belege von der Frau verlangte, obgleich die nur ein schlichtes Girokonto anlegen wollte.
»Dann kann ich Ihnen da leider nicht weiterhelfen, Herr Gruber«, sagte der Mitarbeiter nun erneut betont laut und mit ausgestellter, falscher Zuvorkommenheit.
Zorn wallte in Norah auf. Nach allem, was in Berlin geschehen war, war er ohnehin ihr ständiger Begleiter, stets bereit, sie aus irgendeiner Ecke heraus anzuspringen. Warum waren die Leute nur so verdammt boshaft?
Die Kundin stand noch einen Augenblick lang so da, dann drehte sie sich um. Geschlagen.
»Schönen Tag noch, der Herr«, rief der Mann hinter dem Schalter der Frau auf dem Weg nach draußen grinsend nach, während diese gesenkten Hauptes und ohne noch einmal aufzublicken, die Filiale verließ.
»Pervers«, setzte der Mann hinter dem Tresen hinzu, fing den Blick seiner Kollegin auf.
»Ja, oder etwa nicht?«, fragte er, als diese nicht reagierte. »Ganz ehrlich, wenn ich so was sehe, möchte ich speien.«
Die Kollegin lächelte unverbindlich, der Mann, den sie gerade bediente, schnaubte belustigt Zustimmung, doch niemand sagte etwas. Norah blickte der Frau noch einen Augenblick lang nach, sie konnte sie durch die gläsernen Türen immer noch sehen, wie sie die Straße überquerte und davonging. So fragil, trotz ihres Körperbaus.
»Bitt schön?«, hörte Norah die schnarrende Stimme des Jünglings und wandte sich um.
»Grüß Gott«, sagte sie laut, schaute sich dabei noch einmal nach der Frau um. Sie war verschwunden.
»Grüß Gott«, antwortete der Jüngling, bemerkte Norahs Blick, missdeutete ihn.
»Ist das nicht verrückt, was heute so alles frei herumlaufen darf?«, fragte er und sah Norah mit einem dummen Grinsen und einem Ausdruck im Gesicht an, der irgendwo zwischen Zustimmung heischend und verschwörerisch lag.
Norah lächelte, beugte sich ein wenig vor, senkte die Stimme. Der Mann grinste zurück, neigte sich ihr entgegen. Da war, wie Norah jetzt sah, millimeterdicker Zahnstein auf seinen Zähnen, sie konnte ihn beinahe riechen.
»Ein Auftragsmord kostet rund 20000 Euro«, sagte Norah. »Dass man für zwei- oder dreitausend Euro einen Mord kaufen kann, ist eine moderne Legende. Ich habe das recherchiert. 20000 kostet das schon.«
Der Mann hinter dem Tresen blinzelte.
»Wie bitte?«, sagte er.
»Ich will ehrlich sein«, fuhr Norah fort. »So viel Geld habe ich nicht.«
Sie strich sich die Haare aus der Stirn.
»Aber ein Schuss in die Kniescheibe ist schon für 3500 Euro zu haben. Das halte ich für erschwinglich.«
Der Jüngling starrte sie an.
»Eigentlich wollte ich für das Geld im November auf die Seychellen«, sagte sie.
Eine Pause entstand, während der Mann das Gesagte verarbeitete.
»Sagen Sie mal, spinnen Sie?«, brachte er schließlich hervor.
Norah ließ einen Moment vergehen, ehe sie antwortete.
»Jetzt hör mir mal gut zu, du Arschloch«, sagte sie leise. »Es interessiert mich nicht, warum du so bist, wie du bist. Mir ist egal, ob du eine schlimme Kindheit hattest oder ob du Komplexe hast, weil du einen mikroskopisch kleinen Schniedel besitzt – wovon ich, ehrlich gesagt, überzeugt bin. Das ist mir egal. Wenn ich noch einmal sehe, dass du diese Dame da gerade oder irgendwen sonst so behandelst, dann suche ich mir einen Andrej oder einen Giancarlo oder einen Ditmir oder wie diese zuverlässigen Albaner auch immer heißen, und du gehst in Zukunft – wenn überhaupt – auf Krücken.«
Norah schenkte dem Mann ein strahlendes Lächeln, das ihn nur noch mehr zu verwirren schien.
»Alles klar?«, fragte sie.
»Das ist ein Scherz«, sagte der Mann, lachte auf – was vollkommen falsch klang, das merkte er selbst. Er verzog das Gesicht.
»Bist du sicher?«, fragte Norah ernst.
Der Mann schwieg.
Norah betrachtete ihn genauer. Die verblichenen Aknenarben auf seiner blassen Gesichtshaut, das gegelte Haar, die gelblichen Zähne. Eine Weile noch hielt er stand, dann wendete er den Blick ab.
Norah nickte.
Dachte ich mir.
Sie spürte, wie die Frau am Schalter nebenan, die ihren letzten Kunden bedient und aktuell nichts mehr zu tun hatte, zu ihnen herübersah.
»Dann muss ich es bei einem anderen Kreditinstitut versuchen«, sagte Norah laut und drehte sich auf dem Absatz um. »Trotzdem danke!«
Bevor sie das Foyer verließ, warf sie noch einen Blick über die Schulter.
»Ich schätze, die Seychellen sind ohnehin überbewertet.«
7
»Weißt du, wie wir so etwas vor Gericht nennen?«, fragte Sandra später, als Norah ihrer besten Freundin diese Episode am Telefon erzählte.
»Du wirst es mir bestimmt gleich sagen.«
»Mangelnde Impulskontrolle.«
Norah verdrehte die Augen.
»Der Typ war ein Mistkerl. Du hättest sehen sollen, wie er die Frau behandelt hat.«
»Das verstehe ich ja«, sagte Sandra. »Trotzdem kannst du nicht andauernd solche Sachen machen, Norah.«
»Was heißt hier andauernd?«
Sandra seufzte resigniert, und Norah fragte sich, ob ihre Mandanten das auch hin und wieder zu hören bekamen oder ob dieses Seufzen für renitente Freundinnen vorbehalten war. Wobei Sandra aktuell in Mutterschutz war und ohnehin erst in einem halben Jahr in die Berliner Kanzlei, in der sie seit fünf Jahren arbeitete, zurückkehren würde.
»Irgendwann gerätst du an den Falschen«, sagte Sandra. »Und kriegst so richtig Probleme.«
»Habe ich die nicht längst?«, fragte Norah.
»Es gibt Schlimmeres im Leben als Verleumdungsklagen.«
Cocos zerstörtes Gesicht tauchte vor Norahs innerem Auge auf.
»Ich weiß«, sagte sie leise.
»Wie geht’s Coco eigentlich?«, fragte Sandra, als hätte sie Norahs Gedanken gelesen.
»Das weiß ich momentan gar nicht so genau«, antwortete Norah. »Aber sicher nicht gut.«
Sandra schwieg kurz.
»Pass auf dich auf, okay?«, sagte sie schließlich.
»Du kennst mich doch«, antwortete Norah.
»Eben.«
Abends, allein in ihrer Wohnung, nachdem sie das Telefonat mit Sandra längst beendet und SOS-Nachrichten an Max und Paul und an Tanja versendet hatte, stand Norah am Fenster und sah den Paaren und kleinen Grüppchen von Menschen dabei zu, wie sie den Platz unten überquerten, auf dem Weg zum Essen oder ins Kino oder ins Theater oder sonst wohin. Dann fiel ihr Blick auf die Orchidee, die sie in Berlin gekauft und die nun in Wien ihre neue Heimat gefunden hatte – das einzige lebendige Wesen, das ihr momentan Gesellschaft leistete. Norah sah auf ihr Handy, legte es enttäuscht wieder weg. Keine Nachrichten von Max und Paul, nichts Neues von Tanja. Sie ging in die Küche und öffnete den Kühlschrank, starrte ratlos die frischen Lebensmittel an, die sie gerade eben erst gekauft hatte.
Das Gesicht der Frau in der Bank tauchte vor ihrem inneren Auge auf, noch einmal erlebte sie den Moment, in dem sich ihre Blicke kurz getroffen hatten, und sie dachte an das, was sie in den Augen der Frau gesehen hatte. Und dann dachte sie an das Grinsen des Bankmitarbeiters, an sein verschwörerisches Zwinkern, seine nasale Stimme. Norah schloss die Kühlschranktür, genau in dem Moment, in dem eine vertraute Melodie aus dem Wohnzimmer sie darauf hinwies, dass die Nachrichten begonnen hatten. Müde setzte sie sich vor dem Fernseher auf einen bis zum Rand mit Büchern gefüllten Umzugskarton und ließ zu, dass die Nachrichten auf sie einprasselten wie von einem bösartigen Mob geschleuderte Steine. Krieg, Gier, ertrinkende Menschen, Vergewaltigung, Bodensatz.
Die übliche gedankliche Abwärtsspirale begann, Norah dachte an die Diktatoren und Waffenschieber dieser Welt, und dann dachte sie an den Nachbarsjungen, der in ihre Klasse gegangen war und der im Grundschulalter so heftig von seinem Vater ins Gesicht geschlagen worden war, dass er auf dem rechten Auge erblindete. Sie dachte an die Freundin aus Schulzeiten, die, nachdem ihr irgendwer irgendwas in den Drink gekippt hatte, an einem Sonntagmorgen halbnackt und blutend auf einem Autobahnparkplatz erwacht war. Sie dachte an den Konzeptkünstler, der Menschen – bevorzugt labile junge Frauen – mit dem Skalpell verstümmelte und das Kunst nannte. Sie dachte an die Chefin eines Waffenkonzerns, die sie einst auf einer Wohltätigkeitsveranstaltung kennengelernt hatte, auf der »die Philanthropin« sich feiern ließ, während ihre Waffen anderswo das Grauen brachten. Sie dachte an die Banker in ihren Glastürmen und an den Hunger und an den Durst, an die Bomben und an das Feuer, und –
Norah schrak hoch. An ihrer Tür hatte es geklingelt.
»Hi Norah«, sagte die blonde junge Frau fröhlich, als Norah öffnete.
»Hi.«
Es war die Nachbarin von oben. Norah rang sich ein Lächeln ab. Eine Pause entstand. »Gibt es etwas?«, fragte sie schließlich. Sie merkte selbst, wie unfreundlich das klang.
»Nicht wirklich. Eigentlich wollte ich nur Hallo sagen.«
Es dauerte einen Moment, bis Norah begriff, dass Theresa erwartete, hereingebeten zu werden.
»Sorry«, sagte sie. »Ich bin wirklich unhöflich. Möchten Sie vielleicht einen Moment hereinkommen?«
Theresa lächelte und folgte Norah ins Wohnzimmer.
»Mögen Sie was trinken?«
»Gern.«
»Okay. Ich habe leider nur Leitungswasser. Und Weißwein.«
»Leitungswasser ist super.«
Norah ging in die Küche, füllte zwei Gläser und kehrte damit ins Wohnzimmer zurück.
»Wie gefällt dir Wien?«, fragte Theresa und nahm einen Schluck. »Wir können uns doch duzen, oder?«