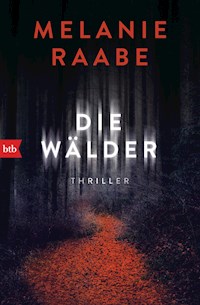10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Gibt es das, eine Seelenverwandtschaft zwischen bislang Unbekannten? Ist es manchmal leichter, mit einer Fremden zu sprechen als mit den Menschen, die man schon lange kennt und liebt? Als die junge Fotografin Nico zufällig zwischen den Jahren der Schauspielerin Ellen Kirsch auf den nächtlichen, winterlichen Straßen Berlins begegnet, fühlt sie fast unmittelbar eine unheimliche Nähe, die sie sich nicht erklären kann. Was haben sie schon gemeinsam, der inzwischen weltberühmte Hollywoodstar und die noch um Anerkennung ringende Fotografin? Was sieht Ellen in ihr, was sie selbst nicht erkennen kann? Vor allem aber: Warum schert sich Nico darum, dass Ellen eines Tages einfach wieder aus ihrem Leben verschwindet? Und zwar so plötzlich, wie sie gekommen ist? Als Nico endlich begreift, warum sie nicht loslassen kann, macht sie sich auf die Suche – nicht nur nach Ellen, sondern auch nach ihrer Mutter und ihrer eigenen Geschichte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 490
Ähnliche
Zum Buch
Gibt es das, eine Seelenverwandtschaft zwischen bislang Unbekannten? Ist es manchmal leichter, mit einer Fremden zu sprechen als mit den Menschen, die man schon lange kennt und liebt? Als die junge Fotografin Nico zufällig zwischen den Jahren der Schauspielerin Ellen Kirsch auf den nächtlichen, winterlichen Straßen Berlins begegnet, fühlt sie fast unmittelbar eine unheimliche Nähe, die sie sich nicht erklären kann. Was haben sie schon gemeinsam, der inzwischen weltberühmte Hollywoodstar und die noch um Anerkennung ringende Fotografin? Was sieht Ellen in ihr, was sie selbst nicht erkennen kann? Vor allem aber: Warum schert sich Nico darum, dass Ellen eines Tages einfach wieder aus ihrem Leben verschwindet? Und zwar so plötzlich, wie sie gekommen ist? Als Nico endlich begreift, warum sie nicht loslassen kann, macht sie sich auf die Suche – nicht nur nach Ellen, sondern auch nach ihrer Mutter und ihrer eigenen Geschichte.
Zur Autorin
Melanie Raabe wurde 1981 in Jena geboren. Nach dem Studium arbeitete sie tagsüber als Journalistin – und schrieb nachts heimlich Bücher. 2015 erschien DIEFALLE, 2016 folgte DIEWAHRHEIT, 2018 dann DERSCHATTEN und 2019 DIEWÄLDER. Ihre Romane werden in über 20 Ländern veröffentlicht, mehrere Verfilmungen sind in Arbeit. Melanie Raabe betreibt zudem gemeinsam mit der Künstlerin Laura Kampf einen erfolgreichen wöchentlichen Podcast rund um das Thema Kreativität, »Raabe & Kampf«. Melanie Raabe lebt und arbeitet in Köln.
Melanie Raabe
Die Kunst des Verschwindens
ROMAN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Originalausgabe Oktober 2022
Copyright © 2022 by btb Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestaltung: Sabine Kwauka
Covermotiv: © Juca Maximo
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-27745-1V003
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/btbverlag
Not knowing when the dawn will come I open every door.
Emily Dickinson
1 ELLEN
Ich höre sie, die Geräusche meines Waldes, das Krachen der Äste und das Rauschen der Blätter, das Raunen der Wurzeln und das Gekicher der Gräser, die leisen Laute der schlafenden Blumen. Die Würmer und Käfer, das Geraschel meiner Freundinnen, der Mäuse, die Rufe der Vögel, die Füchse, die Rehe, die Hasen. Die Kreuzspinnen, die Pilze, die Erde. Und meine Elfen. Ich sehe den Zauber, den sie in die Luft weben, wie gesponnenes Silber. Es ist Mittsommer, so viel weiß ich noch, und ich bin die Königin hier.
Ich liege auf dem Boden, auf meinem Bett aus Moos, bin erwacht aus langem Schlaf, träumte von einem Reh, ruhig und schön, mit zierlichem Geweih, und ich versuche, das Bild festzuhalten, doch es entgleitet mir, und ich reibe mir den Schlaf aus den Augen. Ich erhebe mich, und meine Elfen streichen mir mit kühlen Fingern über die Wangen und fahren mir durch das Haar, von irgendwoher ruft mein Käuzchen, und ich frage nach meinem König, und sie springen kichernd davon.
Etwas bricht durch meinen Wald, ich höre ein Splittern und Krachen, und ich erkenne die Schritte von Menschenkindern, so angstvoll und schwer, und ich erinnere mich. Mittsommer, oh ja, oh ja.
Der Wald wispert, die Menschenkinder sind blind vor Furcht und Raserei. Die Elfen lachen leise, und da ist etwas Dunkles in ihrem Gelächter, eine Grausamkeit, die ich von ihnen nicht kenne, die sie sich in jeder anderen Nacht nicht anmerken ließen.
Dann beginnen sie zu tanzen, eine nach der anderen, nach einer Musik, die ich nicht hören, in einem Rhythmus, den ich nicht fühlen kann, und der ganze Wald tanzt mit ihnen, nur ich stehe hier, angstvoll und schwindelig und allein. Wo nur ist mein König?
Ich richte mich auf. Ich lasse mir die Nacht durch die Finger rinnen. Da ist ein Raunen in meinem Nacken, und mit einem Mal fühle ich es auch, die Sommernacht dringt in meine Poren, färbt alles um mich herum rot. Die Nacht brennt lichterloh. Ich wehre mich dagegen, gegen den Rausch, das Vergessen, die Raserei, den Todestaumel, der meine zarten Elfen befallen hat, einen Moment nur. Dann begreife auch ich, was mit ihnen vorgeht. Es ist nicht der Tod, der sie tanzen macht, sie verwandeln sich. Und ich begreife, dass ich mit ihnen tanzen muss, dass auch ich meine endgültige Form noch nicht angenommen habe, dass auch ich noch ein Stück weiter muss in dieser Nacht, noch ein bisschen, nur noch ein wenig. Ich stolpere auf sie zu, meine Schwestern, die in wildem Tanz verbunden sind, Schwestern, der Sommer ist hier.
Ich hebe die Arme zum Himmel, und wir tanzen, tanzen, und ich verstehe, dass ich ein Teil von ihnen bin wie sie ein Teil von mir. Ich verstehe, dass der Wald ein Teil von mir ist wie ich von ihm. Ich verstehe, dass die Tiere ein Teil von mir sind wie ich von ihnen, und ich spüre, dass ich mich verwandele. Ich selbst bin das Reh aus meinem Traum, und ich spüre, wie mein Körper sich transformiert, wie er schmaler wird und stärker, mehr Wald, mehr ich, ich spüre die Spitzen meines zierlichen kleinen Geweihs schmerzhaft unter meiner Haut, ich spüre, dass sie meine Kopfhaut durchstoßen und meine Verwandlung komplett machen werden, wenn ich es nur zulasse, und ich lasse es zu. Und ich wende den Kopf, und da ist mein König, und ich gehe auf ihn zu, und ich lächle. Verwundert, schmerzvoll.
Mein Oberon. Was für ein Traum, mein Lieber.
Als der Vorhang fällt und sich wieder hebt, sehe ich nichts als Bewegung und Licht. Das Publikum im Saal tobt wie zuvor Hermia und Lysander und Helena und Demetrius auf der Bühne. Der Zuschauerraum ist ein Schlund. Der plötzliche Lärm ist so gewaltig, dass ich kurz versucht bin, mir die Hände auf die Ohren zu pressen, es braust und tost, aber ich beherrsche mich. Ich blinzle gegen das Scheinwerferlicht an, ich lächle, ich nicke den anderen zu, dann trete ich an die Rampe. Das Publikum fängt an zu rasen, der Lärm steigert sich ins Unermessliche. Eine ältere Dame in der zweiten Reihe tupft sich mit einem Stofftaschentuch die Augen, ein junger Mann schluchzt völlig hemmungslos, aber die meisten stehen einfach nur da, mit strahlenden Gesichtern, und klatschen und rufen. Und ich habe mich endlich aus dem Kokon gelöst, den der Sommernachtstraum um mich gesponnen hat, und die Energie des Publikums trifft mich mit voller Wucht, heiß und archaisch und gleißend hell, und die Freude, die ich plötzlich empfinde, ist so allumfassend, dass es mir die Tränen in die Augen treibt. Ich trete beiseite, überlasse den anderen das Rampenlicht, und das Publikum applaudiert weiter, doch als die Reihe wieder an mir ist, beginnt es erneut zu rasen, und ich weiß, dass sie es auch gespürt haben, auch wenn ihnen vielleicht gar nicht bewusst ist, was sie da gesehen haben, denn das hier war echt, das hier war eine tatsächliche Mittsommernacht, schrecklich und rauschhaft und schön. Erneut verbeuge ich mich, so tief ich kann, und als ich wieder hochkomme, spüre ich, wie mir etwas den Hinterkopf hinabrinnt, und obwohl ich nassgeschwitzt bin wie alle auf dieser Bühne, weiß ich doch sofort, dass das hier kein Schweiß ist. Ich verbiete mir hinzufassen, muss mich regelrecht dazu zwingen. Stattdessen nehme ich die Hände meiner Mitspielerinnen, und gemeinsam treten wir ein letztes Mal an die Rampe.
Auf dem Weg von der Bühne treffe ich immer wieder auf Leute aus der Crew, die mich drücken und mir gratulieren wollen, und ich verteile Küsse und Umarmungen und bedanke mich und gebe die Komplimente zurück, bis es mir gelingt, in meine Garderobe zu schlüpfen und die Tür hinter mir zuzuziehen. Der Geruch, der in meiner Garderobe herrscht, ist so schwer, dass er mir fast den Atem raubt. Er geht von den zahllosen Blumen aus, die in vielleicht zwanzig, vielleicht dreißig riesigen Bouquets auf dem Boden stehen, versehen mit Glückwunschkarten zur Dernière, zu meiner letzten New Yorker Aufführung. Die meisten enthalten langstielige rote Rosen mit Blüten, so groß wie meine Fäuste, aber da sind auch einige riesige Vasen mit weißen Lilien. Sie sind es, von denen der schwere, süße Geruch ausgeht. Ich bahne mir den Weg zu meinem Schminkspiegel, vorsichtig, um keines der Blumenarrangements umzustoßen, die einer der guten Geister des Theaters für mich entgegengenommen und ins Wasser gestellt hat.
Ich setze mich auf den Stuhl vor meinem beleuchteten Schminkspiegel und schaue mir ins Gesicht. Ich sehe so weit normal aus, das ist gut. Ich betaste meinen Nacken, und als ich meine Finger betrachte, sehe ich das Blut, und obwohl ich wusste, dass es da sein würde, ist sein Anblick ein kleiner Schock. Ich wische mir mit einem Kosmetiktuch den Nacken ab, dann betaste ich vorsichtig, ganz vorsichtig, meinen Kopf. Zucke zusammen, als ich die zwei kleinen Wunden berühre, die ich unter meinem Haar ertasten kann, ziehe meine Hand zurück. Es ist okay, sage ich leise, es ist okay, alles okay. Ich versuche, tief durchzuatmen. Sage mir, dass ich immer noch ich bin, dass das nicht so schlimm ist, dass das zu mir gehört, dass ich lediglich lernen muss, mich besser zu kontrollieren. Ich schließe die Augen und fasse noch einmal hin. Dieses Mal halte ich es aus, ziehe meine Hand nicht wieder zurück, sondern betaste sie vorsichtig, die beiden kleinen Erhebungen unter meiner Kopfhaut, deren Spitzen sie bereits durchstoßen haben. Ich erinnere mich an diese Empfindung. Ich erinnere mich daran, wie es war, empfindliches Zahnfleisch da, wo einst Milchzähne waren, mit der Zunge zu betasten und eines Tages die Spitze eines bleibenden Zahnes zu fühlen, die durchbrach. Ich erinnere mich daran, wie seltsam sich das anfühlte, wund und wundersam und unvermeidlich. Genau wie das hier.
Kurz drohe ich, in Panik zu geraten, doch ich bekomme mich rechtzeitig wieder in den Griff, stehe auf, wasche mir die Hände in dem kleinen Waschbecken am anderen Ende des Raumes, warte, dass meine Hände aufhören zu zittern, dann wähle ich Anthonys Nummer. Lasse es lange klingeln. Atme auf, als ich seine Stimme höre.
»This is Anthony. Hello?«
»Anthony«, sage ich atemlos. »Ich bin so froh, dass ich dich erreiche. Es ist schon wieder passiert. Ich –«
Irritiert runzele ich die Stirn, als er mich unterbricht.
»Hello?«, sagt er. »Hello? Could you speak up, please?«
»Anthony, hörst du mich?«
Ich höre ihn lachen und begreife, dass ich – nicht zum ersten Mal – auf seine Mailbox hereingefallen bin.
»Just kidding«, sagt er gerade, »this is my voicemail. Leave a message … if you absolutely have to.«
Ich lege das Telefon weg. Natürlich hebt er nicht ab, ich befinde mich in New York, er ist in Berlin, hier ist es halb elf am Abend, bei ihm halb fünf in der Früh. Vermutlich ist es besser so. Bald sehen wir uns ohnehin. Nicht auf einem kalten Bildschirm, sondern von Angesicht zu Angesicht.
Ich wische mir die schwere Theaterschminke aus dem Gesicht, dusche, ziehe mich um, meine schwarzen Smokinghosen, mein schwarzer Kaschmirpullover, meine schwarze Lederjacke, schwarze Boots, ich verabschiede mich von der Crew, setze meine große schwarze Sonnenbrille auf, atme tief durch und stelle mich den Fotografen, die am Hinterausgang auf mich warten. Ein Mann, groß, breit, schwarzer Anzug, von dem ich nur den Rücken sehe, bahnt mir meinen Weg zum Wagen, ein zweiter hält mir einen Regenschirm über den Kopf, öffnet mir die Tür, schließt sie hinter mir – und plötzlich ist da Ruhe.
Noch einmal Zubettgehen in New York, und dann ab nach Hause.
Der Atlantik schimmert golden und blau, und während ich irgendwo zwischen Wachen und Schlafen auf ihn hinabblicke, erinnere ich mich, dass ich vom Wasser geträumt habe letzte Nacht. Dass der Traum mir noch in Fetzen um den Leib hing, als ich unter die Dusche meines Hotelzimmers stieg, in SoHo, wie immer, wenn ich in New York war, und alles, was die Nacht gebracht hatte, fortwusch. Ich sitze ganz hinten im Flieger, allerhinterste Reihe, ganz links. Es ist eine Weile her, dass ich zuletzt Economy geflogen bin, und die junge Produktionsassistentin, die damit betraut war, mir in letzter Minute den nächstbesten Flug nach Berlin zu buchen, wirkte ausgesprochen nervös, als sie mir sagen musste, dass Business und First Class ausgebucht seien. Ob sie mich auf den nächsten Flug buchen solle? Der ginge allerdings erst Stunden später. Alternativ könne ich über Amsterdam fliegen und von dort nach Berlin. Ich winkte ab. Schnellstmöglich nach Berlin, Klasse egal, Airline egal, diese Dinge haben mich noch nie interessiert.
Sie nickte, und ich bedankte mich bei ihr, und hier bin ich nun. Ich hätte irgendwann in den nächsten Wochen ohnehin nach Berlin gemusst für ein paar Meetings und für die Premiere, natürlich. Aber ich reise früher an, um Anthony zu sehen.
Es gibt zwei große Glücksfälle in meinem Leben, und einer davon ist Anthony. Nicht weil er mir gegen alle Widerstände die Hauptrolle in seinem Stück gab, damals, in London, sondern weil er mir fast so etwas wie ein Vater ist. Wenn ich an Anthony denke, dann denke ich nicht an seine Erfolge, sondern ich denke daran, wie er mich in seinem Gästezimmer schlafen lässt, weil er weiß, dass ich mich im Hotel einsam fühle, und wie er abends unglaubliche Gerichte für mich kocht, jeden Tag ein anderes: Risotto mit Tomaten, Rotwein und Chorizo, Hühnchen aus dem Ofen mit Zitronen und grünem Spargel, persischen Reis mit Safran und Granatapfelkernen und die weltbeste Pasta Primavera, mitten im Winter. Wenn ich an Anthony denke, dann denke ich daran, wie er in meiner kleinen Wohnung sitzt, die ich mir dann doch gesucht habe, auf seinen Rat hin, nach all den Hotelzimmern, und so tut, als schmeckten ihm die zerkochten Penne alla Norma, die ich für ihn gemacht habe, um mich für die vielen Male zu revanchieren, die er mich bekocht hatte. Ich denke an sein schüchternes Lächeln und an seinen schmutzigen Humor, und ich denke daran, dass er einen Raum voller Menschen unterhalten kann mit seinen Geschichten, aber stets zu schüchtern ist, um bei Premieren auf die Bühne zu gehen und sich mit seinem Ensemble zu verbeugen.
Noch gut fünf Stunden bis nach Berlin, und ich weiß schon jetzt nicht mehr, wohin mit mir. Die Plätze neben mir sind frei. Erneut betaste ich vorsichtig meinen Kopf, doch ich fühle nichts Ungewöhnliches mehr, die zwei kleinen Wunden sind fort, alles ist gut. Ich hole das Buch aus meinem Rucksack, das ich für den Flug eingepackt habe, klappe den kleinen Tisch vor mir herunter, schalte das Leselicht ein und versuche, mich zu konzentrieren. Dann spüre ich, dass jemand mich ansieht, und stelle fest, dass ein kleines Mädchen direkt vor mir auf seinem Sitz kniet und mich mustert.
»Hey«, sage ich leise. »Kannst du auch nicht schlafen?«
Sie schüttelt den Kopf. Auch eine Deutsche also. Sie ist vier oder vielleicht fünf Jahre alt und sieht aus wie ein Kind aus diesen japanischen Anime-Filmen, die Anthony so gerne sieht. Dunkles, halblanges Haar, Pony, große schwarze Augen, rote Apfelbacken, riesiger Mund. Sie strotzt nur so vor Energie, das sieht man gleich, und ich bin froh, dass ich nicht in der Reihe vor ihr sitze, sie ist die Art von Kind, das einem vor lauter Bewegungsdrang auf Langstreckenflügen unermüdlich in den Sitz tritt und dem man noch nicht einmal böse sein kann deswegen.
»Du hast da Blut«, sagt sie.
»Was? Wo?«
Sie reckt sich über ihren Sitz und berührt mich am Hals.
»Oh«, sage ich und beginne, die Stelle zu reiben, sie ist klebrig, ich muss sie beim Waschen übersehen haben. »Das ist nur Farbe.«
Dass mir noch Kunstblut am Hals klebt, erklärt einiges. Zum Beispiel, weshalb eine der Stewardessen mich vorhin so eingehend gemustert hat.
»Ich bin gleich wieder da«, sage ich und verschwinde in Richtung Toilette.
Als ich zurückkehre, sitzt die Kleine auf meinem Platz. Ihre Eltern schlafen eine Reihe vor ihr tief und fest, und da sie zwischen ihnen saß, muss sie – unbemerkt von ihnen und dem Flugpersonal – entweder über ihren Vater oder über den Sitz geklettert sein.
»Mir ist so langweilig«, sagt sie.
»Das kann ich verstehen.«
Ich setze mich neben sie.
»Wie heißt du?«, fragt das Mädchen.
»Ellen, und du?«
»Mia.«
Sie schielt auf die angebrochene Packung Schokokekse, die ich mir am Flughafen gekauft und in das Netz an meinem Vordersitz gesteckt habe.
»Darf ich einen Keks?«
Ich frage mich kurz, ob die Eltern des Kindes mich wohl verklagen werden, wenn ich es hier mit Zucker vollstopfe, aber was soll’s.
»Also, da muss ich aber mal gut überlegen, das sind schließlich Zauberkekse«, sage ich. »Die sind sehr wertvoll.«
Mia schaut mich mit großen Augen an.
»Was machen die denn?«
»Bei jedem was anderes«, sage ich. »Das ist ja das Besondere daran.«
Mia wippt aufgeregt mit den Beinchen, sagt aber nichts.
»In Ordnung«, sage ich schließlich. »Aber nur einen.«
»Okay«, sagt sie glücklich, fummelt die Packung heraus, nimmt sich einen Keks und schiebt ihn sich komplett in den Mund, sodass er ihre linke Wange ausbeult und sie Schwierigkeiten hat, ihn zu zerbeißen.
Sie stößt ein paar Krümel hervor. Und zwei Silben, die so ähnlich wie danke klingen.
»Darf ich noch einen?«, fragt sie, noch bevor sie den ersten aufgegessen hat.
»Vielleicht später«, sage ich, und sie schmollt, aber nur kurz.
»Bist du alleine?«, fragt Mia und gähnt mit so weit offenem Mund, dass sie mich glatt ansteckt.
Ich nicke.
»Und du?«
»Ich darf nicht alleine fliegen, ich bin ein Kind«, antwortet sie nüchtern.
»Natürlich«, sage ich. »Ich verstehe.«
Eine Pause entsteht, während der sie aus dem Fenster sieht, was ihr aber schnell wieder langweilig wird.
»Mir ist so fad!«, sagt sie und wirft sich im Sitz herum.
»Magst du einen Film gucken?«
Sie schüttelt den Kopf.
»Du kannst mir eine Geschichte erzählen.«
»Okay. Lass mich mal überlegen. Es war einmal ein Mädchen. Das lebte ganz alleine in einer riesengroßen Burg. Die Burg hatte tausend verschiedene Zimmer, und jedes sah anders aus. Aber weil das Mädchen komplett alleine in der Burg lebte, war ihm die ganze Zeit über fürchterlich langweilig.«
»Wo sind denn die Eltern von dem Mädchen?«
»Tot«, sage ich spontan und denke sofort, dass ich einen Fehler gemacht habe, doch die Kleine akzeptiert das so.
»Und hat das Mädchen keine Geschwister?«, fragt sie.
»Keine«, sage ich.
»Ich auch nicht«, sagt Mia.
»Ich auch nicht«, sage ich. »Na ja. Und weil dem Mädchen so furchtbar langweilig ist, überlegt es sich eines Tages, dass es seine Burg verlassen muss, um ein paar Freunde zu finden.«
Ich sehe, wie Mia die Augen schließt.
»Doch die Welt da draußen ist voller Gefahren«, sage ich. »Voller Wesen, von denen unsere junge Heldin noch nie gehört hat. Voller geflügelter –«
Doch ehe ich mir einen Namen für unsere »junge Heldin« ausgedacht und mir überlegt habe, was für geflügelte Kreaturen in ihrer Welt durch die Gegend schwirren, ist Mia auch schon eingeschlafen. Wie schnell Kinder aus äußerster Wachsamkeit in tiefen Schlaf hinübergleiten können, fasziniert mich immer wieder.
Als die Kapitänin unser Eintreffen in Berlin ankündigt, sitzt die Kleine längst wieder zwischen ihren Eltern. Ich bin natürlich wie immer erst kurz vor der Landung eingeschlafen, sodass ich nun Schwierigkeiten habe, in die Wirklichkeit zurückzufinden. Anthony, denke ich. Ich besuche Anthony. Es ist früher Morgen in Berlin, als wir aufsetzen, und während die Maschine Richtung Gate rollt, gehe ich in Gedanken meine Pläne für den Tag durch. Die Produktionsfirma hat mir eine Wohnung in Charlottenburg angemietet, ich muss also nicht ins Hotel. Ich kann mir einfach ein Taxi in die Stadt nehmen, mich im eigenen Bett – oder zumindest in etwas, das einem eigenen Bett nahe kommt – ausschlafen und dann zu Fuß zu Anthony rübergehen.
Anthony hatte so tapfer versucht, seine Enttäuschung darüber zu verbergen, dass ich es nicht zu seinem siebzigsten Geburtstag schaffen würde, es hatte mir das Herz gebrochen. Ich war ja selbst am Boden zerstört. Anthony hatte seine Geburtstage stets ignoriert, hatte keine Geschenke und keine Glückwünsche gewollt, hatte sich an diesem einen Tag immer zurückgezogen. Ich hatte stets Termine angenommen, die auf seinen Geburtstag fielen, und das war nie ein Problem gewesen. Bis zu diesem Jahr, in dem er plötzlich entschieden hatte, seinen Siebzigsten groß zu feiern. Ich wusste zunächst gar nicht, wie ich ihm beibringen sollte, dass ich, statt bei ihm zu sein, in New York auf der Bühne stehen würde.
»Soll ich die letzte Aufführung absagen?«, hatte ich ihn schließlich gefragt.
»Niemals! Das verbietet die Schauspielerinnenehre!«
Darauf war mir nichts mehr eingefallen.
»Aber wenn du nach meinem Geburtstag kommst, ist es doch sowieso viel schöner«, tröstete Anthony mich schließlich. »So habe ich dich wenigstens für mich alleine.«
»Kann ich dir was mitbringen?«, fragte ich.
Er überlegte einen Moment.
»Gibt es noch diesen koscheren Bäcker in Williamsburg?«
Obwohl ich mir Sorgen machte, dass die Geburtstagsfeier, die ich verpassen würde, womöglich seine letzte sein würde, obwohl man mir berichtet hatte, wie es um meinen ältesten Freund stand, und obwohl Anthony seit Wochen furchtbar schwach klang, musste ich lachen.
»Du bist der verfressenste Mensch, den ich kenne«, sagte ich.
»Danke«, entgegnete Anthony. »Ich gebe mir Mühe.«
Ich kann es also kaum erwarten, ihn zu sehen. Mal wieder in Ruhe mit ihm zu reden. Ihm alles zu erzählen, was in den letzten Monaten und Wochen passiert ist. Von der Frau, die nach Nelken roch, von ihrem Talisman, vom Tod, von allem. Von meinen großartigen, geheimen, inzwischen gescheiterten Plänen. Ich sehe sein zartes Gesicht vor mir, seine Lachfalten, seine Koboldaugen. Wenn mich jemand zu trösten vermag, dann Anthony.
Ich kann ihn fast hören.
Oh, Ellen. Der liebe Gott lacht über unsere Pläne. Vor allem über die großartigen.
Als das Kabinenpersonal die Türen freigibt, ziehe ich mir meine Baseballkappe tief ins Gesicht, schnappe mir meine Tasche und recke Mia, die mir von ihrem Sitz aus zuschaut, während ihr Vater Rollkoffer aus dem Gepäckfach hievt, meine linke Faust hin. Kurz blinzelt sie mich halb verschlafen an. Dann erkennt sie mich und stößt mit ihrer dagegen.
Ich verlasse die Maschine, und kaum, dass ich den ersten Atemzug getan habe, kaum, dass ich Berliner Boden unter den Füßen habe, spüre ich es. Etwas … stimmt nicht. Ich kann das Gefühl nicht sofort einordnen, sehe mich instinktiv um, in der Annahme, dass ich etwas gesehen habe, das mich irritiert hat, ohne mir dessen in meinem übermüdeten Zustand völlig bewusst geworden zu sein. Aber da ist nur das Flugzeug, aus dem ich gestiegen bin, da ist die Treppe hinter mir, da sind die anderen Passagiere, müde und langsam wie ich, da sind die Busse vor mir, da ist das Terminal, da ist das Flughafenpersonal, da ist der graue Berliner Morgen. Das Gefühl, dass etwas ganz und gar nicht in Ordnung ist, intensiviert sich, als ich auf den Bus zugehe, der uns zum Terminal bringen wird. Instinktiv ziehe ich die Schultern hoch, schlinge die Arme um den Körper. Ist es ein Klang? Nein, da sind nur die ganz normalen Flughafengeräusche. Ich falte mich in einen freien Platz in der hintersten Ecke des Busses und presse mir meine Tasche vor den Oberkörper, als fröre ich. Aber ich friere nicht. Ich bin auch nicht mehr müde, all meine Sinne sind hellwach. Registrieren die zerschundenen Sitze und das Ballett der Tankfahrzeuge und Gepäckwagen, die beschlagenen Fensterscheiben, die verschiedenen Schichten von Motorenlärm, die Turbinen der startenden und landenden Flugzeuge da draußen, das Dröhnen des Busses, die gedämpften Gespräche der anderen Passagiere. Registrieren den Geruch nach Abgasen und Treibstoff, nach ungeputzten Zähnen und fast verflogenem Aftershave. Registrieren das leichte Vibrieren des Busses. Alles scheint normal, aber es fühlt sich nicht so an. Etwas ist anders, etwas ist neu. Oder ist es das Gegenteil? Fehlt etwas? Was auch immer es ist, ich kann es nicht sehen, ich kann es nicht hören, ich kann es weder riechen noch fühlen. Ich schmecke es eher in der Luft, spüre es mit den feinen Härchen auf meinen Wangen. Was ist das?
Ich versuche den Gedanken abzuschütteln und wappne mich für den Weg durch den Flughafen. Bin zunächst guter Dinge, denn im Bus nahm niemand Notiz von mir. Doch kaum, dass ich die Halle betrete und an den Duty-Free- und Coffeeshops vorbeihaste, werde ich zum ersten Mal erkannt.
Ich mache ein schnelles Selfie mit dem jungen Mädchen, das mich angesprochen hat, wünsche ihr einen schönen Tag und eile davon, doch ich bin zu langsam. Zwei junge Männer schließen zu mir auf und sprechen mich an.
»Hey! Hey, warte doch mal. Du bist doch die eine aus dieser Serie!«
Ich schaue mich um. Der Flughafen ist relativ voll, aber niemand schenkt uns Beachtung. Gut.
»Hey, warte doch mal, lass mal Selfie machen.«
Ich bleibe stehen, direkt vor einem kleinen Shop, der Äpfel, abgepackte Sandwiches und Wasser in Plastikflaschen anbietet. Lotse die Jungs ein bisschen beiseite, sodass sie niemandem im Weg herumstehen und wir insgesamt ein bisschen weniger auffallen.
»Okay, ein Selfie. Aber dann muss ich weiter.«
Die Jungs stellen sich links und rechts von mir auf, der links von mir, der mit dem Handy, legt mir den Arm um die Schultern.
»Lächeln!«
Ich lächele, wünsche den Jungs einen schönen Tag und will mich davonstehlen, komme aber nicht weit, denn das Mädchen hinter der Theke des Shops hätte auch gerne ein Selfie, und weil es schneller geht, es zu machen, als ihm zu erklären, dass ich keine Zeit habe, kriegt es eines. Ein Fehler, denn sofort gesellt sich ein weiterer Typ zu uns, kein Teenager, eher ein Mann in meinem Alter.
»Boah, ich will auch ein Selfie.«
»Tut mir leid«, sage ich. »Aber ich muss wirklich los.«
Ich versuche, das »eingebildete Fotze«, das mir hinterhergerufen wird, zu ignorieren, obwohl mein Körper sofort mit Adrenalin geschwemmt wird. Statt auf dem schnellsten Weg den Flughafen zu verlassen, steuere ich die nächstbeste Toilette an und schließe mich in einer der Kabinen ein. Ich brauche einen Moment, seit der Sache mit dem Stalker reagiere ich viel empfindlicher auf Angriffe als früher. Aber ich komme klar, atme noch einmal tief durch, dann wasche ich mir die Hände und blicke mir in die rot geränderten Augen. Abgesehen von einer verschleierten Frau, die mir keine Beachtung schenkt, bin ich alleine, und das genieße ich. Ich hole mein Handy hervor, das endlich deutsches Netz gefunden hat und auf dem gleich eine ganze Reihe von Nachrichten eintrudelt. Und dann leuchtet das Display erneut auf, und ein Anruf geht ein. Es ist Maddox. Ich runzele die Stirn. Anthonys Mann und ich tolerieren einander, aber wir mögen uns nicht. Wir tun nur so, als würden wir einander mögen, weil wir Anthony beide so sehr lieben. Wie auch immer: Maddox ruft mich niemals an. Ich wusste noch nicht einmal, dass er meine Nummer hat.
»Maddox, hi«, sage ich.
Er spricht nicht gleich, aber er ist da, das höre ich. Und in dem Moment weiß ich es, und das Universum stürzt ein, alle Planeten kullern durcheinander wie Murmeln, und nichts ergibt mehr Sinn.
»Wann?«, frage ich.
Meine Stimme klingt fremd. Immer noch ist es still am anderen Ende.
»Heute Morgen«, sagt Maddox dann. »Vor anderthalb Stunden.«
Er schluchzt leise.
»Er ist weg, Ellen. Gerade war er noch hier, und jetzt ist er fort. Einfach so.«
Ich fahre in die Stadt. Leichter Regen fällt, malt die Rücklichter der anderen Autos in roten und weißen Aquarellen auf die Windschutzscheibe, ich weine nicht. Mein Taxifahrer ist ein ruhiger, älterer Herr, der am Terminal ausgestiegen und um den Wagen herumgegangen ist, um mir die Tür zu öffnen. Der Name auf seinem Ausweis klingt persisch. Er fragt mich, ob ich einen angenehmen Flug hatte, und ich sage: Danke, ja, den hatte ich, frage ihn, wie seine Schicht sei – sehr angenehm bisher –, ob sie gerade begonnen habe oder bald ende – sie habe gerade begonnen –, und anschließend fahren wir eine Weile schweigend dahin. Ich mache die Augen zu, für ein paar Minuten nur, und als ich sie wieder öffne, haben wir die Grenze zum Tag endgültig überschritten.
Es hat aufgehört zu regnen, ich bin in Berlin, und Anthony ist tot. Das Taxi rollt über die Stadtautobahn, ich ziehe mir meine Baseballkappe tiefer ins Gesicht, um meine Augen zu verbergen, denn wenn der nette Mann am Steuer mich jetzt fragt, ob alles in Ordnung ist, klappe ich zusammen, so viel ist sicher.
Ich sehe die erste Plakatwand, als wir durch Friedenau fahren. Die zweite nur ein paar Meter weiter. Wende mich ab. Ich öffne meine Reisetasche, und der buttrige Duft des Gebäcks füllt den Innenraum des Taxis.
»Mögen Sie etwas Süßes?«, frage ich. »Manche halten das hier für die beste Backware des Planeten.«
Der Taxifahrer isst das Gebäck, das ich für meinen toten väterlichen Freund einmal halb um die Welt geflogen habe, während wir durch eine erwachende Stadt fahren, in der an jeder Litfaßsäule und auf jeder Plakatwand mein Gesicht prangt.
2 NICO
Die Straßen sind leer, und das mag ich. Die ganze Stadt nur für mich. Ich ziehe die Kapuze meines Parkas über den Kopf, um mir den Ostwind aus dem Nacken zu halten, und laufe Richtung Bahn. Berlin sieht ausgewaschen aus, ein nicht ganz zu Ende entwickeltes Polaroid.
Links von mir zieht sich eine Häuserzeile entlang, doch zu meiner Rechten klafft eine Lücke. Wenn ich vor Weihnachten zur Arbeit gegangen bin, bin ich hier gerne stehen geblieben und habe dabei zugeschaut, wie dinosaurierhafte Geräte eine komplette Gebäudefront einrissen. Der Anblick faszinierte mich. Vielleicht, weil die Häuser, die dort gestanden hatten, Zeit meines Lebens da gewesen waren und unverrückbar gewirkt hatten. Nun sind sie verschwunden; das mit Bauzäunen abgesperrte Areal wirkt surreal auf mich, so leer, so weit, eine Zahnlücke im Großmaul der Stadt. Ich mache ein schnelles Foto, checke routiniert das Display. Weiter.
Ich liebe die Zeit zwischen den Jahren, die Ruhe, die Leere, und ich mag diesen Ausdruck. Zwischen den Jahren. Mir gefällt der Gedanke, dass die Zeit kein einziger gewaltiger Strom ist, dem man nicht entgehen kann, der keine Müdigkeit kennt, keine Gnade, der keine Ausnahmen macht, der einfach durchs Universum walzt, erbarmungslos und kalt, sondern dass da eine Lücke ist zwischen den Jahren. Eine Atempause. Eine Zeit, die außerhalb der Zeit steht, ein paar Tage, in denen Dinge geschehen, die während des Rests des Jahres unmöglich sind. Als Kind war ich mir, befeuert vom fröhlichen Aberglauben meiner Großmutter, sicher, dass zwischen den Jahren Magie möglich ist. Und auch heute noch gefällt mir diese Idee, obwohl ich nicht mehr an Zauberei glaube, anders als die kleine Nico damals.
Ich hauche in meine hohlen Hände, balle sie kurz zu Fäusten, reibe sie gegeneinander. Ich habe kaum geschlafen letzte Nacht, wurde lange vor dem Weckerklingeln wach, verließ meine Wohnung noch halb im Traum – und ohne Handschuhe. An einer roten Fußgängerampel bleibe ich stehen. Und plötzlich ist es da. Es, er, ein dunkler, dräuender Ton, wie ich ihn nie zuvor gehört habe. Ich sehe mich um, runzle die Stirn. Halte mir instinktiv die Ohren zu, um zu überprüfen, ob das Geräusch in meinem Kopf ist, ein böser Zwilling des hohen, fiependen Tinnitus, den ich mir einst bei einem Rockkonzert zuzog. Aber nein, so ist es nicht. Ich nehme die Hände von den Ohren, versuche zu erkennen, von wo aus der Ton zu mir dringt, versuche zu begreifen, weshalb er mich so trifft, so irritiert. Ich stehe noch immer so da, unbeweglich, mit heftig pochendem Herzen, als die Fußgängerampel vor mir längst auf Grün und wieder auf Rot geschaltet hat. Erst, als ein vorbeifahrendes Auto, in dem ein paar Jungs sitzen, die wahrscheinlich gerade aus einem Club gefallen sind, mich wie wild anhupt, komme ich zu mir und setze mich wieder in Bewegung. Überquere die Straße, weiche einem schwarzen Volvo aus, der mit eingeschaltetem Warnblinklicht auf dem Gehweg vor dem Späti an der Ecke geparkt ist, und ziehe mein Handy aus der Jackentasche, entwirre mit steif gefrorenen Fingern die Kopfhörer, stecke mir die Stöpsel in die Ohren, klicke auf irgendeine Playlist. Nun kann ich das Dräuen nicht mehr hören, aber ich spüre es noch, in meinem Magen. Seltsam, denke ich und hebe den Blick. Niemand außer mir scheint es wahrzunehmen. Bilde ich mir das ein?
Der Platz, an dem sich die U-Bahn-Station befindet, liegt vor mir, und ein überdimensionales, hochhausgroßes Plakat, das die komplette Nordseite der Häuserzeile einnimmt, erweckt meine Aufmerksamkeit. Das war vor den Feiertagen noch nicht da. Ich lege den Kopf in den Nacken, um es zu betrachten; nicht, weil ich mich für die neue Serie eines Streamingdienstes interessierte, die es bewirbt, sondern weil mich das Gesicht der jungen Frau, die darauf zu sehen ist, sofort gefangen nimmt. Sie blickt mit einem unergründlichen Ausdruck direkt in die Kamera. Eine Frau mit Geheimnissen. Starke Brauen umrahmen ihre leicht schräg stehenden Augen, ihr dunkles Haar ist kurz, der geschwungene Mund leicht geöffnet. Sie sieht unglaublich lebendig aus auf diesem Bild, so, als werde sie sich jeden Augenblick bewegen. Wobei vollkommen unklar ist, was sie dann tun würde. Auf mich zukommen? Sich umdrehen und weggehen? In Tränen ausbrechen? Lachen? Schreien? Ihre schmale Figur ist ganz in Schwarz gekleidet – schwarze Jeans und ein schwarzes T-Shirt unter einer schwarzen Lederjacke – und hat etwas, das mich beunruhigt. Vermutlich, weil ihre linke Hand hinter ihrem Rücken verborgen ist. So, als halte, als verberge sie etwas. Was?
Als ich näher komme, kann ich die weiße Schrift am unteren Rand des Bildes entziffern. DOYOUREALLYWANTTOKNOW?
Ich wende den Blick ab, denn plötzlich muss ich an Ben denken. An Ben, der an Neujahr noch einmal nach Berlin kommen wird, um mich zu sehen, ehe er zu seiner lang ersehnten Reise aufbricht. An Ben, der nach der Nachtschicht an seinem Hamburger Krankenhaus vermutlich noch schlafend in seinem Bett liegt, arglos und warm, an Ben, den ich liebe und den ich belüge und den ich verlassen werde. Sofort ist der Druck auf meiner Brust, der mich die ganze Nacht über geplagt hat, zurück, und ich kann kaum atmen. Die Frau auf dem Plakat wirkt leicht, so, als könnte sie sich umdrehen und einfach entschlossen aus dem Rahmen herausmarschieren. Ich bin anders. Ich trage schwer an meinen Geheimnissen.
An der Kreuzung warte ich, bis die Fußgängerampel auf Grün schaltet, und meine Music App, die mir eben noch diesen geisterhaften Song von Phoebe Bridgers vorgespielt hat, den ich so gerne mag, springt um auf ein Lied, das ich nicht kenne und das mir entweder der Algorithmus vorgeschlagen oder das Ben bei seinem letzten Besuch in meine Playlist geschummelt hat, was er häufiger tut, wenn er begeistert von etwas ist und findet, dass ich es unbedingt hören sollte. Ich entsperre mein Handy, um nachzusehen, welche Band das ist, und laufe beinahe in jemanden hinein, der mir entgegenkommt. Ich hebe den Blick und muss zweimal hinschauen, weil der Anblick so surreal ist, denn die schöne junge Frau, die ich gerade noch in Überlebensgröße betrachtet habe, ist von ihrer Plakatwand herabgestiegen und läuft – kaum größer als ich, aber viel zierlicher in ihrem weiten, schwarzen Wintermantel – an mir vorbei. Ihre Haare sind etwas länger, ihr Ausdruck ist deutlich weicher, aber es ist dieselbe Frau, zweifellos. Schön ist sie, so schön, dass sie fast unecht aussieht an diesem profanen Ort an einem ausgewaschenen Berliner Morgen. In ihren Händen ist eine Zigarette, sonst nichts. Zum Glück nimmt sie mich nicht wahr, sieht nicht, dass ich sie anstarre, sie raucht und blickt Richtung Straße, vielleicht hält sie nach einem Taxi Ausschau, vielleicht hat sie aber auch gerade ihre Plakatwand entdeckt. Binnen eines Wimpernschlages bin ich an ihr vorbei und zwinge mich, mich nicht nach ihr umzusehen. Ein Filmstar! Im echten Leben! Ein kleines bisschen Magie zwischen den Jahren. Ich laufe die Treppen zur Station hinunter und lasse zu, dass die Erde mich schluckt. Als ich die Stöpsel aus den Ohren nehme, ist der seltsame Klang in meinen Ohren und meinem Magen verschwunden.
Es ist noch nicht ganz acht Uhr, als ich das Fotostudio betrete, die Lichter einschalte, die Heizung aufdrehe und es mir im Büro bequem mache. Ich bin mehr oder minder nur pro forma hier heute, in meinem Kalender stehen keine Termine. Familien- und Pärchenshootings haben vor Weihnachten geboomt, mit den Junggesellinnenabschieden geht es erst im März wieder los, und auch spontane Kundinnen und Kunden, die ein Pass- oder Bewerbungsfoto brauchen, erwarte ich heute kaum. Ich werde mich mit der Buchhaltung befassen, vielleicht.
Die anderen haben frei bis nach Neujahr, ich muss arbeiten bis Neujahr und habe anschließend den Januar frei, weil ich Ben ursprünglich begleiten wollte. Ich bin allein, und der Tag rauscht so weg. Natürlich rühre ich die Buchhaltung nicht an, vertreibe mir die Zeit stattdessen, indem ich nachdenke und Kaffee trinke, neue Playlists auf Spotify erstelle und eine Liste mit Neujahrsvorsätzen schreibe. Gewohnheitsmäßig notiere ich regelmäßig zum Yoga gehen und Meditation lernen und gesünder essen – solche Dinge.
Dann fällt mir die junge Frau wieder ein, die mir heute Morgen am Eingang zur U-Bahn entgegenkam, ich google die Serie, für die das Plakat mit ihr warb, finde sie. The Vanishing. Ich klicke auf Besetzung.
Da ist sie. Sie heißt Ellen Kirsch. Ist zweiunddreißig Jahre alt, wie ich. Ich muss zweimal hinschauen, als ich ihr Geburtsdatum sehe, brauche den Bruchteil einer Sekunde, um zu begreifen, weshalb es mir so vertraut vorkommt: Es ist auch meines. Ich muss schmunzeln, denn ich bin noch nie jemandem begegnet, der auf den Tag so alt ist wie ich, und das wird mir jetzt erst klar.
Ellen Kirsch ist Deutsche, wurde laut Wikipedia jedoch aus Gründen, die das Internet mir nicht verrät, in Marrakesch geboren und wuchs in Frankfurt auf. Mit Anfang zwanzig begann sie ihre Ausbildung an der renommiertesten Schauspielschule des Landes, brach sie ein Jahr später ab, spielte Theater in München und in Wien und stand schließlich für einige Filme vor der Kamera. Die Rolle, die ihr zum Durchbruch verhalf, war die einer jungen Frau mit bipolarer Störung in einem Drama, das kaum jemand sah, für das sie allerdings einige renommierte Preise erhielt. Woraufhin sie zwei Jahre später für eine kleine Rolle in einer Hollywoodproduktion gecastet und international bekannt wurde. Danach spielte sie in einer Menge Produktionen, zwischendrin immer wieder Theater. Vor allem in London, aber auch immer wieder in Berlin und New York. Zuletzt spielte sie am Broadway. Ein Superstar in the making, dem mit der Hauptrolle in The Vanishing der Aufstieg in die absolute A-Riege bevorstehe – so berichtet es das Netz. Mir fällt auf, dass ich tatsächlich einige Filme mit ihr gesehen, sie aber nicht wiedererkannt habe. Ellen Kirsch mag schön sein, doch sie versteht es, sich dermaßen in ihre Rollen hineinzumorphen, dass sie bisweilen nicht mehr wiederzuerkennen ist.
Am späten Nachmittag bekomme ich Kopfweh, denke zuerst, dass ich noch bis 18 Uhr bleiben muss, denn dann endet unsere Öffnungszeit, aber dann fällt mir wieder ein, dass das hier ja mein Laden ist und dass ich ihn schließen kann, wann ich will – vor allem an Tagen, an denen eh keiner kommt, also werfe ich eine Ibuprofen ein und mache Feierabend.
Als ich das Studio absperre, bemerke ich, dass der Tag sich gewandelt hat, die Luft ist klar, die Wintersonne bescheint den Asphalt mit den immer noch wenigen Passanten, und ich beschließe, zu Fuß nach Hause zu gehen. Frank Ocean singt mir ein Lied, und seine Stimme verleiht der Stadt neuen Glanz, während ich Richtung Görlitzer Bahnhof laufe und meinen Gedanken nachhänge.
Als ich neunzehn war und gerade mein Abitur in der Tasche hatte, habe ich mich auch mal an der Schauspielschule beworben, die Ellen Kirsch für kurze Zeit besucht hat. Ich hatte als Teenager leidenschaftlich Theater gespielt, und obwohl ich wusste, dass sich Hunderte Menschen auf die wenigen Plätze bewarben, war ich mir sicher, dass ich es schaffen würde. Tat ich natürlich nicht, und das ist vielleicht auch ganz gut so.
Ich nehme eine schnelle Sprachnachricht für Alba auf: Drinks?
Sie antwortet in Sekundenschnelle: Immer!
Ich stecke das Handy weg, scheuche ein paar Tauben auf, die sich um heruntergefallene Pommes frites und ein Stück Dönerfleisch streiten, passiere einen Krankenwagen, der mit ausgeschalteter Sirene, aber blinkendem Blaulicht an der Straße geparkt ist, mache einen großen Schritt über die Stolpersteine, die am Eingang zu meiner Wohnstraße an ein von den Nazis ermordetes Ehepaar erinnern, weiche meiner neugierigen Nachbarin aus, indem ich die Straßenseite wechsele, bevor sie mich entdeckt hat, und bin daheim.
Einen frischen Espresso vor mir, hole ich den Zettel hervor, auf dem ich meine Vorsätze notiert habe. Ich schreibe täglich 10 000 Schrittegehen und wieder mehr Bücher lesen. Nach einer Weile füge ich Ben von Kurt erzählen hinzu, und ab diesem Punkt macht mir meine Liste keinen Spaß mehr, und ich lege sie weg.
Alba hat ein Café bei sich um die Ecke ausgesucht, das aussieht, als hätte man eine altmodische Apotheke mit einem Brooklyner Hipsterladen gekreuzt. Wärme schlägt mir entgegen, der Laden ist rappelvoll, es riecht nach Kaffee, orientalischen Gewürzen und Serotonin. Entgegen ihrer sonstigen Gewohnheit ist Alba pünktlich und erwartet mich bereits an einem kleinen Tisch an der Fensterfront. Die Beine weit von sich gestreckt lümmelt sie auf einem der schönen, aber notorisch unbequemen Stühle herum und tippt irgendetwas in ihr Handy. Wir absolvieren unser Begrüßungsritual, während dem Alba mich immer ein paar Sekunden lang so fest an sich drückt, als wollte sie mich zermalmen vor Liebe, während sie mein Gesicht in ihre Haare presst, die immer nach Flieder und kaltem Rauch und alter Freundschaft riechen.
»Wie geht’s dir?«, fragt Alba, während ich Platz nehme. »Wie war Weihnachten?«
»Okay«, sage ich. »Und bei dir?«
»Oh mein Gott, hör mir auf. Meine Mutter hat uns alle wahnsinnig gemacht. Wie jedes Jahr, wenn ich’s mir so recht überlege. Ich weiß nicht, wieso mein Bruder und ich uns das immer noch antun.«
Ich sage nichts, und Alba schaut mich erschrocken an.
»Scheiße, Mann«, sagt sie. »Tut mir leid.«
»Quatsch, wieso? Alles gut.«
Ich weiß natürlich, was Alba gerade siedend heiß eingefallen ist. Dass ich nämlich keine Mutter mehr habe, über die ich mich in schöner Regelmäßigkeit beklagen könnte.
»Hast du …« Sie zögert, ein vollkommen Alba-untypisches Verhalten, und ich ahne, was jetzt kommt. »Hast du die Sache mit dem Schiff neulich mitbekommen?«
Ich nicke. Natürlich habe ich das. Vor einigen Tagen ist ein belgisches Passagierschiff gesunken, vier Menschen sind ertrunken, der Rest konnte gerettet werden. Warum wollen alle immer mit mir über Schiffsunglücke reden? Wie kommt man auf so eine Idee? Reden die Leute mit Menschen, die dem Wrack eines Flugzeuges entkommen sind, auch am liebsten über Flugzeugabstürze?
»Erzähl mir lieber, wie es dir geht«, sage ich, bemüht, das Thema zu wechseln.
Ich spreche nicht über meine Mutter; nicht, wenn ich es vermeiden kann.
»Was macht die Arbeit?«, fahre ich fort. »Und hattest du vor Weihnachten nicht ein Date? Mit diesem Anwalt?«
Diese Themen sind echte Volltreffer, das sehe ich meiner Freundin sofort an.
Was folgt, ist ein vom Rotwein, den Alba bereits für uns bestellt hat und den wir hier immer trinken, befeuerter Monolog über die Unfähigkeit ihrer Chefin in der Agentur, die Unverschämtheit der Männer auf Datingportalen, die mangelnde Solidarität ihrer Kolleginnen und das Chaos in ihrer Wohnung, dessen sie einfach nicht Herr wird.
»Ich habe mir ein Buch von Marie Kondo gekauft«, werfe ich ein. »Aber als ich anfangen wollte, es zu lesen, habe ich es in meiner Unordnung daheim nicht mehr gefunden.«
Alba lacht, wirft sich ihre karamellfarbenen Braids über die Schulter und hebt ihr Glas. Wir stoßen an, obwohl wir das schon getan haben, als der Wein kam – aber mit einer Freundin anzustoßen gehört zu den Dingen, die man nicht oft genug machen kann.
»Wie läuft’s bei dir mit der Arbeit?«, fragt Alba und greift nach ihrem Handy, das gerade verführerisch aufgeleuchtet hat. Vielleicht eine Nachricht von einem der Mistkerle von irgendeinem Datingportal, auf jeden Fall hellt sich Albas Miene sofort auf, als sie sie liest.
»Nicht so gut, ehrlich gesagt«, antworte ich. »Mir fehlt es gerade irgendwie ein bisschen an Inspiration.«
»Cool, das ist cool«, sagt Alba, tippt eine kurze Antwort und legt ihr Handy weg. »Vielleicht kannst du mir demnächst mal neue Bewerbungsfotos machen. Und ein paar hotte Bilder für Tinder. Wobei – da sind eh nur Idioten. Du kannst so was von froh sein, dass du Ben hast.«
Es folgt ein halbstündiger Monolog darüber, dass alle netten Männer vergeben sind, dass ihre Therapeutin glaube, Alba habe Angst vor dem Glück und betreibe in Beziehungsdingen Selbstsabotage. Dann kommen die »Middle Eastern Tapas«, die wir bestellt haben, und unterbrechen ihren Redeschwall.
»Und bei dir so?«, fragt sie und dippt ein Stück Brot in ihren Rote-Bete-Hummus.
»Ach, ich weiß auch nicht«, sage ich. »Es gibt da etwas, das ich schon länger mit mir rumschleppe. Ich –«
Wieder leuchtet das Display von Albas Handy auf, und wie selbstverständlich greift sie danach.
»Entschuldige«, murmelt sie und fängt an, darauf herumzutippen. »Red weiter, ich hör dir zu.«
»Okay. Also, ich weiß gar nicht so richtig, wie ich es sagen soll«, beginne ich. »Wenn ich es sage, wird es real, verstehst du, was ich meine? Und das macht mir Angst.«
»Hm-hm«, macht Alba, den Blick immer noch auf ihr Handy gerichtet, dessen Display ihr schönes, mondförmiges Gesicht beleuchtet.
Ich unterdrücke ein Seufzen.
»Ich habe erfahren, dass ich gar kein Mensch bin, sondern ein Alien«, sage ich.
»Verstehe«, murmelt Alba.
»Außerdem habe ich Ben mit George Clooney betrogen.«
Alba entgegnet nichts, tippt.
»Und ich habe eine unheilbare Krankheit und nur noch ein paar Monate zu leben«, schließe ich.
»Hm-hm«, macht Alba. »Krass.«
Sie legt ihr Handy beiseite, sieht mich an.
»Äh, tschuldige, was ist mit George Clooney?«
Ich muss lachen, obwohl ich eigentlich sauer sein sollte, aber so ist Alba nun mal. Sie ist verpeilt und egozentrisch, aber wenn nötig, gäbe sie für ihre Liebsten ihr letztes Hemd, und überhaupt: Wer bin ich, meine Freundinnen ändern zu wollen?
»Ich muss mal auf Toilette, bestellst du mir noch ein Glas Wein?«
Ich stehe auf, und Alba nickt.
Als ich zurückkomme, habe ich beschlossen, Alba überhaupt nichts mehr zu erzählen. Selbst, wenn es mir gelänge, zu Wort zu kommen, vielleicht, weil Alba sich an einer Fischgräte verschluckte oder so … Eigentlich sollte ich zuallererst mit Ben reden, so viel bin ich ihm wirklich schuldig.
»Oh mein Gott«, sagt Alba, als ich zurück an den Tisch komme. »Du wirst nicht glauben, wer gerade draußen vorbeigelaufen ist.«
»Wer denn?«
Ich setze mich und nehme noch einen Schluck von meinem frischen Glas Malbec.
»Ellen fucking Kirsch«, sagt sie.
Ich hebe die Brauen.
»Du kennst Ellen Kirsch?«
Alba schaut mich an, als wäre mein Satz von wegen »Ich bin ein Alien« jetzt doch in ihr Bewusstsein gesickert.
»Äh, wer kennt Ellen Kirsch bitte nicht? Hast du sie nicht in diesem Hollywoodfilm mit diesem super hotten Schauspieler aus Game of Thrones gesehen?«
»Ich glaube nicht.«
»Dieser Schotte. Wie heißt der noch? Ich komm nicht drauf. Egal. Na, jedenfalls hat sie angeblich vor, wieder nach Berlin zu ziehen«, sagt Alba. »Vorher war sie für eine Theaterproduktion in New York, aber eigentlich lebt sie in L.A.«
»Was für eine Theaterproduktion?«
Alba runzelt die Brauen, dann fällt ihr wieder ein, dass ich ja früher selbst Theater gespielt habe und mich für so einen nerdigen Kram interessiere.
»Das mit den Elfen«, sagt sie. »Du weißt schon. Shakespeare.«
»Ein Sommernachtstraum?«
»Kann sein. Auf jeden Fall hat Lana del Rey die Musik für das Stück geschrieben. Ist das nicht irre? Die beiden kennen sich anscheinend irgendwie.«
»Woher weißt du das alles?«
»Ich folge ihr auf Instagram. Also, Ellen Kirsch, meine ich.«
Albas Augen glänzen, sie liebt Promiklatsch.
»Oh, und wusstest du, dass sie was mit ihrem Co-Star hatte?«
»Mit dem hotten Schotten?«
Alba gluckst.
»Genau! Wobei das gar nicht so lustig ist, der hat nämlich schon eine Frau. Und drei Kinder.«
Mein Handy vibriert in meiner Tasche, und als ich es heraushole, sehe ich eine Nachricht von Ben. Sie besteht aus drei Emojis: einem Auge, einem roten Herz und einem durchgedrehten Smiley. Ich muss grinsen. Diese Kombination ist ein Running Gag zwischen uns, ein Verweis auf den Song »I Love You Like A Madman« von den Wave Pictures. Wenn Ben mir ohne viele Worte sagen will, dass er verrückt nach mir ist, mich eben liebt »Like A Madman«, dann schickt er mir diese Kombination an Piktogrammen, und ich antworte auf dieselbe Art. Ich weiß auch nicht mehr genau, wann und wie das begonnen hat, aber wir machen das seit Jahren. Alba verdreht die Augen.
»Ben?«
Ich nicke.
»Ich hasse euch«, sagt Alba. »Euer Glück ist einfach nur zum Kotzen.«
Ich muss lachen, und Alba grinst.
»Noch einen Drink?«
»Lieber nicht, ich habe vorhin eine Schmerztablette genommen.«
»Migräne?«
Ich mache eine unbestimmte Bewegung und lasse die Rechnung kommen.
»Alba?«, frage ich, während ich nach meinem Portemonnaie krame. »Was ist der Sinn des Lebens?«
Diese Frage habe ich schon vielen Menschen gestellt. Die meisten zögern mit der Antwort, antworten mit einer Gegenfrage, wollen wissen, wieso ich ihnen damit komme. Alba nicht. Sie überlegt nur kurz.
»Den ganzen Quatsch hier zu genießen, schätze ich.«
Gute Antwort. Während Alba mich plappernd verabschiedet, schweifen meine Gedanken erneut zu Ben, und als ich mit hochgezogenen Schultern und tief in den Manteltaschen vergrabenen Fäusten nach Hause gehe, vorbei an einer kleinen Gruppe von Jugendlichen, die in einem Hauseingang stehen und rauchen, vorbei an wartenden Taxis und Bars und Litfaßsäulen, von denen mir Ellen Kirschs unergründliches Gesicht entgegenblickt, verspreche ich mir, dass ich noch in diesem Jahr mit ihm reden werde.
3 ELLEN
Etwas ist falsch, aber ich weiß nicht, was es ist. Das Gefühl, das mich am Flughafen überkam, ist nie ganz verschwunden. Es schwillt an, und es schwillt ab, eine düstere Präsenz, pulsierend und wabernd wie Narbenschmerzen.
Zudem fremdele ich mit Berlin, und auch das ist neu. Als ich die Stadt verließ, um erst nach London und dann in die USA zu gehen, fühlte sich nach Berlin zurückzukehren immer wie nach Hause kommen an. Und irgendwie dachte ich stets, dass ich eines Tages wieder hier landen würde. Das gab mir Sicherheit in meinem Nomadenleben: das Wissen, dass ich noch einen Koffer in Berlin hatte. Eine Homebase. Aber die, so merke ich jetzt, existiert nicht mehr. Die Berliner Luft riecht anders, der Wind hat sich gedreht. Liegt es daran, dass Anthony nicht mehr hier ist? Liegt es an mir?
Ich gehe eine Seitenstraße entlang, feiner Nieselregen fällt, und das ist schön so. Die Dunkelheit steht mir, ich verlasse ohnehin nur bei Nacht das Haus, niemand nimmt Notiz von mir, und halb links vor mir ragt die Gedächtniskirche auf, die ich schon immer gerne angeschaut habe, so wie man mit einer Mischung aus Faszination und Entsetzen wieder und wieder mit der Zunge über einen abgebrochenen Zahn fährt. Ich trage Jeans, einen schwarzen Wollpullover und meine Lederjacke. Bin mit so leichtem Gepäck in die Stadt gekommen, dass ich erst einmal Wintersachen werde kaufen müssen. Und angemessene Kleidung für die Beerdigung, denn Anthony hat mir immer alles nachgesehen, nur nachlässige Kleidung nicht. Ich friere ein bisschen, bin nicht nur zu dünn angezogen, sondern habe auch seit achtundvierzig Stunden nicht geschlafen. Ich fühle mich seltsam verloren zwischen den Jahren, taumele umher irgendwo zwischen Trauer und Jetlag, bin im Grunde gerade erst in Berlin angekommen, fühle mich aber, als wäre ich seit Wochen hier.
Ich biege in die Straße ein, in der die alte Kneipe liegt, in der ich mit Liv verabredet bin. Die Szenebar, in die sie gehen wollte, habe ich ihr ausgeredet, wenn ich auf etwas keine Lust habe, dann darauf, heute Abend mit irgendwem aus der Branche plaudern zu müssen. Das Lokal, das ich ausgesucht habe, riecht nach schalem Bier und – anders lässt es sich schlicht nicht sagen – nach Mann. Ein Fußballspiel läuft, findet aber nur die Beachtung der drei Herren, die an der Theke sitzen. An den anderen Tischen wird getrunken, laut geredet, an einem wird sogar Karten gespielt, und ich habe es mir spontan anders überlegt, es gibt doch noch Orte in Berlin, an denen ich mich zu Hause fühle; schon allein die Tatsache, dass hier nicht Football läuft oder – Gott bewahre! – Baseball, macht mich Amerikaheimkehrerin unangemessen froh. Liv ist noch nicht da, also setze ich mich an einen der Hochtische, lasse die Beine mit den Turnschuhen baumeln und bestelle zwei Bier, als die Bedienung, eine resolut wirkende Frau mit weinrotem Kurzhaarschnitt und tätowierten Armen fragt, was sie gegen mich tun könne.
Liv habe ich seit Ewigkeiten nicht gesehen. Wir sind zusammen zur Schauspielschule gegangen und haben es geschafft, über all die Jahre Kontakt zu halten. Und ich weiß auch nicht, aber irgendwie muss ich heute jemanden aus meinem alten Leben sehen. Jemanden, der mich schon lange kennt und den ich schon lange kenne. Jemanden, der in mir keinen Hollywoodstar sieht, sondern – nun ja, einfach mich.
Sie ist eine Viertelstunde zu spät. Auch sonst hat sie sich überhaupt nicht verändert, sie kommt nicht einfach rein, sie tritt auf. Und im Gegensatz zu mir erregt sie Aufsehen – und genießt es. Sie hat immer noch dieses fabelhafte, lange, honigblonde Haar, und ihr klassisch schönes, sommersprossiges Gesicht ist durch zwei ausgeprägte Stirnfalten nur anziehender geworden. Sie drückt mir Küsse auf die Wangen und bearbeitet mein Gesicht anschließend mit ihrem Daumen, um den Lippenstift wieder fortzuwischen, mit dem sie mich beschmiert hat. Dann setzt sie sich und schaut sich um.
»Schämst du dich, dich in zivilisierter Gesellschaft mit mir blicken zu lassen, oder wieso treffen wir uns hier?«
Sie versucht, belustigt zu klingen, ist aber im Grunde ernsthaft indigniert, das spüre ich sofort.
»Mir war einfach ein bisschen nach altem Berlin«, sage ich. »Ich war lange nicht hier.«
Die Bedienung bringt die Getränke, die ich bestellt habe.
»Ist Bier okay, oder möchtest du was anderes trinken?«, frage ich.
»Ist da Alkohol drin?«, fragt Liv und schnüffelt an ihrem Glas.
»Wofür hältst du mich?«, frage ich. »Denkst du, ich bestelle alkoholfreies Bier?«
»Bei euch Hollywoodstars kann man nie wissen«, versetzt Liv und leert das halbe Glas in einem Zug. »Clean eating und so.«
»Ich bin kein Hollywoodstar«, sage ich.
»Ja, genau.«
Liv lacht, und irgendwie klingt es hässlich. Einen Moment lang schweigen wir uns an, und auch danach kostet es uns einiges an Mühe, das Gespräch in Gang zu bringen. Ich frage Liv nach ihren Engagements, nach ihrer Familie, nach ihrem Freund, und sie antwortet ausführlich, aber eine echte Konversation bekommen wir nicht hin, irgendetwas ist anders, und irgendwie lässt mich das Gefühl nicht los, dass Liv sauer auf mich ist. Ich habe nur nicht die geringste Ahnung, wieso.
»Du«, sagt sie, »sorry, aber ich muss mal auf Toilette. Ich bin gleich zurück.«
Ich trinke mein Bier, denke an Anthony, mit dem ich zwei-, dreimal hier war, und betrachte die gerahmten Bilder an der Wand gegenüber, die eine unerklärlich stimmige Mischung aus Landschaftsfotografie, prominenten Berlinerinnen und Berlinern, Alltagsszenen und Porträts zeigt.
»Gunnar hat mir gerade geschrieben«, sagt Liv, als sie zurückkommt und sich wieder auf ihren Hocker schwingt. »Er ist mit ein paar Leuten aus seiner aktuellen Produktion essen, nur ein paar Straßen weiter. Ich würde da nachher wahnsinnig gerne noch schnell Hallo sagen, Gunnar hatte letzte Woche Geburtstag. Kommst du mit?«
Ich zögere. Gunnar ist Livs Exfreund, ein Filmregisseur, mit dem sie immer noch gut befreundet ist. Ich habe ihn nie getroffen, kenne ihn nur aus Erzählungen. Ich mag nicht.
»Es würde mir so viel bedeuten«, legt Liv nach. »Komm schon, Ellen.«
Ich unterdrücke ein Seufzen. Wie könnte ich da Nein sagen? Ich zahle unser Bier, und ein paar Minuten später sitzen wir im Taxi.
Das Restaurant entpuppt sich als exakt die Art von Szeneschuppen, die ich unbedingt vermeiden wollte, und ich verbringe den Rest des Abends damit, mich von Liv rumzeigen, mir von Gunnar sein neues Filmprojekt pitchen und mich von den anderen Gästen aus den Augenwinkeln beobachten zu lassen. Irgendwann wird es mir zu blöd, und ich nehme meine Jacke.
»Oh, bleib doch noch«, gurrt Liv.
»Ich muss los«, sage ich. »Mir ist hier zu viel Trubel.«
Liv verzieht gereizt das Gesicht.
»War mir nicht klar, dass es für dich Stress bedeutet, mit deinen alten Freunden abzuhängen.«
Sie merkt, wie unschön das klingt und fängt sich sofort wieder.
»Ich seh dich so selten«, sagt sie und zieht eine Schnute.
»Anthony ist gestorben«, sage ich. »Mir ist gerade nicht nach vielen Leuten.«
»Oh mein Gott, ja natürlich«, sagt Liv. »Davon habe ich gehört. Das tut mir so leid, Süße.«
»Du wusstest es?«
Sie zuckt mit den Schultern. Natürlich. Ich nicke, verabschiede mich, überhöre alle Einwände von wegen Wäre es nicht besser, dich abzulenken? und Ich möchte nicht, dass du alleine zu Hause rumsitzt und lasse mich von der Drehtür auf die Straße katapultieren. Ich lande zwischen den Rauchern auf dem Gehweg, orientiere mich kurz, stelle fest, dass ich zu Fuß zu meinem Airbnb gehen kann und beschließe, die kühle Abendluft zu genießen, denn mit einem hatte Liv recht: Ich habe keine Lust, alleine in einer Wohnung zu sitzen, die nicht meine ist, und an Anthony zu denken. Und in dem Moment trifft es mich. Anthony ist weg, und zwar für immer. Der Gedanke treibt mir die Luft aus den Lungen. Ich versuche, tief einzuatmen, sie wieder mit Sauerstoff zu füllen, aber es gelingt mir nicht. Plötzlich kommt mir die Stadt um mich her unerträglich laut vor, so, als hätte jemand alle Regler hochgedreht und einen Verzerrer eingeschaltet. Ich muss nach Hause, ich kann nicht mehr. Ich sehe mich nach einem Taxi um, keines in Sicht. Versuche, mir ein Uber zu rufen, doch aus irgendeinem Grund funktioniert das nicht. Ich gehe gerade mit hochgezogenen Schultern und dem Handy in der Hand die Friedrichstraße entlang, als drei Typen neben mir auftauchen. Ich schaue nicht hin, obwohl offensichtlich ist, dass sie mich absichtlich nicht einfach überholen, sondern neben mir hergehen, um meine Aufmerksamkeit zu erregen.
»Doch, das isse«, sagt der, der links von mir geht.
Sie sehen, von ihren Jacken mal abgesehen, alle drei gleich aus: Mitte zwanzig, dunkelblonder Kurzhaarschnitt, teure Jeans, gute Schuhe. Wahrscheinlich kennen sie sich vom BWL-Studium oder aus dem FC-Bayern-Fanclub.
»Nee, das isse nich«, sagt der zu meiner Rechten, der mit dem wohl ironisch gemeinten Oberlippenbart.
»Bist du das?«, fragt der dritte, schert aus und hält mir ein Handy unter die Nase, auf dessen Display ein Foto von mir in Unterwäsche zu sehen ist. Kurz begreife ich nicht, woher er dieses Bild hat, doch dann erkenne ich, dass es ein Standbild aus einem meiner ersten Filme ist. Ich kann die drei nicht länger ignorieren, blicke auf und stelle fest, dass der zu meiner Linken, der im olivgrünen Parka, mich filmt.
»Hör auf damit«, sage ich und hebe die Hand vors Gesicht.
»Sage ich doch, dass sie das ist«, sagt er zu seinen Freunden. »Hi, Elly! Sag mal was für die Kamera!«
Ich reiße mich zusammen und sage einfach mal gar nichts, ich will einfach nur nach Hause. Gehe schneller. Die Typen passen ihr Tempo an.
»Ach komm, sei nicht schüchtern«, sagt der Parka, überholt mich und läuft mit seiner Handykamera im Anschlag gebückt vor mir her, die schlechte Parodie eines Kameramannes.