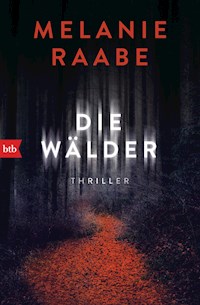8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: KiWi Musikbibliothek
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Melanie Raabe über Lady Gaga und die Kraft des Sich-selbst-Erfindens. Die Bestsellerautorin Melanie Raabe nimmt sich einen der größten lebenden Popstars zum Vorbild, um endlich das Leben zu leben, von dem sie so lange geträumt hat. Ein inspirierendes Buch über das Phänomen Lady Gaga, aber eben auch über das Phänomen Melanie Raabe. Lady Gaga kommt für Melanie Raabe genau zur richtigen Zeit. Eigentlich ein Indiemädchen, lässt sie sich auf den »überdrehten Plastikpop« ein und merkt: Die traut sich was. Melanie Raabe beschließt, das ewige Suchen und Finden im Leben hinter sich zu lassen und sich stattdessen – wie Lady Gaga – zu erfinden. Sie arbeitet als Journalistin in Köln, doch eigentlich will sie schon immer Schriftstellerin werden. Also los. Lady Gagas Musik hilft ihr dabei, die zu werden, die sie heute ist: eine erfolgreiche Künstlerin. Melanie Raabes Text über Lady Gaga ist ein Aufruf an jede*n, allen Mut zusammenzukratzen, um das zu werden, was man schon immer sein wollte. No more P-P-P-Poker Face!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 78
Ähnliche
Melanie Raabe
LADY GAGA
Melanie Raabe über Lady Gaga
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Inhaltsverzeichnis
Über Melanie Raabe
Über dieses Buch
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
Inhaltsverzeichnis
Intro
Just Dance
Born This Way
Applause
[Foto der Autorin]
Perfect Illusion
Alice
Rain On Me
Outro / The Edge of Glory
Danksagung
Noch mehr Lesespaß
Inhaltsverzeichnis
Intro
Lady Gaga ist tot.
Dezember 2019. Ich befand mich mitten in einem Umzug und hatte mir den Tag freigenommen, um meinen Keller leer zu räumen, als ich die Nachricht erhielt. In wenigen Tagen würde mein vierter Roman erscheinen, und bis dahin wollte, bis dahin musste ich mit allem fertig sein. Ich stieg gerade die Treppen zu meiner Wohnung hinauf, als das Handy in meiner Jeans vibrierte. Die Nachricht kam von meinem Freund, und sie war so kurz wie niederschmetternd: »Lady Gaga ist tot.« Ich starrte die Buchstaben auf dem Display an, mein Herz pumpte wie wild, meine Gedanken rasten. Lady Gaga ist tot.
Noch während ich die letzten paar Stufen nahm, gingen mir tausend Dinge durch den Kopf. War es ein Unfall? Car crash? Flugzeugabsturz? Etwas anderes, Unwahrscheinlicheres? Herzinfarkt? Hirnschlag? Das kann auch jungen Menschen passieren, das hört man doch immer wieder. Und: Gaga ist krank, leidet unter chronischen Schmerzen, nimmt garantiert jede Menge Medikamente. Nein, Moment. Sie nahm jede Menge Medikamente. War es eine Überdosis? Oh Gott, war es am Ende Selbstmord? Gaga hat immer sehr offen über ihre psychischen Erkrankungen gesprochen, über die Depression, die anxiety, all das …
Ein Teil von mir nahm überrascht zur Kenntnis, wie geschockt, wie traurig ich war. Ich hatte sie nie verstanden, die Fans, die um Popstars trauerten wie um Freundinnen, um Freunde. So fühlte sich das also an. Da stirbt jemand, den du in vielerlei Hinsicht besser kennst als manche deiner Liebsten.
Ich jedenfalls weiß Dinge über Lady Gagas Kindheit und ihre Beziehungen, über ihre Triumphe und ihre Niederlagen, ihre Traumata und ihre Träume, die ich noch nicht einmal von manchen meiner engsten Freundinnen weiß. Lady Gaga hat sich preisgegeben. In ihrer Kunst und weit darüber hinaus. Und ich war bei so vielem dabei. Ich habe nicht nur zugehört und zugesehen, ich habe mitgefühlt. Wie kalt müsste mein Herz sein, um sie nun nicht zu betrauern?
In meiner Wohnung entsperrte ich mein Handy, atemlos. Öffnete die Google-App, tippte »Lady Gaga« und klickte auf News. Ich erwartete einen medialen Sturm und fand: nichts. Ich wunderte mich, scrollte. Und dann stieß ich auf die folgende Schlagzeile: »Deutschlands schönste Kuh ›Lady Gaga‹ ist tot«.
Ich musste mich kurz setzen, durchatmen.
Ich verfluchte den morbiden Humor meines Freundes. Wie konnte er es wagen? Darüber machte man keine Witze! Gleichzeitig war ich unfassbar erleichtert. Und begriff mit einem Schlag, was Lady Gaga mir bedeutete. Für viele war Lady Gaga schlicht die Queen des Disco-Pop, die vor allem durch verrückte Outfits auffiel. Doch für mich war sie so viel mehr.
Inhaltsverzeichnis
Just Dance
Ich wünschte, ich könnte irgendeine biografische Parallele zwischen mir und Lady Gaga ziehen, aber ich finde keine. Stefani Joanne Angelina Germanotta wurde 1986 in New York City geboren (wo auch sonst?). Ich hingegen stamme aus dem Osten, bin Jahrgang 81 und verbrachte die ersten acht Jahre meines Lebens in einem winzigen Dorf in Thüringen.
Es war ein verwunschenes Dorf, und es umgab mich wie ein Kokon. Es war voller alter Magie, die Sorte, die nur Kinder wahrnehmen können. Es gab Häuser im Dorf, die nachts näher zusammenrückten, als würden sie sich vor der Dunkelheit fürchten. Kastanien, die ihre Zweige neigten, damit wir Kinder leichter auf sie heraufklettern konnten. Pappeln am alten Sportplatz, die manchmal die Plätze tauschten, wenn sie sich unbeobachtet fühlten. Es gab Vögel – Blaumeisen vor allem und Rotkehlchen –, die auf meiner ausgestreckten Hand landeten und mir Geschichten erzählten, und einmal, als ich während eines Gewitters nach Hause lief und ehrlich gesagt ein bisschen Angst hatte bei all dem Blitzen und Krachen, begleitete mich ein Fuchs den ganzen Weg lang und verschwand erst wieder irgendwo im Gebüsch, als ich sicher daheim angekommen war. So eine Art von Dorf war das. So zumindest habe ich es in Erinnerung. Kontakt zu Popmusik hatte ich kaum, aber einmal in der Woche lief im Westfernsehen »Formel Eins«, und als ich vielleicht vier oder fünf war, hatte ich meine erste Lieblingsband. Zwei junge Männer, die sich Petschoabois nannten, was ich merkwürdig und exotisch fand, damals aber nicht hinterfragte. Überhaupt hinterfragte ich wenig. Dass ich ganz anders aussah als meine Freundinnen, fiel mir nicht weiter auf. Tagsüber gab es Bäume, die darauf bestanden, ausgiebig von Kindern beklettert zu werden, und nachts gab es Träume, die geträumt werden wollten. Meine Träume in dieser Zeit waren Nacht für Nacht voller sprechender Tiere und freundlicher Feen.
Unmittelbar nach der Wende zogen wir in den Westen, und der Kokon, der mich so lange umgeben hatte, brach auf. Aber das war in Ordnung so, ich tauschte thüringisches Dorf gegen Kleinstadt in NRW, Kletterbäume gegen Spielplätze, Erdbeeren aus Omas Garten gegen Gummibärchen. Sozialismus gegen Kapitalismus. Alte Freundinnen gegen neue. Ich fand das alles in allem okay. In der Kleinstadt gab es Eis mit Kaugummi im Stiel, und am Ausgang meiner neuen Grundschule befand sich eine Rutsche, sodass man nach der letzten Stunde nicht die Treppen nehmen musste, sondern in die Freizeit schlittern konnte. So eine Kleinstadt war das. So zumindest habe ich es in Erinnerung.
Ich war ein sehr glückliches Kind und ein relativ unglücklicher Teenager, mit vielen Freundinnen, guten Noten und allerlei Nöten. Ich weiß nicht mehr, wie es kam, dass ich mich von einem echten Sonnenschein in eine menschliche Gewitterwolke verwandelte. Ich weiß nur, dass ich alles sein wollte, nur nicht ich selbst. Zu dieser Zeit hätte ich mit jedem tauschen mögen. Was für ein Unglück, dass ich ausgerechnet ich war! Oh, the horror! Vielleicht lag es wirklich einfach nur an der Pubertät, vielleicht ist die Antwort tatsächlich so banal, auf jeden Fall verwandelte ich mich in das ängstlichste und schüchternste Mädchen der Stadt. Mit dreizehn oder vierzehn war ich so scheu, dass ich aufhörte, mich in der Schule zu melden, aus Angst, etwas Dummes zu sagen. Wichtig war nur noch eines: So wenig wie möglich aufzufallen. Was gar nicht so leicht ist, wenn man die einzige Schwarze Person an der ganzen Schule ist. Aber ich nahm die Herausforderung an und machte mich so unsichtbar, wie ich nur konnte. Meine Jugend war eine Zeit ohne Magie, keine sprechenden Tiere, und ganz bestimmt keine guten Feen. Falls ich zu dieser Zeit überhaupt träumte, dann waren es vermutlich Albträume von hämischem Gelächter, von Schemen in nächtlichen Gassen, vom Fallen. Rückblickend war das alles nicht dramatisch. Nur normale Teenage Angst.
Und so ging es irgendwie weiter, Abitur, zu Hause ausziehen, studieren. Meine Schüchternheit zog mit. Drückte sich mit mir in Ecken herum und redete mir ein, dass Schweigen Gold sei. Ich saß in meinen Seminaren, schrieb mit und duckte mich, wenn mich der Blick eines Dozenten oder einer Professorin streifte. Während meiner ganzen Hochschullaufbahn meldete ich mich kein einziges Mal zu Wort. Ich schrieb lieber daheim an meinen Texten. Als Teenager hatte ich schlimme, weinerliche Gedichte geschrieben, mit Anfang zwanzig wagte ich mich erstmals ernsthaft an Prosa. (Die ich natürlich niemandem zeigte, ich war ja nicht verrückt.) Irgendwie schaffte ich es auch ohne mündliche Beteiligung, einen richtig guten Abschluss zu machen und ein richtig cooles Volontariat zu bekommen, also zog ich nach Köln, um Journalistin zu werden. Schon während diverser Praktika hatte ich gemerkt, dass dieser Job meinem Naturell entgegenkam. Dass ich zurückhaltend, aber aufmerksam und vor allen Dingen eine gute Zuhörerin bin, entpuppte sich plötzlich als Vorteil.
Ich hatte nun also einen Job. Und lief einfach weiter mit. Arbeiten, feiern gehen, die Musik hören, die alle hören, mitschwimmen, vorsichtig sein, bloß keinen sozialen Selbstmord begehen, bloß nicht auffallen.
Aber ist es nicht immer so? Die Schüchternen, die Ängstlichen verlieben sich in die Lauten und Mutigen. So ist es auch mit Gaga und mir.
Als sie 2008 ihren ersten Hit Just Dance landet, bin ich eine siebenundzwanzigjährige Lokaljournalistin. Meine frühen Zwanziger sind recht hübsch vor sich hingeplätschert, aber seit einer Weile sind die Dinge in Unordnung. Lange weiß ich nicht genau, was es ist. Im Grunde ist doch alles okay! Ich befinde mich in einer glücklichen Beziehung. Ich arbeite in dem Job, den ich mir ausgesucht habe. Und wenn man bedenkt, dass ich mir die allergrößte Mühe gebe, bloß nicht aufzufallen und möglichst niemals etwas zu tun, was die Aufmerksamkeit auf mich lenken könnte, führe ich doch ein recht interessantes Leben. Und ich habe verdammt großartige Freundinnen und Freunde. Dennoch ist etwas ganz und gar nicht in Ordnung. Es dauert eine Weile, bis ich den Gedanken isoliert habe, der mich plagt. Der sich im Laufe der letzten Jahre eingeschlichen hat und keine Ruhe mehr gibt. Ich weiß nicht, wo er herkommt, aber er kreist in meinem Kopf wie ein giftiges Mantra: Soll das schon alles sein?
Siebenundzwanzig, das ist ein geradezu mythisches Alter für mich. Was vor allem am Club 27