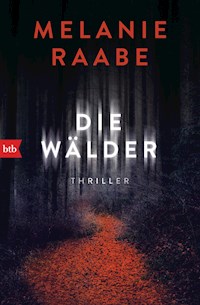9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Sie stellt ihm eine Falle. Aber ist er wirklich ein Mörder?
Die bekannte Romanautorin Linda Conrads, 38, ist ihren Fans und der Presse ein Rätsel. Seit gut elf Jahren hat sie keinen Fuß mehr über die Schwelle ihrer Villa am Starnberger See gesetzt. Trotz ihrer Probleme ist Linda höchst erfolgreich. Dass sie darüber hinaus eine schreckliche Erinnerung aus der Vergangenheit quält, wissen nur wenige. Vor vielen Jahren hat Linda ihre jüngere Schwester Anna in einem Blutbad vorgefunden – und den Mörder flüchten sehen. Das Gesicht des Mörders verfolgt sie bis in ihre Träume. Deshalb ist es ein ungeheurer Schock für sie, als sie genau dieses Gesicht eines Tages über ihren Fernseher flimmern sieht. Grund genug für Linda, einen perfiden Plan zu schmieden – sie wird den vermeintlichen Mörder in eine Falle locken. Doch was ist damals in der Tatnacht tatsächlich passiert?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 472
Ähnliche
MELANIE RAABE
Die Falle
Roman
1. Auflage
Copyright © 2015 by btb Verlag
in der Verlagsgruppe Random House GmbH, München
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-13696-3www.btb-verlag.de
1
Ich bin nicht von dieser Welt.
Das sagen zumindest die Leute. Als ob es nur eine Welt gäbe.
Ich stehe in meinem großen, leeren Esszimmer, in dem ich niemals esse, und sehe nach draußen. Der Raum liegt im Erdgeschoss, der Blick fällt durch eine große Fensterfront auf die Wiese hinter meinem Haus und auf den Waldrand. Dann und wann kann man Rehe beobachten. Füchse.
Es ist Herbst, und während ich so durch das Fenster nach draußen blicke, kommt es mir vor, als sähe ich in einen Spiegel. Das Crescendo der Farben, der Herbststurm, der die Bäume wiegt, der manche ihrer Äste biegt, andere bricht. Der Tag ist dramatisch und schön. Auch die Natur scheint zu fühlen, dass bald etwas zu Ende gehen wird. Sie bäumt sich noch einmal auf, mit all ihrer Kraft, mit all ihren Farben. Bald wird sie still daliegen vor meinem Fenster. Der Sonnenschein wird erst von nassem Grau und schließlich von klirrendem Weiß abgelöst werden. Die Menschen, die mich besuchen kommen – meine Assistentin, mein Verleger, meine Agentin, mehr sind es im Grunde nicht –, werden über die Nässe und die Kälte klagen. Darüber, dass sie erst die Scheibe freikratzen mussten, mit tauben Fingern, bevor sie losfahren konnten. Darüber, dass es noch dunkel ist, wenn sie morgens die Wohnung verlassen, und schon wieder dunkel, wenn sie abends nach Hause kommen. Für mich haben diese Dinge keinerlei Bedeutung. In meiner Welt ist es Sommer wie Winter exakt 23,2 Grad warm. In meiner Welt ist immer Tag und niemals Nacht. Hier gibt es keinen Regen, keinen Schnee, keine kaltgefrorenen Finger. In meiner Welt gibt es nur eine Jahreszeit, und ich habe noch keinen Namen für sie gefunden.
Diese Villa ist meine Welt. Das Kaminzimmer ist mein Asien, die Bibliothek mein Europa, die Küche mein Afrika. Nordamerika liegt in meinem Arbeitszimmer. Mein Schlafzimmer ist Südamerika, und Australien und Ozeanien liegen auf meiner Terrasse. Nur ein paar Schritte entfernt, aber vollkommen unerreichbar.
Ich habe das Haus seit elf Jahren nicht mehr verlassen.
Die Gründe dafür kann man überall in der Presse nachlesen, auch wenn die ein oder andere Publikation ein wenig übertreibt. Ich bin krank, ja. Ich kann mein Haus nicht verlassen, richtig. Aber ich bin nicht gezwungen, in vollkommener Dunkelheit zu leben, und ich schlafe auch nicht unter einem Sauerstoffzelt. Es ist erträglich. Alles ist geregelt. Die Zeit ist ein Strom, gewaltig und sanft, in dem ich mich treiben lassen kann. Nur Bukowski bringt die Dinge ab und zu durcheinander, wenn er draußen im Regen über die Wiesen getollt ist und ein wenig Erde an seinen Pfoten und ein paar Tropfen in seinem Fell mit nach drinnen trägt. Ich liebe es, ihm mit der Hand durch das struppige Fell zu fahren und die Nässe darin auf meiner Haut zu spüren. Ich liebe die schmutzigen Spuren der anderen Welt, die Bukowski auf Fliesen und Parkett hinterlässt. In meiner Welt gibt es keine Erde, keine Bäume und keine Wiesen, keine Kaninchen und keinen Sonnenschein. Das Vogelgezwitscher kommt vom Band, die Sonne aus dem Solarium in meinem Keller. Meine Welt ist nicht weit, aber meine Welt ist sicher. Zumindest dachte ich das.
2
Das Erdbeben kam an einem Dienstag. Es gab keine kleineren Vorbeben. Nichts, das mich gewarnt hätte.
Ich war gerade in Italien unterwegs. Ich reise oft. Am leichtesten fällt es mir, Länder zu bereisen, in denen ich tatsächlich einmal gewesen bin, und in Italien war ich häufig. Also kehre ich ab und zu dahin zurück.
Italien ist ein schönes und gleichzeitig ein gefährliches Land, denn es erinnert mich an meine Schwester.
An Anna, die Italien schon geliebt hatte, lange bevor sie zum ersten Mal dort gewesen war. Die sich als Kind einen Italienischkurs besorgt und die Kassetten so oft abgespielt hatte, bis sie völlig ausgeleiert waren. An Anna, die als Teenager mit ihrer mühselig zusammengesparten Vespa so halsbrecherisch durch die Straßen unserer deutschen Heimatstadt kurvte, als schlängelte sie sich durch die engen Gassen Roms.
Italien erinnert mich an meine Schwester und daran, wie die Dinge früher waren, vor der Dunkelheit. Ich versuche stets, den Gedanken an Anna zu verscheuchen, aber er ist klebrig wie ein altmodischer Fliegenfänger. Andere dunkle Gedanken bleiben daran hängen, unweigerlich.
Dennoch also Italien. Eine ganze Woche lang hatte ich mich in drei nebeneinander liegende Gästezimmer im Obergeschoss zurückgezogen, die ich nie nutze und selten betrete, und sie zu Italien erklärt. Ich hatte die passende Musik aufgelegt, mir italienische Filme angesehen, mich in Dokumentationen über Land und Leute vertieft, hatte überall Bildbände verstreut und mir Tag für Tag von einem eigens beauftragten Catering-Unternehmen kulinarische Spezialitäten aus verschiedenen Regionen des Landes liefern lassen. Und der Wein. Oh, der Wein. Er macht mein Italien beinahe echt.
Ich gehe durch die Gassen von Rom, auf der Suche nach diesem ganz speziellen Restaurant. Die Stadt ist stickig und heiß, ich bin erschöpft. Erschöpft davon, gegen den Strom der Touristen zu schwimmen, erschöpft davon, die Avancen der zahllosen fliegenden Händler abzuwehren, erschöpft von der Schönheit um mich herum, die ich in großen Schlucken getrunken habe. Die Farben erstaunen mich. Der Himmel hängt grau und tief über der Ewigen Stadt, und unter ihm fließt der Tiber in mattem Grün.
Ich muss eingeschlafen sein, denn als ich erwache, ist die Dokumentation über das antike Rom, die ich mir angesehen habe, längst vorbei. Ich bin verwirrt, als ich zu mir komme. Ich kann mich an keinen Traum erinnern, habe aber Schwierigkeiten, in die Wirklichkeit zurückzufinden.
Heutzutage träume ich selten. In den ersten Jahren nach meinem Rückzug aus der wirklichen Welt habe ich intensiver geträumt als je zuvor. Ganz so, als wollte mein Gehirn den Mangel an neuen Impulsen, den es tagsüber erfuhr, in der Nacht wettmachen. Es ersann die farbenfrohsten Abenteuer für mich, tropische Regenwälder mit sprechenden Tieren. Städte aus kunterbuntem Glas, bevölkert von Menschen mit magischen Kräften. Meine Träume begannen immer fröhlich und hell, aber früher oder später färbten sie sich ein, wie ein in schwarze Tinte getauchtes Löschblatt, zunächst fast unmerklich, ganz allmählich. Im Regenwald fielen die Blätter, und die Tiere verstummten. Das bunte Glas war plötzlich messerscharf, man schnitt sich die Finger daran, der Himmel dräute brombeerfarben. Und früher oder später tauchte es auf. Das Monster. Manchmal nur als vages Gefühl der Bedrohung, das ich nicht so recht greifen konnte, manchmal am Rande meines Gesichtsfeldes, als Schemen. Manchmal verfolgte es mich, und ich rannte und vermied es, mich umzusehen, denn ich konnte den Anblick seines Gesichts nicht ertragen, noch nicht einmal im Traum. Wenn ich das Monster direkt ansah, dann starb ich. Jedes Mal. Starb und wachte auf, nach Luft schnappend wie eine Ertrinkende. Und dann, in den ersten Jahren, als die Träume noch kamen, war es schwer, die nächtlichen Gedanken zu verscheuchen, die sich auf meinem Bett niederließen wie Krähen. Und dann konnte ich nicht anders. Egal, wie schmerzvoll die Erinnerungen auch waren – in diesen Momenten dachte ich an sie, an meine Schwester.
Kein Traum, kein Monster heute Nacht, und doch fühle ich mich beklommen. Ein Satz hallt in meinem Kopf nach, den ich nicht recht zu fassen kriege. Da ist eine Stimme. Ich blinzle mit verklebten Augen, bemerke, dass mein rechter Arm eingeschlafen ist, knete ihn, versuche, ihn wiederzubeleben. Der Fernseher läuft noch, und daher kommt die Stimme, die sich in meine Träume geschlichen, die mich geweckt hat.
Es ist eine männliche Stimme, geschäftsmäßig und neutral, so wie sie immer klingen auf diesen Nachrichtenkanälen, die manchmal diese schönen Dokumentationen bringen, die ich so liebe. Ich rappele mich hoch, taste nach der Fernbedienung, finde sie nicht. Mein Bett ist riesig, mein Bett ist die See, so viele Kissen und Decken, Bildbände und eine ganze Armada an Fernbedienungen: für den Fernseher an sich, für den Receiver, für den DVD- und meine zwei Blu-Ray-Player, die verschiedene Formate abspielen können, für die Sound-Anlage, meinen DVD-Rekorder und für mein altes VHS-Gerät. Ich schnaube resigniert, die Nachrichtenstimme berichtet mir Dinge aus dem Nahen Osten, von denen ich nichts wissen will, nicht jetzt, nicht heute, ich habe Urlaub, ich bin in Italien, ich habe mich auf diese Reise gefreut!
Es ist zu spät. Die Realitäten der wirklichen Welt, von denen die Nachrichtenstimme erzählt, die Kriege, die Katastrophen, die Grausamkeiten, die ich so gerne für ein paar Tage ausblenden wollte, sind in meinen Kopf gedrungen und haben mir in Sekundenschnelle alle Leichtigkeit geraubt. Das Italiengefühl ist verschwunden, die Reise geplatzt. Morgen früh werde ich wieder in mein eigentliches Schlafzimmer zurückkehren und den ganzen Italienkram wegräumen. Ich reibe mir die Augen, die Helligkeit des Fernsehers schmerzt mich. Der Nachrichtensprecher hat den Nahen Osten verlassen und berichtet nun über innenpolitische Themen. Resigniert schaue ich ihm zu. Meine müden Augen tränen. Nun hat der Mann seinen Text fertig aufgesagt, und es folgt eine Live-Schaltung nach Berlin. Ein Reporter steht vor dem Reichstag, der sich majestätisch und trutzig in der Dunkelheit erhebt, und erzählt irgendetwas über die letzte Auslandsreise der Kanzlerin.
Mein Blick stellt sich scharf. Ich zucke zusammen, blinzle. Begreife es nicht. Aber ich sehe ihn! Direkt vor mir! Benommen schüttele ich den Kopf. Das kann nicht sein, das kann einfach nicht sein. Ich traue meinen Augen nicht, blinzle erneut, hektisch, als könnte ich das Bild so vertreiben, doch es ändert nichts. Mein Herz zieht sich schmerzhaft zusammen. Mein Gehirn denkt: unmöglich. Aber meine Sinne wissen, dass es wahr ist. Mein Gott!
Meine Welt erzittert. Ich begreife nicht, was um mich herum geschieht, aber mein Bett erbebt, die Bücherregale an den Wänden geraten ins Wanken, brechen schließlich in sich zusammen. Bilder fallen von der Wand, Glas splittert, an der Decke bilden sich Risse, haarfein zunächst, bald fingerdick. Die Wände stürzen ein, der Lärm ist unbeschreiblich, und dennoch ist es still, ganz still.
Meine Welt liegt in Schutt und Asche. Ich sitze auf meinem Bett, inmitten der Trümmer, und starre auf den Fernseher. Ich bin eine offene Wunde. Ich bin der Geruch von rohem Fleisch. Ich klaffe weit auf. Es blitzt in meinem Kopf, schmerzhaft und gleißend hell. Mein Gesichtsfeld färbt sich rot, ich greife mir ans Herz, mir schwindelt, mein Bewusstsein flackert, ich weiß, was das ist, dieses rohe, rote Gefühl, ich habe eine Panikattacke, ich hyperventiliere, gleich werde ich ohnmächtig, hoffentlich werde ich ohnmächtig. Dieses Bild, dieses Gesicht, ich ertrage es nicht. Ich will den Blick abwenden, aber es ist unmöglich, ich bin wie versteinert. Ich will nicht länger hinsehen, aber ich muss, ich kann gar nicht anders, mein Blick ist auf den Fernseher gerichtet, ich kann einfach nicht wegschauen, ich kann nicht, meine Augen stehen weit offen, und ich starre es an, das Monster aus meinen Träumen, und ich versuche, aufzuwachen, endlich aufzuwachen. Zu sterben und dann aufzuwachen, wie ich es immer tue, wenn ich das Monster direkt vor mir sehe, im Traum.
Aber ich bin schon wach.
3
Am nächsten Morgen klettere ich aus den Trümmern hervor und setze mich Stück für Stück wieder zusammen.
Mein Name ist Linda Conrads. Ich bin Autorin. Ich diszipliniere mich jedes Jahr dazu, ein Buch zu schreiben. Meine Bücher sind sehr erfolgreich. Ich bin wohlhabend. Oder besser: Ich habe Geld.
Ich bin 38 Jahre alt. Ich bin krank. Die Medien spekulieren über eine mysteriöse Krankheit, die es mir verbietet, mich frei zu bewegen. Ich habe mein Haus seit über einer Dekade nicht mehr verlassen.
Ich habe Familie. Oder besser: Ich habe Eltern. Ich habe meine Eltern seit vielen Jahren nicht mehr gesehen. Sie besuchen mich nicht. Ich kann sie nicht besuchen. Wir telefonieren selten.
Es gibt etwas, woran ich nicht gerne denke. Allerdings ist es mir unmöglich, nicht daran zu denken. Es hat mit meiner Schwester zu tun. Es ist schon lange her. Ich habe meine Schwester geliebt. Meine Schwester hieß Anna. Meine Schwester ist tot. Meine Schwester war drei Jahre jünger als ich. Meine Schwester ist vor zwölf Jahren gestorben. Meine Schwester ist nicht einfach gestorben. Meine Schwester wurde ermordet. Vor zwölf Jahren ist meine Schwester ermordet worden, und ich habe sie gefunden. Ich habe ihren Mörder flüchten sehen. Ich habe das Gesicht des Mörders gesehen. Der Mörder war ein Mann. Der Mörder wandte mir das Gesicht zu, dann lief der Mörder davon. Ich weiß nicht, warum er davonlief. Ich weiß nicht, warum er mich nicht angegriffen hat. Ich weiß nur, dass meine Schwester tot ist und ich nicht.
Meine Therapeutin bezeichnet mich als hochgradig traumatisiert.
Das ist mein Leben, das bin ich. Ich will eigentlich nicht daran denken.
Ich rappele mich hoch, schwinge die Beine über die Bettkante, stehe auf. Jedenfalls habe ich das vor, aber in Wahrheit rühre ich mich keinen Zentimeter. Ich frage mich, ob ich gelähmt bin. Ich habe keine Kraft in Armen und Beinen. Ich versuche es noch einmal, aber es ist, als kämen die schwachen Befehle meines Gehirns nicht bei meinen Gliedmaßen an. Vielleicht ist es in Ordnung, wenn ich einen Augenblick hier liegen bleibe. Es ist Morgen, aber es ist ja nicht so, als warte etwas auf mich außer meinem leeren Haus. Ich gebe die Anstrengung auf. Mein Körper fühlt sich seltsam schwer an. Ich liege ein bisschen, aber ich schlafe nicht wieder ein. Als ich das nächste Mal auf die Uhr sehe, die auf dem hölzernen Nachttischschränkchen neben dem Bett steht, sind sechs Stunden vergangen. Das wundert mich, das ist nicht gut. Je schneller die Zeit vergeht, desto schneller kommt die Nacht, und ich fürchte die Nacht, all der Lampen in meinem Haus zum Trotz. Nach mehreren Anläufen bringe ich meinen Körper doch noch dazu, ins Badezimmer zu gehen und dann die Treppe ins Erdgeschoss hinunterzusteigen. Eine Expedition ans andere Ende der Welt. Bukowski saust mir glücklich entgegen, schwanzwedelnd. Ich füttere ihn, fülle sein Schälchen mit Wasser, lasse ihn hinaus, ein bisschen herumtoben. Sehe ihm durch die Scheibe hindurch zu, erinnere mich, dass es mich normalerweise glücklich macht, ihm beim Rennen und Spielen zuzusehen, aber ich fühle nichts. Ich will nur, dass er schnell zurückkommt heute, damit ich wieder ins Bett kann. Ich pfeife nach ihm, er ist ein kleines, hüpfendes Pünktchen am Waldrand. Wenn er nicht freiwillig zurückkäme, könnte ich nichts tun. Aber er kommt immer zurück. Zu mir, in meine kleine Welt. Auch heute. Er springt mich an, fordert mich zum Spielen auf, aber ich kann nicht. Er gibt auf, enttäuscht.
Es tut mir leid, Kumpel.
Er rollt sich an seinem Lieblingsplatz in der Küche zusammen und blickt mich traurig an. Ich drehe mich um, gehe in mein Schlafzimmer. Dort lege ich mich sofort wieder ins Bett, ich fühle mich schwach, durchlässig.
Vor der Dunkelheit, vor meinem Rückzug, als ich stark war und in der wirklichen Welt gelebt habe, habe ich mich nur dann so gefühlt, wenn eine schwere Grippe im Anmarsch war. Aber ich bekomme keine Grippe. Ich bekomme eine Depression – wie immer, wenn ich an Anna und die Geschehnisse von damals denken muss, die ich normalerweise so sorgsam ausblende.
So lange habe ich es geschafft, ruhig vor mich hin zu leben und jeden Gedanken an meine Schwester zu unterdrücken. Aber jetzt ist alles wieder da. Und so lange es auch her sein mag – die Wunde hat sich nicht geschlossen. Die Zeit ist ein Quacksalber.
Ich weiß, dass ich etwas unternehmen sollte, bevor es zu spät ist, bevor ich vollends in den Mahlstrom der Depression gerate, der mich hinabzieht in die Schwärze. Ich weiß, dass ich mit einem Arzt sprechen, mir vielleicht etwas verschreiben lassen sollte, aber ich kann mich nicht dazu aufraffen. Die Kraftanstrengung erscheint mir irrsinnig groß. Und letztlich ist es ja auch egal. Dann habe ich eben eine Depression. Ich könnte für immer hier im Bett bleiben. Welchen Unterschied machte es? Wenn ich das Haus nicht verlassen kann, warum sollte ich dann jemals wieder dieses Schlafzimmer verlassen müssen? Oder dieses Bett? Oder die Stelle, an der ich gerade liege? Der Tag geht, und die Nacht nimmt seinen Platz ein.
Ich denke daran, dass ich jemanden anrufen könnte. Norbert vielleicht. Er würde kommen. Er ist nicht nur mein Verleger, wir sind Freunde. Wenn ich die Muskeln in meinem Gesicht bewegen könnte, würde ich beim Gedanken an Norbert schmunzeln. Ich denke an unser letztes Treffen. Wir saßen in der Küche, ich habe uns Spaghetti mit selbst gemachter Bolognese-Sauce gekocht, und Norbert hat mir von seinem Urlaub in Südfrankreich erzählt, von Begebenheiten aus dem Verlag, von den neuesten Verrücktheiten seiner Frau. Norbert ist wunderbar, laut, lustig, voller Geschichten. Er hat das beste Lachen der Welt. Das beste Lachen beider Welten, um genau zu sein.
Norbert nennt mich seine Extremophile. Als er es zum ersten Mal zu mir gesagt hat, musste ich es googeln. Und staunen darüber, wie recht er hat. Extremophile sind Organismen, die sich extremen Bedingungen angepasst haben und so in eigentlich lebensfeindlichen Umgebungen überleben können. In enormer Hitze oder extremer Kälte. In völliger Dunkelheit. In verstrahlter Umgebung. In Säure. Oder eben, und das meint wohl Norbert, in fast kompletter Isolation. Extremophil. Ich mag das Wort, und ich mag es, wenn er mich so nennt. Es klingt, als hätte ich mir das alles hier selbst ausgesucht. Als würde ich es lieben, auf diese extreme Art zu leben. Als hätte ich irgendeine Wahl.
Momentan habe ich nur die Wahl, ob ich auf der linken oder der rechten Seite, auf dem Bauch oder auf dem Rücken liegen möchte. Ein Tag vergeht oder zwei. Ich gebe mir größte Mühe, an gar nichts zu denken. Irgendwann stehe ich auf, trete an die Bücherregale, die die breiten Wände meines Schlafzimmers säumen, ziehe ein paar Bände heraus, drapiere sie auf meinem Bett, lege mein liebstes Billie-Holiday-Album in Endlosschleife auf und schlüpfe wieder unter die Decke. Ich höre, blättere und lese, bis meine Augen schmerzen und die Musik mich ganz aufgeweicht hat wie heißes Badewasser. Ich mag nicht mehr lesen, ich würde gerne einen Film sehen, aber ich traue mich nicht, den Fernseher einzuschalten. Ich traue mich einfach nicht.
Als ich Schritte höre, schrecke ich hoch. Billie singt nicht mehr, ich habe ihre traurige Stimme irgendwann mit Hilfe einer meiner dutzend Fernbedienungen zum Schweigen gebracht. Wer ist da? Es ist mitten in der Nacht. Warum schlägt mein Hund nicht an? Ich möchte mich hochrappeln, nach etwas greifen, womit ich mich verteidigen kann, mich verstecken, irgendetwas tun, aber ich bleibe einfach liegen, mit rasendem Atem, weit offenen Augen. Jemand klopft. Ich sage nichts.
»Hallo?«, ruft eine Stimme, ich kenne sie nicht.
Und dann wieder: »Hallo? Sind Sie da drin?«
Die Tür öffnet sich, ich wimmere, meine kraftlose Version eines Schreis. Es ist Charlotte, meine Assistentin. Natürlich kenne ich ihre Stimme, es war nur meine Angst, die sie so seltsam verzerrt hat. Charlotte kommt zweimal die Woche, kauft für mich ein, bringt meine Briefe zur Post, tut, was zu tun ist. Meine bezahlte Verbindung zur Außenwelt. Nun steht sie unschlüssig im Türrahmen.
»Ist alles in Ordnung?«
Meine Gedanken sortieren sich neu. Es kann nicht Nacht sein, wenn Charlotte hier ist. Ich muss sehr lange im Bett gelegen haben.
»Sorry, dass ich einfach so reingekommen bin, aber als Sie auf mein Klingeln nicht reagiert haben, habe ich mir Sorgen gemacht und aufgeschlossen.«
Klingeln? Ich erinnere mich an ein Geräusch, das in einen meiner Träume gedrungen ist. Ich träume wieder, nach all den Jahren!
»Ich fühle mich ein wenig krank«, sage ich. »Ich habe fest geschlafen und die Klingel nicht gehört. Verzeihen Sie.«
Ich schäme mich ein bisschen, schaffe es noch nicht einmal, mich aufzusetzen, bleibe einfach so liegen. Charlotte wirkt beunruhigt, dabei ist sie nicht so leicht aus der Fassung zu bringen. Genau deswegen habe ich sie mir ausgesucht. Charlotte ist jünger als ich, vielleicht Ende zwanzig. Sie hat eine Menge Jobs, kellnert in mehreren Cafés, arbeitet irgendwo in der Stadt an einer Kinokasse – solche Dinge. Und zweimal wöchentlich kommt sie zu mir. Ich mag Charlotte. Ihre kurzen, blauschwarz gefärbten Haare, ihre robuste Gestalt, ihre kunterbunten Tattoos, ihren dreckigen Humor, die Geschichten von ihrem kleinen Sohn. Dem Satansbraten, wie sie sagt.
Wenn Charlotte nervös wirkt, dann muss ich schlimm aussehen.
»Brauchen Sie was? Aus der Apotheke oder so?«
»Danke, ich habe alles, was ich benötige, im Haus«, sage ich.
Ich klinge komisch, wie ein Roboter, das merke ich selbst, kann es aber nicht ändern.
»Ich brauche Sie heute nicht, Charlotte. Ich hätte Ihnen Bescheid geben sollen. Verzeihung.«
»Kein Problem. Die Einkäufe sind im Kühlschrank. Soll ich vielleicht noch mal mit dem Hund raus, bevor ich gehe?«
Oh Gott, der Hund. Wie lange habe ich hier gelegen?
»Das wäre toll«, sage ich. »Geben Sie ihm auch gleich was zu essen, ja?«
»Okay.«
Ich ziehe mir die Decke bis unter die Nase, um zu signalisieren, dass das Gespräch für mich beendet ist.
Charlotte schwebt noch ein wenig im Türrahmen, offensichtlich unschlüssig, ob sie mich alleine lassen kann, dann trifft sie eine Entscheidung und geht. Ich höre die Geräusche, die sie in der Küche macht, als sie Bukowski füttert. Normalerweise liebe ich es, wenn Geräusche im Haus sind, aber heute bedeutet es mir nichts. Ich lasse mich von Kissen, Decken und Dunkelheit schlucken, aber heute finde ich keinen Schlaf.
4
Ich liege im Dunkeln und denke an den schwärzesten Tag in meinem Leben. Ich erinnere mich, dass ich nicht trauern konnte, als meine Schwester zu Grabe getragen wurde, da noch nicht. Dass mein Kopf und mein Körper angefüllt waren von nur einem Gedanken: Warum? Dass kein Platz für etwas anderes war als: Warum? Warum? Warum? Warum musste sie sterben?
Ich fühlte, dass mir meine Eltern diese Frage stellten, sie, die anderen Trauernden, Annas Freunde, Kollegen, einfach alle, denn ich war doch dort gewesen, ich musste doch etwas wissen. Was um Himmels willen war geschehen? Warum hatte Anna sterben müssen?
Ich erinnere mich, wie die Trauergäste weinten, wie sie Blumen auf den Sarg warfen, einander stützten, sich die Nasen putzten. Das alles fühlte sich so unecht für mich an, so seltsam verzerrt. Die Geräusche, die Farben, sogar die Gefühle. Ein Pastor, der mit seltsam gedehnter Stimme sprach. Menschen, die sich wie in Zeitlupe bewegten. Blumengestecke aus Rosen und Lilien, vollkommen farblos.
Verdammt, die Blumen! Der Gedanke bringt mich in die Gegenwart zurück. Ich setze mich in meinem Bett auf. Ich habe vergessen, Charlotte darum zu bitten, die Blumen in meinem Wintergarten zu gießen, und jetzt ist sie längst wieder weg. Charlotte weiß, wie sehr ich meine Pflanzen liebe und dass ich mich für gewöhnlich selbst um sie kümmere. Daher ist es mehr als unwahrscheinlich, dass sie von sich aus daran gedacht hat, ihnen Wasser zu geben. Mir bleibt nichts anderes übrig, als es selbst zu tun. Stöhnend stehe ich auf. Der Boden unter meinen nackten Füßen ist kühl. Ich zwinge mich, einen Fuß vor den anderen zu setzen, den Flur Richtung Treppe entlangzugehen, ins Erdgeschoss hinunterzusteigen, das große Wohn- und mein Esszimmer zu durchqueren. Ich öffne die Tür zu meinem Wintergarten und betrete den Dschungel.
Mein Haus wird beherrscht von Weite, von Leere, von toten Gegenständen – wenn man einmal von Bukowski absieht. Aber hier, in meinem Wintergarten mit seinem wuchernden, üppigen Grün, regiert das Leben. Palmen. Farne. Passionsblumen, Strelitzien, Flamingoblumen und immer und immer wieder Orchideen. Ich liebe exotische Pflanzen.
Die schwüle Wärme des Wintergartens, der nichts anderes ist als mein eigenes kleines Tropenhaus, treibt mir fast augenblicklich den Schweiß auf die Stirn, das lange, weite T-Shirt, das ich mir zum Schlafen angezogen habe, klebt feucht an meinem Körper. Ich liebe dieses grüne Dickicht. Ich will keine Ordnung. Ich will Chaos, Leben. Ich will, dass die Zweige und Blätter mich streifen, wenn ich durch die Reihen gehe, als liefe ich durch einen Wald. Ich will den Duft der Blüten riechen, mich davon betören lassen, will ihre Farben aufsaugen.
Jetzt sehe ich mich um. Ich weiß, dass der Anblick meiner Pflanzen mich erfreuen müsste, doch heute fühle ich nichts. Mein Wintergarten ist hell erleuchtet, aber draußen herrscht Nacht. Durch das gläserne Dach über mir funkeln gleichgültige Sterne. Wie auf Autopilot führe ich die Tätigkeiten aus, aus denen ich sonst so viel Befriedigung ziehe. Ich gieße die Blumen. Ich fühle mit den Fingern die Erde, ertaste, ob sie trocken und krümelig ist und Wasser braucht, oder ob sie feucht an meinen Händen kleben bleibt.
Ich bahne mir einen Weg in den hinteren Teil meines Gewächshauses. Hier befindet sich mein persönlicher kleiner Orchideengarten. Die Pflanzen türmen sich auf Regalen, hängen in Töpfen von der Decke. Sie blühen verschwenderisch. Hier steht auch mein Liebling, der zugleich mein Sorgenkind ist. Eine kleine Orchidee, ganz unscheinbar zwischen ihren Schwestern mit den üppigen Blüten, hässlich fast, nur zwei, drei matte, dunkelgrüne Blätter, dazu graue, trockene Wurzeln, keine Blüten, schon lange keine Blüten mehr, noch nicht einmal ein Stiel. Sie ist die einzige Pflanze, die ich nicht eigens für diesen Wintergarten gekauft habe. Ich hatte sie schon vorher. Habe sie mitgebracht aus meinem alten Leben, aus der wirklichen Welt – vor vielen, vielen Jahren. Ich weiß, dass sie nie wieder blühen wird, aber ich bringe es nicht übers Herz, sie wegzuwerfen. Ich gebe ihr ein wenig Wasser. Dann wende ich mich einer besonders schönen Orchidee mit schweren, weißen Blüten zu. Ich lasse meine Finger über ihre Blätter gleiten, betaste vorsichtig ihre samtigen Blüten. Die Knospen, die sich noch nicht geöffnet haben, sind fest, beinahe hart zwischen meinen Fingern. Sie bersten fast vor Leben. Nicht mehr lange, und sie werden sich öffnen. Ich denke, dass es schön wäre, ein paar dieser blühenden Stängel abzuschneiden und sie im Haus in eine Vase zu stellen. Und während ich mir das alles durch den Kopf gehen lasse, muss ich plötzlich wieder an Anna denken. Auch hier werde ich die Gedanken an sie nicht los.
Schon als wir noch klein waren, hat sie nicht so gerne Blumen gepflückt wie ich und die anderen Kinder. Es sei gemein, fand sie, den Blumen die schönen Köpfe abzureißen. Ein Lächeln schleicht sich auf meine Lippen, als ich jetzt daran denke. Annas Marotten. Und plötzlich sehe ich meine Schwester ganz deutlich vor mir, ihr blondes Haar, ihre kornblumenblauen Augen, ihre winzige Nase, ihren riesigen Mund, die Falte zwischen ihren fast unsichtbaren Brauen, die immer dann auftauchte, wenn sie sich ärgerte. Die kleinen Muttermale, die ein perfektes Dreieck auf ihrer linken Wange bildeten. Den fast unsichtbaren blonden Flaum auf ihren Wangen, den man nur erkennen konnte, wenn die Sommersonne in einem absolut perfekten Winkel auf ihr Gesicht traf. Ich sehe sie, ganz deutlich. Und ich höre ihre Stimme, glockenhell. Und ihr dreckiges Jungslachen, das in so starkem Kontrast zu ihrem mädchenhaften Wesen stand. Ich sehe sie vor mir, wie sie lacht. Es ist wie ein Schlag in den Magen.
Ich denke an eines der ersten Gespräche mit meiner Therapeutin, kurz nach Annas Tod. Die Polizei hatte keine Spur, das Phantombild, das man mit meiner Hilfe hatte anfertigen lassen, war nutzlos, selbst ich fand, dass es dem Mann, den ich gesehen hatte, nicht besonders ähnlich war. Doch so sehr ich es auch versuchte, ich konnte es nicht besser. Ich erinnere mich, wie ich zu der Therapeutin sagte, dass ich einfach wissen müsse, warum es passiert sei. Dass mich die Ungewissheit quäle. Ich erinnere mich, dass sie sagte, das sei normal, das sei das Schlimmste für alle Angehörigen. Wie sie mir eine Selbsthilfegruppe empfahl. Eine Selbsthilfegruppe, das war ja fast zum Lachen. Ich erinnere mich, dass ich sagte, dass ich alles dafür geben würde, wenn ich doch nur den Grund erfahren könnte. Wenigstens das war ich meiner Schwester schuldig. Wenigstens das.
Warum? Warum? Warum?
»Sie sind von dieser Frage besessen, Frau Conrads, das ist nicht gut, Sie müssen loslassen. Ihr Leben leben.«
Ich versuche, Annas Bild und jeden Gedanken an sie abzuschütteln. Ich will nicht an sie denken, denn ich weiß, wozu das führt. Ich bin schon einmal fast wahnsinnig geworden darüber. Über den Gedanken, dass Anna tot ist – und ihr Mörder immer noch irgendwo da draußen frei herumläuft.
Dass ich nichts tun konnte, das war das Schlimmste. Da war es besser, gar nicht mehr daran zu denken. Mich abzulenken. Anna zu vergessen.
Ich versuche es auch jetzt, aber dieses Mal funktioniert es nicht. Warum?
Das Gesicht des Nachrichtenreporters blitzt vor mir auf, und es macht klick in meinem Kopf. Schlagartig wird mir klar, dass ich in den vergangenen Stunden unter Schock stand.
Aber jetzt sehe ich klar. Der Mann im Fernsehen, dessen Anblick mich so verstört hat, war echt.
Das war kein Alptraum, es war die Realität.
Ich habe den Mörder meiner Schwester gesehen. Es mag zwölf Jahre her sein, aber ich erinnere mich genau. Mit Macht wird mir bewusst, was das bedeutet.
Ich lasse die Gießkanne, die ich gerade erst mit frischem Wasser gefüllt habe, fallen. Scheppernd landet sie auf dem Boden, ihr Inhalt ergießt sich über meine nackten Füße. Ich drehe mich um, verlasse den Wintergarten, stoße mir an der Schwelle zum Haus den Zeh, ignoriere den scharfen Schmerz, der meinen Fuß durchfährt, haste weiter.
Mit schnellen Schritten durchquere ich das Erdgeschoss meines Hauses, nehme die Stufen zum Obergeschoss, schlittere den Flur entlang, komme völlig außer Atem in meinem Schlafzimmer an. Der Laptop liegt auf dem Bett. Er strahlt etwas Bedrohliches aus. Ich zögere nur kurz, dann setze ich mich und ziehe ihn zu mir heran, mit zitternden Fingern. Fast habe ich Angst, ihn aufzuklappen, ganz so, als könnte man mich durch meinen Monitor beobachten.
Ich gehe online, öffne Google, tippe den Namen des Nachrichtensenders ein, auf dem ich den Mann gesehen habe. Ich bin nervös, vertippe mich ein paar Mal, erst beim dritten Anlauf schaffe ich es. Ich rufe die Homepage auf, die zur Nachrichtenredaktion des Senders gehört. Klicke mich durch zu den Mitarbeitern. Denke fast, dass das Ganze vielleicht doch nur ein Hirngespinst war, dass es den Mann gar nicht gibt, dass ich ihn nur geträumt habe.
Aber dann finde ich ihn. Nach nur wenigen Klicks finde ich ihn. Das Monster. Ich schrecke zusammen, als sein Bild plötzlich auf dem Monitor erscheint, halte instinktiv meine linke Hand davor, so dass sie sein Foto verdeckt, ich kann ihn nicht ansehen, noch nicht, die Wände wackeln schon wieder, mein Herz rast. Ich konzentriere mich auf meinen Atem. Schließe die Augen. Ganz ruhig. Gut so. Ich öffne sie wieder, betrachte die Website. Ich lese seinen Namen. Seine Vita. Ich lese, dass er Preise gewonnen hat. Dass er Familie hat. Ein erfolgreiches, erfülltes Leben führt. Etwas zerreißt in mir. Ich fühle etwas, das ich seit Jahren nicht mehr gefühlt habe, und es ist glühend heiß. Langsam nehme ich die Hand herunter, die das Foto auf meinem Monitor verdeckt hat.
Ich betrachte ihn.
Ich blicke in das Gesicht des Mannes, der meine Schwester ermordet hat.
Die Wut schnürt mir die Kehle zu, und ich denke nur noch eines:
Ich werde dich kriegen.
Ich klappe meinen Laptop zu, lege ihn weg, stehe auf.
Meine Gedanken rasen. Mein Herz klopft.
Das Unglaubliche ist: Er lebt ganz in der Nähe! Für jeden normalen Menschen wäre es ein Leichtes, ihn zu stellen. Aber ich bin in meinem Haus gefangen. Und die Polizei, die Polizei hat mir schon damals nicht geglaubt. Nicht wirklich.
Wenn ich ihn also sprechen, ihn konfrontieren, ihn irgendwie zur Rechenschaft ziehen will, dann muss ich ihn schon dazu bewegen, zu mir zu kommen. Wie kann ich ihn ködern?
Erneut schießt mir das Gespräch mit meiner Therapeutin durch den Kopf.
»Warum nur? Warum musste Anna sterben?«
»Sie müssen die Möglichkeit akzeptieren, dass Sie die Antwort auf diese Frage nie bekommen werden, Linda.«
»Das kann ich nicht akzeptieren. Niemals.«
»Sie werden es lernen.«
Niemals.
Ich denke fieberhaft nach. Er ist Journalist. Und ich bin eine berühmte, für ihre Unnahbarkeit berüchtigte Autorin, die seit Jahren von allen großen europäischen Zeitschriften und Sendern förmlich um ein Interview angebettelt wird. Besonders wenn ein neues Buch erscheint.
Wieder denke ich an das Gespräch mit der Psychologin. Und erinnere ich mich an den Rat, den sie mir damals gegeben hat.
»Sie quälen sich nur selbst, Linda.«
»Ich kann die Gedanken nicht stoppen.«
»Wenn Sie einen Grund brauchen, dann erfinden Sie einen. Oder schreiben Sie ein Buch. Spülen Sie es aus Ihrem System. Und dann müssen Sie es loslassen. Leben Sie Ihr Leben.«
Alle Härchen in meinem Nacken stellen sich auf. Mein Gott. Das ist es!
Gänsehaut überzieht meinen Körper.
Es ist so offensichtlich.
Ich werde ein neues Buch schreiben. Die Geschehnisse von damals in einen Kriminalroman verpacken.
Ein Köder für den Mörder und eine Therapie für mich.
Alle Schwere ist aus meinem Körper gewichen. Ich verlasse mein Schlafzimmer, meine Gliedmaßen gehorchen mir wieder. Ich gehe ins Bad, stelle mich unter die Dusche. Ich trockne mich ab, ziehe mich an, betrete mein Arbeitszimmer, fahre meinen Computer hoch und beginne zu schreiben.
Aus »Blutsschwestern« von Linda Conrads
1JONAS
Er schlug mit aller Kraft zu. Die Frau stürzte zu Boden, schaffte es, sich halb hochzurappeln, und versuchte in Panik zu entkommen, hatte aber nicht den Hauch einer Chance. Der Mann war so viel schneller. Er drückte sie mit Gewalt zu Boden, kniete auf ihrem Rücken, packte sie bei ihren langen Haaren und begann, ihren Kopf mit aller Wucht auf den Boden zu schlagen, wieder und wieder. Die Schreie der Frau gingen in ein Wimmern über, dann verstummte sie. Der Mann ließ von ihr ab. In sein Gesicht, das eben noch von blindem Hass verzerrt gewesen war, stahl sich ein ungläubiger Ausdruck. Stirnrunzelnd betrachtete er seine blutverschmierten Hände, während hinter ihm riesig und silbern ein Vollmond aufging. Die Elfen kicherten, eilten zu der wie tot daliegenden Frau, tauchten ein paar schlanke Finger in ihr Blut und begannen, es sich wie eine Kriegsbemalung in die bleichen Gesichter zu schmieren.
Jonas seufzte. Schon seit Ewigkeiten war er nicht mehr im Theater gewesen, und er wäre sicher auch nicht von alleine auf die Idee gekommen. Es war Mia gewesen, die den Wunsch geäußert hatte, mal wieder ins Schauspielhaus zu gehen statt immer nur ins Kino. Eine ihrer Freundinnen hatte ihr die aktuelle Inszenierung von Shakespeares »Sommernachtstraum« empfohlen, und Mia hatte sofort begeistert Tickets besorgt. Jonas hatte sich auf den Abend gefreut. Allerdings hatte er eine leichte Komödie erwartet. Was er stattdessen bekommen hatte, waren alptraumhafte Elfen, diabolische Kobolde und Liebespaare, die sich im nächtlichen Wald mit vollem Körpereinsatz und einem enormen Verbrauch an Kunstblut gegenseitig zerfleischten. Er sah zu seiner Frau hinüber, die mit glitzernden Augen das Geschehen verfolgte. Auch der Rest des Publikums war wie gebannt. Jonas fühlte sich ausgeschlossen. Offensichtlich war er der Einzige im Saal, der dem gewalttätigen Spektakel auf der Bühne nichts abgewinnen konnte.
Vielleicht war er früher auch einmal so gewesen, vielleicht hatte er Grauen und Gewalt auch einmal als faszinierend und unterhaltsam empfunden. Er konnte sich nicht mehr daran erinnern. Vermutlich war es einfach zu lange her.
Seine Gedanken drifteten ab, weg von der Shakespeareschen Mittsommernacht hin zu dem Fall, mit dem er gerade zu tun hatte. Mia hätte ihm einen unauffälligen Stoß in die Rippen versetzt, hätte sie gewusst, dass er neben ihr im Dunkel des Theatersaales saß und doch nur wieder an die Arbeit dachte – aber so war es nun einmal. Er dachte an den letzten Tatort, ging im Kopf die tausend großen und kleinen Puzzlestücke durch, die er und seine Kollegen in mühevoller Kleinarbeit zusammengetragen hatten und die aller Voraussicht nach zur baldigen Verhaftung des Ehemanns des Opfers führen wür…
Jonas erschrak, als es plötzlich komplett dunkel und dann schlagartig sehr hell wurde und ohrenbetäubender Beifall einsetzte.
Als sich das Publikum um ihn herum – wie einer geheimen Verabredung folgend, von der nur er nicht in Kenntnis gesetzt worden war – zu Standing Ovations erhob, kam sich Kommissar Jonas Weber vor wie der einsamste Mensch auf dem Planeten.
Mia schwieg, während er den Wagen durch die nächtlichen Straßen nach Hause lenkte. Ihre Begeisterung über das Stück war sie bereits beim Anstehen an der Garderobe und auf dem Weg zum Parkplatz losgeworden, und nun lauschte sie der Musik, die aus dem Radio kam, ein heiteres Lächeln, das nicht ihm galt, auf den Lippen.
Jonas setzte den Blinker rechts und fuhr in die Einfahrt. Sein Haus schälte sich im Lichtstrahl der Scheinwerfer in körnigem Schwarz-Weiß aus der Dunkelheit. Er zog gerade die Handbremse, als sein Handy zu vibrieren begann.
Er nahm den Anruf entgegen, erwartete, dass Mia neben ihm reagieren, dass sie leise schimpfen, seufzen oder zumindest die Augen verdrehen würde, doch da kam nichts. Ihre kirschroten Lippen formten ein stummes »Gute Nacht«, dann stieg sie aus. Jonas sah ihr hinterher, während die Stimme seiner Kollegin aus dem Handy quoll, sah zu, wie seine Frau sich von ihm entfernte. Wie ihr langes, honigblondes Haar, ihre schmalen Jeans, ihr dunkelgrünes Oberteil langsam schwarz-weiß wurden, als die Dunkelheit sie umschloss.
Früher hatten Mia und er um jede gemeinsam verbrachte Minute gekämpft, hatten es jedes Mal bedauert, wenn ein Einsatz ihre gemeinsame Zeit abrupt unterbrach. Heute war es ihnen zunehmend egal.
Jonas zwang sich, seine Aufmerksamkeit dem Telefonat zuzuwenden. Die Kollegin gab ihm eine Adresse durch, schnell tippte er sie in sein Navigationsgerät ein. Er sagte: »Ja, okay. Bin schon unterwegs.«
Legte auf. Atmete tief aus. Wunderte sich darüber, dass er über seine gerade mal vier Jahre alte Ehe bereits in Kategorien wie »früher« und »heute« dachte.
Jonas wandte seinen Blick von der Tür ab, hinter der Mia verschwunden war, und startete den Wagen.
5
Dinge, die es nicht gibt in meiner Welt: Kastanien, die plötzlich vom Baum fallen. Kinder, die mit den Füßen durch Herbstlaub rascheln. Kostümierte Menschen in Straßenbahnen. Schicksalhafte Zufallsbegegnungen. Kleine Frauen, die von ihren großen Hunden durch die Gegend gezogen werden, als führen sie Wasserski.
Sternschnuppen. Entenküken beim Schwimmunterricht. Sandburgen. Auffahrunfälle. Überraschungen. Schülerlotsen. Achterbahnen. Sonnenbrand.
Meine Welt kommt mit wenigen Farben aus.
Musik ist meine Zuflucht. Filme sind mein Zeitvertreib, Bücher sind meine Liebe, meine Leidenschaft. Aber Musik ist meine Zuflucht. Wenn ich fröhlich oder ausgelassen bin, was zugegebenermaßen selten vorkommt, dann lege ich eine ebensolche Scheibe auf – von Ella Fitzgerald vielleicht oder Sarah Vaughan –, und dann habe ich fast das Gefühl, dass sich jemand mit mir freut. Wenn ich dagegen traurig bin und niedergeschlagen, dann leiden Billie Holiday oder Nina Simone mit mir. Trösten mich vielleicht sogar ein bisschen, manchmal.
Ich stehe in der Küche, höre Nina und fülle eine Handvoll Kaffeebohnen in meine altmodische kleine Mühle. Ich genieße den Geruch des Kaffees, dieses kräftige, dunkle, tröstliche Aroma. Ich beginne, die Bohnen zu mahlen, von Hand. Freue mich über das knackende, krachende Geräusch, das sie dabei machen. Anschließend öffne ich das kleine hölzerne Fach, in dem der gemahlene Kaffee gelandet ist, und fülle ihn in einen Filter. Wenn ich allein daheim bin und nur Kaffee für mich selbst brauche – also meistens –, dann bereite ich ihn stets von Hand zu. Das Einfüllen, das Mahlen, das Umfüllen, das Aufkochen des Wassers, das langsame, stetige Aufbrühen des Kaffees, der langsam in meine Tasse tröpfelt – das ist ein Ritual. Wenn man ein so ruhiges Leben führt wie ich, dann tut man gut daran, sich an den kleinen Dingen zu erfreuen.
Ich leere den Filter aus und betrachte den schwarzen Kaffee in meiner Tasse, setze mich damit an den Küchentisch. Der Duft, der in der Luft hängt, beruhigt mich ein wenig.
Durch das Küchenfenster kann ich die Zufahrt zu meinem Haus sehen. Sie liegt ganz friedlich da. Doch schon bald wird das Monster aus meinen Träumen diesen Weg nehmen. Es wird an meiner Tür klingeln, und ich werde ihm öffnen. Der Gedanke ängstigt mich.
Ich nehme einen Schluck Kaffee, verziehe das Gesicht. Normalerweise trinke ich ihn gerne schwarz, aber heute ist er mir zu stark geraten. Ich hole die Kaffeesahne aus dem Kühlschrank, die ich für Charlotte oder andere Besucher bereithalte, und kippe einen ordentlichen Schwung in meinen Kaffee. Fasziniert beobachte ich die kleinen Sahnewölkchen, die durch meine Tasse wirbeln, die sich zusammenziehen und wieder ausdehnen, vollkommen unkalkulierbar in ihren Bewegungen wie spielende Kinder. Und mir wird klar, dass ich mich in eine Situation begebe, die ebenso unberechenbar ist wie diese wirbelnden kleinen Wolken, die ich nicht kontrollieren kann. Ich kann den Mann in mein Haus locken, ja.
Und dann?
Die Wölkchen hören auf zu tanzen, lassen sich nieder. Ich nehme einen Löffel, rühre um, trinke meinen Kaffee in kleinen Schlucken. Mein Blick ruht auf der Zufahrtsstraße zu meinem Haus. Sie ist von alten Bäumen gesäumt, schon bald wird sie von gelben, roten und braunen Kastanienblättern übersät sein. Erstmals wirkt sie bedrohlich auf mich. Das Atmen fällt mir plötzlich sehr schwer.
Ich kann das nicht.
Ich reiße meinen Blick von der Zufahrt los und nehme mein Smartphone zur Hand. Ich tippe eine Minute oder zwei darauf herum, bis ich die Stelle gefunden habe, an der ich die Unterdrückung meiner Rufnummer einschalten kann. Ich stehe auf, drehe die Musik leiser. Dann setze ich mich wieder und wähle die Nummer des Kommissariats, das damals in Annas Mordfall ermittelt hat. Ich kenne sie auswendig, selbst heute noch.
ENDE DER LESEPROBE