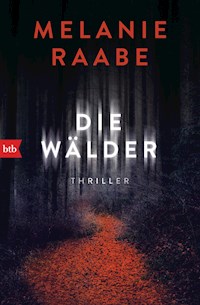18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Über Schlaf und Schlaflosigkeit, über Träume und die Geister der Vergangenheit.
Im Leben der jungen Wissenschaftlerin Mara Lux dreht sich fast alles um das Thema Schlaf. Die Wahl-Londonerin ist eine führende Forscherin auf diesem Gebiet, gleichzeitig leidet sie selbst seit vielen Jahren unter quälender Insomnia. Sie fürchtet ihre Träume, die bisweilen auf unerklärliche Weise in die Wirklichkeit zu schwappen scheinen. Mara, die nicht nur durch und durch rational ist, sondern die auch gerne alles unter Kontrolle hat, macht das sehr zu schaffen.
In Deutschland ist sie fast nie, ihre Eltern sind früh gestorben, deshalb ist Mara nicht wenig überrascht, als sie eines Tages eine Nachricht von einem Notar aus Frankfurt erhält: Jemand möchte ihr ein großes, altes Herrenhaus in der deutschen Provinz vermachen, und zwar anonym. Mara glaubt an eine Verwechslung – und reist dennoch, neugierig geworden, in die ihr fremde Kleinstadt, um sich das Ganze anzusehen. Erstaunt muss sie feststellen, dass sie durch ihre Träume mit diesem Ort auf seltsame Weise verbunden ist. Der neue Roman von Melanie Raabe – über Schlaf und Schlaflosigkeit, über Träume und die Geister der Vergangenheit, über Geheimnisse und den Verlust geliebter Menschen, übers Innehalten und Weitermachen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 450
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Zum Buch
Der neue Roman von Melanie Raabe – über Schlaf und Schlaflosigkeit, über Träume und die Geister der Vergangenheit, über Geheimnisse und den Verlust geliebter Menschen, übers Innehalten und Weitermachen.
Im Leben der jungen Wissenschaftlerin Mara Lux dreht sich fast alles um das Thema Schlaf. Die Wahl-Londonerin ist eine führende Forscherin auf diesem Gebiet, gleichzeitig leidet sie selbst seit vielen Jahren unter quälender Insomnia. Sie fürchtet ihre Träume, die bisweilen auf unerklärliche Weise in die Wirklichkeit zu schwappen scheinen. Mara, die nicht nur durch und durch rational ist, sondern die auch gerne alles unter Kontrolle hat, macht das sehr zu schaffen.
In Deutschland ist sie fast nie, ihre Eltern sind früh gestorben, deshalb ist Mara nicht wenig überrascht, als sie eines Tages eine Nachricht von einem Notar aus Frankfurt erhält: Jemand möchte ihr ein großes, altes Herrenhaus in der deutschen Provinz vermachen, und zwar anonym. Mara glaubt an eine Verwechslung – und reist dennoch, neugierig geworden, in die ihr fremde Kleinstadt, um sich das Ganze anzusehen. Erstaunt muss sie feststellen, dass sie durch ihre Träume mit diesem Ort auf seltsame Weise verbunden ist.
Zur Autorin
Melanie Raabe wurde 1981 in Jena geboren. Nach dem Studium arbeitete sie tagsüber als Journalistin – und schrieb nachts heimlich Bücher. 2015 erschien DIEFALLE, 2016 folgte DIEWAHRHEIT, 2018 dann DERSCHATTEN und 2019 DIEWÄLDER. Mit DIEKUNSTDESVERSCHWINDENS (2022) verließ sie schließlich erstmals das Gebiet des traditionellen Thrillers. Ihre Romane wurden in 22 Sprachen übersetzt und vielfach erfolgreich verfilmt. Melanie Raabe lebt und arbeitet in Köln.
Melanie Raabe
Der längste Schlaf
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2024 by btb Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: Sabine Kwauka
Covermotiv: © The Dreamer@Daria Petrilli | Licensore Chiara Roilo | www.dariapetrilli.eu
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-27744-4V003
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/penguinbuecher
eins
Manchmal habe ich das Gefühl, dass meine Schlaflosigkeit längst ein Teil von mir ist. Dass sie zu mir gehört wie meine braunen Augen, meine Vorliebe für Blumen, warme Croissants und gute Bücher oder meine Abneigung gegen Angeber, Zyniker und Rosenkohl. Ich atme tief ein und aus und versuche, mein übermüdetes Gehirn mit Sauerstoff zu versorgen. Es ist unerträglich heiß in der U-Bahn.
Die Tage werden schon seit Langem merklich kürzer, aber die Hitze hat den Hochsommer überlebt. London fühlt sich seltsam an in diesem September, die Schatten werden länger, ich rieche den Herbst bereits in der Luft – doch er kommt nicht. Ich spüre, wie mir mein T-Shirt am Rücken klebt, und bin froh, dass ich mich entschieden habe, das Kostüm für meine Präsentation nicht schon am Morgen anzuziehen, sondern es in einem Kleidersack mitzunehmen. Ich sage »das Kostüm«, weil ich mir in dem teuren, dunkelblauen Anzug von Ralph Lauren, den ich mir eigentlich absolut nicht leisten kann, einigermaßen verkleidet vorkomme. Normalerweise trage ich immer dasselbe: Jeans, ein weißes T-Shirt und – wenn es kühl ist – dazu einen lockeren schwarzen Blazer. Dazu mein unverhandelbarer roter Lippenstift, mein Markenzeichen, meine Kriegsbemalung – und fertig. Ich habe mich früh dazu entschieden, mich nicht mit Nebensächlichkeiten wie Kleidung oder aufwendigem Make-up aufzuhalten, und so hängen in meinem Kleiderschrank acht Paar Jeans, sechzehn weiße T-Shirts und vier verschiedene schwarze Jacketts. Ich betrachte den Kleidersack auf meinem Schoß. Es waren meine besten Freundinnen, die mich dazu gedrängt haben, mir ein besonderes Outfit für meinen Vortrag zuzulegen, und irgendwie landeten wir bei Harrods, und irgendwie drückten sie mir diesen Anzug in die Hand und jubelten, als ich damit aus der Umkleidekabine kam, und ihre Freude war so hinreißend, dass ich mich anstecken ließ.
Erschöpft schließe ich für einen Moment die Augen. Ich habe in den letzten Nächten erneut kaum ein Auge zugetan. Mein Körper fühlt sich schwer an, mein Kopf hingegen seltsam leicht. Ich schlafe seit Jahrzehnten schlecht, was einigermaßen ironisch ist, wenn man mein Forschungsgebiet bedenkt, und rund um den Todestag meiner Eltern, der ausgerechnet auf meinen Geburtstag fällt, den ich seither nie wieder gefeiert habe, ist es immer besonders schlimm. Ich bin natürlich nicht allein mit meiner Schlaflosigkeit, und ganze zwei Drittel aller Erwachsenen bekommen Nacht für Nacht weniger als die empfohlenen acht Stunden. Allerdings weiß ich besser als die meisten, was der permanente Schlafentzug für Körper und Seele bedeutet: Die Tatsache, dass ich die vergangenen Nächte damit verbracht habe, mich im Bett herumzuwälzen, hat schon jetzt verschiedene unangenehme Effekte herbeigeführt. Mein Herz schlägt schneller als sonst, mein Blutdruck steigt. Die Gefahr, irgendwann an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu sterben, erhöht sich mit jeder schlechten Nacht, ebenso mein Risiko für Diabetes und Alzheimer. Mein Immunsystem arbeitet nicht mehr effizient, meine Blutzuckerwerte sind gestört. Und das sind nur die Auswirkungen auf meinen Körper. Die auf meine Psyche sind ähnlich verheerend: Mangelnder Schlaf trägt zu allen psychiatrischen Erkrankungen bei, die wir kennen, allen voran Depression.
Ich weiß diese Dinge. Ich bin Neurowissenschaftlerin und befasse mich vorrangig mit Schlaf. Allerdings bräuchte ich weder all die Fachliteratur in meinem Arbeitszimmer noch meinen Doktortitel, um zu begreifen, dass tagelange Schlaflosigkeit keine gute Sache ist, denn: Ich fühle mich absolut grauenhaft.
Ich öffne die Augen, als ich spüre, dass ich jetzt und hier einschlafen und dann womöglich meine Station verpassen könnte, blinzele angestrengt, versuche, meinen Blick scharfzustellen. Schaue mich um im Abteil. Da ist eine hochschwangere Frau mit Kinderwagen, deren vielleicht anderthalbjähriges Mädchen mich neugierig ansieht. Ich schenke der Kleinen ein Lächeln, und sie strahlt zurück. Sie und ich sind die Einzigen in diesem Waggon, die nicht auf ein Display schauen, und ich schneide ein paar Grimassen für sie, was sie wahnsinnig zum Lachen bringt, bis sie schließlich, eine Station vor mir, mit ihrer Mutter aussteigt.
Die Underground holpert mich meinem Ziel entgegen, und als ich die Treppen Richtung Ausgang nehme und schließlich das Licht der Welt erblicke, da ist es kurz so, als sähe ich das alles hier zum ersten Mal. Die geduldigen Wasser der Themse, die unaufgeregt durch diese hektische Stadt fließen, die Tower Bridge, die schon um diese Zeit Menschen mit Handykameras anzieht. Auf meinem Weg zum King’s College, der Universität, an der ich einst studiert habe und nun selbst forsche und lehre, bleibe ich kurz stehen und sehe mich um. Versuche, diesen Moment festzuhalten. Aus dem ahnungslosen Mädchen aus der deutschen Kleinstadt, der jungen Studentin, die mit einem viel zu knapp bemessenen Stipendium und großen Hoffnungen in die Stadt kam, ist eine renommierte Forscherin geworden, die ihre Arbeit heute auf einer Plattform präsentieren darf, die sie potenziell Millionen Menschen auf der ganzen Welt zugänglich machen wird. Die berühmte TED-Konferenz fand bisher alljährlich in Vancouver statt. Dass die Veranstaltung dieses Jahr einen europäischen Ableger bekommt, stellt eine Premiere dar. Alle sagen mir seit Monaten, dass meine Teilnahme eine riesengroße Sache ist. Als wüsste ich das nicht selber.
Ich reiße mich vom Postkarten-London los und setze meinen Weg fort, halb, weil es zu heiß ist, um sich freiwillig in der Sonne aufzuhalten, halb, weil ich nicht so der sentimentale Typ bin und mich nicht besonders gerne mit früher beschäftige. Ich bin seit fünfzehn Jahren in der Stadt, ich bin gekommen, geblieben und habe nie einen Blick zurückgeworfen. Ich stecke Shawn, dem bärtigen Obdachlosen, der mit seinem Schäferhund an der Straßenecke sitzt, ein paar Pfund in den Pappbecher, bleibe kurz stehen.
»Wird heiß heute«, sage ich. »Brauchst du ein Wasser oder so?«
Er schaut mich an, freundliche braune Augen in einem wettergegerbten Gesicht.
»Der längste Sommer und der letzte«, sagt er.
»Wie meinst du das?«
»Genau wie ich es sage«, antwortet er. »Der längste Sommer und der letzte.«
Ich will gerade etwas erwidern, als ich bemerke, dass sein Hund sich aufgesetzt hat und intensiv etwas anstarrt, das sich direkt hinter meinem Rücken zu befinden scheint. Instinktiv drehe ich mich um, doch dort ist nichts. Auch Shawn starrt nun auf einen Punkt irgendwo hinter mir, einen nachdenklichen Ausdruck im Gesicht.
»Alles okay?«, frage ich, erhalte jedoch keine Antwort.
Stirnrunzelnd hole ich eine kleine Flasche Wasser aus meiner Tasche, die ich ohnehin nicht brauche, weil ich im Büro auch einfach Leitungswasser trinken kann, und stelle sie ihm hin.
Ich eile vorbei an Studierenden, die in die Bibliotheken schwärmen, vorbei an den dog walkers, die manchmal gleich ein ganzes Rudel großer und kleiner Hunde ausführen oder von ihnen ausgeführt werden, man weiß es bisweilen nicht so genau. Ich durchquere den Park, vorbei an den schlafenden Männern auf der Wiese, an den Seniorinnen, die im Schatten Tai-Chi üben und deren fließende Bewegungen ich fast jeden Morgen bewundere, vorbei an den Grüppchen brauner Nannys, die in teuren Kinderwagen weiße Kinder vor sich herschieben. Ich biege ein in die Straße, die zu dem Gebäude führt, in dem mein Büro liegt, ignoriere den Baulärm, ignoriere das aggressive Gehupe eines Taxi-Fahrers, der mit einem anderen Autofahrer aneinandergeraten ist, ignoriere den Lärm, den ein vorbeifahrender Feuerwehr-Löschzug verursacht, und erreiche mein allmorgendliches Ziel. Als ich an dem Foodtruck vorbeikomme, der in der Früh Bagels und tagsüber Sandwiches anbietet, hebe ich grüßend die Hand in Richtung von Rami, der ihn betreibt und der mir normalerweise mein Frühstück verkauft: einen schwarzen Kaffee und dazu ein oder zwei Bagels, die ich für gewöhnlich oben am Schreibtisch zu mir nehme, während ich meine E-Mails beantworte. Ich bin so auf dieses Ritual konditioniert, dass mein Magen augenblicklich anfängt zu knurren, als ich Rami sehe. Und das, obwohl ich ausgiebig gefrühstückt habe. Aber so ist das eben bei mir: Ich kann immer essen. Ich liebe meine Arbeit, meine Freundinnen und Freunde, klare Definitionen und den Duden, roten Lippenstift und: Essen, da kann man nichts machen.
»Hey Rami«, sage ich. »Wie geht’s dir heute Morgen?«
Gleich wird er antworten, dass er zu viel zu tun hat und dafür wirklich zu wenig Geld bekommt, und ich liebe diesen ritualisierten kleinen Austausch, den wir hier jeden Morgen, Montag bis Samstag, aufführen.
»Viel Arbeit, wenig Geld«, sagt Rami, verdreht scherzhaft die Augen.
Ich grinse.
»Und wie geht’s dir?«
»Es muss ja«, antworte ich auf Deutsch.
Es muss ja ist einer von mehreren deutschen Sätzen, die ich Rami in den letzten Jahren beigebracht habe und sein absoluter Favorit. Er lacht.
»Das Übliche?«, fragt er schließlich, als sich eine weitere Kundin nähert.
Ich beschließe, mich zusammenzureißen.
»Heute nur einen Kaffee bitte, ich habe schon gefrühstückt.«
Er schaut beleidigt, sagt aber nichts. Ich nehme meinen Kaffee und lege ein paar Pfund auf den Tresen. Ich liebe es, dass ich bei Rami noch mit Bargeld bezahlen kann, wenn es ihn nicht gäbe, wüsste ich gar nicht mehr, wie sich das anfühlt.
»Und war dein Frühstück so gut wie meine Bagels?«,fragt er schließlich.
»Nicht mal annähernd«, sage ich und werfe einen begehrlichen Blick auf das Gebäck in der Auslage, verziehe nachdenklich den Mund.
Rami beobachtet mich genau, er kennt mich und ahnt, dass meine Willenskraft seinen Backwaren nicht gewachsen ist.
»Na ja, vielleicht einen kleinen«, sage ich, noch ein wenig unschlüssig.
Ramis Lachen wärmt mich noch, als ich, den Kleidersack über dem Arm, meinen Kaffee in der einen, eine Tüte mit zwei Bagels in der anderen Hand, mein Büro betrete. Kaum, dass ich mich gesetzt und den ersten Schluck Kaffee genommen habe und gerade in mein zweites Frühstück beißen will, streckt Patience ihren Kopf durch die Tür. Mein Magen knurrt vernehmlich, was eigentlich – Stichwort bereits vertilgtes enormes Frühstück – unmöglich ist.
Hunger, denke ich, der: [unangenehmes] Gefühl in der Magengegend, das durch das Bedürfnis nach Nahrung hervorgerufen wird; Verlangen, etwas zu essen beziehungsweise [große] Lust, etwas Bestimmtes zu essen; Appetit. Aber auch: Mangel an Nahrungsmitteln; Hungersnot oder heftiges, leidenschaftliches Verlangen, Begierde.
Ich schiebe den Bagel zurück in seine Papiertüte und lächele Patience an. Ich mag Patience, habe sie selbst als wissenschaftliche Mitarbeiterin eingestellt, aber ich bin noch nie jemandem begegnet, dessen Name weniger zu ihm passt. Keine Ahnung, was ihre Eltern sich gedacht haben, als sie sie Geduld genannt haben. Patience ist brillant, und arbeitet Tag und Nacht, wahrscheinlich wird sie ihre erste Juniorprofessur noch früher erhalten, als ich damals meine. Vor allem aber ist sie so ungeduldig, dass selbst ich neben ihr wie die Gelassenheit in Person wirke.
»Großer Tag heute, oder?«, fragt sie.
Ich hebe die Schultern.
»Ehrlich gesagt versuche ich, mich deswegen nicht verrückt zu machen.«
»Na ja. Wie ich dich kenne, könntest du deinen Talk sogar im Schlaf halten. Und zwar seit Monaten.«
Da hat sie natürlich recht. Ich werde darüber sprechen, dass wir eine Gesellschaft sind, die verlernt hat, richtig zu schlafen. Wer wüsste das besser als ich? Ich werde die neuesten Erkenntnisse der Forschung teilen, in der Hoffnung, dass sie den anderen Schlaflosen da draußen helfen. Denn für gewöhnlich tun sie das – wenn auch nicht bei mir.
»Ich wusste gar nicht, dass du heute reinkommst«, sagt Patience. »Hast du nicht gesagt, die Leute von TED wollen alle Speaker schon ultra früh dahaben?«
»Schon«, sage ich. »Ich bleibe heute auch nicht lange. Wollte nur fix meine Post durchsehen.«
»Na, ich lasse dich mal«, sagt Patience. »Viel Glück später, okay?«
»Danke, love.«
Die Tür schließt sich hinter ihr, und ich nehme noch einen Schluck Kaffee, ehe ich endlich in mein zweites Frühstück beiße und beginne, mich durch meine E-Mails zu klicken. Da sind Nachrichten meiner Studierenden, die sich schon jetzt um die Lektüre fürs nächste Semester sorgen, ein paar Nachrichten von Kolleginnen und Kollegen, die mir Glück für meine Präsentation wünschen, was mich kurz zum Lächeln bringt. Ich scrolle mich weiter durch mein Postfach und stutze, als ich eine deutsche E-Mail finde. Ich lebe schon so lange in London und habe praktisch alle Verbindungen nach Deutschland gekappt – von der Freundschaft zu Roxi, meiner besten und ältesten Freundin einmal abgesehen. Roxi heißt eigentlich Roxane, wurde früher viel gehänselt oder dumm angequatscht wegen ihres Namens und beschloss daraufhin, ihn mit einer Extraportion Stolz zu tragen. »Roxi« darf nur ich sie nennen, weil wir Kinder waren, als wir einander kennenlernten, für alle anderen ist sie Roxane, sie besteht darauf. Sie genießt es, sich mit ihrem Namen vorzustellen, sie sagt ihn gerne, sie buchstabiert ihn gerne, trägt ihn gerne in Formulare ein, und viel mehr muss man über dieses anbetungswürdige Wesen eigentlich gar nicht wissen. Roxi ist die Coolness in Person, sie ist furchtlos, und ihr Selbstbewusstsein ist unerschütterlich, im nächsten Leben möchte ich gerne entweder als Vogel oder als Roxi wiedergeboren werden.
Neugierig klicke ich auf die E-Mail. Sie kommt von einem Notar in Frankfurt, der mich im Auftrag eines Klienten gerne über eine so wichtige wie dringliche Angelegenheit in Kenntnis setzen möchte, und mich um einen Anruf bittet. Es gehe um eine Schenkung. Um eine Immobilie. Seltsam. Ich kann mir keinen Umstand ausmalen, unter dem das Sinn ergäbe. Ich habe keine auch noch so entfernten Verwandten mehr in Deutschland, die mir etwas vererbt haben könnten. Eine Verwechslung vielleicht, eine zufällige Namensgleichheit? Oder Spam? Neugierig geworden tippe ich auf den Link zur Homepage, die in der Signatur von Notar Dr. Aaron Schmidt zu finden ist. Die Seite, die sich auf meinem Monitor öffnet, arbeitet mit gedeckten Blautönen und strahlt Ruhe und Seriosität aus. Ich scrolle vorbei an den Dienstleistungen des Notariats – Beurkundung, Erstellung juristischer Gutachten und so weiter und so weiter – bis ich ein Foto finde. Es zeigt eine brünette Frau mit rahmenloser Brille im dunklen Kostüm, die neben einem weißhaarigen Mann im schwarzen Anzug steht. Beide lächeln offen in die Kamera. Ich betrachte Dr. Aaron Schmidt einen Moment lang. Ich bin versucht, sofort zum Telefon zu greifen, um die Sache zu klären, entscheide mich dann aber doch anders. Wenn ich, ehe ich zur Konferenz aufbrechen muss, zumindest meine wichtigsten Mails beantworten und die Post durchsehen will, habe ich für Telefonate außer der Reihe jetzt keine Zeit. Ich beschließe also, mich später darum zu kümmern.
Das Konferenzzentrum liegt unweit des British Museum, und ich habe aus der Erfahrung des Morgens gelernt und mir einen klimatisierten Uber bestellt, statt erneut in den Hades Underground zu steigen. Ein sehr freundlicher junger Hipster mit tätowierten Händen nimmt mich in Empfang, verpasst mir ein Namensschild und führt mich in den Backstagebereich. Bis ich das Konferenzzentrum betrat, lag die Müdigkeit auf mir wie Blei, und jeder Schritt fühlte sich so an, als müsste ich nicht Luft durchschreiten, sondern eine klebrige Masse, dunklen Honig. Doch nun, wo ich vor Ort bin und die Anspannung aller förmlich in der Luft schmecken kann, schießt auch bei mir das Adrenalin in den Körper und weckt mich zuverlässig auf.
»Ich bringe Sie erst mal in die Maske, wenn das okay ist, und danach zum Green Room.«
»Das ist sehr okay«, sage ich.
Kate, die Visagistin, die mich bühnentauglich machen soll, erwartet mich bereits. Im Stuhl nebenan sitzt ein drahtiger, sehr fit wirkender Mann, den ich auf Anfang fünfzig schätze, und lässt sich von Kates Kollegin die Augenringe überschminken. Ein Leidensgenosse, eindeutig. Ich erkenne Menschen, die zu wenig schlafen, aus ein paar Meilen Entfernung. Ich grüße, setze mich.
»Hey«, sagt mein Sitznachbar. »Du bist die Schlafforscherin, oder?«
Ich nicke.
»Mara«, sage ich. »Freut mich.«
»Seo-yeon«, sagt er, und mit einem Schlag weiß ich, mit wem ich es zu tun habe, ich habe in einer der Mails im Vorfeld der Konferenz über ihn und sein Start-up, das er im Silicon Valley aufgebaut hat, gelesen.
Ich habe mich geirrt, es ist nicht chronische Insomnia, die ihm dunkle Schatten unter die Augen gemalt hat, sondern die Zumutung namens Jetlag.
»Du bist der CEO von Spirited Away!«, sage ich.
Er lächelt und zeigt seine perfekten, strahlend weißen Zähne, die durch seine kalifornische Bräune noch heller wirken.
»Ich habe von dir gelesen«, füge ich hinzu, während Kate mir Concealer unter die Augen tupft. »Aber ich habe nicht hundertprozentig verstanden, wie genau dein Business funktioniert.«
Sein Lächeln wird noch breiter, er muss diese Frage Abertausende Male beantwortet haben.
»Wir erstellen digitale Geister.«
»Was genau muss ich darunter verstehen?«
»Unsere Kundschaft besteht aus Menschen, die mit dem bevorstehenden Tod einer geliebten Person konfrontiert sind«, erzählt er. »Die meisten von ihnen können sich einfach nicht vorstellen, nie wieder mit ihren Liebsten zu kommunizieren. Dank unserer KI bleibt ihnen diese absolute Form des Abschiedes erspart, und sie können weiter mit der geliebten Person in Austausch treten.«
Kurz stelle ich mir vor, wie es wäre, weiterhin mit meinen toten Eltern kommunizieren zu können, während Kate damit beginnt, meine Augenbrauen in Form zu bürsten.
»Merkwürdige Vorstellung«, sage ich.
»Vielleicht«, entgegnet Seo-yeon. »Zumindest dann, wenn man zum ersten Mal darüber nachdenkt. Aber viele Dinge, die uns heute normal erscheinen, galten noch vor zweihundert Jahren als absolut abwegig.«
Ich lasse das einen Augenblick auf mich wirken, und meine Maskenbildnerin nutzt den Moment, um mich zu bitten, die Augen zu schließen. Ich gehorche.
»Und wie funktioniert es?«, frage ich. »Ganz praktisch?«
Kates Pinsel kitzelt auf meinen Augenlidern.
»Wir nehmen alle digitalen Daten von der Person, die bald gehen wird, die uns zur Verfügung gestellt werden können. Textnachrichten, Voicemails, Posts auf Social Media, Videomaterial – einfach alles. Verkürzt gesagt: Wir füttern damit unsere KI. Sie lernt, wie die Person sich ausdrückt, wie sie formuliert, vor allem wie sie denkt. All das bleibt auf unseren Servern erhalten. So wird es den Hinterbliebenen möglich, weiter mit den Verstorbenen zu kommunizieren. Über den physischen Tod hinaus.«
»Über Textnachrichten?«, frage ich und öffne wieder die Augen, weil ich merke, dass Kate sich inzwischen mit meinen Lippen beschäftigt.
»So haben wir begonnen«, sagt Seo-yeon »Hinterbliebene konnten weiter Nachrichten mit ihrem verstorbenen Partner austauschen, so, als wäre er einfach nur verreist oder gerade einkaufen. Oder sie konnten sich Rat holen bei ihrer verstorbenen Mutter.«
»Na ja«, sage ich. »Nicht wirklich, oder? Diese digitalen Geister sind ja nicht tatsächlich diese verstorbenen Menschen.«
»Nein«, gibt er zu. »Das sind sie nicht. Aber sie sagen, was diese Verstorbenen sagen würden, wenn sie es noch könnten.«
»Interessant.«
Und irgendwie verdammt schräg.
»Und was ist der nächste Schritt? Du sagtest gerade, mit Textnachrichten habt ihr begonnen. Wie geht es weiter?«
»Audio«, sagt er. »Da sind wir bereits. Und dann: Video.«
Das muss ich sacken lassen. Seo-yeons Maskenbildnerin lässt ihn derweil wissen, dass er fertig ist, und er bedankt sich, erhebt sich. Ich betrachte ihn über die Spiegel vor mir. Ich finde sein Unterfangen ziemlich wahnsinnig, aber wer bin ich schon, das zu beurteilen?
»Viel Erfolg gleich«, sagt Seo-yeon und legt mir freundlich eine Hand auf die Schulter. »Ich bin sehr gespannt auf deinen Talk.«
»Danke«, sage ich. »Ebenso.«
Er ist schon fast durch die Tür, da fällt mir noch etwas ein.
»Wie kam dir die Idee?«, frage ich. »Zu Spirited Away?«
Kurz verdunkelt sich sein Gesicht, aber er fängt sich schnell.
»Mein Zwillingsbruder«, sagt er. »Ein Tauchunfall vor neun Jahren.«
Er hebt leicht die Schultern, lächelt. Dann zaubert er sein Smartphone aus der Tasche, beginnt im Gehen, darauf herumzutippen, und ist bald verschwunden. Und ich blicke ihm hinterher und frage mich, ob er gerade eine berufliche E-Mail beantwortet oder mit dem Geist seines toten Zwillingsbruders textet. Was für eine Welt.
»Krass, oder?«, sagt Kate.
»Ein bisschen schon.«
Ich denke an die Menschen aus dem U-Bahn-Abteil heute Morgen, an die Smartphones in ihren Händen, die gesenkten Köpfe, die konzentrierten Blicke. Körperlich waren sie bei mir im Abteil, aber ihr Geist war woanders. Sind wir alle Geister, inzwischen? Trudeln wir irgendwo im Äther umher, losgelöst von unseren Körpern? Ich nehme mir vor, bei Gelegenheit mit Elif darüber zu sprechen, eine meiner besten Freundinnen hier in der Stadt und eine der technikaffinsten Personen, die ich kenne, die allerdings kürzlich wieder auf ein Klapphandy umgestiegen ist, das sie auf Ebay ersteigert hat, weil sie der doch einigermaßen dramatischen Meinung ist, ihr Smartphone zerstöre ihre Seele. Ich wende meine Aufmerksamkeit wieder meinem Spiegelbild zu. Kate hat meine Augenringe überschminkt, routiniert Make-up aufgetragen, meine Wimpern getuscht und meinen Lippenstift aufgefrischt. Nun bearbeitet sie gerade meine Wangen. Ich plaudere freundlich mit ihr und lasse das alles irgendwie über mich ergehen, aber mit den Gedanken bin ich ganz woanders. Wenn ich die Gelegenheit hätte, mit den Toten zu reden. Würde ich es tun?
Der Raum, in den ich anschließend gebracht werde, sieht aus, wie Green Rooms von Konferenzzentren eben aussehen: sehr kühl, sehr clean, sehr karg. Auf dem Tisch in der Mitte des Raumes stehen gesunde Snacks. Äpfel, Bananen und Trauben, Beeren, aufgeschnittene Mangos und Kiwis, dazu Wasser, Green Juices in kleinen Glasflaschen, Ingwer-Kurkuma-Shots, aber auch jede Menge Softdrinks, allesamt aus dem Portfolio der Sponsoren. Es gibt eine Sitzecke, die niemand nutzt. Drei Personen stehen an der Fensterfront, von der aus man auf das Wasser schauen kann. Ich erkenne einen Altersforscher, über den ich schon viel gelesen habe, der seiner ultrareichen Klientel mit einer Mischung aus Fastenkuren und Medikamentencocktails dazu verhelfen will, mindestens einhundertundzehn Jahre alt zu werden. Er trägt einen schwarzen Anzug mit weißem Hemd ohne Krawatte zu seiner Filmstarbräune, und ich muss ihn bei Gelegenheit unbedingt mal fragen, was in seinen Pillen steckt. Ihm gegenüber steht eine sehr berühmte Tennisspielerin, die über körperliche und emotionale Resilienz sprechen und der Konferenz ein bisschen von dem Glamour verleihen wird, den Wissenschaftlerinnen wie ich leider nicht liefern können. Und dann ist da noch eine sehr dünne, sehr junge, sehr hektisch wirkende Frau, die sich im Hintergrund hält, aber permanent nervös auf ihr Handy schaut, und ich bin mir ziemlich sicher, dass es sich bei ihr um die Assistentin der Tennisspielerin handelt. Der Altersforscher gibt mir die Hand, die Tennisspielerin nickt mir zu, dann schnappe ich mir einen Apfel und einen Müsliriegel, und der freundliche Hipster zeigt mir meine Einzelgarderobe. Auf dem Gang hasten aufgeregte Leute hin und her, und ich versuche, mich nicht von ihrer Hektik anstecken zu lassen. Nur ein Talk, kein Grund, sich aufzuregen. Wenn ich mir das nur immer wieder sage, glaube ich es vielleicht irgendwann selbst.
Als der Hipster verschwunden ist und ich allein in meiner Garderobe zurückbleibe, empfinde ich einen Moment der Erleichterung. Unter dem Adrenalin spüre ich meine Erschöpfung. Ich schließe die Tür und betrachte mich im Spiegel. Ich sehe jung aus für mein Alter und habe früh gelernt, dass es Bereiche des Lebens gibt, in denen das von Vorteil ist. Meiner, die Forschung, gehört nicht dazu. Ich ziehe mich aus, hole meinen neuen, dunkelblauen Anzug aus dem Kleidersack, ziehe ihn an, schlüpfe in meine schwarzen High Heels. Schaue mich an. Sehe schick aus und komme mir verkleidet vor. Ich zögere nur kurz, dann ziehe ich den viel zu teuren Anzug wieder aus und meine Uniform wieder an. Am Ende des Tages sollte doch ohnehin meine Forschung im Fokus stehen, nicht mein Outfit.
Ich setze mich in den Stuhl vor meinem Garderobenspiegel und gehe ein letztes Mal meine Notizen durch. Patience hatte natürlich vollkommen recht, selbstverständlich kenne ich sie längst auswendig, aber ich weiß nicht, was ich sonst machen soll, und darauf, zurück in den Green Room zu gehen und Small Talk zu machen, habe ich keine Lust. Ich bin gut mit Menschen, wenn ich muss, aber am liebsten verbringe ich meine Zeit mit meiner Forschung, und dementsprechend schnell ist mein sozialer Akku erschöpft, wenn ich Konferenzen oder Fachtagungen absolviere oder als Expertin Interviews gebe. Geplant war das alles ohnehin nicht; dass ich eine mediale Karriere gemacht habe, habe ich meiner Freundin Elif zu verdanken, und ob das Fluch oder Segen ist, kann ich immer noch nicht genau sagen. Ich forsche seit einem guten Jahrzehnt intensiv auf meinem Fachgebiet und habe mir in meiner wissenschaftlichen Community mit einigen meiner Veröffentlichungen einen Namen gemacht. Aber dann wurde ich von der BBC angefragt, im Rahmen einer Sendung über Schlaf im Fernsehen zu sprechen, sagte nur zu, weil die Anfrage von Elif kam. Ich dachte damals gar nicht so richtig darüber nach, wollte einfach einer Freundin einen Gefallen tun, also absolvierte ich ein Vorgespräch für die Sendung und fuhr dann eines frühen Morgens zum Studio, ließ mich schminken und verkabeln, und sprach anschließend mit den Hosts fünf Minuten lang über die Wissenschaft rund um das Thema Schlaf und Träume. Und warum auch immer: Die Zuschauerinnen und Zuschauer waren fasziniert. Ich erhielt E-Mails ohne Ende, einige Kolleginnen und Kollegen klopften mir auf die Schulter, andere hoben die Brauen, Fernsehshows, na ja, und dann erhielt ich einen Anruf von meiner heutigen Lektorin, die fragte, ob ich nicht ein Sachbuch rund um das Thema Schlaf schreiben wolle. Und dann kam die Anfrage von TED.
Mein Handy vermeldet den Eingang einer Textnachricht von Simon. Heute ist der Talk, oder? Viel Glück! Ich schicke ihm meinen Lieblingsemoji zurück, eine Frau mit erhobenem Arm. I’m ready! Simon und ich haben nach der Trennung vor sechs Monaten entschieden, dass wir Freunde bleiben wollen – und im Grunde funktioniert das ganz gut.
Er war es, der sich von mir getrennt hat, angeblich weil ich nicht in der Lage sei, Nähe zuzulassen. Ich kann es ihm nicht verdenken, denn diesen Satz habe ich inzwischen schon von einigen Männern gehört, sodass da vermutlich was dran ist. Aber ich mochte Simon sehr und bin immer noch dabei, das Ganze zu verdauen. Jetzt ist allerdings nicht der Zeitpunkt, darüber nachzudenken, denn es geht auch schon los. Der Stage Manager steckt den Kopf durch die Tür.
»Darf ich Sie entführen?«
Er bringt mich an den Rand der Bühne, die soeben eine berühmte Klimaaktivistin betreten hat. Ich sehe ihr eine Weile lang zu, sie wirkt ein wenig nervös, was sie aber nur noch sympathischer macht, und irgendwann taucht Visagistin Kate auf und fängt an, ein letztes Mal mein Gesicht abzupudern. Ich bedanke mich, wir tauschen ein Lächeln. Die Aktivistin ist fertig, eine der Organisatorinnen betritt die Bühne, um mich anzukündigen. Gezeigt werden diese Einführungen später nicht, sie sind nur für das Konferenzpublikum im Saal gedacht.
Professor Dr. Mara Lux. Geboren in Deutschland, studierte Neurowissenschaft in London und im kalifornischen Stanford, forscht zum Thema Schlaf. War vor vier Jahren eine der jüngsten Professorinnen, die ihre Alma Mater jemals berufen hat, spricht heute zu –
Ich schalte ab. Konzentriere mich. Ich spüre das Adrenalin, das durch meinen Körper rast. Ich atme ein, und ein kleines Lächeln stiehlt sich auf mein Gesicht, denn mit einem Mal spüre ich es deutlich. Ich krieg das hin. Es geht los, ich trete auf die Bühne, ich blende die Kameras aus, konzentriere mich auf die Gesichter im Publikum. Ich hole noch einmal tief Luft, dann beginne ich zu sprechen.
zwei
Lange Jahre wurde ich von Lampenfieber geplagt. Und obwohl die ganz schlimme Bühnenangst der Vergangenheit angehört, ist eines davon geblieben: Nach einem Vortrag bin ich stets so erleichtert, dass es an Euphorie grenzt. Unmittelbar danach, als ich die Bühne verließ, fühlte ich mich einen Zentner leichter. Den Rest des Tages ging ich wie auf Wolken und hatte tatsächlich die naive Hoffnung, heute Nacht aus schierer Erleichterung Schlaf zu finden. Doch nun liege ich schon seit geraumer Zeit im Bett, starre die Decke an und versuche, nicht auf die Uhr zu schauen.
Mein Vortrag ist gut gelaufen. Zwar forsche ich seit Jahren an Medikamenten, die von post-traumatischen Belastungsstörungen und damit verbundenen Alpträumen betroffenen Menschen helfen sollen, wieder angstfrei einzuschlafen. Doch die Feinheiten meiner Arbeit sind für die Allgemeinheit größtenteils unverständlich und wenig interessant, daher habe ich mich in meinem Talk auf die absoluten Basics beschränkt und sie mit aktuellen Forschungsergebnissen verknüpft. Aufklärung selbst über die einfachsten Zusammenhänge des komplexen Vorgangs, den wir Schlaf nennen, ist immer noch notwendig. Mich erstaunt jedes Mal aufs Neue, dass selbst unter denen, die auf gesunde Ernährung achten und morgens durch den Hyde Park joggen – was sicherlich beides eine gute Idee ist –, nur wenige wissen, dass ausreichender Schlaf noch wichtiger ist als das. Er ist die Basis von allem. Ein Kollege von mir hat es mal so ausgedrückt: Schlaf okkupiert ein Drittel unseres Lebens und determiniert die Qualität der anderen beiden Drittel. Und vor allem: Je mehr wir schlafen, desto länger leben wir. Es ist in der Tat so einfach. Das mag überraschend klingen. Aber nur, bis man einmal weiß, was während des Schlafens so alles abläuft an nächtlichen Prozessen, die sowohl Körper als auch Seele helfen, gesund zu bleiben. Ich gab mir Mühe, die Aufmerksamkeit des Publikums zu fesseln, erzählte, dass Schlaf nicht nur gesünder macht, sondern auch kreativer. Berichtete davon, dass Paul McCartney die Idee zu »Let It Be« im Traum kam, und dass Mary Shelley ihren »Frankenstein« ganz ähnlich ersann. Ich beschrieb, was Schlaf fördert: täglich zur gleichen Zeit aufstehen und zu Bett gehen, auch am Wochenende, sportliche Betätigung, aber nicht zu kurz vor der Einschlafzeit, genügend Tageslicht am Morgen und möglichst wenig Bildschirmlicht am Abend – und so weiter und so weiter. Und ich zählte auf, was Schlaf hemmt: Koffein, Alkohol, unregelmäßige Tagesabläufe, sprich: Spontaneität, Partys, späte Geselligkeit – eben alles, was Spaß macht. Das Publikum lachte an dieser Stelle, und das sollte es ja auch. Aber dass ich meinen Talk unterhaltsam vortrug, machte sein Thema nicht weniger ernst. Meinen Ratschlägen dauerhaft folgen werden wohl nur die wenigsten. Dabei sollten sie das wirklich, denn sie sind wissenschaftlich fundiert, und sie funktionieren bei jeder und jedem, nur eben nicht bei mir.
Ich seufze, drehe mich auf die Seite und spüre Nicks Atem auf meinem Gesicht.
Die Tatsache, wie ein Mensch schläft, verrät unendlich viel über diese Person. Damit meine ich nicht nur die Träume, die jemand hat, ich meine den Akt des Schlafens an sich, vor allem das Einschlafen. Es gibt Menschen, die sich damit herumquälen, die ihre Gedanken nicht abschalten können, deren Hirne so auf Hochtouren laufen, dass es dauert, bis der Schlaf kommt. Und dann gibt es Menschen wie Nick – den ich seit Jahren kenne, über den ich wenig weiß und mit dem ich, seit das mit Simon vorbei ist, wieder ab und zu Sex habe –, die sich hinlegen und es einfach geschehen lassen. Manchmal lasse ich ihn bei mir übernachten, wenn er keine Lust hat, noch nach Hause zu fahren. Mir ist es gleich. Ob ich alleine die Nacht durchwache oder während jemand neben mir schläft, ist vollkommen unerheblich. Jedes Mal, wenn Nick hierbleibt, sehe ich ihm fasziniert dabei zu, wie er sich auf die Seite legt, immer auf die Linke, mich anlächelt, gute Nacht sagt – und schon ist er weg. Wohin geht er? Wer ist bei ihm? Klar, in meinem Schlaflabor könnte ich ihm Elektroden verpassen und die Hirnströme messen, die ihm beim Träumen durch den Kopf gehen, aber letzten Endes gehören seine Träume, sein Schlaf immer noch ihm.
Wenn ich den schlafenden Nick betrachte, dann könnte ich fast der Illusion erliegen, dass Schlafen etwas Friedliches ist. Bei ihm sieht es immer ein bisschen so aus, als umarme ihn der Schlaf. Mich hingegen verschmäht er, und manchmal fällt es mir schwer, das nicht persönlich zu nehmen. Ich habe alles versucht, wirklich alles, nur Schlaftabletten nehme ich schon lange nicht mehr, die Nebenwirkungen waren auf Dauer zu gravierend. Ich mache alles richtig, befolge alle meine eigenen Tipps, aber der Schlaf kommt einfach nicht. Natürlich ahne ich, wieso. Unterbewusst fürchte ich mich vor meinen Träumen. Selbst jetzt noch.
Ich seufze. Es ist fast komplett dunkel in meinem Schlafzimmer, die Jalousien sperren die Lichter Londons aus. Ich liege unter meiner leichten Bettdecke und schaue Nick beim Träumen zu. Setze mich schließlich auf. Ich ahne, dass ich nicht einschlafen werde, so müde ich auch sein mag. Aus dem immer selben, alten Grund. Doch hinzu kommt: Mir schwirrt noch zu viel im Kopf herum. Der Todestag meiner Eltern, der TED-Talk, all das. Ich verlasse mein Schlafzimmer, schleppe mich in die Küche, koche mir einen Tee, klappe meinen Laptop auf, der auf dem Küchentisch liegt. Wenn ich schon nicht schlafen kann, dann kann ich auch arbeiten. Ich lasse mich am kleinen Küchentisch nieder, stütze den müden Kopf in die Hände. Gehe ans Werk.
Ich nehme einen ersten Schluck Tee, verbrenne mir ordentlich die Oberlippe und öffne mein Postfach. Zu meiner Überraschung finde ich eine weitere Nachricht des in Frankfurt ansässigen Notars, mit der dringenden Bitte, mich bei ihm zu melden. Ich beschließe, ihn gleich am Morgen anzurufen, wahrscheinlich hat er ohnehin die falsche Mara Lux. Umso wichtiger, dass ich den Irrtum schnell aufkläre, wenn diese Sache so dringend ist, wie es scheint. Ich scrolle weiter, finde eine Mail von Dr. Porter, meinem früheren Mentor. Porter hatte eine Weile gehofft, dass ich seine Forschung fortführen würde und war einigermaßen enttäuscht, als ich mich von der klinischen Psychologie ab- und der Schlafforschung zuwandte. Seither haben wir nur noch selten Kontakt. Was ich bedauere. Ich öffne seine Mail mit dem Betreff: Glückwunsch. Wie sich herausstellt, saß Porter im Publikum, als ich heute auf der Konferenz sprach, konnte jedoch nicht bleiben, um mir persönlich zu gratulieren. Ich bedanke mich für die freundlichen Worte, bitte ihn, Naomi, seiner Frau, Grüße von mir zu bestellen, und nehme mir vor, ihn bald einmal in Ruhe anzurufen. Porter und Naomi waren immer das ideale Paar für mich, die perfekte Balance zwischen Nähe und den anderen atmen lassen, so zumindest sah es von außen für mich aus. Neidisch war ich auf die beiden nie, auch wenn ich weiß, dass ich nie haben werde, was sie haben. Dass ich Nähe nicht so gut kann, das hätte mir nicht erst Simon sagen müssen. Und überhaupt ist mir derzeit nicht nach Dating, ich habe anderes zu tun, insofern: ein Hoch auf Männer wie Nick und die Bindungsunfähigkeit. Ich schließe mein E-Mail-Programm und öffne das Textdokument, in das ich die ersten Ideen für mein Sachbuch getippt habe, überfliege den Einstieg.
Der Schlaf und die Träume, die er uns bringt, faszinieren uns seit Menschengedenken. Die frühesten Aufzeichnungen, die mit Träumen zu tun haben, stammen aus Mesopotamien, und sowohl aus Indien als auch aus China sind Texte überliefert, die ungefähr 1000 vor Christi entstanden und sich mit der Deutung von Träumen befassen. Lange hielten wir Träume für eine Möglichkeit, mit den Göttern oder mit den Geistern unserer Vorfahren zu kommunizieren oder einen Blick in eine spirituelle Sphäre zu werfen, die uns tagsüber verborgen war. Die Erkenntnis, dass Träume nicht von außen kommen, sondern dass es unser eigenes Gehirn ist, das sie generiert, ist relativ neu. Dank der Hirnforschung, dank der Neurowissenschaft haben wir heute jedoch ein relativ breites Verständnis davon, was passiert, während wir schlafen, und was es mit unseren Träumen auf sich hat.
Plötzlich spült eine Woge der Müdigkeit über meinen Körper. Gerade ist mir so, als könnte ich tatsächlich einschlafen. Auf Zehenspitzen finde ich meinen Weg zum Bett, Nicks lange, ruhige Atemzüge weisen mir im Dunkeln den Weg. Ich denke an meine Eltern, von denen es keine digitalen Geister gibt und deren Tod sich übermorgen zum fünfundzwanzigsten Mal jährt – und lege mich hin. Schließe die Augen, mein Körper wird leicht, ich falle. Ich falle durch die Matratze, ich falle durch den Boden unter mir und durch die Wohnung der Nachbarn darunter, falle durch das ganze Gebäude, durch die Erdschichten darunter, weiter und weiter, und dann bin ich weg. Und da, wo ich lande, ist Feuer. Ich spüre seine Hitze auf meinen Wangen, ich fühle seinen Willen, zu wachsen, größer zu werden und stärker, und einen kurzen Moment lang verstehe ich seine Sprache, die aus Knacken besteht und aus Flüstern. Luft, Luft, größer, weiter, weiter, mehr, mehr, mehr, mehr. Und seine Gier ängstigt mich. Und ich schaue zu, wie das Feuer das kleine Haus verzehrt, in dem ich mich befinde, und dann die Umgebung, und dann die Häuser in der Nachbarschaft, und dann das angrenzende Waldstück und dann die Stadt. Ich stehe da, kann atmen mitten im Feuer, meine Haut ist glatt und kühl, und ich fürchte mich. Und dann endet meine Lähmung, und ich trete heraus aus dem Feuer, und ich gehe eine Dorfstraße entlang, um mich herum sind Fachwerkhäuser, wie aus einem deutschen Märchen, und es ist Nacht, und es ist warm, und es ist dunkel, doch die Straßenlaternen brennen, und ich sehe einen Mann und ein Kind, ein Mädchen, beide von hinten, und der Mann trägt eine Maske, und das Mädchen hat Angst. Und eine Zeit lang laufe ich ihnen hinterher, versuche, sie zu erreichen, doch es gelingt mir nicht. Obwohl ich renne, so schnell ich kann, und die beiden gehen, nicht sonderlich schnell, einfach gehen, so wie man eben geht, eine nächtliche Dorfstraße entlang, schaffe ich es nicht, ich hole sie nicht ein, ganz im Gegenteil, sie entfernen sich weiter und weiter von mir. Und ich empfinde eine enorme Dringlichkeit, denn das hier ist wichtig, die beiden sind wichtig, ihre Gesichter, ihre wahren Gesichter zu sehen, ist wichtig, doch es gelingt mir nicht, und ich gerate in Verzweiflung, ich spüre, dass ich weine, und da dreht das Mädchen sich um und sieht mich an, und ich sehe sein Gesicht, und ich erschrecke, ganz ohne zu wissen, warum, und der Traum endet, und ich bin plötzlich daheim, bin in London, und ich vergesse das Feuer, und ich vergesse den Mann mit der Maske und das Mädchen, und meine Nachbarin Mrs. Jones fliegt durch die Londoner Spätsommernacht, und Zootiere streifen durch die Stadt, und meine Mutter steht hinter dem Tresen von Ramis Foodtruck und brät mir Eier mit Schinken, wie früher, und dann wache ich auf.
»Gut geschlafen?«, fragt Nick.
Ich blinzle. Er trägt nur ein Handtuch um die Hüften und ist frisch geduscht. Ich wundere mich, dass er noch hier ist.
»Ganz okay«, sage ich. »Und du?«
»Wie ein Stein, du kennst mich ja.«
Allerdings, das tue ich.
»Wie spät ist es?«, frage ich.
»Gleich halb acht. Lust auf Frühstück? Ich habe Rühreier gemacht und Speck.«
Ob ich Lust auf Frühstück habe, ist eine rhetorische Frage. Nick und ich sehen uns nicht besonders oft, aber jeder, der mich auch nur flüchtig kennt, weiß, dass man mich mit Essen immer, aber auch wirklich immer kriegt. Als Nick das erste Mal einfach angefangen hat, in meiner Küche Eier zu braten, war ich alles andere als begeistert, aber seit ich herausgefunden habe, dass er verdammt gutes Frühstück macht, lasse ich ihn walten.
Ich dusche in Windeseile, denn ich fühle mich ausgehungert, als hätte ich seit Tagen nichts gegessen. Nick schaut mir eine Weile belustigt zu, während ich am Frühstückstisch Toast, Eier und Speck in mich hineinschlinge, dann macht er sich bereit für die Arbeit.
»Du hast heute Nacht im Schlaf geredet«, höre ich ihn aus dem Flur, während er sich gerade seine Sneaker anzieht.
»Ach ja? Was habe ich denn gesagt?«
»Nichts Kohärentes. Wirres Zeug. Aber du schienst ziemlich vergnügt.«
»Ich glaube, ich habe irgendwas mit Tieren geträumt.«
Ich schließe die Augen, und es dauert nur einen Moment, bis die nächtliche Szene wieder vor meinem inneren Auge entsteht.
»Ich bin durch Kensington gelaufen«, sage ich. »Und plötzlich kam mir eine Giraffe entgegen. Und Mrs. Jones von oben war da. Sie konnte fliegen oder so was. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hatte.«
Ich zucke mit den Schultern.
»Traumlogik.«
Nick lacht.
»Mrs. Jones, deine Nachbarin? Die, die ständig die Polizei ruft? Sie ist nicht zufällig auf einem Besen geflogen oder so was?«
Jetzt muss ich ebenfalls lachen, auch wenn ich sofort ein schlechtes Gewissen bekomme. Mrs. Jones ist wirklich einigermaßen furchtbar. Sie hat Streit mit fast allen Parteien im Haus, und als ich ihr neulich die Einkäufe nach oben trug, weil der Aufzug kaputt war, bedankte sie sich mit einem genervten Schnauben. Aber irgendwie mag ich sie trotzdem.
»Du bist schlimm«, sage ich. »Und nein. Sie konnte einfach so fliegen.«
Nick und ich verlassen die Wohnung gemeinsam, heiter, zunächst. Doch schon, als wir in der Lobby ankommen, merken wir, dass etwas nicht stimmt. Mehrere Bewohnerinnen und Bewohner haben sich hier versammelt und unterhalten sich aufgeregt. Vor dem Eingang flackert Blaulicht. Und jetzt sehe ich auch die Polizisten, die auf dem Gehweg stehen. Nick ist in Eile und verschwindet in Richtung Underground, ich hingegen mische mich unter die Gruppe von Nachbarinnen und Nachbarn. Ich habe ein schlechtes Gefühl, ein ganz, ganz schlechtes, dunkles, zähes, klebriges Gefühl. Die hübsche junge Frau aus dem ersten Stock wird auf mich aufmerksam und kommt zu mir.
»Es ist Mrs. Jones«, sagt sie mit belegter Stimme. »Sie ist aus dem Fenster gesprungen. Heute Nacht. Oder besser in den frühen Morgenstunden. Ist das nicht schrecklich?«
Sie öffnet und schließt weiter den Mund, und bestimmt kommen da Laute heraus, die sich zu Worten zusammensetzen, aber ich höre sie nicht, ich bin zu sehr mit den Gedanken beschäftigt, die in meinem Kopf dröhnen. Nehme wahr, wie sie mich schließlich kameradschaftlich am Oberarm berührt und weiterläuft, vermutlich macht sie sich auf den Weg ins Büro. Auch ich verlasse das Gebäude, wie ein Roboter, darauf programmiert, zur Arbeit zu gehen, komme, was da wolle.
Vor mir liegen die Straßen Londons, aber vor meinem inneren Auge sehe ich Mrs. Jones, die durch den Londoner Nachthimmel fliegt. Ich fühle mich ganz schwach auf den Beinen, aber ich bleibe nicht stehen.
Schock, denke ich, der:
durch ein außergewöhnlich belastendes Ereignis bei jemandem ausgelöste seelische Erschütterung [aufgrund deren die Person nicht mehr fähig ist, ihre Reaktionen zu kontrollieren].
Heute Nacht habe ich geträumt, dass Mrs. Jones vom Himmel fällt, und heute Morgen ist sie tot.
Ich falle lange genug, um den Aufprall zu fürchten. Ich falle langelangelange. Ich habe genügend Zeit, um zu denken: So lange, wie du gerade fällst, wird der Aufprall sehr, sehr weh tun. Ich habe genügend Zeit, um zu denken, dass einen so ein heftiger Aufprall umbringen kann, und ich habe sogar genügend Zeit, um mich zu fragen, was einen eigentlich umbringt bei so einem Aufprall, man bricht sich alle Knochen, klar, aber das bringt einen doch bestimmt nicht um, vielleicht erschrickt das Herz so arg, dass es stehen bleibt, oder es ist was mit den anderen Organen. Ich denke an all die Filme, die ich gesehen habe, in denen jemand aus wirklich hoher Höhe irgendwo runterfiel, von einem Hochhaus oder von einer Klippe oder was weiß ich, und dass ich mich immer gefragt habe, ob man da noch groß was merkt, ob man während des Fallens noch groß was denkt, und jetzt weiß ich es, und wie krass ist das eigentlich. Schon komisch, was alles in den Bruchteil einer Sekunde passt, wirklich komisch, total abgefahren eigentlich, denn mehr als der Bruchteil einer Sekunde kann das hier nicht sein, trotz allem nicht. Und dann bin ich fast so etwas wie heiter, aber ganz kurz nur, wirklich super ultra kurz, denn dann denke ich noch etwas anderes, dann denke ich plötzlich an etwas wirklich Wichtiges, an das einzig Wichtige eigentlich, und verstehe nicht mehr, wie ich überhaupt an irgendetwas anderes denken konnte, ich denke: Kai, verdammte Scheiße, Kai, und dann kommt der Aufprall, und der tut erst sehr, sehr weh, und dann gar nicht mehr.
Als ich wieder zu mir komme, weiß ich erst mal gar nicht, wo ich bin. Es fühlt sich ein bisschen so an, wie am ersten Tag des Urlaubs morgens wach zu werden und erst mal verwirrt zu sein, weil man über Nacht vergessen hat, dass man nicht zu Hause ist, sondern in einem Hotelbett liegt oder so. Die Verwirrung ruft Erster!, aber direkt danach kommt die Angst. Meine Augen sind offen, und sie sehen etwas, das sich nicht wirklich beschreiben lässt. Es ist unglaublich schön, es ist weit und von einem milden Blau, das beinahe schon Rosa und Hellgelb ist, und darüber schwirren zierliche Schatten, und in dem Gewebe, aus dem dieses Blauaberbeinaheschonrosaundhellgelb besteht, sind winzige Löcher, durch die Licht fällt, sehr altes, von weit her kommendes Licht, und ich schaue mir das eine Weile an, ehe sich ein Wort formt, und das Wort lautet Sterne, und ihm folgt ein zweites, und es heißt Himmel. Und ich komme ein wenig zu mir und begreife: Ich liege auf dem Rücken, und dort über mir ist der Himmel, und ich mache kurz die Augen zu, presse sie zusammen, ganz fest, ehe ich den Mut finde, sie zu öffnen und mich umzusehen. Denn ich weiß jetzt wieder, wo ich bin und warum, und ich fürchte mich so vor dem, was ich sehen werde. Aber es hilft ja alles nichts, also öffne ich die Augen wieder und gebe meinem Körper den Befehl, sich aufzusetzen, und er macht das auch brav, und ich wundere mich, wie leicht er sich anfühlt und auch darüber, dass mir wirklich rein gar nichts weh tut, obwohl mir doch alles, wirklich absolut alles weh tun müsste, und dann fällt mir nach Sterne und Himmel noch ein Wort ein, und das Wort heißt Schock.
Ich sehe mich um.
»Kai?«
Der Himmel über mir leuchtet in milden Farben, und obwohl es dunkel ist hier unten, kann ich Kai erkennen. Er liegt auf dem Bauch in einer Wasserlache. Kai gibt keinen Laut von sich, und ich glaube, er ist tot, und aus mir dringt ein ganz komisches Geräusch, das ganz alt und seltsam klingt, älter als das Licht der Sterne da oben vielleicht, und ich krieche auf meinen Bruder zu, berühre ihn vorsichtig an der Schulter, und da höre ich es, ein ganz leises Wimmern.
»Kai, bist du okay? Hörst du mich?«
Ich versuche, ihn auf den Rücken zu drehen, und ich weiß zwar, dass man jemanden, der schlimm verletzt ist, nicht bewegen soll, aber ich kann ihn so nicht liegen lassen, mit dem Kopf in dieser schmutzigen Pfütze, also drehe ich ihn um. Oder ich versuche es zumindest, aber meine Kraft reicht nicht aus. Ich muss selbst schwerer verletzt sein, als ich dachte, denn ich lege eine Hand unter seinen Kopf, um ihn zu stützen, und versuche mit der anderen, seine Schulter zu greifen und ihn auf den Rücken zu rollen, aber sein kleiner Körper bewegt sich kein Stück. Ich versuche es noch einmal, der Unterschied ist minimal. Wieder dieses ganz leise Wimmern, das mir durch Mark und Bein geht, weil ich nicht weiß, ob es Schmerz ausdrückt oder Angst oder beides, und ich weiß, dass ich all meine Kraft zusammennehmen werde, und wenn es das Letzte ist, was ich tue, ich werde meinen kleinen Bruder auf den Rücken drehen, damit er mein Gesicht sehen kann und weiß, dass alles wieder in Ordnung kommt, und dass er nicht allein ist, okay, also los. Ich konzentriere mich, ich balle meine Kraft wie eine Faust, und es ist wie Zauberei, als hätte ich plötzlich Superkräfte wie einer der Helden aus Kais blöden Marvel-Serien, denn mit einem Mal geht es ganz leicht, und ich drehe ihn ganz vorsichtig auf den Rücken. Seine Augen sind geschlossen, aber er atmet.
»Kai? Hörst du mich?«
Ich sehe, wie sich sein Brustkorb hebt und senkt, und ich weiß nicht, was ich machen soll, denn langsam wird mir klar, was geschehen ist und wo wir hier sind und wessen Schuld das alles ist und dass ich Kai hier rausholen muss, und dass ich keine Ahnung habe, wie.
Ich erinnere mich an das Gefühl des Laufens, so leicht, so frei, ich erinnere mich, wie ich einen Blick über meine Schulter warf und sah, dass Kai mir dicht auf den Fersen war, ich erinnere mich, dass ich dachte, dass ich nicht vergessen durfte, ihm zu sagen, dass er später beim Abendbrot auf keinen Fall erzählen sollte dass wir im Wald gewesen waren, denn der Wald war verboten, im Wald gab es einen alten Steinbruch und alte Schächte und all diese Dinge, vor denen Mama uns gewarnt hatte, seit wir klein waren. Ich erinnere mich, wie ich den Blick wieder nach vorne richtete, früh genug, um die morschen Planken vor mir zu sehen, nicht früh genug, um rechtzeitig innezuhalten. Und dann der Fall, und dann die Hoffnung, Kai möge es geschafft haben, möge nicht ebenfalls in den alten Brunnen gestürzt sein, und dann die Erkenntnis, dass wir beide hier gefangen waren, nicht weit weg von zu Hause, vielleicht zehn Minuten, wenn man so schnell lief, dass man Seitenstechen bekam, höchstens fünfzehn. Und ich verfluche mich, während ich Kais kleinen Kopf in meinen Schoß lege, ich verfluche mich für meine Dummheit und meine Aufsässigkeit, ich verfluche mich dafür, dass ich immer noch so kindisch bin, dass ich zwar so tue, als würde ich Kai einen Gefallen tun, wenn ich draußen mit ihm spiele, dass ich das aber eigentlich immer noch gerne tue, auch wenn ich nicht will, dass meine Freundinnen in der Schule das wissen, denn mit meinem jüngeren Bruder durch die Wiesen und Wälder nahe unserer Siedlung zu streifen, das ist wirklich Kinderkram, da haben sie einfach recht. Ich verfluche mich für mein Pech, immer bin ich es, die beim Abschreiben erwischt wird, immer bin ich es, die beim Schnick-Schnack-Schnuck-Spielen verliert, und natürlich bin ich es, die genau den Weg wählt, der zu einem stillgelegten Brunnen führt, und zwar AMLETZTENTAGDERSOMMERFERIEN, die ganzen Ferien über war nichts passiert, und schon morgen wäre es vorbei gewesen mit dem DurchdieWälderrennen, schon morgen hätten wir wieder in der Schule gesessen, ich mit Mia, Greta und Aylin, Kai mit seinen bescheuerten kleinen Jungsfreunden und alles wäre in Ordnung gewesen, aber natürlich hatte ich es geschafft, kurz vor knapp noch alles zu versauen, und wenn Papas neue Freundin mich eine hässliche kleine Spinne nannte, wenn Papa nicht dabei war, dann hatte sie schon recht, denn wer verdarb die Dinge? Ich, immer ich, wer denn auch sonst, natürlich ich. Und da mache ich etwas, das ich noch nie gemacht habe und nur von Oma Gertrude kenne, ich mache die Augen zu, und ich bete. Bitte mach, dass Kai wieder aufwacht, bitte mach, dass Kai wieder aufwacht, bitte mach, dass er in Ordnung kommt, bitte mach, dass er die Augen öffnet, wenn er die Augen öffnet, dann finde ich einen Weg hier raus, ich schwör’s, ich hole uns hier raus, aber bitte mach, dass Kai nicht stirbt, ich will auch alles tun. Und während ich so innerlich vor mich hingefleht habe, muss Kai wohl zu sich gekommen sein, denn als ich die Augen wieder aufmache, ist er wach und sieht mich an.
»Kai!«, sage ich ein bisschen zu laut. »Kai, bist du okay? Tut dir was weh?«
Er antwortet nicht. Stößt ein Wimmern aus, das mich absolut fertigmacht. Er versucht, meine Hände abzuschütteln, vielleicht tue ich ihm weh?, also lasse ich ihn los, sehe zu, wie er probiert, sich zu bewegen, er wirkt ein bisschen benommen, aber das ist ja auch kein Wunder. Schließlich setzt er sich auf, und das klappt ganz gut. Seine Jeans sind trocken, aber sein T-Shirt ist durchweicht, ich muss selbst klatschnass sein, doch ich spüre nichts davon. Sehe Kai zu, wie er seine Hände anschaut. Seine Finger bewegt. Seine Hände sind ganz verschrammt, seine Arme auch, aber davon einmal abgesehen scheint alles so zu funktionieren, wie es sollte.
Ich lege ihm eine Hand auf die Wange.
»Alles okay so weit, Kumpel?«, frage ich.
Er reagiert nicht auf das, was ich sage, und das macht mir Angst.
»Kai?«
Er blinzelt, als hätten seine Augen sich noch nicht so richtig an die Dunkelheit hier unten gewöhnt. Erst denke ich, er schaut mich endlich richtig an, doch sein Blick geht durch mich hindurch, bleibt an etwas hinter mir hängen, an der Wand des Brunnens vermutlich, so alt, so steil, so unüberwindlich, und nun beginnt Kai zu weinen. Ich versuche, ihn zu trösten, aber es ist, als würde er mich gar nicht hören, er wimmert und schluchzt, und das macht mir eine solche Angst, dass ich beschließe, ihn sich erst einmal ausheulen zu lassen, denn er ist ja erst sieben Jahre alt und gerade zusammen mit seiner bescheuerten großen Schwester, die eigentlich auf ihn aufpassen sollte, durch eine morsche Abdeckung in einen alten Brunnenschacht im Wald gestürzt, und sein Bein ist vielleicht verstaucht oder so was, und ihm tut bestimmt auch sonst alles weh, und vor allem aber ist ihm klar, dass wir hier nicht so einfach wieder rauskommen, denn er ist erst sieben, aber blöd ist er nicht, ganz und gar nicht.
»Bist du da?«, sagt er. »Bist du da?«
»Ich bin hier, es ist okay.«
Aber es hilft nicht. Er weint nur noch heftiger.