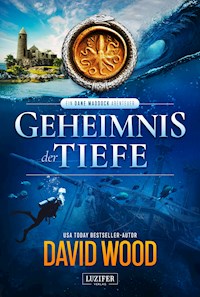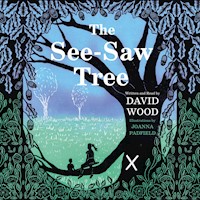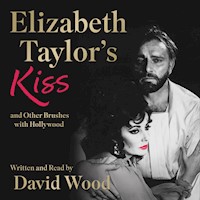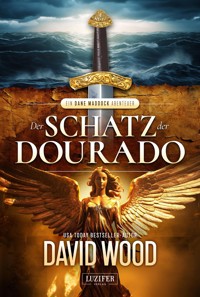
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Luzifer-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Dane Maddock Abenteuer
- Sprache: Deutsch
Ein versunkener Schatz. Ein uraltes, biblisches Artefakt. Ein Geheimnis, so alt wie die Menschheit. Am 25. Januar 1829 sank die portugiesische Brigg DOURADO vor der Küste Indonesiens, und mit ihr ungeahnte Schätze aus dem Heiligen Land. Eines dieser Relikte birgt den Schlüssel zu einem uralten Mysterium. Nachdem ihr Vater während seiner Suche nach dem Wrack der DOURADO ermordet wurde, wendet sich Kaylin Maxwell an den ehemaligen Navy Seal Dane Maddock und seinen Partner Bones Bonebrake, um die DOURADO zu finden und ein verlorenes biblisches Artefakt zu bergen, welches die Grundfesten der Kirche und der gesamten Menschheit ins Wanken bringen könnte. Es beginnt ein gefährliches Abenteuer, dass die beiden Männer in die Tiefen des Pazifiks und bis in eine geheimnisvolle Stadt aus Stein entführt. ★★★★★ »Atemloses Seemansgarn, welches biblische Spekulationen, uralte Geheimnisse und gemeine Kreaturen miteinander verwebt. Da ist Konkurrenz im Anmarsch, Indiana Jones!« - Jeremy Robinson ★★★★★ »Eine adrenalingeladene Achterbahnfahrt!« - Alan Baxter, Autor von Hidden City ★★★★★ »Innerhalb von Sekunden nach dem Öffnen des Buches war ich gefesselt. Intrigen, Spannung, Monster und Schatzsucher. Was kann man sich mehr wünschen? David hat mit diesem Buch einen Volltreffer gelandet!« - Nick Thacker, Autor von The Enigma Strain ★★★★★ »Sehen wir den Tatsachen ins Auge – David Wood ist der nächste Clive Cussler. Sie werden das Buch nicht mehr aus der Hand legen können, bis das letzte Geheimnis gelöst wurde.« - Edward G. Talbot ★★★★★ »Dane und Bones … zusammen sind sie unaufhaltsam. Mitreißende Action von Anfang bis Ende. Durchgehend Witz und Humor. Nur eine Frage - wie lange dauert es noch bis zum nächsten Teil? Denn ich kann es nicht erwarten.« - Graham Brown, Autor von Shadows of the Midnight Sun ★★★★★ "Was für ein Abenteuer! Eine großartige Lektüre, die nicht nur jede Menge Action bietet, sondern auch nachdenkliche Einblicke in seltsame Gefilde, die man manchmal besser unerforscht lässt." - Paul Kemprecos, Autor von Cool Blue Tomb und den NUMA-Files ★★★★★ »Mit der durch und durch unterhaltsamen Art und Weise, wie Herr Wood spekulative Geschichte mit unserer heutigen Suche nach der Wahrheit vermischt, hat er eine Geschichte geschaffen, die begeistert und dazu anregt, über die Grenzen der reinen Fiktion hinaus zu denken und die Welt des 'Warum nicht' zu betreten.« - David Lynn Golemon, Autor der Event Group-Reihe ★★★★★ »Eine verschlungene Geschichte voller Abenteuer und Intrigen, die einen nicht mehr loslässt!« - Robert Masello, Autor von The Einstein Prophecy ★★★★★ »Ich mag Thriller mit vielen Explosionen, globalen Schauplätzen und einem Geheimnis, bei dem ich etwas Neues lerne. Wood liefert! Empfehlenswert für eine rasante, spannende Lektüre.« - J.F. Penn, Autor von Desecration
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 341
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Schatz der Dourado
Dane Maddock Abenteuer 2
David Wood
This Translation is published by arrangement with David Wood Title: THE SWORD OF GOLIATH. All rights reserved. First Published 2020.
Diese Geschichte ist frei erfunden. Sämtliche Namen, Charaktere, Firmen, Einrichtungen, Orte, Ereignisse und Begebenheiten sind entweder das Produkt der Fantasie des Autors oder wurden fiktiv verwendet. Jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen Personen, lebend oder tot, Ereignissen oder Schauplätzen ist rein zufällig.
Impressum
Deutsche Erstausgabe Originaltitel: THE SWORD OF GOLIATH Copyright Gesamtausgabe © 2024 LUZIFER Verlag Cyprus Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Cover: Michael Schubert Übersetzung: Marie Auer
Dieses Buch wurde nach Dudenempfehlung (Stand 2024) lektoriert.
ISBN E-Book: 978-3-95835-893-5
Folgen Sie dem LUZIFER Verlag auf Facebook
Sollte es trotz sorgfältiger Erstellung bei diesem E-Book ein technisches Problem auf Ihrem Lesegerät geben, so freuen wir uns, wenn Sie uns dies per Mail an [email protected] melden und das Problem kurz schildern. Wir kümmern uns selbstverständlich umgehend um Ihr Anliegen.
Der LUZIFER Verlag verzichtet auf hartes DRM. Wir arbeiten mit einer modernen Wasserzeichen-Markierung in unseren digitalen Produkten, welche Ihnen keine technischen Hürden aufbürdet und ein bestmögliches Leseerlebnis erlaubt. Das illegale Kopieren dieses E-Books ist nicht erlaubt. Zuwiderhandlungen werden mithilfe der digitalen Signatur strafrechtlich verfolgt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Inhaltsverzeichnis
Prolog
25. Januar 1829, Indischer Ozean
Der kostbare Traum verflüchtigte sich wie der letzte Morgennebel kurz vor dem Sonnenaufgang. Eine weitere Welle schlug gegen die Bordwand der Dourado und das lautstarke Krachen hallte wie Donner in der winzigen Kabine wider. Monsieur le Chevalier Louis Domenic de Rienzi klammerte sich Halt suchend gegen das Schaukeln und Rollen an den Rand seines Bettes. Er hatte von einer triumphaleren Rückkehr nach Frankreich geträumt, wo er die Früchte seiner jahrelangen harten Arbeit präsentieren würde. Er zog sich die feuchte, muffige Decke über den Kopf, aber sie bot nur kläglichen Schutz gegen die Schreie und Rufe, die von oben herabdrangen. Er kniff die Augen zusammen und versuchte angestrengt, wieder einzuschlafen, aber ohne Erfolg. Leise fluchend schob er die durchweichte Decke bis zur Brust nach unten und starrte an die alte Holzdecke.
Ein Mann seines Standes sollte besser untergebracht sein. Aber natürlich war dies das Beste, was der Kapitän zu bieten hatte. Wenn er nach Frankreich zurückkehrte, wenn sie sahen, was er wiedergefunden hatte, würde er ein wichtiger Mann sein. Er würde nur die prachtvollsten Unterkünfte haben.
Er lächelte. Für einen Moment verwandelte sich die alte Holzkajüte in eine luxuriöse Suite auf einem der besten Schiffe.
Eine weitere Welle brachte das Schiff wie einen Betrunkenen ins Wanken, und seine imaginäre Kabine löste sich in einem schwindelerregenden Rollen auf. Rienzi wartete, bis sich das Schiff wieder stabilisiert hatte, bevor er aufstand und seine Stiefel und seinen Mantel anzog. Die Rufe an Deck wurden immer lauter und dringlicher. Der Sturm musste ernster sein, als er angenommen hatte.
Rienzi warf einen kurzen Blick in den winzigen Spiegel, der gegenüber dem Bett an der Wand hing. Er war kein junger Mann mehr, aber das Alter verlieh ihm einen Hauch der Würde, die ihm in der Jugend gefehlt hatte. Er war als junger Mann von zu Hause weggegangen, kehrte aber als erfahrener Abenteurer mit einer fantastischen Geschichte zurück.
Seine Kabinentür öffnete sich zu einem schmalen Flur. Eine zierliche Frau im Morgenmantel lugte aus der Tür direkt gegenüber seiner eigenen. Ihre Nachthaube hing schief, was ihren verkniffenen Gesichtszügen einen komischen Ausdruck verlieh. Ihre Blicke trafen sich und sie stieß einen kleinen Schrei aus, bevor sie die Tür wieder zuschlug. Rienzi lachte leise und machte sich auf den Weg zu der schmalen Treppe, die zum Deck hinaufführte.
Salzige Luft erfüllte seine Nase, als er in die kühle Nacht hinaustrat. Dicke Regentropfen schlugen ihm ins Gesicht und wuschen die letzten Reste des Schlafes weg. Ein Mannschaftsmitglied eilte vorbei und stieß Rienzi in der Eile an. Der Matrose murmelte etwas, das eine Entschuldigung hätte sein können, aber Rienzis Portugiesisch war sehr begrenzt.
Wütende schwarze Wolken untermalten die Wildheit des Sturms, der das Schiff gefangen hielt. Die Brigg tanzte auf den Wellen, die wie hungrige, nach Beute greifender Finger über das Deck brachen. Rienzi zog seinen Mantel enger um sich, um den kalten, beißenden Wind abzuwehren, und dankte der Gottesmutter, dass hier auf der unteren Hälfte der Welt Sommer herrschte. Wie mochte dieser Sturm wohl zu Hause mitten im französischen Winter anmuten?
Mit der Grazie eines Fechters trat er auf das Deck hinaus und hielt auf dem schaukelnden Holz das Gleichgewicht. Die Decksarbeiter wuselten umher und versuchten offensichtlich vor den Passagieren, die sich in der Nähe des Hauptmastes aneinander klammerten, ein tapferes Gesicht zu machen. Seltsam, dass sich die Menschen an Deck sicherer fühlten, wo eine verirrte Welle sie wegfegen konnte, als unten in den warmen und trockenen Kajüten.
Bald fand er den Kapitän, Francisco Covilha, der mit dem Steuerrad kämpfte und gleichzeitig Befehle brüllte.
»Kapitän«, rief er, »kann ich Ihnen behilflich sein?« Rienzi kannte sich ein wenig mit der Seefahrt aus, wenn auch sicher nicht so gut wie der erfahrene Seemann. Dennoch schien es angemessen, zumindest das Angebot zu machen.
Der portugiesische Seefahrer schüttelte den Kopf und rief in stark akzentuiertem Französisch zurück. »Es tut mir leid, Monsieur. Ich muss uns von den Felsen fernhalten.« Er hielt das Steuerrad fest im Griff und deutete mit dem Kopf nach vorn und Backbord.
Rienzi drehte sich um und erblickte mit Schrecken eine zerklüftete Reihe von Felsen, die aus dem Meer ragten und deren abgehackte Konturen sich im schwachen Schein der Morgendämmerung abzeichneten. Trotz aller Bemühungen der Besatzung trieb die Dourado auf dem Kamm tödlicher Wellen dem sicheren Untergang entgegen.
Dem Kapitän und der Mannschaft war nicht zu helfen, und er hatte auch keine große Hoffnung, dass das Schiff seinem drohenden Untergang entgehen würde. Aber es gab tatsächlich etwas, was Rienzi tun konnte. Unter dem Rollen und Schwanken des Schiffs machte er sich auf den Weg zu den verängstigten Passagieren, die sich in nervöser Unordnung zusammenkauerten. Sie hielten ihn für eine Autoritätsperson und begannen, Fragen zu stellen.
Die meisten von ihnen sprachen Englisch, aber einige wenige waren Franzosen. Rienzi könnte die unkultivierte Sprache der Tölpel nördlich des Kanals sprechen, würde es aber nicht tun, wenn es nicht unbedingt notwendig wäre. Er musste an seinen Ruf denken.
»Sprechen Sie nicht«, rief er über ihre verwirrten Fragen hinweg. »Wir haben wenig Zeit.« Obwohl er Französisch sprach, schienen ihn alle zu verstehen und verstummten. Er warf noch einmal einen Blick auf die aufragenden Felsen. Sie schienen wie die Zähne einer urzeitlichen Bestie, bereit, dieses zerbrechliche Gefährt zu zermalmen. Es blieb keine Zeit, die anderen nach unten zu bringen, und sollte es zu einem schwerwiegenden Zusammenprall kommen, wäre ein Platz unter Deck nicht die beste Alternative.
Er entdeckte ein Seil, das an einer nahe gelegenen Reling festgemacht war. Mit solchen Seilen zurrten sich die Besatzungsmitglieder in gefährlichen Situationen am Schiff fest. Er wies die Passagiere an, sich zu setzen, und zeigte ihnen, wie sie das Seil um ihre Arme wickeln mussten, damit alle gesichert werden konnten. Eine der Engländerinnen beschwerte sich über die Kälte und den Regen, aber er ignorierte sie. Als alle festgezurrt waren, wickelte er das Ende des Seils um sein Handgelenk und ließ sich auf das Deck fallen, wo er wie ein zum Tode Verurteilter auf die Guillotine wartete.
Meine Schätze! Der plötzliche Gedanke durchdrang den Schleier der Besorgnis und setzte sich in seinem Herzen fest. Ein kalter Hauch von Angst machte sich in seinem Magen breit und erfüllte ihn mit Schrecken. Unbezahlbare, unersetzliche Artefakte, das Werk eines ganzen Lebens, lagerten im Bauch des Schiffes. Wie viele Jahre hatte er damit verbracht, sie zusammenzutragen? Vor allen anderen durfte vor allem ein Gegenstand nicht verloren gehen.
Mit diesem Gedanken im Hinterkopf erhob er sich wieder und blickte auf das Meer hinaus. Die Felsen lagen immer noch gefährlich nahe vor ihnen, und die Wellen, die daran zerschellten, warfen Schaumkronen auf, die ihn an eine tollwütige Bestie erinnerten. Sie schienen jetzt weiter backbordseitig zu liegen. Hatte der Kapitän die Kontrolle über das Schiff zurückerlangt? Sie trieben schneller auf das andere Ende der Felsen zu, und der kalte Regen schnitt ihm ins Gesicht. Er hielt den Atem an. Würden sie es schaffen?
Er wickelte das Sicherungsseil von seinem Unterarm ab, kroch bäuchlings zur Seite, klammerte sich an die Reling und beobachtete, wie der Abstand zwischen der Dourado und diesen Wächtern des Verderbens immer weiter schrumpfte. Der letzte Felsen rauschte nur knapp einen Fuß entfernt vorbei.
Und dann explodierte die Welt.
Ein lautes, reißendes Geräusch erfüllte seine Ohren und alles überschlug sich. Er stürzte in Richtung Bug. Schmerz durchzuckte seine kalten, tauben Gliedmaßen, denn er rollte und stürzte über das harte, glatte Deck. Mit einem atemlosen Ächzen und einem heftigen Schlag an der Schädelbasis prallte er gegen den Fockmast. Benommen kämpfte er darum, aufzustehen. Doch seine Füße und Hände wollten nicht funktionieren, und sein Kopf schien voller Sand zu sein. Mit einem gequälten Stöhnen kapitulierte er und schloss die Augen.
»Ich habe keine Wahl, Monsieur Rienzi. Ich muss den Befehl geben, das Schiff zu verlassen.« Francisco Covilha war kleiner als Rienzi und wirkte dennoch so, als würde er den Entdecker von oben herab betrachten. Das Mondlicht brachte seine schiefe Nase und sein faltiges Gesicht zur Geltung.
»Kapitän, das kann nicht Ihr Ernst sein«, flehte Rienzi. »Sie haben uns seit dem Morgen über Wasser gehalten. Sicherlich können wir durchhalten, bis Hilfe eintrifft.« Er rieb sich den Kopf, der noch immer von dem Schlag pochte, der ihn bewusstlos gemacht hatte. Er hatte versucht, den Schmerz im Wein zu ertränken, aber es war ihm nur gelungen, seine Sinne so weit zu betäuben, dass sie eine lästige Ablenkung darstellten.
»Es wird keine Hilfe kommen.« Covilha schüttelte den Kopf. »Wir haben das Ruder verloren, als wir auf die Felsen aufliefen. Höchstwahrscheinlich sind wir aus den Schifffahrtswegen hinausgetrieben. Wir können nicht erwarten, dass uns jemand zu Hilfe kommt, und dieses Schiff wird sich nicht mehr lange über Wasser halten. Die Pumpen können mit dem einströmenden Wasser nicht Schritt halten. Sie haben es doch sicher schon bemerkt, oder?«
Rienzi starrte den kleineren Mann einen Moment lang an. In der Tat hatte er den steigenden Pegel mit einem ebenso wachsenden Gefühl der Verzweiflung beobachtet. Doch er konnte es sich nicht leisten, diese Ladung zu verlieren. Sie war zu wertvoll. Die Welt konnte es sich nicht leisten, dass er diese Ladung verlor. Wie konnte er es dem Mann verständlich machen?
»Kapitän, wenn Sie nicht wissen, wo wir sind«, argumentierte er, »wie können Sie dann hoffen, die Passagiere und die Mannschaft sicher in einen Hafen zu bringen?« Vielleicht war es egoistisch von ihm, zu versuchen, das sinkende Schiff im Wasser zu halten, aber er hatte keine Wahl. Er musste Covilha unbedingt davon überzeugen, das Schiff und die Ladung nicht aufzugeben. Es bestand immer noch eine geringe Möglichkeit, dass ihnen jemand zu Hilfe kam. Jede Minute, die er herausschlug, erhöhte diese Chance.
»Ich weiß nicht genau, wo wir sind«, sagte Covilha und hielt einen vernarbten Finger hoch, »aber wir sind den ganzen Tag nach Süden und Südosten abgedriftet. Ich habe eine ungefähre Vorstellung davon, wo wir uns befinden, und weiß, dass ich uns nach Singapur bringen kann. Das heißt, wenn wir von diesem Schiff herunterkommen, bevor wir alle ertrinken.« Der Kapitän setzte eine entschlossene Miene auf, und in diesem Moment begriff Rienzi, dass er den Mann niemals davon abbringen würde.
»Kapitän«, rief eine Stimme hinter Rienzi. Eines der Besatzungsmitglieder, ein kleiner, dunkelhäutiger Mann mit einer krummen Narbe, die von seinem linken Ohr bis zur Oberlippe verlief, eilte an ihm vorbei. Sein ängstlicher Blick verzerrte sein entstelltes Gesicht noch mehr. »Das Wasser kommt viel schneller als zuvor. Wir haben vielleicht nur noch Minuten!«
Der Kapitän warf Rienzi einen mitfühlenden Blick zu. »Es tut mir leid, Monsieur.«
Rienzis Schuldgefühle, weil er nur an die Hässlichkeit des Matrosen gedacht hatte, lösten sich mit Covilhas folgenden Worten auf.
»Geben Sie den Befehl zum Verlassen des Schiffes«, sagte der Kapitän. Ohne ein weiteres Wort wandte er sich von Rienzi ab und rief eilig Anweisungen.
Rienzi fluchte leise vor sich hin, eilte zum Vorderdeck und stieg auf die Ebene hinab, auf der die Kojen der Besatzung lagen. Er hatte sich genau eingeprägt, wo seine Schätze lagerten. Vor allem der eine. Deshalb fand er mühelos die Falltür, die in den Laderaum hinunterführte. Von oben drangen die Geräusche verängstigter Passagiere herab, die geglaubt hatten, das Schlimmste sei vorbei, und nun das Schiff verlassen mussten. Wie passend, dass dies um Mitternacht geschieht, dachte er.
Er riss die Falltür auf und stieg die Leiter hinunter. Schon nach wenigen Sprossen hörte er das Plätschern des Wassers im Inneren. Der Rumpf füllte sich schnell. Ein eisiges Gefühl des Unheils stieg in ihm auf, und er versuchte, in die tiefe Schwärze zu schauen, aber es war zu dunkel, um etwas zu erkennen. Er musste eine Laterne finden, auch wenn sie wahrscheinlich wenig nützen würde. Warum hatte er es nicht in seiner Koje aufbewahrt? Er kannte die Antwort: Es war zu groß, um es in dem winzigen Raum zu verstecken, und wäre für den Kapitän und die Mannschaft eine zu große Versuchung gewesen. Es war ihm sicherer erschienen, es in der Kiste mit den anderen Artefakten zu lassen. Jetzt war es vor neugierigen Händen sicher. Oder würde es bald sein. Die Ironie entlockte ihm ein kurzes Lachen.
Er kletterte die Leiter wieder hinauf und zurück auf das Deck. Die Dourado neigte sich bereits nach Backbord, und er hatte Mühe, das Gleichgewicht zu halten, als er in sein Quartier eilte. Dort holte er seine kleine Laterne und sein Tagebuch, das er in einem Sack aus Wachstuch aufbewahrte. Hastig entzündete er den Docht der Laterne und kehrte an Deck zurück.
Das Schiff schaukelte nun gewaltig, und er war gezwungen, sich mit der freien Hand auf das Deck zu stützen und sich wie eine verwundete Krabbe zu bewegen. Auf dem Weg zum Vorderdeck erregte ein Geräusch seine Aufmerksamkeit. Er hob seine Laterne und das Licht fiel auf zwei junge Frauen, die sich mit vor Angst erstarrten Gesichtern an den Mast klammerten.
»Zu den Booten«, rief er. »Schnell!«
Die kleinere Frau, eine Blondine, deren milchiger Teint in der Mischung aus Mond- und Lampenlicht fast gespenstisch wirkte, schüttelte den Kopf. Die andere reagierte überhaupt nicht. Die Angst schien sie zu lähmen.
»Monsieur!«, ertönte die dröhnende Stimme des Kapitäns. »Das zweite Boot legt ab! Sie müssen sofort kommen!«
»Warten Sie auf uns, Kapitän! Es sind noch Passagiere an Bord!«, rief Rienzi.
Wenn der Mann nicht auf ihn warten wollte, würde er vielleicht auf die Frauen warten.
»Beeilen Sie sich, ich bitte Sie!« Covilhas Stimme reichte beachtlich weit. »Das Schiff sinkt schnell!«
»Mon Dieu«, murmelte Rienzi, als er zu den verängstigten Frauen hinüberkletterte. »Kommen Sie mit mir«, befahl er. »Ich werde Sie zu den Booten bringen.«
Diejenige, die eben noch stumm dagesessen hatte, eine schlanke Brünette mit braunen Augen, nickte. Mit sichtlichem Widerwillen ließ sie den Mast los und kroch an seine Seite.
»Komm, Sophie«, rief sie der Blondine zu. »Wir müssen schnell gehen. Wir haben keine Zeit mehr.« Doch Sophie schüttelte den Kopf und weigerte sich, sich zu bewegen.
Diesmal machte Rienzi sich nicht die Mühe, seinen Fluch zu unterdrücken, sondern trat an die Seite der Frau, wobei seine Stiefel auf dem feuchten Deck rutschten. Mit dem Sack aus Wachstuch zwischen den Zähnen löste er mit der freien Hand Sophies Finger vom Mast. Er fasste sie um die Taille und hob sie auf seine Schulter. Er spürte, wie die Arme der anderen Frau ihn umfassten und ihn stützten, als sie gemeinsam über das schräge Deck stolperten.
Der Kapitän wartete an der Reling. Gemeinsam halfen sie den Frauen in das kleine Boot. In einiger Entfernung wartete das Langboot. Beide Boote waren mit besorgten Seeleuten und Reisenden überfüllt.
»Sind das alle?«, fragte Covilha.
Rienzi nickte und warf seinen Sack ins Boot hinunter. »Leinen los. Ich werde in Kürze nachkommen.« Er drehte sich um und ließ den Kapitän mit offenem Mund an der Strickleiter zurück. Er stolperte und schlitterte durch das Mannschaftsdeck zurück zu der Öffnung, die in den Laderaum führte. Er ließ seine Laterne durch die offene Falltür baumeln und spürte, wie ihm das Herz in die Hose rutschte. Alles stand unter Wasser. Alles würde verloren sein. Es würde verloren sein. Er hätte es aus dem Laderaum bergen sollen, als das Schiff auf die Felsen aufschlug. Er hatte nicht geglaubt, dass das Schiff wirklich sinken würde!
Ein klägliches Wimmern riss ihn aus seinen düsteren Gedanken, vor allem, als er feststellte, dass es nicht aus seiner eigenen Kehle kam. Er blickte nach unten und sah einen kleinen Hund, der durch das eiskalte Salzwasser paddelte, das durch den überfluteten Laderaum schwappte. Wie war er dorthin gekommen? Das Wasser stand so hoch, dass er das bemitleidenswerte Geschöpf mit Leichtigkeit am Genick packen und in Sicherheit bringen konnte.
Die Dourado schlingerte, und jetzt konnte er tatsächlich spüren, wie das Schiff sank. Wenn er sich nicht in Sicherheit brachte, bevor es unterging, konnte der Sog ihn unter Wasser ziehen. Er warf die Laterne weg und ignorierte das Klirren von splitterndem Glas. Den verängstigten Hund an seine Brust gepresst, stolperte er zur Leiter und kletterte auf Deck. Ohne nach den Rettungsbooten Ausschau zu halten, stürzte er zur Reling und sprang darüber hinweg. Die Dourado lag bereitsso tief, dass er kaum Zeit hatte, sich gegen den Schock des kalten Wassers zu wappnen.
Als er spürte, dass seine Füße das Wasser berührten, trat er hektisch um sich, um nicht zu weit unterzugehen. Er hob den kläffenden, panischen Hund über seinen Kopf und schaffte es, die winzige Kreatur über Wasser zu halten. Keuchend brach er durch die Oberfläche und schüttelte den Kopf, um das brennende Salzwasser aus den Augen zu bekommen. Er war erleichtert, als er das kleinere Boot in der Nähe sah, das auf ihn zusteuerte. Er ignorierte den Instinkt seines Körpers, sich zusammenzurollen, und bemühte sich angestrengt, sich über Wasser zu halten, während seine Retter zu ihm ruderten. Seine Beine fühlten sich wie Blei an, und seine durchnässte Kleidung und die schweren Stiefel zogen ihn nach unten. Er strampelte mit verzweifelter Wut, sank jedoch. Erst glitten seine Schultern unter die Wasseroberfläche, dann sein Kinn, dann sein ganzer Kopf. Er war dem Tod geweiht.
Starke Hände packten ihn an den Schultern und zogen ihn hoch. Covilha und der vernarbte Seemann zerrten ihn in das Boot. Er ließ sich auf die Planken fallen und sackte erschöpft gegen die Beine der anderen.
»Das alles für einen Hund«, flüsterte eine Stimme hinter ihm.
Kapitel 1
Ein totes Schiffist eine bessere Gesellschaft als ein lebender Mensch. Dane Maddock stieß sich mit zwei kräftigen Tritten durch das klaffende Loch in der Seite des gesunkenen Schiffes. Er ließ sich treiben, wobei er darauf achtete, die feine Schlickschicht, die das Innere des Schiffes bedeckte, nicht zu berühren. Es wäre sonst die Unterwasserversion eines Whiteouts und würde seine Erkundung verderben. Ein Schwarm leuchtend blauer Sergeant Majors, so genannt wegen ihrer dunklen, vertikalen Streifen, die an das Abzeichen eines Sergeants erinnerten, schwamm vorbei und schien den Eindringling in ihrem wässrigen Reich nicht zu bemerken. Maddock grüßte sie mit einem gespielten Salut, und sie verschwanden in der Weite des Meeres. Mit einer weiteren kleinen Bewegung seiner Schwimmflossen glitt er tiefer ins Innere des Wracks.
Der Thunfischfänger war nicht sehr alt. Die Außenseite war weiß mit breiten grünen Streifen. Er erwartete nicht, im Inneren etwas Interessantes zu finden, aber nach einem langen und fruchtlosen Tag der Suche nach den Überresten der gesunkenen spanischen Galeone brauchte er dringend eine Ablenkung.
Er schaltete seine Stirnlampe ein und sah sich um. Höchstwahrscheinlich war dies das Boot eines Drogenhändlers gewesen. Das Innere war vollkommen ausgehöhlt, und es fehlte alles, was zum Fischfang gehörte. Ein Feuerlöscher hing noch an der Wand, eines der wenigen verbliebenen Utensilien in dieser versunkenen Blechbüchse. Er glitt hinüber und strich vorsichtig den Schlamm vom Inspektionsetikett. 2002 stand darauf. Er sah sich noch einige Augenblicke um und betrachtete die zerbröckelnden Polster der Sitze und die Reste von Meereslebewesen, die sich im Inneren niedergelassen hatten. Hier gab es nichts, was sein Interesse weckte. Er warf einen kurzen Blick auf seine Taucheruhr. Ihm blieben noch etwa zehn Minuten Luft. Es war Zeit, wieder aufzutauchen.
Er drehte sich um und schwamm aus dem Wrack. Als er das Boot verließ, zog ein Schatten über ihn hinweg und etwas Großes und Dunkles erschien am Rand seines Sichtfeldes. Er blickte auf. Über ihm kreiste die dicke, graue Gestalt eines Bullenhais. Maddock hielt inne und beobachtete das wilde Tier. Mit einem aggressiven und unberechenbaren Bullenhai war nicht zu spaßen. Am besten wartete er, bis dieser seinen Weg fortsetzte.
Die große Kreatur schwamm in einem engen Kreis fünf Meter über ihm. Maddock hielt sich fest, um nicht seine Aufmerksamkeit zu erregen. Schwache Sonnenstrahlen drangen durch das kristallklare Wasser und reflektierten auf der Haut des Hais. Das Tier schien Maddock mit seinem durchdringenden Blick zu fixieren, obwohl er wusste, dass er sich das nur einbildete.
Minuten vergingen, ohne dass der Hai sich entfernte. Maddock hätte schwören können, dass das Vieh ihn im Auge behielt. Als würde er ihn mit seinen gezackten weißen Zähnen angrinsen und ihn herausfordern, es zu wagen. Wieder schaute er auf seine Uhr. Noch sechs Minuten Luft. Viel länger konnte er nicht warten. Er würde es riskieren müssen. Wenigstens war das Wasser nicht allzu tief – kaum mehr als dreißig Meter, wenn überhaupt. Trotzdem war es am sichersten, langsam aufzusteigen und ein paar Stopps einzulegen, um Dekompressionsprobleme zu vermeiden. Sein Herz schlug ein wenig schneller, aber er widerstand dem Drang, mit aller Kraft an die Oberfläche zu schießen, und begann einen langsamen, kontrollierten Aufstieg.
Er hatte Geschichten von Männern gelesen, die mit Bullenhaien getaucht waren, und hatte sogar ein paar von ihnen getroffen. Die meisten von ihnen waren verrückte Adrenalinjunkies gewesen. Es war jedoch zumindest theoretisch möglich, den Raum zu teilen, ohne die Bestie zu provozieren. Das Problem war nur, dass es sehr stark davon abhing, was für einen Tag der Hai gerade hatte.
Er hielt die Arme dicht an den Seiten, streckte sich und bewegte sich mit kontrollierten Tritten fort. Langsam glitt er nach oben zu seinem wartenden Boot, wobei er so ruhig wie möglich blieb und versuchte, sich wie ein Stück Treibgut zu verhalten. Steig nicht schneller auf als deine Luftblasen, erinnerte er sich.
Der Hai patrouillierte weiter in der Gegend und zeigte keine Anzeichen von Unruhe, zumindest hoffte Maddock das. Er hatte jetzt einen guten Blick auf das Raubtier. Es war mindestens drei Meter lang und wahrscheinlich ein Weibchen. Durch das Glas eines Aquariums oder von einem Tauchkäfig aus betrachtet, könnte er diese Schönheit wohl besser würdigen. Haie waren faszinierende Geschöpfe. Eine Mischung aus Muskeln, Zähnen und Magen, pflegte sein Vater zu sagen. Bis jetzt gab er ihm keinen Hinweis darauf, dass er ihn bemerkt hatte. Maddock trat mit den Flossen und glitt nun in einem steilen Winkel nach oben. In diesem Moment bog der Hai nach links ab und steuerte direkt auf ihn zu.
Maddock spannte sich an. Das an seinem Oberschenkel befestigte Tauchermesser würde ihm gegen die zähe Haut wenig nützen. Entgegen seiner Instinkte zwang er sich, ruhig zu bleiben, sich tot zu stellen und einfach im Wasser zu treiben. Der Hai schoss auf ihn zu und Maddock sah nur noch die breite, hässliche Schnauze und Reihen rasiermesserscharfer, aufblitzender Zähne.
Sein natürlicher Überlebensinstinkt rang mit seinem Willen und schrie ihn an, er solle sein Messer zücken und zustechen. Gerade als er nachgeben wollte, zog der Hai an ihm vorbei und streifte seine Schulter mit seiner rauen Haut. So schnell, wie er gekommen war, verschwand er auch wieder.
Maddock schloss für einen Moment die Augen und sprach ein kurzes Dankgebet an die Götter des Meeres. Ohne sich nach dem Hai umzusehen, drückte er sich hastig die Nase zu und pustete, sodass seine Ohren knackten, bevor er seinen langsamen Aufstieg fortsetzte. Er sah auf sein Handgelenk hinunter. Fünf Minuten. Als er aufblickte, entdeckte er zu seiner Überraschung zwei Boote über sich. Er hatte sich so sehr auf den Hai konzentriert, dass er die Ankunft des zweiten Bootes nicht bemerkt hatte. Misstrauisch glitt er weiter Richtung Wasseroberfläche. Das neu eingetroffene Boot trieb direkt über ihm. Vorsichtig tauchte er hinter dem Heck auf.
Die helle karibische Sonne tanzte blendend auf dem azurblauen Wasser, und er blinzelte. Bei dem Boot handelte es sich um einen alten Kutter der Küstenwache. Jemand hatte es in einem hässlichen Grünton neu gestrichen und die kubanische Flagge schlampig auf die Rückseite gepinselt. Vier Männer standen mit dem Rücken zu ihm, drei von ihnen hielten Gewehre im Anschlag. Einer von ihnen sprach mit der Besatzung von Maddocks Boot, der Sea Foam. Die Neuankömmlinge waren mit alten AK-47 bewaffnet und trugen einen bunten Mix aus militärischen Uniformteilen, so grün und hässlich wie ihr Schiff.
An Bord der Sea Foam stand Maddocks Partner, Uriah Bonebrake, von seinen Freunden einfach Bones genannt, den unwillkommenen Eindringlingen gegenüber. Ein falsches Lächeln zierte sein Gesicht und seine Körperhaltung wirkte fälschlicherweise entspannt. Der in Carolina geborene Cherokee, mit dem Maddock seit ihrer gemeinsamen Zeit bei den Navy SEALS befreundet war, trug eine Neun-Millimeter-Glock an seiner rechten Hüfte, die unter seinem locker sitzenden Hawaiihemd nicht zu sehen war. Willis Sanders, Matt Barnaby und Corey Dean, die anderen Mitglieder der Crew, standen hinter Bones. Willis, dessen ebenholzfarbene Haut und rasierter Kopf in der Sonne glänzten, verschränkte die Arme vor der Brust und starrte die Neuankömmlinge kalt an. Matts magere, gebräunte Miene wirkte besorgt, während Corey verängstigt aussah. Seine Mannschaft war waffentechnisch unterlegen, aber Maddock wusste, dass alle außer Corey nach einer Lücke suchten und bereit waren, zurückzuschlagen, sobald sich die Gelegenheit ergab.
»Sie befinden sich in kubanischen Gewässern, Señor«, sagte der Mann ohne Gewehr in der Hand. »Wir müssen Ihr Boot nach Drogen durchsuchen.« Einer seiner Kameraden lachte leise und er brachte ihn mit einer Handbewegung zum Schweigen.
»Das hier sind keine kubanischen Gewässer, Chief«, erwiderte Bones mit seiner tiefen, entspannten, fast freundlichen Stimme. »Wie ich Ihnen schon sagte, wir sind Meeresarchäologen. Dies ist ein Forschungsschiff. Wenn Sie Drogen suchen, gibt es da diesen Typen, der an der Ecke beim Walmart in der Nähe meines Hauses rumhängt und Ihnen wahrscheinlich was besorgen kann.«
Bones wusste ebenso wie Maddock, dass es sich bei diesen Clowns vielleicht um Kubaner, aber auf keinen Fall um Regierungsagenten handelte. Sie waren selbsternannte Piraten, Schläger, die vor allem private Freizeitboote überfielen. Er musste seiner Crew helfen. Aber wie?
»Sie, mein großer Freund, sind nicht so witzig, wie Sie glauben. Ich schlage vor, Sie kooperieren. Zwingen Sie uns nicht, Ihnen etwas anzutun.« Die Stimme des Mannes war so ölig wie seine Haut.
»Das ist jetzt wirklich nicht nötig.« Bones behielt seinen freundlichen Ton bei. »Wir haben eine Kühlbox in der Kajüte. Ich teile mein Dos Equis nicht, aber vielleicht wollen Sie ja ein Diät-Mountain-Dew oder eine Dose Bud?«
Bones spielte auf Zeit, damit Maddock ihnen helfen konnte. In der Hoffnung, aufgrund des Kuttermotors nicht gehört zu werden, tauchte Maddock schnell zurück zum versunkenen Thunfischfänger ab. Er hatte eine Idee.
Er glitt zurück ins Boot, wobei er sich die Schulter an einem zerklüfteten Metallstück aufriss. Das Salzwasser brannte in der Wunde, aber er hatte keine Zeit, darüber nachzudenken. Sein Blick fiel auf die Uhr. Noch weniger als drei Minuten. Er musste sich beeilen.
Hastig schwamm er durch das düstere Boot und fand bald, was er suchte. Er hob es hoch und drehte sich um, stellte jedoch fest, dass er absolut nichts mehr sah. In seiner Eile hatte er den Schlick auf dem Boden des Schiffes aufgewühlt, und das Innere des untergetauchten Schiffes war nun mit einer dicken, undurchsichtigen Wolke aus Sediment gefüllt.
Mehr verärgert als besorgt, nahm er sich einen Moment Zeit, um sich zu orientieren. Es war ein kleines Boot, und er sollte keine Probleme haben, wieder herauszukommen, aber die kostbaren Sekunden liefen ihm davon. Er blies ein paar Luftblasen aus, um sicherzugehen, dass er die korrekte Richtung hatte. Dann streckte er eine Hand zur Decke. Er schwamm zur gegenüberliegenden Seite des Bootes, an der sich das Loch befand, und hielt sich dabei zur Orientierung an der Wand fest.
Der Ausgang offenbarte sich ihm wie ein Stück blauer Himmel an einem Regentag. Er verließ das gesunkene Boot und machte sich bereit, zur Sea Foam und seiner Mannschaft zurückzukehren. Aus dem Augenwinkel nahm er eine Bewegung wahr. Der Hai! Diesmal blieb ihm nichts anderes übrig, als an die Oberfläche zu schwimmen und zu hoffen, dass das Urtier ihn weiterhin ignorierte. Er biss die Zähne zusammen und schwamm so schnell er konnte hinauf. Der Hai nahm keine Notiz von ihm, sodass er unbehelligt auftauchen konnte.
Die Anspannung hatte ihren Höhepunkt erreicht. Der Anführer der Kubaner fuchtelte mit den Armen und brüllte auf Spanisch. Aufgrund der wenigen aufgeschnappten Worte wusste Maddock, dass der Mann mit Körperverletzung drohte. Bones' Blick huschte für einen kurzen Moment in Maddocks Richtung. Mehr musste er nicht wissen. Bones hatte ihn gesehen und war bereit. Maddock befreite sich von seinen Schwimmflossen und nahm den Sauerstofftank ab, als der Bullenhai auf der anderen Seite der Boote auftauchte und direkt auf ihn zusteuerte. Die Rückenflosse schnitt durch das ruhige Wasser des Golfs. Die Wunde an seiner Schulter! Das Tier hatte ihn gewittert und kam nun auf ihn zu. Aber das Wichtigste zuerst.
Das sollte funktionieren, dachte Maddock. Er hob den Feuerlöscher, den er aus dem Boot der Drogenhändler geholt hatte, und schoss mit voller Wucht auf die Piraten.
Von den Männern auf dem Kutter ertönten überraschte Rufe, und Schüsse ertönten, als Bones die Ablenkung nutzte, um seine Glock zu ziehen und das Feuer zu eröffnen. Die beiden Eindringlinge, die am weitesten von Maddock entfernt standen, gingen sofort zu Boden. Der Mann am Heck schoss wild mit seiner AK um sich. Salven aus heißem Blei erfassten die Sea Foam.
Der Hai war zehn Meter entfernt und kam schnell näher. Maddock schleuderte den Feuerlöscher in seine Richtung, ergriff die Bordwand und zog sich aus dem Wasser. Er stürzte über das Heck und sprang auf die Füße, wobei er sein Tauchermesser zog. Nur wenige Schritte entfernt entdeckte ihn der verwirrte Angreifer, der immer noch versuchte, seine brennenden Augen offen zu halten, und richtete seine Waffe auf ihn.
Kugeln sausten an Maddocks Ohr vorbei, als er die Lücke zwischen sich und dem Kubaner schloss. Er holte mit der linken Hand aus und schlug den Lauf der Waffe zur Seite. Gleichzeitig stieß er mit der rechten Hand kräftig zu. Der Kubaner, der sein Gewehr noch immer festhielt, konnte sich nicht schützen. Maddock stieß sein Messer in die Brust des Mannes. Mit einem schnellen Ruck nach links, dann nach rechts, riss er die Waffe wieder los und stieß den sterbenden, selbsternannten Piraten von sich.
Der letzte Feind war auf einem Knie und lieferte sich einen Schusswechsel mit Bones. Er war mit einem Kaliber.38-Revolver bewaffnet. Zähneknirschend stürzte Maddock auf ihn zu. Der Räuber musste ihn aus dem Augenwinkel bemerkt haben. Er drehte sich um, richtete seine Pistole auf Maddock und drückte ab. Das hohle Geräusch des Hahns, der wiederholt auf eine leere Trommel schlug, schien ohrenbetäubend laut zu sein. Der Mann fluchte auf Spanisch, warf Maddock die nutzlose Waffe entgegen und sprang dann auf.
Maddock zielte tief und hart auf die Mitte des Mannes, aber sein Gegner war ein erfahrener Kämpfer. Der Kubaner drehte sich nach rechts, packte Maddocks linkes Handgelenk mit beiden Händen und versuchte, ihn über seine Schulter zu werfen. Maddock sah die Bewegung kommen und schaffte es, den Mann am losen Stoff seiner Uniformhose hinter seinem linken Oberschenkel zu packen. Er riss kräftig an ihm und brachte beide aus dem Gleichgewicht. Als sie auf das Deck stürzten, traf der Kubaner Maddocks Handgelenk, sodass sein Tauchermesser übers Deck schlitterte. Er rollte sich ab, kam flink wieder auf die Beine und stürzte sich erneut auf Maddock.
Das jahrelange Kampftraining meldete sich nun zurück. Maddock machte sich lang und beugte die Knie. Er schlang einen Arm um die Taille des Mannes und den anderen um seinen Oberschenkel. Er ließ sich vom Schwung des Angreifers mitreißen und hob ihn wie einen Baumstamm auf seine Schulter. Den Schmerz seiner Wunde ignorierend, drehte er sich um und ließ seinen Gegner über die Bordwand ins Wasser fallen.
Der Kubaner tauchte wütend schreiend auf, doch seine Schreie verwandelten sich schnell in ein verängstigtes Kreischen, als das Wasser um ihn herum aufgewühlt wurde und zu schäumen begann. Der Bullenhai stürzte sich in einem unheimlichen, lautlosen Angriff auf ihn. Der Mann schrie und schlug mit den Fäusten auf den Hai ein, doch ohne Erfolg. Bones, der sich während des Kampfes aus Angst, den falschen Mann zu treffen, zurückgehalten hatte, hob nun seine Waffe und zielte auf den Hai. In diesem Moment hörte der Kubaner auf, sich zu wehren. Große Mengen Blut strömten aus dem Maul des Hais. Das wilde Raubtier zog den leblosen Körper unter Wasser und hinterließ eine purpurne Lache zwischen den beiden Booten.
Die Kraft verließ Maddocks Beine und er lehnte sich schwer gegen das Geländer.
»Danke, dass ihr geholfen habt«, rief er seinen Freunden zu.
»Hey Mann, nur weil er den Hai nicht gesehen hat, heißt das nicht, dass er uns nicht aufgefallen ist«, rief Bones zurück. »Der Typ war sowieso ein Idiot.« Der Indigene mit dem Pferdeschwanz beugte sich mit seinem muskulösen, knapp zwei Meter großen Körper über die Reling, legte die Hände an den Mund und rief in Richtung Wasser: »Hey Kumpel, wie viele Schüsse hat ein Revolver?«
»Das ist eiskalt«, sagte Maddock. Er fühlte sich ein wenig schuldig, weil er den dunklen Humor genoss, den Bones sich zu eigen gemacht hatte, um mit der Realität der Kämpfe fertig zu werden, die sie im Dienst erlebt hatten.
»Ja, aber ich habe recht.« Bones' freudloses Grinsen erinnerte Maddock zu sehr an all das, was sie bei den SEALS gesehen hatten. Bones war ein guter Mann, aber auch ein erbarmungsloser Killer, wenn er glaubte, es gäbe einen triftigen Grund dafür, ein Leben zu nehmen.
Willis und Matt stürmen mit Pistolen in der Hand aus der Kajüte.
»Mann, ihr habt uns echt nichts übrig gelassen.« Willis' rasierter Kopf und seine tiefe Stimme erinnerten Maddock an Dennis Haysberts Figur Cerrano in den Major-League -Filmen. Er wandte sich an Matt. »Nach allem, was wir zusammen durchgemacht haben, können diese Jungs immer noch nicht teilen.« Wie Bones gehörte auch Willis zu den Ex-SEALS und liebte einen guten Kampf.
»Es ist nicht unsere Schuld, dass ihr eure Waffen unter Deck gelassen habt. Einige von uns sind immer vorbereitet.« Bones grinste.
»Ich dachte, Maddock wäre der Pfadfinder in dieser Gruppe«, hielt Willis dagegen.
»Wo ist Corey?«, fragte Maddock etwas schärfer als beabsichtigt. Aufgrund des Kampfes war er angespannt und er ärgerte sich bereits über den Schaden an seinem Boot.
»Unten. Er hat die Küstenwache angefunkt, als wir diese Typen kommen sahen, und hält sie jetzt auf dem Laufenden«, antwortete Matt und lehnte sich gegen die Reling der Sea Foam. Er fuhr sich mit seinen langen Fingern durch die stachligen, braunen Haare, während er den Blick über den Horizont schweifen ließ. Der Zustand seiner Haare war für ihn immer von größter Bedeutung. »Sie sollten jeden Moment hier sein.« Matt hatte früher als Infanterist bei der Army gedient, aber der dürre Maat und Ingenieur hatte sich als fähiger Seemann erwiesen.
»Sie sind fast da.« Corey, ihr hellhäutiger, rothaariger Computerspezialist, kam gerade aus der Kajüte. Er setzte sich neben Bones auf das Deck, stützte die Ellbogen auf die Knie, legte das Kinn auf die Hände und runzelte die Stirn. »Ihr wisst, was das bedeutet.«
»Ja«, stöhnte Maddock, »zurück zu den Docks.«
Eine Verzögerung konnten sie sich nicht leisten. Die Geschäfte liefen schlecht, und er hatte darauf gezählt, dass die spanische Galeone ihr Schicksal ändern würde. Er hatte seine Hausaufgaben gemacht, gründlich recherchiert und war sich sicher, eine Spur von ihr zu haben. Aber in diesem Geschäft blieb nichts lange geheim. Seine Konkurrenten würden von der Schießerei erfahren und sich fragen, was er hier draußen zu suchen hatte.
»Es sollte nur für einen Tag sein«, sagte Bones hoffnungsvoll. »Es ist ziemlich offensichtlich, wer diese Typen sind. Oder sollte ich sagen, waren?« Er verzog den Mund zu einem schiefen Lächeln.
»Ich hoffe, dass es nicht lange dauert«, erwiderte Maddock. »Wir müssen wieder an die Arbeit.«
Sonst sind wir am Arsch, sparte er sich. Die anderen wussten es bereits.
»Wenn jemand das Wrack vor uns findet …« Er verstumme, als das Boot der Küstenwache am Horizont auftauchte.
Kapitel 2
Maddock und Bones begutachteten die Schäden an der Sea Foam, als das dumpfe Geräusch sich nähernder Schritte ihre Aufmerksamkeit erregte. Obwohl sie zurück im Hafen waren, machte sie der Angriff noch immer nervös. Selbst Corey, der nicht im Geringsten zu Gewalt neigte, hatte sich mit Matts Reservewaffe bewaffnet – einer 9-Millimeter – und hielt Ausschau nach Gefahren.
Eine junge Frau, vielleicht Mitte zwanzig, stand am Ende des Stegs. Sie war groß und ihre langen, gut gebräunten Beine kamen in den Khaki-Shorts wunderbar zur Geltung. Ein enges, weißes, ärmelloses Top schmiegte sich genau richtig an ihren schlanken, athletischen Körper. Die intensive Sonne von Key West glitzerte auf ihren langen, weißblonden Haaren, die sie in einem hochgesteckten Dutt trug. Ihrem kantigen und doch attraktiven Gesicht schien die feuchte Luft nichts anhaben zu können. Ihr Kinn war ein wenig zu klein und ihre Nase ein wenig zu groß für ihr Gesicht, aber das verlieh ihrer Erscheinung nur noch mehr Charakter. Sie betrachtete Maddock intensiv aus ihren grünen Augen, die ihm für einen Moment den Atem raubten. Sie war eine Schönheit.
»Heilige Scheiße«, murmelte Bones. »Ich würde sie nicht aus dem Bett werfen, wenn sie darin krümelt.«
»Guten Tag«, sagte die junge Frau und lächelte breit. Sollte sie Bones' Bemerkung gehört haben, ließ sie es sich nicht anmerken. »Erlaubnis, an Bord zu kommen?« Ihre Frage schien eine reine Formalität zu sein. Das wusste auch Maddock. Schöne Frauen waren auf der Sea Foam rar gesät.
»Gewährt«, antwortete Bones schnell und schob Maddock mit der Schulter zur Seite. Er bot seine Hand an, um der jungen Frau auf das Deck zu helfen. Sie brauchte seine Hilfe jedoch nicht, denn sie sprang über die Reling und landete mit katzenhafter Geschicklichkeit auf den Füßen. Bones trat einen Schritt zurück und grinste anerkennend. »Nicht schlecht. Was sind Sie eigentlich, eine von diesen rumänischen Turnerinnen oder so?«
»Wohl kaum.« Sie klopfte sich etwas unsichtbaren Schmutz von den Shorts. »Nun denn. Ihr seid dann wohl Bonebrake und Maddock.« Sie nickte jedem von ihnen zu.
»Als ob wir eine Wahl hätten«, antwortete Maddock und fragte sich sofort, ob das für sie genauso dumm klang wie für ihn. Bones war der Clevere von ihnen. »Und Sie sind …?«
»Kaylin Maxwell.« Sie sah ihn an, als müsste er sie kennen.
An diese Beine würde er sich bestimmt erinnern, wenn auch nicht an den Namen.
»Tut mir leid, Miss Maxwell, kennen wir uns?«
»Sicher«, warf Bones ein. Sein Lächeln ließ die strahlend weißen Zähne in seinem tief gebräunten Gesicht aufblitzen. »Du weißt schon, bei dieser Sache, an diesem Ort …« Kaylin sah ihn verwirrt an und er verstummte.
Kaylin verschränkte die Arme und betrachtete die Einschusslöcher an der Seite des Bootes. »Termiten?«, fragte sie mit fester Stimme.
»Kubaner«, erwiderte Maddock. »Es ist eine lange Geschichte.«
»Aber eine tolle Geschichte«, unterbrach Bones ihn. »Wir waren Helden. Wie wäre es, wenn ich Ihnen einen Drink spendiere und Ihnen alles darüber erzähle?«
»Ich nehme ein Bier, wenn Sie eins da haben«, sagte sie. »Aber ich kenne Ihren Ruf gut genug, um mich nicht von Ihnen einladen zu lassen.«
Maddock wartete darauf, dass sie ihre Anwesenheit erklärte, doch sie tat nichts dergleichen. »Sie haben uns noch nicht verraten, woher wir Sie kennen.«
»Sie kennen mich nicht«, antwortete die Blondine, »aber Sie beide kannten meinen Vater sehr gut.«
Maddock hielt einen Moment inne und trat dann einen Schritt zurück. »Moment! Sie sind die Tochter von Maxie?« Commander Hartford Maxwell hatte seine und Bones' Einheit während ihrer Dienstzeit bei den SEALS geleitet. Maddock hatte als Lieutenant Commander unter ihm gedient. »Ich habe seit Jahren nichts mehr von ihm gehört. Wie geht es ihm?«
Kaylin wandte den Blick ab, ihre hellen Augen verdunkelten sich und sie wirkte niedergeschlagen.
Maddock wurde das Herz schwer. Er kannte ihre Antwort bereits.