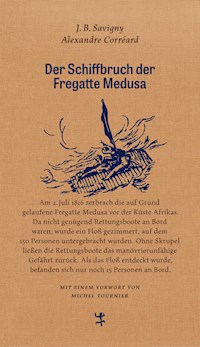
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin
- Kategorie: Lebensstil
- Serie: Französische Bibliothek
- Sprache: Deutsch
Die Wahrheit ist oft unwahrscheinlich! Am 2. Juli 1816 zerbrach die auf Grund gelaufene Fregatte Medusa vor der Küste Afrikas. Da nicht genügend Rettungsboote an Bord waren, wurde ein Floß gezimmert, auf dem nicht weniger als 150 Personen untergebracht wurden. Ohne Skrupel entfernten sich die Rettungsboote und ließen das weitgehend manövrierunfähige Gefährt zurück. Als das Floß durch Zufall nach zwölf Tagen entdeckt wurde, befanden sich nur noch fünfzehn Personen am Leben. Der vorliegende Romanbericht zweier Überlebender beschreibt eindrucksvoll den Kampf auf hoher See sowohl gegen den Hunger als auch gegen die Leidensgenossen. Berühmt wurde der Text nicht nur durch die erstaunlich nüchterne Schilderung von Meuterei und Kannibalismus, sondern auch durch die politische Bedeutung, da nicht wenige Zeitgenossen in diesem Schiffbruch ein Bild des Staatsschiffs sahen. Die Medusa wurde sofort als allégorie réelle auf die Zustände im nach-revolutionären Frankreich bezogen. Der Bericht lieferte aber auch den Impuls für eine der imposantesten Bildfindungen der Moderne. Gaben die beiden Autoren den politischen Misständen durch ihre Beschreibung des Schiffbruchs eine Stimme, so gab der junge Théodore Géricault ihm mit seinem gleichnamigen Monumentalgemälde ein Gesicht. In seinem Essay geht Jörg Trempler auf die Beziehung zwischen Textquelle und Bildgestalt ein. Er kommt über die Rezeptionsgeschichte des Gemäldes auf aktuelle Fragen zur Bildpolitik zu sprechen und zieht eine Parallele zur heutigen Livebildberichterstattung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Savigny / Corréard
Der Schiffbruch der Fregatte Medusa
Jean-Baptiste Henri Savigny
Alexandre Corréard
Der Schiffbruch der Fregatte Medusa
Mit einem Vorwort von Michel Tournier,einem Nachwort von Johannes Zeilingerund einem Bildessay zu Théodore Géricaults»Floß der Medusa« von Jörg Trempler
Inhalt
Michel Tournier – Das Floß der Medusa
Jean-Baptiste Henri Savigny und Alexandre Corréard – Schiffbruch der Fregatte Medusa auf ihrer Fahrt nach dem Senegal, im Jahr 1816
Johannes Zeilinger – Der Tod der Medusa
Jörg Trempler – Der Stil des Augenblicks. Das Bild zum Bericht
Nautisches Glossar
Literaturverzeichnis
Michel Tournier
Das Floß der Medusa
Das furchtbare Schicksal der Medusa, jenes französischen Schiffes, das am 2. Juli 1816 auf der Arguin-Bank, vierzig Seemeilen vor der Küste Afrikas, Schiffbruch erlitt, dringt erst durch mehrere Filter zu uns; sie entstellen es, bereichern es aber auch.
Gefiltert wird es naturgemäß durch die Zeit, die uns davon trennt, und nicht minder auch durch das geschichtliche Umfeld—jene frisch bejubelte Restauration mit ihrem Salto über ein Vierteljahrhundert der Revolution und des Empire hinweg nach rückwärts. Um sich davon wenigstens eine schwache Vorstellung zu machen, muß man die Befreiung Frankreichs von 1944 erlebt haben und den politischen und moralischen Umbruch, den sie mit sich brachte. Daß der Kommandant des Schiffes – Hugues Duroy Vicomte de Chaumareys – ein früherer Emigrant ohne jede seemännische Erfahrung war, spielte beim Grund für die Katastrophe und auch bei ihrer nachträglichen Beurteilung eine entscheidende Rolle.
Bei näherer Betrachtung ist es seltsam und erstaunlich, daß ein Gemälde, dessen Schöpfer Théodore Géricault aus politischen Gründen und wegen seines frühen Todes bar jeder Anerkennung und Ehrung bleiben sollte, derart berühmt wurde, daß es sich zwischen das reale Geschehen und uns schiebt. Was wäre uns ohne Géricault vom Schiffbruch der Medusa in Erinnerung? Hier betritt man den Bereich des Mystischen, in dem das Bild über die Wirklichkeit siegt. Der morbide Reiz dieses Bildes erwächst aus dem ununterscheidbaren, bedrängenden Durcheinander von Toten und Überlebenden, von heller Hoffnung und absoluter Verzweiflung.
Das Thema Floß wurzelt tief in unserer Vorstellungswelt. Man spürt ein deutliches Unbehagen, wenn man auf Géricaults Gemälde ein vom Wind geblähtes Segel sieht, von dem das Floß anscheinend vorangetrieben wird. Eine traumwandlerische Logik in uns läßt die Gleichsetzung Floß – Schiff nicht zu. Nein, das Floß ist kein Schiff, und es verträgt weder Segel noch Motor. Dieses Gefühl hatten übrigens von Anfang an auch die Seeleute der Medusa, die behaupteten, das Floß durch Ruderboote schleppen zu können. Es wurde ihnen alsbald klar, daß das Floß eine träge, maßlos schwere Masse darstellte und daß Rudererkraft sie niemals von der Stelle bewegen konnte. Sie mußten, ob sie wollten oder nicht, die Taue loswerfen, die sie mit dem Floß verbanden, und es seinem Schicksal überlassen.
Diese naturgegebene Unbeweglichkeit des Floßes hat neuerdings im Urwald des Amazonas eine wunderbare Illustration gefunden: mit dem »Gipfelfloß«. Hubschrauber hatten auf den Wipfeln der Bäume im tropischen Urwald ein großes Netz ausgebracht, auf dem dann ein Team von Naturforschern lebte. Unter freiem Himmel, dreißig Meter über dem Boden, konnten sie Vögel, Insekten und die Vegetation des »grünen Baldachins«, der Gipfeletage des Feuchtwaldes, erforschen, wo der Hauptteil des tropischen Lebens beheimatet ist. Nichts weckt so sehr wie dieses »Floß« die Vorstellung von Unbeweglichkeit inmitten eines fragilen, sich ständig wandelnden Umfeldes.
Hier ist wohl der rechte Ort, eine der bizarrsten, bedeutungsschwersten Komponenten dieser erstaunlichen Geschichte anzusprechen: den Namen Medusa, den das Schiff trug. Durch welches Mysterium, welche Verirrung konnte man einem Schiff diesen Namen anhängen? Denn eine Meduse ist nicht etwa ein Fisch, sie ist ein gallertiger Schirm, der sich wabbelnd in den Wassern bewegt. Paul Valéry hat sie mit lyrischer Kraft gefeiert, die Quallen, diese »Wesen aus einer Substanz ohnegleichen, durchscheinend und sensibel, irre sich wandelnd, gläserne Leiber, Kuppeln von wehender Seide, Kronen wie aus Glas, lange, lebendige Riemen, alle durchwogt von eiligen Wellen, Fransen und Runzeln, in die sie sich legen und aus denen sie sich wieder glätten.«* Und zu erwähnen ist auch das schlangenstarrende Haupt von einer der drei Gorgonen – der Medusa –, das sie, welche es ansahen, zu Stein werden ließ. Ein Schiff wirklich Medusa zu taufen — hieß das nicht, es bewußt einem geheimnisvoll-tragischen Schicksal überantworten?
Dennoch enthält das tödliche Dahindriften der 117 Schiffbrüchigen des Unglücksfloßes zumindest eine Episode, die anmutig, wundersam und voll luftiger Poesie ist. Am Abend des vierten Tages gegen vier Uhr, so berichtet Jean-Baptiste Henri Savigny, ging ein Schwarm fliegender Fische auf dem Floß nieder. Über 300 wurden von den Schiffbrüchigen eingefangen und lieferten ihnen eine unerwartete, von der Vorsehung geschenkte Nahrung. Man denkt da gewiß an das Manna, das Jehova auf die Juden herabregnen ließ, als sie Mose folgend die Wüste durchquerten, aber noch mehr denkt man vielleicht an den wunderbaren Fischfang, den Jesus den Männern vom See Genesareth bescherte.
Das ist nicht das einzige religiöse Echo dieser Geschichte. Paradoxerweise fehlte es den Schiffbrüchigen an allem — außer an Wein, denn ein Barriquefaß hatte auf das Floß umgeladen werden können, und darum gesellte sich zu Erschöpfung und Hunger oftmals der Rausch. Auch da strömen uns biblische Anklänge zu, denn in unserer religiösen Bilderwelt fließt der Wein in Strömen, von Noahs Trunkenheit bis zur Hochzeit zu Kana.
So sind wir nun durch den Wein zum Kern des Dramas der Medusa gelangt, den wir nicht umgehen können. Ich meine die Szenen von Kannibalismus, die geschahen und die mit äußerstem Grauen das Überleben der Fünfzehn ermöglichten, die von der Brigg L’Argus geborgen wurden.
Über das Verzehren von Menschen wurden in den Ethnien, wo es vorkommt, zahlreiche Studien erstellt. Der Abscheu, den es uns einflößt, sollte angesichts der Dimension, die ihm in allen beobachteten Fällen zukommt, sehr viel geringer sein. Denn es geht nie darum, menschliches Fleisch zu sich zu nehmen, wie man Gemüse oder ein Tier ißt. Der Tote, dessen Körper unter die Mitglieder von ein und demselben Stamm verteilt wird, ist immer ein Fremder, und das Verzehren seines Körpers hat das Ziel, sich Fähigkeiten einzuverleiben, die ihm eigen und die wertvoll sind. Kannibalismus ist also weit mehr ein geistiger als ein materieller Akt, und zumeist hat der Verzehr von Menschenfleisch die Form einer symbolischen Zeremonie.
Auch da werden wir wieder in unsere eigene geistige Welt verwiesen. Für die Judenchristen, die wir ja sind, ist die Eucharistie kein Mysterium, das man sich so leicht zu eigen macht. Als Jesus sie verkündete, rief er damit bei seinen Jüngern Empörung und Abkehr hervor. Am stärksten äußerte sich Jesus hierüber in der Synagoge von Kaparnaum:
»Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot ißt, der wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Da stritten die Juden untereinander und sagten: Wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben? Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes eßt und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch ißt und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben, und ich werde ihn am Jüngsten Tage auferwecken. […] Viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen: Das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? […] Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm.« (Johannes 6,51–54, 60, 66)
Zwischen Kannibalismus und Eucharistie liegt natürlich eine ungeheure Distanz. Doch der Weg aufwärts, der sie vereint, ist durchlässig. Vor einigen Jahren war ein Flugzeug an einem Gipfel der Anden zerschellt, und die Überlebenden hatten nichts anderes zu essen gehabt als die Leichen der toten Reisegefährten. Das Ereignis schlug in den Medien erhebliche Wellen. Ich befragte dazu den orthodoxen Theologen Olivier Clément: »Welcher Unterschied besteht zwischen Kannibalismus und Eucharistie?« Ich werde seine Antwort nie vergessen: »Der Kannibale ißt totes Fleisch, während der Christ, der kommuniziert, an einer lebendigen Wahrheit teilnimmt.«
* Paul Valéry, Tanz, Zeichnung und Degas. Aus dem Fränzösischen von Werner Zemp, Frankfurt am Main 1951.
150 Fran zoten suchten ihr Heil auf dieser Maschine; nur 15 fanden Rettung nach 13 tœgichen Leiden.
Schiffbruch der Fregatte Medusa
auf ihrer Fahrt nach dem Senegal,im Jahr 1816;
oder
vollständiger Bericht
von den merkwürdigen Ereignissen auf dem Floß, in derWüste Sahara, zu Saint-Louis und in dem Lager bei Dakar,nebstErörterungen über den landwirtschaftlichen Anbauder afrikanischen Westküste, vom Kap Blancbis zu der Mündung des Gambia,von
Jean-Baptiste Henri Savigny,ehemaliger Wundarzt im Seedienstund
Alexandre Corréard,
Ingénieur-Géographe,beide Schiffbrüchige auf dem Floß.
Vorwort
Die Jahrbücher des Seewesens liefern kein Beispiel eines so schauderhaften Schiffbruchs als den der Fregatte Medusa. Zwei Unglückliche, demselben wie durch ein Wunder entronnen, übernehmen hier das eben so herzbrechende als heikle Geschäft, alle Umstände dieses schrecklichen Ereignisses zu schildern. Mitten unter den grausamsten Leiden nahmen wir uns den Eid ab, sie der gesitteten Welt in einem vollständigen Bericht mitzuteilen, sofern uns der Himmel noch vergönnte, unser geliebtes Vaterland wieder zu betreten. Wir würden befürchten, uns an uns selbst, so wie an unseren Mitbürgern zu verschuldigen, wenn wir Dinge im Dunkel ließen, über die sie begierig sein müssen, Licht zu schöpfen. Alle Umstände, von denen wir nicht selbst Augenzeugen waren, sind uns von glaubwürdigen Männern mitgeteilt, welche für deren Echtheit bürgen. Auch führen wir nichts an, wovon sich nicht gehörige Beweise beibringen ließen. Was die Nachrichten betrifft, welche sich zunächst auf das Schiff beziehen, so haben wir deshalb bei mehreren Seeleuten, die sich an Bord befanden, Erkundigungen eingezogen, und wo ihre Aussagen nicht ganz gleichlautend waren, hielten wir uns an die Tatsachen, welche die meisten Zeugen für sich hatten. Zuweilen werden wir uns genötigt sehen, grausame Wahrheiten ans Licht zu bringen, aber diese können nur die treffen, deren Ungeschick oder Kleinmütigkeit alle jene Schrecknisse herbeiführten. Wir dürfen zuletzt noch mit Zuversicht sagen, daß unsere zahlreich gesammelten Beobachtungen uns in Stand setzen, alles, wie bei einem so wichtigen Werke mit Recht zu erwarten steht, vollkommen treu und richtig darzustellen.
Fregatte Medusa in voller Takelung.
Einleitung
Die französischen Niederlassungen an der westlichen Küste Afrikas vom Kap Blanc bis zur Mündung des Flusses Gambia standen abwechselnd bald unter französischer, bald unter englischer Hoheit, endlich aber blieben sie in den Händen der Franzosen, deren Vorfahren schon im 14ten Jahrhundert, gleich nach Entdeckung dieses Landes, sich hier angesiedelt hatten.
Die Engländer bemächtigten sich im Jahr 1758 der Insel Saint-Louis, des Sitzes der Oberstatthalterschaft aller unserer Besitzungen auf diesem Teile der Küste; 1779, also zwanzig Jahre später, kam sie wieder an uns. Um diese Zeit wurden uns unsere Besitzungen durch den am 3ten September 1783 zwischen Frankreich und England abgeschlossenen Friedensvertrag von neuem zugesichert. 1808 fielen sie abermals in die Hände der Engländer, nicht sowohl durch Gewalt der Waffen als durch die Verräterei einiger Männer, die nicht verdienten, Franzosen zu heißen. Endlich wurden sie uns zurückgegeben durch die Pariser Verträge von 1814 und 1815, welche den vom Jahre 1783 nach seinem ganzen Inhalt bestätigten.
Die Artikel dieses Vertrags bestimmen die gegenseitigen Rechte beider Regierungen auf die westliche Küste von Afrika. Sie geben die französischen Besitzungen folgendermaßen an: vom Kap Blanc, 19° 30’ Länge und 20° 55’ 30” Breite bis zur Mündung des Gambia 19° 9” Länge und 13° Breite. Sie verbürgen uns ferner den ausschließenden Besitz dieser Ländereien, indem sie den Engländern nur zugestehen, gemeinschaftlich mit den Franzosen, von dem Flusse St. Jean bis Portendick inbegriffen den Gummihandel zu treiben, ohne daß es ihnen erlaubt sei, an diesem Flusse noch an sonst einem Punkte der Küste sich im geringsten, und auf welche Art es auch sein mag, festzusetzen.
Das einzige, was den Engländern in diesen Verträgen zugesichert wird, ist das Eigentumsrecht auf die Faktorei Albreda an der Mündung des Gambia so wie auf das Fort James.
Nachdem die Rechte beider Völker auf diese Art auseinander gesetzt waren, machte Frankreich Anstalten, den ihm zugefallenen Teil in Besitz zu nehmen. Der Marineminister beschäftigte sich ernsthaft damit, ließ im Verlauf von zwei Jahren zu dieser Unternehmung vier Schiffe ausrüsten und gab endlich Befehl zur Abfahrt nach dem Senegal. Es gehörten dazu:
Ein Oberst, Oberbefehlshaber im Namen des Königs auf der ganzen Küste vom Kap Blanc bis zur Mündung des Gambia.
Zugleich war er Oberverwaltungsweser
1
Ein Bataillonschef, Kommandant von Gorée
1
Ein Bataillonschef, Kommandant des Bataillons von Afrika, bestehend aus drei Kompanien, jede von 84 Mann
253
Ein Artillerieleutnant, beauftragt mit der Aufsicht über die
Pulvermühlen und Batterien; unter seinem Befehl
Zehn Mann Kanoniere
11
Ein Kommissar-Inspektor des Seewesens, zugleich
Verwaltungschef
1
Vier Magazinwärter
4
Sechs Schreiber
6
Vier Aufpasser
4
Zwei Priester
2
Zwei Lehrer
2
Zwei Oberschreiber
(sie können Notare und selbst Bürgermeister vertreten)
2
Zwei Hospital-Direktoren
2
Zwei Apotheker
2
Fünf Wundärzte
5
Zwei Hafen-Kapitäne
2
Drei Steuermänner
3
Ein Gärtner
1
Achtzehn Weiber
18
Acht Kinder
8
Vier Bäcker
4
Außerdem zu einer Reise, die man willens war nach dem Lande Galam zu unternehmen:
Ein Ingenieur vom Bergwesen
1
Ein Ingénieur-Géographe
1
Ein naturkundiger Landbauer
1
Ferner, zu einer Unternehmung, welche dahin ging, auf dem Kap Verde, oder in dessen Nähe, einen Platz zu einer Ansiedlung ausfindig zu machen:
Ein Arzt
1
Ein Landbauer für die europäischen Erzeugnisse
1
Ein Landbauer für die Kolonialerzeugnisse
1
Zwei Ingénieures-Géographes
2
Ein Naturkundiger
1
Ein Seeoffizier
1
Zwanzig Arbeiter
20
Drei Weiber
3
Also in allem 365, von denen ungefähr 240 auf die Fregatte Medusa kamen.
Bericht
von dem Schiffbruch der Fregatte Medusa
Am 17ten Juni 1816, morgens um sieben Uhr, verließ das nach dem Senegal beorderte Geschwader unter Anführung des Fregattenkapitäns Herrn von Chaumareys, die Reede der Insel Aix. Die Fahrzeuge, aus denen es bestand, waren die Medusa1, eine Fregatte von 44 Kanonen, befehligt von dem Herrn von Chaumareys; die Korvette Echo2, angeführt von Herrn Cornet de Venancourt, Fregattenkapitän; die Loire, ein Flütschiff, und die Brigg Argus3, unter den Schiffsleutnants Herrn Gicquel des Touches und von Parnajon. Der Wind kam aus Norden und wehte angenehm; wir hatten alle Segel aufgespannt; kaum aber waren wir auf offener See, so ließ der Wind etwas nach, und wir mußten lavieren, um den Turm von Chassiron zu umfahren, welcher an der Spitze der Insel Oléron liegt.4 Nachdem wir den ganzen Tag laviert hatten, verlangte die Loire abends gegen fünf Uhr zu ankern, weil sie die Strömungen nicht überwältigen konnte, die sie von dem Fahrwasser abhielten; Herr von Chaumareys erlaubte es ihr und ließ zugleich das ganze Geschwader die Anker werfen. Wir waren jetzt eine halbe Stunde von der Insel Ré mitten in der Enge von Antioche. Unser Schiff ankerte zuerst, und die übrigen Fahrzeuge stellten sich in unserer Nähe auf. Die Loire, welche am langsamsten segelte, fand sich erst nach allen andern auf dem Ankerplatz ein. Das Wetter war schön, der Wind blies aus Nordwest, etwas zu gebrochen, als daß wir Chassiron hätten umsegeln können, um so mehr, da sich ungünstige Strömung einstellte. Abends gegen sieben Uhr, mit eintretender Ebbe, lichteten wir die Anker und spannten die Segel auf; alle Fahrzeuge taten ein Gleiches, nachdem sie einige Augenblicke vorher das Zeichen zum Aufbruch erhalten hatten. Mit anbrechender Nacht befanden wir uns zwischen den Leuchttürmen von Chassiron und La Baleine5, die wir in kurzer Zeit umsegelten; kaum waren wir auf offener See, so trat beinahe eine gänzliche Windstille ein, die Schiffe arbeiteten nicht mehr, der Himmel bedeckte sich, das Meer wurde unruhig, alles kündigte einen Sturm an, der Wind drohte sich nach Westen zu wenden und folglich widrig zu werden; er war veränderlich und ruckend; gegen zehn Uhr bemerkte man, daß wir auf der eingeschlagenen Fahrt geradewegs einer Gefahr, »les Roches-Bonnes« genannt, entgegensteuerten.6 Wir machten verschiedene Wendungen, um derselben zu entkommen. Gegen Mitternacht bildete sich im Norden eine finstere Sturmwolke, die von dort her blies; nun konnten wir den Vorderteil nach der See wenden, die Wolken zerstreuten sich, und am folgenden Tage war sehr schönes Wetter mit schwachem Nordost; einige Tage lang legten wir nur einen kurzen Weg zurück.
Den 21ten oder 22ten umsegelten wir Kap Finistère. Außerhalb der Spitze, welche den Golf von Gascogne begrenzt, trennten sich die Loire und die Argus von uns; da sie schlechte Segler waren, konnten sie unmöglich der Fregatte folgen, die sie nicht anders in ihrer Nähe hätte behalten können als vermittelst der Bramstange und der Beisegel.
Nur die Echo war noch zu sehen, aber in einer großen Entfernung und aus allen Kräften segelnd, um uns nicht zu verlieren; die Fregatte fuhr viel rascher als diese Korvette, so daß sie bei geringer Anspannung der Segel nicht allein mit ihr Fahrt hielt, sondern sie auch zum Erstaunen übersegelte; der Wind war indes etwas stärker geworden, und wir legten neun Knoten zurück.7
Ein unglücklicher Zufall störte unsere Freude über diese günstigen Winde; ein Schiffsjunge von fünfzehn Jahren fiel ins Meer; mehrere von unseren Leuten standen auf dem Hinterteile des Schiffes und der Schanzdecke, wo sie den Sprüngen der Meerschweine zusahen.8 Auf den Freudenruf über das Gaukeln dieser Fische folgte plötzlich ein ängstliches Geschrei des Mitleids. Einige Augenblicke hielt sich der Unglückliche längs dem Bord an einem Strick, den er im Hinabfallen ergriffen hatte, aber bei der Schnelle, mit welcher die Fregatte segelte, mußte er ihn bald fahren lassen. Man gab der Echo, die sehr weit entfernt war, ein Zeichen von diesem Mißgeschick; noch mehr, man wollte einen Kanonenschuß tun, aber es war kein einziges Stück geladen. Hierauf warf man die Rettungstonne aus.9 Wir zogen die Segel ein und machten eine Wendung von der Seite. Dies erforderte viel Zeit. Auf den Ruf »Ein Mann ins Meer« hätte man vielmehr die Höhe des Windes gewinnen sollen. Zwar hörten wir von der Batterie her laut rufen, daß er gerettet sei; ein Matrose hatte ihn wirklich beim Arm gefaßt, aber er mußte ihn loslassen, wollte er nicht selbst mit fortgerissen werden. Indes schickte man ein kleines Fahrzeug von sechs Rudern und mit drei Mann besetzt in See. Alles war vergeblich; nachdem sie bis in einer ziemlichen Entfernung gesucht hatten, kamen sie wieder an Bord, ohne einmal die Rettungstonne gesehen zu haben. Ist es diesem unglücklichen Burschen gelungen, sie zu erreichen, so muß er nach den grausamsten Qualen darauf umgekommen sein. Man richtete die Segel und fuhr weiter.
Die Korvette Echo war wieder zu uns gestoßen, und wir segelten geraume Zeit mit ihr auf Stimmweite; aber bald verloren wir sie noch einmal. In der Nacht vom 26ten wurde laviert, weil wir befürchteten, auf die acht Felsen zu treffen, von denen der nördlichste 34° 45’ Breite und der südlichste 34° 30’ liegt, so daß der Umfang dieser Gefahr ungefähr fünf Lieues von Norden nach Süden und vier Lieues von Osten nach Westen beträgt; der südliche Felsen ist ungefähr 40 Lieues Nord, 5° Ost von der Spitze Ost der Insel Madeira entfernt.
Den 27ten früh versprachen wir uns, die Insel Madeira zu sehen, aber wir schifften vergeblich bis Mittag, wo wir das Zeichen auf der Seekarte machten, um unseren Standpunkt festzustellen. Der Sonne nach befanden wir uns auf der Höhe von Porto-Santo; wir fuhren seitwärts fort, und abends mit Sonnenuntergang riefen die Wachen auf den Masten »Land!«.10 Dieser Irrtum in Angabe eines Landungsortes betrug wenigstens 30 Lieues nach Osten hin; wir schrieben ihn den Strömungen der Meerenge von Gibraltar zu, die uns gewaltig umgetrieben hatten. Gründet sich dieser Irrtum wirklich auf den Strömungen, so verdient er alle Aufmerksamkeit von den Seefahrern, welche diese Gewässer besuchen. Die ganze Nacht fuhren wir nur mit geringer Segelkraft; gegen Mitternacht wendeten wir uns nach einem andern Windstrich, um dem Lande nicht zu nahe zu kommen. Am folgenden Tage ganz früh sahen wir sehr deutlich die Inseln Madeira und Porto-Santo; links die, welche man gewöhnlich die wüsten Inseln nennt; Madeira war wenigstens zwölf Lieues entfernt, wir hatten den Wind im Rücken und legten neun Knoten zurück. In wenigen Stunden befanden wir uns ganz nahe der Insel. Geraume Zeit segelten wir hart längs der Küste und kamen bei den zwei vorzüglichsten Städten, Funchal und Do-Sob vorbei. Madeira erhebt sich wie ein Amphitheater; die Landhäuser zeugen von gutem Geschmack und gewähren einen reizenden Anblick. Alle diese lieblichen Wohnungen sind von prächtigen Gärten und Pomeranzen- und Zitronen-Wäldern umgeben, die, wenn der Wind vom Land her kommt, eine halbe Stunde weit auf der See den angenehmsten Geruch verbreiten. Die Hügel prangen mit Weinstöcken, die mit Paradiesfeigenbäumen eingefaßt sind: kurz, alles vereinigt sich, Madeira zu einer der schönsten Inseln von Afrika zu machen. Ihr Boden ist eine wachstumsfördernde Erde, vermischt mit einer Asche, die ihr eine bewunderungswürdige Kraft mitteilt. Überall zeigen sich Spuren einer durchs Feuer gegangenen Erde, welche die Farbe des Elements an sich trägt, dem sie ihre Beschaffenheit verdankt. Funchal, die Hauptstadt der Insel, liegt 19° 20’ 30” Länge und 32° 37’ 40” Breite. Sie ist nicht gut angelegt; die Straßen sind eng und die Häuser größtenteils von schlechter Bauart. Der höchste Teil der Insel ist der Pico von Ruvio, der sich 200 Meter über die Meeresfläche erhebt. Die Volksmenge auf Madeira beträgt 85 000 bis 90 000 Einwohner, wie uns ein glaubwürdiger Mann versicherte, der sich einige Zeit hier aufgehalten hat.
So fuhren wir längs der Küste von Madeira, weil der Befehlshaber willens war, ein Boot hinzusenden, um Erfrischungen zu holen; allein, da plötzlich Windstille eintrat, mußten wir befürchten, zu nahe ans Land zu kommen und die heftigen Strömungen nicht überwältigen zu können, die sich in der Nähe desselben bilden. Es erhob sich ein leiser Strichwind, der uns bald in offene See trieb, wo die Winde günstig und ziemlich stark waren. Man gab den Gedanken auf, das Boot ans Land zu schicken, und wir traten die Fahrt wieder an, indem wir noch an acht Knoten zurücklegten. Wir waren drei Stunden lang im Angesicht der Bucht von Funchal geblieben. Spät abends sah man Madeira sehr deutlich; am folgenden Tag mit Sonnenaufgang entdeckte man die Inseln Salvages und abends den Pico von Teneriffa auf der Insel dieses Namens. Dieser hohe Berg, hinter welchem die Sonne soeben untergegangen war, gewährte uns ein wahrhaft majestätisches Schauspiel; sein erhabenes Haupt schien wie mit Feuer gekrönt. Seine Höhe über der Meeresfläche beträgt 3711 Meter, er liegt auf 19° Länge und 28° 17’ Breite. Mehrere Personen an Bord wollten ihn schon um acht Uhr morgens gesehen haben, als wir doch noch 30 Lieues davon entfernt waren; freilich hatten wir sehr heiteren Himmel.
Der Anführer beschloß, ein Boot nach Sainte-Croix, eine der ansehnlichsten Städte auf der Insel, zu schicken. Es sollte Früchte holen sowie auch Seihgefäße in Mörserform, die hier aus vulkanischer Erde gefertigt werden. Die ganze Nacht über machten wir kleine abwechselnde Seitenbewegungen; tags darauf fuhren wir längs der Inselküste in doppelter Flintenschußweite und kamen unter die Kanonen einer kleinen Schanze, Fort-Français genannt. Einer von unseren Reisegefährten sprang auf vor Freude bei dem Anblick dieses kleinen Festungswerkes, das einige Franzosen eilig erbaut hatten, als die Engländer unter Anführung des Admirals Nelson sich dieser Ansiedlung bemächtigen wollten. Hier, sagte er, hier scheiterte ein zahlreiches Geschwader, angeführt von einem der bravsten Offiziere der englischen Seemacht, an einer Handvoll Franzosen, die sich mit Ruhm bedeckten und Teneriffa retteten; der Admiral Nelson sah sich genötigt, die Flucht zu ergreifen, nachdem er in dem mörderischen und langen Gefecht einen Arm verloren hatte.
Nach Umsegelung einer Spitze, die in das Meer hervorragt, kamen wir in die Bucht, wo sich die Stadt Sainte-Croix befindet. Der Anblick von Teneriffa ist majestätisch. Die ganze Insel besteht aus sehr hohen Bergen, auf welchen sich furchtbare Felsen befinden, die von solchem Umfange sind, daß sie sich nordwärts senkrecht über das Meer zu erheben und jeden Augenblick mit ihrem Umsturz die Schiffe zu bedrohen scheinen, die an ihrem Fuße vorbeisegeln. Über denselben ragt der Pico, dessen Haupt sich in den Wolken verliert. Wir haben nicht bemerkt, daß er, wie einige Reisende berichten, unaufhörlich mit Schnee bedeckt sei und Lava ausspeie; vielmehr schien uns seine Spitze ganz frei von Eismassen und vulkanischen Ergüssen. Am Fuße des Berges und bis zu einer gewissen Höhe entdeckt man Vertiefungen, die mit Schwefel angefüllt sind, und nicht weit davon mehrere Begräbnishöhlen der Guanchen, Urbewohnern dieser Insel.
Gegen Mittag stieß die Korvette Echo, die wir verloren hatten, wieder zu uns. Sie erhielt Befehl, mit uns gleiche Bewegungen zu machen, was sie auch tat; sie schickte niemand an Land. So vereinigt lavierten wir gemeinschaftlich in die Bucht von Sainte-Croix. Abends gegen vier Uhr, nachdem das ausgeschickte Boot zurück war, steuerten wir nach dem Senegal. Man hatte in der Stadt ziemlich große irdene Krüge gekauft, so wie auch feine Weine, Pomeranzen, Zitronen, Bananenfeigen und alle Arten von Gemüse.
Mehrere unglückliche Franzosen befanden sich schon seit langem auf dieser Insel in Kriegsgefangenschaft und lebten von dem, was die Spanier ihnen zukommen ließen. Sie waren jetzt, Kraft des Friedens, in Freiheit gesetzt und warteten nur auf eine günstige Gelegenheit, in ihr Vaterland zurückzukehren. Ihre Bitten fanden keinen Eingang bei dem Anführer des Boots; er weigerte sich unbarmherzig, sie ihrem Vaterlande und ihren Familien wiederzugeben. Auf diesem Boot befand sich ein anderer Offizier Herr Lapeyrère, der stark darauf drang, diese Unglücklichen mitzunehmen, aber seine Bitten vermochten nichts über jenen.
Die Sittenverderbnis in Sainte-Croix ist grenzenlos. Sie geht so weit, daß viele Weiber, als sie erfuhren, es seien Franzosen angekommen, sich an die Türen stellten, auf die Vorübergehenden lauerten, zitternd vor Wollust und Begierde sich ihnen näherten und sie baten, bei ihnen einzukehren, um der Göttin von Paphos zu opfern. Alles das geschieht größtenteils in Gegenwart der Männer, die kein Recht haben, sich dagegen aufzulehnen, weil die heilige Inquisition es so will und die zahlreichen Mönche auf der Insel große Sorge tragen, diesen Brauch aufrecht zu halten. Sie verstehen die Kunst, die Männer blind zu machen, und gebrauchen dazu Vorspiegelungen, die sie von der Religion hernehmen, mit der sie einen schändlichen Mißbrauch treiben. Sie heilen sie von der Eifersucht, zu welcher sie sehr geneigt sind, indem sie ihnen versichern, ihre Leidenschaft, die sie lächerlich oder mannstoll nennen, sei nichts anderes als Anfechtungen des Satans, von denen nur sie, die Mönche, sie befreien könnten, indem sie ihren teuren Gefährtinnen religiöse Gesinnungen einflößen. Solche Mißbräuche sind beinahe unvermeidlich unter einem brennenden Himmel, wo die Leidenschaft der Liebe oft stärker ist als die Vernunft und zuweilen die Dämme durchbricht, die ihr die Religion entgegenstellen möchte. Den überspannten Leidenschaften also muß man diese Sittenverderbnis zuschreiben und nicht den Mißbräuchen, die man so geneigt ist, unserer göttlichen Religion zur Last zu legen.
Teneriffa kommt der Insel Madeira nicht bei; ja es läßt sich in Ansehung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse zwischen beiden durchaus keine Vergleichung anstellen, so sehr ist die Beschaffenheit des Bodens verschieden; allein in Betreff des Handels hat Teneriffa den Vorzug. Im Mittelpunkt der Kanarischen Inseln gelegen, ist sie im Stande, sehr mannigfaltige Geschäfte zu treiben, dahingegen Madeira nichts für sich hat als den Verkauf oder Umtausch seiner Weine gegen europäische Fabrikwaren.
Der Boden von Teneriffa ist viel trockner; ein großer Teil ist zu sehr vom Feuer mitgenommen, als daß er zum Ackerbau tauglich wäre; nichtsdestoweniger wird jedes tragbare Fleckchen sehr gut genutzt; ein Beweis vielleicht, daß die hiesigen Spanier von Natur nicht so träge sind, als man geneigt ist zu glauben.
Wieder auf offener See, fanden wir günstigen Nordnordostwind.
In der Nacht vom 29ten Juni brach durch Nachlässigkeit des Bäckermeisters auf dem Zwischendeck der Fregatte Feuer aus, allein man kam schnell zu Hilfe, und es wurde gelöscht. Tags darauf und in der Nacht erneuerte sich der Unfall, aber diesmal mußte man, um dem Feuer Einhalt zu tun, den Ofen einreißen, der am folgenden Tage wieder eingerichtet wurde.
Am 1ten Juli entdeckten wir das Kap Bojador, 16° 47’ Länge und 26° 12’ 30” Breite; zugleich sahen wir die Küsten der Wüste Sahara und glaubten die Mündung des Flusses Saint-Jean zu bemerken, der noch wenig bekannt ist. Um zehn Uhr morgens hatten wir den Wendekreis erreicht. Hier ging die hergebrachte Feierlichkeit vor sich: die Späße der Matrosen belustigten uns einige Augenblicke; wir waren weit entfernt, den schrecklichen Unfall zu ahnen, der in kurzem dem dritten Teile der Personen, die sich auf der Fregatte befanden, das Leben kosten sollte. Dieser Brauch der Wendekreistaufe ist wunderlich genug; ihr Hauptzweck ist wohl das bißchen Trinkgeld, das man bei der Gelegenheit den Matrosen zuwendet.
Von Sainte-Croix aus hatten wir beständig süd-süd-westlich gesteuert. Während der Wendekreisfeierlichkeit umsegelten wir das Kap Barbas, 19° 8’ Länge und 22° 6’ Breite. Zwei Offiziere ließen mit einmal eine andere Fahrt einschlagen, ohne den Befehlshaber davon zu unterrichten; dies veranlaßte einen ziemlich lebhaften Wortwechsel, der aber weiter keine Folgen hatte. Diese beiden Offiziere behaupteten, wir gingen auf eine Gruppe Felsen los und wären bereits den Klippen sehr nahe. Wir waren den ganzen Morgen in dem Golf Saint-Cyprien gefahren, dessen Inneres von Felsen strotzt, die bei niedrigem Wasserstand die Brigantinen verhindern, diese Stelle zu befahren; so sagte uns am Senegal Herr Valentin, der Vater, der diese ganze Küste vollkommen kennt und sich wunderte, wie die Fregatte ohne Kollision mitten zwischen diesen Klippen gefahren war. Das Land lag nur auf halb Kanonenschußweite, und wir bemerkten sehr deutlich ungeheure Felsen, an welchen das Meer sich heftig brach.11 Bei zufällig eingetretener Windstille hätten uns die starken Strömungen, die landwärts treiben, unfehlbar auf gefährliche Stellen geworfen.
Abends glaubte man das Kap Blanc gesehen zu haben und steuerte nun west-süd-westlich nach den Anweisungen des Seeministers. In der Nacht brannte die Korvette Echo, die sich von Madeira aus immer bei uns gehalten hatte, zu wiederholten Malen Zündpulver ab und steckte eine Leuchte an ihrem Besanmast auf; man gab ihr nicht dieselben Zeichen zurück, sondern begnügte sich mit Aufsteckung einer Leuchte an dem Fockmast; diese erlosch bald darauf und wurde durch kein anderes Feuer ersetzt. Herr Savigny war auf Deck, wo er einen Teil der Nacht zubrachte und sich von der Nachlässigkeit des Wachhabenden überzeugte, der es sich nicht einmal einfallen ließ, auf die Zeichen der Echo zu antworten. War es recht, in der Nähe einer so dringenden Gefahr, die Standpunkte der beiden Schiffe nicht zu vergleichen, wie es immer geschieht, wenn ein Geschwader divisionsweise fährt? Der Befehlshaber der Fregatte wurde nicht einmal von den Zeichen der Korvette in Kenntnis gesetzt; um elf Uhr segelte sie uns im Backbord; darauf sah er, daß die Richtung ihrer Fahrt mit der unsrigen einen ziemlich offenen Winkel bildete und sie sich sehr wahrscheinlich mit uns kreuzen würde; späterhin zeigte sie sich auch auf unserer Rechten; man versichert, ihr Logbuch zeige, sie habe die ganze Nacht west-süd-westlich gesteuert; das unsrige ist gleichlautend. Eins von beiden also, sie muß eine Wendung in unserer Rechten oder wir müssen eine in ihrer Linken gemacht haben, denn mit Tagesanbruch war sie nicht mehr zu sehen. Auf dem Meere ist es sehr leicht, eines Schiffes in der Entfernung von sechs Lieues ansichtig zu werden; sie mußte uns also von Mitternacht an bis sechs Uhr morgens um mehr als sechs Stunden übersegelt haben, was sich nicht denken läßt, denn sie fuhr viel langsamer als wir und machte alle zwei Stunden halt, um das Senkblei auszuwerfen. Diese Trennung läßt sich also nicht anders erklären, als daß man annimmt, entweder die Fregatte sei mehr südlich oder die Korvette mehr westlich gefahren. Wenn die beiden Schiffe, wie man behauptet, denselben Windstrich gehalten hätten, so wäre es unmöglich, sich diese Trennung zu erklären.
Alle zwei Stunden legte die Fregatte bei, um zu senkloten; außerdem tat man dies noch alle halbe Stunden, ohne beizulegen. Wir hatten immer niedrigen Wasserstand und suchten das Weite, um mehr Tiefe zu gewinnen; endlich morgens waren wir bei mehr als 100 Brasses. Nun steuerte man süd-süd-östlich; diese Richtung machte so ziemlich einen geraden Winkel mit der, die wir während der Nacht genommen hatten; sie führte geradewegs auf das Land zu, dessen Anfahrt an dieser Stelle fürchterlich gefahrvoll wird, da sich hier eine sehr lange Sandbank, die »Arguin-Bank« genannt wird, befindet, die nach einer uns mitgeteilten Anweisung sich 30 Lieues weit ins Meer erstreckt.12 Nach der gewöhnlichen Angabe des Marineministers entgeht man dieser gefährlichen Stelle mit einer Umfahrt von 22 Lieues auf hoher See; wobei aber noch ausdrücklich empfohlen wird, nicht anders landwärts zu steuern, als mit der größten Behutsamkeit und mit fleißiger Auswerfung des Senkbleies. Alle übrigen Fahrzeuge unseres Geschwaders, die ihren Kurs nach diesen Anweisungen richteten, sind glücklich in Saint-Louis angekommen, ein Beweis von ihrer Richtigkeit.13 Überdies heißt es in denselben, man solle west-süd-westlich steuern, sobald man des Kap Blanc ansichtig geworden; nun aber ist zu vermuten, daß wir es abends nicht gesehen, wie man sich doch einbildete; so hatte man also einen ungewissen Abfahrpunkt, und dies veranlaßte den Irrtum, der uns so verderblich wurde.
Herr Corréard, einer meiner Reisegefährten, erzählt unter anderem, wie sich der Kapitän auf eine ganz sonderbare Art täuschen ließ. Morgens um sechs Uhr wurde er geweckt. Einige Personen, die auf Deck standen, überredeten ihn, eine dicke Wolke, die in der Richtung und in der Tat nicht weit vom Kap Blanc zu sehen war, sei dieses Kap selbst. Mein Unglücksgefährte, der gut sieht und eine Wolke von einem Felsen zu unterscheiden weiß, von denen er in den Alpen, wo er geboren ist, genügend gesehen hat, sagte zu diesen Herren, daß es weiter nichts sei als ein Dunstfelsen. Man antwortete ihm, die Anweisung, die der Minister dem Kapitän gegeben hatte, verpflichtete ihn dazu, dieses Kap in Obacht zu nehmen; da wir es aber bereits um zehn Lieues übersegelt hatten, so bliebe nichts übrig, als dem Kapitän weiszumachen, die Befehle des Ministers seien pünktlich vollzogen, und zu dem Zweck müsse man (was ja nicht schwer sei) ihn bei dem Gedanken lassen, daß diese Wolke wirklich der Felsen sei. Wie man uns sagt, haben einige Personen behauptet, das Kap Blanc wäre am 1ten Juli abends gesehen worden. Wir getrauen uns aber zu versichern, daß dem keineswegs so ist.
Nach dieser vermeintlichen Erspähung des Kap Blanc vom 2ten Juli morgens hätte man billig westwärts steuern sollen, um die Sandbank Arguin zu umschiffen; war diese Gefahr erst beseitigt, so mußte man wieder südlich einschlagen, um auf der Straße nach dem Senegal zu bleiben; allein derjenige, der seit einigen Tagen die Fahrt leitete, wußte den Befehlshaber zu bewegen, sogleich südwärts zu segeln und geradewegs auf Portendick loszugehen. Wir wissen nicht, was Herrn von Chaumareys veranlassen mochte, sein Vertrauen einem Manne zu schenken, der gar nichts mit dem Stabe zu schaffen hatte. Er war ehemals Hilfsoffizier im Seedienst gewesen und kam nach zehnjähriger Kriegsgefangenschaft aus England. Hier hatte er gewiß nicht mehr gelernt als die anderen Offiziere an Bord, die sich natürlich durch dieses Vorziehen gekränkt fühlten. Während wir das Kap Barbas umsegelten, sah Herr von Chaumareys mit sorgloser Gutmütigkeit der Wendekreisposse zu, indes derjenige, der sein Vertrauen gewonnen hatte, auf dem Vorderteil der Fregatte umherging und mit kaltem Blute die zahlreichen Gefahren erblickte, die sich an der Küste zeigten. Mehrere Personen tadelten die eingeschlagene Richtung, unter anderem der Gerichtsschreiber Herr Picard, der acht Jahre zuvor auf der Sandbank Arguin gestrandet war. Dieser gescheite Mann prophezeite uns schon jetzt, daß wir in Gefahr kommen würden.
Mittags maß man die Höhe, um unsern Standpunkt zu wissen. Wir sahen auf dem Hinterkastell den wachhabenden Funker, Herrn Maudet, der unsere Stellung auf der Seekarte über einem Hühnerkorb absteckte; dieser Offizier, der alle Pflichten seines Amtes kennt, versicherte, daß wir auf Sandbankhöhe wären und meldete es demjenigen, der seit einigen Tagen dem Befehlshaber mit seinem Rat zur Hand ging. »Nicht doch«, antwortete er, »wir haben noch an die 80 Brasses Tiefe.«14
Waren wir mit der Nachtfahrt der Gefahr einigermaßen ausgewichen, so brachte uns doch die Morgenfahrt wieder darauf. Herr Maudet, überzeugt, daß das Schiff über der Sandbank war, ließ auf seine Verantwortung das Senkblei werfen; die Farbe des Wassers hatte sich ganz verändert, wie es selbst diejenigen bemerken konnten, die am wenigsten geübt waren, die Tiefe des Meeres daran zu erkennen; man glaubte sogar, unter den kleinen Wellen ein Gemisch von Sand zu bemerken; zahlreiche Kräuter zeigten sich längs dem Bord, und man fing viel Fische; was alles unzweifelhaft bewies, daß wir uns über einer Sandbank befanden; in der Tat maß das Senklot nur 18 Brasses; der wachhabende Offizier ließ es unverzüglich dem Oberbefehlshaber melden, welcher sogleich Befehl gab, etwas stärker zu segeln. Wir steckten die Beisegel an Backbord auf; das Senkblei ward noch einmal ausgeworfen und gab sechs Brasses; man meldete es dem Kapitän, er befahl, geschwind so viel Wind zu gewinnen wie nur möglich, doch leider war es zu spät.
Als die Fregatte eine kleine Drehung machte, stieß sie mit dem Steuerruder auf Grund; sie wurde einen Augenblick wieder flott, aber bald erfolgte ein zweiter und dritter Ruck; endlich blieb sie sitzen, an einer Stelle, wo wir nur fünf Meter 60 Zentimeter Wasser hatten, und doch war jetzt hohe Flut.
Wir mußten also um so ängstlicher sein, da nun das Abnehmen eintrat und wir zu der Zeit sitzen geblieben waren, als der Wasserstand am höchsten war. Dazu kommt, daß die Flut überhaupt zur Zeit des Vollmonds in dieser Gegend sehr wenig Wasser bringt, so daß es nur um 50 Zentimeter höher steigt als gewöhnlich; ja selbst bei Springflut erhebt es sich nur um höchstens 120 Zentimeter über die Sandbank. Wie schon gesagt, gab das Wurfblei, als wir aufstießen, nur fünf Meter 60 Zentimeter und bei niedrigem Wasserstand sogar nur vier Meter 60 Zentimeter; die Fregatte mußte also um einen Meter weniger Tiefe haben. Indes, sobald wir gestrandet waren, trafen die mit dem Senkblei ausgeschickten Boote tiefere Stellen als diejenige, wo wir festsaßen, aber auch andere, die noch seichter waren, daher stand zu vermuten, daß die Bank sehr ungleich und mit kleinen Erhöhungen bedeckt sei. Alle Arbeiten von dem Augenblicke an, wo sich die 18 Brasses ergaben, bis zu dem, wo wir strandeten, folgten sich mit außerordentlicher Schnelle; das Ganze währte nicht über zehn Minuten. Mehrere Personen haben uns versichert, daß, wenn man nach Entdeckung der 18 Brasses die Höhe des Windes gewonnen hätte, die Fregatte außer Gefahr gewesen wäre, denn ganz stieß sie erst im Westen der Bank auf. Das Stranden erfolgte am 2ten Juli, ein Viertel auf vier Uhr nachmittags, auf 19° 36’ Nordbreite und 19° 45’ Westlänge. Dieses Unglück verbreitete die tiefste Bestürzung. Waren mitten unter diesem gräßlichen Wirrwarr noch einige Gefaßte, so können ihnen die Verzerrungen auf den Gesichtern der übrigen nicht entgangen sein; mancher war nicht mehr zu erkennen. Hier scheußlich verschrumpfte Züge, dort ein gelbes oder totenblasses Ansehn! Einige Männer waren wie zu Boden gedonnert und an ihrem Platze geschmiedet, ohne Kraft zu finden, sich davon loszureißen. Erholt von dem ersten erstarrenden Schrecken, brachen die meisten in ein Geschrei der Verzweiflung aus; einige verfluchten sogar laut diejenigen, deren Unwissenheit uns so verderblich geworden war. Ein Offizier stieg gleich anfangs auf Deck und sagte zu dem, der seit einigen Tagen die Fahrt des Schiffes leitete: »Sehen Sie, mein Herr, wohin uns Ihr Eigensinn gebracht hat; ich hatte es Ihnen doch vorausgesagt.« Nur zwei Frauen schienen bei diesem Unglück ganz ungerührt, die Gattin und die Tochter des Gouverneurs. Welch auffallender Unterschied! Männer, die seit 20 bis 25 Jahren tausend Gefahren bestanden hatten, waren tief angegriffen, während eine Frau und Fräulein Schmaltz gegen alles, was um sie her vorging, gleichgültig blieben!
Sobald die Fregatte gescheitert war, ließ man eilends die Segel nieder, nahm die Topsegel und Mastkörbe ab und versuchte alles, um sie wieder flottzumachen. Mit anbrechender Nacht wurden die Arbeiten eingestellt, um der Mannschaft, die ungemeinen Eifer gezeigt hatte, einige Ruhe zu vergönnen. Am folgenden Tage, dem dritten, senkte man die Segelstangen, drehte das Tau um einen Anker, den man tags zuvor spät am Abend 120 Brasses weit hinter der Fregatte ausgeworfen hatte. Allein dieser Versuch verlief erfolglos, denn der Anker, welcher sehr schwach war, konnte nicht genug Widerstand leisten und gab nach. Nun warf man einen anderen von vorn am Schiffe; nach unsäglicher Anstrengung brachte man ihn ziemlich weit bis auf eine Stelle, wo das Wasser nur fünf Meter 60 Zentimeter tief war. Um dies zu bewerkstelligen, band man ihn an eine Schaluppe, unter welche man, weil sie zu schwach war, um eine solche Last zu tragen, eine Schnur von leeren Tonnen angebracht hatte.15 Übrigens war der Wasserstand ziemlich hoch und die Strömung sehr heftig.
Die Schaluppe erreichte zwar die Stelle, wo sie den Anker werfen sollte, allein er griff nicht mit den Schaufeln in den Sand, denn eines der Enden war schon auf dem Grunde, während das andere noch ganz über dem Wasser stand; so konnte er also das nicht bewirken, was man sich versprochen hatte, denn als man die Anker-spill drehte, leistete er nur sehr wenig Widerstand und wäre bis an Bord zurückgekommen, wenn man fortgefahren hätte, angestrengt zu drehen.16 Am Tage schlug man den Boden aus einigen Tonnen, die sich im Kiele befanden, und fing sofort an zu pumpen; die Korbmasten, mit Ausnahme des kleinen, wurden abgenommen und ins Meer gelassen; man schiffte gleichfalls die Segelstangen, das Bugspriet und alles Holzwerk aus, das man mitflößen wollte; nur die beiden kleinsten Segelstangen ließ man stehen, um der Fregatte das Gleichgewicht zu halten, wenn sie etwa umzuschlagen drohte.
Da das Schiff nicht mehr zu retten war, so mußte man nur noch auf das Heil der Mannschaft bedacht sein. Man hielt einen Rat, in welchem der Gouverneur des Senegal selbst den Plan von einem Floß entwarf, das 200 Mann und Lebensmittel für dieselben aufnehmen sollte.17 Freilich mußte man zu einem solchen Mittel schreiten, denn die sechs kleinen Boote, die wir an Bord hatten, konnten unmöglich 400 Mann fassen. Die Lebensmittel sollten auf das Floß geschafft werden, wovon dann zur bestimmten Eßstunde die Mannschaft der Boote sich ihre Rationen geholt hätte. Wir sollten alle zugleich an den sandigen Küsten der Wüste eintreffen und hier, mit Waffen und Kriegsvorrat versehen, die sich auf der Fregatte vorfanden, eine förmliche Karawane zur Insel Saint-Louis antreten. Alles, was sich nach der Zeit ereignete, bewies nur zu klar, daß dieser Plan vortrefflich ausgedacht war und einen glücklichen Erfolg gehabt hätte; unglücklicherweise aber vereitelte ihn der engherzigste Egoismus.
Nachmittags gegen zwei Uhr warf man abermals einen Anker in einer ziemlichen Entfernung von der Fregatte; einen Augenblick





























