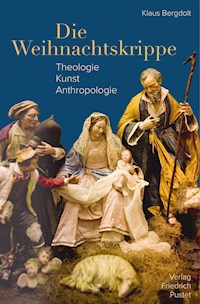12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Zwischen 1346 und 1350 erlag etwa ein Drittel der europäischen Bevölkerung der Pest, die sich von der Krim aus nach Westen ausbreitete. Erst das 20. Jahrhundert sah vergleichbare Katastrophen. Klaus Bergdolt bietet ein umfassendes Bild des "Schwarzen Todes", der Europa verändert hat wie danach erst wieder die Weltkriege unserer Zeit. Nach einem Rückblick auf die Seuchen der Antike und des frühen Mittelalters und eine Einführung in die medizinische Problematik stellt Klaus Bergdolt mithilfe zeitgenössischer Chronisten den Seuchenalltag dar. Dann analysiert er die Begleitphänomene des Schwarzen Todes wie Geißlerzüge und Judenpogrome und zeigt schließlich den Einfluss der Pest auf Kunst und Literatur des Spätmittelalters.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Klaus Bergdolt
Der Schwarze Todin Europa
Die Große Pest und das Endedes Mittelalters
C.H.Beck
Zum Buch
Die Pest, die Europa zwischen 1346 und 1350 heimsuchte, war eine der größten Katastrophen der abendländischen Geschichte. Etwa ein Drittel der Bevölkerung fiel ihr zum Opfer. Der Pestalltag ließ die Menschen wie in einem Bürgerkrieg verrohen; die Angst vor Ansteckung und Tod besiegte Moralgesetze und Verantwortungsgefühl.
Nach einem Rückblick auf die Seuchen der Antike und des frühen Mittelalters und einer Einführung in die medizinische Problematik der Pest stellt Klaus Bergdolt anhand packender Beschreibungen zeitgenössischer Chronisten den Seuchenalltag dar. In mehreren Abschnitten werden die Begleitphänomene des Schwarzen Todes analysiert: Geißlerzüge, Judenpogrome sowie die Auswirkungen der Pest auf das Wirtschafts- und Sozialgefüge der europäischen Länder. Schließlich gilt die Aufmerksamkeit des Autors dem Einfluß der Pest auf Kunst und Literatur des Spätmittelalters.
Über den Autor
Klaus Bergdolt, Dr. med. Dr. phil., ist o. Professor für Geschichte und Ethik der Medizin an der Universität zu Köln. Bei C.H.Beck ist von ihm lieferbar: Das Gewissen der Medizin (2004) und Die Pest. Geschichte des schwarzen Todes (C.H.Beck Wissen, 22011).
Wilhelm Bergdolt (1905–1971)in Dankbarkeit
Inhalt
1. Vorwort
2. Die «Pest» im Altertum
3. Die Pest des frühen Mittelalters
4. Ursache, Infektionswege und klinisches Bild der Pest
5. Pesttheorien im Spätmittelalter
6. Pestregimina und Pestconsilia
7. Europa um 1348
8. Der Ursprung der Pest
9. Die Pest in Osteuropa
10. Der Schwarze Tod in Italien
11. Die Pest in Venedig
12. Die Pest in Florenz
13. Die Pest in Frankreich
14. Die Iberische Halbinsel
15. Die Pest in den deutschsprachigen Ländern
16. Skandinavien und die Niederlande
17. England und der Schwarze Tod
18. Ein Zeuge des Unglücks: Francesco Petrarca
19. Die Geißler
20. Die Judenverfolgungen
21. Das Beispiel einer deutschen Stadt: Würzburg
22. Die Mentalitätskrise der Vierzigerjahre
23. Das Verhalten des Klerus
24. Die ärztliche Ethik
25. Die Universitäten zur Zeit der Pest
26. Die Reaktion der Behörden: das Beispiel Pistoia
27. Wirtschaftliche und soziale Folgen der Pest
28. Pest und Bildende Kunst
29. Pest und Literatur
30. Nachwort
Anmerkungen
Bildquellenverzeichnis
Bibliographie
Register
1. Vorwort
Die Pest, die Europa zwischen 1347 und 1351 heimsuchte, um sich für Jahrhunderte als «Krankheit par excellence»[1] zu etablieren, stellte eine der großen Katastrophen der europäischen Geschichte dar. Die Alltagsbilder des Schwarzen Todes,[2] der im Herbst 1346 von der Krim seinen Ausgang nahm und unseren Kontinent in die schwerste Krise seit Menschengedenken stürzte, lassen selbst heutige Betrachter schaudern. Männer, Frauen und Kinder wurden unversehens, oft innerhalb weniger Stunden, von einer neuen, schmerzhaften, ansteckenden und unheilbaren Seuche hinweggerafft, nachdem sie meist schon nach Auftreten der ersten Krankheitssymptome aus der menschlichen Gemeinschaft ausgestoßen worden waren. Der Europäer unseres Jahrhunderts hat solche Formen des Ausgestoßenseins, das Paradoxon des einsamen Todes inmitten eines Massensterbens, von den Tötungsmaschinerien des Stalinismus und Nationalsozialismus einmal abgesehen, zwar in Kriegs- und Kriegsfolgezeiten erlebt, doch nie mehr als Folge einer allgemeinen Pandemie. Cholera, Typhus, Pocken, Diphtherie, Kinderlähmung oder gefährliche Grippewellen fanden zwar immer wieder zahlreiche Opfer, hatten im Vergleich zur Pest, die 1348 praktisch ganz Europa überrollte, aber doch nur regionale Bedeutung.[3] Dagegen wiesen Seuchen- und Kriegszeiten stets zahlreiche Gemeinsamkeiten auf. Die Grausamkeit des Schwarzen Todes ließ die Menschen wie in einem Bürgerkrieg verrohen, die Angst vor einer Infektion besiegte Moralgesetze und Verantwortungsgefühl. Völlig zu Recht, wenn auch primär unter ökonomischen Gesichtspunkten, stellte James W. Thompson einen allgemeinen Vergleich zwischen dem Inferno von 1348/51 und der Katastrophe des ersten Weltkriegs an.[4] Einer fatalen Gesetzmäßigkeit folgend brachten Seuchen und Kriege – vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert – den Völkern Europas fast zwangsläufig Hunger und Tod, Einsamkeit und Verzweiflung. Dürers «Apokalyptische Reiter» symbolisieren eindrucksvoll die Zusammenhänge von Kriegen, Teuerung, Hungersnot, Pestseuchen und Massensterben.[5] Als «klassische» Plagen stellten sie jahrhundertelang einen Alptraum der Menschheit dar.
Die Abwendung der Mitmenschen, ihre Mitleidlosigkeit und Panik, erklären sich in Pest- und Kriegszeiten durch die Todesangst, der überkommene Ordnungen und Institutionen im Regelfall ebensowenig standhalten wie eingespielte Hilfsmechanismen oder christliche Wertvorstellungen. Sie war ohne Zweifel begründet. Zwischen 1347 und 1350 erlag der Pest etwa ein Drittel der europäischen Bevölkerung (wobei die Mortalität in den einzelnen Städten erheblich variierte[6]), ein ungeheurer Anteil, wenn man bedenkt, daß z.B. – um wiederum den Bezug zum 20. Jahrhundert herzustellen – im und nach dem zweiten Weltkrieg, einschließlich der Opfer des Holocausts und der Vertreibungen, «nur» etwa fünf Prozent der Europäer umkamen.[7] Hier könnte man zwar einwenden, daß die absolute Zahl der Opfer des letzten Weltkriegs erheblich höher lag als 1348/51 (etwa 60 Millionen im Vergleich zu 20 Millionen)[8] und zudem menschliches Leid niemals in Prozenten gemessen werden kann, doch lassen sich die psychosozialen und wirtschaftlichen Folgen der Pest recht gut mit den epochalen Umwälzungen unserer Zeit vergleichen. Es bleibt jedenfalls unbestritten, daß der Schwarze Tod (der Begriff wird im folgenden ausschließlich auf die Pest zur Mitte des 14. Jahrhunderts bezogen) das spätmittelalterliche Europa mindestens ebenso sehr veränderte wie die Weltkriege die moderne Welt. Schon Egon Friedell stellte in seiner Kulturgeschichte der Neuzeit (1932) fest: «Das Konzeptionsjahr des Menschen der Neuzeit war das Jahr 1348, das Jahr des ‹Schwarzen Todes›»,[9] und diese Ansicht wurde von vielen Historikern geteilt.[10] Das 14. Jahrhundert gewinnt so nicht nur eine emotionale, sondern eine eminent historische Bedeutung. Nie zuvor fühlten sich Papst, Kaiser und Könige, Adlige und Handwerker, Gelehrte und Bauern, Klerus und städtische Obrigkeit in gleicher Weise herausgefordert und existentiell bedroht. Weniger die an einigen Orten auftretenden Massenpsychosen, die nicht selten gefährliche Ausmaße annahmen,[11] sondern eine berechtigte Realangst bestimmte dabei ihr Verhalten. Es kann nicht überraschen, daß weitsichtige Zeitgenossen, allen voran Petrarca, schon damals den Umbruchcharakter ihrer Epoche erkannten, den sie freilich nicht nur mit dem Schrecken der Pest zu erklären suchten.[12]
Im folgenden wird der Versuch unternommen, die Auswirkungen der Katastrophe von 1348 auf Wirtschaft und Politik, Kunst und Literatur, Medizin und Theologie, Alltag und Moral zusammenzufassen, kurz, die social response der europäischen Gesellschaft aufzuzeigen. Beschränkungen in der Auswahl der Quellen und Themenschwerpunkte sind dabei unvermeidlich. Zudem erscheint der Forschungsstand, was die einzelnen Teilthemen angeht, recht unterschiedlich.[13] Der Autor war sich durchaus bewußt, daß jedes Teilkapitel interessant genug wäre, in einem separaten Buch vorgestellt zu werden, und daß eine globale Übersicht über eine bestimmte Kulturepoche Risiken birgt. Viele Aspekte des Themas konnten so nur gestreift, aktuelle Forschungsthemen oft nur zusammenfassend diskutiert werden. Im übrigen wurde dankbar auf grundlegende Arbeiten zurückgegriffen, so von J. B. Biraben, N. Bulst, R. Delort, R. S. Gottfried, F. Graus, A. Haverkamp, B. I. Zaddach, P. Ziegler oder K. G. Zinn, um nur einige Namen zu nennen.[14] Ein Kapitel ist der Pathogenese und dem «klinischen Bild» der Pest gewidmet, da ohne Kenntnis von Grundzügen der Seuchenlehre manche von zeitgenössischen Chronisten beschriebene Alltagsphänomene nicht zu verstehen sind. So erscheint es z.B. völlig unsinnig, Beulen- und Lungenpestepidemien zu unterscheiden, da nicht nur der Infektionsweg, sondern vor allem die Resistenzlage eines Individuums über den Befall der Atemorgane entschied. Brach in einer Stadt die Beulenpest aus, ließ sich bei einigen älteren oder geschwächten Bewohnern mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch ein Lungenbefall nachweisen, d.h. die Pest wurde fortan auch durch «Tröpfcheninfektion» übertragen.[15] Ein weiterer Abschnitt handelt von der «Pest» des Altertums sowie der Seuche des frühen Mittelalters.[16] Obgleich das Thema besonders auch soziale Aspekte und Konsequenzen der Katastrophe von 1348/50 einschließt, war es weniger Absicht des Autors, eine Sozialgeschichte der Pest im 14. Jahrhundert zu schreiben. Vielmehr sollte der Leser mit möglichst vielfältigen Phänomenen des Pestalltags um 1350 konfrontiert werden. Auch heute noch bewegen die Berichte zeitgenössischer Chronisten, die den Schwarzen Tod aus nächster Nähe erlebten, ja oft genug selbst erkrankten. Sie stellen – die Bemerkung sei gestattet – den ergreifendsten Teil des Buches dar und sprechen in ihrer Expressivität für sich selbst. Aus diesem Grund findet der Leser, besonders in den die Ausbreitung der Pest abhandelnden Kapiteln, zahlreiche wörtliche Zitate aus Augenzeugenberichten.[17]
Obgleich die Reaktion der Gesellschaft auf globale tödliche Bedrohungen nicht zuletzt von den «jeweiligen historischen Rahmenbedingungen» (Zinn[18]) abhängt, steht, ungeachtet aller historischen Neugier, zudem auch die Frage im Raum: Wie würden die Menschen unserer Tage, wie würden wir selbst reagieren, wenn wir plötzlich mit einer der Pest des 14. Jahrhunderts vergleichbaren Seuche konfrontiert würden, d.h. wenn, von heute auf morgen, der Tod wie eine Grippe oder wie Schnupfen übertragen würde? Die Erfahrung mit der, was die Ansteckungsgefahr betrifft, im Vergleich zur Pest geradezu harmlosen Immunschwäche Aids läßt nichts gutes ahnen. So gewinnt das Thema, wie die Seuchengeschichte überhaupt, eine neue, höchst aktuelle Bedeutung.
In der alteuropäischen Gesellschaft bedeutete, jedenfalls bis ins frühe 18. Jahrhundert, Umgang mit Epidemien vor allem Umgang mit der Pest. In Auseinandersetzung mit ihr wurden bereits während des Schwarzen Todes Methoden der Prophylaxe und des Schutzes entwickelt, denen man offensichtlich bis ins 19. Jahrhundert vertraute. Sie hatten freilich einen fatalen gemeinsamen Nenner: Sie waren kaum effektiv. Ungeachtet mancher Lernprozesse, die vor allem die Quarantäne Verdächtiger und die Isolierung Kranker betrafen, unterschied sich deshalb der Pestalltag in den folgenden Jahrhunderten nur wenig von dem des 14. Jahrhunderts.
2. Die «Pest» im Altertum
Jahrtausendelang zählten Pestseuchen zu den Geißeln der Menschheit. In unregelmäßigen Abständen hatten sie bereits die Kulturvölker der Antike heimgesucht. Der Durchschnittsmensch fühlte sich ohnmächtig gegenüber Epidemien und Krankheiten, die nicht erst in der christlichen Tradition als Strafe Gottes empfunden wurden.[1] Es erscheint in diesem Zusammenhang eher belanglos, ob es sich bei den in der antiken Literatur geschilderten Seuchen tatsächlich um die Pest im naturwissenschaftlichen Sinn des Wortes handelte, d.h. die durch Yersinia bzw. Pasteurella Pestis[2] hervorgerufene Infektionskrankheit. Sorgfältige Interpretationen zeitgenössischer Beschreibungen lassen eher das Gegenteil vermuten. Mit großer Wahrscheinlichkeit wurden im Altertum auch Pocken, Typhus, Dengue-Fieber und andere ansteckende Seuchen als Pest (lat. pestis, griech. loimós, hebr. deber) bezeichnet. Dies ist ohne weiteres verständlich, da sich die finalen Krankheitsbilder, gekennzeichnet durch Gewichtsreduktion, Benommenheit, Flüssigkeitsverluste, Bluthusten, Durchfälle, Hautgeschwüre, Augenentzündungen und Lymphknotenschwellungen (Bubonen), bei allgemeiner Therapieresistenz weitgehend entsprechen und der Zusammenbruch des körpereigenen Abwehrsystems eine mehr oder weniger einheitliche klinische Symptomatik hervorrufen kann, die rasch zum Tode führt.[3] Solche «Pestseuchen» im weitesten Sinn stellten für Europa, Asien und Nordafrika eine kontinuierliche Bedrohung dar und bestimmten den Alltag Ägyptens, Mesopotamiens, Israels, Griechenlands und Roms ebenso wie Hungersnot oder Kriege. Die Berichte zeitgenössischer Chronisten lassen dabei menschliche Verhaltensmuster erkennen, wie wir sie letztendlich auch zur Zeit des Schwarzen Todes, ja bis in unsere Tage bei Epidemien wiederfinden.[4]
Neben der physischen Existenz bedrohten Seuchen auch stets die psychische Stabilität des Individuums. Sie lösten Familienbande, provozierten und entschieden Kriege, stürzten Dynastien, verursachten Völkerwanderungen, führten zu Hungersnot, riefen soziale Spannungen hervor und beeinflußten das religiöse Verhalten. Doch zeigten die antiken Epidemien niemals die flächendeckende Wirkung der echten «mittelalterlichen» Pest. Die Seuche (deber), die Gott den Ägyptern als Plage schickte, scheint nach der alttestamentarischen Darstellung so ebensowenig dem Schwarzen Tod vergleichbar gewesen zu sein wie diejenige, welche das Heer der Philister dezimierte, nachdem diese die Bundeslade geraubt hatten. Zwar spricht der biblische Autor tatsächlich von Beulen (Apholin) als Krankheitssymptomen, ja von einer charakteristischen Mäuseplage, doch bleibt sein Bericht zu allgemein, um auf eine echte Pest schließen zu lassen.[5]
Tatsächlich läßt sich diese Diagnose für keine uns bekannte Epidemie des Altertums mit Sicherheit stellen. Zwar beschreibt auch Hippokrates (460–377), die führende medizinische Autorität der Griechen,[6] Fieber und Drüsenschwellungen als Symptome einer Seuche, deren Augenzeuge er war (und die von Galen und anderen antiken Autoren später als «Pest» interpretiert wurde).[7] Doch sind hier ebenso Zweifel angebracht wie bei der berühmten «Pest» des Thukydides (429), die durch die meisterhafte Schilderung des Athener Historikers in die Literatur einging. Erstmals in der Seuchengeschichte werden hier «klassische» Verhaltensmuster beschrieben, wie sie auch für den Schwarzen Tod typisch waren. Bittprozessionen, die Suche nach «Schuldigen», Todesangst, aber auch eine paradox erscheinende Vergnügungssucht,[8] der Verfall der Sitten und die Verrohung des Alltags, die Flucht der Reichen, die Verzweiflung der Infizierten und Sterbenden sowie eine allgemeine Resignation charakterisieren den Seuchenalltag ebenso wie die tödliche Selbstaufopferung mancher Angehöriger und Ärzte. Der Vorwurf der Brunnenvergiftung fehlt in Athen bereits ebensowenig wie in der mittelalterlichen Pestliteratur.[9]
Die geschilderten Reaktionen wurden bald zu Topoi der Seuchengeschichte. Sie lassen sich in entsprechenden Situationen, wie erwähnt, auch später häufig nachweisen. Im übrigen vermuten die Medizinhistoriker heute, daß Athen durch eine Pockenepidemie dezimiert wurde (was auch für die Pest angenommen wird, vor der im zweiten nachchristlichen Jahrhundert Galen aus Rom floh[10]). Tatsächlich erlauben aber die von Herodot, Livius, Sueton und Cassius Dio verfaßten Seuchenbeschreibungen kaum präzise Diagnosen. Fest steht nur, daß es sich jeweils um Epidemien mit hohen Menschenverlusten handelte.[11] Natürlich konnten auch die Ärzte der Antike keine wirksamen Prophylaxe- und Therapievorschläge präsentieren, es sei denn den dringlichen Rat zur Flucht. Diese radikale Prophylaxe stellte noch im 18. Jahrhundert die sinnvollste Maßnahme überhaupt dar und wurde, vom Rückzug der Pest aus Europa in der Folgezeit einmal abgesehen, erst nach Entwicklung der Antibiotika überflüssig.[12]
3. Die Pest des frühen Mittelalters
Obgleich ein Vorkommen von Yersinia Pestis in der Antike nicht beweisbar ist, handelte es sich bei der Katastrophe von 1348/51 keinesfalls um die erste nachweisbare Pest der europäischen Geschichte. Interpretieren wir die Quellen richtig, wurde die Beulenpest bereits 541 unter Justinian von Ägypten aus in die levantinischen Hafenstädte eingeschleppt.[1] Prokop, der Chronist am Kaiserhof in Byzanz und sein Nachfolger Agathias, ferner Evagrius Scholastikus aus Antiochia, der Historiker Johannes Malalás, der Rhetor Zacharias und – weit im Westen, am Merowingerhof – Gregor, der Bischof von Tours, beschrieben die Justinianische Pest[2] aus unmittelbarer Erfahrung, wobei sie in ihren rhetorischen Berichten recht unverblümt die Seuchenbeschreibung des Thukydides imitierten.[3] Die Mimesis des angesehensten Historikers der Antike gab ihren Schriften, obwohl es sich in Athen, wie wir sahen, gerade nicht um eine wirkliche Pest gehandelt hatte, besonderen Glanz.[4] Spätestens im Winter 543 hatte die Seuche im Osten Aserbeidschan (Atropatene), im Westen Dalmatien, Italien, Spanien und Nordafrika erreicht, im Norden Reims und Trier. Die Menschenverluste waren enorm, besonders in den Hafenstädten des Mittelmeers. Der Schiffsverkehr und – nach dem Zeugnis des Evagrius – Kranke auf der Flucht[5] sorgten für eine rasche Ausbreitung der Epidemie, die literarisch freilich weit weniger bekannt wurde als der Schwarze Tod des 14. Jahrhunderts.[6] Während der Kaiser sie optimistisch im März 544 «offiziell» für erloschen erklärte, flackerte die erste gesicherte Pest der europäischen Geschichte bereits 577 wieder auf und blieb etwa 200 Jahre endemisch[7] (nicht zufällig etablierte sich um 680 in Rom der Kult des hl. Sebastian, des wichtigsten Pestheiligen im ersten Jahrtausend[8]). Die verlustreichste Epidemiewelle überzog um 750 Italien. Kurz darauf erlosch die Pest endgültig. Erst 1347, nach rund 600 Jahren, sollte die Krankheit Europa wieder in Angst und Schrecken versetzen.[9]
Die Parallelen zwischen dem Schwarzen Tod und der Justinianischen Pest waren vielfältig. Wie im 14. Jahrhundert deutete man bereits zur Völkerwanderungszeit eine merkwürdige Häufung von Naturkatastrophen, Vulkanausbrüchen, Überschwemmungen und Kometenerscheinungen als unheilvolle Vorzeichen von Kriegen und Seuchen und brachte sie mit der Pest in Zusammenhang.[10] «Die Zukunft liegt im Dunkeln. Sie wird sich entwickeln, wie es Gott gefällt, der auch die Ursache kennt», notierte Evagrius pessimistisch.[11] Die meisten Zeitgenossen waren davon überzeugt, daß Gott die Menschheit strafen wollte. Theophanes Homologetes vermutete, daß «der Pesttod kam …, um den frevelhaften Konstantinos (d.h. Kaiser Konstantinos V. Kopronymos, 741–755) zu züchtigen und ihn von seiner Raserei gegen die heiligen Kirchen und die ehrwürdigen Ikonen abzubringen».[12] Die Seuche wurde so zweifellos auch politisch ausgeschlachtet. Bekanntlich stellte der Bilderstreit über Jahrhunderte ein Hauptproblem byzantinischer Innenpolitik dar.[13]
Prokop, der berühmteste Chronist des 6. Jahrhunderts, beschrieb gewissenhaft die neurologischen Symptome der Seuche, wie wir sie aus vielen späteren Schilderungen kennen: Wahnsinnsanfälle, Lähmungen, Benommenheit, Traumgesichter und Fieber.[14] Augenentzündungen, Unterblutungen der Haut, Durchfall, Drüsenschwellungen, Gelenkschmerzen, die hohe Ansteckungsgefahr sowie die Wahrscheinlichkeit eines baldigen Todes stellte Evagrius in den Vordergrund seiner Darstellung. Traten Bubonen, also Pestbeulen auf, war mit dem Tod innerhalb von drei Tagen zu rechnen.[15] Prokop unterschied dabei schon richtig Fälle mit raschem Tod (d.h. innerhalb weniger Stunden) von solchen, wo die Erkrankten erst nach mehreren Tagen starben, was eine rein empirische Unterscheidung von Lungen- und Beulenpest bedeutete. Aussicht auf Rettung bestand, wenn eine Pestbeule platzte und sich der infektiöse Inhalt nach außen ergoß.[16]
Wie viele Seuchenperioden rief auch die Pest des Justinian Hungersnot und soziales Elend hervor. Viele Kranken brachen auf offener Straße zusammen, ohne daß jemand den Mut fand, ihnen zu helfen. In den Städten sollen die Straßen von Leichen gesäumt gewesen sein. Allein für die Hauptstadt Konstantinopel gab Prokop eine (freilich rhetorisch übertriebene Zahl) von 5000 bis 10.000 «und mehr» Opfern pro Tag an![17] Nach Johannes von Ephesus befiel die Seuche bevorzugt die Armen, die nicht hatten fliehen können.[18]
Wir wissen heute, daß die Justinianische Pest unabsehbare politische Konsequenzen hatte. Die Berber konnten noch im 6. Jahrhundert ungehindert das damals byzantinisch besetzte Gebiet des heutigen Tunesien erobern, dessen Besatzung der Seuche erlegen war. Ebenso problemlos nahmen die Awaren und Langobarden Illyrien ein, während die Bulgaren 599 das schutzlose Konstantinopel belagerten. Die Byzantiner verloren Syrien, die Sassaniden Mesopotamien und, zwischen 635 und 640, auch Teile Ägyptens an die Araber. Kalif Omar hielt 637 seine Truppen so lange in der Wüste zurück, bis die Pest in Damaskus abgeklungen und die byzantinischen Garnison samt der Mehrzahl der Einwohner umgekommen war. Er konnte die Stadt so praktisch kampflos einnehmen. Andererseits wurden die Eroberer, die mit dem Erreger der Seuche noch nicht in Berührung gekommen waren, durch die folgende Pestwelle selbst dezimiert.[19] Pest und Politik bildeten zur Zeit der Völkerwanderung zeitweise zwei Seiten einer Medaille.
Freilich war im 14. Jahrhundert die Erinnerung an die Seuchenkatastrophe des frühen Mittelalters verblaßt. Während der gelehrte Evagrius sich 542 sehr wohl an den Bericht des Thukydides erinnerte, lagen die von ihm verfaßten Aufzeichnungen 1348 – wie diejenigen Prokops und anderer frühbyzantinischer Autoren – in Klosterbibliotheken der Hauptstadt und waren bestenfalls einigen Klerikern bekannt. Nur privilegierte Chronisten wie der Kaiser Johannes Kantakuzenos kannten die Werke aus justinianischer Zeit, während die antike Vorlage des Thukydides häufiger als Vorlage diente.[20] Auch im Westen war die Historia Francorum Gregors von Tours offensichtlich in Vergessenheit geraten, obgleich am Hof der Valois Abschriften existierten.[21] Ein erstaunliches Phänomen, berücksichtigt man, daß viele mehr oder weniger bedeutende Ereignisse der antiken Geschichte im Mittelalter sehr wohl präsent waren (man denke nur an Dantes oder Petrarcas Antikenbegeisterungi) und selbst Kunstwerke des 6. Jahrhunderts häufig kopiert wurden.[22] Besonders im Westen Europas hatte man die bis dahin folgenschwerste Epidemie, der ein Drittel bis die Hälfte der byzantinischen Bevölkerung zum Opfer gefallen war, verdrängt.[23] Erst durch die im Hoch- und Spätmittelalter entwickelte Schreibkultur, den zunehmenden Kommunikationsfluß zwischen den Ländern sowie die Institution höfischer und städtischer Chronisten wurde eine solche kollektive Vergeßlichkeit unmöglich.
Von der mangelhaften Überlieferung einmal abgesehen, hätten sich die Historiker und Humanisten des 14. Jahrhunderts für das frühe und hohe Mittelalter zunächst auch wenig interessiert. Petrarca, Boccaccio und andere intellektuelle Zeitgenossen verachteten diese «finstere» Epoche zutiefst.[24] Es war so, im wahrsten Sinn des Wortes, eine «unerhörte» Seuche, die Europa um die Mitte des 14. Jahrhunderts heimsuchte.[25]
4. Ursache, Infektionswege und klinisches Bild der Pest
Um die von Evagrius und Prokop bereits im 6. Jahrhundert beschriebenen Krankheitssymptome zu verstehen, ist ein kurzer Exkurs in die Pathophysiologie der Pest unvermeidlich. Die Krankheit wird durch den Pestbazillus, Yersinia bzw. Pasteurella Pestis hervorgerufen, den Alexandre Yersin 1894 während einer Epidemie in Hongkong entdeckte.[1] Hauptwirte des Erregers sind kleine Nager, besonders aber Ratten, die homolog, d.h. über bereits infizierte Artgenossen durch den Biß («Stich») des Ratten- oder Pestflohs (Xenopsylla Cheopis Roth) infiziert werden. Befällt der Rattenfloh dabei die Wanderratte (Rattus Norvegicus Birkenhout), bleibt die Pest mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit endemisch, d.h. sie tritt nur hier und dort in unregelmäßigen Abständen auf, ohne daß sie sich dabei zu einer wirklichen Epidemie entwickelt. Infiziert der Floh dagegen die Hausratte (Rattus Rattus), gelangt der Erreger vermehrt, ja massenhaft in menschliche Siedlungsräume, in Häuser, Speicher, Keller, aber auch Laderäume von Schiffen. Da der Rattenfloh gleichzeitig menschenpathogen ist, besteht damit Lebensgefahr für die Bevölkerung. Die heterologe Übertragung des Erregers von der Hausratte auf den Menschen bewirkt somit die Epidemie, die meist von Städten, Häfen oder größeren Dörfern ihren Ausgang nahm. Leider überträgt auch der Menschenfloh (Pulex irritans) den Pestbazillus, so daß bei zunehmender Infizierung der Bevölkerung zwangsläufig auch ein homologer Infektionsmechanismus von Mensch zu Mensch einsetzt und die Mortalitätsziffer steigert.[2]
Der genaue Infektionsmodus wurde bereits 1897 durch Ogata geklärt. Im infizierten Floh blockiert ein Pfropfen aus Bazillen und Blut den Proventrikel, eine kleine Tasche der Speiseröhre. Beim «Stich» bzw. Biß wird dieser hochinfektiöse Blutpfropf regurgiert und in die Bißwunde, d.h. in die Blutbahn von Ratte oder Mensch geschleudert. Möglich ist auch eine Infektion durch den Flohkot, der bei starkem Jucken, besonders bei Menschenflohbefall, in die Haut gerieben wird oder durch offene Wunden und Ekzeme in die Blutbahn des Wirts gelangt.[3]
Besonders nach dem Eingehen infizierter Ratten und Nager setzen sich die Pestflöhe massenhaft auf Menschen ab. Pferd, Schaf, Rind und Kamel werden offensichtlich vom Ratten- oder Menschenfloh gemieden und erkranken extrem selten, während sich Hunde- und Katzenflöhe, die ebenfalls als Überträger in Frage kommen, im allgemeinen auf Hunde- und Katzenfelle beschränken. Insgesamt ist der Mensch nur eine von etwa 370 potentiellen Wirtsspezies, wobei die meisten freilich bei der Pestübertragung im Vergleich zu den Nagern eine untergeordnete Rolle spielen.[4] Die Infektion wird aber dadurch begünstigt, daß Flöhe ungefähr dreißig Tage auch ohne Symbiose mit einem Wirtstier überleben und während dieser Zeit ohne weiteres aus Kleidern, Lumpen, Betten, Ritzen usw. heraus Menschen befallen können. Unterhalb von zehn Grad Celsius fällt der Floh in eine Gliederstarre. Dies ist wohl der Grund, daß sich die Pest im Winter bzw. bei kühleren Temperaturen langsamer ausbreitete.[5]
Die Infektion mit dem Pestbazillus erfolgte aber nicht nur durch Flohbiß, Kratzen oder Hautläsionen, sondern ebenso über den Nasen-Rachen-Raum (wie dies im Mittelalter schon bei der Lepra der Fall gewesen war[6]). Generell sind somit zwei große Ansteckungswege bekannt: durch die Haut und über die Lungen. Die Hautinfektion, im «klassischen» Fall durch Flohstiche hervorgerufen, führt in der Regel zur Beulenpest (Bubonenpest). Nach einer Inkubationszeit von einem bis sechs Tagen entsteht an der Einstichstelle eine Nekrose, die sich blau-schwarz verfärbt (Schwarze Blattern). Zwei oder drei Tage später bildet sich eine Schwellung der regionalen Lymphknoten, die zum eitrigen Aufbrechen neigen. Nach etwa einer Woche erfolgt, unter rasenden Kopfschmerzen, Benommenheit, Fieberschüben und allgemeiner Erschöpfung, eine langsame Besserung, oder die Lymphbarriere bricht durch, d.h. die Erreger gelangen in die Blutbahn. Die nachfolgende Septikämie führt fast immer zum Tode. Falls die Blutvergiftung ausbleibt, sind anhaltende Pusteln, diffuse Lymphknotenschwellungen («Pestbeulen»), Hautunterblutungen, Verdauungsstörungen, Schwindel, Halluzinationen und psychische Auffälligkeiten, wie sie bereits Prokop beschrieb, typisch.[7] Jederzeit kann über ein Delir und Koma noch der Tod eintreten. Sitzen das primär infizierte Ganglion bzw. die zugehörigen Lymphknoten tief, kann der Patient auch ohne sichtbare äußere Symptome sterben. Durchbricht ein Abszeß die Lungengewebe, ist zudem ein sekundärer Lungenbefall möglich, dessen Symptome dem primären entsprechen. Er endet praktisch immer tödlich.
Die hochgefährliche primäre Lungenpest, die wie Schnupfen oder Grippe über den Nasen-Rachen-Raum übertragen wird, d.h. durch «Tröpfcheninfektion», hat eine Inkubationszeit von einem bis zwei Tagen und ist durch Herzrasen, Bluthusten, Atemnot und schließlich Ersticken auf Grund einer Nervenlähmung sowie der Lungengewebszerstörung gekennzeichnet. Sie führt fast immer zum Tode. Das Ende kann u.U. schon nach wenigen Stunden eintreten. Boccaccio berichtet von gesunden, jungen Menschen, die sich morgens noch ihrer Gesundheit erfreuten, «um am Abend darauf in der anderen Welt mit ihren Vorfahren zu tafeln».[8] Freilich bildete ein so rascher Tod die Ausnahme. Er trat im Regelfall nach ein bis zwei Tagen ein.[9] Beulen- und Lungenpest stellten aber, wie bereits erwähnt, nur verschiedene Verlaufsformen derselben Krankheit dar. Jederzeit konnte die Bubonenpest in die gefährlichere Form übergehen! Unsinnig wäre es, die harmlosere Verlaufsform einer historischen Epidemie mit dem isolierten Auftreten der Beulenpest zu erklären. Bei Individuen mit herabgesetzter Resistenz, bei Neugeborenenoder Alten, war jederzeit mit einem Lungenbefall zu rechnen!
Natürlich lassen sich die während der letzten hundert Jahre gewonnenen Detailkenntnisse über Pathomechanismus und klinische Verlaufsformen der Pest nur mit Vorbehalten auf den Schwarzen Tod des 14. Jahrhunderts übertragen, da Bazilleneigenschaften sich ohne weiteres verändern können.[10] Andererseits unterschied bereits Prokop, vor allem aber 1365 Guy de Chauliac, der Leibarzt dreier Päpste und des Königs von Frankreich, ohne natürlich die Ursachen zu durchschauen, rein empirisch Lungen- und Beulenpest. In Guys Chirurgia Magna lesen wir: «Die Krankheit hielt sich (in Avignon) sieben Monate. Es gab zwei Formen. Die erste dauerte zwei Monate und war durch anhaltendes Fieber und Blutspucken gekennzeichnet, und man starb daran innerhalb von drei Tagen. Die zweite dauerte lange Zeit an, ebenfalls unter anhaltendem Fieber, wobei sich Pusteln und Beulen auf der Haut entwickelten, besonders unter den Achseln und in der Leistengegend. Man starb daran nach fünf Tagen».[11]
Die Krankheitsdauer variierte natürlich in beiden Fällen, und es gab Menschen, die die Beulenpest überlebten.[12] Eine relative, d.h. nur eine bestimmte Zeit anhaltende Immunität war bei den Überlebenden die Regel und wurde bereits im 14. Jahrhundert beschrieben.[13] Die Prognose hing letztlich von der Funktionsfähigkeit der Lymphknotenbarrieren ab. Wurden sie durchbrochen, war ein tödlicher Ausgang wahrscheinlich. Die Lungenpest war deshalb so gefährlich, weil diese Schutzschranke von vorneherein ausgeschaltet war. Der Erreger gelangte über die Lungenbläschen direkt ins Blut.
Die erwähnten Wanderratten traten in Europa gehäuft erst im 17. Jahrhundert auf, so daß ihre epidemiehemmende Rolle zur Zeit des Schwarzen Todes keine Rolle spielte. Durch ihre starke Mobilität – sie verlassen, im Gegensatz zur Hausratte, Städte, Dörfer und Siedlungen nach kurzer Zeit – verhinderten sie explosionsartige Ausbreitungen der Seuche. Wahrscheinlich hängt der Rückzug der Pest aus Europa seit dem 18. Jahrhundert tatsächlich mit einer relativen Vermehrung dieser Rattenspezies und einer Verminderung der Hausratten zusammen.[14] Epidemiehöhepunkte waren – dies beweist die Pestgeschichte seit 1348 – fast immer im Herbst zu erwarten, da sich die Hausratten im Spätsommer und Rattenflöhe zu Herbstbeginn vermehrten.[15] Kalte Winter verhinderten große Epidemien, doch folgte eine zweite Erkrankungswelle meist im Frühjahr, wenn infizierte Ratten, von den aus der Kältestarre erwachten Flöhen «gestochen», in Massen verendeten und der Floh, mangels geeigneter Wirte unter den Nagern, notgedrungen auf Menschen übersiedelte.[16]
Wir kennen heute recht genau die Wirkung des Pesterregers auf den menschlichen und tierischen Organismus. Lymphzellen und «Makrophagen» sind nicht nur unfähig, Yersinien abzutöten, sondern nehmen sie fatalerweise als Wirtszellen auf. Die Bazillen, ovale, gramnegative,[17] unbewegliche Stäbchenbakterien, verstopfen so die Kapillaren und verursachen Blutungen und Ödeme im Gewebe, die innerhalb der Ganglienkapseln auf das Nervengeflecht drücken. Unerträgliche Schmerzen gehörten daher mit zum Krankheitsbild der Pest und kennzeichneten das finale Stadium der Septikämie.[18] Der Infektionsmodus der Seuche ist freilich auch heute noch nicht in allen Details erklärt, weshalb z.B. das Ausbleiben großer Epidemien in den Ballungszentren der Dritten Welt durchaus rätselhaft erscheint. Immerhin wurden noch nach dem zweiten Weltkrieg in den USA kleinere Pestepidemien nur durch massiven antibiotischen Einsatz unter Kontrolle gebracht.[19]
5. Pesttheorien im Spätmittelalter
Von der Alltagserfahrung abgesehen, daß die unbekannte Seuche hochinfektiös war, war der Kenntnisstand der Ärzte und Gelehrten des 14. Jahrhunderts über Ursache, Wirkung und Therapie der Pest deprimierend gering. Die spätmittelalterlichen Mediziner verließen sich in ihrem Kampf gegen den Schwarzen Tod auf antike Fachautoritäten wie Hippokrates, Galen und einige spätantike Autoren, die der humoralpathologischen Krankheitslehre anhingen. Gesundheitsstörungen bedeuteten demnach Fehlmischungen (Dyskrasien) der vier Körpersäfte Blut, Schleim, gelbe und schwarze Galle. Wie etwa ein Überwiegen der kalten und trockenen schwarzen Galle (melaina cholé) zur Melancholie prädisponiert, bedeutet ein Überschuß des feucht-warmen Blutes die Gefahr der Fäulnis innerer Organe, die nach der Überzeugung antiker und mittelalterlicher Ärzte den eigentlichen Pestvorgang darstellte. Man nahm an, daß diese Fäulnis aus der Luft oder über die Nahrung in den Körper gelangte. Die Luftverpestung erklärte man sich durch Ausdünstungen (Miasmen), deren Ursprung und Zusammensetzung freilich umstritten war.[1] Wie die Luft konnten auch zur Fäulnis neigende Speisen, etwa verdorbener Fisch, Magen und Darm infizieren. Als besonders gefährlich, ja als «klassische» Gefahrenquelle galten ein feuchtschwüles Klima sowie die gefürchteten Südwinde. Ebenso stand die Luft über stehenden Gewässern und Sümpfen im Verdacht, die Ausbreitung der Miasmen zu begünstigen. Gefürchtet waren auch Ausdünstungen bzw. der Atem von bereits Erkrankten, die man, zwar mit humoralpathologischer Begründung, doch – nicht zuletzt aus Erfahrung – objektiv richtig[2] für extrem infektiös hielt. Die Ärzte prüften deshalb den Puls meist mit abgewandtem Gesicht.[3]
Sie versuchten zudem durch Aderlaß, die Menge des vermeintlich schädlichen Blutes zu verringern und durch Einlauf bzw. Brechmittel Fäulnisgase oder faulige Speisereste aus dem Körper zu eliminieren. An klimatisch ungünstigen Orten, aber auch in Krankenzimmern reinigte man die Luft durch den Rauch von Holzfeuern. Gesicht und Hände wurden mit Essigwasser desinfiziert, dem man eine «pestizide» Wirkung zuschrieb. Da bekannt war, daß in Wohnräumen warme (und somit auch die pestverdächtige) Luft nach oben steigt, wurden die Kranken selbst hoch gelagert, damit sie die von Angehörigen und Pflegern eingeatmete Luftschicht nicht «verpesten» konnten.[4] Nur kalter Nordwind, niemals feuchtschwüler Südwind sollte nach Ansicht der Mediziner ins Krankenzimmer gelangen.[5]
Buffalmacco, Der Triumph des Todes (Pisa, Camposanto, um 1338).
Die Pesttheorien des 14. Jahrhundert kulminierten im Pesthauchmodell des Gentile da Foligno, eines umbrischen Arztes, der selbst, «weil er sich zu sehr um die Pestkranken bemüht hatte»,[6] im Juni 1348 in Perugia der Seuche erlag. Als Folge einer ungünstigen Konstellation von Mars, Jupiter und Saturn, der drei «oberen» Planeten, am 20. März 1345 (!) wurden nach Gentile krankmachende Ausdünstungen von Meer und Land in die Luft gesogen, erhitzt und als «verdorbene Winde» (aer corruptus) wieder auf die Erde zurückgeschleudert. Wird ein solcher Pesthauch, so die Theorie, vom Menschen eingeatmet, sammeln sich giftige Dämpfe um Herz und Lunge, verdichten sich dort zu einer «Giftmasse»,[7] die diese Organe infiziert, durch die ausgeatmete Luft aber auch Familienangehörige, Gesprächspartner und Nachbarn anstecken kann.[8] Therapie bedeutete nach Gentile da Foligno «die Stärkung des Herzens und der Hauptorgane sowie die Bekämpfung der giftigen Fäulnis, welche in der Verhinderung ihrer Zunahme bei bereits Erkrankten und eines Befalls von Gesunden besteht».[9] Wichtigste Aufgabe des Arztes, aber auch der Behörden bleibt so die Prophylaxe und die Verhinderung von Massenepidemien, «damit die Erkrankten nicht auf unmenschliche Art sich selbst überlassen und auf noch elendere Weise ausgestoßen werden … als es den gefühllosen Tieren eigen ist».[10]
Entscheidend war, daß sich auch das berühmte Pariser Pestgutachten vom Spätsommer 1348 auf diese Thesen bezog. Es wurde im Auftrag des Königs, in der Übersetzung und Bearbeitung von Pierre de Damouzy, der Pariser Fakultät vorgelegt, von den medizinischen Koryphäen der Stadt allgemein akzeptiert und der Öffentlichkeit präsentiert. [11] Im Grunde verschleierte es freilich die Hilflosigkeit der Ärzte. Bereits 1832 urteilte Hecker sehr treffend: «Die berühmte Fakultät befand sich in der peinlichen Lage, auf Verordnung weise zu sein».[12] Sicher war nur, daß die Pest ansteckend war. Auch Gentiles Pesthauchmodell reflektierte im letzten nur Thesen antiker Autoritäten. Daß klimatische Gegebenheiten, etwa feuchtschwüle Luft, Krankheiten förderten, erkannten bereits die Autoren des Corpus Hippocraticum, d.h. später dem Hippokrates zugeschriebener Werke des 5. bis 2. Jahrhunderts vor Christus. Nach Galen können auch Brunnen und stehende Gewässer, Tierkadaver und menschliche Leichen, die zu Kriegszeiten nicht sofort beerdigt werden, die Luft verderben.[13] Daß bei Erdbeben pesterregende Luft aus dem Erdinneren frei wird, hatte Avicenna im Canon Medicinae bestätigt, der seit dem 12. Jahrhundert in lateinischer Übersetzung vorlag.[14] Tatsächlich ereignete sich am 25. Januar 1348 in Friaul ein schreckliches Beben, dessen Ausläufer selbst in Deutschland und Mittelitalien Zerstörungen anrichteten. Viele Chronisten sahen hier direkte Zusammenhänge mit der Pest, die wenige Monate später diese Länder überzog.[15]
Der in den Pestgutachten gegebene Rat war eindeutig: Die Flucht aus den verpesteten Gebieten galt – in der Antike wie im 14. Jahrhundert – als die sinnvollste Reaktion überhaupt. Fenster sollten nur nach Norden geöffnet, die eingeatmete Luft durch Duftstoffe, etwa in den Pestmasken der Ärzte, gereinigt werden.[16] Körperliche Anstrengung, so auch der Geschlechtsverkehr, waren zu vermeiden, um nicht die Einatmung gefährlicher Miasmen zu forcieren. Eine Pestdiät erschien durchaus sinnvoll, um fäulniserregende Substanzen vom Körper fernzuhalten. Stinkende, penetrant riechende Stoffe galten, vor die Nase gehalten, als sicherstes Prophylaktikum, wie auch der berühmte Theriak, jenes Sammelsurium von toten Substanzen, Opiaten, Schlangenfleisch, Vipernextrakten und Krötenpulver, das als Allheilmittel gepriesen wurde.[17]
Die von Boccaccio und anderen Autoren beschriebenen «hedonistischen» Verhaltensweisen erhalten vor dem Hintergrund zeitgenössischer Pesttraktate duchaus einen positiven Sinn. «Lachen, Scherze und gesellige Feiern» trugen zum Ausgleich der Temperamente bei. Der Rückzug in die Landvilla, wo Musik und Spiel gepflegt wurden, stärkte durch den Entspannungseffekt die Widerstandskräfte. Noch 1580 betonte der Paduaner Medizinprofessor Mercuriale, daß man durch Musik, Zuversicht, Freude und Heiterkeit erreichen kann, «daß Geist und Körper kräftiger gegen die Krankheit der Pest ankämpfen».[18] Siegmund Albich (1347–1427), Leibarzt des böhmischen Königs Wenzel und Professor an der Prager Universität, mahnt in seinem Pestregimen, «von der Pest weder zu sprechen noch an sie zu denken, da allein schon die Angst vor der Seuche, die Einbildung und das Reden von ihr den Menschen ohne Zweifel pestkrank machen».[19]
Von eminenter Bedeutung für die spätmittelalterliche Medizin war zudem die Astrologie, die im Westen durch Übersetzungen arabischer Autoren populär geworden war.[20] Wie alle materiell faßbaren Vorgänge galt auch die Physiologie von Mensch und Tier, d.h. die Interaktion der Leibessäfte, als direkt von astrologischen Einflüssen abhängig, weshalb die Berücksichtigung der Sterne bei Diagnosestellung und Therapie unabdingbar schien. Pietro d’Abano und Taddeo Alderotti hatten zu Beginn des 14. Jahrhunderts in Padua bzw. Bologna die Astrologie als medizinisches Lehrfach etabliert.[21] In Montpellier unterstrich der jüdische Gelehrte Profatius bereits vor 1300 durch Übersetzungen und die Konstruktion eines Astrolabiums ihren Stellenwert.[22] Jeder Arzt, der zur Zeit des Schwarzen Todes praktizierte, hatte eine profunde astrologische Ausbildung erfahren. Das hippokratisch-galenische Lehrgebäude war bereits im 10. Jahrhundert durch Avicenna um die Sternkunde erweitert worden,[23] und gerade zur Zeit der großen Pest wiesen bedeutende Ärzte wie Guy de Chauliac oder Dino del Garbo auf ihre Bedeutung für die Heilkunde hin:[24] Der Astrologe berät zu Seuchenzeiten den Arzt, aber auch die Behörden. Er kann zur Flucht raten und vor nutzlosen Schritten warnen. Ein guter Arzt ist freilich selbst astrologisch versiert. Im übrigen sah man in der Sternkunde im 14. Jahrhundert eine seriöse Naturwissenschaft. Ebenso fand die uralte Vorstellung vom menschlichen Körper als Mikrokosmos, der – nicht zuletzt durch die parallele Vierzahl der Körpersäfte, Elemente, Himmelsrichtungen und Jahreszeiten – dem Makroskosmos der Welt entspricht, in den Pesttheorien ihren Niederschlag. Auch unter diesem Gesichtspunkt ließ sich die Astrologie als medizinische Teilwissenschaft rechtfertigen.[25]
Es sei noch einmal betont: Die spätmittelalterlichen Ärzte kannten weder die Ursache noch den Verbreitungsmodus der Pest. Es gab im 14. Jahrhundert weder die Möglichkeit, den Pesterreger nachzuweisen, noch das theoretische Wissen, um von der humoralpathologisch orientierten Schulmedizin der Zeit abzurücken. Man ergriff aber bereits 1348 Maßnahmen zur Eindämmung der Seuche, die unsere Bewunderung verdienen. Die venezianischen Behörden regelten z.B. in kürzester Zeit Massenbestattungen, die Beseitigung von Tierkadavern, die Isolierung der Kranken und führten eine Art Meldepflicht in den Städten ein (wenn auch die Quarantäne selbst erst 1374 in Reggio d’Emilia bzw. 1377 in Ragusa nachweisbar ist[26]). Man bemerkte 1348 auch, daß Gerber seltener erkrankten als Bäcker, was wohl tatsächlich auf desinfizierende Gerbstoffe zurückzuführen war.[27] Tommaso del Garbo, ein berühmter Arzt aus Bologna, riet, die Fenster der Krankenzimmer stets weit geöffnet zu halten, da frische Luft der Pest schade, was in gewissem Sinn der Lehrmeinung widersprach.[28] Priester und Notare sollten Todgeweihten niemals in der stickigen Luft des Krankenzimmers gegenübertreten.[29] Doch waren solche Ansätze empirischen Denkens angesichts der unangreifbaren Autorität antiker und arabischer Autoren zur Zeit des Schwarzen Todes noch die Ausnahme.
6. Pestregimina und Pestconsilia
Tommaso del Garbo war Verfasser eines Pestconsilium, einer neuen Art von Fachliteratur, die 1348 in Europa aufkam und eng mit den Pestregimina verwandt war. Bei den Regimina handelte es sich um diätetische Anweisungen für Ärzte und Laien. Beide Literaturformen vermischten sich. Vorbilder der Pestconsilia waren Rechtsconsilia, die in Italien bereits im 13. Jahrhundert nachweisbar sind und das geschriebene Gesetz im praktischen Gerichtsalltag ergänzten.[1] Die Verfasser von Consilia beschrieben Kasuistiken. Ursache und Verlauf der Pest wurden humoralpathologisch erklärt, wobei eigene Erfahrungen mit der unbekannten Seuche berücksichtigt wurden. Tommaso del Garbo beriet auch Ärzte, Notare, Priester, Familienangehörige sowie sonstige Besucher der Erkrankten. Konform mit Galen empfahl er als Schutz gegen die Ansteckung in Wein getauchtes Brot sowie die berühmten Panazeen Theriak und Mithridat,[2] ferner Gewürznelken, deren Duft seiner Erfahrung nach Desinfektionswirkung besaß. Pragmatisch erscheint folgender Rat an die Priester, welche Sterbenden die Beichte abnehmen mußten: Jedermann sollte aus dem Zimmer gehen, damit der Kranke nicht flüstern mußte, sondern laut reden konnte und der Beichtvater sich ihm nicht zu nähern brauchte. Hatte der Besucher das Krankenzimmer verlassen, sollte er Mund und Hände mit Essig und Wein reinigen. Auch Süßigkeiten, in frischem, kaltem Wasser aufbewahrt, mit anregenden Substanzen wie Melisse, Ochsenzungenblüten und «sehr gutem» Zucker versetzt, galten als wirksam. Wer Theriak prophylaktisch einnahm, mußte täglich mindestens die Menge einer Haselnuß davon essen.[3]
Im Pestconsilium des Giovanni Dondi finden sich diätetische und therapeutische Ratschläge. Der Leibarzt des Bischofs von Mailand[4] empfiehlt den Aderlaß selbst am Kopf des Kranken, um das infektiöse Blut im Körper zu reduzieren. Die Waschung des Gesichts und der Hände mit Rosenwasser und Essig erscheint selbstverständlich. Trübe und neblige Luft sollte vermieden werden, ebenso der Südwind. Dondi empfiehlt, sich frühmorgens durch ein gutriechendes Feuer, z.B. von Eichen, Eschen-, Oliven- oder Myrthenholz, einzuräuchern. Werfe man dabei Balsam, Weihrauch oder Sandelholz in die Flammen, verstärke sich deren desinfizierende Wirkung. Alle Speisen waren mit stark duftenden Substanzen zu durchsetzen. Fleisch von Hammeln, Kälbern, Ziegen, Rebhühnern, Fasanen und Hühnern erschien unbedenklich, Fisch dagegen gefährlich. Wein und Bier wurden ausdrücklich empfohlen, süße Früchte wie Birnen, die leicht faulig werden, abgelehnt. Fast alle Ratschläge erklären sich durch die humoralpathologische Pesttheorie.[5] Frauen, geschweige denn «jeder unehrenhafte Verkehr» waren zu meiden und überhaupt alles, was die gefürchtete «Überhitzung» des Körpers hervorrief. Ferner sollte man tagsüber nicht schlafen, sich nie der Sonne aussetzen, weder in heißen noch feuchten Gegenden wohnen und Bäder fliehen. Auch für Dondi, letztlich als Uhrenkonstrukteur erfolgreicher denn als Pestarzt,[6] stellte die rechtzeitige Flucht das beste Prophylaktikum dar.
Ein Anonymus aus Padua (Pestschriften erschienen zunächst fast ausschließlich in Italien!) betont um 1360 in seinem Consilium, daß vorbeugende Maßnahmen sich sowohl nach der Jahreszeit wie nach geographischen Gegebenheiten zu richten hätten. Wichtig erscheint es dem astrologisch versierten Autor, die Arzneien zum richtigen Zeitpunkt einzunehmen bzw. notwendige Maßnahmen rechtzeitig zu ergreifen: Droht die Pest im Frühjahr, ist die Flucht empfehlenswert, um der miasmenreichen Sommerhitze zu entgehen. Wer keine Fluchtmöglichkeit hat, sollte Haus und Umgebung regelmäßig räuchern, zudem aber in seiner Wohnung die Miasmen durch Rosen, Veilchen und «alles, was gut riecht» bekämpfen. Kommt der Pesthauch – wie nach Erdbeben – aus Erdspalten oder aus Tümpeln mit abgestandenem Wasser, sind Räume im Erdgeschoß zu meiden. Entstammt er dagegen höheren Luftschichten, hat man sich gegenteilig zu verhalten. Bewegung gilt grundsätzlich als schädlich, da man vermehrt den miasmenreichen Pesthauch einatmet. Nur leichte Massagen sollten den Kreislauf anregen. «Was seelische Belastungen angeht, sei man heiter und fröhlich», lautet eine weitere Maxime des Anonymus. Wichtig ist auch eine geordnete Verdauung und Ausscheidung, da im Körper gestaute Ausscheidungsstoffe zur Fäulnis neigen.[7] Auch dieses Werk läßt sich nur in Kenntnis der mittelalterlichen Pesttheorie verstehen.
Das schon erwähnte Consilium des Gentile da Foligno, das älteste erhaltene überhaupt, war an die Ärzteschaft von Genua gerichtet. Kühn erscheint die Empfehlung, in Wohnräumen hohe Flammen zu entfachen. Jede Speise sollte in Wein getränkt werden. Bei warmen Mahlzeiten muß Kampher, bei kalten Mooskraut als Geruchsstoff verwendet werden. Saure Speisen galten als optimale Nahrung («Es besteht nämlich kein Zweifel, daß Angesäuertes die Fäulnis hemmt»). Theriak, Aderlaß und die Isolierung der Erkrankten bildeten seit Gentile Grundlagen der Pesttherapie.[8]
Natürlich wurden auch Außenseitermethoden angepriesen. Dionysus Secundus Colle, ein Arzt aus Friaul, empfahl seinen Mitbürgern zur Prophylaxe und Therapie ein Naturheilmittel, das Nießwurz, Pfirsichblüten, Tausendgüldenkraut und Bärlapp mit Zucker und Honigsaft enthielt. Der Landarzt pries auch die Wirkung von Holundersaft und Wolfsmilchpflanzen, die in Ziegenmilch gelöst wurden. Zudem beschwor er die miasmenhemmende Wirkung aromatischer Substanzen. Man solle deshalb Lorbeer- und Wacholderbeeren, besser noch Rinden von Lärchen, Pinien und Tannen im Mund tragen.[9] Im übrigen bestätigte auch Boccaccio in seinem Bericht über die Florentiner Pest, daß die Seuche eine Hochkonjunktur für Außenseiter und Quacksalber bedeutete, die «nie studiert hatten».[10]
Die Consilia und Regimina stellten Wegweiser der «ersten Stunde» dar, die nach 1348 in ganz Europa emsig kopiert wurden. Die Mediziner bemühten sich verzweifelt, ihre von vielen angezweifelte Fachkenntnis unter Beweis zu stellen. Prüfen wir die vorgeschlagenen prophylaktischen und therapeutischen Maßnahmen kritisch, war allerdings nur die Fluchtempfehlung sinnvoll. Zwar meiden Flöhe (wie viele andere Insekten) tatsächlich bestimmte Geruchsstoffe und wohl auch die Hitze des Feuers, doch hätten entsprechende Empfehlungen (die zweifellos auf sehr allgemeinen, jahrhundertealten Seuchenerfahrungen beruhten) eine floride Pest auf engstem Raum, geschweige denn die Lungenpest niemals aufhalten können. Effektiver war dagegen eine andere Maßnahme: Unzählige harmlosere Epidemien hatten bereits vor dem Schwarzen Tod die Isolierung aller nahegelegt, die an unbekannten Krankheiten litten. Daß dies auch bei der Pest sinnvoll war, bemerkte man schon nach wenigen Tagen. Mehr konnte in der vormikroskopischen und vorantibiotischen Ära nicht in Erfahrung gebracht werden. Man darf zudem nicht übersehen, daß die Humoralpathologie – bei allen praktischen Mängeln – in sich ein durchaus schlüssiges Gedankengebäude darstellte, das viele Krankheitsursachen und -symptome mühelos zu erklären schien.[11]