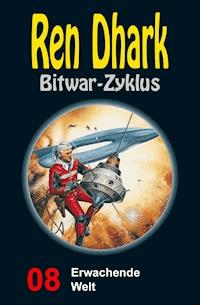2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Unheimlicher Roman: Ein schrecklicher Fluch droht aus der Tiefe eines Sees im schottischen Hochland. Eine übersinnlich begabte junge Frau gerät an die Grenzen der Wirklichkeit und begegnet dem Grauen. Alfred Bekker schrieb diesen Roman als "Leslie Garber".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Der See des Unheils
Cassiopeiapress Romantic Thriller
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenDer See des Unheils
Unheimlicher Roman von Alfred Bekker
© by Alfred Bekker
© 2014 der Digitalausgabe by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich (Westf.)
www.AlfredBekker.de
Der Umfang dieses Ebook entspricht 100 Taschenbuchseiten.
Unheimlicher Roman Ein schrecklicher Fluch droht aus der Tiefe eines Sees im schottischen Hochland. Eine übersinnlich begabte junge Frau gerät an die Grenzen der Wirklichkeit und begegnet dem Grauen. Alfred Bekker schrieb diesen Roman als "Leslie Garber".
1
Es war eine kalte, stürmische Nacht. Das Wasser des Sees war aufgewühlt, und die sieben kleinen Ruderboote, die sich in dieser schrecklichen Nacht hinaus auf das Wasser gewagt hatten, schwankten bedenklich.
Finstere Gestalten in dunklen Mönchskutten saßen an den Rudern. Die Kapuzen hingen ihnen tief in den Gesichtern.
Man hätte sie für Mönche halten können.
Wäre da nicht ein winziges Detail gewesen, das sie von gewöhnlichen Mönchen unterschied.
Um den Hals trugen sie umgedrehte Kreuze aus Holz. Das Zeichen Satans und der Mächte der Finsternis.
Nur eine Person war anders gekleidet. Es war eine junge Frau mit vom Wind zerzausten dunklen Haaren. Sie trug ein rotes Kleid, an dem der Wind heftig zerrte. Sie zitterte leicht vor Kälte. Ihr Blick wirkte beinahe wie in Trance. Sie schien in die Ferne zu sehen.
Ins Nichts.
Der Wind pfiff den Ruderern um die Ohren und riss an ihren schweren Kutten. Der Anführer stand ruhig im Bug eines der etwas schwerfälligen Boote. Die Schwankungen schienen ihm nichts auszumachen. Er stand da und sein Blick wanderte über den Horizont.
Dies war Loch Maree, ein uralter See im Norden Schottlands.
Umgeben von Bergen, die sich jetzt wie düstere Schatten abhoben.
Ein tiefer See...
Und diese Tiefe mochte seit Äonen die Heimat von Kreaturen sein, die den Menschen unter normalen Umständen mieden.
Schrecklichen Geschöpfen der Finsternis...
"Wir sind weit genug!", schrie der Anführer dann plötzlich mit rauer, kehliger Stimme. "Bildet einen Kreis mit den Booten!" Er hatte Mühe, den Wind zu übertönen und versuchte, sich zusätzlich mit Handzeichen verständlich zu machen.
Das war nicht schwer, denn sie alle wussten, worum es hier ging und was nun zu geschehen hatte.
Die Erfüllung einer alten Weissagung...
Sie hatten wegen des rauen Seegangs große Schwierigkeiten, die Boote einigermaßen in Kreisform zu bringen und sie dann dort auch zu halten. Wie Nussschalen schaukelten sie, Spielbälle in der Gewalt der Natur...
Die falschen Mönche erhoben sich. Sie standen schwankend auf ihren Booten und breiteten die Arme aus. Dann begannen sie mit einem Singsang in einer uralten, längst vergessenen Sprache. Raue, kehlige Laute waren es, die über ihre Lippen kamen. Ein Beschwörungsritus.
Ein Singsang entstand. Und der Anführer wandte sich an die Frau im roten Kleid. Diese hatte sich ebenfalls erhoben. Sie sah den Anführer an.
"Jetzt ist der Augenblick, auf den es ankommt", sagte der Anführer und schlug seine Kapuze zurück. Ein scharf geschnittenes, von dunklem Haar umrahmtes Gesicht kam zum Vorschein. Der schwarze Bart gab ihm etwas Düsteres. Sein Blick fixierte die Frau. "Jahrhunderte mussten vergehen, ehe das möglich wurde, was wir jetzt tun", murmelte er dann.
"Ich weiß, Hugh", erwiderte die Frau, aber der tosende Wind verschluckte das Meiste ihrer Worte.
"Mara!", sagte Hugh dann geradezu beschwörend. "Es kommt jetzt auch auf dich an."
"Ja."
"Du bist das Medium, Mara."
"Ich weiß."
Ihre Sprache war seltsam schleppend, wie unter Hypnose.
In Hughs Augen blitzte es.
"Lass uns beginnen, Mara. Ehe der Zeitpunkt verstrichen ist, an dem diese Beschwörung möglich ist."
Sie stand neben ihm und schloss die Augen. Hugh presste seine Daumen gegen die Schläfen und Maras zarte Züge sahen nun aus wie unter einer schier übermenschlichen Anstrengung.
Hugh murmelte einige Worte. Worte in jener vergessenen Sprache, die auch die anderen bei ihrem Singsang benutzten und deren wahre Bedeutung keinem von ihnen bekannt war.
Der Singsang schwoll an, vermischte sich mit dem Rauschen der Wellen und dem Heulen des Windes.
"Wir rufen dich, o Siebenarmiger!", rief Hugh dann und die anderen. "Erscheine du uns, der du seit 777 Jahren verbannt warst... Erscheine!"
Eine Wolke schob sich in diesem Moment vor den fahl vom Himmel scheinenden Mond. Einen Augenblick lang wurde es nahezu stockdunkel.
Dann begann es aus der Tiefe des Sees heraus zu leuchten.
Erst war es nur ein matter Schimmer, doch rasch wurde das Leuchten intensiver. Im Wasser bildete sich ein Strudel und das leuchtende Etwas tauchte bis an die Oberfläche. Mit einem ohrenbetäubenden und selbst die Geräusche des wütenden Windes übertönenden Zischen sprang eine Kaskade von Lichtfunken aus dem Wasser heraus.
Hughs Augen waren schmal geworden. Er schützte sich mit der Hand vor der Helligkeit und sah fasziniert auf das, was nun geschah. Mitten im Wasser hatte sich ein Tunnel aus Licht gebildet. Eine Öffnung, die weit hinab in die unergründliche Tiefe des Loch Maree führte. Etwas Dunkles stieg daraus hervor. Ein formloser Schatten, der nach wenigen Augenblicken das Licht überdeckte.
Dann war da nur noch Dunkelheit.
Hugh blickte angestrengt in das Wasser.
Irgendetwas schwamm dort, reckte dunkle Arme aus dem Wasser und bewegte sich seitwärts. Für den Bruchteil einer Sekunde glaubte Hugh ein Paar katzenhaft blitzende Augen zu sehen.
"Siebenarmiger! Wir sind es, die dich gerufen haben!", rief Hugh mit vibrierender, brüchiger Stimme. Mara hatte indessen noch immer die Augen geschlossen. Ein beinahe wimmerndes Stöhnen entrang sich ihren Lippen.
Hugh flüsterte besorgt ihren Namen.
Das finstere, schattenhafte Wesen, das durch den Lichttunnel aus der Tiefe heraufgekommen war, bewegte sich auf Hughs Boot zu.
Im nächsten Moment fasste eine dunkle, monströse Pranke nach einem der Ruder.
Hugh stockte der Atem.
Eine Hand mit sieben Fingern!
Er schluckte. Dann erschien auf seinem Gesicht für einen kurzen Moment ein triumphierendes Lächeln, das jedoch schon im nächsten Augenblick einen Ausdruck des Schreckens wich.
Das Wesen zog sich zurück. Die Hand ließ das Ruderblatt los.
Ein katzenhaftes Augenpaar starrte Hugh noch einen Moment lang an, dann tauchte das unheimliche Wesen unter und verschwand in den Tiefen des Loch Maree.
"Was ist geschehen?", fragte Mara indessen.
Sie hatte die Augen geöffnet.
Hugh blickte hinab in das dunkle Wasser, in dem sich nun für einen kurzen Moment das fahle Mondlicht spiegelte.
"Er ist weg!", flüsterte er. Furcht war aus seinen Worten herauszuhören.
Der Singsang der anderen war längst verstummt. Sie starrten ihren Anführer an und schienen ziemlich ratlos zu sein.
Dann deutete plötzlich einer von ihnen zum Ufer und rief: "Seht, dort!"
Sie wandten die Blicke und sahen, wie eine unheimliche Gestalt den Fluten des Loch Maree entstieg und sich als dunkler Schatten gegen steinigen Strand abhob. Als das Mondlicht wieder einmal für Augenblicke zwischen den Wolken hindurchschien und den Unheimlichen in sein kaltes Licht tauchte, ging ein Raunen durch die Kuttenträger auf den Booten.
Sie schauderten, als sie einen Moment lang die Gestalt erkennen konnten.
Sieben Arme!, durchfuhr es Hugh. Er hat wirklich sieben Arme, so wie die Legenden es berichten...
2
Es war schon ziemlich spät und ich hatte einen ziemlich harten Tag in der Redaktion des London City Observers hinter mir, jener großen Boulevardzeitung, bei der ich seit einiger Zeit als Reporterin arbeitete.
Eigentlich hätte ich längst zu Hause sein wollen.
Aber wie so oft war im letzten Moment etwas dazwischengekommen. Irgendeine aktuelle Meldung hatte noch kurz vor Redaktionsschluss ins Blatt hineingemusst und so hatte ich meinen Artikel noch einmal umschreiben und kürzen müssen. Die Fotos, die mein Kollege Jim Barry gemacht hatte, wurden um die Hälfte verkleinert, dann war Platz genug.
Solche Überraschungen liebe ich nicht gerade.
Aber als Journalistin muss man wohl oder übel damit leben.
Schließlich richtet sich das Weltgeschehen nicht nach den Redaktionszeiten des London City Observers. Und irgendwo auf der Welt ist immer etwas los, das wichtig genug ist, um auf die Seiten unseres Blattes zu kommen.
Ich seufzte, atmete dann tief durch und strich mir eine Strähne aus dem Gesicht, die sich irgendwann aus meiner Frisur herausgestohlen hatte und mir seitdem ständig in die Augen fiel.
Ich schloss die Augen.
Einen Moment lang Kraft schöpfen, dachte ich. Ich war so gut wie fertig mit meiner Arbeit. Wenn nicht noch irgendetwas dazwischenkam.
"Einen Kaffee?", fragte eine Stimme.
Ich riss die Augen auf und blickte in das zwar unrasierte, aber dafür sympathische Gesicht meines Kollegen Jim Barry.
Jim war im selben Alter wie ich und Fotograf. Wir arbeiteten oft zusammen und bildeten dann ein hervorragendes Team.
Ich hob erstaunt die Augenbrauen und musterte Jim etwas verwundert. Seine äußere Erscheinung mit den etwas zu langen blonden Haaren, der verwaschenen, museeumsreifen Jeans, die er sich in mühevoller Handarbeit selbst immer wieder geflickt hatte und dem abgetragenen Jackett passten zu seiner unkonventionellen Art.
Der Kragen seines Jacketts war von den Riemen seiner Kamera derart ruiniert, dass man es wohl nie wieder in seine ursprüngliche Form bringen konnte. Das Jackett hatte Fischgrätmuster und sein Hemd war kariert.
Aber über Geschmack lässt sich ja bekanntlich nicht streiten und wahrscheinlich hinkte Jim der aktuellen Herrenmode derart weit hinterher, dass er ihr fast schon wieder voraus war.
Wenn man lange genug wartete, wurde eben alles irgendwann einmal wieder modern.
Er hielt zwei Pappbecher mit dampfendem schwarzen Kaffee in den Händen und reichte mir einen davon.
"So etwas nenne ich Gedankenübertragung", meinte ich.
Er lachte.
"Genau das richtige jetzt, was?"
"Kann man wohl sagen." Ich nippte an meinem Becher und verbrannte mir beinahe die Lippen dabei. Immerhin war der Kaffee stark genug, um nach diesem Tag wieder ein paar Lebensgeister in mir zu wecken.
Jim setzte sich halb auf meinen Schreibtisch und ich befürchtete schon, dass er mir irgendwelche wichtigen Unterlagen zu Boden riss. Aber das passierte zum Glück nicht.
Er sah mich mit blitzenden Augen an.
Himmelblau waren sie.
"Tja, du nimmst meine Fähigkeiten als Gedankenleser viel zu selten in Anspruch, Jessica", flachste er. Er hob die Augenbrauen.
"Wer weiß?", sagte ich. "Vielleicht komme ich darauf zurück."
"Das lässt mich hoffen! Soll ich dir sagen, was du dir im Moment am allersehnlichsten wünschst?"
"Also..."
"Ein Abendessen mit Londons Starfotograf Nummer eins!"
Ich sah ihn mit gespieltem Erstaunen an. "Wer ist das denn? Kenne ich ihn?"
"Kleiner Tipp: Er arbeitet für dieselbe Zeitung wie du, im selben Großraumbüro und wurde von dir immer schmählich übersehen!"
"Oh, Jim, du Ärmster!"
Wir lachten beide.
Aber ein Quäntchen Ernst steckte schon hinter dieser ausgelassenen Flachserei. Insgeheim war Jim nämlich immer ein bisschen verliebt in mich gewesen, was ich allerdings nie erwidert hatte. Seine etwas jungenhafte, unkomplizierte und oftmals witzige Art machten aus ihm einen angenehmen Kollegen. Und die Tatsache, dass wir schon so manche heikle Situation zusammen überstanden hatten, schweißte uns natürlich zusammen. Als Freunde allerdings nur. Ein Paar würde aus uns nicht werden. Den Mann meiner Träume stellte ich mir einfach anders vor.
Jim wusste, wie ich darüber dachte.
Und im Grunde akzeptierte er das auch.
Allerdings unternahm er immer wieder mal einen Versuch, mich davon zu überzeugen, dass ich es war, die sich irrte.
"Ich bin gleich fertig hier", sagte ich, nachdem ich die Hälfte des Kaffees aufgetrunken hatte. "Und dann geht es nach Hause. Ein heißes Bad und..."
"Nichts da!", sagte Jim. "Nach all dem Spaß kommt jetzt die schlechte Nachricht, die ich dir bringen muss."
Ich sah ihn an.
"Was für eine schlechte Nachricht?"
"Naja, ob sie wirklich schlecht weiß ich natürlich noch nicht..."
"Nun sag schon, worum geht es!"
Er wollte mich noch ein bisschen auf die Folter spannen. Das sah ich seinem schelmischen Gesicht deutlich an.
"Ich sage nur: Rone", meine er dann.
Rone - der Name unseres manchmal etwas bärbeißigen Chefredakteurs, chronisch überarbeitet und nichts so sehr hassend wie schlechte Artikel, die ihn zur Weißglut treiben konnten.
"Wir sollen zum Chef?", vergewisserte ich mich. "Jetzt noch?"
Jim schüttelte den Kopf. "Nicht sofort. Er hat gerade noch den Verleger bei sich im Büro..."
3
"Ich muss Sie loben", begrüßte Martin T. Rone mich zu meiner Überraschung, als wir sein Büro betraten. Er hatte sich aus seinem Drehsessel erhoben und umrundete den überquellenden Schreibtisch.
Rone war ein breitschultriger, etwas untersetzter Mann. Er konnte manchmal aufbrausend sein, aber im Grunde war er ein netter Kerl. Auch wenn er das oft wirkungsvoll zu verstecken wusste.
Ich sah ihn erstaunt an.
"Wovon sprechen Sie, Mr. Rone?"
"Na, von ihrem letzten Artikel. Sehr gut geschrieben und sauber recherchiert. Das nenne ich gute Arbeit!"
Ich glaubte schon beinahe, mich verhört zu haben. Denn überschwängliches Lob gehörte eigentlich nicht zu den Dingen, die für Rone typisch waren. Er hatte sehr strenge Maßstäbe.
Schließlich war es sein erklärtes Ziel, den London City Observer dort zu halten, wo er Rones Meinung nach hingehörte: ganz oben.
Jim schloss die Tür und verschränkte die Arme vor der Brust. Ich sah kurz zu ihm hinüber und konnte ihm die Gedanken förmlich an den Falten auf seiner Stirn ablesen.
Worum geht es hier wirklich?, schien dort geschrieben zu stehen.
"Haben Sie beide heute Abend irgendetwas vor?", fragte Rone dann und fuhr ohne eine Antwort abzuwarten fort: "Gut, Sie haben Zeit..."
"Dachte ich mir doch, dass ich nicht nur deswegen hier bin, damit Sie mir sagen können, wie toll mein Artikel ist", seufzte ich.
Rone nickte.
"So ist es."
"Worum geht es?"