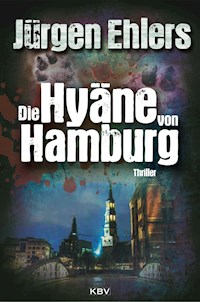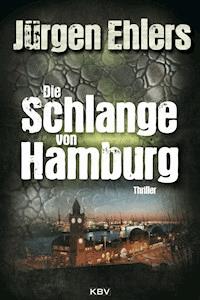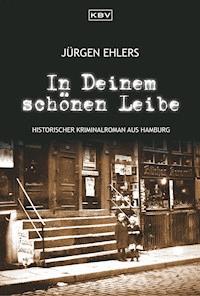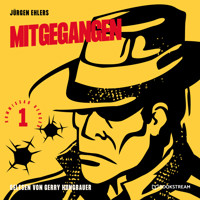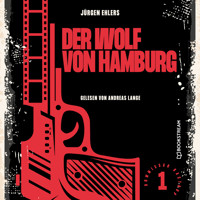Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
England 1745. Der ehrgeizige William Augustus, der Lieblingssohn des Königs, übernimmt das Oberkommando der englischen Armee; sein Freund Jan Veenstra, der deutschstämmige Sohn seines Lehrers, wird Hauslehrer beim Laird von Dunvegan auf der Insel Skye in Schottland. Aber er hat einen zusätzlichen Auftrag: Er soll als Agent der Regierung verdächtige Aktivitäten der schottischen Opposition nach London melden. Jan ist froh, den Intrigen am Hof entronnen zu sein. Er ahnt nicht, dass sein Auftrag selbst Teil einer Intrige ist. Der ehrgeizige William Augustus will seinem Bruder die Thronfolge streitig machen. Und dabei stört Jan Veenstra; er weiß zu viel über ihn. Auf Homosexualität steht die Todesstrafe, und das gilt auch für Prinzen. In Schottland scheint Jan zwar vorerst unter Kontrolle, aber noch besser wäre es, wenn er für immer verschwände. Als der Sohn des katholischen Thronanwärters, Charles Edward Stuart, mit nur sieben Getreuen an der schottischen Westküste landet, um das Vereinigte Königreich für seinen Vater zurückzuerobern, und als Jan in das Geschehen eingreift, ergibt sich eine Gelegenheit, das Problem endgültig zu lösen. William Augustus fasst einen teuflischen Plan...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 516
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jürgen Ehlers
Der Spion von Dunvegan Castle
Bisher vom Autor bei KBV erschienen:
»Mann über Bord«
»Mitgegangen«
»Neben dem Gleis«
»Die Nacht von Barmbeck«
»In Deinem schönen Leibe«
Jürgen Ehlers wurde 1948 in Hamburg geboren, lebt heute mit seiner Familie auf dem Land und arbeitet hauptberuflich im Geologischen Landesamt Hamburg. Seit 1992 schreibt er Kurzkrimis, die in verschiedenen Verlagen im In- und Ausland veröffentlicht wurden, und ist Herausgeber von Krimianthologien. Er ist Mitglied im »Syndikat« und in der »Crime Writers’ Association«.
Sein erster Kriminalroman »Mitgegangen« wurde in der Sparte Debüt für den Friedrich-Glauser-Preis nominert.
Jürgen Ehlers
Der SpionvonDunveganCastle
Originalausgabe
© 2012 KBV Verlags- und Mediengesellschaft mbH, Hillesheim
www.kbv-verlag.de
E-Mail: [email protected]
Telefon: 0 65 93 - 998 96-0
Fax: 0 65 93 - 998 96-20
Umschlaggestaltung: Ralf Kramp
Redaktion: Volker Maria Neumann, Köln
Druck: Aalexx Buchproduktion GmbH, Großburgwedel
Printed in Germany
Print-ISBN 978-3-942446-41-9
E-Book-ISBN 978-3-95441-104-7
Die Personen
Historische Personen sind durch ein * gekennzeichnet.
PERSONEN AUF DER INSEL SKYE
Jan Veenstra
Am englischen Königshof aufgewachsen. Freund des Duke of Cumberland, Sohn seines Lehrers. 1721 geboren, zu Beginn der Handlung ist er 23 Jahre alt.
Laird Normand MacLeod of Dunvegan*
Der Chief des Clans MacLeod, Abgeordneter für Inverness-shire, Witwer, steht auf der Seite der Regierung.
Janet MacLeod*
Seine verstorbene Frau.
Lucy MacLeod
Tochter Normand MacLeods, Jans Schülerin auf Dunvegan. Zu Beginn der Handlung ist sie 17 Jahre alt.
John MacLeod*
Sein Sohn, Leutnant in der englischen Armee, der Erbe, kommt im Buch kaum vor.
Robert MacLeod
Sein jüngerer Bruder, wird mit Jan Veenstra verwechselt.
Lord Alexander MacDonald of Sleat*
Der gutmütige, leicht zu beeinflussende Chief des Clans MacDonald. Freund Normand MacLeods.
Margaret MacDonald*
Seine Frau.
Kingsburgh*
Lord Alexanders rechte Hand.
Doktor Bruce Peacock
Er hilft Jan aus einer schwierigen Situation. Aber ist er ein Freund?
Pastor Thomas Seaford
Seine Qualitäten lernt der Leser erst im Laufe der Handlung kennen.
Roy MacLeod
Ehrlich, mutig. Ein guter Freund. Jan betrügt ihn und rettet ihm das Leben.
Ceana MacLeod
Eine schöne, junge Frau, die an Elfen glaubt.
DIE REGIERUNGSTREUEN
König George II.*
Dumm, unberechenbar, jähzornig.
Amalie Sophie Marianne von Wallmoden, Countess of Yarmouth*
Eine seiner Mätressen.
Frederick (Friedrich Ludwig), Prince of Wales*
Der älteste Sohn, Thronfolger, vom Vater gehasst.
Augusta von Sachsen-Gotha*
Seine zwölf Jahre jüngere Gemahlin. Zu Beginn der Handlung haben die beiden sechs Kinder.
William Augustus, Duke of Cumberland*
Der ehrgeizige Lieblingssohn des Königs. Aus gutem Grund ist und bleibt er ledig.
George Hamilton
Mehr als ein Freund Cumberlands.
Captain John Fergusson*
Kommandant der Sloop Furnace, terrorisiert seine Landsleute.
Marshall George Wade*, General John Cope*, General Henry Hawley*, John Campbell, 4th Earl of Loudoun*, George Munro*
Weitere Militärs im Dienste der englischen Regierung.
Sir Everard Fawkener*
Cumberlands Sekretär.
Thomas Pelham-Holles, Duke of Newcastle*
Ein erfolgreicher Politiker, absolut skrupellos.
Andrew Stone*
Newcastles Sekretär.
Duncan Forbes*
Oberster Richter Schottlands, Junggeselle, Weintrinker. Steht unbeirrt auf der Seite der Regierung.
Friedrich Händel*
Der Komponist. Steht auf der Seite des Königs und als Glück bringendes Denkmal im Vergnügungspark.
DIE REBELLEN
James Francis Edward Stuart*
Sohn des abgesetzten englischen Königs James II. Der »König jenseits des Meeres« ist als Katholik von der englischen Thronfolge ausgeschlossen. Da er in Rom bleibt, bleibt er auch von der Handlung ausgeschlossen.
Prinz Charles Edward Stuart*
Sein Sohn, will mit Frankreichs und Spaniens Hilfe die Krone für das Haus Stuart zurückerobern.
Laird John Dubh MacKinnon*
Alter Schmuggler und Rebell. Ihm gehört der südliche Teil der Insel Skye.
Laird Malcolm MacLeod of Brea in Raasay*
Ihm gehört die kleine Nachbarinsel von Skye, die von Fergusson verwüstet wird.
George Murray*, Donald Cameron of Lochiel*, Lord Arthur Balmerino*, Lord David Elcho*, Ranald MacDonald of Clanranald*
Anführer der Rebellen
Simon Fraser (Lord Lovat)*
Ein durchtriebener Fiesling, hält sich aus allem heraus.
Alan MacLeod (MacGregor)
Hasst die MacLeods.
Sowohl die Schreibweise der Personen als auch der Ortsnamen ist in den Quellen nicht einheitlich. Ich habe mich bemüht, die authentischen Namen zu verwenden (Normand statt Norman MacLeod, Kingsburgh statt Kingsborough). Bei den Orten habe ich die heute auf den Landkarten verwendete englische Schreibweise bevorzugt (Elgol statt Elagol, Raasay statt Raasa). Das Schiff, auf dem Prinz Charles Edward Stuart nach Schottland kam, hieß Du Teillay und nicht La Doutelle, wie in älteren Quellen angegeben.
Hund oder Bulle?
Chigwell bei London, England, Mai 1744
1.
Der Platz vor der Gastwirtschaft war in weitem Rund mit einem provisorischen Zaun abgesperrt, und hinter der Barriere drängten sich jetzt ein paar hundert Menschen. Jan und sein Begleiter waren rechtzeitig gekommen, sie standen in der ersten Reihe. William Augustus, der junge Duke of Cumberland, sah sich um. Die Zuschauer, zumeist Männer, aber auch Frauen und Kinder, schienen überwiegend den ärmeren Bevölkerungsschichten anzugehören. Niemand dabei, der ihn kannte. Gut. Niemand brauchte von diesem Treffen mit Jan und von diesem Gespräch zu wissen.
»Wie hast du von dieser … dieser Darbietung erfahren?«, fragte Jan.
William lachte. »In meiner Position ist es entscheidend, gut informiert zu sein.« Bull Baiting gab es natürlich auch in London, in Hockley-in-the-Hole zum Beispiel, aber nach der Schlacht von Dettingen hatte William zu oft im Mittelpunkt gestanden. Er konnte sich nicht mehr sicher sein, ob man ihn dort nicht erkennen würde. »Übrigens solltest du lieber Englisch sprechen«, sagte er, »sonst fallen wir auf.«
Jan nickte. »Bull Baiting«, sagte er. »Eine Art Stierkampf also. Bis jetzt hatte ich gedacht, so etwas gäbe es nur in Spanien.«
Wie naiv Jan doch war, dachte Cumberland. Sie hatten sich gemeinsam einige Male aus der behüteten Welt des Hofes entfernt, aber zu den wilderen Unternehmungen, Preiskämpfen etwa, bei denen halbnackte Frauen mit dem Messer aufeinander losgingen, hatte er Jan lieber nicht mitgenommen. Er sagte: »Stierkampf gibt es auch hier in England. Aber es ist kein gewöhnlicher Stierkampf, bei dem ein strahlender Held mit gezücktem Degen das arme Tier niedermetzelt, sondern es ist ein Kampf Tier gegen Tier. Sie hetzen Hunde auf den Stier.«
Daher also das Gebell. Jan sah sich um. Jemand ging mit einem Eimer herum und sammelte Geld ein.
»Was wird das?«, fragte Jan.
»Du kannst wetten.«
»Wetten?«
»Ja, natürlich. Das ist doch der Sinn des Ganzen. Du musst dich entscheiden: Glaubst du, dass am Ende der Stier am Boden liegt, oder dass er sich die Hunde vom Leib halten kann?«
Gerade wurde der Stier in den Ring geführt. Ein großer, mächtiger Bulle; er sah wild und gefährlich aus.
»Bull or dogs?«, fragte der Mann mit dem Eimer.
»Bull.« Jan setzte einen Shilling auf den Stier.
»Sehr wohl mein Herr, einen Shilling auf den Stier, so geht es, meine Herrschaften, sehen Sie her, so geht es!« Der Mann verbeugte sich in gespielter Ehrfurcht.
William lachte. Jan wurde rot. Ihm war klar, dass er zu viel gesetzt hatte. William setzte Sixpence auf die Hunde.
»Jetzt glaubt keiner mehr, dass du ein kleiner Handwerker bist.«
»Es tut mir wirklich leid …«
»Unwichtig. Sie dürfen nicht wissen, wer ich bin. Du kannst dich hier ruhig sehen lassen. Es ist ja im Prinzip eine respektable Veranstaltung. Ich habe selbst Lords schon bei solchen Wettkämpfen gesehen, und die haben sich nicht im Mindesten geschämt. Aber in meiner Position ist es nicht ratsam.«
»Nein.« Jan fragte sich, was den Duke of Cumberland so sehr reizte, dass er dennoch gekommen war.
Der Stier stand in der Mitte der Arena. Sein Besitzer hielt ihn an einem Strick, damit er sich nicht auf das Publikum stürzen konnte, das ihn aus sicherer Entfernung verhöhnte. Von rechts wurden jetzt die Hunde hereingeführt. Kräftige Kampfhunde, die an ihren Leinen zerrten. Die Unterhaltung erstarb.
»Es geht los!«, raunte William.
Jan nickte. Einer der Hunde – Jan konnte nicht mit Sicherheit sagen, ob er sich losgerissen hatte oder von seinem Besitzer in den Ring geschickt worden war – raste in wildem Eifer auf den Stier zu. Der versuchte, das Tier auf die Hörner zu nehmen. Der Hund wich aus, sprang den Stier an. Der schüttelte ihn ab, und bevor der Hund sich wieder aufrappeln konnte, hatte der Stier ihn erwischt und ihm mit dem linken Horn die Seite aufgeschlitzt. Das tödlich verletzte Tier jaulte und wälzte sich am Boden. Der Stier stieß noch einmal zu.
»Sieht nicht schlecht aus für dich!«, rief William.
Da wurden die anderen Hunde freigelassen. Sie stürzten sich auf den Bullen, bissen zu, wo sie ihn packen konnten, in die Flanken, in die Hörner. Der Stier schüttelte sie ab.
»Ich bin mit dir hierhergekommen«, sagte William, »weil wir hier ungestört miteinander reden können. Und wir müssen miteinander reden. Du bist dreiundzwanzig Jahre alt, genau wie ich. Aber während für mich völlig klar ist, wie mein weiteres Leben verlaufen wird, ist für dich nichts geklärt. Ich bin der Duke of Cumberland, und ich bin erwachsen. Ich brauche keinen Lehrer mehr.«
Jan nickte. Das wusste er alles.
»Aber was willst du machen? Du hast überhaupt keine Funktion am Hofe. Du bist ja nur der Sohn meines Lehrers, meines verstorbenen Lehrers, um genau zu sein.«
»Du brauchst dir um mich keine Sorgen zu machen«, sagte Jan. »Ich werde schon durchkommen!«
»Ich mache mir aber Sorgen. Du bist mein Freund. Ich will nicht, dass du nur gerade so durchkommst. Ich will, dass du eine gute Position bekommst, einen Posten, der deinen Fähigkeiten entspricht …«
In diesem Moment brüllte der Stier vor Wut und Schmerz auf; einer der Hunde hatte sich in seiner Flanke festgebissen. Die Menge tobte. Einige feuerten den Stier an, der wie wahnsinnig umhersprang und mit den Hufen ausschlug, während die meisten dem Hund zuriefen, auf keinen Fall loszulassen.
Jan riss sich von dem brutalen Schauspiel los. »Ich könnte als Lehrer arbeiten«, sagte er.
»Ja, das könntest du. Das habe ich auch schon gedacht. Und zufällig habe ich erfahren, dass einer unserer schottischen Freunde, ein gewisser Normand MacLeod, einen Lehrer für seine Tochter sucht.«
Ein neuer Aufschrei. Der Bulle hatte sich auf den Boden geworfen und den Hund unter sich begraben. Sein Besitzer drängte sich durch die Menge und versuchte, die Dogge unter dem rasenden Stier herauszuziehen.
»Fair Play! Fair Play!«, forderte die Menge.
Doch wie der Mann sich auch mühte, es gelang ihm nicht, die Beine des Hundes zu packen; er bekam selbst einen Huftritt vom Bullen und hinkte zur Seite. Der Hund regte sich nicht mehr.
Jan schüttelte den Kopf. »Ich weiß nicht. Mit kleinen Mädchen kann ich überhaupt nicht gut umgehen.«
William lachte. »So klein ist sie gar nicht mehr. Siebzehn Jahre. Du wirst ihr nicht die Windeln wechseln müssen.«
»Edinburgh«, sagte Jan zweifelnd. Was wusste er von Schottland? Er hatte Schwierigkeiten, sich auf das Gespräch zu konzentrieren, das sein künftiges Leben entscheiden sollte, während gleichzeitig vor ihm ein Kampf auf Leben und Tod tobte. Der Bulle hatte sich erhoben, stand wieder da wie zu Beginn, den Kopf leicht gesenkt, und wartete auf den nächsten Angriff. Der Hund, der es als Nächster versuchte, ein massiges, schwarz-weiß geflecktes Tier, war nicht schnell genug. Der Bulle schleuderte ihn hoch in die Luft, dass er vor Schmerz jaulte. Er landete mitten zwischen den Zuschauern, rappelte sich auf und rannte wieder nach vorn.
William ließ keinen Blick von dem Schauspiel. Er schüttelte den Kopf. »Nicht Edinburgh. Du hast mir doch immer erzählt, dass die großen Städte dir nicht gefallen. Nun, da habe ich genau das Richtige für dich gefunden. Dunvegan auf der Insel Skye.«
»Skye?«
»Ja, das ist eine dieser westlichen Inseln. Gehört alles zum schottischen Hochland. Wild und romantisch …«
Der Hund flog ein zweites Mal durch die Luft; eine Frau kreischte auf, als ihr der blutige Köter ins Gesicht klatschte. Sie ging zu Boden. Wütend rappelte sie sich wieder auf und rieb sich die Wange. Die Umstehenden lachten. Der Hund rührte sich nicht mehr.
»Aber der gute Laird ist vollkommen zivilisiert, genau wie wir. Er sitzt als Abgeordneter für Inverness-shire im Unterhaus. Er hat für Walpole gestimmt, bis zuletzt. Ich bin sicher, dass du hervorragend mit ihm auskommen wirst. Wenn er denn da ist. Die meiste Zeit hält er sich in London auf.«
Jan sah seinen Freund an.
»Du denkst natürlich an das Geld …«
Jan schüttelte den Kopf. Er hatte überhaupt nicht an Geld gedacht.
Erneut wurden mehrere Hunde losgelassen. Wieder versuchte der Bulle die Angreifer abzuschütteln, doch jetzt hatte sich das Blatt zu seinem Nachteil gewendet. Einem der Hunde gelang es, sich in seiner Nase festzubeißen und ihn zu Boden zu zwingen. Der Stier brüllte, schüttelte sich und schlug mit den Hufen aus, doch es half nichts. Mehr und mehr Hunde schafften es, sich in ihn zu verbeißen.
»Dein Shilling ist verloren«, sagte William ungerührt. »Was nun deine schottischen Einkünfte angeht, so kann ich dir versichern, dass der Laird dir genauso viel zahlt wie ein Privatlehrer hier in London erhalten würde. Und du bist Teil des Haushalts, wohnst im Schloss, isst mit der Familie, sodass dir keine weiteren Unkosten entstehen.«
Jan sah sich in einem düsteren schottischen Schloss salziges Porridge essen. Jetzt waren die Hundebesitzer um den schwer verletzten Bullen versammelt und mühten sich, die Tiere zu trennen. Einige waren dabei, den Bullen festzuhalten, während andere darangingen, die Kiefer der Hunde mit Knüppeln auseinander zu zwingen.
»Jetzt weißt du, warum man sie Bulldoggen nennt! – Du kannst also sehr viel Geld sparen. Zwei, drei Jahre, und du besitzt ein kleines Vermögen. Und das ist noch nicht alles. Ich habe außerdem dafür gesorgt, dass du ein zweites Gehalt in gleicher Höhe erhalten wirst.«
»Ein zweites Gehalt?«
»Ja. Deswegen dieses Treffen hier draußen, wo uns niemand zuhören kann. Du weißt, dass Schottland ein – sagen wir einmal schwieriger Teil des Vereinigten Königreichs ist. Wir können uns hier in London nie ganz sicher sein, ob und wie weit wir den Schotten trauen dürfen. Der Geist der Papisten spukt noch immer in den Bergen herum, und jetzt … Vorsicht!«
Der Bulle hatte mit einem verzweifelten Ruck die Männer abgeschüttelt, die ihn halten sollten. Es zeigte sich nun, dass er keineswegs kampfunfähig war. Er schüttelte sich, sah die Männer mit ihren Hunden am Rande des Rings und raste los. Es schien Jan, dass er genau auf ihn zustürmte. Die Zuschauer schrien auf und versuchten, sich in Sicherheit zu bringen. Links und rechts von ihnen stürzten Menschen übereinander. Kinder kreischten. Der Bulle kam näher, sie waren verloren! Verzweifelt warf sich Jan zu Boden. Jetzt war das Tier heran. Ein trockener Knall, und der Bulle – der Bulle kam nicht. Zögernd richtete Jan sich auf.
»Das war knapp«, sagte William. Gelassen steckte er die Pistole wieder ein.
»Er hat ihn erschossen!«, rief jemand. Er zeigte mit dem Finger auf William. »Der Mann da, der hat den Bullen erschossen!«
»Keine Aufregung!«, sagte William. Und zu Jan: »Kein Aufsehen. Gib ihm Geld. Zahl, was er verlangt.«
»Er hat meinen Bullen erschossen!«
»Tut mir leid«, sagte Jan. »Aber es war notwendig. Wie hoch ist der Schaden?«
Die Umstehenden, die schon darauf gehofft hatten, anstelle des abgekürzten Bull Baitings nun eine handfeste Schlägerei zu erleben, verloren ihr Interesse. »Wo bleibt der Affe?«, riefen sie. »Wann kommt endlich der Affe?«
Der Hund, der als Erster in den Ring gerast war, war noch immer nicht tot, sondern schleppte sich mit heraushängenden Eingeweiden über den Platz.
»Wo waren wir stehen geblieben?«, fragte William. »Ach ja. Da wir uns im Krieg mit den katholischen Mächten des Kontinents befinden, könnte es nur allzu leicht passieren, dass jemand auf den Gedanken kommt, die Situation zu unserem Nachteil auszunutzen. Und da ist Schottland nun einmal der schwächste Punkt.«
»Du rechnest mit einem Aufstand?«
»Eigentlich nicht. Aber ich weiß, dass das Haus Stuart im Norden bis heute über zahlreiche Anhänger verfügt. Und ich weiß aus sicherer Quelle, dass es noch immer Kontakte zu dem falschen Prinzen auf dem Kontinent gibt.«
»Dem Alten Thronanwärter? Der muss doch inzwischen steinalt sein!«
»Ich meine den Jungen Thronanwärter, wenn du in dieser Terminologie bleiben willst. Meinen Cousin. Aber Charles Edward Stuart ist natürlich kein rechtmäßiger Anwärter auf den englischen Thron, sondern ein Schwindler. Ein Hochstapler. Die Thronfolge ist klar geregelt. Per Gesetz. Act of Settlement, 1701, wenn du dich erinnerst. Und darin steht, dass kein Katholik König von England werden kann. Eine klare Sache. – Dennoch ist natürlich nicht auszuschließen, dass mein Cousin versucht, mit französischer Hilfe unser Königshaus zu stürzen und die Macht an sich zu reißen.«
»Und was soll ich dabei tun?«
»Die Augen offen halten. Du bist unser Mann im schottischen Hochland. Du sprichst mit den Leuten, hörst dich um und schreibst uns alles, was dir auffällt.«
Jan schüttelte den Kopf. »Zum Spion bin ich nicht geeignet.« Er hielt inne.
Ein Pferd wurde in den Ring geführt; auf seinem Rücken saß ein Affe. Der Affe war mit grotesk buntem Zeug gekleidet wie ein zu klein geratener Mensch, und er war auf dem Rücken des Pferdes festgebunden, sodass er nicht herunter konnte. Jan ahnte, dass jetzt der Höhepunkt der Veranstaltung bevorstand, und er war sich sicher, dass er ihm nicht gefallen würde.
»Wir brauchen einen absolut ehrlichen Menschen für diese Aufgabe.«
Jan sagte: »Das geht nicht. Das kann doch gar nicht gehen. Wenn ich von Schottland aus einen Brief an den Herzog von Cumberland schicke, dann sieht doch jeder sofort …«
»Du wirst es so machen, dass es nicht jeder sofort merkt. Und ich bin sowieso außen vor. Ich bin die nächste Zeit bei meinen Truppen in Flandern. Du musst dich mit Lord Tweeddale auseinandersetzen. Er ist der für Schottland zuständige Minister.«
»Das tue ich nicht. Du weißt genau, dass ich nicht lügen kann.«
Cumberland schwieg einen Augenblick. Er hatte seinen Plan mit dem Duke of Newcastle diskutiert. Der hatte aus dem Fenster gesehen, so als ob ihn das alles nichts anginge, und ganz beiläufig bemerkt, eine dauerhafte Lösung sei wahrscheinlich sicherer. Eine dauerhafte Lösung! Nein, das kam nicht infrage. Er sagte: »Tweeddale kann auch nicht lügen. Er ist einer der ehrenwertesten Politiker, die ich kenne.« Und einer der ahnungslosesten, hätte er hinzufügen können. In Wahrheit lief alles Wesentliche über den Duke of Newcastle.
Jan antwortete nicht.
»Ich bitte dich, Jan, es geht um alles, was uns wert und teuer ist. Wenn die Jakobiten wieder an die Macht kommen, werden sie alle Freiheiten abschaffen, die dieses Land in den letzten Jahrzehnten mühsam erkämpft hat. England ist eine Demokratie, das modernste Land der Erde, ein Hort der Aufklärung …«
Die Hunde wurden losgelassen. Die Menge raste vor Begeisterung. Der Affe zappelte und schrie wie ein Mensch in höchster Todesangst. Er versuchte vergeblich, sich loszureißen, während das Rudel mörderischer Hunde unter ihm sich daran machte, das Pferd zu Fall zu bringen und zu zerfleischen.
Die Vorführung war vorüber, jetzt drängten sich die Menschen vor dem Eingang der Kneipe. Der Wirt machte ein glänzendes Geschäft. Auch William war in die Gastwirtschaft verschwunden. Er kam mit zwei Krügen Bier zurück. Sie setzten sich in den Schatten
»Ich hätte dir das Bier ausgeben müssen. Du hast uns das Leben gerettet«, sagte Jan.
William winkte ab. »Nicht der Rede wert.«
»Was für ein verteufelt guter Schuss, mit einer Pistole einen heranstürmenden Stier zu erlegen!«
»Du musst nur gut zielen, das ist alles.«
Ja, William war äußerst kaltblütig, wenn es darauf ankam, daran bestand kein Zweifel.
»Dieses Bull Baiting – was für ein grausames Schauspiel«, sagte Jan.
»Ja, furchtbar. Königin Elisabeth hat schon vor gut 150 Jahren versucht, diesen Sport verbieten zu lassen, aber sie ist damit nicht durchgekommen.«
»Sport nennst du das? Tiere quälen und töten!«
»Du musst nicht gleich jedes Wort auf die Goldwaage legen«, sagte der Duke. »Und bei näherer Betrachtung wirst du zugeben müssen, dass dieses Bull Baiting zunächst einmal das Leben des Stieres verlängert.«
»Verlängert?« Jan starrte ihn an.
»Ja, natürlich. Die Tiere werden doch gewöhnlich gezüchtet, um geschlachtet und verzehrt zu werden. Und den größten Gewinn erzielst du, wenn du das machst, sobald das Tier ausgewachsen ist. Aber dieser Bulle, den wir gerade gesehen haben, der war weit über seine Schlachtreife hinaus. Und selbst heute wäre er nicht gestorben, wenn ich ihn nicht erschossen hätte.«
»Die Hunde hätten ihn zerfetzt.«
»Nein, das hätten sie nicht getan. Das ist nicht der Sinn der Sache. Sie hätten ihn bezwungen, aber vermutlich nicht getötet. In ein bis zwei Wochen wären seine Wunden verheilt, und er hätte wieder im Ring gestanden.«
»Selbst wenn der Stier, wie du sagst, auf diese Weise sein Leben verlängert hätte – was für ein Leben wäre das gewesen? Ein Leben voll höllischer Schmerzen, und das womöglich Woche für Woche. Da ist es schon besser für ihn, wenn er tot ist!«
»Das sagst du, weil du nicht in seiner Lage bist. Ich glaube, dass das Rindvieh in diesem Punkt genauso denkt wie ein Mensch. Und wie ein Mensch denkt, ist klar. Ich habe in Dettingen bei unserem Angriff Dutzende auf die grausamste Weise verletzte und verstümmelte Franzosen gesehen, aber keiner hat mich um den Coup de Grace gebeten. Sie wollten alle am Leben bleiben. Als Invaliden, als Krüppel, ganz egal. Leben. Um jeden Preis.«
Jan schwieg. Dettingen – er wollte nicht mehr daran denken. Und dies hier, das war eine unglaubliche und völlig unnötige Grausamkeit, die verboten gehörte.
William sah ihn spöttisch an: »Es ist interessant zu sehen, dass du dich ausschließlich für das Schicksal des armen Stieres interessierst. Die getöteten Hunde bedeuten dir nichts?«
»Keines dieser Tiere sollte sterben!«, rief Jan. Aber es war wahr, er hatte in erster Linie Mitleid mit dem Opfer, dem Bullen gehabt, dabei waren in Wahrheit beide Opfer, Stier und Hunde.
»Diese Hunde, mein Freund, würden gar nicht erst leben, wenn es kein Bull Baiting gäbe. Sie werden eigens für diesen Zweck gezüchtet. Dabei haben die Tiere eigentlich gar nichts gegeneinander, und zum Teil schlafen sogar Stiere und Doggen friedlich nebeneinander im selben Stall, bis es dann schließlich zum Kampf kommt. Die Menschen sind es, die sie aufeinander hetzen.
Jan nickte.
»Und damit kommen wir zum interessantesten Punkt des ganzen Spektakels, zu den Menschen. Das ist der Aspekt, der mich am meisten reizt. Du hast sie gesehen. Hunderte von Leuten. Alles Christen, alles aufgeklärte Menschen unseres Jahrhunderts. Du hast gehört, wie sie gejohlt und geschrien haben. Besonders als der Affe seinen großen Auftritt hatte.«
»Das war barbarisch.«
»Ja, das war barbarisch. Die Menschen sind Barbaren, Jan. Alle Menschen. Und es gibt nur eines, was sie noch stärker erfreut hätte: wenn statt des Affen ein Mensch auf diesem Gaul gesessen hätte und wenn er am Ende tatsächlich zerrissen worden wäre.«
»Das kann ich nicht glauben«, sagte Jan mechanisch.
William lächelte. Es wurde Zeit, dass sie nach London zurückfuhren. »Wir sehen uns heute Abend bei Ranelagh«, sagte er.
2.
Das Gebäude sah aus wie eine riesige, reich dekorierte Hutschachtel. Berühmte Künstler hatten es gemalt, mehrfach sogar, nicht weil es so schön war, sondern weil es wichtig war. Die Kapelle spielte; keine Tanzmusik natürlich; zu Ranelagh ging man nicht, um zu tanzen, sondern um Leute zu treffen. Dennoch schien die Stimmung fröhlicher als sonst. Viele waren direkt von der Siegesfeier hierher gegangen. Der Platz des Königs war noch leer; er würde erst später kommen, aber Jan sah Lord Carteret und den Duke of Newcastle, die sich angeregt unterhielten. Whigs waren sie beide, und doch politische Gegner. So hieß es zumindest. Ein Glück, dass Jan sich um Politik nicht zu kümmern brauchte. Cumberland war auch schon da; ein anderer junger Mann redete auf ihn ein.
»Unsinn«, sagte William Augustus gerade. »Die paar Pfund kann ich dir auch nächste Woche noch geben. Und merk dir eines: Wenn du etwa versuchen solltest … Ah, Jan! Gut, dass du kommst! George, darf ich euch miteinander bekannt machen? Das ist Jan Veenstra.«
»Hamilton, angenehm«, murmelte der Mann. »Übrigens, wenn du Lust hast … Ich habe gehört, dass am Wochenende wieder in Hockley …«
Jan starrte den Mann an. Woher kannte er ihn? Er war sich sicher, ihn schon irgendwo gesehen zu haben.
Cumberland unterbrach ihn. »Nein, George, tut mir leid: Ich werde nicht mit dir nach Hockley-in-the-Hole gehen. Ich habe Besseres vor. – Entschuldige mich bitte!«
»Oh! – Ja, dann …« George Hamilton wandte sich ab.
Und jetzt fiel es Jan ein. Ganz kurz nur hatte er ihn gesehen, ihn und William Augustus, dann hatte er die Tür rasch wieder zugemacht.
»Einige Leute sind wirklich hartnäckig! Und dieser Hamilton … Manchmal ist er ja ganz witzig, aber wenn man längere Zeit mit ihm zusammen ist, kann er einem ganz schön auf die Nerven gehen.« William Augustus lachte. Dabei warf er Jan einen forschenden Blick zu. Hatte sein Freund den Mann wiedererkannt? Möglich. Aber war das noch wichtig? »Hast du dich entschieden?«, fragte er beiläufig.
Jan nickte. »Ja, ich werde die Stelle annehmen.«
Das war gut. »Übrigens: Das Konzert vorhin war großartig«, sagte er.
Das Dettinger Te Deum. Händel hatte es geschrieben, zum Ruhme des Königs. Die Uraufführung hatte Jan verpasst. Eine gewaltige Musik für eine prächtige Siegesfeier. Und für William Augustus war es zugleich ein letzter kultureller Höhepunkt vor dem Abschied von London.
»Einfach grandios«, sagte er. »Schade, dass du nicht mit dabei sein konntest. Glanz und Gloria. Die Aufführung hätte auch der Königin gefallen!«
Jan nickte. Caroline, die Mutter seines Freundes, war vor sechs Jahren gestorben. Jan sah hinüber zum Tisch des Königs. Der hatte inzwischen seinen Platz eingenommen. Da saß er nun, ihr oberster Herr, im Kreise seiner Höflinge. George der Zweite, von Gottes Gnaden König von Großbritannien, Frankreich und Irland, Verteidiger des Glaubens – so lautete sein offizieller Titel. Dabei besaß er kein Stück von Frankreich, außer den Kanalinseln. Er galt als launisch und jähzornig, aber Jan gegenüber hatte er dies nie gezeigt. Trotz seiner niedrigen Stellung hatte er als Sohn des Lehrers immer irgendwie mit zum Haushalt gehört.
Bis zur Schlacht von Dettingen jedenfalls. Jans Arm schmerzte noch immer. Fünf Monate war es jetzt her. Es war ein komplizierter Bruch gewesen, aber natürlich hatten die Feldscher im Lazarett Wichtigeres zu tun gehabt, als sich groß um den lächerlichen Armbruch eines Zivilisten zu kümmern. Dettingen. Ein mörderisches Gemetzel. Siebentausend Tote und Verwundete hatte es gegeben. Die Pragmatische Armee, ein bunt zusammengewürfelter Haufen aus Engländern, Holländern und Deutschen, hatte gesiegt, der König hatte gesiegt, und William Augustus hatte gesiegt, auch wenn er einen Schuss ins Bein abbekommen hatte. Jan hatte allerdings nicht gesiegt, sondern verloren. Sein Vater war zu Beginn der Schlacht beim Umsturz ihres Wagens umgekommen, und er selbst hatte damit seine Position und Stellung am Hofe eingebüßt. Jetzt war er nur noch der Sohn des toten Lehrers, er wurde nicht mehr gebraucht. Aber er konnte nicht klagen. Viele waren schlechter dran als er.
»Was macht dein Bein?«, fragte er.
»Danke, es geht schon.«
»Du wirkst bedrückt«, fand Jan.
»Nein, das täuscht«, log Cumberland. Selbst wenn das Problem mit Jan gelöst schien, blieb noch genug Ärger. Auch Hamilton musste natürlich weg. Der vor allem. Aber was ihm am meisten Sorge bereitete, war das Problem mit der Thronfolge. Die Unterredung mit seinem Vater gleich nach dem Konzert war wieder einmal ergebnislos geblieben. Lob natürlich, aber das kannte er schon, das waren nur Floskeln. Da war er nun der Lieblingssohn des Königs von England, aber es half alles nichts; mochte der Vater seinen Bruder noch so sehr schmähen und verachten, Frederick war der Erstgeborene, vierzehn Jahre älter als William Augustus, und es gab eigentlich keinen Zweifel: Frederick würde der nächste König von England sein.
Eine Zeitlang hatten König und Königin geglaubt, Frederick sei nicht nur lebensuntüchtig, sondern obendrein auch zeugungsunfähig. War nicht der Sohn seiner Mätresse in Wahrheit das Kind von Lord Hervey, ihrem vorherigen Liebhaber? Als der kleine George geboren wurde, hatten sie angenommen, auch dieses Kind sei nur untergeschoben. Caroline hatte wieder den schönen Lord Hervey in Verdacht gehabt. Aber das Kind war nicht untergeschoben. Vom ersten Augenblick an war William Augustus klar gewesen, dass das Baby keineswegs Herveys Schönheit geerbt hatte, sondern vielmehr aussah wie die kleine Ausgabe von George II., seinem Großvater. Und damit war William von Platz Zwei in der Thronfolge auf Platz Drei gerückt, denn geerbt wurde zunächst einmal in gerader Linie.
Aber damit nicht genug. Frederick und seine Gemahlin hatten Kind auf Kind gezeugt, und inzwischen war William auf Platz Sieben zurückgefallen. Dabei war er der bessere Führer. Er hatte sein Können in Dettingen unter Beweis gestellt, und obwohl er einer der jüngsten Offiziere war, hatten die älteren, erfahreneren Kollegen seine Fähigkeiten neidlos anerkennen müssen. Oder vielleicht auch neidvoll, das war ihm egal.
Für ihn, William Augustus, gab es nur einen Weg. Er musste auf militärischem Gebiet glänzen. Das beherrschte er, das war für England von ungeheurer Wichtigkeit, und auf dem Gebiet konnte ihm Frederick nicht das Wasser reichen. Wenn es ihm gelänge, als Heerführer den Krieg gegen Frankreich siegreich zu beenden, würde England geradezu gezwungen sein, ihm entsprechende Anerkennung zu zollen. Und für einen solchen Sieg gab es nur einen angemessenen Lohn: die Thronfolge.
Jan sah Willian Augustus an: »Du träumst!«
»Ja, in der Tat, ich habe einen Moment lang geträumt. – Wie lange kennen wir uns nun? Zwölf Jahre? Oder dreizehn? Und dies ist nun der Abschied. Komm, lass uns etwas trinken.«
3.
›Ein wesentlicher Grund dafür, dass der Mensch so wenig über sich weiß, besteht darin, dass die meisten Schriftsteller der Menschheit nur sagen, wie sie sein sollte, und wenig Geist darauf verschwenden, ihr zu zeigen, wie sie wirklich ist. Ich glaube, dass der Mensch (außer aus Haut, Fleisch, Knochen und derartigen Dingen) sich aus einem Gefüge verschiedener Begierden zusammensetzt, von denen jede einzelne die Oberhand gewinnen und sein Handeln bestimmen kann, ob er will oder nicht. Zu zeigen, dass diese Eigenschaften, von denen wir alle vorgeben, uns ihrer zu schämen, in Wahrheit die Grundlage unserer blühenden Gesellschaft darstellen, das ist mein Anliegen …‹
»Ich weiß nicht, ob du ausgerechnet dieses Buch lesen solltest!«, sagte MacPherson.
Jan erschrak. Er hatte den Buchhändler nicht kommen hören. »Ich will es mir nicht kaufen«, sagte er. »Ich habe davon gehört, und ich wollte sehen, wie es ist.«
»Die Bienenfabel. – Ich vermute, es ist einer deiner Freunde vom Königshof, der davon gesprochen hat?«
Jan nickte. William Augustus hatte das Buch erwähnt.
»Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Sie alle entrüsten sich über dieses Buch, und doch leben sie genauso, wie es de Mandeville beschreibt.«
»Sie kennen sich aus«, sagte Jan.
»Am Hofe? Nein, nicht so richtig. Nur was die Bücher angeht, da habe ich einen gewissen Überblick. Das bleibt nicht aus, wenn man königlicher Hofbuchhändler ist. Davon leben kann man freilich nicht.« Er lachte. »Was führt dich zu mir?«
»Ich bin gekommen, um mich zu verabschieden.«
»Oh.«
Der Abschied tat Jan weh. Wenn ihn etwas in London fasziniert hatte, dann waren es die grenzenlosen Möglichkeiten, sich zu bilden. Bücher ohne Ende. Nicht dass er sich viele davon kaufen konnte, aber die Möglichkeit, sie anzusehen, darin zu blättern und zu lesen. Schon als Kind hatte er viele Stunden im Buchladen zugebracht. MacPherson wusste, dass er die Bücher nicht beschädigte. Er hatte ihn darin blättern lassen, so viel er wollte.
»Ich werde als Lehrer nach Schottland gehen«, sagte Jan.
»Nach Schottland? – Das ist gut, wir brauchen Lehrer in Schottland.«
Wir hatte er gesagt. Jan wurde bewusst, dass MacPherson ja Schotte war. Einer von vielen Schotten in London. »Ich gehe nach Skye, nach Dunvegan.«
»Nach Dunvegan? Zu Normand MacLeod? Dem Abgeordneten? Den kenne ich, der kauft seine Bücher auch bei mir. – Und du gehst, um die Tochter zu unterrichten, nehme ich an. Die Söhne sind ja schon erwachsen und wohnen nicht mehr zu Hause. Aber die Kleine … Wie hieß sie doch noch gleich?«
»Lucinda«, sagte Jan.
»Richtig, Lucy.«
»Ich hoffe, dass ich es kann«, sagte er. »Ich meine – ich habe ja keine richtige Ausbildung. Und es steht nicht fest, dass der Sohn des Lehrers auch wieder ein guter Lehrer wird.«
»Ich bin überzeugt, dass du es kannst«, sagte MacPherson. »Und … ach, entschuldige mich einen Augenblick!«
Zwei Männer waren in den Laden gekommen. Der eine hatte offenbar eine Liste von Büchern mitgebracht, die er MacPherson vorlegte. Der andere sah einen Augenblick lang zu, wie der Buchhändler daran ging, die entsprechenden Bände zu holen; dann ging er in den hinteren Teil des Ladens und sah sich um.
Jan stellte die Bienenfabel zurück in das Regal. Der Mann stand jetzt plötzlich neben ihm, räusperte sich. Jan blickte auf.
»Herr Veenstra?«, fragte der Mann mit leiser Stimme.
Jan nickte. Den Mann kannte er nicht. Er hatte den Minister erwartet.
»Schöne Grüße von Tweeddale«, sagte der Mann. »Er konnte nicht kommen. Ich bin sein Bote.« Er überreichte Jan einen Umschlag.
»Danke.« Jan wollte das Kuvert aufreißen, aber der Mann hielt ihn zurück. »Nicht hier, nicht jetzt.«
Jan steckte den Umschlag ein. Der Mann wandte sich wortlos ab, so als habe diese Begegnung niemals stattgefunden. So sah es also aus, wenn man als Spion arbeitete, dachte Jan. Er hatte nicht geglaubt, dass schon hier in London große Heimlichkeit vonnöten sein könnte. Der Minister Tweeddale war ein sehr umgänglicher Mann; Jan hatte sich mit ihm über Literatur unterhalten. Dieser Bote dagegen mit seinem groben Gesicht wirkte geradezu furchteinflößend.
Der Mann war zu seinem Kollegen zurückgekehrt, und die beiden sahen zu, wie MacPherson Verlagsverzeichnisse studierte. Offenbar waren nicht alle gewünschten Bücher vorrätig. Jan zog sich hinter ein Regal zurück, sodass man ihn vom Eingang nicht sehen konnte, und öffnete den Umschlag.
Er enthielt vierzig Pfund und ein Schriftstück, das die Buchung seiner Schiffspassage nach Leith bestätigte. Leith, das war der Hafen von Edinburgh. Jan sollte sich bis 18 Uhr an Bord einfinden. Heute bis 18 Uhr! Jan erschrak. Das ging nicht. Das hieß, das ginge schon, natürlich, er hatte ja nicht viel zu packen, er besaß ja fast nichts, aber … da musste er ja sofort los, konnte sich nicht einmal mehr von William Augustus verabschieden. Jan steckte den Brief ein, wollte den Mann ansprechen, nachfragen, doch die beiden Herren waren inzwischen verschwunden.
»Wer war das?«, fragte Jan den Buchhändler.
»Die beiden Männer? Der eine, der Finstere, das war Andrew Stone. Lord Newcastles rechte Hand sozusagen. Den anderen kannte ich nicht. Wieso fragst du?«
»Ach, nichts. Ich hatte gedacht …«
»Dass du ihn kennst? Unwahrscheinlich. Stone tritt öffentlich kaum in Erscheinung. Aber er liest viel.«
»Ein guter Kunde«, stellte Jan fest.
»Ach«, sagte MacPherson, »nette Kunden sind mir lieber!«
Jan wurde rot. Es war klar, dass der Buchhändler ihn damit meinte.
»Was nun die Bienenfabel angeht«, sagte er, »so bin ich nicht der Meinung des Autors. De Mandeville irrt, wenn er glaubt, die niederen Triebe brächten die Gesellschaft voran. Ich bin vielmehr überzeugt, dass die Bildung das Grundgerüst unserer modernen Gesellschaft ist. Noch nie haben die Menschen so viel gewusst wie heute. Noch nie ging es ihnen so gut.«
»Ja«, sagte Jan. Die vierzig Pfund fielen ihm ein, die er in der Tasche hatte. Er war jetzt ein reicher Mann.
4.
Thomas Pelham-Holles, der Duke of Newcastle, war der Bruder des Premierministers Henry Pelham. Während Henry vor allen Dingen um die Staatsfinanzen besorgt war, zog Newcastle im Kabinett die Fäden, und gemeinsam waren sie unschlagbar. Stone hatte ihm Bericht erstattet.
»Und der junge Mann reist tatsächlich noch heute ab?«, fragte Newcastle.
Stone nickte.
Das war gut. Er würde wenig Gelegenheit haben, irgendwelche Freunde und Bekannte in die Einzelheiten seiner Reisepläne einzuweihen. Per Schiff würde er mindestens zwei Wochen bis Edinburgh brauchen, von dort eine weitere Woche bis nach Inverness. Ein guter Reiter mit einem schnellen Pferd konnte dagegen die Strecke in der Hälfte der Zeit zurücklegen. Und Stone war ein guter Reiter. Er war auch ein guter Schütze, aber darauf wollte Newcastle lieber nicht zurückgreifen. Es durfte keine Spuren geben, keine Verbindung zur Regierung in London, keine Verbindung zur Krone.
»Sie haben Zeit genug, in Inverness einen oder besser zwei Männer anzuwerben, die sich mit modernen Jagdwaffen in den Hinterhalt legen. Das wird doch möglich sein, oder?«
»Für Geld tun Menschen alles.«
»Zahlen Sie nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Und alles, was Veenstra bei sich trägt, können Sie natürlich behalten.«
»Die Männer kennen Veenstra nicht«, gab Stone zu bedenken.
»Sie können ihn gar nicht verfehlen. Ein einzelner Reisender aus London – so etwas ist eine Rarität im schottischen Hochland.«
»Sehr wohl.«
Newcastle nickte. War es richtig, was er da tat? Ja, es war richtig so. Der Duke of Cumberland wäre zweifellos ein besserer Regent als Frederick, der Prince of Wales. Und Cumberland wusste das; er wollte König werden. Aber das war natürlich unmöglich, unter normalen Umständen. Zwar würde König George II. es begrüßen, sollte Cumberland seine Nachfolge antreten, aber er würde keinen Finger dafür rühren, dies auch tatsächlich durchzusetzen. George II. war nur an Dingen interessiert, die ihn selbst betrafen. Was nach seinem Tode geschehen mochte, war ihm völlig gleichgültig. Nein, Cumberland konnte nicht König werden. Aber Prinzregent anstelle des kleinen George III., für den Fall dass Frederick ausfiele, das wäre denkbar. Damit wäre er de facto König. Aber Frederick würde nur ausfallen, wenn er stürbe. Ob William Augustus sich darüber im Klaren war? Ob er sein Vorhaben bis zu diesem Ende durchgedacht hatte? Es reichte nicht aus, Jan Veenstra zu beseitigen, bei Weitem nicht, auch sein eigener Bruder würde aus dem Wege geräumt werden müssen. Hatte er das bedacht? Wäre er dazu fähig? Einer wie er, der schon Skrupel hatte, wenn es um den völlig unbedeutenden Veenstra ging?
Nun, das würde sich herausstellen. In Veenstras Fall war es leicht, Cumberland alle Sorgen abzunehmen.
»Ich werde mich um ihn kümmern«, hatte Newcastle gesagt, und Cumberland hatte ihn nur angesehen und nicht gefragt, was er damit meinte. Aber widersprochen hatte er ihm auch nicht.
5.
»Wenn man bedenkt, wie ungeheuer beschwerlich noch vor zehn Jahren die Reise von Edinburgh nach Inverness war, dann kann man nur sagen: Lob und Preis sei der Regierung des Vereinigten Königreiches!«
Jan nickte. Sie waren zu Fuß unterwegs auf einer der neuen Straßen, die Marshall Wade hatte anlegen lassen. Wenn auch der Zweck dieser Straßen in erster Linie militärisch sein mochte, so kamen sie doch auch dem Handel und Verkehr zugute.
Jan war per Schiff bis Edinburgh gereist. Er hatte gehofft, von dort eine weitere Passage bis nach Inverness zu bekommen, aber nach den erheblichen Verzögerungen auf dem ersten Teil der Seereise – das Schiff hatte eine Woche vor der Küste gelegen und auf ein Drehen des Windes gewartet, um in den Firth of Forth einlaufen zu können –, hatte er sich entschlossen, die Reise auf dem Landweg fortzusetzen. Ein Pferd schien ihm zu teuer; er hätte es in Inverness mit Verlust verkaufen müssen, und der Weg von dort aus nach Westen war, soweit er gehört hatte, ohnehin im Wesentlichen ein Fußweg. Außerdem war Jan noch nie geritten. So war er denn über Perth nach Norden gewandert, hatte am vierten Tag Dalwhinnie erreicht und sich danach den endlosen Anstieg zum Pass von Corrieyairack hinaufgequält. Er hatte sein Gepäck verflucht und den Regen, der nicht aufhören wollte. Kurz vor der Passhöhe hatte ihn dann der junge Kaufmann eingeholt.
Sie waren zusammen weitermarschiert, das Wetter hatte sich gebessert, genau wie Jans Laune, und nach einer unbequemen Nacht in einer engen und überfüllten Herberge in Fort Augustus waren sie jetzt auf dem Weg nach Inverness, der Hauptstadt des Nordens, die sie am Abend erreichen wollten.
»Schade, dass Marshall Wade diese Straßen nicht quer durch das ganze Land hat bauen lassen!«, sagte Jan.
Sein Begleiter sah ihn belustigt an. »Wozu?«, fragte er. »Jenseits vom Great Glen, auf der anderen Seite vom Loch Ness, da gibt es doch nur noch Berge und Wildnis.« Er nahm seine Brille ab, hauchte auf die Gläser und rieb sie mit einem Tuch blank.
Jan gestand, dass er genau dorthin wollte. »Ich gehe als Lehrer auf die Insel Skye.«
Der Kaufmann sah ihn mitleidig an. »Bist du dir sicher, dass es da überhaupt Schulen gibt?«
Nein, da war Jan sich nicht sicher. Aber dass er als Privatlehrer zum Laird of Dunvegan gehen würde, das wollte er dem Mann nicht auf die Nase binden.
Jan sah seinen Begleiter an. Wie konnte der Mann Kaufmann sein und mit so leichtem Gepäck reisen? »Ich habe dich noch gar nicht gefragt, womit du eigentlich handelst.«
»Mit Arznei.«
»Bist du also ein Apotheker?«, fragte Jan.
»Apotheker, Arzt – ich bin alles in einer Person. Wenn du irgendeine Krankheit hast, komm nur zu mir. Ich werde dir helfen. Und jetzt, wo ich dich kennen gelernt habe, mache ich es bei dir sogar zum Sonderpreis.«
»Nein, danke«, sagte Jan.
»Oder sogar umsonst!«
Jan versicherte, er sei völlig gesund.
»Schade. Du musst nämlich wissen, ich bin ein Spezialist für Augenkrankheiten. Ich kuriere alle Mängel der Augen. Menschen, die ihr Augenlicht vor Jahren verloren haben – von mir bekommen sie es zurück. Den grauen Star heile ich in zehn Minuten.«
»Glückwunsch«, sagte Jan knapp. Er verstand nicht viel von Medizin, aber so viel wusste er doch, dass der graue Star für gewöhnlich so leicht nicht zu besiegen war.
»Oder bei Unfruchtbarkeit.« Der Mann war nicht zu bremsen. »Auch da habe ich das rechte Mittel parat. Pillen, die ich extra vom Kontinent habe importieren lassen. Zwei davon eingenommen, nach dem Essen, das hilft auf jeden Fall. Die Schwangerschaft wird garantiert. Selbst ohne Beischlaf.«
Jan behauptete, dass er lieber auf die Schwangerschaft verzichten wollte als auf den Beischlaf.
6.
Die beiden Männer aus Inverness waren früh auf den Beinen. Der Wirt rieb sich den Schlaf aus den Augen. Gern hätte er weitergeschlafen, aber es ging um sein Geld. Die beiden Männer gefielen ihm nicht. Und sie hatten noch nicht bezahlt.
»Schönes Wetter«, sagte er, um irgendetwas zu sagen. »Ideal für die Reise.«
»Ihr habt noch einen weiteren Gast gehabt heute Nacht?« Derjenige, der Alan MacGregor hieß, wies auf den Schimmel, der neben ihren Gäulen stand.
Der Wirt nickte. »Schönes Tier«, sagte er.
»Ja.« Sie selbst hatten billige Gäule gemietet. Alan wusste, dass sie sich auf einen Wettritt mit Jan Veenstra nicht würden einlassen können. Aber das war auch nicht geplant.
»Kommt aus London«, sagte der Wirt. »Will auf die Inseln.«
»Auf die Inseln? Die Hebriden?«
»Skye, glaube ich.«
MacGregor nickte. Er hatte nur zur Sicherheit noch einmal nachgefragt. Kein Zweifel, es war ihr Mann. Sie hatten zu spät gemerkt, dass er schon unterwegs war. Zwei Tage lang waren sie ihm gefolgt; nun hatten sie ihn endlich eingeholt. Er hatte schon geschlafen, als sie am Vorabend in der Dämmerung hier in dem einsamen Gasthof eingetroffen waren. Und er schlief jetzt noch immer. Sie hatten ihn bisher nicht zu Gesicht bekommen.
»Was sind wir Ihnen schuldig?«, fragte Ben Gordon, der zweite der Männer.
Der Wirt nannte den Betrag. Nervös sah Alan zu, wie sein Begleiter umständlich die Münzen aus seinem Beutel fischte. Er hatte es eilig. Jeden Moment konnte Veenstra hier im Stall auftauchen. Wenn sich herausstellte, dass sie denselben Weg hatten, würde er vermutlich mit ihnen zusammen reiten wollen, und das würde alles viel schwieriger machen. Und eine zweite Chance würde es sowieso nicht geben. Am späten Nachmittag würde er in Glenelg eintreffen, und auf die Insel wollte Alan ihm auf keinen Fall folgen. Dort kannte man ihn zu gut.
»Wir wollen nur bis Glenelg«, sagte Ben überflüssigerweise, während er die Rechnung beglich. »Wir sind geschäftlich unterwegs.«
»Geschäftlich?«
»Ja. Getreide für die englische Garnison.«
»Bernera Barracks.« Der Wirt spuckte die Worte geradezu aus. »Geschäfte mit den Engländern!«
Ben zuckte mit den Schultern. »Geschäft ist Geschäft«, sagte er.
»Es wird Zeit, dass wir loskommen!«, mischte sich Alan MacGregor ein. Sie waren weiß Gott genug aufgefallen inzwischen.
»Viel Erfolg!«
»Den können wir brauchen. Wir hoffen, dass sich in Glenelg die Gelegenheit ergibt, ein bisschen auf die Jagd zu gehen«, sagte Ben.
»Auf die Jagd?« Der Wirt schien skeptisch.
»Ja, ich weiß«, sagte Ben rasch. »Schusswaffen sind eigentlich verboten. Aber wir haben ganz gute Beziehungen, und da gibt es schon mal Ausnahmen.«
Die beiden Männer saßen auf. Der Wirt sah ihnen nach, wie sie in Richtung Westen davonritten.
»Hier könnte es gehen«, sagte Alan.
Ben nickte. Sie waren fast eine Stunde geritten. Der Abstand zu dem Dorf, in dem sie übernachtet hatten, sollte jetzt groß genug sein. Sie waren auf dem Weg keiner Menschenseele begegnet. Hier befanden sie sich in offenem Gelände, hier hatten sie freies Schussfeld. Und es gab ein paar große Felsbrocken, hinter denen man sich verbergen konnte.
»Wohin mit den Pferden?«
Die Pferde waren zu groß, ließen sich nicht verstecken. Alan entschied sich dafür, die Tiere ein Stück weiter talabwärts anzupflocken. Sie nahmen ihre Waffen und gingen etwa hundert Yards zurück. Da lag der Stein, der ihnen Deckung bieten würde. Ausgezeichnet. Und Veenstra war noch immer nicht in Sicht. Ben hatte die ganze Zeit befürchtet, dass der junge Mann sie noch einholen könnte, immerhin hatte er das bessere Pferd. Aber das war nicht geschehen, offenbar schlief Veenstra lange, und nun saßen sie hier in der Einöde und lauerten ihm auf.
»Er ist ein Spion«, sagte Alan unvermittelt.
»Ja.« Ben registrierte, dass auch Alan Angst hatte. Nicht so sehr davor, dass der Anschlag misslingen könnte, sondern davor, auf einen Menschen zu schießen und ihn zu töten. Ben hatte noch nie auf einen Menschen geschossen. Aber Alan, der war Soldat gewesen, der hatte Erfahrung, dem sollte es eigentlich nichts ausmachen.
»Wir schießen auf das Herz«, sagte Alan. »Nicht auf den Kopf. Das Herz ist sicherer. Und aus dieser Entfernung kann gar nichts schiefgehen.«
»Nein.« Ben fragte sich, ob es nicht sicherer wäre, wenn zumindest einer von ihnen auf das Pferd schießen würde, damit der Mann nicht wegreiten konnte, falls sie ihn verfehlten. Aber natürlich würden sie ihn nicht verfehlen. Dennoch hätte Ben lieber auf das Pferd geschossen als auf den Menschen.
Die Sonne stand schon hoch am Himmel. »Jetzt könnte er eigentlich allmählich kommen!«, sagte Alan.
Ben nickte. Es gefiel ihm nicht, dass es so lange dauerte. Ja, natürlich war dies eine einsame Gegend, aber irgendwann würde ganz sicher irgendjemand vorbeikommen und sich darüber wundern, dass hier zwei Pferde standen, und wenn er sich dann weiter umsah, würde er die beiden Männer hinter dem Felsblock entdecken und sich noch viel mehr wundern. Zwei Männer mit Gewehren, und dass die auf der Jagd waren, das würde niemand glauben.
»Das Warten ist das Schlimmste«, sagte Alan. »So ist das immer. Wenn es dann wirklich zum Kampf kommt, dann hat man keine Zeit mehr zum Nachdenken, und du schießt und stichst zu, mit dem Bajonett, und du brüllst, und alles ist gut. Aber vorher, wenn nichts passiert, und wenn du dir ausmalst, was alles passieren könnte – das ist die Hölle.«
»Warum bist du eigentlich weg vom Militär?«
»Schlechte Bezahlung. Und schlechte Menschen. Die Soldaten, das sind einfach schlechte Menschen.«
Ben schwieg. Konnte es schlechtere Menschen geben als zwei für Geld gedungene Attentäter, die sich anschickten, aus dem Hinterhalt einen ahnungslosen Mann zu erschießen?
»Er ist ein Spion«, wiederholte Alan. Offenbar machte er sich dieselben Gedanken. »Und außerdem brauchen wir das Geld. Mein Gott, Ben, ich war noch nie so pleite wie jetzt, und wenn dieser Mann nicht gekommen wäre und uns diesen Auftrag gegeben hätte …«
Ja, pleite waren sie beide. Woran der Mann das wohl erkannt hatte? Vermutlich hatte er herumgefragt. Es war jedenfalls kein Geheimnis, dass Alan mit der Miete im Rückstand war. Erheblich im Rückstand.
»Was ist, wenn wir einfach vorbeischießen?«, fragte Ben plötzlich.
Alan schüttelte den Kopf. »Das geht nicht. Denk an das Geld. Die zweite Hälfte gibt es erst, wenn wir den Auftrag ausgeführt haben«, sagte er. »Und ich brauche den ganzen Betrag.«
Ben fragte sich, ob er nicht trotzdem vorbeischießen sollte. Es war solch ein friedlicher Frühsommermorgen. Das Tal lag in der Sonne. Ein paar weiße Wölkchen …
»Er kommt!«
Ben schrak auf. Ja, er kam. Aus ihrem Versteck beobachteten die beiden Männer, wie der Reiter langsam näher kam. Jan Veenstra schien viel Zeit zu haben. Das erleichterte ihre Aufgabe. Und gerade vor ihrem Versteck machte der Weg eine kleine Biegung, sodass der Reiter ein Stück weit direkt auf sie zukommen musste. Sie konnten ihn nicht verfehlen.
Alan murmelte vor sich hin: »Jan Veenstra, du verdammter französischer Spion, jetzt haben wir dich, jetzt haben wir dich!«
Ben fragte sich, ob der Mann wirklich ein Spion war, oder ob ihr Auftraggeber das nur behauptet hatte.
Der Reiter hatte jetzt die Biegung erreicht. Er hielt an, sah nach vorn. Offenbar hatte er ihre Pferde entdeckt. Jetzt, dachte Ben. Jetzt war der richtige Moment. Er sah Alan an. Der hatte bereits auf den Reiter angelegt. Ben tat es ihm nach. Nun setzte der Reiter sich wieder in Bewegung. Er verließ den Weg, schnitt die Kurve ab, bewegte sich jetzt quer zu ihnen, aber alles in gemächlichem Tempo.
»Jetzt!«, rief Alan.
Sie schossen fast gleichzeitig. Der Reiter stürzte vom Pferd; der Gaul wieherte auf und rannte davon, während sein Reiter bewegungslos am Boden liegen blieb.
»Getroffen!«
Sie rannten los. Einen flüchtigen Moment lang dachte Ben, sie hätten nachladen sollen, aber das hätte viel zu lange gedauert; wenn der Mann wirklich noch am Leben sein sollte, müssten sie ihn mit dem Messer erledigen. Alan hatte das Gewehr fallen gelassen und den Dolch in die Hand genommen. Auch Ben griff nach seinem Messer, aber das war überflüssig, der Mann lag auf dem Bauch und rührte sich nicht mehr.
»Jetzt ist’s vorbei mit dem Spionieren!«
Alan stieß den Mann mit dem Fuß an, drehte ihn auf den Rücken. Ben sah, dass beide Einschüsse dicht nebeneinander lagen. Beide hatten sie die Brust zerfetzt, das Herz getroffen. Kein Zweifel, dachte er, Jan Veenstra war tot.
Alan biss sich auf die Lippen. Er wusste, dass dieser Tote nicht Jan Veenstra war. Aber das ließ sich nun nicht mehr ändern. Auch gut, dachte er. Eigentlich war es so noch besser.
7.
Jan Veenstras Wanderung nach Norden hatte länger gedauert, als er erwartet hatte. Der Weg war beschwerlich. MacPherson hatte behauptet, das schottische Hochland sei wild und gefährlich, und selbst er als Schotte – er stammte aus Edinburgh – würde sich nicht in die Berge trauen, ohne vorher sein Testament gemacht zu haben. Ein Scherz, hatte Jan gedacht. Inzwischen war er sich nicht mehr so sicher.
Jetzt, nachdem er Inverness verlassen und sich allein auf den Weg nach Westen begeben hatte, kam es Jan so vor, als habe er einen Sprung rückwärts in der Geschichte gemacht.
Die Behausungen wirkten ärmlich, die Bewohner, die ihn verwundert anstarrten, waren erbärmlich gekleidet. Das enge Tal bot wenig Raum für Acker oder Weideland, und Jan ahnte, dass es in diesen Gegenden gegen Ende des Winters noch immer Hunger gab. Jan wollte dieses trostlose Tal so rasch wie möglich durchqueren. Er ging, solange es hell war, und er war froh, als er schließlich in der Dämmerung zu einer Art Gasthaus gelangte, aus dem fröhliche Musik erschallte.
»Was ist denn hier los?«, fragte Jan, nachdem er sich mit Mühe einen Weg in das Innere der Herberge gebahnt hatte. »Eine Hochzeit?«
Der Mann, an den er sich gewandt hatte, schüttelte den Kopf. »Eine Beerdigung.«
Jan zog die Augenbrauen hoch. In der Tat gewahrte er jetzt, dass mitten im Saal der Leichnam eines Mannes aufgebahrt war. »Das ist der Wirt.«
»Ich will nicht stören«, murmelte Jan.
Der andere hielt ihn am Ärmel fest. »Du bist nicht von hier, was?«
Jan schüttelte den Kopf.
»So machen wir das hier im Norden. Wenn einer stirbt, kommen alle Freunde zu Besuch, und die Nacht nach dem Tode wird durchgetanzt. Das da ist übrigens die Witwe.«
Jan sah zu seiner Verwunderung, dass die Witwe an dem bunten Treiben beteiligt war. »Sie tanzt mit?«, fragte er.
»Muss sie doch«, sagte der Mann. »Die Witwe führt den ersten Tanz an. Und dann wird die ganze Nacht gelacht und gesungen und gesoffen. Wenn du hier über Nacht bleiben willst, wirst du nicht viel Ruhe finden!«
»Wo ist der Schlafsaal?«, fragte Jan. Er war todmüde und konnte nicht mehr weiter.
»Dies ist der Schlafsaal!«, sagte der Mann. Und, als er Jans entgeistertes Gesicht sah, fügte er hinzu: »Du kannst es ja im Pferdestall versuchen. Nicht sehr bequem, aber deutlich ruhiger.«
Jan schlief fest und gut. Nur zweimal wurde er gestört. Das erste Mal, als ein kicherndes, junges Pärchen über ihn stolperte, und das zweite Mal, als jemand unmittelbar neben ihm ins Stroh kotzte. Bei Sonnenaufgang wurde Jan wach und begab sich in die Gaststube. Der Leichnam lag noch immer dort. Männer und Frauen schliefen auf den Bänken und auf dem Fußboden. Es war kalt im Raum. Das Torffeuer war ausgegangen. Jan fror.
»Ich habe gewusst, dass das so kommen musste«, sagte einer, der schon zu früher Stunde ein Glas Whisky vor sich stehen hatte.
»Ist er krank gewesen, der Wirt?«, fragte Jan.
Der Mann schüttelte den Kopf. »Ich hab es gesehen.«
»Gesehen?«
»Ich war draußen auf dem Feld, wollte nachgucken, ob die Kartoffeln schon raus sind, aber zu früh natürlich. Jedenfalls – da habe ich es vor mir gesehen, ganz deutlich. Das Gasthaus, die Bahre, den mit Blumen geschmückten Leichnam.«
»Wann haben Sie das gesehen?«, fragte Jan.
Der Mann zuckte mit den Schultern. »Vor zwei, drei Tagen vielleicht.«
Er wird gemerkt haben, dass der Mann krank ist, und sich den Rest ausgemalt haben, dachte Jan. Er wusste, dass einem die Phantasie üble Streiche spielen konnte – schon gar, wenn Whisky im Spiel war.
»Das zweite Gesicht«, sagte der Mann. »Ich hab das zweite Gesicht. Sehe Dinge im Voraus, und dann passieren sie. – Du glaubst nicht an so etwas, nicht wahr? Das sehe ich dir an, du kommst aus Edinburgh oder aus London, was weiß ich. Aber es ist so, das kannst du mir glauben.«
Jan nickte. Keinen Streit anfangen, dachte er.
»Es ist so«, wiederholte der Mann. »Der junge Mann, der neulich hier durchgekommen ist? Der Lockenkopf aus London? – Tot ist er heute! Und ich hab ihn noch gewarnt!«
Einen Augenblick lang saßen sie sich schweigend gegenüber. Jan nippte an seinem Becher Milch. Dann sagte der Mann: »Und da ist noch etwas, was ich weiß.« Er wies mit dem ausgestreckten Zeigefinger auf Jan. »Über dich! Einsperren werden sie dich …«
Aber Jan war nicht scharf darauf, irgendeine unheimliche Prophezeiung über sein zukünftiges Leben zu erfahren. Er warf ein paar Münzen auf den Tisch und machte, dass er davonkam.
»Nimm dich in Acht!«, rief der Mann hinter ihm her. »Freunde sind Feinde, und Feinde sind Freunde! Nimm dich in Acht!«
8.
Am Morgen des siebten Tages setzte Jan Veenstra mit der Fähre nach Skye über. Aber noch hatte er sein Ziel nicht erreicht. Es dauerte bis zum späten Nachmittag, bis Jan den westlichen Rand der Hochfläche erreichte und nun plötzlich das Schloss vor sich sah. Dunvegan Castle. Keiner dieser dunklen, altertümlichen Wehrtürme, sondern ein richtiges Schloss, durch einen breiten Graben gesichert. Alles war genau so, wie der Laird es ihm in seinem Brief beschrieben hatte. Allein das Boot lag auf der anderen Seite, für Jan unerreichbar. Er fragte sich, ob er rufen sollte, bis er schließlich eine Glocke entdeckte, die am Ast eines großen Baumes befestigt war.
Jan läutete. Wenig später öffnete sich auf der anderen Seite das Tor, und ein großer Mann trat heraus, gekleidet wie ein Engländer. Er mochte vielleicht vierzig Jahre alt sein.
»Bin ich hier richtig bei Laird MacLeod?«, rief Jan hinüber. Er kam sich dumm vor; es war offensichtlich, dass er in Dunvegan angekommen war.
Der Laird lachte. »Sie müssen Jan Veenstra sein!« Er machte das Boot los und ruderte die paar Schläge, die nötig waren, um den Burggraben zu überqueren, der hier in das Meer mündete. »Herzlich willkommen! Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Reise.«
Jan bejahte dies. Er stieg in das Boot, und während der Laird wieder die Ruder ergriff, sah Jan, dass inzwischen in der Pforte ein junges Mädchen erschienen war.
»Ist das die junge Dame?«
Der Laird sah sich um. »Ja, das ist Lucy.«
Jan wusste, dass sie siebzehn Jahre alt war. Sie wirkte jünger – wahrscheinlich, weil sie weder Schminke noch Puder benutzte. Womöglich auch kein Parfüm. Vermutlich stank sie also. Jedenfalls war sie keine dieser steifen Prinzessinnen und Hofdamen, die er aus London kannte. Sie wirkte fröhlich und ungezwungen. Sein erster Eindruck: Sie würden miteinander auskommen.
Lamm mit Hörnern
Dunvegan, Isle of Skye, Schottland, Juni 1744
1.
Sie werden oben im Fairy Tower schlafen«, sagte der Laird, »wenn Sie nichts dagegen haben. Ich hoffe, die vielen Stufen machen Ihnen nichts aus.«
»Nein, natürlich nicht.«
»Aber es spukt dort oben«, gab Lucy zu bedenken. »Nicht umsonst heißt der Turm Elfenturm!« Ein Blick in ihr Gesicht verriet, dass sie gewiss nicht an Gespenster glaubte. »Und ich weiß nicht, ob Elfen im Schlafzimmer des Lehrers wirklich angemessen sind.«
»Eher akzeptabel jedenfalls als Menschen aus Fleisch und Blut«, brummte Normand MacLeod.
Lucy schwieg. Hatte der Laird einen wunden Punkt berührt? Der Turm, ein typischer alter, schottischer Wehrturm, lag an der Südostecke der Burg. Er hatte vier Stockwerke, und in jedem gab es ein kleines Zimmer. Der Raum, der für Jan vorgesehen war, lag ganz oben.
»So, da wären wir.«
Waren die Stufen der schmalen Wendeltreppe auch alt und ausgetreten, so fand Jan das Turmzimmer jedenfalls modern eingerichtet. Es hatte richtige Fenster mit Glasscheiben, nicht nur Schießscharten, wie sie früher üblich gewesen waren. Von hier oben hatte man einen herrlichen Blick über den Meeresarm des Loch Dunvegan mit seinen Inseln. Es gab einen Kamin, einen großen Bücherschrank, viel zu groß für die drei Bücher, die Jan mitgebracht hatte, und es gab ein herrliches Bett.
Der Laird hatte Jans Blick richtig gedeutet. »Hier werden Sie nicht auf Stroh oder auf Heidekraut schlafen müssen«, sagte er. »Für den gewöhnlichen Highlander mag das angehen, er wickelt sich in seinen Plaid und merkt nicht, worauf er liegt. Aber für uns, die wir uns an die angenehmen Seiten des Lebens gewöhnt haben, sind richtige Bettwäsche aus Leinen und eine gut mit Daunen gefüllte Decke nicht mehr wegzudenken.«
»Das ist wahr«, sagte Jan. In London hatte er noch geglaubt, das ländliche Leben würde ihm nichts ausmachen, aber auf der Reise durch das Hochland hatte er sich doch in manch unbequemer Nacht nach einem richtigen Bett gesehnt.
Abends saßen sie auf der Terrasse. Lucy hatte Jan das ganze Schloss gezeigt. Es war nicht so groß, wie es von außen wirkte. Die Wirtschaftsräume und der Flügel, in dem die Bediensteten wohnten, nahmen einen erheblichen Teil in Anspruch. Hinzu kam, dass die Burg auf einen Fels gebaut war und daher hoch über ihre Umgebung hinausragte.
»Schön, dass Sie gekommen sind«, sagte der Laird. »Und dass Sie heil angekommen sind. Die Reise durch das Hochland ist selbst heute noch nicht ohne Risiko. Erst letzte Woche ist irgendein junger Engländer hinterrücks erschossen worden. Und ausgeraubt natürlich. Wir wissen bis heute nicht, wer das war.«
»Ich hatte unterwegs keine Probleme«, sagte Jan.
»Das freut mich. – Es ist nicht leicht, jemand zu finden, der überhaupt bereit ist, zu uns in die schottische Einsamkeit zu ziehen. Und dann noch mit so guten Zeugnissen!«
Jan wurde rot. Er hatte nicht gewusst, dass falsche Zeugnisse für ihn ausgestellt worden waren. »Ich freue mich, dass ich hier bin«, sagte er.
»Ich hatte schon befürchtet, ich müsste Lucy nach Edinburgh schicken.«
»Ich wäre nicht gegangen«, behauptete Lucy. »Hold fast! Das ist unser Motto!«
Jan hatte das Bild mit dem Stier und dem Schriftzug in der Eingangshalle wohl bemerkt.
»Ja«, sagte der Laird, »das stammt noch aus alter Zeit, als viel gekämpft und gestritten wurde. Vieles, was Sie hier im Schloss sehen, sind Überreste von früher. Alles Geschichte. Heute haben die Anführer der Clans das Schwert mit dem Parlamentssitz vertauscht, aber unser Einfluss ist dadurch nicht kleiner geworden.«
»Nicht alle teilen diese Ansicht«, sagte Lucy.
»Nein, nicht alle. Aber die wichtigsten. Hier auf Skye gehört fast alles Land den MacLeods und den MacDonalds. Und Alexander MacDonald und ich, wir sind beide Vertreter des Fortschritts. Die kleineren Clans, also die MacKinnons im Südosten und die anderen MacLeods auf unserer Nachbarinsel Raasay, die mögen glauben, dass alles so weitergeht wie früher, aber das ist natürlich falsch. Das Vereinigte Königreich befindet sich in einer Phase starker Veränderungen. Die Aufklärung hat die Engstirnigkeit der Vergangenheit verdrängt, und wir sind auf dem Weg zu einer Zukunft, die gekennzeichnet sein wird von Wohlstand, Frieden und Freiheit.«
»Du bist hier nicht im Parlament, Papa!« Lucy lachte.
»Das mag zwar wie eine Parlamentsrede klingen, aber das meine ich auch so. Und Hold fast! ist der falsche Wappenspruch für uns. Am liebsten würde ich ihn ändern in Let go, Lass los!«
»Das gefällt mir«, sagte Jan.