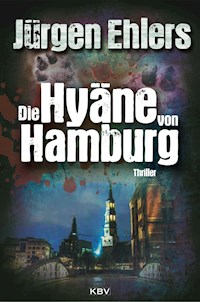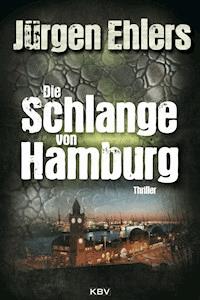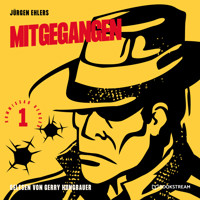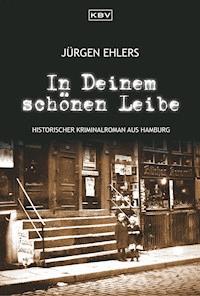
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: KBV
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Berger
- Sprache: Deutsch
Ein kalter Oktobertag im Hamburg des Jahres 1938. Die siebenjährige Anna ist von der Schule nicht nach Hause gekommen. Die Freundinnen wissen von nichts. Die Lehrerin sagt: "Anna? - Die war heute gar nicht in der Schule!" Draußen ist es längst dunkel. Alle Polizeistreifen sind alarmiert. Der Reichssender Hamburg bringt stündliche Suchmeldungen. Kommissar Berger versucht, die Mutter zu beruhigen, aber er befürchtet das Schlimmste. Bereits vor vier Jahren ist ein Kind verschwunden und nie wieder aufgetaucht. Der Anfang einer Serie? Was nur die Polizei weiß: Ein Unbekannter schreibt seit Jahren anonyme Briefe an junge Mädchen: "In deinem schönen Leibe ... locken die Eingeweide ..." Handelt es sich nur um groben Unfug, oder hat sich der Verfasser womöglich daran gemacht, seine Mordfantasien in die Wirklichkeit umzusetzen? Auch der dritte Fall für Kommissar Berger beruht auf einer wahren Begebenheit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 415
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jürgen Ehlers
In Deinem schönen Leibe
Bisher vom Autor bei KBV erschienen:
»Mann über Bord«
»Mitgegangen«
»Neben dem Gleis«
»Die Nacht von Barmbeck«
»In Deinem schönen Leibe«
Jürgen Ehlers wurde 1948 in Hamburg geboren, lebt heute mit seiner Familie auf dem Land und arbeitet hauptberuflich im Geologischen Landesamt Hamburg. Seit 1992 schreibt er Kurzkrimis, die in verschiedenen Verlagen im In- und Ausland veröffentlicht wurden, und ist Herausgeber von Krimianthologien. Er ist Mitglied im »Syndikat« und in der »Crime Writers’ Association«.
Sein erster Kriminalroman »Mitgegangen« wurde in der Sparte Debüt für den Friedrich-Glauser-Preis nominert.
Jürgen Ehlers
In Deinemschönen Leibe
Originalausgabe© 2011 KBV Verlags- und Mediengesellschaft mbH, Hillesheimwww.kbv-verlag.deE-Mail: [email protected]: 0 65 93 - 99 86 68Fax: 0 65 93 - 99 87 01Umschlaggestaltung: Ralf KrampRedaktion: Volker Maria Neumann, KölnPrint-ISBN 978-3-942446-11-2E-Book-ISBN 978-3-95441-036-1
Das Schlimmste wird es schon nicht sein
12. Oktober 1938 abends
Der Kopf des Führers schwamm in einer Schüssel mit Wasser.
»Na, was machen deine Mörder?«, fragte Horst. Er war jetzt acht Jahre alt und stolz auf seinen Vater.
»Nichts. Wir haben alles unter Kontrolle«, erwiderte Wilhelm Berger. Er war nicht mehr ganz so stolz auf das, was er im Beruf leistete. Die Aufgaben der Polizei hatten sich verändert. Er betrachtete die Briefmarken in der Schüssel. Deutsches Reich, 12 Pfennige. Der Führer war widerspenstig, schwamm an der Oberfläche. Wilhelm Berger tauchte ihn unter.
Horst hatte inzwischen eine ganz ansehnliche Sammlung. Auf dem Tisch lagen auf Löschpapier die Köpfe mehrerer amerikanischer Präsidenten. Einiges davon hatte Horst in der Schule eingetauscht, aber die meisten amerikanischen Marken stammten von den Briefen von Susannes Vater.
»Wollen wir nachher etwas spielen?«, fragte Susanne.
»Ja, gern.« Der unregelmäßige Dienst bei der Kripo führte dazu, dass sie nur selten ihre Abende gemeinsam verbringen konnten. Und wenn er mal zu Hause war, gab es bestimmt irgendeine Veranstaltung vom BdM, die ihre Tochter nicht versäumen durfte. Susanne war 17 Jahre alt.
Sie holte den Karton mit dem Mensch ärgere Dich nicht.
»Übrigens: Morgen Abend bin ich nicht da«, sagte Dagmar leichthin. »Wir wollen ins Kino gehen.«
»Mit Helga?« Wilhelm Berger sah seine Frau an.
»Ja, und mit noch ein paar anderen Kollegen. – Es gibt Heimat. Mit Zarah Leander«, fügte sie hinzu. Das jedenfalls stimmte.
Wilhelm Berger hatte es geschluckt, wie immer. Gut. Aber es gab noch einen Punkt, über den sie sprechen musste. Am liebsten wäre Dagmar sofort damit herausgeplatzt, aber das wäre falsch gewesen. Ganz beiläufig wollte sie es anbringen.
Wilhelm Berger nahm mit einer Pinzette die Marken vom Löschpapier, die bereits getrocknet waren. Der Führer in Braun, der Führer in Rot. Na schön. Wir haben alles im Griff, dachte er. Die Sorgen des letzten Jahres waren verflogen. Alles war gut gegangen. Er war in die NSDAP eingetreten; alle Beamten mussten seit 1937 Mitglied in der Partei sein. Und Dagmar arbeitete weiter in der Bank; weder ihr Status als Doppelverdiener noch die Tatsache, dass sie Halbjüdin war, hatten daran etwas geändert. Sie war tüchtig, das allein zählte, und ihr Chef wollte auf ihre Mitarbeit nicht verzichten. Es war sogar gelungen, Susanne in den BdM aufnehmen zu lassen, obwohl sie einen jüdischen Vater in Amerika hatte und sie somit zu drei Vierteln Jüdin war. Aber natürlich sah sie durchaus arisch aus, und sie war evangelisch-lutherisch getauft und konfirmiert worden.
Dennoch war es nicht leicht gewesen. Es hatte einiger Überredungskunst bedurft. Wilhelm Berger hatte seinen Status als Kriminalkommissar geltend gemacht, wodurch er ja de facto SS-Mitglied war. Das hatte am Ende gewirkt. Schwieriger war es gewesen, Susanne von der Notwendigkeit dieser Maßnahme zu überzeugen. Sie hatte für die Nazis nichts übrig, und Berger befürchtete, dass sie das irgendwann einmal deutlicher zum Ausdruck bringen mochte, als es ratsam war.
Horst hatte inzwischen begonnen, die Marken, die schon trocken waren, nach Ländern zu ordnen.
Dagmar beschloss, nicht länger zu warten. Sie räusperte sich. »Man kann auch ein rassenbiologisches Gutachten erstellen lassen, um nachzuweisen, dass man ein Arier ist«, sagte sie.
»Tatsächlich?« Wilhelm Berger hatte geglaubt, dass das allein aufgrund der Vorfahren entschieden würde. Dazu gab es ja schließlich den Ahnenpass.
»Selbst wenn die Vorfahren nicht reine Arier sind, kann es doch sein, dass die nordischen Merkmale sich durchsetzen.«
»Hm. – Ich werde mich mal erkundigen«, versprach Berger.
»Ich habe mich schon erkundigt. In Hamburg kann man das machen lassen. Beim Universitätskrankenhaus in Eppendorf. Oder in Kiel. – Kiel soll sicherer sein.«
»Sicherer?«
»Na ja, es ist doch schließlich klar, was bei der Untersuchung herauskommen soll. Ich habe Susanne in Kiel angemeldet. Für nächste Woche.«
Wilhelm Berger sah seine Tochter an. Susanne tat so, als ob sie das alles nichts anginge. Aber immerhin kam kein wütender Protest. Also hatten Mutter und Tochter das miteinander abgesprochen.
»Wenn das so einfach funktioniert ...« Wilhelm Berger sollte es recht sein. Alles, was der Absicherung von Susannes Status als Nichtjüdin dienen konnte, war zu begrüßen.
»Aber es kostet Geld.«
»Ja. Natürlich. – Wie viel ist es denn?«
»Ich habe mit dem Professor gesprochen. Mit 1000 RM müssen wir rechnen.«
»1000 Mark!«
»Der Preis scheint mir nicht zu hoch für das, was damit erreicht werden kann!«
»Nein, du hast recht.« Die Reste, die noch vom Vermögen seines Vaters übrig geblieben waren, schwanden rapide.
Aber Dagmar hatte recht – es musste sein. Früher hatte Wilhelm Berger alle Warnungen in den Wind geschlagen, aber die Entwicklung der letzten Monate hatte ihm Angst gemacht. Diese Verhaftungsaktion im Sommer – er hatte Dagmar und Susanne nichts davon erzählt, um sie nicht zu beunruhigen. Alle Juden, die schon mal irgendwann mit dem Gesetz in Konflikt gekommen waren, hatten sie festgenommen. Viele davon hatten nur ein einziges Mal irgendein krummes Ding gedreht, waren zum Teil seit Jahren nicht straffällig geworden. Aber es gab keine Unterschiede, alle kamen in Vorbeugehaft, alle wurden ins KZ eingeliefert. Es hieß, Himmler brauche Arbeiter, um die Lager zu erweitern. Aber das war natürlich nur ein Gerücht. Wilhelm Berger hatte diese Aktion zum Anlass genommen, für Susanne einen Pass zu beantragen.
Auch Herbert Richter war nicht wohl gewesen bei dieser Geschichte, das hatte Wilhelm Berger ihm angesehen. Aber Bergers junger Chef hatte sich damit herausgeredet, dass durch Wegsperren sämtlicher Straftäter die Zahl der Verbrechen zurückging. Das stimmte zwar, aber nicht in dem Maße, in dem die Nazis sich das erhofft hatten. Und ein Teil des Rückgangs der Straftaten war einfach nur darauf zurückzuführen, dass sich die wirtschaftliche Lage Deutschlands gebessert hatte. Die Weltwirtschaftskrise war überstanden.
Susanne baute schon mal das Spielbrett auf. Sie würde die roten Setzer haben wollen, wie immer.
Das Telefon klingelte. »Wahrscheinlich für mich«, sagte Wilhelm Berger.
Susanne krauste die Stirn.
Dagmar ging ran. »Berger?«
Die Stimme am anderen Ende der Leitung klang aufgeregt.
Dagmar reichte ihrem Mann den Hörer. »Für dich!«
Es war Fehlandt. »Tut mir leid, euch zu stören, aber du musst sofort mit rauskommen. Ein kleines Kind ist verschwunden. Sieht übel aus, die Geschichte. Richter und ich holen dich mit dem Wagen ab.«
»Ich komme«, sagte Berger. »Ich warte an der Straße auf dich.«
»Scheiße!« Susanne fegte die Setzer vom Spielbrett. Auch ein paar Briefmarken flogen vom Tisch.
»Wir können doch auch zu dritt spielen«, sagte Dagmar besänftigend.
Susanne schüttelte den Kopf. »Ich geh nach oben. Ich les noch was.«
»Es tut mir leid, Susanne«, sagte Wilhelm Berger verärgert. »Aber der Dienst geht vor. Und dies ist – dies ist eine ernste Sache.«
»Im Gegensatz zu deiner Familie!« Susanne stapfte davon.
Wilhelm Berger setzte zu einer scharfen Erwiderung an. Dagmar schüttelte den Kopf. »Sie braucht dich!«, sagte sie leise.
Wilhelms Ärger verflog. Er nahm Hut und Mantel von der Garderobe. Dagmar rief: »Dein Schlüssel! Du hast deinen Schlüssel vergessen!« Aber da war Wilhelm schon weg.
Horst bückte sich und hob seine Briefmarken wieder auf.
»Nun komm schon!« Fehlandt hielt ihm die Wagentür auf.
Berger stieg ein. Kaum hatte er Platz genommen, gab Richter Gas, und der Wagen machte einen Satz nach vorn. Berger flog in die Polster, Fehlandt fluchte. Herbert Richter war ein schlechter Fahrer.
»Jede Sekunde zählt«, murmelte Richter. »Jede Sekunde zählt!«
»Was ist denn überhaupt los? Entführung?« Berger rieb sich die Schulter.
»Hoffentlich nicht!«
»Keine Panik«, sagte Fehlandt. »Bis jetzt wissen wir gar nichts. Absolut gar nichts. Und du, Herbert, du redest doch immer davon, dass die Zahl der Verbrechen so stark zurückgegangen ist. Das kann gar keine Entführung sein; das passt doch überhaupt nicht ins Bild.«
Berger warf seinem Kollegen einen raschen Blick zu. Fehlandt wirkte völlig ernst, aber es war klar, dass er den Vorgesetzten auf den Arm nehmen wollte. Richter sprang erwartungsgemäß sofort darauf an.
»Die Kriminalität in Hamburg ist seit 1933 deutlich zurückgegangen. Schon wenige Monate nach der Machtergreifung ist es uns gelungen, die Zahl der Diebstähle in Hamburg um 20 Prozent zu senken …«
»Herbert, guck bitte nach vorn«, sagte Berger,
»… die Zahl der Raubüberfälle gar um fast 40 Prozent. Und Aufruhr und derartige Delikte haben sich erfreulicherweise überhaupt nicht mehr ereignet. Das endgültige Ziel ist natürlich, dass wir eine Volksgemeinschaft bekommen, in der es gar keine Verbrecher mehr gibt, in der alle friedlich und harmonisch miteinander leben …«
»Wie schön!«, sagte Fehlandt. »Wenn man mit dir unterwegs ist, das baut einen richtig auf. Weiß die Partei schon, wann dieser Zustand erreicht sein wird?«
»Natürlich nicht, aber wenn wir alle ständig daran arbeiten …«
Fehlandt lachte. Herbert Richters Lobeshymnen auf den neuen Staat waren im Laufe der Zeit schwächer geworden. Berger hatte das Gefühl, dass er selbst nicht mehr an die Verwirklichung dieser Utopie glaubte. Dass er diese Zahlen nur noch herbetete, um die Fassade aufrechtzuerhalten, während er in Wahrheit längst begonnen hatte, an den Vorzügen des Dritten Reiches zu zweifeln. Die Verhaftungsaktion im Sommer hatte auch ihm stark zugesetzt.
»Sollen wir obenrum fahren oder mitten durch?«, fragte Fehlandt.
»Wo fahren wir überhaupt hin?«, warf Berger ein.
»Eimsbüttel. – Wir fahren mitten durch. Über die Lombardsbrücke. Das geht schneller.«
Berger bezweifelte, dass das schneller war.
»Warum fährt der Kerl nicht rechts!« Richter trommelte mit den Fingern auf das Lenkrad.
»Es gibt entschieden zu viele Autos«, knurrte Fehlandt. »Kein Wunder, wenn am Ende der Verkehr zusammenbricht.«
»Der Verkehr bricht nicht zusammen.« Zumindest in diesem Punkt war Richter zuversichtlich. »Der Führer hat dem Bau von Fernstraßen höchste Priorität eingeräumt.«
Berger wusste, dass Fehlandt sich selbst einen schnellen Wagen zugelegt hatte, ein ziemlich teures Modell. Aber Fehlandt war Junggeselle, und für seine aufwändige Freizeitbeschäftigung war ein Wagen von Vorteil.
Fehlandt räusperte sich.
»Was wolltest du sagen?«, fragte Richter.
»Ach, nichts. – Ich dachte nur, hoffentlich ist das alles ein Irrtum.«
Es geht ihm genauso wie mir, dachte Berger. Nur nicht darüber sprechen, nur nichts herbeireden! »Welche Wache ist es überhaupt?«
»Wache 48.«
Berger seufzte. An die Wache 48 hatte er ungute Erinnerungen. »Wie lange ist das jetzt her?«, fragte er Fehlandt.
»Mit Hannack? Der Sprung aus dem Fenster? – Fünf Jahre müssen das jetzt sein.«
Eines stand jedenfalls fest: Heute würde niemand aus dem Fenster springen. Alle Fenster der Wache 48 waren jetzt voll vergittert wie bei einem Gefängnis.
»Hier entlang, bitte«, sagte ein Wachtmeister.
Der Raum, in dem die junge Frau auf sie wartete, war kärglich möbliert wie alle Dienststuben. Viel trister konnte es in einer Zelle nicht aussehen. Und die Stimmung war nicht besser. Die junge Frau, die sie angstvoll ansah, hatte rotgeweinte Augen. Der Tee, den man ihr angeboten hatte, war ungetrunken und in seiner Tasse kalt geworden.
»So, Frau Altmann, jetzt kommen die Spezialisten«, sagte der Wachtmeister, der ganz offensichtlich froh war, die Verantwortung los zu sein.
Die Spezialisten! Fehlandt verkniff sich ein Grinsen. Wie viele verloren gegangene Kinder hatte er in seiner Karriere wiedergefunden? Null. Und bei Berger sah es seines Wissens auch nicht besser aus. Jedenfalls nicht, was lebende Kinder anging.
»Nun mal ganz mit der Ruhe«, sagte Richter. Jetzt, wo es darauf ankam, wirkte er völlig gelassen. »Also, was genau ist passiert?«
»Die Anna – sie ist nicht nach Hause gekommen!«
»Die Anna?«
»Ja. Das ist meine Tochter. Das habe ich doch alles Ihren Kollegen schon erzählt.«
»Erzählen Sie es uns bitte noch einmal.«
»Sie ist verschwunden. Was soll ich nur machen? Und es ist doch schon dunkel! – Sie hätte doch längst zu Hause sein müssen!«
»Wie alt ist denn die Kleine?«, fragte Fehlandt.
»Sieben Jahre.«
»Sieben Jahre? Na ja, dann ist sie ja nicht mehr so ganz klein. Dann geht sie ja schon zur Schule.« Herbert Richters Ruhe wirkte ansteckend.
»Ja, natürlich. Ich habe sie heute früh vor der Arbeit noch bis zum Eppendorfer Weg gebracht. Von dort aus geht sie dann immer allein weiter bis zur Schule. Und mittags kommt sie wieder zurück.«
»Da wird sie wahrscheinlich nach der Schule noch mit irgendeiner Freundin mitgegangen sein und dann gar nicht auf die Zeit geachtet haben.«
Der Wachtmeister, der die Anzeige aufgenommen hatte, schüttelte den Kopf. »Diese Möglichkeit haben wir schon ausgeschlossen. Ich habe die Lehrerin angerufen; Anna Altmann ist heute gar nicht in der Schule gewesen!«
»Gar nicht in der Schule gewesen?« Berger zog die Brauen hoch. Also nicht erst seit ein paar Stunden verschwunden. Das sah in der Tat schlecht aus. Sehr schlecht.
»Kann sie bei Verwandten sein?«
»Das haben wir schon überprüft. Bei ihrem Großvater in Wellingsbüttel ist sie jedenfalls nicht. Da haben wir angerufen.«
»Was ist mit sonstigen Verwandten? Onkel, Tante und so weiter?«
Frau Altmann schüttelte den Kopf. »Wir kommen aus Berlin«, sagte sie. »Aber zu den meisten Verwandten habe ich keinen Kontakt mehr. Da wäre nur noch mein geschiedener Mann.«
»Und der wohnt in Berlin?«
Frau Altmann nickte.
»Könnte es sein, dass Anna vielleicht bei ihm ist? Dass Ihr Mann das Mädchen entweder geholt hat, oder dass Anna auf irgendeine Weise zu ihm gefahren ist?«
»Nein, das kann ich mir nicht vorstellen.«
Wirklich nicht? Berger malte sich aus, dass es irgendeinen Streit gegeben haben könnte, und dass das Mädchen einfach versucht hatte, zu seinem Papa zu laufen. Vielleicht hatte es das ja sogar geschafft. In der Bahn – er selbst war als Kind mehr als einmal schwarzgefahren. Das war kein großes Problem. Und wenn das Kind wirklich in Berlin war – wer weiß, was es dann seinem Vater erzählt hatte. Wahrscheinlich wusste der Mann gar nicht, dass die Kleine in Hamburg gesucht wurde. – Nein, das war eine Illusion.
Richter ließ sich Namen und Anschrift des Vaters geben; darum würden die Berliner Kollegen sich kümmern. »Na, dann werden wir wohl einmal nachsehen müssen, wo sie steckt. Wie sieht die Kleine denn aus?« Richter nickte Fehlandt zu; der zückte den Bleistift.
»Sie trägt einen Mantel, so einen beigebraun melierten, groben Stoffmantel. Und darunter einen braun und weiß karierten Rock und einen roten Pullover.«
»... einen roten Pullover. Ja, das hab ich!«, sagte Fehlandt. Auch er bemühte sich, überlegen zu wirken.
Berger ließ sich dadurch nicht täuschen.
»Ach ja, die Mütze. Das Auffälligste ist wahrscheinlich Annas Mütze. So eine weiße Strickmütze mit Zipfeln an den Ohren. So eine Teufelsmütze, wissen Sie?«
Teufelsmütze notierte Fehlandt. Was immer das sein mochte. »Und wie groß ist das Mädchen?«
»Wie groß? – Ach, wann hab ich sie denn zuletzt gemessen? Das ist schon eine ganze Weile her. Ungefähr 1,30 Meter wahrscheinlich. Und sie ist schlank. Und die Haare, die sind dunkelblond, und sie trägt sie als Bubikopf.«
Fast alle Mädchen waren schlank, fast alle hatten einen Bubikopf.
»Ein Foto haben Sie nicht vielleicht von ihr?«
Die Mutter schüttelte den Kopf. »All diese Fragen«, sagte sie. Ihre Stimme zitterte. »So tun Sie doch etwas! Sie müssen doch etwas tun!«
»Wir tun schon die ganze Zeit etwas«, sagte der Wachtmeister.
»Nun beruhigen Sie sich mal«, sagte Berger. »Das Schlimmste wird es schon nicht sein. Das haben wir öfter mal, dass Kinder von zu Hause weglaufen. Wir werden die kleine Ausreißerin schon finden.« Er sah Frau Altmann an. War sie beruhigt? Fast. Berger schämte sich. Überbringer schlechter Nachrichten war er schon oft gewesen. Überbringer falscher Hoffnungen – das war etwas Neues.
»Und was passiert jetzt?«, fragte die Frau.
»Alle Polizisten in der ganzen Stadt suchen inzwischen nach Ihrem Mädchen. Und es sollte doch gelacht sein, wenn sie das Kind nicht finden. Und Sie – Sie gehen jetzt am besten nach Hause, damit auch jemand da ist, wenn die Kleine zurückkommt. Und wenn die Anna wieder da ist, dann rufen Sie uns bitte an, damit wir nicht weitersuchen müssen. Vielleicht ist sie ja sogar jetzt schon zu Hause und wartet auf Sie!« Berger sah, wie die Frau wieder Hoffnung schöpfte. Aber es war natürlich nur ein winziger Strohhalm, nach dem sie hier griff.
»Ja, vielleicht ist sie schon zu Hause. Ich – ich geh dann wohl besser!« Sie verabschiedete sich hastig.
Als sie gegangen war, sahen die Polizisten sich an. »Und jetzt?«, fragte Berger.
Der Wachtmeister zuckte mit den Achseln. »Wir haben alles in die Wege geleitet. Als die Meldung einging, hab ich sofort eine Runddepesche an alle Wachen geschickt und die Anzeige mit der Eilstafette an die Kriminalpolizei weitergegeben.«
»Rundfunk«, sagte Berger. »Warum lassen wir sie nicht über den Rundfunk suchen?«
»Das muss über das Präsidium laufen«, sagte Richter. »Heute erreichen wir da niemand mehr. Niemand, der das verantworten kann.«
»Ich verantworte das«, sagte Berger.
»Das geht nicht.«
»Doch, das geht. Das muss gehen. Das ist ein Notfall; das Kind ist in Gefahr, da müssen wir sofort handeln.«
Richter schüttelte den Kopf. »Ich versuche, den Chef zu erreichen. Darf ich mal telefonieren?«
Der Chef war nicht da. Daraufhin versuchte Richter, sich mit dem Polizeipräsidenten verbinden zu lassen. Auch das schlug fehl. Wilhelm Berger war nervös. Es war jetzt viertel vor acht am Abend. Die Meldung sollte in den Acht-Uhr-Nachrichten gebracht werden, um möglichst viele Hörer zu erreichen. Herbert Richter wählte die Nummer des Polizeisenators.
Berger tippte auf die Uhr. Richter nickte, wählte weiter. Es gab noch ein zweites Telefon. Berger ging um den Schreibtisch herum, nahm den Hörer ab, wählte die Nummer der Auskunft.
Richter lauschte in seinen Hörer. Niemand ging ran.
»Die Nummer der NORAG bitte«, sagte Berger. »Was? Reichssender Hamburg dann eben. Ist mir egal, wie das jetzt heißt! Die Nachrichtenredaktion bitte. Und zwar sofort. Hier ist die Kriminalpoli…« Die Dame am anderen Ende hatte aufgelegt.
»Bitte?« Richter hatte offenbar jemand erreicht. »Nicht zu Hause? – Nein, danke, ich möchte keine Nachricht für den Herrn Senator hinterlassen.«
»Verdammter Mist!« Berger war wütend.
»Lass mich das mal machen!« Herbert Richter rief bei der Auskunft an, ließ sich mit dem Sender verbinden und gab den Text durch, der in den Nachrichten gebracht werden sollte. Für die »Ersten Nachrichten« um 20 Uhr war es zwar zu spät, aber um 22 Uhr würde die Meldung verlesen werden.
»Zu spät, zu spät!«, murmelte Fehlandt.
Aber es war immerhin ein Versuch. Herbert Richter würde morgen ein paar unangenehme Fragen zu beantworten haben. Überschreitung seiner Kompetenzen, dachte Berger. Aber Richter als SS-Mann der ersten Stunde – brauchte so einen das groß zu kümmern?
»Feierabend«, sagte Fehlandt. Er rieb sich die Augen.
Herbert Richter unterdrückte ein Gähnen. Es gab nichts mehr, was sie jetzt tun konnten. Oder doch?
Berger wollte noch nicht aufgeben. »Ich würde vorschlagen, wir gucken uns noch einmal die Umgebung der Altmann´schen Wohnung an. Fruchtallee.«
»Glaubst du nicht, dass die Schutzpolizei das schon getan hat?« Fehlandt wollte ins Bett.
»Darum geht es nicht. Nehmt doch einmal an, dass das Mädchen bloß weggelaufen ist. Dass irgendetwas passiert ist, weshalb die Anna glaubte, nicht nach Hause gehen zu können. Was uns die Mutter nicht erzählt hat, weil sie es entweder für unbedeutend oder für peinlich hält, oder weil sie es gar nicht weiß. Aber wenn das Kind wirklich weggelaufen ist, dann will es natürlich nicht nach Amerika auswandern, sondern dann will es gefunden werden. Und deshalb wird es ganz in der Nähe seiner Wohnung sein.«
»Wenn das so ist, dann hat ihre Mutter sie inzwischen längst gefunden. Und wenn sie sie nicht gefunden hat, dann wird sie jedenfalls heute Nacht nicht erfrieren. Einen so warmen Oktober haben wir lange nicht gehabt.«
»Nein, Wilhelm hat recht, wir gucken nach«, entschied Richter. »Das dauert ja nicht lange. Einmal um den Block und durch die Gärten. Sicher ist sicher.«
Die Suche dauerte doch länger, als Berger gedacht hatte. Auf dem Weg zwischen Wohnung und Schule lag Wehbers Park. Ein idealer Platz, um sich im Dunkeln zu verstecken. Die Polizisten leuchteten das Planschbecken ab, aber darin lag nur Laub. Sie inspizierten Hauseingänge und Hinterhöfe. Alles umsonst: Anna Altmann fanden sie nicht.
»Könnt ihr mich auf dem Rückweg eben zu Hause absetzen?«, fragte Herbert Richter.
»Klar«, sagte Fehlandt. »Ich fahr euch alle nach Hause und bring dann den Wagen weg.«
Es läutete an der Haustür. Endlich, dachte Dagmar. »Das wird Papa sein«, sagte sie. »Machst du mal bitte auf, Horst?«
Horst ging zur Haustür.
»Guten Abend, kleiner Mann! Dürfen wir reinkommen?«
»Mama, da sind – da sind welche …«
Dagmar hatte die Stimmen gehört und war aus der Küche herbeigeeilt. Sie erschrak. Im Eingang standen vier Männer in SA-Uniformen.
»Dürfen wir reinkommen?«
»Ich weiß nicht …« Was hatte das zu bedeuten? »Mein Mann ist nicht zu Hause. Vielleicht wäre es besser, wenn sie ein anderes Mal …«
»Ach, das ist schon in Ordnung«, sagte derjenige, der offenbar ihr Anführer war. Er schob Dagmar zur Seite, und die Männer marschierten ins Wohnzimmer.
»Stiefel abputzen!«, empörte sich Horst.
»Ach, das ist schon in Ordnung«, wiederholte der SA-Mann. Die anderen lachten.
Dagmars Gedanken rasten. Was wollten die Männer? Was sollte dieser – dieser Überfall? »Darf ich fragen, was mir die Ehre Ihres Besuches verschafft?«
Derjenige der Männer, der am grobschlächtigsten aussah, lachte. »Die Ehre unseres Besuches! Habt ihr das gehört?«
Der Anführer ging nicht darauf ein. Er sagte: »Es handelt sich um einen reinen Freundschaftsbesuch. Ihr Mann – und vielleicht auch Sie, das weiß ich nicht – ist ja erst vor Kurzem in die Partei eingetreten. Und da wollten wir uns die neuen Parteimitglieder doch einmal ansehen und uns bekannt machen.«
»Ich bin nicht in der Partei«, sagte Dagmar.
»Dann wird es aber Zeit, dass Sie eintreten, junge Frau!«
»Ich werde es mir überlegen.« Was sollte das alles? Dagmar hoffte, dass Wilhelm bald nach Hause käme. Oder war es besser, dass er nicht da war? Galt dieser Besuch in Wirklichkeit ihm?
»Nein, wirklich, junge Frau! Da gibt es doch nicht viel zu überlegen! Alle Volksgenossen sind aufgerufen, am Aufbau des neuen Deutschland mitzuarbeiten. Und Sie als Volksgenossin bilden da keine Ausnahme.«
Die Männer hatten sich inzwischen im Wohnzimmer verteilt. Dagmar hoffte, dass sie bald wieder verschwinden würden. Und dass Susanne nicht herunterkäme. Susanne war oben in ihrem Zimmer und las.
Der Anführer setzte sich auf das Sofa. »Ich darf doch?«
»Bitte«, sagte Dagmar. Sie versuchte, aus den Abzeichen an seiner Uniform abzulesen, was für einen Dienstgrad er hatte. So etwas wie ein Leutnant? Oberleutnant? Sie kannte sich mit den Uniformen der SA nicht aus.
»Hübsch haben Sie es hier!« Der Mann ließ seinen Blick durch das Zimmer schweifen.
»Das ist das Elternhaus meines Mannes«, sagte Dagmar.
»Schade, dass er nicht da ist!«, sagte der SA-Mann. »Sonst hätte er uns sicher schon etwas zu trinken angeboten.«
»Etwas zu trinken?« Dagmar hatte keineswegs die Absicht, ihren ungebetenen Gästen irgendetwas anzubieten.
»Ja, das wäre nicht schlecht. Ein Bier vielleicht. Nein, halt, kein Bier. Wenn wir bei so vornehmen Leuten zu Besuch sind, dann sollten wir wahrscheinlich lieber ein Glas Wein trinken. Oder zwei. Was meint ihr?«
»Ich bin für Bier«, sagte der Grobschlächtige.
»Wer hat dich gefragt? – Nein, wir trinken Wein. Einen guten deutschen Weißwein. Vom Rhein natürlich. Und bemühen Sie sich nicht, Frau Berger, der Otto hier, der wird uns ein paar Flaschen aus dem Keller holen.«
»Wo ist die Kellertreppe?«, fragte Otto.
»Meine Herren, das geht nun aber wirklich nicht!« Dagmar bemühte sich um ein festes Auftreten.
Der Anführer lachte. »Ach, junge Frau, Sie glauben ja gar nicht, was alles geht! Aber das wollen wir heute überhaupt gar nicht unter Beweis stellen. Ich habe ja schon gesagt: Dies ist ein Freundschaftsbesuch. Und deswegen werden wir uns auch wie Freunde benehmen.«
Der Grobschlächtige lachte. Er ließ sich in den Sessel fallen, lehnte sich zurück, dass das Möbelstück ächzte, und legte seine Stiefel auf den Tisch.
»Wo ist die Kellertreppe?«, fragte Otto noch einmal. Er sprach ganz ruhig, aber dennoch klang es bedrohlich. Otto hatte eine hässliche Narbe auf der Stirn, und er sah aus wie jemand, der einer Schlägerei sicher nicht aus dem Wege ging.
Dagmar wies auf die Tür zum Keller.
»Wollen Sie nicht mitkommen?«, fragte Otto lauernd.
Die Männer lachten, aber der Anführer sagte: »Red keinen Unsinn! Frau Berger bleibt hier. Du wirst doch wohl in der Lage sein, allein ein paar Flaschen aus dem Keller zu holen!«
Horst, der Achtjährige, der offenbar ebenfalls spürte, dass die Lage ziemlich angespannt war, wandte sich an den netten SA-Mann, mit dem er zuerst gesprochen hatte: »Möchtest du meine Briefmarken sehen?«
»Deine Briefmarken? – Ja, warum nicht. Zeig mir mal deine Briefmarken. Ich sammle nämlich auch Briefmarken, musst du wissen.«
»Du sammelst Briefmarken?«, lachte der Grobschlächtige.
»Ja, das tue ich. Hast du etwa was dagegen?«
Vom Keller her hörte man lautes Klirren, so als ob ein ganzes Regal umgestoßen worden wäre. Dagmar sprang auf. Der Anführer hielt sie zurück. »Kein Grund zur Beunruhigung«, sagte er. »Der Otto ist manchmal etwas ungeschickt, das muss man ihm nachsehen. Da geht schon mal was zu Bruch. Deswegen lassen wir ihn das ja üben.«
Der Wein, dachte Dagmar. Oder das Eingemachte. Egal – was auch immer da zu Bruch gegangen sein mochte, das war unwichtig. Hauptsache, keiner tat den Kindern etwas. Aber die SA-Männer ließen sich von Horst das Briefmarkenalbum zeigen, und von Susanne war nach wie vor nichts zu hören und zu sehen. Dabei musste sie doch mitbekommen haben, dass hier unten nicht alles mit rechten Dingen zuging.
Otto kam mit drei Flaschen Weißwein aus dem Keller. Eine davon rutschte ihm aus den Händen, aber der Teppich fing den Sturz auf, und die Flasche blieb heil. »Oh!«, sagte Otto. »Das wäre beinahe schiefgegangen!«
»Der Korkenzieher ist wahrscheinlich in der Küche«, sagte der Anführer.
»Das geht aber nun wirklich nicht!«, protestierte Dagmar noch einmal.
»Doch, doch, das geht!«, sagte einer der Männer, der inzwischen im Buffet nach Weingläsern suchte. »Sind das hier die richtigen?«
»Viel zu klein!«, befand der Anführer.
»Diese hier?« Er hielt einen der Römer aus dem bunten, böhmischen Kristallglas hoch.
»Ja, die sind besser.«
Horst, der sich unerschütterlich um Harmonie bemühte, zeigte seine Briefmarken.
»Das ist ja eine schöne Sammlung«, sagte der nette SA-Mann.
»Die meisten davon sind von seinem Großvater.« Dagmar strich ihrem Sohn über das Haar.
»Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass die ziemlich alt sind. Von einem König Alfons habe ich noch nie etwas gehört.« Er wandte sich an seine Kameraden: »Oder habt ihr schon mal etwas von König Alfons gehört?«
»Alfonso«, verbesserte ihn Horst.
»Wie auch immer. Jedenfalls ist das eine ganz tolle Sammlung. Und so viele ausländische Marken! Bekommt ihr viel Post aus dem Ausland?«
»Nein«, sagte Dagmar.
»Doch, manchmal«, verbesserte sie Horst.
Die SA-Männer hatten inzwischen das ganze Erdgeschoss inspiziert und waren am Ende mit einem Korkenzieher zurückgekommen. Einer von ihnen entkorkte die drei Flaschen Weißwein. Die anderen hielten ihre Gläser hin, und Otto füllte sie bis zum Rand.
»Wo die wohl alle herkommen?«, fragte der freundliche SA-Mann. »Die hier zum Beispiel. Was steht da? Correos – was soll das denn heißen? Correos kenne ich nicht. Liegt das in Südamerika?«
»Das heißt bestimmt Korea«, mischte sich Otto ein.
Horst wusste es besser: »Die sind aus Spanien«, sagte er. »Hier, hier oben steht es doch: República Española!«
»Du kennst dich ja gut aus!«
Dagmar konnte nur hoffen, dass die SA-Männer sich nicht so gut auskannten. Zum Glück waren es auch nur wenige Marken aus Spanien, und die meisten waren in der Tat ziemlich alt. Wilhelms Vater hatte eine große Menge Briefmarken hinterlassen. Susanne hatte dagegen von ihren Marken nicht viele herausgerückt.
Dagmar wusste nicht, was sie tun sollte. Dass es sich nicht um einen reinen Freundschaftsbesuch handelte, das war offensichtlich. Aber worum ging es? Erst hatte sie befürchtet, dass Susanne irgendeine Dummheit begangen haben könnte, aber da die Männer bisher überhaupt noch nicht von Susanne gesprochen hatten, ging es offenbar nicht um ihre Tochter. Aber worum dann?
»Und was liest man denn so in gebildeten Kreisen?«, fragte einer der SA-Männer. Er öffnete den Bücherschrank. »Ah, ja, ich sehe schon!« Er nickte anerkennend mit dem Kopf. »Ernst Jünger und Ettighofer – das sind ja richtig gute Bücher! Die habe ich selbst gelesen. Oder wenigstens angefangen zu lesen.«
Das waren die Bücher, die Wilhelm damals eingesammelt hatte, als sein Kollege Kosinski sich erschoss. Der Vermieter hatte seinen Nachlass einfach auf die Straße gestellt.
»Und hier in der zweiten Reihe ...« Der SA-Mann machte sich daran, die Bücher aus dem Schrank zu räumen.
Dagmar wusste, was in der zweiten Reihe stand.
»Na ja, wenn ich mir das hier so ansehe, dann muss ich schon sagen, das ist nicht gerade die beste Literatur! Das haben Sie schon richtig gemacht, diese Dinger ganz in die hinterste Ecke zu verbannen. Da sind ja Sachen dabei, die hätten längst verbrannt werden müssen. Die haben Sie wohl vergessen damals. Ist auch kein Wunder, wo sie hinter all den anderen Büchern stehen. So war es doch, oder?«
Dagmar nickte. Was blieb ihr anderes übrig?
»Wissen Sie was«, sagte der Anführer, »wir nehmen den ganzen Krempel am besten gleich mit. Dann haben Sie da keinen Ärger mehr mit. Otto, geh doch noch mal in den Keller und bring einen ordentlichen Pappkarton mit; da packen wir dann das ganze Zeugs rein, und dann nehmen wir das nachher mit. Da brauchen Sie sich gar nicht drum zu kümmern.«
Otto machte sich auf den Weg.
In diesem Augenblick gab es im oberen Stockwerk ein Geräusch, so als ob jemand ein Fenster öffnete. Susanne! Mein Gott, dachte Dagmar, jetzt springt sie aus dem Fenster. Im nächsten Augenblick hörte man draußen tatsächlich einen dumpfen Aufschlag und dann einen unterdrückten Schrei.
»Was war das?«, fragte der Anführer der SA-Männer.
Er brauchte nicht lange auf die Antwort zu warten. Die Tür ging auf, und ein weiterer SA-Mann kam herein, der Susanne hereintrug.
»Loslassen!«, rief sie.
Der SA-Mann ließ sie los. Susanne schrie auf: »Mein Bein!«
Dagmar nahm ihre Tochter in den Arm. »Was ist passiert?«, fragte sie.
Der SA-Mann grinste. »Dieses kleine Vögelchen hier, das wollte davonfliegen«, sagte er. »Aber es ist nicht weit gekommen. Es ist noch nicht flügge. Es ist im Garten gelandet und hat sich das Bein verstaucht.«
Einer der Männer sagte: »Ich geh dann mal nach oben und mach das Fenster zu! – Nicht, dass es da am Ende noch reinregnet!«
Auch das noch! Das fehlte noch, dass die SA in ihren Schlafzimmern herumwühlte. Aber Dagmar war machtlos. Der Mann verschwand nach oben.
Otto war inzwischen mit einem großen Pappkarton aus dem Keller zurückgekehrt. »So«, sagte er, »dann wollen wir mal alles hübsch einpacken!« Er machte sich daran, die Bücher aus der zweiten Reihe des Schrankes auszuräumen.
In dem Augenblick wurde die Haustür aufgerissen. Ein SA-Mann rief: »Da kommt ein Wagen!«
Der Anführer steckte zwei Finger in den Mund und pfiff gellend. Im Nu kam der Mann aus dem Obergeschoss zurück. Alle standen auf. Der Anführer nahm noch rasch einen Schluck Wein; dann sagte er: »Es war nett bei Ihnen, Frau Berger, aber ich glaube, jetzt müssen wir gehen! Wir haben ja schließlich noch andere …«
»Was ist hier denn los?« Berger und Fehlandt standen in der Tür.
»Nur ein kleiner Freundschaftsbesuch«, sagte der SA-Führer. »Wir wollten gerade gehen.« Die übrigen Männer drängten sich an ihm vorbei nach draußen.
»He, halt! Was bedeutet das alles?«
»Auf Wiedersehen!«, rief der SA-Mann. »Und Heil Hitler!« Im nächsten Moment war er verschwunden.
»Mistkerle!«, rief Fehlandt ihnen nach.
»Dagmar, was ist passiert?«, fragte Berger.
Horst war schneller: »Die Männer haben sich meine Briefmarken angeguckt!«, sagte er. »Und sie wollten die alten Bücher mitnehmen, die keiner mehr lesen will. Aber die haben sie nun doch vergessen.«
Susanne saß im Sessel und weinte.
»Ich weiß nicht, ob das so ohne Weiteres weggeht!« Fehlandt hatte die Gläser zur Seite geräumt, die Tischdecke über eine Stuhllehne gehängt und war jetzt dabei, die Tischplatte mit einem Handtuch zu trocknen. Horst war auf dem Weg ins Bett.
»Immerhin«, sagte Wilhelm, »die Gläser haben sie heil gelassen.«
»Als ob es darauf ankommt!«, sagte Susanne böse. »Die SA war hier. Bei uns in der Wohnung! Begreift das doch endlich! Und die sind nicht hier gewesen, um Flecke auf dem Eichentisch zu machen oder um Gläser kaputt zu machen oder heil zu lassen, denen geht es um ganz etwas anderes!«
»Ja, das verstehen wir ja«, sagte Fehlandt rasch. »Aber um was?«
»Woher sollen wir das wissen?«
Berger zuckte mit den Schultern. »Was weiß ich? Bei mir im Dienst ist jedenfalls nichts vorgefallen, womit ich mir den Zorn der Braunhemden zugezogen haben könnte. Aber wie sieht es bei dir aus, Susanne?«
»Bei mir?«, fragte Susanne empört.
»Hast du irgendetwas getan oder gesagt, was die Herrschaften verärgert haben könnte?«
»Keiner von uns hat irgendetwas Derartiges getan«, mischte Dagmar sich ein.
»Schon gut, schon gut!« Es hatte keinen Sinn, diesen Punkt jetzt weiter zu vertiefen. Aber Wilhelm Berger wusste, dass seine Tochter zu unüberlegten Äußerungen neigte. Es bestand immer die Gefahr, dass sie irgendwo aneckte. »Ich meine ja nur, wir müssen alle vorsichtig sein. Und du ganz besonders, Susanne.«
»Warum ich ganz besonders? Glaubst du, ich bin jemand, der uns alle leichtfertig in Gefahr bringt?« Susanne war wirklich aufgebracht.
Dagmar legte ihr die Hand auf die Schulter. »Das behauptet niemand, Susanne. Was Papa sagen will, glaube ich, ist, dass du diejenige von uns bist, die unter den gegenwärtigen Umständen am stärksten gefährdet ist. Man kann es dir zwar nicht ansehen, Kind, aber du bist nun einmal zu drei Vierteln jüdisch. Und was das in der heutigen Zeit bedeutet, das brauche ich dir ja nicht erst zu sagen.«
»Es war schwierig genug, dafür zu sorgen, dass du in den BdM aufgenommen worden bist«, setzte Wilhelm Berger nach. Das war überhaupt nur gelungen, weil er Polizist war, und weil er damit gedroht hatte, seinen Chef einzuschalten. Das hatte gewirkt. Zum Glück. In Wirklichkeit hätte ihn sein Chef in dieser Angelegenheit sicher nicht unterstützt.
»Ich lege keinen Wert darauf, in diesem Bund deutscher Mädel mitzuspielen«, sagte Susanne. Sie massierte ihr Bein. Zum Glück war es nicht gebrochen.
Dagmar versuchte, sie zu beruhigen. »Es gibt Dinge«, sagte sie, »bei denen hat man einfach keine Wahl. Dazu gehört, dass Papa in die Partei eintreten musste, und dazu gehört auch deine BdM-Mitgliedschaft. Die Nazis haben wenig Verständnis für Leute, die sich nicht an ihre Regeln halten.«
Fehlandt sagte: »Es kommen auch wieder andere Zeiten. Aber wenn man die erleben will, dann muss man sehen, dass man vorher nicht ... ausscheidet.«
»Ihr ... lasst euch einfach alles gefallen!«
»Manchmal«, sagte Dagmar, »manchmal muss man sich einiges gefallen lassen. Du bist mutig gewesen, du bist aus dem Fenster gesprungen, um Hilfe zu holen, aber was hat es dir genützt: gar nichts! Das Einzige, was es eingebracht hat, ist ein verstauchter Fuß.«
»Mama hat recht«, sagte Berger. Aber er war keineswegs gewillt, sich alles gefallen zu lassen. Heute hatte er sich überrumpeln lassen, aber diesem Fatzke von der SA, dem würde er es heimzahlen!
»Horst, du wolltest doch ins Bett gehen!«, sagte Dagmar. Horst war im Schlafanzug auf der Treppe erschienen. Er ignorierte Dagmars Anweisung.
»Wer war das überhaupt, der die Gruppe angeführt hat?«, fragte Fehlandt.
Dagmar zog die Schultern hoch. »Der Mann hat sich nicht vorgestellt.«
»Irgendein Truppführer«, sagte Fehlandt. »Jedenfalls hatte er diese zwei Sterne am Kragenspiegel.«
Dagmar fragte: »Dieser SS-Mann, euer unmittelbarer Vorgesetzter, kann es sein, dass die ganze Aktion von dem ausging?«
»Von Herbert?« Fehlandt schüttelte den Kopf.
»Sehr unwahrscheinlich«, befand auch Berger. »Schutzstaffel und Sturmabteilung – die haben nichts miteinander zu tun. Das sind Konkurrenten, die sich gegenseitig nicht grün sind. Wenn diese Geschichte von der SS ausgehen würde, dann hätten sie ihre eigenen Leute geschickt. Dann wäre der Besuch wahrscheinlich deutlich unangenehmer ausgefallen.«
»Dies war unangenehm genug«, sagte Dagmar.
Horst widersprach: »Ich fand, die Männer waren ganz nett.«
Als ob die Erde sie verschluckt hätte
13. Oktober
Berger hatte schlecht geschlafen. Der Besuch der SA bei ihm zu Hause ging ihm nicht aus dem Kopf. Herbert Richter, den er gleich als Erstes darauf ansprach, wusste von nichts. »Du musst das zurückstellen«, sagte er. »So bedauerlich das für dich auch sein mag – im Augenblick hat Anna Altmann Vorrang. Wir müssen alle Energie da hineinstecken, das Kind zu finden.«
Das war eine Selbstverständlichkeit. Kaum hatten sie ein paar Worte miteinander gewechselt, da schrillte schon das Telefon.
Richter zum Chef!
Es gab also tatsächlich Ärger wegen der Eigenmächtigkeit gestern Abend. Hoffentlich nicht zu viel Ärger. Berger fühlte sich verantwortlich, aber er konnte seinen Vorgesetzten in dieser Angelegenheit nicht vertreten. Großen Aufwand hatten sie betrieben und nichts erreicht. Berger überflog die Niederschriften der Anrufe, die sie auf Grund der Radiodurchsage erhalten hatten. Drei Hinweise, denen die Schutzpolizei nachgegangen war. Alle drei Hinweise hatten sich als falsch erwiesen. Keiner der Anrufer hatte Anna Altmann gesehen.
Fehlandt war dabei, die Akten des alten Falles zusammenzuräumen, den er sich letzte Woche erneut vorgenommen hatte.
»Die kannst du jetzt vergessen«, sagte Berger. »Ist doch sowieso Schnee von gestern.«
Fehlandt schüttelte den Kopf. »Anna Altmann hat jetzt natürlich Vorrang, aber das hier – das nehme ich mir hinterher wieder vor. Das stimmt doch vorn und hinten nicht!«
»Immer noch dieser Anschlag auf den Gauleiter? Wann war das noch mal? Das muss doch inzwischen schon an die fünf Jahre her sein.«
»Ja, ziemlich genau fünf Jahre. Aber der Fall ist immer noch nicht gelöst. Und diese Vernehmungsprotokolle, die ergeben einfach keinen Sinn.«
»Das ist keine Seltenheit«, sagte Berger.
»Ja, ich weiß, weil die Polizisten, die die Vernehmung durchführen, keine Kurzschrift können und deshalb die Protokolle so knapp wie möglich gestalten. Aber in diesem Fall liegt das Problem woanders: Die Aussagen sind sich einfach zu ähnlich.«
»Du glaubst, da ist etwas abgesprochen worden?«
»Sieh doch selbst!« Fehlandt schob Berger die Akte zu.
Berger überflog die Aufzeichnungen. »Ich sehe, was du meinst«, sagte er.
»Ich muss die Beteiligten von damals noch einmal neu vernehmen.«
»Ja, aber nicht jetzt.« Berger dachte: So weit war es nun gekommen. Da saß sein Kollege Fehlandt, der sich noch vor wenigen Jahren gefreut hätte, wenn Karl Kaufmann wirklich bei diesem Anschlag in die Luft geflogen wäre, und der hatte nichts Besseres zu tun, als den Täter von damals zu jagen.
»Hier ist der Bericht aus Berlin!« Herbert Richter kam mit dem Fernschreiben.
Richtig. Die Vernehmung des Vaters. Berger las:
In den frühen Morgenstunden hat eine Durchsuchung der Altmann’schen Wohnung stattgefunden. Die Wohnung besteht aus einem größeren Schlafzimmer sowie einer Küche, Keller- und Bodengelass. Bei der Durchsuchung war die jetzige Ehefrau Altmann sowie das Pflegekind Elsa Wanner zugegen, während Altmann selbst bereits um 5 Uhr seinen Dienst bei der Berliner Verkehrs-AG angetreten hatte. Die Altmann´sche Wohnung wurde in ihren sämtlichen Teilen wie Betten, Chaiselongue, Schränke, Kisten, Körbe usw. eingehend durchsucht, ohne dass das Geringste, das mit dem Verschwinden der Anna in Verbindung stehen könnte, gefunden wurde. Es fand sich lediglich eine einige Monate alte Postkarte, die Anna an ihren Vater geschrieben hatte. In der Bodenkammer und im Keller war die Durchsuchung gleichfalls ergebnislos. Es sind hier auch keine unbekannten Leichen als aufgefunden verzeichnet worden, auf die die Beschreibung der Anna passen könnte.
Gezeichnet Drager, Kriminalkommissar.
»Also Fehlanzeige«, sagte Fehlandt.
Berger nickte. Er hatte nichts anderes erwartet. »Das hört sich an, als hätten sie die ganze Wohnung auseinandergenommen!«
»Ja, ja! Polizei, dein Freund und Helfer! – Schön wär's ja!«
Berger hatte dafür gesorgt, dass alle Zeitungen benachrichtigt wurden. Außerdem ließ die Kriminalpolizei Handzettel drucken, die an allen Schulen der Umgebung und an die Bevölkerung verteilt wurden. Gesucht wird Anna Altmann. Der Reichssender Hamburg brachte noch immer in jeder Nachrichtensendung ausführliche Fahndungsmeldungen. Alles ohne Ergebnis.
»Die ist tot«, sagte Fehlandt.
»Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben«, widersprach Berger. Aber in Wirklichkeit hatte auch er keine Hoffnung mehr.
»Ich hoffe, dass wir sie finden«, sagte Fehlandt. »Ich weiß, das klingt makaber, aber wenn wir sie nicht finden, dann ist alles noch viel furchtbarer. Dann müssen wir davon ausgehen, dass sie einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist.«
Mussten sie das nicht längst, fragte sich Berger. »Paula Struck«, sagte er. »Allmählich müssen wir uns mit dem Gedanken vertraut machen, dass wir es mit einem zweiten Fall Struck zu tun haben.«
»Ja«, bestätigte Fehlandt. »Daran habe ich gleich gedacht. Wann war das noch mal?«
»25. September 1934. In Lokstedt war das. Paula Struck war sechs Jahre alt. Sie ist verschwunden und nie wieder aufgetaucht.«
»Als ob die Erde sie verschluckt hätte.«
»Es gibt ja Gegenden, wo so etwas möglich wäre«, sagte Fehlandt. »Dass jemand von der Erde verschluckt wird. Im Karst zum Beispiel. Da kann es vorkommen, dass sich im Untergrund eine Höhle bildet, und wenn man Pech hat, stürzt sie gerade ein, wenn man obendrüber steht.«
»Aber Karst – das ist irgendetwas, was im Erdkundebuch steht. Das gibt es vielleicht in Jugoslawien, oder wo noch? In der Schwäbischen Alb meinetwegen. Aber doch nicht hier bei uns.«
»Doch, auch hier bei uns. Du kennst doch den Bahrenfelder See. Das soll so ein Karstsee sein. Und dann gibt es alte Berichte, dass irgendwo da in Othmarschen einmal die Erde eingebrochen sei, und mehrere ausgewachsene Eichen sind im Boden versunken.«
»Ammenmärchen!«
»Nein, aber das ist eine sehr alte Geschichte. Über hundert Jahre alt. Und dennoch …«
Berger schüttelte den Kopf. »Wenn das gestern wirklich passiert wäre, dann würde man doch das Loch sehen und das Kind herausziehen. Das ist völlig unmöglich.«
»Die Anna? – Eine ganz normale Schülerin.« Die Lehrerin unterbrach sich und hustete. »Entschuldigung. Das kommt vom Rauchen. Wahrscheinlich sollte ich nicht rauchen ...«
Berger zuckte mit den Achseln. »Das tun wir alle«, sagte er. Sie saßen im Lehrerzimmer.
»Jedenfalls ist die Anna nicht besonders auffällig. Sie ist keine von den Dummen, das nicht, aber auch niemand, den ich für die Aufnahmeprüfung zum Gymnasium empfehlen würde. Fleißig natürlich, wie alle Mädchen in dem Alter, aber der Fleiß allein bringt es ja auch nicht.«
Berger nickte. »Und – als Mensch?«
»Als Mensch?«
»Na ja, im Umgang mit anderen.«
»Normal«, sagte die Lehrerin.
Das reichte Berger nicht. »Ist sie ein typisches Stadtkind? Ist sie das, was man als gewieft bezeichnen würde?«
»Nein, das nicht. Ich meine, man merkt natürlich, dass sie in der Stadt aufgewachsen ist. Aber gewieft ist sie nicht. Eher harmlos.«
»Naiv?«
»Vielleicht auch das. Jedenfalls ist sie eines der Kinder, das man nicht allzu oft ermahnen muss. In der Regel tut sie das, was man ihr sagt.«
Das ist schlecht, dachte Berger. Aber natürlich galt das in gewisser Weise für alle Kinder. Auch Horst und Susanne taten in der Regel, was man ihnen sagte. »Also waren Sie überrascht, dass sie heute nicht in der Schule war?«
»Nicht besonders. Fast jeden Tag fehlt irgendjemand. Und auch wenn der Herbst bis jetzt recht milde verlaufen ist, so ist dies doch eine Zeit, in der verstärkt Erkältungen auftreten.«
»Dann würde es also gar nicht besonders auffallen, wenn ein Kind fehlt? Ich meine, sind Sie sich überhaupt völlig sicher, dass die Anna Altmann nicht im Unterricht gewesen ist?«
Die Lehrerin lächelte. Sie legte ein Blatt Papier auf den Tisch. »Das ist die Milchliste«, sagte sie. »Die Kinder kriegen täglich ihre Milch. Und auf dieser Liste wird abgehakt, wer seine Milch bekommen hat. Damit sich niemand zweimal anstellt.«
Die Polizisten warfen einen Blick auf die Liste. Unter dem gestrigen Datum gab es keinen Haken hinter Annas Namen.
Die Polizisten waren gegangen. Die Lehrerin stand am Fenster und sah zu, wie sie wieder in ihr Auto stiegen. Sie zündete sich eine Zigarette an. Was für eine üble Geschichte, dachte sie. Die kleine Anna – das war eines der Mädchen, das man einfach gern haben musste. Auch wenn sie natürlich ihre kleinen Schwächen und Fehler hatte. Zum Beispiel hatte sie die letzten beiden Tage einfach keine Hausaufgaben gemacht. Und zu spät gekommen war sie auch. Aber wozu hätte sie den Polizisten das erzählen sollen?
Fehlandt und Richter waren zusammen losgezogen, um Anna Altmanns Klassenkameraden zu vernehmen. Und Fehlandt staunte. Richter, der im Kreise der Kollegen immer ein wenig gehemmt und unsicher wirkte, war hier offenbar in seinem Element.
»Guten Morgen, Kinder«, sagte Richter. »Ihr habt sicher alle gehört, dass die Anna verschwunden ist. Und ich, ich bin von der Polizei. Wir wollen die Anna finden und sie wieder nach Hause zu ihrer Mutti bringen.«
»Aber du siehst gar nicht aus wie ein Polizist!«, sagte einer der Jungen.
»Ich bin bei der Kriminalpolizei«, sagte Richter. »Wir tragen keine Uniform bei der Kriminalpolizei.«
»Nein, das meine ich nicht«, beharrte der Junge. »Ich meine, dass du so nett aussiehst!«
»Findest du? – Nun, ich finde dich auch nett. Ich finde euch alle nett. Ich mag Kinder. Und ich kann euch versichern, wir haben viele nette Kollegen bei der Kriminalpolizei.«
»Die meisten Polizisten, die ich kenne, die sind alt und böse«, sagte ein Mädchen zweifelnd.
»Dann kennst du die falschen Polizisten!«, behauptete Richter. »Ich glaube, ihr solltet uns alle mal im Präsidium besuchen, damit ihr sehen könnt, wie wir arbeiten, und dass die meisten von uns überhaupt gar nicht böse sind. – Aber zunächst einmal müssen wir gemeinsam ein kleines Rätsel lösen.«
»Was denn für ein Rätsel?«
»Das Rätsel, wie eure Anna verschwunden ist. Wir haben von ihrer Mutter gehört, dass sie gestern ganz normal zur Schule gegangen ist. Aber eure Lehrerin hat uns erzählt, dass sie hier nicht angekommen ist. Das stimmt doch, oder?«
»Ja«, sagten die Kinder.
»Hat denn vielleicht jemand von euch die Anna gestern Morgen noch gesehen?«
Ein Mädchen meldete sich.
»Hast du sie gesehen?«
»Ja.«
»Und wo ist das gewesen?«
»Beim Kino ist das gewesen. Ich hab noch gerufen: ›Anna, kommst du mit?‹ Denn es war schon ziemlich spät, und ich musste mich beeilen.«
»Und ist Anna gekommen?«
Das Mädchen schüttelte den Kopf. »›Gleich‹, hat sie gesagt. Ich hatte noch überlegt, ob ich auf sie warten sollte, aber ich bin dann doch lieber gerannt. Ich wollte ja nicht zu spät kommen.«
»Und die Anna, die hat einfach nur so da gestanden?«
»Nein, sie hat sich die Bilder von dem Film angeguckt.«
»Weißt du, was das für ein Film gewesen ist?«
»Ja, natürlich. Lockenköpfchen ist das gewesen. Mit Shirley Temple.«
»Den Film habe ich auch gesehen«, sagte Richter. »Was für ein niedlicher Film!«
»Ich auch«, rief ein anderes Mädchen, »ich auch!«
Fehlandt stellte sich vor, wie Richter in seiner furchteinflößenden SS-Uniform zwischen all den kleinen Mädchen im Kino gesessen und Lockenköpfchen geguckt hatte. Aber vermutlich war er in Zivil gewesen.
»Ich hab sie auch gesehen!«, meldete sich ein Junge zu Wort. »Die Anna meine ich. Nicht den Film.«
»Und wo ist das gewesen?«
»Das war bei diesem Vogelgeschäft. An der Ecke Sophienstraße/Eimsbüttler Chaussee.«
Fehlandt sagte nichts, aber er zog die Augenbrauen hoch. Die Kinder mussten doch ungefähr zur gleichen Zeit zur Schule gegangen sein. Und die Anna konnte nicht gut gleichzeitig an zwei Orten gewesen sein.
Richter fragte: »Und das war ganz bestimmt die Anna?«
»Ja, natürlich. Die kenne ich doch! Die hat doch diesen Pickel auf der Hand. Die kann man gar nicht verwechseln. Nach der Schule ist das gewesen, so zwischen elf und zwölf. Wir hatten ja gestern früher Schluss.«
»Und – hast du mit der Anna gesprochen?«
Nein, das hatte er nicht. Mit Mädchen sprach man doch nicht. Jedenfalls nicht, wenn man in der zweiten Klasse war.
»Und was hat sie da gemacht, die Anna?«
»Ins Schaufenster geguckt. Das tue ich auch manchmal. Die haben ganz viele bunte Vögel in dem Laden ...«
»Magst du gern Tiere?«
Der Junge nickte.
»Ich auch«, sagte Richter. »Aber ich durfte nie welche haben zu Hause.«
»Ich auch nicht. Papa will das nicht.«
»Glaubst du, dass die Anna da auf jemand gewartet hat?«
Das wusste der Junge nicht. Dann sagte er: »Kann ich dich etwas fragen?«
»Ja, natürlich.«
»Hast du eigentlich eine Pistole?«
»Ja klar, ich habe auch eine Pistole.«
»Hast du die dabei? Kann ich die mal sehen?«
Richter gab dem Jungen die Pistole.
Fehlandt verschlug es den Atem. Was tat der da?
»Eins musst du wissen«, sagte Richter. »Eine Pistole ist etwas sehr Gefährliches. Diese ist jetzt nicht geladen. Aber ganz gleich, ob sie geladen ist oder nicht, man zielt damit niemals auf andere Menschen.«
Der Junge legte die Waffe vorsichtig auf den Tisch.
»Darf ich auch mal?«, rief ein anderer Junge.
»Ich auch?«
»Ja, natürlich.« Richter tat so, als hätten sie alle Zeit der Welt.
Fehlandt gab ihm ein Zeichen; dann machte er sich auf den Weg.
Berger hatte sich die Akte Paula Struck vorgenommen. Es war eine dünne Akte. Unerledigt. Die sechsjährige Johanne Friederieke Paula Struck war am 25. September 1934 gegen 14.30 Uhr zum Spielen auf die Straße gegangen. Vor der elterlichen Wohnung war sie zuletzt um 16 Uhr gesehen worden. Danach war sie spurlos verschwunden. Um 19.30 Uhr hatten die Eltern das Kind bei der Polizei in Lokstedt vermisst gemeldet. Die preußische Polizei hatte sofort reagiert – Lokstedt gehörte damals noch zu Preußen – und über den Sender Hamburg nach dem Kind suchen lassen. Ohne Ergebnis. Niemand hatte das Mädchen gesehen. In der Beschreibung hieß es: 1,20 Meter groß, schwächlich, dunkelblonder Pagenkopf, an beiden Knien Narben und – auf der beigefügten Fotografie deutlich erkennbar – ein Teil der rechten Augenbraue fehlte. Bekleidet war Paula mit einem hellblauen Seidenleinenkleid mit halblangen Ärmeln und Schulterkragen, blauweiß gemustertem, ärmellosem Kittel, Kragen dunkelblau, weißem Unterrock, langen, grauen Strümpfen mit weißen Strumpfbändern. Sie trug schwarze Schnürschuhe mit Einlagen.
Der Vater war Bauunternehmer, also nicht ganz mittellos. Die Hoffnung, dass vielleicht eine Lösegeldforderung eingehen könnte, hatte sich jedoch nicht erfüllt. Das Kind blieb verschwunden. Bei Wiedervorlage der Akte ein Jahr später hatte der zuständige Kriminal-Bezirkssekretär geschrieben:
Trotz aller Nachforschungen fehlt bisher jede Spur. Es besteht die Vermutung, dass das Kind entführt und festgehalten oder in der Umgebung von Lokstedt verunglückt ist, oder aber auch, dass es einem Sittlichkeitsverbrechen zum Opfer gefallen ist.
Berger schüttelte den Kopf über so viel Scharfsinn.