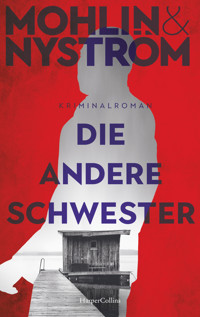10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ecco Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Karlstad-Krimi
- Sprache: Deutsch
Tragödien verjähren nie — ein neuer Fall für den ehemaligen FBI-Agenten John Adderley
In einem Vogelnest wird ein Stück eines menschlichen Knochens gefunden. Der kleine schwedische Ort ist in Aufruhr, denn vor dreißig Jahren verschwanden die Brodin-Zwillinge auf mysteriöse Weise von einem Spielplatz in der Stadt. Stammt der Knochen von einem der Jungen? Warum taucht der Knochen jetzt auf? In der Straße, in der die Zwillinge wohnten, werden die Spekulationen immer wilder. Der frühere FBI-Agent John Adderley — jetzt Bezirksbeamter in Karlstad — hat den erneut geöffneten Fall auf seinem Schreibtisch und muss sich zeitgleich um seine neunjährige Nichte kümmern.
Der dritte Teil der beliebten schwedischen Krimi-Reihe um den Ermittler John Adderley
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 624
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Die Originalausgabe erschien 2023 unter dem TitelDen tysta fågeln bei Norstedts, Stockholm.
© by Peter Mohlin, Peter Nyström
Deutsche Erstausgabe
© 2024 für die deutschsprachige Ausgabe
HarperCollins in der
Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH, Hamburg
Covergestaltung von Hauptmann & Kompanie, Zürich
Coverabbildung von rck_953, elwynn, Anna in Sweden, BG Plus2 | Shutterstock
E-Book-Produktion von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN E-Book 9783749906215
www.harpercollins.de
TEIL 1
1.
»Ich sagte, ihr sollt aufhören!«
Als John die wütende Männerstimme hörte, wandte er den Blick vom Fußballfeld ab. Auf dem Hang am Waldrand grinsten zwei kleine Jungen einen Mann mit einer leuchtend gelben Kappe an, der ihr Vater zu sein schien. Die Jungen hatten Steine in der Hand und warfen sie unbekümmert auf ein Vogelnest in einer der Birken. John schüttelte den Kopf. Hätte er seinen Vater so ignoriert, hätte er eine Ohrfeige und Hausarrest bekommen.
Er achtete nicht weiter auf die frechen Kinder und konzentrierte sich wieder auf das Spiel. Die Heimmannschaft Grums IK traf im Stadion von QBIK auf die Karlstädterinnen, und es war immer noch kein Tor gefallen.
Nicole schnappte sich den Ball und dribbelte in die gegnerische Hälfte. Jetzt hatte sie nur noch zwei Grumser Verteidigerinnen zwischen sich und der Torhüterin. Sie zog nach rechts und schoss den Ball knapp am Pfosten vorbei. Enttäuscht sank sie auf die Knie und vergrub ihr Gesicht in den Händen.
»Guter Versuch, Nicole! Nächstes Mal machst du’s«, rief der Trainer von der Bank.
Nicole warf einen kurzen Blick zu John, der am Rande des Geschehens stand. Er nickte ihr aufmunternd zu, und sie rappelte sich wieder auf. Ihre dünnen Beine arbeiteten wie wirbelnde Trommelstöcke.
John liebte es, seiner Nichte beim Fußballspielen zuzusehen. Da war etwas in den Augen des Mädchens, das sich veränderte. Ein plötzliches Selbstvertrauen, das sie in einen anderen Menschen verwandelte. Oder zu sich selbst, dachte er. In die, die sie wirklich war. Eine gesunde, glückliche Neunjährige, die Lust auf das Leben hatte. Acht Monate war es her, dass ihr Vater gestorben war, und die Trauer und der Verlust waren immer noch groß. Außer hier. Auf dem Spielfeld schien es nichts anderes zu geben als den Ball und das Tor, in das er geschossen werden sollte.
John rückte die dunkle Sonnenbrille zurecht, die ihm auf die Nasenspitze gerutscht war. Nach über zwanzig Jahren in den USA hatte er vergessen, wie erbarmungslos das nordische Licht auch im Mai schon sein konnte. Jeden Morgen weckten ihn die Sonnenstrahlen, die sich ihren Weg durch die Panoramafenster seiner Wohnung bahnten. Die Firma, die versprochen hatte, Verdunkelungsvorhänge anzubringen, hatte den Liefertermin bereits zweimal verschoben. Wenn sie nächste Woche nicht kamen, würde er ihnen Feuer unter dem Hintern machen.
»Entschuldigen Sie, aber Sie sind doch Polizist, oder?«
John sah die Frau an, die auf ihn zukam. Sie war die Mutter von einem der Mädchen aus dem Team.
»Ja, das stimmt«, sagte er.
»Ich denke, da ist etwas, das Sie sich ansehen sollten.«
Die Frau ging vor ihm den Hang hoch, ohne auf eine Antwort zu warten. John folgte ihr quer durch die verlassenen Picknickdecken. Er war so in das Spiel vertieft gewesen, dass er nicht bemerkt hatte, wie die Familien der Spielerinnen ihre Kaffeetafel verlassen und sich in einem Kreis am Waldrand versammelt hatten.
»Was ist passiert?«, fragte er, als sie sich der Gruppe näherten.
Wie immer fühlte er sich in seinem grauen Anzug unter all den Trainingsanzügen ziemlich overdressed. Es war ein ganz normaler Donnerstag, und es war noch nicht einmal fünf Uhr nachmittags. Trotzdem schien es, als hätten die Leute nach der Arbeit noch Zeit gehabt, sich umzuziehen, bevor sie hierherkamen.
»Das Vogelnest«, sagte die Frau und deutete auf die hoch aufragende Birke. »Es ist runtergefallen.«
Einer der Männer drehte sich um. Es war der Kerl mit der knallgelben Kappe.
»Meine beiden Ganoven haben mit Steinen darauf geworfen«, sagte er. »Sind Sie von der Polizei?«
John nickte.
Der Typ mit der Kappe ging zur Seite und ließ ihn durch. Auf dem Boden hockte eine grauhaarige Frau neben einem Haufen verknäulter Zweige. Zwischen Daumen und Zeigefinger hielt sie einen zehn Zentimeter langen vergilbten Gegenstand, so dick wie ein kräftiger Kugelschreiber.
John nahm die Sonnenbrille ab. »Was ist das?«, fragte er.
»Ein Knochen«, sagte die Frau leise. »Der Vogel muss ihn als Baumaterial benutzt haben. Aber er ist ein wenig merkwürdig.«
»Okay«, sagte John und wartete auf eine Erklärung. Die Frau klang besorgt.
»Wir wissen nicht, von welchem Tier er stammt«, fügte der Mann mit der Kappe hinzu. »Lena arbeitet als Tierärztin, und ich bin leidenschaftlicher Jäger. Aber hier wissen wir beide nicht weiter.«
»Vielleicht hat das Wetter ihn zerstört«, schlug John vor.
»Nein, das denke ich nicht«, antwortete die Frau.
Sie stand auf und hielt ihm den Knochen hin. John trat näher und betrachtete ihn. Die Oberflächenstruktur war noch vorhanden, und er schien nicht allzu verwittert zu sein.
»Ich bin mir nicht sicher, ob es von einem Tier ist«, sagte sie.
John sah sie ungläubig an. »Sie glauben also, er stammt von einem Menschen? Sollte ich das so verstehen?«
»Ich bin Tierärztin, keine Osteologin«, sagte sie. »Aber ich denke, der Knochen sollte der Polizei zur Untersuchung übergeben werden.«
Alle Blicke richteten sich auf John. Was die Frau behauptete, klang absolut ungeheuerlich. Er konnte schon das Gelächter im Café hören, wenn seine Kollegen von der Polizei in Karlstad ihn nach dem Mord an Bambi befragen würden. Gleichzeitig konnte er die Autorität in ihrer Stimme nicht überhören. Sie schien zu wissen, wovon sie sprach.
»Natürlich kann ich ihn zu unseren Technikern bringen«, sagte er.
Ein Mann mit Hund reichte ihm eine Plastiktüte. John zog sie wie einen Handschuh über seine Hand, nahm den Knochen entgegen und knotete die Tüte zu.
Im nächsten Moment ertönten gellende Schreie von den Mädchen auf dem Spielfeld.
John drehte sich hastig um.
Der Ball lag im Tor der Heimmannschaft, und an der Strafraumlinie hob Nicole triumphierend den Arm.
2.
Der Schichtwechsel löste auf dem Parkplatz in Gruvön ein kurzes, aber heftiges Treiben aus. Torgny Hammarström nickte den bekannten Gesichtern der Nachtschicht zu. Sie gingen durch die Tore hinein, er war auf dem Weg nach draußen.
Drei Schichten. Rund um die Uhr. Das ganze Jahr.
Die Fabrik war wie ein Perpetuum mobile, dachte er. Auf der einen Seite kam der Rohstoff hinein – Zellstoff aus dem Wald –, und auf der anderen Seite kamen die Endprodukte heraus: Papier und Pappe.
Torgny erinnerte sich an seinen ersten Arbeitstag. Er war neunzehn Jahre alt gewesen und direkt von der Schule gekommen. An diesem Morgen hatte seine Mutter zwei Lunchpakete gepackt – eines für ihn und eines für seinen Vater. In Gruvön war er Ivars Sohn. Und seine Kollegen machten ihm von Anfang an klar, dass er in große Fußstapfen zu treten hatte.
Sobald Ivar außer Hörweite war, erzählten sie von seinen Heldentaten als Vorsitzender der Papierarbeitergewerkschaft im Jahr 1996. Wie er in seinem blauen Anzug ins Büro gestapft war und auf den Toiletten der Direktion gekackt hatte, als die Abflüsse in den Umkleideräumen der Arbeiter verstopft waren. Und wie er mit einem wilden Streik gedroht hatte, wenn die Beschäftigten mit mehr als dreißig Dienstjahren nicht fünf Tage Urlaub zusätzlich zum Tarifvertrag bekämen.
Als sein Vater vor acht Jahren gestorben war, hatten die Kollegen eine Schweigeminute für ihn eingelegt. Die zusätzlichen Urlaubstage für treue Mitarbeiter gab es immer noch, sie hießen Ivars Woche. In diesem Jahr wollte Torgny seine freien Tage nutzen, um die Holzdielen auf der Terrasse zu erneuern.
Er setzte sich ins Auto und drehte den Schlüssel um. Obwohl er alle Zündkerzen gewechselt hatte, lief der Volvo im Leerlauf nicht sauber. Bevor der Motor wieder ausging, gab er Gas und legte den Gang ein. Die alte Kiste machte einen Satz vorwärts, und er fuhr aus dem Parkhaus.
Fast alle seine Kollegen bogen links ab, auf die Straße, die unter der E18 hindurch nach Grums führte. Er hingegen bog rechts ab, weg von der Gemeinde, hinauf nach Ålvikshöjden. Sechzehn identische Häuser, hoch oben auf einer Landzunge, gleichmäßig zu beiden Seiten der einzigen Straße der Gegend verteilt. Torgny lebte dort seit seiner Kindheit und kannte jeden Baum auf seinem Heimweg.
Nach fast zwei Kilometern durch den Kiefernwald wurde er langsamer. Beatrice war wie immer im Garten und beugte sich über das Blumenbeet vor dem Haus. Als sie das Knirschen der Reifen auf dem Kiesweg hörte, richtete sie sich auf und drehte sich um. In der einen Hand hielt sie einen Strauß Tulpen, in der anderen eine Gartenschere. Ihr lockiges rotes Haar stand offen, und sie hatte bereits ein Kleid angezogen.
Torgny stieg aus dem Auto, ging auf sie zu und küsste sie zärtlich auf die Wange. Ihre Haut war warm von der Sonne und duftete nach dem Parfüm, das sie sich von ihm zu Weihnachten gewünscht hatte.
»Du riechst nach Schweiß«, beschwerte sie sich und stieß ihn von sich. »Geh duschen, wir müssen in einer Viertelstunde bei deiner Schwester sein. Ich habe ein frisches Hemd in den Flur gehängt.«
»Keine Sorge, das schaffen wir schon«, sagte er und nahm die Stufen zur Haustür hinauf mit zwei langen Schritten.
Im Badezimmer warf Torgny seine Klamotten in den Wäschekorb und stieg in die Duschkabine. Er drehte das Wasser auf und spülte sich ab, schäumte die Hände ein und strich sich über den flachen Oberkörper. Er konnte zwar keinen Waschbrettbauch vorweisen, aber er war immer noch besser in Form als die meisten seiner gleichaltrigen Kollegen. Sein Job als Supervisor war eine sitzende Tätigkeit, da konnte er nicht wie ein Scheunendrescher essen. Das Shampoo ließ er weg. Die Elvis-Tolle war schon immer sein Markenzeichen gewesen, und mit frisch gewaschenem Haar funktionierte sie nicht gut.
Nachdem er sich abgetrocknet hatte, wickelte er sich das Handtuch um die Hüfte und zog sein Hemd an. Es war seltsam, aber nach all den Jahren spürte er noch immer ein warmes Gefühl in der Brust, wenn er daran dachte, dass Beatrice dort draußen im Garten auf ihn wartete. Während die anderen Frauen in der Nachbarschaft von Jahr zu Jahr ausgelaugter aussahen, wurde seine Frau immer schöner.
Wie ein Wein, der zur Vollendung reift.
Das waren nicht seine eigenen Worte, sondern ein Gleichnis, das einer der Redner bei den Feierlichkeiten zu Torgnys Fünfzigsten gebraucht hatte. Die Feier hatte vor einigen Jahren im Gemeindehaus von Ålvikshöjden stattgefunden, und die ganze Straße war gekommen. Obwohl es sein Geburtstag war, drehten sich die meisten Reden um Beatrice. Oder besser gesagt, wie froh Torgny sein konnte, sie zur Frau zu haben.
Nach einer besonders schmeichelhaften Ehrung war sie aufgestanden und hatte gerufen: »Ich bin diejenige, die das Glück hatte, Torgny zu heiraten.«
Die Gäste lachten höflich. Aber nur wenige stimmten ihr zu. Nicht einmal Torgny selbst. Er wusste, dass Beatrice eigentlich zu gut für ihn war.
Aber im Stillen sagte er sich, dass es nicht nur Glück war. Sein Werben war von einer Entschlossenheit geprägt gewesen, die ihm in seinem Leben oft gefehlt hatte. Er war geduldiger gewesen als die anderen, und das hatte sich ausgezahlt. Sogar Ivar, der bei den Mädchen, die Torgny zu sich nach Hause einlud, normalerweise die Augen verdrehte, hatte seine Zufriedenheit zum Ausdruck gebracht. »Die solltest du gut festhalten«, hatte er nach dem ersten Sonntagsessen gesagt.
Torgny zuckte zusammen, als die Haustür geöffnet wurde. Beatrice kam in den Flur, legte die Gartenschere auf das Tischchen unter dem Spiegel und zeigte auf ihre Armbanduhr.
»Ja, ich weiß«, sagte Torgny. »Ich ziehe mich nur noch fertig an.«
Er drehte sich um und ging die Treppe zum Schlafzimmer hinauf.
»Du hast das Hemd schief zugeknöpft«, rief sie ihm hinterher.
Torgny blieb stehen und blickte auf sein Hemd hinunter. Beatrice hatte recht. »Ich werde das in Ordnung bringen«, sagte er und dachte wieder an die Worte seines Vaters.
Die solltest du gut festhalten.
Er hatte Ivars Rat befolgt – und würde es auch weiterhin tun.
3.
John schob den leeren Karton zur Seite. Es war die dritte Pizza in dieser Woche, und das waren mindestens zwei zu viel. Nicole hatte seine Routine, Essen aus dem spanischen Tapas-Restaurant nebenan zu holen, über den Haufen geworfen. Die würzigen Würstchen und der Tintenfisch waren einer endlosen Reihe von Teigfladen mit Schinken und Ananas gewichen.
Heute Morgen hatte John gespürt, wie seine Hose an der Taille spannte, und beschlossen, dem Wahnsinn ein Ende zu setzen. Trotzdem konnte er nicht Nein sagen, als seine Nichte den Sieg gegen Grums feiern wollte. Nach einem kurzen Zwischenstopp auf der Polizeiwache waren sie in die Pizzeria am Romstadsvägen gegangen und hatten eine Pizza Hawaii mit nach Hause genommen.
Nicole kaute mit offenem Mund und starrte auf ihr Tablet. Sie fluchte, wenn der animierte Luftballon nicht ihren Bewegungen auf dem Bildschirm folgte.
»Deine Finger sind zu klebrig«, sagte John und reichte ihr die Papierrolle.
Er erhob sich von der Obstkiste, die ihm als Stuhl an dem abgenutzten Kiefernholztisch diente. Der Vermieter der Wohnung, in der er zur Untermiete wohnte, war ein echter Bohemien. Die Wohnung befand sich im einundzwanzigsten Stock eines neu gebauten Hauses in Bryggudden. Sie war wahrscheinlich eine der teuersten in Karlstad, aber die Möbel hätten auch in einem Obdachlosenheim in der Bronx stehen können.
Der Grundriss war so exzentrisch wie die Inneneinrichtung. Zweihundert Quadratmeter ohne Innenwände. Der riesige Raum, oder das Studio, wie es in der Anzeige hieß, bekam Licht aus allen vier Richtungen. Der einzige Stauraum in der Wohnung bestand aus zwei Schränken, die John selbst aufgestellt hatte, weil er es leid war, dass überall Kleider herumhingen.
Er öffnete das Bier, das er aus dem Kühlschrank geholt hatte, und sah Nicole an. Das Mädchen war so energielos. Fast alles, was sie tat oder sagte, schien auf einer Art Autopilot zu laufen. Sie erwachte nur aus ihrem Winterschlaf, wenn ihr ein Fußball vor die Füße geworfen wurde.
Ehrlich gesagt wusste er nicht, wie er mit ihr umgehen sollte. Vermutlich müsste er das Fernsehschauen und das Pizzaessen einschränken, aber was dann? John war kein Psychologe und hatte keine Erfahrung im Umgang mit traumatisierten Kindern. Seine Nichte hatte die Leiche ihres Vaters sehen müssen, nachdem dieser einem Mörder zum Opfer gefallen war. John konnte sich nicht einmal vorstellen, welche Auswirkungen ein solches Ereignis auf ein Kind haben konnte.
Er nahm einen tiefen Schluck von dem Bier und hörte, wie Nicole am Tisch vor sich hin summte. Billy hatte das auch immer gemacht, erinnerte er sich. Unzählige Stunden hatte John den seltsamen Tönen seines Bruders gelauscht, während er im Garten ein altes Radio auseinandernahm oder an seinem Fahrrad bastelte.
Die Ähnlichkeiten zwischen Vater und Tochter nahmen kein Ende. Die Locken in ihrem dunklen Haar, der schmollende Blick, die Art, wie sie lief – das alles war Billy.
John kam sich wie ein schlechter Mensch vor, wenn er Nicole die Schuld dafür gab, dass er immer noch in Karlstad war. Aber Tatsache war, dass die Koffer für den Umzug nach Berlin gepackt gewesen waren, als das Mädchen auf einmal mit blauen Flecken am ganzen Körper in der Winterkälte vor seiner Wohnung gestanden hatte. Sie war aus dem Haus der Pflegefamilie in Snaversrud geflohen, wo sie kurz nach Billys Tod untergebracht worden war.
John hatte keine andere Wahl gehabt, als sie im Empire State wohnen zu lassen. Gleich in der ersten Nacht hatte er ihr erklärt, dass er das Hochhaus so nenne, weil es in den USA einen Wolkenkratzer mit dem gleichen Namen gebe.
Das war fast fünf Monate her, und das Sozialamt hatte immer noch kein neues Zuhause für sie gefunden. Manchmal fragte er sich, ob sie es überhaupt versuchten.
»Können wir nicht unsere eigene Pizza machen?«, fragte Nicole zwischen zwei Bissen.
Er drehte sich zu ihr um. »Warum? Du magst doch die, die wir kaufen.«
»Ja, aber ich habe gehört, dass einige aus der Klasse ihre eigenen machen. Zu Hause. Mit lustigen Gesichtern und so.«
John rang sich ein Lächeln ab. »Ich kann die Jungs in der Pizzeria fragen, ob sie das nächste Mal ein Gesicht für dich machen, ist das okay?«
»Ja, ich denke schon.«
Nicole spielte wieder auf dem Tablet. John hörte, dass sie enttäuscht klang. Er brauchte einen Moment, um herauszufinden, warum. Das Pizzagesicht war nicht das Problem. Sie wollte, dass sie etwas zusammen unternahmen, etwas, das Spaß machte.
John seufzte leise und dachte, dass er noch einmal mit ihr reden musste. Ihr ein für alle Mal erklären, dass sie nur vorübergehend bei ihm lebte, während sie auf ein richtiges Zuhause wartete. Sie musste verstehen, dass er keine Zeit zum Kochen und Spielen hatte. Er konnte sie nur zum Fußball bringen, mehr schaffte er nicht.
Das Handy, das in einer Steckdose über dem Waschbecken aufgeladen wurde, klingelte. John schaute auf das Display. Es war Bengt Anderberg. Der Bezirkspolizeichef von Värmland hatte sich völlig überraschend selbst zum kommissarischen Leiter der Kripo ernannt, solange die vakante Stelle noch nicht besetzt war.
John räusperte sich und drückte den Hörer ans Ohr. »Hallo«, sagte er.
»Du warst heute in Grums, habe ich gehört«, sagte Anderberg in seiner typisch direkten Art.
»Ja, das stimmt. Das mit der Tüte auf deinem Schreibtisch tut mir leid. Aber ich habe gehört, dass du heute länger arbeitest. Wenn du Zeit hast, könntest du das Knochenstück gerne zur Gerichtsmedizin bringen.«
»Das ist bereits geschehen«, sagte Anderberg. »Der Zettel, den du geschrieben hast, hat Bosse und mich neugierig gemacht.«
Bosse, oder Bo Hoffman, wie er eigentlich hieß, war der Leiter der forensischen Abteilung der Polizei von Värmland. Er war im vergangenen Jahr an das Nationale Forensische Zentrum in Linköping ausgeliehen worden, aber jetzt war er wieder in Karlstad.
»Hatte er Zeit, sich das anzusehen?«, fragte John.
»Ja, deshalb rufe ich an«, sagte Anderberg.
John stellte die Bierflasche auf die Spüle. Die Ernsthaftigkeit in der Stimme des Bezirkskommissars verursachte ein unangenehmes Gefühl in seiner Brust.
»Seiner Meinung nach handelt es sich um das Schlüsselbein eines Kindes«, fuhr Anderberg fort. »Wir haben auch den Gerichtsmediziner hinzugezogen, und der kommt zum selben Ergebnis.«
»Oh, Scheiße« war alles, was John hervorbrachte. Er ging ins Badezimmer, damit Nicole das Gespräch nicht mithören konnte. Es war der einzige Raum mit einer Tür, die man schließen konnte. »Wissen wir sonst noch etwas?«
»Nicht viel«, sagte Anderberg. »Aber ich möchte, dass wir uns trotzdem kurz treffen. Bist du zu Hause?«
»Ja.«
»Gut. Ich bin in zehn Minuten auf dem Supermarktparkplatz vor dem Haus.« Anderberg beendete das Gespräch, und John blieb mit dem Handy in der Hand vor dem Spiegel stehen. Mit seinen vierunddreißig Jahren hatte er bereits auf beiden Seiten des Atlantiks in Mordfällen ermittelt, aber noch nie in einem Fall, bei dem das Opfer ein Kind war. Ein älterer Kollege in New York hatte ihn gewarnt, wie er sich fühlen würde, wenn dieser Tag käme.
»Das ist etwas ganz anderes«, hatte er gesagt. »Es geht unter die Haut.«
John spülte sich das Gesicht mit kaltem Wasser ab und ließ die Tropfen über seine Wangen rinnen. Er wollte nicht daran denken, was mit dem Kind passiert war, dem dieses Schlüsselbein gehörte.
4.
Torgny ging, den Arm um Beatrice gelegt, die einzige Straße in Ålvikshöjden entlang. Die Temperatur war perfekt. Die Maiabendsonne war warm genug, dass er keinen Pullover über dem Hemd tragen musste, und die Luft war frühlingsfrisch.
Er ging langsamer, um den kurzen Spaziergang in die Länge zu ziehen. Sie waren schon spät dran, auf eine weitere Minute kam es nicht mehr an. Seine Schwester wohnte in dem Haus am anderen Ende des Geländes, am Wendepunkt, nur ein paar Hundert Meter entfernt.
Torgny verstand nicht, warum seine Frau so gestresst war. Es war ja nicht so, dass sie sich nach Gesellschaft sehnte. Sie und Sussie arbeiteten beide in der häuslichen Pflege, und ihre Beziehung war so frostig geworden, dass der Chef den Dienstplan ändern musste, damit sie nicht in derselben Schicht arbeiteten.
Er ließ Beatrice’ Schulter los und strich ihr über das Haar. Seine Schwester saß mit einer Zigarette im Mund auf der Treppe vor dem Haus. Sie starrte auf ihre Füße und strich sich mit einem Pinsel kirschroten Nagellack auf die Zehennägel. Torgny räusperte sich, um auf sich aufmerksam zu machen.
»Da seid ihr ja. Die feinen Leute kommen mal wieder zu spät.« Sussie schraubte den Deckel des Glasfläschchens zu und steckte es in die Tasche ihrer Jogginghose mit dem Tarnmuster. Sie stand auf und drückte ihre Zigarette in einem mit Wasser gefüllten Glasgefäß aus, das auf dem Geländer stand.
»Bitte sehr«, sagte Beatrice und reichte ihr die Blumen aus dem Garten. »Die Tulpen sind jetzt so schön, dass ich nicht widerstehen konnte, ein paar für dich zu pflücken.«
Sussie nahm den Strauß, ohne sich zu bedanken. »Ich sehe, du hast auch etwas mitgebracht«, sagte sie und deutete mit einem Kopfnicken in Richtung des Weinkartons in Torgnys Hand.
»Ja, du hast mich doch drum gebeten«, sagte er und reichte ihr den Karton.
»Es ist nicht der mit der Katze drauf.« Skeptisch betrachtete Sussie die Verpackung, auf der eine schöne Landschaft mit Weinreben im Vordergrund zu sehen war.
Torgny zuckte die Schultern. »Den mit der Katze gab es nicht mehr, also habe ich einen anderen gekauft. Ich glaube, das macht nichts.«
Sussie murmelte etwas Unverständliches als Antwort und ging vor ihnen ins Haus. Sie warf die Blumen auf den Küchentisch und öffnete die Backofentür, um die Kartoffeln zu wenden. Torgny sah den schwarzen Glanz in Beatrice’ Augen. Für sie war es genauso schlimm, eine Pflanze zu misshandeln wie ein Haustier zu quälen.
Er schaute sich in der Küche um. Der Besuch bei seiner Schwester war wie eine Reise in die Vergangenheit. Die Geräte waren ausgetauscht worden, aber sonst war alles noch so wie damals, als Sussie und er als Kinder auf dem braunen Linoleumboden Fangen gespielt hatten.
Beatrice hatte Torgny immer wieder darauf hingewiesen, dass er sein Elternhaus Sussies Haus nannte. Das war vielleicht nicht so seltsam, weil sie dort wohnte, aber rechtlich gesehen gehörte es genauso ihm. Oder, besser gesagt, genauso wenig. Seine Mutter lebte noch und war die alleinige Eigentümerin, auch wenn sie jetzt in einer Zweizimmerwohnung in Grums lebte.
Die Geschichte, wie Sussie das Haus übernommen und ihre Mutter daraus vertrieben hatte – Beatrice’ Wortwahl, nicht seine –, war ein wenig wirr. Ähnliches galt für die Scheidung seiner Schwester von ihrem Ex-Mann in Kristinehamn. Klar war nur, dass vier Kinder im schulpflichtigen Alter plötzlich ohne ein Dach über dem Kopf dagestanden hatten und dass das Jugendamt eingeschaltet worden war.
»Wo ist denn Halil?«, fragt Torgny, nachdem Sussie den Karton geöffnet, den Hahn aufgedreht und drei Gläser bis zum Rand gefüllt hatte.
»Er steht am Grill«, sagte sie und nippte misstrauisch am Wein. »Diese Plörre ist ja ungenießbar. Er schmeckt total sauer, findest du nicht?«
Torgny verzichtete auf eine Antwort und nahm sein Weinglas mit auf die Terrasse. Dort stand der neue Mann seiner Schwester, umgeben von einer Rauchwolke. Inzwischen waren Halil und sie seit über zehn Jahren verheiratet.
»Brennt es nicht?«, fragte Torgny.
Sein Schwager hustete. »Ich glaube, es ist zu wenig Anzünder.« Sein hagerer Körper und der markante Hängebauch waren durch den Nebel kaum zu erkennen.
Torgny hob eine Boulevardzeitung auf, die auf Sussies Liegestuhl gefallen war, und wedelte damit über den Briketts herum. Durch die Sauerstoffzufuhr entfachte sich das Feuer, und der Rauch nahm ab.
Halil sah ihn dankbar an. »Fünfundzwanzig Jahre in Schweden, und ich kann immer noch keinen Grill anzünden«, sagte er lächelnd.
Torgny lächelte zurück. Halil war in seinen späten Teenagerjahren allein aus der Türkei gekommen und sprach fast akzentfrei. Grillen war wahrscheinlich der einzige Aspekt des Lebens in Schweden, den er noch nicht beherrschte. Er war ein Meister im Kubb, liebte Allsång på Skansen und wusste mehr über die Eishockeyspieler von Färjestad als alle anderen Männer in Ålvikshöjden zusammen.
»Was ist heute mit Sussie los?«, fragte Torgny. »Sie ist wie eine Gewitterwolke.«
»Ach, mach dir keine Sorgen. Wahrscheinlich hat sie nur Hunger.« Halil öffnete eine Dose Bier und reichte auch ihm eine.
»Nein, danke, ich habe schon was«, sagte Torgny und hob sein Glas. Er nahm einen Schluck und ließ den Wein in seinem Mund kreisen. Nicht so schlimm, dachte er. Sussie will sich nur beschweren.
»Hast du etwas von Markus gehört?«, fragte Halil. »Wie geht es ihm auf der Reise?«
»Gut, denke ich. Beatrice hat gestern eine SMS bekommen, dass er gelandet ist.«
»Neuseeland, oder?«
»Ja, genau. Er wird den ganzen Sommer dortbleiben.«
Torgny mochte es, wenn Halil sich nach seinem Sohn erkundigte. Das tat er fast jedes Mal, wenn sie sich trafen. Er hatte keine eigenen Kinder, und vielleicht war das der Grund, warum er sich so sehr um die Kinder von Sussie und um Markus kümmerte. Jetzt waren sie alle erwachsen, und manchmal schien Halil derjenige zu sein, der sie am meisten vermisste.
Torgny trank noch einen Schluck Wein und blickte in den Garten. Die Apfelbäume, die Ivar gepflanzt hatte, als er und Sussie noch Kinder gewesen waren, blühten rosa und weiß. Letztes Jahr hatte Halil einige gefällt, um ein Gartenhäuschen zu bauen, aber die Bäume, die übrig geblieben waren, reichten immer noch aus, um sie alle mit frischem Obst zu versorgen.
Zwischen den Stämmen waren die Schornsteine der Fabrik zu sehen. Viele hätten gedacht, sie würden die Aussicht stören. Für Torgny war das Gegenteil der Fall, der vertraute Anblick beruhigte ihn. Die Fabrik stand hier seit den Dreißigerjahren und hatte Generationen in Grums Arbeit und Auskommen gegeben. Halil griff nach dem Fleisch, das auf dem Schneidebrett neben dem Grill lag. Er legte die üppigen Rinderfilets auf den Rost über den Briketts, die jetzt nur noch schwach glommen.
»Schöne Dinger«, sagte Torgny anerkennend.
Im selben Augenblick kam ein Windstoß auf und entfachte das Feuer erneut. Hohe Flammen schlugen zwischen dem Grillrost empor.
»Verdammte Scheiße«, fluchte Halil und machte sich auf die Suche nach der Grillzange. Torgny versuchte vergeblich, die Fleischstücke mit den Händen zu fassen. Das Feuer war zu stark, es versengte die Haare an seinen Unterarmen.
Mitten in diesem Chaos öffnete Sussie die Terrassentür. Sie hielt eine Schüssel mit Kartoffeln in den Händen.
»Was machst du da, Halil?«, rief sie. »Du ruinierst ja das Essen!«
Für Torgny war das der letzte Strohhalm. »Nein, jetzt reicht es aber«, sagte er und schaute seiner Schwester in die Augen. »Was ist denn los?«
»Nichts«, schnauzte sie. Ihre Augen verschossen Blitze, die jedes Grillfeuer entfacht hätten.
»Komm schon, irgendwas ist los. Warum bist du so wütend?«
Sussie seufzte und ließ sich auf einen der Stühle sinken. Mit einem Mal war es, als wäre die Wut aus ihr gewichen und einer resignierten Müdigkeit gewichen.
»Du weißt, was es ist«, murmelte sie. »Pål Kratz ist wieder da.«
5.
John stieg in Anderbergs schwarzen Mercedes. Es war ungewöhnlich, dass sie sich außerhalb der Dienstzeit trafen. Der Bezirkspolizeichef leitete die Kripoabteilung nebenher und hatte nur wenige Stunden pro Woche Zeit dafür. In der Praxis überließ er John die operative Arbeit.
»Nun, so kurz vor dem Urlaub kommt das ja wie gerufen«, sagte Anderberg ironisch. »Wo genau hast du den Knochen gefunden?«
»Ich war es nicht«, sagte John und schob den Beifahrersitz zurück, um Platz für seine Füße zu schaffen. Er vermutete, dass sonst immer Frau Anderberg dort saß, und sie konnte nicht sehr groß sein.
»Wer war es?«
John erzählte von Nicoles Fußballspiel und wie die Jungs das Vogelnest abgeschossen hatten.
»Hätten die nicht warten können, bis ich den Chefposten neu besetzt habe?«, klagte Anderberg.
»Was sagt Hoffman zum Alter des Kindes?«, fragte John.
Die Lederpolster knarrten, als sich der Bezirkspolizeichef bewegte. Mit seinem schweren, gebeugten Körper und dem struppigen Schnurrbart erinnerte er an ein Walross. »Zwischen neun und zwölf, je nach Größe.«
»Und das Geschlecht lässt sich nicht bestimmen, nehme ich an?«, fragte John weiter.
»Nein, rein äußerlich nicht. Aber das Labor könnte uns dabei helfen. Hoffman hat mit den Analysten gesprochen, und wenn wir Glück haben, ist noch etwas biologisches Material in den Knochen.«
»DNA, meinst du?«
Anderberg nickte. »Ja. Aber das ist noch nicht sicher. Die Techniker werden morgen früh mit der Analyse beginnen. Am liebsten hätten sie mehr Skelettteile, weil dann die Chance größer ist, einen intakten Zellkern zu finden.«
John blickte durch die Windschutzscheibe. Eine Frau kam mit einem voll beladenen Einkaufswagen und einem mürrischen Kind im Schlepptau aus dem Supermarkt.
»Da ein Vogel den Knochen für sein Nest benutzt hat, muss er aus der Gegend stammen«, sagte er und wandte sich wieder seinem Chef zu.
»Ja, das leuchtet ein«, sagte Anderberg. »Wie weit fliegen Vögel eigentlich, um Material für den Nestbau zu holen?«
John schüttelte den Kopf. Er hatte keine Ahnung. »Da gibt es sicher Unterschiede zwischen den Arten«, sagte er. »Wenn wir eine Chance haben wollen, weitere Überreste des Kindes zu finden, müssen wir das Suchgebiet eingrenzen. Ich muss einen Ornithologen anrufen.«
Der Bezirkspolizeichef lehnte seinen Kopf gegen die Kopfstütze. »Wenn es denn ein Kind ist«, murmelte er.
»Was? Ich dachte, du meintest, sowohl Hoffman als auch der Gerichtsmediziner seien sich sicher, dass …«
»Du verstehst mich falsch«, unterbrach ihn Anderberg. »Ich meine, dass es vielleicht nicht nur ein Kind ist.«
John sah ihn verwirrt an. »Jetzt komme ich nicht mehr mit. Warum sollte es noch mehr geben?«
Anderberg seufzte und fuhr sich mit der Hand über die Oberlippe. »Bis das Labor die Analyse abgeschlossen hat, werden wir nicht wissen, wie alt das Schlüsselbein ist«, sagte er. »Es könnte fünf oder hundert Jahre alt sein. Aber wir können uns darauf einigen, dass das Kind nicht gestern gestorben ist, oder?«
John nickte. Sie hatten beide das vergilbte Knochenstück gesehen. Ein Vogel hätte es niemals in sein Nest bringen können, wenn der Körper, zu dem es gehörte, nicht zersetzt worden wäre.
»Ich verstehe, wenn du da nicht automatisch an etwas denkst«, fuhr Anderberg fort. »Aber diejenigen von uns, die schon eine Weile dabei sind, haben sofort die Grums-Zwillinge im Kopf. Hast du von denen gehört?«
»Nein«, sagte John.
»Das ist eine verdammt hässliche Geschichte. Jens und Jonas Brodin. Sie verschwanden im Herbst 1986 in einer Gegend außerhalb von Grums, die Ålvikshöjden heißt. Das Alter stimmt, die Jungen waren zehn Jahre alt.«
Das Unbehagen, das John oben in der Wohnung empfunden hatte, kehrte zurück. Ein totes Kind war schlimm genug, aber zwei ließen ihn fast an seiner Berufswahl zweifeln.
»Falls sie es sind«, sagte er, »warum sind dann die Leichen nicht früher aufgetaucht? Das Schlüsselbein muss ja an der Oberfläche gelegen haben, wenn der Vogel es aufsammeln konnte.«
»Dafür könnte es mehrere Erklärungen geben«, sagte Anderberg. »Vielleicht lagen die Leichen auf dem Grund eines Sees, und die Skelettreste sind erst jetzt an die Oberfläche gespült worden. Oder der Boden ist im Laufe der Jahre allmählich erodiert und hat das Grab freigelegt. Der Wolkenbruch am Himmelfahrtswochenende könnte dazu beigetragen haben.«
John erinnerte sich an das Unwetter vor einer Woche. Nicoles Fußballtraining war abgesagt worden, sodass er nicht von der Arbeit nach Hause eilen musste, um sie abzuholen.
»Mal angenommen, das Labor kann die DNA extrahieren«, sagte er. »Haben wir noch Material von den Zwillingen zum Vergleich?«
»Nein, leider nicht. In dem Waldstück, in dem die Jungen verschwanden, wurde Blut gefunden, aber nach der Blutgruppenanalyse hat man es entsorgt. Damals wusste man es noch nicht besser.« Der Bezirkspolizeichef wirkte, als würde er sich schämen, obwohl es kaum seine Schuld war, dass die DNA-Technologie in Värmland erst später eingeführt worden war.
»Wir müssen neue Vergleichstests machen«, sagt John. »Leben die Eltern noch?«
Anderberg hob die Hände. »Langsam, langsam«, forderte er. »Bevor wir ihnen ein Stäbchen in den Mund stecken und ihr Leben wieder auf den Kopf stellen, brauchen wir einen positiven Bescheid aus Linköping.«
»Natürlich, das verstehe ich. Aber wissen wir, ob sie noch in der Gegend leben?«
»Ja, sie leben noch hier. Die Mutter ist mit einem neuen Mann nach Hammarö gezogen, aber der Vater wohnt noch an derselben Adresse in Ålvikshöjden.«
John bemerkte, dass Anderberg gut über die in den Fall involvierten Personen Bescheid zu wissen schien. Er wusste, dass der Bezirkspolizeichef nicht immer ein Schreibtischtäter gewesen war. Früher hatte er auch im Außendienst gearbeitet und sich selbst die Finger schmutzig gemacht.
»Ich hatte gerade als Polizist angefangen, als die Brodins verschwunden sind«, fuhr Anderberg fort, als könne er Johns Gedanken lesen. »Ich habe nie an dem Fall gearbeitet, aber er ist über die Jahre immer wieder aufgetaucht, und ich habe versucht, mich auf dem Laufenden zu halten.«
»Hatten die Jungs Geschwister?«, fragte John.
»Nein, es waren nur die beiden.« Anderberg streckte sich umständlich nach einer Schachtel auf dem Rücksitz. »Bitte sehr«, sagte er und reichte sie John. »Das sind die Ermittlungsakten. Es gibt sie nicht digital, nur auf Papier. Ich möchte, dass du sie dir ansiehst.«
John lugte unter den Deckel. »Eine Schachtel, ist das alles?«, fragte er.
»Ja. Um die Wahrheit zu sagen, die Kollegen haben sich ziemlich festgefahren.«
»Es ist also ein hoffnungsloser Fall, den du bei mir ablädst?«
»Wenn jemand damit weiterkommen kann, dann du, Fredrik.« Anderberg lächelte ihn an. Er war einer der wenigen in der schwedischen Polizei, die wussten, dass sich hinter dem Namen Fredrik Adamsson ein ehemaliger FBI-Agent verbarg.
Nach der Infiltration eines nigerianischen Drogenrings in Baltimore und dem nachfolgenden Prozess hatte John eine neue Identität erhalten und war in ein Zeugenschutzprogramm aufgenommen worden. Entgegen den Anweisungen der Behörden hatte er Karlstad als Wohnort gewählt, den Ort, an dem er die ersten zwölf Jahre seines Lebens verbracht hatte, bevor sich seine Eltern trennten und er mit seinem Vater nach New York zog.
Es war nie seine Absicht gewesen, lange in Schweden zu bleiben. Nicht länger als drei Monate, um ein paar Dinge aus der Vergangenheit zu klären. Aber es war nicht so gelaufen wie geplant, und nun saß er in Anderbergs Auto – mit einem möglichen Doppelmord auf dem Schoß und einer neunjährigen Nichte, die in seiner Wohnung auf ihn wartete.
Nicole wusste nicht einmal, dass John ihr Onkel war, so sehr hütete er das Geheimnis. Für das Mädchen war er nur ein engagierter Polizist, den sie nach dem tragischen Tod ihres Vaters kennengelernt hatte.
»Ich muss los«, sagte er und klemmte sich die Schachtel unter den Arm.
»Natürlich, geh schnell zurück zu Nicole.« Anderberg drückte auf einen Knopf neben dem Armaturenbrett und ließ den Motor an. »Nur noch eins …«
John war bereits ausgestiegen, er beugte sich vor und steckte den Kopf durch die offene Beifahrertür. »Ja?«
Der Bezirkspolizeichef sah ihn ernst an. »Halte mich regelmäßig auf dem Laufenden. Auch über Details. Diesmal will ich ganz nah dran sein. Wenn der Knochen von einem der Grums-Zwillinge stammt, wird das ein heftiger Zirkus. Die Journalisten werden sich auf uns stürzen.«
»Klar, kein Problem«, sagte John und schlug die Tür zu.
Dann beobachtete er, wie der Mercedes langsam über den Asphalt zur Ausfahrt des Parkplatzes rollte.
6.
Torgny sah zu, wie sich seine Schwester ein neues Glas Wein einschenkte. Offenbar war er doch genießbar, obwohl keine Katze auf dem Karton prangte. Sie erzählte eine Geschichte, die Torgny schon oft gehört hatte. Sie handelte von Pål Kratz und seiner Rückkehr nach Ålvikshöjden.
Torgny kannte die Hintergründe, denn sie waren Teil seiner eigenen Kindheit. Im Haus neben seinem Elternhaus wohnte Solveig mit ihrem Sohn Pål und ihrer jüngeren Tochter Linnea, die geistig behindert war. Oder Mongo, wie Torgny und die anderen Straßenkinder das arme Mädchen nannten. Aber nie so, dass Mutter Solveig es hören konnte. Sie hatte dicke Oberarme und eine Teppichpeitsche, die an einem Nagel im Flur hing.
Die Kinder fürchteten sich vor Solveig, und die Erwachsenen flüsterten, dass sie ihnen leidtue. Der Vater der Kinder hatte das Weite gesucht, sobald klar war, dass seine Tochter nicht so war, wie sie sein sollte.
Torgny erinnerte sich, wie er ein paarmal versucht hatte, mit dem großen Bruder Pål zu spielen. Sie waren gleich alt, und er ging in die Parallelklasse der Mittelschule in Grums. Es hatte nicht geklappt. Der Junge von nebenan war ein schrecklicher Fußballer und hatte keinerlei Ballgefühl. Er war still und schien am liebsten mit seinen Comics allein zu sein.
Auch als Teenager machte Pål nicht viel aus sich. Er hing mit den jüngeren Jungs auf der Straße herum und ging selten auf Schulpartys. Man kannte ihn vor allem als Mongo-Linneas Bruder.
Bis zur Woche nach den Abschlussprüfungen.
Da trat er aus dem Schatten und war einen Sommer lang das große Gesprächsthema in Ålvikshöjden. Pål haute ab, ohne jemandem ein Wort zu sagen. Der Zettel, den er laut Mythos auf dem Küchentisch hinterließ, brachte ihm unter seinen Altersgenossen in Grums einen legendären Status ein.
Ich bin jetzt weg!
Ein James Dean, der im sulfatgesättigten Licht der Morgendämmerung die Silhouette der Fabrik hinter sich ließ. Cooler ging es kaum.
Torgny erinnerte sich, dass sein Vater nicht so beeindruckt gewesen war. »Solveig hat es auch so schon schwer genug«, hatte er gemurmelt und war mit einer Tüte aufgetauter Brötchen aus der Tiefkühltruhe zum Nachbarhaus gegangen. Dort war er so lange geblieben, dass seine Mutter Torgny als Boten schicken musste, um ihm zu sagen, dass das Abendessen fertig sei.
Ivar hatte dem Ausreißer eine Woche gegeben. Dann würde er zurückkommen, hungrig und beschämt. Torgny hatte auch gedacht, dass Pål bald wiederauftauchen würde. Aber das tat er nicht.
Soweit Torgny wusste, hatte Solveigs Sohn seit über dreißig Jahren keinen Fuß mehr nach Ålvikshöjden gesetzt. Bis vor ein paar Wochen. Da hatte er plötzlich auf dem Nachbargrundstück den Rasenmäher angeworfen, und Sussie, die sich gerade auf der Terrasse sonnte, einen Heidenschreck eingejagt.
»Ich glaube, es geht um das Erbe«, sagte seine Schwester und schnitt ein Stück vom Rinderfilet ab, das vor ihr auf dem Teller lag.
Halil hatte eine Rettungsaktion gestartet und die Fleischstücke auf ein Blech in den Ofen gelegt. Jetzt waren sie an der Oberfläche schwarz und in der Mitte zäh durchgebraten.
»Solveig hat doch kein Geld, oder? Sie hat ihr ganzes Leben in ihrem Laden gesessen und Vorhänge genäht«, sagte Torgny und legte das Besteck beiseite. Er hatte sich an den Kartoffeln und der ungesunden Sauce béarnaise satt gegessen.
»Ihr gehört das Haus«, sagte Sussie. »Du hast doch gehört, was Göran und Birgitta für ihr Haus bekommen haben, oder?«
Ja, Torgny hatte es gehört. Die Leute in Ålvikshöjden sprachen von nichts anderem. Es war, als hätte die ganze Straße in der Postleitzahlenlotterie gewonnen.
»Was sagt Solveig selbst dazu?«, fragte Beatrice. »Weiß sie, dass ihr Sohn sie besucht?«
»Besucht?«, sagte Sussie und stellte das Glas so hart auf das Wachstuch, dass der Wein über den Rand spritzte. »Er ist hier eingezogen, verdammt. Wer tut das seiner alten Mutter an? Bleibt so lange weg und taucht dann wieder auf, als wäre nichts gewesen?«
»Ich glaube nicht, dass sie ihn erkennt«, sagte Halil, als sich Schweigen breitmachte. »Die Demenz wird immer schlimmer.«
»Sie erkennt mich.« Sussie schaute ihren Mann streitlustig an.
»Ja, aber das ist etwas anderes«, sagte Halil. »Du bist seit Jahren jeden Tag dort.«
»Das stimmt«, sagte sie. »Ich habe mich um sie und Linnea gekümmert. Ich habe die häusliche Pflege übernommen, die Rechnungen bezahlt und dafür gesorgt, dass das Haus einigermaßen sauber ist. Alles, was Pål hätte tun sollen, und dann behandelt er mich wie einen Eindringling.«
»Habt ihr euch wieder gestritten?«, fragte Torgny.
Sussie nickte. »Ich war heute Morgen vor der Arbeit da, um zu sehen, ob alles in Ordnung ist. Und natürlich hatte der Idiot die Tabletten falsch einsortiert. Sie sollte das Alendronat am Dienstag nehmen, nicht am Donnerstag. Also habe ich Pål aus dem Bett geholt und ihn gefragt, ob er will, dass seine Mutter stirbt.«
Torgny sah, wie Halil seine Brille abnahm und sich zaghaft die Nasenwurzel massierte.
»Aber glaubst du, dass er sich bedankt hat?«, fuhr Sussie fort. »Nix da. Stattdessen wurde er wütend, weil ich ihn geweckt hatte, und sagte, ich solle anklopfen, bevor ich hereinkomme.« Sie bearbeitete das zähe Stück Fleisch so wutentbrannt, dass das Messer über das Porzellan schabte.
»Versteh mich nicht falsch, Sussie«, sagte Beatrice. »Aber es ist kein Wunder, dass er so reagiert. Pål wohnt dort, und das musst du respektieren. Es ist jetzt seine Aufgabe, sich um Solveig und Linnea zu kümmern, nicht deine.«
»Aber er kommt damit nicht klar! Soll ich mich etwa zurücklehnen und die alte Dame sterben lassen?«
»Sie wird nicht sterben, weil sie das Alendronat am falschen Tag bekommt«, sagte Beatrice. »Gib Pål etwas Zeit, dann wird er die Abläufe schon in den Griff bekommen.«
Sussie breitete dramatisch die Arme aus. »Wer sagt, dass er nicht wieder abhaut? All die Jahre hat er seine Mutter und seine Schwester im Stich gelassen und uns die ganze Arbeit machen lassen. Nicht nur mich, auch dich.« Sie nickte Halil zu, der sich die Brille wieder auf die Nase schob.
»Ich habe den Rasen gemäht und Schnee geschippt«, sagte er. »Keine großen Sachen.«
»Und was haben wir dafür bekommen?«, fragte Sussie. »Dafür, dass wir uns um sie gekümmert haben? Nichts, nicht einmal ein Dankeschön.«
»Ganz umsonst war das doch bestimmt nicht«, wandte Beatrice ein. »Als Pflegerin bekommst du eine Aufwandsentschädigung von der Gemeinde, oder?«
Sussie schnaubte. »Diese Pennys machen keinen Unterschied.«
»Aber Solveigs Auto scheint sehr komfortabel zu sein. Damit seid ihr doch im letzten Sommer in den Urlaub gefahren, wenn ich mich recht erinnere.«
Torgny legte seiner Frau die Hand auf den Arm. Auch er hatte Sussies Nörgelei satt, aber seine Schwester in dieser Stimmung zu provozieren, konnte nur auf eine Weise enden. Das wusste er aus Erfahrung. Die Türklinke ihres Kinderzimmers war immer noch lose, weil sie die Tür so oft zugeknallt hatte.
»Solveig hat nichts dagegen, wenn wir uns ab und zu den Audi ausleihen«, meinte Sussie.
»Aber Pål vielleicht schon«, meinte Beatrice. »Da liegt der Hase im Pfeffer. Sonst würde das Auto wie immer in eurer Einfahrt stehen. Aber das tut es nicht mehr, es steht in Solveigs.«
»Es kann dir doch scheißegal sein, wo das Auto steht.« Sussie sprang auf und riss ihr Besteck mit sich. Messer und Gabel fielen auf ihre Hose und hinterließen Saucenflecken, bevor sie auf dem Holzboden landeten. Sie stürmte ins Haus und verschwand. Torgny hatte Mitleid mit Halil, der ihr hinterherlaufen musste, um sie zu beruhigen.
»Musst du so stur sein?«, flüsterte er Beatrice zu, als sie allein auf der Terrasse zurückblieben. »Sussie hat sich wirklich für Solveig und Linnea eingesetzt. Wer weiß, was sonst passiert wäre.«
»Ich weiß, und natürlich war es dumm«, sagte Beatrice. »Aber es stört mich, wenn sie sich als Florence Nightingale aufspielt und sie zugleich ausnutzt.«
»Es ist doch kein Weltuntergang, wenn sie sich manchmal das Auto ausleiht.«
»Es ist nicht nur das. Mach die Augen auf, Torgny. Können wir es uns leisten, mitten in der Woche Rinderfilet zu kaufen? Ich bin sicher, die alte Tante bezahlt es.«
»Du solltest nicht über Dinge reden, von denen du keine Ahnung hast«, sagte er.
Beatrice seufzte. »Ich verstehe nicht, warum du immer auf Sussies Seite bist.«
»Und ich verstehe nicht, warum du sie immer niedermachen musst.«
Stille senkte sich über die Terrasse. Nicht die wortlose Stille, die Torgny zu schätzen gelernt hatte, wenn er mit seiner Frau in der Küche Kaffee trank. Sondern die aufdringliche Art, die früher oder später durchbrochen werden musste.
»Zahlt sie denn Miete für das Haus?«, fragte Beatrice schließlich.
»Ja, laut meiner Mutter schon.«
»Wer’s glaubt, wird selig. Stört es dich nicht, dass sie einfach mit ihren Kindern hier eingezogen ist und das Haus übernommen hat?«
»Können wir ein andermal darüber reden?«, fragte Torgny.
Er stand auf, kratzte die Teller ab und stapelte sie auf dem Tisch. Das übrig gebliebene Fleisch legte er in die Schüssel, in der die Kartoffeln gewesen waren, und stellte sie unter den Deckel des Grills, damit die Vögel nicht an die Reste herankamen. Beatrice sammelte die Gläser ein und kippte die Weinreste auf den Rasen.
»Warum bringen wir das Geschirr nicht rein?«, fragte sie.
»Nein, das überlassen wir Halil. Ich glaube, es ist besser, wenn wir jetzt einfach nach Hause gehen.«
7.
John kam am Freitagmorgen um 8.30 Uhr auf der Polizeiwache an, nachdem er Nicole an der Schule abgesetzt hatte. In seinen Armen hielt er die Schachtel mit den Ermittlungen über die Grums-Zwillinge, die Anderberg ihm gegeben hatte. Eigentlich hatte er gestern Abend gleich mit der Lektüre beginnen wollen, aber seine Nichte hatte nicht einschlafen können und ihn gebeten, sich zu ihr ins Bett zu legen. Schließlich war John als Erster eingeschlafen und in seinen Klamotten von der verdammten Sonne geweckt worden, gottlos früh wie immer.
Er nahm den Aufzug zur Kripoabteilung im zweiten Stock. Die Türen zu den meisten Räumen auf dem Flur waren geschlossen. Durch die Fensterscheiben konnte er seine Kollegen sehen, die auf ihre Tastaturen einhämmerten, um die Schreibtischarbeit nachzuholen, die während der Woche liegen geblieben war.
John stellte den Karton mit den Grums-Akten in sein Zimmer und ging zur Kaffeemaschine im Pausenraum. Die Maschine schnaufte und paffte wie immer, als wäre jede Tasse die letzte. Nicht umsonst trug sie einen Aufkleber mit der Aufschrift Achtung, Bullenkaffee.
»Schmeckt nicht besonders, oder?«, hörte er eine Stimme hinter sich.
John drehte sich um und sah Ulf »Fuck-up« Törner in der Tür stehen. Er trug das, was die Frühjahrskollektion für Kriminalbeamte in Karlstad zu sein schien: unförmige Jeans, ein Polohemd und Birkenstock-Kopien an den Füßen.
Nachdem er bei mehreren Ermittlungen eng mit dem Kollegen zusammengearbeitet hatte, war John klar geworden, warum er diesen Spitznamen bekommen hatte. Der Mann war nicht dumm, im Gegenteil. Aber er war immer bereit, eine Abkürzung zu nehmen, wenn er dadurch ein paar Stunden früher nach Hause kam. Im Gefolge von Ulf kam es zu einer Reihe überstürzter Ermittlungen, die den Staatsanwälten vor Gericht immer wieder Schwierigkeiten bereiteten. Wenn die Fälle überhaupt so weit kamen, meist hatte er sie schon vorher »abgefuckt«. Er selbst rettete sich oft in seine Rolle als Gewerkschaftsvertreter. Wenn die Kritik an einer fehlgeschlagenen Untersuchung zu laut wurde, suchte er sich eine Konferenz zum Thema Arbeitsrecht und verließ für ein paar Tage das Feld.
»Solange er Koffein enthält, werde ich es überleben«, sagte John und nahm einen Schluck von seinem Kaffee.
»Bald hat die Tortur ein Ende«, sagte Ulf mit Stolz in der Stimme. »Anderberg hat mir erlaubt, eine neue Maschine zu bestellen.«
»Im Ernst?«, fragte John erstaunt. Der Bezirkspolizeichef war als notorisch geizig bekannt.
»Ja, der Kaffee hier ist ein Problem für die Arbeitsumgebung, und als Personalvertreter musste ich ein Machtwort sprechen. Wenn wir Glück haben, bekommen wir sie schon nächste Woche.«
»Klingt gut«, sagte John und nahm die Tasse mit auf den Flur. Die Erfahrung hatte ihn gelehrt, sich mit seinem Kollegen kurzzufassen, sonst lief er Gefahr, dass dieser nicht mehr aufhörte zu reden.
Zurück im Büro machte John es sich in seinem Schreibtischstuhl bequem. Er ordnete die Untersuchungsprotokolle, Vernehmungsprotokolle und technischen Berichte aus der Schachtel in ordentlichen Stapeln auf seinem Schreibtisch und begann zu lesen.
Es war kurz nach fünf Uhr nachmittags am 7. Oktober 1986, als die Zwillinge Jens und Jonas Brodin ihr Haus in Ålvikshöjden verließen. Mutter Hillevi hatte ihren Söhnen gesagt, sie sollten in der Nähe bleiben und um sieben Uhr zum Abendessen zurück sein. Als sie nicht kamen, machte sie sich auf die Suche. Sie klingelte bei Nachbarn mit gleichaltrigen Kindern, um zu fragen, ob Jens und Jonas da seien, bekam aber nur Kopfschütteln als Antwort. Einige Zeit später fand sie ihre BMX-Räder auf dem Spielplatz. Ab diesem Zeitpunkt machte sie sich ernsthafte Sorgen. Hillevi wusste, dass ihre Söhne ihre Fahrräder liebten und sie nie unbeaufsichtigt lassen würden.
John zog einen braunen Umschlag mit privaten Fotos hervor, die die Mutter den Ermittlern zur Verfügung gestellt hatte. Die Brüder mussten eineiige Zwillinge sein, dachte er. Sie sahen fast gleich aus, mit glattem hellbraunem Haar, schelmischen Augen und abstehenden Ohren. Jens und Jonas Brodin waren zehn Jahre alt gewesen, als sie verschwanden, ein Jahr älter als Nicole jetzt.
John las weiter. Um 21.17 Uhr ging der Anruf bei der Notrufzentrale ein. Die Polizeistreife traf eine halbe Stunde später ein und nahm Hillevis Aussage auf. Den Aufzeichnungen zufolge war die Mutter aufgeregt, beantwortete die Fragen aber ehrlich und klar. Die Söhne seien nie zuvor verschwunden gewesen, und, nein, es habe keine Bedrohung für sie gegeben. Der Vater der Jungen, Kenneth Brodin, befand sich auf einer Geschäftsreise in Finnland und wollte so schnell wie möglich nach Hause zurückkehren.
Nach Rücksprache mit dem Einsatzleiter wurde eine weitere Streife nach Ålvikshöjden geschickt, um die Suche zu unterstützen. Auch die Nachbarn wurden einbezogen. Um 2.30 Uhr wurde die Suche unterbrochen. Die Zwillinge waren immer noch nicht gefunden worden.
John spürte die wachsende Sorge seiner ehemaligen Kollegen. Zeit war bei Vermisstenfällen ein entscheidender Faktor. Mit jeder Stunde, die verstrich, schwanden die Chancen auf ein glückliches Ende.
Am nächsten Morgen wurde die Suche mit neuer Intensität wieder aufgenommen. Hunde wurden eingesetzt, und es dauerte nicht lange, bis einer von ihnen an einer Stelle im Wald anschlug, kaum hundert Meter nördlich des Spielplatzes.
Dort fanden die Polizisten Blutspuren auf dem Boden. Die Menge war schwer zu schätzen, da die Flüssigkeit vom Boden aufgesaugt worden war. Man ging von etwa zwei Dezilitern aus.
John blätterte im Bericht der Spurensicherung. Das Blut im Wald gehörte zur gleichen Gruppe wie das der Jungen: A+. Ein starkes Indiz dafür, dass sie Opfer von Gewalt geworden waren. Es war unmöglich zu sagen, ob beide Kinder Blut verloren hatten oder nur eines. Sie waren eineiige Zwillinge, wie John vermutet hatte, und hatten die gleiche Blutgruppe.
Der nächste Schritt in der Untersuchung war die Einschaltung der Staatsanwaltschaft. Das war das Standardverfahren bei solch schwerwiegenden Verdachtsfällen. Es wurde ein förmliches Ermittlungsverfahren wegen Menschenhandels, Mordes oder Totschlags eingeleitet.
Mithilfe von Zeugen, die die Zwillinge an jenem Nachmittag gesehen hatten, wurde eine Zeittafel erstellt, die John, so gut es ging, zu interpretieren versuchte. Als das Dokument vor vierunddreißig Jahren gedruckt wurde, musste die Tintenpatrone fast leer gewesen sein. Die Buchstaben wurden immer blasser, je weiter er auf der Seite nach unten kam.
17.10:Die Jungen verlassen das Haus in Ålvikshöjden.
18.00:Die Jungen werden auf einem Spielplatz von einem Rentnerehepaar beobachtet, das einen Abendspaziergang macht. Der Spielplatz befindet sich an der Zufahrt zur Wohnsiedlung.
18.15:Erneute Beobachtung der Jungen auf dem Spielplatz. Zeuge ist ein fünfzehnjähriger Junge auf einem Moped, der in Richtung Grums fährt.
Hier endete die Spur von Jens und Jonas Brodin. In den folgenden Wochen wurde intensiv gesucht, ohne dass die Kinder gefunden wurden. John bemerkte, dass die Suchnotizen immer kürzer wurden, je geringer die Hoffnung war, die Kinder noch lebend zu finden.
Die Ermittler nahmen natürlich auch das Umfeld der Zwillinge unter die Lupe. Besondere Aufmerksamkeit galt den Eltern. Hillevi Brodin war Verkäuferin in Grums. Ihre Schilderung des fraglichen Nachmittags und Abends wurde von Nachbarn aus der Umgebung bestätigt.
Kenneth Brodin kam am Tag nach dem Verschwinden der Zwillinge gegen Mittag in Ålvikshöjden an und wurde zu Hause befragt. Er gab an, im Ausland gewesen zu sein. Der Mann arbeitete als Servicetechniker in der Papierfabrik Gruvön und wurde oft zu anderen Fabriken des Konzerns in ganz Europa geschickt, um dort zu helfen. In einer handschriftlichen Notiz am Rande der Kopie hatte jemand geschrieben: In der Fabrik checken. John durchsuchte die Unterlagen und fand eine Notiz vom selben Tag, in der der Werksleiter von Gruvön die Reise nach Finnland bestätigte.
Keiner der Eltern war vorbestraft. Dasselbe galt für andere Erwachsene – Lehrer und Sporttrainer –, die regelmäßig Kontakt zu den Jungen hatten. Die meisten von ihnen hatten außerdem ein Alibi für die Tatzeit.
Nachdem das unmittelbare Umfeld abgegrast war, begannen die Ermittler in immer weiteren Kreisen nach dem Täter zu suchen. Verurteilte Pädophile in Värmland wurden vernommen, aber keiner konnte mit Ålvikshöjden in Verbindung gebracht werden oder verhielt sich so, dass weitere Maßnahmen gerechtfertigt gewesen wären.
John konnte das unterdrückte Fluchen seiner Kollegen fast hören, als jede neue Spur in einer Sackgasse endete. Ohne Fortschritte war es unmöglich, den Schwung aufrechtzuerhalten. Die Abstände zwischen den Suchaktionen wurden immer größer, und im Dezember 1988, etwas mehr als zwei Jahre nach dem Verschwinden der Jungen, wurden die Ermittlungen eingestellt.
John erhob sich von seinem Stuhl und streckte sich. Erst jetzt merkte er, wie steif er nach dem stundenlangen Stillsitzen war. Wenn es Anderbergs Plan gewesen war, ihn in den Fall hineinzuziehen, dann war er aufgegangen.
Das Problem bei alten Ermittlungen, die wieder aufgenommen werden mussten, war oft, dass es keinen natürlichen Ausgangspunkt für die Arbeit gab. Kein Tatort, den man untersuchen konnte, keine neuen Zeugen, mit denen man sprechen konnte. Bei den Grums-Zwillingen war das nicht der Fall, und das hatte John einem Vogel zu verdanken.
Irgendwo muss das Schlüsselbein ja herkommen, dachte er und zog sein Handy aus der Innentasche seiner Jacke.
Der nächste Ornithologe war nur eine Google-Suche entfernt.
8.
Torgny seufzte. Die Fernsehnachrichten am Freitag unterschieden sich nicht von denen der anderen Wochentage. Es war der gleiche Mist, der Abend für Abend über den Bildschirm flimmerte. Schießereien, Drogenhandel, grobe Diebstähle von Leuten, die nie ins Land hätten gelassen werden dürfen. In den Vororten der Großstädte ging es zu wie im Wilden Westen, wo Banden das Sagen hatten und taten, was sie wollten.
Auch in Grums gab es immer wieder Probleme. Torgny erinnerte sich an die Aufregung im vergangenen Jahr, als eine Bande von Migrantenkindern ein ganzes Viertel schikaniert hatte. Einige Kollegen in der Fabrik sprachen sogar davon, eine Bürgerwehr zu gründen.
Åkesson hatte offenbar von Anfang an recht, dachte Torgny, als der Vorsitzende der Schwedendemokraten auf dem Bildschirm erschien. Lange bevor irgendein anderer Politiker es gewagt hatte, über die Probleme der Masseneinwanderung zu sprechen, hatte er die Dinge beim Namen genannt. Dass die Schweden zu Fremden im eigenen Land geworden waren.
In Grums gab es eine Konditorei, in die er und Beatrice immer gegangen waren, als Markus noch ein Kind war. Sein Sohn hatte es geliebt, die Schokobrötchen, Mazariner und Zimtschnecken zu zählen, die in der Glasvitrine in Reih und Glied lagen. Heute hieß der Laden Klein Damaskus, und wenn Torgny dort einen Kaffee trank, war er der einzige Schwede.
Ein Fremder, wie Åkesson gesagt hatte.
Trotzdem hatte Torgny ihn bei der letzten Wahl nicht gewählt. Die Jungs bei der Arbeit konnten machen, was sie wollten, aber er hielt den Sozialisten die Stange. Wenn er aus der Partei austräte, würde sich Papa nicht nur einmal im Grab umdrehen. Er würde sich drehen wie ein Schaufelrad auf dem Fluss Borgvik.
Torgny schaltete den Fernseher aus und ging in die Küche, um den Fischauflauf aufzuwärmen, den Beatrice für ihn gemacht hatte. Sie hatten heute nach der Arbeit kaum Zeit zum Reden gehabt, nur ein paar kurze Worte im Auto gewechselt, als er sie zum Bus fuhr.
Beatrice’ Abende mit dem Lesezirkel in Karlstad waren heilig und mit rotem Stift im gemeinsamen Kalender vermerkt. Die Freundinnen hatten sich während ihres Studiums an der Hochschule, der heutigen Universität, kennengelernt. Beatrice hatte ihr Studium der Sozialarbeit im zweiten Semester abgebrochen, als sie mit Markus schwanger wurde, aber dennoch den Kontakt aufrechterhalten.
Torgny wusste, dass er kleinlich war. Trotzdem konnte er nicht anders, als sich über die ganze Sache mit Bücher und Blubber zu ärgern. So hieß er, der Lesezirkel. Und allein, dass er einen Namen hatte, war so albern und pompös, dass ihm schlecht wurde. Torgny ging mit Halil und ein paar anderen Nachbarn aus der Straße zu den Heimspielen von Färjestad, aber dafür brauchten sie sich keine T-Shirts mit der Aufschrift Ålvikshöjdens Hockeyjungs drucken zu lassen.
Den Ehepartnern war es streng verboten, an den Treffen des Buchclubs teilzunehmen. Mit einer Ausnahme: dem jährlichen Weihnachtsessen bei Familie Linder in einer großen Villa auf Hammarö mit eigenem Bootssteg und Sauna. Die Männer schwitzten und tranken Bier in der Sauna, während die Frauen im Wohnzimmer über Literatur diskutierten. Dann versammelten sie sich in der prächtigen Küche des Bauernhauses und ließen sich Kartoffelauflauf, Schinken und Rippchen schmecken.
Torgny hasste die Weihnachtstafeln bei Linders. Er fühlte sich verloren zwischen den anderen Männern, die sich nur über Geschäfte und gemeinsame Bekannte unterhielten. Beim Abendessen war die Unterhaltung abwechslungsreicher, aber da hatte er schon so lange geschwiegen, dass es ihm unangenehm war, den Mund aufzumachen.
Seine soziale Unbeholfenheit war nicht das Schlimmste, er konnte damit leben. Was Torgny noch Tage später ein schlechtes Gewissen machte, war zu sehen, wie sehr Beatrice sich amüsierte. Sie strahlte mit den Kerzen um die Wette und stürzte sich mit Lebensfreude und Lust in jedes Thema, das besprochen wurde. Auf der Heimfahrt im Auto war sie immer still, und er fragte sich, was sie wohl dachte.
Die Mikrowelle piepte, und Torgny hob den Teller mit einem Geschirrtuch an, um sich nicht am Geschirr zu verbrennen. Während er das Essen zum Sofa trug, sah er sich im Wohnzimmer um und fragte sich, welche teuren Renovierungspläne Beatrice diesmal aus dem Lesezirkel mitbringen würde. Das Geld rann ihr nur so durch die Finger. Im letzten Winter hatten sie den Ofen eingebaut, und im Jahr zuvor hatte Torgny die Wände in einer Farbe gestrichen, die er für braun hielt, die aber, wie Beatrice erklärte, Caffè Latte war.
Das einzige Möbelstück, das nicht ersetzt zu werden drohte, war das Klavier von Markus. Irgendwann hatte Torgny vorgeschlagen, es an einen anderen Platz im Zimmer zu stellen. Beatrice hatte abgelehnt. Es sollte bleiben, wo es immer gewesen war, bereit für die flinken Finger ihres Sohnes, wann immer er zu Besuch kam.
Torgny seufzte, zog sein Handy aus der Tasche und surfte auf der Website von Lexus. Er hatte das RX-Modell schon so oft Probe gefahren, dass der Verkaufsleiter im Autohaus zu murmeln begann, der kostenlose Kaffee sei nur für Kunden. Es wäre toll, diesen selbstgefälligen Mistkerl eines Tages zum Schweigen zu bringen, den Überweisungsbeleg der Bank aus der Tasche zu fischen und ihn vor ihm auf den Tresen zu knallen.
Normalerweise hätte Torgny an dieser Stelle seinen Tagtraum unterbrochen. Hätte sich daran erinnert, dass sechshunderttausend Kronen wahnsinnig viel Geld waren, und stattdessen bei Blocket nach Gebrauchtwagen gesucht. Aber nicht heute Abend. Er hatte seit seinem neunzehnten Lebensjahr gearbeitet, keine Elternzeit genommen und war kaum krank gewesen. Irgendwann musste er sich etwas gönnen. Torgny nahm einen Block, einen Bleistift und einen richtigen Taschenrechner – der auf seinem Handy war unbrauchbar – und setzte sich wieder auf das Sofa. Der kleinste Eigenanteil betrug zwanzig Prozent. Das waren etwa hundertzwanzig- bis hundertdreißigtausend, je nach den Optionen. Den Rest konnte er sich von der Autofirma leihen. Die hatten günstige Kredite, das stand überall auf der Website.
Er loggte sich bei seiner Bank ein und überprüfte den Stand seines Sparkontos. Etwas über vierzigtausend. Selbst wenn er den Volvo für zwanzig verkaufen könnte, hätte er erst die Hälfte. Es sei denn …
Sein Blick fiel auf ein anderes Konto mit dem Namen Sparen für Markus. Torgny hatte es zur Taufe seines Sohnes eröffnet und noch am selben Tag die erste Einzahlung getätigt. Seitdem wurden jeden Monat dreihundert Kronen von seinem Gehaltskonto darauf überwiesen. Das Geld war als Anzahlung für Markus’ erste Wohnung gedacht gewesen. Ivar hatte das Gleiche für Torgny getan. Dank dem Beitrag seines Vaters konnten er und Beatrice sich das Haus in Ålvikshöjden leisten.
Das Problem – wenn man es so nennen mochte – war, dass Markus das Geld nicht gebraucht hatte. Er hatte eine Ausbildung zum Systemwissenschaftler absolviert und schon während des Studiums begonnen, freiberuflich für Firmen in Schweden und im Ausland zu arbeiten. Als er vor einigen Jahren eine Eigentumswohnung in Stockholm gekauft hatte, war Torgny erst im Nachhinein davon berichtet worden. Sein Sohn wollte nicht, dass er sich zu sehr darüber aufregte.
Als Torgny schließlich den Preis für die Wohnung in der dritten Etage am Odenplan erfuhr, verstand er, warum. Das Kapital, das er über Jahrzehnte angespart hatte, hätte nur für ein paar Quadratmeter gereicht.
Über Geld hatten sie nie gesprochen, Markus und er. Die Überweisung der dreihundert Kronen erfolgte weiterhin am 26. eines jeden Monats. Mit Zinsen waren es jetzt fast hundertfünfzigtausend.
Mehr, als er brauchte, um die Anzahlung für den Wagen zu leisten.
Torgny warf den Bleistift auf den Block, ohne eine einzige Notiz gemacht zu haben. Mathematik war nicht das Problem. Das Geld war da, er musste nur Markus anrufen und ihn bitten, es benutzen zu dürfen. Und sich selbst demütigen, fügte er in Gedanken leise hinzu. Auch wenn der Sohn gut alleine zurechtkam und seinem alten Vater wahrscheinlich ein neues Auto gönnte, fühlte es sich falsch an, die Frage zu stellen. Erst recht, wenn Markus am anderen Ende der Welt Urlaub machte.