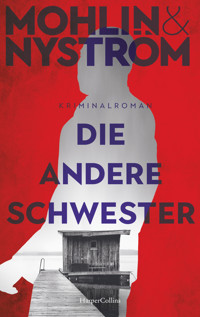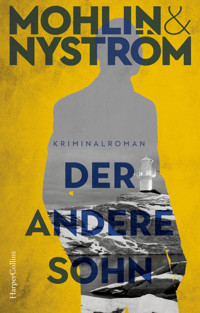
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Karlstad-Krimi
- Sprache: Deutsch
Vor zehn Jahren ist in der schwedischen Kleinstadt Karlstad eine junge Frau spurlos verschwunden. Ihre Leiche blieb verschollen, den einzigen Verdächtigen Billy musste man laufen lassen. Doch die Tat ist nie vergessen worden, die Schuldzuweisungen sind nie verstummt. Nun wird der Cold Case neu aufgerollt.
Als sich der amerikanische FBI-Agent John Adderley nach einem missglückten Undercover-Einsatz in Baltimore eine neue Identität zulegen muss, ist für ihn sofort klar: Er will nach Schweden zurückkehren, zu seinen Wurzeln. Denn John hat noch eine alte Schuld zu begleichen. Billy ist sein Halbbruder und hat John schon früher angefleht, ihm zu helfen. Er sei unschuldig und die Provinzpolizei damals wie heute nur auf der Suche nach einem Sündenbock, beteuert er. Trotz des Risikos, dass Johns Verfolger aus Baltimore ihm in seine alte Heimat folgen, reist er nach Karlstad und wird Teil des Ermittlerteams. Das bringt nicht nur ihn in tödliche Gefahr.
»Ein richtig schöner Schmöker in den man sich gerne vertieft.« Buchhändlerin Susanne Ludorf, NDR DAS!, 04.02.2021
»Super spannend. Ein großes Lesevergnügen!« Buchhändlerin Susanne Ludorf, NDR DAS!, 04.02.2021
»[…] das Autorenduo Peter Mohlin und Peter Nyström […] hat einen richtig guten, spannenden und lebensnahen Krimi geschrieben.« Die Rheinpfalz, 20.02.2021
»Mohlin/Nyström ziehen ihre Leser*innen mit einem Geflecht aus heimlichen Affären, Intrigen, Lügen und verdrängter Schuld gekonnt in den Bann ihres Plots.« Kulturnews, 25.02.2021
»Auftakt einer vielversprechenden Reihe.« Hörzu, Ausgabe 10/2021
»[…] eine abwechslungsreich und raffiniert gestrickte Story.« Heilbronner Stimme, 12.03.2021
»Ein eleganter Krimi.« Peer Teuwsen,NZZ am Sonntag, 27.06.2021
»‘Der andere Sohn‘ ist ein Pageturner, wie Krimileser ihn lieben.« Katja Eßbach,NDR, 05.07.2021
»Ein rundum gelungenes Debüt, das Lust auf mehr macht.« Anja Braunwarth,medical tribune, 13.07.2021
»Was für ein Auftakt!« »Spannung pur bis zu einem extrem überraschenden Showdown!«Münchner Merkur,27.07.2021
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 707
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
HarperCollins®
Copyright © 2021 für die deutsche Ausgabe by HarperCollins in der HarperCollins Germany GmbH, Hamburg
© 2020 by Peter Mohlin, Peter Nyström Originaltitel: »Det sista livet« Erschienen bei: Norstedts, Stockholm
Covergestaltung: Hauptmann & Kompanie, Zürich Coverabbildung: BMJ, Studio Light and Shade / Shutterstock Lektorat: Carla Felgentreff E-Book-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN E-Book 9783749950508
www.harpercollins.de
Werden Sie Fan von HarperCollins Germany auf Facebook!
TEIL 1: 2019 & 2009
TEIL 1
2019 & 2009
1. Baltimore, 2019
1.
BALTIMORE, 2019
Er lag im Bett und starrte an die weiße Decke. Der Fleck auf der Gipsplatte trat nach und nach klarer hervor, er sah aus wie ein Gespenst oder ein Ballon, jedenfalls wie etwas, das ein Kind gemalt hatte.
John wurde klar, dass er sich im Grenzgebiet zwischen Wachsein und Schlaf befand. Wie lange er zwischen den beiden Welten geschwebt hatte, wusste er nicht. Er versuchte den Kopf zu drehen, um zu sehen, wo er war. In der nächsten Sekunde spürte er eine Welle aus Schmerz, die seinem Hinterkopf entsprang und schließlich den ganzen Körper erfasste. Er kniff die Augen zusammen und versuchte irgendwo in seinem Inneren Schutz zu finden. Doch es gab keinen Zufluchtsort.
Als der schlimmste Schmerz abgeklungen war, beschloss er, den Raum mit seinen anderen Sinnen zu untersuchen. Es roch nach Reinigungsmittel, aber ohne den synthetischen Geruch, den solche Produkte oft verbreiten. Weder Zitrus noch Blumen, nur ein klinischer Duft von Sauberkeit.
Er nahm einen Piepton zu seiner Linken wahr. Der Laut wiederholte sich im Abstand von einer Sekunde und stammte offenbar von einer Maschine auf Kopfhöhe.
Langsam schloss er die Hand um den Stahlrahmen des Betts und fuhr daran entlang, bis er gegen etwas stieß, das ein Kabel zu sein schien. Er nahm es und zog es in sein Blickfeld. Am Ende des Kabels war ein Plastikzylinder mit einem roten Knopf befestigt. Er drückte darauf und wartete, ob etwas passierte. Schon nach wenigen Sekunden hörte er, wie eine Tür aufging und sich Schritte näherten. Eine Frau in einem weißen Kittel beugte sich über das Bett, sie hatte die Haare im Nacken zu einem Knoten gebunden.
»Sind Sie wach, John? Hören Sie mich?«
Er nickte vorsichtig und erntete ein Lächeln.
»Sie sind im Johns-Hopkins-Krankenhaus in Baltimore«, sagte sie. »Wir haben die Schusswunden in Ihrer Brust operiert.«
Sobald die Krankenschwester das aussprach, spürte er die Schmerzen, die von dem Eingriff herrührten. Diese Schmerzen waren anders. Nicht so explosiv wie jene in seinem Hinterkopf, sondern dumpfer. Wie eine zweite Schicht aus Schmerz.
Die Krankenschwester klärte ihn weiter über seinen Gesundheitszustand auf. Er habe viel Blut verloren und sei bewusstlos gewesen, als man ihn vor vierundzwanzig Stunden eingeliefert habe. Bei der anschließenden Operation sei es den Ärzten gelungen, die inneren Blutungen zu stoppen. Die Kugeln, zwei an der Zahl, hätten die lebenswichtigen Organe verfehlt und den Körper durchschlagen.
»Wasser«, stieß er hervor und war überrascht, wie schwach seine Stimme klang.
Die Krankenschwester holte einen Becher mit Strohhalm von einem Tisch und hielt ihn John hin. Er saugte das Wasser zu hastig ein und verschluckte sich, hustete, und die weiß gekleidete Frau musste ihm mit einer Serviette die Wangen abwischen.
»Es ist schwer zu trinken, wenn man ganz flach liegt. Soll ich das Bett höher stellen?«
Er nickte.
Die Krankenschwester drückte auf einen Knopf an der Wand, und das Kopfteil hob sich langsam. Endlich hatte er einen Überblick über den Raum. Links neben dem Bett stand ein Infusionsgestell auf Rädern. John zählte drei durchsichtige Schläuche, die seinen Körper über Zugänge in seinen Armbeugen mit Medikamenten versorgten. Das Piepsen, das er gehört hatte, stammte von einem Gerät, das seine Atmung und die Sauerstoffversorgung überwachte.
Die Vorhänge an den beiden Fenstern waren dünn und ließen mehr Sonnenlicht herein, als ihm angenehm war. Die Tür zum Korridor hatte eine eingelassene Glasscheibe. Sie war so groß, dass er den Polizisten sehen konnte, der davor Wache hielt.
John drehte langsam den Kopf nach rechts und entdeckte ein zweites Bett. Offenbar war er nicht der einzige Patient im Raum. Als er das Gesicht des Mannes sah, explodierte der Schmerz in seinem Hinterkopf erneut.
Dort, nur wenige Meter von ihm entfernt, lag der Mann, der ihm vierundzwanzig Stunden zuvor eine Pistole an den Hinterkopf gedrückt hatte.
2. Karlstad, 2009
2.
KARLSTAD, 2009
Wieder die Mailbox. Heimer wusste, dass sie seinen Anruf sah, obwohl es kurz vor Mitternacht war. Das Mobiltelefon schien mit ihrer Hand verwachsen zu sein und klingelte Tag und Nacht. Sobald der eine Kontinent schlafen ging, erwachte der nächste – und sie war erreichbar, wann immer die Truppen ihre Befehlshaberin brauchten.
Aber wenn er, ihr Mann, sie anrief, ging sie nicht ran. Sie screente ihre Calls, wie man im Businesssprech sagte. Manchmal bekam er Lust, das Handy eines Mitglieds der Geschäftsführung auszuleihen und Sissela damit anzurufen. Nur um zu sehen, ob sie ranging.
Heimer blickte aus dem großen Panoramafenster und stellte überrascht fest, wie dunkel das Wasser draußen war. Bald würde Emelie nach Stockholm zurückfahren und der Sommer offiziell vorbei sein. Er musste daran denken, wie er seine Tochter kaum wiedererkannt hatte, als er sie eine Woche vor Mittsommer am Bahnhof abgeholt hatte. Die Verwandlung zu einer braven BWL-Studentin hatte sich so schnell vollzogen, dass er ihren neuen Look noch gar nicht verinnerlicht hatte.
Sissela war natürlich überglücklich gewesen, als Emelie im vergangenen Herbst ihr Studium angefangen hatte. Was vorgefallen war, wurde abgehakt, die Erbin des Familienunternehmens war an einer der prestigeträchtigsten Hochschulen untergebracht. Er war nicht ganz so überzeugt gewesen. Im Laufe des Sommers hatte er sich bemüht, die Beziehung zu Emelie zu kitten und ihr Vertrauen zurückzugewinnen. Aber sie hatte ihn nicht an sich herangelassen.
Er versuchte aufs Neue, Sissela zu erreichen. Warum ging sie nicht ran? Wenn er innerhalb einer Stunde dreimal anrief, musste sie doch verstehen, dass es wichtig war?
Heimer setzte sich an die Kücheninsel und dachte darüber nach, wie beschissen der Tag gewesen war. Bereits beim Frühstück hatte es Streit gegeben. Während des ganzen Studienjahres waren die Rückmeldungen aus Stockholm positiv gewesen. Emelie hatte erzählt, sie hätte die Prüfungen bestanden und würde sich mit den anderen Studenten gut verstehen. Seiner Frau gegenüber hatte er die Studienergebnisse angezweifelt. Ihre Tochter hatte seine Dyslexie geerbt, und er wusste noch, wie schwer ihm die theoretischen Teile des Architekturstudiums gefallen waren. Aber Sissela hatte seine Einwände beiseitegewischt und gefragt, warum er seinem einzigen Kind nicht mehr zutraue.
Gestern war das Luftschloss dann eingestürzt. Ein Geschäftspartner von Sissela, der den Rektor der Handelshochschule gut kannte, hatte gehört, dass man sich dort Sorgen um Emelie machte. Sie fehle häufig in den Vorlesungen und sei in letzter Zeit kaum noch auf dem Campus gesichtet worden. Sissela hatte natürlich umgehend den Rektor angerufen und nicht lockergelassen, ehe der Arme Klartext geredet hatte. Von sechzig möglichen Leistungspunkten hatte ihre Tochter nach zwei Semestern nur vierundzwanzig erreicht. Die beiden letzten Prüfungen hatte sie nicht einmal mitgeschrieben.
Das Frühstück hatte sich zu einem Kreuzverhör entwickelt, bei dem Emelie mit ihren Lügen konfrontiert worden war. Heimer hatte versucht, seine Frau zu beruhigen, aber Sissela schien schon vergessen zu haben, wie schlecht es Emelie in den vergangenen Jahren gegangen war. Wie kurz davor sie gewesen waren, ihre Tochter für immer zu verlieren.
Der Morgen hatte damit geendet, dass Emelie in ihrem Zimmer verschwunden war und das Haus anschließend mit einem Rucksack verlassen hatte. Kurz darauf war auch Sissela weggefahren, und er blieb allein zurück in den Trümmern dessen, was einmal eine Familie gewesen war. Und räumte auch allein den Dreck der anderen weg, wie üblich.
Den übrigen Vormittag hatte er seinen Weinkeller in Ordnung gebracht. In den letzten Monaten hatte er mit der Inventur geschlampt, und das Verzeichnis seiner Flaschen musste auf dem aktuellen Stand sein, damit die Versicherung weiterhin griff. Es war eine gute Ablenkung gewesen. Als er die Schuhe geschnürt hatte, um die zwölf Kilometer zu laufen, die sein Trainingsprogramm vorschrieb, hatte er sich ein wenig besser gefühlt.
Aber die gute Stimmung hatte nicht lange gewährt. Nach dem Abendessen, das er allein zubereitet und gegessen hatte, zerbrach die letzte Illusion vom neuen Leben der Tochter. Heimer ging in ihr Zimmer. Er hatte nicht vorgehabt, dort herumzuschnüffeln. Er wollte einfach nur kurz dort sein. Das machte er ab und zu, seit sie nach Stockholm gezogen war. Um sich daran zu erinnern, dass seine Tochter und er einmal ein unschlagbares Team gewesen waren.
Er hatte die oberste Schublade des Schreibtischschranks nur aus einem Impuls heraus geöffnet. Sie war nicht richtig geschlossen gewesen, und er hatte sie eigentlich nur zuschieben wollen. Zumindest redete er sich das selbst ein. Stattdessen hatte er die Schublade aufgezogen, und der Stapel aus alten Schulheften war ihm sofort ins Auge gestochen. Sie wirkten verdächtig arrangiert. Er hatte die Papiere hochgehoben und das Tütchen mit dem weißen Pulver entdeckt.
Es war nur noch ein kleiner Rest drin, ganz unten. Er hatte ihn mit dem Mittelfinger aufgewischt und zum Mund geführt und sofort den chemischen, bitteren Geschmack von Kokain erkannt.
Seitdem versuchte er vergeblich, seine Tochter auf ihrem Handy zu erreichen. Irgendwie hatte er genau das geahnt, aber nicht sehen wollen. Die neue Emelie war zu perfekt. Die Therapeuten im Therapiezentrum hatten wiederholt gemahnt, dass der Weg nach einer psychischen Erkrankung lang und oft steinig war. Aber für seine Tochter schien der Aufenthalt in Björkbacken eine Wunderkur gewesen zu sein. Sie war als ausgeflippte Neunzehnjährige mit einer Neigung für Drogen hineingegangen – und als junge Frau herausgekommen, die sich an der Handelshochschule bewarb und ins Familienunternehmen einsteigen wollte. Und das alles innerhalb von nur sechs Monaten.
Heimer verließ die Küche und wanderte ziellos im Haus umher. Die Sohlen seiner Lederschuhe quietschten auf dem weiß geölten Massivparkett, und er fühlte sich wie der einzige Gast auf einer öden Party. Völlig overdressed mit Anzug und Hemd, obwohl er genauso gut in Pantoffeln und Morgenmantel durch die Räume hätte schlurfen können. Es war ja sowieso niemand da.
Er zog sich um, wählte eine beigefarbene Cordhose und das schwarze Polohemd, das er neulich in Mailand gekauft hatte. Das Hemd saß eng an seinem schlanken, sehnigen Oberkörper, den er seinem Lauftraining zu verdanken hatte. Nicht viele Siebenundvierzigjährige waren so gut in Form. Das Haar über seiner Stirn war ein wenig lichter geworden, und die Haut um die Augen hatte Falten bekommen, aber er mochte sein Gesicht, es alterte in Würde.
Ab und zu kaufte er heimlich eine Damenzeitschrift, wenn er zusammen mit Sissela auf einer Premiere in Stockholm gewesen war. Er liebte es, einer der Menschen auf diesen Fotos zu sein, und verglich sich und Sissela oft mit Paaren im selben Alter. Die Bjurwalls waren kaum zu übertreffen, was Ausstrahlung und Geschmack betraf.
Heimer ging wieder in die Küche. Er strich sich ein Brot, aß aber nur die Hälfte davon. Seine Gedanken wanderten zu Emelie, und er fragte sich, wo sie war. Sie war so wütend gewesen, als sie das Haus verlassen hatte, und er hoffte inständig, bald mit ihr reden zu können. Ganz in Ruhe, wenn der schlimmste Zorn verraucht war.
Er ging erneut in das Zimmer seiner Tochter und setzte sich auf das Bett. Ihm fiel auf, wie schlecht die neue Emelie zur alten passte. Weiße Blusen und Kaschmirpullover hingen neben schwarzen Kapuzenpullis und T-Shirts mit aufgedruckten Bandnamen im Kleiderschrank. Die Burberry-Tasche stand auf dem Boden neben einer gelben Plastikkiste voller Schallplatten. Und der deutlichste Kontrast: das glatte MacBook in einem Lederetui neben dem hochhausartigen PC mit drei externen Bildschirmen und einem Headset, das eher zu einem Kampfpiloten gepasst hätte.
Das Foto über dem Schreibtisch erinnerte an eine andere Zeit. Ein Gruppenbild der Striker Chicks von dem ersten Wettkampf, an dem sie bei der DreamHack in Jönköping teilgenommen hatten. Emelie stand ganz rechts außen, einen Kopf größer als die anderen Mädchen im Team. Das blonde Haar war damals schwarz gefärbt und zu einem kurzen Pagenkopf geschnitten. Die Schminke war dicker aufgetragen, und in der Oberlippe steckten die beiden Ringe, über die Sissela sich so aufgeregt hatte.
Heimer wandte den Blick ab. Er wollte noch eine Runde rennen. Sich völlig verausgaben und den Blutgeschmack im Mund spüren. Vergessen, was für eine rückgratlose Amöbe er gewesen war, und sei es nur für einen Moment.
Da hörte er, wie im Erdgeschoss die Haustür geöffnet wurde. Danach den dumpfen Aufprall einer Tasche, die auf den Klinkerboden gestellt wurde, und das Klirren der Kleiderbügel, die an der Stange unter der Hutablage gegeneinander stießen. Müde Schritte auf der Treppe.
»Bringst du mir ein Glas Wasser, Schatz?«
Heimer war in die Küche gegangen, um Sissela zu begrüßen. Jetzt sah er, wie sie im angrenzenden Wohnzimmer ihre Stöckelschuhe auszog und sich aufs Sofa sinken ließ. Sie stolperte nur ganz leicht über die Worte, aber er hörte sofort, dass sie getrunken hatte.
»Klar«, sagte er und bemühte sich, nicht zu zeigen, wie genervt er war, weil er sie den ganzen Abend nicht erreicht hatte. Emelie brauchte ihre Unterstützung, da wäre es dumm, einen Streit vom Zaun zu brechen.
Er drückte ein Glas gegen die Vertiefung in der Kühlschranktür. Während das kalte Sprudelwasser hineinströmte, betrachtete er seine Frau. Das platinblonde Haar mit der störrischen Strähne, die nicht hinter dem Ohr bleiben wollte. Die aristokratische Nase, die ihr, wie er wusste, sehr gefiel. Und dann das Kinn, über das sie sich ein wenig zu oft strich. Der Arzt hatte die Haut beim letzten Eingriff zu stark gespannt. Es sehe einfach nicht natürlich aus für eine Frau über vierzig, jammerte sie regelmäßig. Heimer sagte nichts dazu, dachte aber insgeheim, dass es bei Schönheitsoperationen doch genau darum ging. Wenn sie natürlich aussehen wollte, hätte sie ihr altes Kinn behalten können.
Er stellte das Wasserglas auf eine Unterlage, um den Wohnzimmertisch zu schützen.
»Danke«, sagte sie und leerte das halbe Glas in einem Zug. »Tut mir leid, dass ich so spät heimkomme. Die Besprechung hat ewig gedauert, und ich hatte völlig vergessen, dass wir danach noch eine Weinprobe geplant hatten. Ich habe dir ein paar Flaschen mitgebracht. Der Neue im Vorstand hat Anteile an einem Anbaugebiet in Südafrika, und als ich von deinem Interesse für Weine erzählt habe, wollte er unbedingt, dass ich eine Kiste für dich mitnehme.«
»Richte ihm meinen Dank aus«, antwortete Heimer und setzte sich ihr gegenüber auf den Lamino-Sessel.
Er hasste es, wenn seine Frau so etwas machte. Wie konnte sie glauben, dass die Flaschen von diesem Pferdehändler einen Platz in seinem Weinkeller verdienten? War ihr nicht bewusst, mit welch einer Sorgfalt er seine Sammlung eingekauft hatte? Das letzte bisschen Platz war für ein paar Flaschen Bordeaux reserviert, die er bei Sotheby’s Weinauktion im Herbst zu ersteigern hoffte.
»Hast du heute Abend etwas von Emelie gehört?«, fragte er.
»Nein«, sagte sie. »Ist sie nicht zu Hause?«
Er schüttelte den Kopf, während sie ein Bein anzog und anfing, sich selbst den Fuß zu massieren. Heimer versuchte sich zu erinnern, wann sie aufgehört hatte, ihn darum zu bitten, wenn sie einen langen Arbeitstag in unbequemen Schuhen hinter sich hatte.
»Ihr geht es nicht gut«, sagte er und stand auf.
Mit einer Handbewegung gab er Sissela zu verstehen, dass sie ihm folgen sollte. Zusammen gingen sie in das Zimmer ihrer Tochter. Er zog die Schublade heraus und deutete auf das Tütchen mit dem Rest von Kokain.
»Ist es das, was ich denke?«
Er nickte.
»Ich fühle mich so betrogen«, sagte Sissela nach einem kurzen Schweigen. »Erst die ganzen Lügen über die Uni und jetzt das. Sie hat doch versprochen, damit aufzuhören.«
»Wir waren naiv. Uns hätte klar sein müssen, dass es nicht so leicht geht.«
»Du meinst, dass ich naiv war. Du hast ja nie wirklich geglaubt, dass es ihr besser geht.«
Ja, das meinte er tatsächlich. Aber er fand es gut, dass sie von sich aus zu diesem Schluss kam, ohne dass er sie mit der Nase darauf stoßen musste.
»Sie geht nicht an ihr Handy«, sagte er. »Ich glaube, ich sollte los und sie suchen.«
»Ist das wirklich eine gute Idee?«, wandte Sissela ein. »Sie kommt bestimmt bald zurück, und dann möchte ich, dass wir beide zu Hause sind. Emelie hört mehr auf dich als auf mich.«
Falsch, dachte er. Früher hatte sie mehr auf ihn gehört. Vor Björkbacken.
Wie immer richtete er sich nach Sissela, und sie tranken Kamillentee, weil sie meinte, er würde die Nerven beruhigen. Als ihre Tochter um ein Uhr immer noch nicht zurück war, ging sie ins Bett. Heimer legte sich mit einer Decke auf das Sofa. So würde er aufwachen, wenn Emelie versuchte sich hereinzuschleichen. Er schwor sich, wirklich mit ihr zu reden. Irgendwo tief drinnen gab es die alte Emelie noch. Die all ihre Hoffnung auf ihn gesetzt hatte – und diesmal wollte er sie nicht enttäuschen.
3. Baltimore, 2019
3.
BALTIMORE, 2019
Der Platz, an dem der Mann gelegen hatte, war leer, das Bett verschwunden, und das Gerät, an den sie seinen Körper angeschlossen hatten, stand ausgeschaltet auf einem Wagen an der Wand.
John hatte erneut das Bewusstsein verloren, als ihn das Gesicht des Mannes daran erinnert hatte, warum er sich im Krankenhaus befand. Jetzt herrschte draußen Dunkelheit. Es war Abend oder vielleicht schon Nacht. Er wusste es nicht. Im Raum gab es keine Uhr.
Die Krankenschwester kam wieder herein. Sie trat neben sein Bett und wirkte besorgt. Sie meinte, dass Blackouts nicht zu den typischen Symptomen bei Schusswunden im Oberkörper passten, und wollte einen Arzt holen. John protestierte. Sein Hinterkopf tat nicht mehr weh, und die Schmerzen in der Brust wurden vom Morphin gedämpft. Nach kurzem Zögern lenkte die Krankenschwester ein.
»Was ist mit dem Mann passiert, der neben mir gelegen hat?«, fragte er.
»Er wird noch einmal operiert. Beim ersten Mal gab es Komplikationen, deshalb wollten die Ärzte noch einen zweiten Eingriff vornehmen«, sagte sie, verstummte dann aber hastig.
Vielleicht hatte sie ihre Schweigepflicht verletzt und zu viel über einen anderen Patienten verraten. John fragte sich, wie viel die Krankenschwester eigentlich über die Männer wusste, die sie pflegte. Polizeischutz vor dem Zimmer stand im Johns-Hopkins bestimmt nicht auf der Tagesordnung.
Sie wünschte ihm eine gute Nacht, nachdem er ihr versprochen hatte, sie zu rufen, falls ihm wieder schwindlig werden sollte. John schloss erst die Augen, als die Frau den Raum verlassen hatte. Die fragmentarischen Erinnerungen an die Ereignisse im Hafen von Baltimore waren zu einem verständlichen Ganzen verschmolzen, sobald er das Gesicht des Mannes erblickt hatte. Obwohl sein Körper sich wehrte und der Schmerz am Hinterkopf wieder zu pulsieren begann, zwang er sich zurück zu dem Frachtcontainer und dem Moment, als er überzeugt gewesen war, dass sein Leben gleich vorbei wäre.
Abaeze war da, zusammen mit den übrigen vertrauten Gesichtern. Und natürlich Ganiru. Immer Ganiru. Er hatte sie herbestellt und führte sie jetzt durch das Labyrinth aus Containern zum nördlichen Teil des Hafengeländes. Schließlich blieb er vor einem davon stehen und schob den Riegel beiseite, sodass die schweren Türen aufglitten.
Er gab Abaeze, der neben ihm stand, mit einem Nicken zu verstehen, dass er in den Container steigen solle. Dann folgten John und die anderen. Sie stellten sich nebeneinander an die Wand und sahen zu, wie Ganiru versuchte, die Türen hinter sich zu schließen. Die Schließvorrichtung leistete Widerstand, aber als er sich mit der Hüfte dagegenstemmte, glitten die Kolben in die richtige Position, und das helle Licht, das zuvor noch hereingeströmt war, wurde ausgesperrt.
Im nächsten Augenblick glimmte eine schwache Beleuchtung an der Decke des Containers auf. John schaute hoch und sah eine Baulampe, die an einem Haken hing. Ganiru trat ein paar Schritte vor und streckte die Hand nach der Lichtquelle aus. Er nahm sie vom Haken und hielt sie vor sich auf Brusthöhe. Der kalte helle Schein beleuchtete sein Gesicht von unten und ließ ihn wie einen bösen Geist aussehen.
»Setzt euch hin.«
John schielte zu den anderen hinüber. Es war komisch, sich auf den schmutzigen Boden zu hocken.
»Setzt euch hin«, wiederholte Ganiru.
Diesmal gehorchten die Männer, nahmen Platz und lehnten sich mit dem Rücken gegen die Wände aus Wellblech. John spürte das kalte Metall durch sein Hemd.
»Was soll das Ganze?«, fragte Abaeze.
John hätte dafür ein paar harte Ohrfeigen geerntet. Aber bei Abaeze war es anders. Er war länger dabei und hatte eine andere Stellung in der Gruppe.
»Ich hätte nie gedacht, dass ich das einmal sagen muss, aber einer von euch ist ein Spitzel.«
John war froh, dass sein Gesicht im Dunkeln lag und er sich nicht verraten konnte. Er hatte schon oft davon geträumt, wie sich die Pranken des Chefs um seinen Hals schlossen. Wie die Daumen direkt unter dem Adamsapfel zudrückten und ihm die Luft raubten.
»Wie sicher bist du?«, sagte Abaeze leiser.
»Hundert Prozent. Die DEA hat ein paar von unseren Lieferungen abgefangen. Also habe ich euch neulich von einem gefakten Transport erzählt, der mit einem Frachtflugzeug reinkommen sollte. Und ratet mal, welche Kisten die Schweine aufgemacht haben?«
Ganiru schwenkte die Baulampe wie eine Fackel vor seinen Männern hin und her. Er ging von Gesicht zu Gesicht und blieb vor jedem ein paar Sekunden lang stehen.
»Wenn jemand was weiß, dann raus mit der Sprache«, zischte er.
Als die dunklen Augen an John vorbeigewandert waren, versuchte er die Hand zu heben, um sich den Schweiß von der Stirn zu zwischen. Sie gehorchte nicht. Die Befehle des Gehirns kamen nicht an, irgendwo in seinem Körper war das System zusammengebrochen.
Wieder Ganiru. Sein Gebrüll hallte im Container wider. »Ich verlange eine Antwort!«
Als niemand etwas sagte, riss er die Pistole aus dem Holster unter seinem Jackett und legte sie vor sich auf den Boden. Er verpasste der Waffe einen heftigen Stoß, sodass sie sich um ihre eigene Achse drehte. John folgte der rotierenden Mündung mit dem Blick. Anfangs drehte sie sich mit gleichbleibender Geschwindigkeit, wurde aber bald langsamer. Schon setzte sie zur letzten Drehung an, und John wusste, dass es schlecht für ihn aussah. Doch die Mündung beschloss im letzten Moment, an ihm vorbeizugleiten und auf einen anderen Mann zu zeigen.
Ganiru hob die Waffe auf, steckte sie ins Holster zurück und hängte die Baulampe wieder an den Haken an der Decke. Dann riss er den Mann hoch und schleppte ihn zum Eingang. Mit seiner freien Hand öffnete er den Container und stieß den Mann so hart in den Rücken, dass er draußen auf den Asphalt stürzte.
Ganiru wandte sich zu den Gesichtern um. Er sah jetzt ruhiger aus. Lächelte ein wenig, als sei das Spiel mit der Pistole nicht ernst gemeint gewesen.
»Ich erschieße alle zehn Minuten einen von euch, bis ich erfahre, wer uns verpfiffen hat«, sagte er und ging hinaus.
Es donnerte in Johns Ohren, als die Türen zufielen und das Licht wieder auf den weißen Schein der Baulampe reduziert wurde. Im nächsten Moment peitschten in rascher Abfolge zwei Schüsse auf.
Im Container herrschte völlige Stille. Als hielten alle Männer innerhalb der vier Blechwände die Luft an, und keiner wollte der Erste sein, der sie wieder herausströmen ließ. Schließlich wurde das Schweigen so erdrückend, dass der Mann, der direkt an der Tür saß, den Mund öffnete.
»Macht euch keine Sorgen, keiner ist verletzt«, sagte er. »Diese Kugeln stecken im Boden. Ich glaube keine Sekunde an diese Story von der gestoppten Lieferung. Hier drin ist doch wohl niemand so bescheuert und verpfeift uns, oder? Ganiru war schon immer paranoid, er will uns nur testen.«
John war versucht, ihm zu glauben. Er klang so beruhigend, so tröstend. Bald würde alles vorbei sein, und sie würden zusammen mit Ganiru darüber lachen. Der Chef würde sie auf einen Drink in diese triste Kneipe am Patterson Park einladen, die sein Cousin betrieb.
John versuchte seinem Gehirn noch einmal zu befehlen, den rechten Arm zu heben. Die Nerven streikten weiterhin.
»Was denkst du, Abaeze? Du kennst ihn ja«, sagte eine Stimme weiter weg aus dem Halbdunkel.
Abaeze sah hochkonzentriert aus und zuckte nur mit den Schultern. Als würde er sich um nichts anderes kümmern als seine eigenen Gedanken.
Der Schließmechanismus schepperte wieder. Ein schmaler Streifen von Tageslicht drang herein und weitete sich, als die Tür halb aufging. Etwas wurde in den Container gestoßen, dann verschwand das Licht aufs Neue.
Ganirus Stimme war durch den Spalt zu hören, bevor er die Tür wieder zudrückte. »Noch fünf Minuten.«
John sah, dass einige der Männer aufsprangen und sich in einem Halbkreis um den Körper auf dem Boden hinstellten. Einer schüttelte ihn, um eine Reaktion zu bekommen. Erst vorsichtig, dann immer heftiger. Da kippte das Gesicht zur Seite, und ein Auge starrte John an. Das andere war weggeschossen.
Der Mann, der soeben versucht hatte, die anderen zu beruhigen, wankte in eine Ecke des Containers und übergab sich laut würgend. Der bittere Geruch von Magensäure und halb verdauten Fajitas breitete sich in dem engen Raum aus.
Mehrere der Männer fingen an zu schreien und sich gegenseitig zu beschuldigen. John saß wie festgeklebt auf dem Boden und versuchte seine wilden Gedanken zu ordnen. Doch es war unmöglich, sie zu einer verständlichen Einheit zu verbinden.
Abaeze stellte sich mitten in den Container und trennte zwei Männer voneinander, die angefangen hatten, sich zu prügeln.
»Wenn wir jetzt nicht die Ruhe bewahren, werden wir alle sterben«, rief er.
Die Männer ließen widerwillig voneinander ab. Vermutlich sahen sie ein, dass Abaeze als Einziger in der Lage war, Ganiru umzustimmen.
»Wenn er zurückkommt, werde ich ihm sagen, wer uns verraten hat. Ich werde mir nie verzeihen, dass einer von uns sterben musste, bevor ich es geschafft habe, eins und eins zusammenzuzählen«, sagte er und setzte sich wieder.
Die anderen Männer hockten sich ebenfalls hin. Dann wurde es merkwürdig still im Container. Verängstigte Männer entlang der Wände, die es vermieden, einander anzusehen.
Schließlich ergriff einer von ihnen das Wort. »Wer ist es?«
Abaeze schüttelte den Kopf. »Wenn Ganiru kommt.«
John fragte sich, wie viel von dem Chaos, das in seinem Kopf herrschte, nach außen hin zu erkennen war. Sein Atem ging so schnell, dass er keuchte wie ein fiebriges Kind. Aber niemand beachtete ihn. Alle hatten mit sich selbst zu tun und kalkulierten ihre Chancen. Ihr Wort gegen das von Abaeze, falls er sie beschuldigte. Wem würde Ganiru glauben?
Die Türen des Containers öffneten sich wieder, und ihr Henker stieg mit unbeschwerten Schritten über die Leiche auf dem Boden. Er musste gemerkt haben, dass sich alle Blicke auf Abaeze richteten.
»Hast du mir etwas zu sagen?«, fragte er.
Abaeze zögerte nicht. Seine Stimme war fest und triefte vor Verachtung. »Er ist der Verräter«, sagte er und streckte die Hand aus.
John sah, dass der Finger auf ihn gerichtet war, und spürte die Blicke sämtlicher Männer. In ihren Augen las er nicht nur Hass, sondern auch einen Anflug von Erleichterung. Wenn er verlor, würden sie gewinnen. Der erste Preis war die Gnade, auch am nächsten Tag aufwachen zu dürfen.
Aber woher wusste Abaeze Bescheid? Wenn er es denn wusste. Er konnte genauso gut zufällig irgendjemanden ausgewählt haben, um nicht selbst beschuldigt zu werden. John war am kürzesten dabei, allein das machte ihn zu einem dankbaren Opfer.
»Bist du sicher?«, fragte Ganiru.
»Ja, er hat einmal sein Telefon im Auto vergessen, als er pinkeln musste. Da kamen komische Nachrichten. Hab es damals nicht verstanden, aber jetzt kapiere ich, worum es ging«, sagte er und spuckte in Richtung des Verräters.
John starrte auf die Spucke vor seinen Füßen. Ihm war übel, aber er konnte den Würgereiz beherrschen. Würde Ganiru das wirklich schlucken? Glaubte er ernsthaft, dass Spitzel auf diese Weise mit ihren Auftraggebern kommunizierten?
Offenbar – denn jetzt sah er, dass Ganiru die Waffe auf ihn richtete.
»Du brichst mir das Herz. Oder das bisschen, was davon noch übrig ist.«
John wollte sich verteidigen. Den Psychopathen derart volltexten und belügen, dass dieser nicht mehr wusste, wo oben und unten war. Aber seine Zunge war genauso gelähmt wie der restliche Körper. Er bekam kein einziges Wort hervor.
»Lass mich das machen«, sagte Abaeze. »Ich schlafe heute Nacht besser, wenn ich diesen Dreckskerl erledigen darf.«
Ganiru nickte zufrieden. »Klar, er gehört dir.«
Abaeze riss John hoch. Es war eine erniedrigende Art zu sterben. All das Training, um Druck standzuhalten, und jetzt ließ er sich wie eine willenlose Kreatur zur Schlachtbank führen. Ganiru hielt die Türen auf, damit Abaeze ihn hinausschleppen konnte. Fast war er dankbar dafür, nicht im Container sterben zu müssen. Wenigstens konnte er seinen letzten Atemzug an der frischen Luft tun.
»Auf die Knie«, befahl Abaeze.
John bekam einen Stoß, fing sich mit den Händen ab und stand nun auf allen vieren, mit dem Rücken zu Abaeze. Er war froh, dass die anderen Männer im Container blieben. Der Tod war etwas Privates, und er wollte seinen letzten Augenblick nicht mit ihnen teilen.
Er drehte sich um und sah, wie Ganiru Abaeze die Pistole gab. Hörte das metallische Klicken, als Abaeze die Waffe entsicherte. Spürte die Mündung am Hinterkopf, die sein Gesicht zu Boden drückte. John folgte mit dem Blick einem Riss im Asphalt, bis dieser unter einem weiteren Container verschwand.
Dies war das Ende, das letzte Kapitel – davon war er überzeugt.
Sein innerer Film stoppte, als er hörte, dass die Türklinke nach unten gedrückt wurde. Er schlug die Augen auf und sah, wie der Polizist aus dem Flur der Krankenschwester half, ein Bett durch die Türöffnung zu schieben. Das musste Abaeze sein, der von der Operation zurückkam. John schaute sofort, ob er Bewegungen wahrnehmen konnte, aber sein Zimmernachbar schien nicht wach zu sein.
Die Krankenschwester parkte das Bett neben Johns und schloss den Patienten an die Überwachungsgeräte an. Dann piepte ihr Pager, und sie ließ John allein mit dem schlafenden Abaeze zurück.
John musterte den schweren Körper, der kaum ins Bett passte. Er musste über zwei Meter groß sein und weit über hundert Kilo wiegen. Seine Haut war so schwarz, dass sie fast bläulich schimmerte. Eine breite Nase und sehr tiefe Falten in den Wangen, die John bislang nicht bemerkt hatte. Die kräftigen Arme, die auf der Decke ruhten, schienen nicht im Fitnessstudio trainiert worden zu sein. Ihre Muskeln waren von einer Fettschicht umhüllt, deswegen aber nicht weniger beeindruckend. John verstand, warum Ganiru so begeistert von ihm gewesen war. Wer seine Schulden nicht bezahlen wollte, entdeckte meistens doch noch versteckte Reserven, wenn Abaeze am Verhandlungstisch aufkreuzte.
Im nächsten Moment drang ein Husten aus dem schlaffen Mund. John zuckte zusammen. Abaeze hustete erneut, er kam ganz eindeutig wieder zu Bewusstsein.
John überlegte kurz, ob er den Alarm betätigen sollte, verzichtete aber darauf, als Abaeze die Augen öffnete und sich zu ihm umdrehte. Es schien ein paar Sekunden zu dauern, bis der Riese begriff, wen er vor sich hatte. Dann lächelte er schwach und sagte: »Na, immerhin lebst du noch.«
John erwiderte das Lächeln. »Ja, und wir wissen ja beide, wem ich das zu verdanken habe.«
4. Karlstad, 2009
4.
KARLSTAD, 2009
Heimer probierte den frisch gepressten Saft und stellte fest, dass die Orangen nicht seinen Ansprüchen genügten. Der Laden führte neuerdings eine andere Sorte, die nicht so süß war wie die vorherige. Er reinigte die Presse, stellte das Gehäuse in die Spülmaschine und füllte zwei Gläser. Dann servierte er eines davon seiner Frau an der Kücheninsel. Sie nahmen ihr Frühstück häufig dort ein, weil es der einzige Platz war, wo auch von Osten das Licht hereinfiel. An Tagen mit klarem Wetter konnten sie die Sonne über den Baumwipfeln aufgehen sehen.
Das Fenster war erst in letzter Sekunde eingefügt worden, und Heimer war froh, dass er sich durchgesetzt hatte. Die Lage des Grundstücks am Ufer des Vänern legte es natürlich nahe, alle Räume zum Wasser hin auszurichten. Aber Värmland bestand nicht nur aus Seen, sondern auch aus Wäldern. Heimer mochte diesen Satz. Er hatte ihn benutzt, um die Baufirma davon zu überzeugen, den Grundriss ein weiteres Mal zu überarbeiten. Im Gegenzug hatte er versprochen, dass es die letzte Änderung sein würde, die auch Leitungen oder tragende Wände betraf. Ein Versprechen, das er bereits am Tag darauf gebrochen hatte, als er mitten in der Nacht mit einer neuen Vision für das Schlafzimmer und das angeschlossene Bad aufgewacht war.
Während des Hausbaus war er ganz in seinem Element gewesen, und Sissela hatte sich ausnahmsweise aus allem rausgehalten und sein Architekturwissen respektiert. Es war noch vorhanden, auch wenn er schon seit Jahren nicht mehr in diesem Beruf gearbeitet hatte.
Heimer betrachtete seine Frau, während sie das Glas zum Mund führte. Ihre Hände sahen alt aus. Diesen Teil des Körpers konnten weder teure Wundercremes noch Schönheitschirurgen vorm Verfall bewahren. Wollte man das Alter einer Frau wissen, brauchte man nur auf ihre Hände zu schauen. Das war genauso zuverlässig wie die Radiokarbonmethode.
Dann dachte er wieder an Emelie.
Seine Gedanken schwirrten immer nur kurz in andere Richtungen, bevor sie wieder bei ihr landeten. Als hätte jemand seinen Brustkorb in einen Schraubstock gespannt und würde ihn langsam festdrehen. Er sehnte sich nach seiner Laufrunde. Er wollte einfach nur laufen, bis der Körper keine Kraft mehr für Gefühle hatte. Bis der Kopf von der vollständigen körperlichen Erschöpfung wie betäubt war.
»Es ist halb elf«, sagte Sissela. »Wir müssen etwas unternehmen.« Ihre Stimme war ruhig, aber entschlossen.
»Dieser Saft«, sagte er. »Findest du nicht, dass er irgendwie komisch schmeckt?«
»Heimer, das geht so nicht. Das Kokain in ihrem Zimmer …«
»Sie meldet sich bestimmt bald«, unterbrach er sie.
»Ich habe Angst, dass sie sich wieder etwas angetan hat. Vielleicht ist sie bei Mange, die beiden haben sich ja den Sommer über recht oft getroffen. Ich rufe Hugo an.«
Er sah ihr nach, als sie mit dem Mobiltelefon in der Bibliothek verschwand. Hugo Aglin war der Kaufmännische Geschäftsführer und das einzige Mitglied der Führungsebene von AckWe, der ab und zu ernsthaft mit Heimer redete. Er hatte unweit von ihnen ein Haus gebaut und hin und wieder um Rat gebeten, den Heimer ihm auch gern gegeben hatte. Dass jemand aus dem Unternehmen ihm etwas anderes zutraute, als nur das Geld seiner Frau auszugeben, war ungewöhnlich. Die meisten behandelten ihn so, wie Sissela es auch machte – mit künstlicher Begeisterung über seine exzentrischen Interessen. Aufmunternder Applaus für das Kind, bevor die Tür geschlossen wurde, weil die Erwachsenen sich in Ruhe unterhalten wollten. Hugo war der Einzige, dem er jemals den Weinkeller gezeigt hatte. Der Rest von diesem Pack konnte einen Barolo Riserva nicht mal von Traubensaft unterscheiden und hatte dort unten nichts verloren.
Es war leicht nachzuvollziehen, warum Sissela sich freute, dass Emelie jetzt mehr mit Hugos Sohn zu tun hatte. Er war in jeder Hinsicht eine bessere Gesellschaft als die Mädchen von den Striker Chicks, die sich auf dem Foto in ihrem Zimmer die Arme um die Schultern legten. Sissela nannte sie verächtlich Computernerds, wenn Emelie nicht zuhörte. Heimer wusste dagegen nicht, was er von Mange Aglin – oder Magnus, wie er eigentlich hieß – halten sollte. Mit seinen zurückgegelten Haaren trug er zweifellos dazu bei, dass Tynäs seinem Spitznamen The Hämptons alle Ehre machte.
Sissela hatte sich geärgert, als ein Journalist von Nya Wermlands-Tidningen zwei Punkte über das A der amerikanischen Luxuskolonie gesetzt hatte und auf diese Weise – in ihren Augen – die Gegend verhöhnte, in der sie lebten. Heimer hatte es lustig gefunden. Auf der kleinen Landzunge im Vänern wohnte immerhin auch der Eigentümer der Zeitung persönlich.
Ansonsten war der prominenteste Einwohner von Tynäs der Schlagerstar Dansbandskungen, der mehrere Millionen Platten verkauft hatte. Heimer konnte sich sehr darüber amüsieren, dass Sissela und er das Nachbargrundstück gekauft und eine Villa gebaut hatten, die das einst so beeindruckende Haus des Sängers plötzlich wie ein schlichtes Ferienhäuschen erscheinen ließ. Der Schlagerkönig hatte nie protestiert, aber während der Bauphase hatte die sonst so samtweiche Baritonstimme einen angestrengten Unterton gehabt, wenn sie sich im Supermarkt grüßten.
Der Beitrag in der Lokalzeitung hatte die Überschrift Geteilte Welten getragen und nicht nur den wohlhabenden Teil von Hammarö außerhalb von Karlstad geschildert, sondern auch die Gegend um die Fabrik in Skoghall. Dort sah die sozioökonomische Mischung anders aus, und die Einwohner mussten den Gestank der Sulfate ertragen, die bei der Produktion von Holzstoff verwendet wurden.
Tynäs und Skoghall waren nicht weit voneinander entfernt, kaum zehn Kilometer. Doch nachdem Heimer viele Jahre auf Hammarö gewohnt hatte, wusste er, dass der Abstand in Wirklichkeit größer war. Die beiden Orte waren Planeten in verschiedenen Sonnensystemen.
Er räumte das Frühstück weg und war gerade fertig, als seine Frau aus der Bibliothek zurückkam.
»Mange schläft noch, aber Hugo hat versprochen, mit ihm zu reden, sobald er wach ist. Die Kinder haben gestern eine Party bei ihm im Haus gefeiert, und es ist gut möglich, dass Emelie auch da war. Er meinte, dass wir uns keine Sorgen machen sollen.«
Sissela klang jetzt ruhiger – mehr wie ein CEO und weniger wie eine bekümmerte Mutter. Heimer beschloss, dass dies der richtige Moment war, um sie kurz allein zu lassen. Er musste seine Laufrunde absolvieren. Sowohl der Körper als auch sein Schädel brauchten das.
Eine Viertelstunde später begab er sich auf die gewohnte Runde. Er wartete, bis die neue Garmin-Uhr an seinem Handgelenk Kontakt mit dem Satelliten hatte. Dann steckte er sich die Kopfhörer in die Ohren und schaltete den MP3-Player ein. Er würde heute eine kürzere Strecke laufen und wollte einen 3:40er-Schnitt halten.
Der erste längere Anstieg kam bereits nach knapp einem Kilometer und war ein erster Indikator: An guten Tagen genoss er die Kraft in den Beinen, wenn sie sich vom Boden abstießen und ihn den Hang hinauftrugen. An anderen Tagen spürte er am Ende des Anstiegs die Milchsäure in den Oberschenkeln. Dann wusste er, dass es eine zähe Runde werden würde.
Er schielte auf die Uhr, die ihm sagte, dass der erste Kilometer hinter ihm lag. Sein Körper sprach gut an, trotz des Chaos in seinem Schädel. Oder vielleicht genau deswegen. Die Sorgen trieben ihn voran. Er musste sich quälen, so nah an die Belastungsgrenze gehen wie möglich. Nur so konnte er seine Gedanken zum Schweigen bringen.
Als der Anstieg geschafft war, bog der breite Pfad nach links ab und führte am Wasser entlang. Das war Emelies Lieblingsteil der Runde. Sie behauptete, das liege an der Aussicht auf den Vänern, der sich weiter unten ausbreitete. Er zog sie dann gern auf und sagte, der Grund sei doch wohl eher, dass dieser Abschnitt so leicht zu laufen sei und sie sich nach dem Anstieg erholen könne.
Er liebte es, mit ihr über das Laufen zu fachsimpeln. Anfangs hatte er sie zwingen müssen, ihn zu begleiten. Für jeden gelaufenen Kilometer durfte sie zwanzig Minuten an den Computer. Im Gegenzug musste er ihr versprechen, jeden Tag ein bisschen zuzusehen, wenn sie spielte.
Das hatte ihm die Augen geöffnet. Er hatte keine Ahnung gehabt, was Counter-Strike war, bevor Emelie ihn in die Geheimnisse des Spiels eingeweiht hatte. Die Regeln waren einfach. Zwei Teams mit jeweils fünf Personen. Die einen spielten die Terroristen, die anderen die Terroristenbekämpfer. Alles passierte virtuell, online und mit einer Geschwindigkeit, die ihm anfangs Kopfschmerzen bereitete, ehe sie ihn nach einer Weile faszinierte. Er begriff rasch, dass Emelie und ihre Teamkameradinnen von den Striker Chicks richtige Cracks waren und sich auf den E-Sportseiten einen Ruf gemacht hatten.
»Was würde Mama wohl sagen, wenn ich im Tennis so gut wäre wie bei Counter-Strike?«, hatte Emelie ihn gefragt, als sie es zum ersten Mal geschafft hatte, zwei ganze Runden mit ihm zu laufen und sich damit fast fünf Stunden Spielzeit verdient hatte.
Die Worte hatten ihn getroffen. Er wusste genau, was Sissela dann gemacht hätte – sie hätte die ganze Welt wissen lassen, dass ihre Tochter ein kommender Star war, und einen amerikanischen Privatcoach einfliegen lassen.
Von diesem Moment an hatte Heimer ihre Spielleidenschaft anders bewertet. Seine Tochter hatte etwas gefunden, das sie liebte, und seine Aufgabe war es, sie dabei zu unterstützen. Er hatte ihr gesagt, sie solle ihre Freundinnen von den Striker Chicks anrufen und sie bitten, zu ihnen zu kommen. Dann war er mit der ganzen Bande in den Elektronikmarkt gefahren und hatte sie das Auto mit allem vollstopfen lassen, was sie benötigten, um noch besser zu werden. Er übernahm sämtliche Kosten.
Wie Emelie ihn angesehen hatte, als er die Kofferraumtür über dem Berg von Elektronikgeräten geschlossen hatte. Diese Erinnerung hütete er wie einen Schatz. Aber das war lange her. In diesem Sommer war sie kein einziges Mal mit ihm laufen gegangen.
Seine Uhr piepste und machte ihn auf die Kilometerzeit aufmerksam. Drei Minuten und achtundfünfzig Sekunden. Das war zu langsam. Bei all den Gedanken an Emelie hatte er den Rhythmus verloren, und er zwang sich, das Tempo wieder zu erhöhen.
Als er nach dem Laufen das Haus betrat, hatte Sissela Besuch bekommen. Hugo Aglin stand neben ihr an der Kücheninsel und deutete auf einen Laptop. Vielleicht lag es nur am Licht des Bildschirms, aber Heimer fand, dass seine Gattin sehr blass wirkte.
»Tut mir leid, wenn ich dich nicht ordentlich begrüße, Hugo, aber ich bin völlig durchgeschwitzt«, sagte er und hielt die Arme hoch, um zu zeigen, wie feucht seine Handflächen waren.
»Du musst dir das ansehen«, stieß Sissela mit zusammengepressten Lippen hervor.
»Es ist ein Foto von Emelies Facebook-Seite«, erklärte Hugo. »Mange hat es mir gezeigt, als ich ihn gefragt habe, ob er weiß, wo sie steckt.«
Heimer hatte nur eine vage Ahnung von Facebook. Er hatte Emelie davon erzählen hören und verstanden, dass es eine Art Schwarzes Brett für Freunde im Internet war. Er ging zur Kücheninsel und merkte, wie er mit den Strümpfen Fußspuren aus Schweiß auf dem Parkett hinterließ.
Hugo drehte den Bildschirm zu ihm hin, und er sah das Foto. Es zeigte Emelies Unterarm mit der merkwürdigen Tätowierung, um die sie solch ein Geheimnis gemacht hatte. Das Motiv bestand aus drei Quadraten, und in zweien davon befand sich ein v-förmiges Häkchen.
Er hatte die Tätowierung zufällig gesehen, nachdem seine Tochter aus Björkbacken zurückgekommen war, und hatte versucht ihr zu entlocken, was sie bedeutete. Sehr widerstrebend hatte sie ihm schließlich verraten, dass es sich um eine Bucketlist handelte. Drei Dinge, die sie vor ihrem Tod noch tun wollte. Natürlich hatte er gefragt, was diese drei Dinge waren, aber da hatte sie nur den Kopf geschüttelt und gesagt, das werde sie niemandem erzählen.
»Siehst du«, sagte Sissela und zeigte auf das dritte Quadrat, das bislang leer gewesen war. »Sie hat sich selbst geschnitten. Sie hat sich das letzte Häkchen direkt in die Haut geritzt.«
5. Baltimore, 2019
5.
BALTIMORE, 2019
Ihm fiel auf, dass er nicht wusste, wie der Mann hieß, der ihm das Leben gerettet hatte. Für John war er bisher Abaeze gewesen, Ganirus Vertrauensmann und treuer Soldat in Baltimores nigerianischem Drogennetzwerk. Aber die Wahrheit sah anders aus. Das war ihm nach dem Schuss im Hafen sofort klar gewesen. Er hatte auf die Kugel gewartet, die sich durch seinen Schädel bohren und sein Leben mit sich reißen würde. Stattdessen hatten seine Ohren von dem lauten Knall gedröhnt. Und als das Dröhnen nicht wieder verschwinden wollte, hatte er gewusst, dass er irgendwie davongekommen war.
Im nächsten Moment hatte er sich umgedreht und gesehen, dass Ganiru auf dem Asphalt lag und sich beide Knie hielt. Offenbar hatte sein Beschützer nicht nur einen, sondern zwei Schüsse auf den Anführer abgefeuert.
Abaeze hatte John befohlen loszurennen. Die ersten Schritte waren die schwierigsten. Aber kurz darauf war die Verbindung zwischen Kopf und Füßen wieder hergestellt, und er war in immer höherem Tempo davongelaufen. Dann fielen die ersten Schüsse hinter ihnen. Die Männer im Container mussten den Zusammenhang verstanden haben, als Ganiru angefangen hatte zu schreien. Sie hatten die Jagd auf die Verräter aufgenommen und nicht gezögert, ihre Waffen zu gebrauchen. Wenn die Einsatzkräfte nur ein paar Minuten später eingetroffen wären, hätten sie vermutlich beide nicht überlebt.
»Wie geht’s dir, Junge?«, sagte Abaeze jetzt und richtete sich auf seinem Kissen auf, damit er über den Seitenschutz des Betts blicken konnte.
Er war vollständig wach und wirkte nicht so desorientiert wie John nach seiner Operation. Abaeze war zwar mindestens fünfzehn Jahre älter als er, aber ihn als »Junge« zu bezeichnen, war trotzdem ziemlich weit hergeholt. John wurde nächstes Jahr fünfunddreißig, und die Leute schätzten sein Alter meistens richtig – jedenfalls nicht niedriger.
»Tja, ganz okay«, antwortete er zögerlich. »Und selbst?«
»Total beschissen. Fühlt sich an, als hätte mir jemand in den Bauch geschossen«, sagte Abaeze und überraschte John mit einem Lachen, dem sogleich ein Stöhnen folgte, als die Operationswunde durch die Bewegungen der Bauchmuskeln gespannt wurde. »Scheiße, tut das weh. Ich brauche mehr Schmerzmittel. Du kennst nicht zufällig jemanden, der so was vertickt?« Er lachte wieder.
John hatte noch nie eine solche Verwandlung bei einem Menschen beobachtet. Der Drogendealer Abaeze und der Patient Abaeze hatten denselben hünenhaften Körper – davon abgesehen aber nichts gemeinsam. Der eine war schweigsam und ernst gewesen, der andere war die Parodie eines bettlägerigen Komikers.
»Wer bist du eigentlich?«, entfuhr es John. Natürlich ahnte er die Antwort, wollte aber trotzdem hören, was sein Bettnachbar zu sagen hatte.
Abaeze wurde sofort ernster. »Brodwick würde es nicht gefallen, wenn wir darüber reden. Er will bestimmt erst einmal ein getrenntes Debriefing machen.«
Brodwick. James E. Brodwick. Der Chef des regionalen FBI-Büros in Baltimore. Also hatte John richtig geraten. Abaeze war wie er selbst eingeschleust worden. Aber warum hatte man ihm nicht gesagt, dass es einen weiteren Maulwurf in Ganirus Netzwerk gab? Brodwick hatte sicherlich seine Gründe. Trotzdem fühlte John sich von seinen eigenen Leuten hintergangen.
Gleichzeitig sah er ein, dass er lieber froh sein sollte. Ohne Abaeze wäre das Ganze anders ausgegangen. Er hatte einen kühlen Kopf bewahrt und eine Lösung gefunden. Was hatte John beigetragen? Rein gar nichts. Er war wie gelähmt gewesen und hatte sich nicht bewegen können.
»Ich dachte, ich wäre tot. Als du auf Ganiru geschossen hast, meine ich. Ich musste mir an den Hinterkopf greifen, um mich zu vergewissern, dass du mir nicht das Hirn weggeblasen hast.«
»Tut mir leid«, sagte Abaeze. »Aber ich musste es echt aussehen lassen.«
Reflexartig griff John wieder die Stelle an seinem Hinterkopf, an der er die Pistolenmündung gespürt hatte.
»Du musst mir sagen, wie du heißt, damit ich weiß, wem ich zu danken habe.«
»Trevor – wenn mir nicht alles wehtäte, würde ich dir die Hand geben. Und du?«
»John. Ich heiße John.«
Es fühlte sich komisch an, seinen richtigen Namen auszusprechen. Fast ein Jahr lang war er jemand anderes gewesen. Das Büro hatte eine Identität mit einer klassischen Gewaltkarriere für ihn zusammengeschustert, die die Aufmerksamkeit von Ganirus Recruitingabteilung erregen würde. Man hatte ihm eine Wohnung in der Belair Road gegeben und ihn dann in Ruhe seinen Job machen lassen. Es hatte eine Weile gedauert, aber nach und nach konnte John das Vertrauen von Ganiru und seinen Leuten gewinnen. Seine Aufträge als Laufbursche waren anspruchsvoller geworden, und an einem Sonntag im Frühling war er in die elegante Villa im Vorort eingeladen worden. Als er dort Ganirus Ehefrau kennenlernte und den Lamborghini seines Chefs Probe fahren durfte, war ihm klar geworden, dass man ihn endgültig akzeptiert hatte.
Brodwick hatte alle Register gezogen, als er ihn von der Kripo in New York rekrutiert hatte. Dies sei eine einmalige Gelegenheit, dem Land zu dienen, und verdeckte Ermittler seien die wichtigste Waffe des FBI gegen das organisierte Verbrechen. John verstand, warum er sich so bemühte. Es war garantiert nicht leicht, Kandidaten zu finden, die sich auf ein solches Risiko einließen. Er hatte das Angebot angenommen, aber völlig unterschätzt, was dieses neue Leben eigentlich bedeutete. Der Drogenhandel machte nie Pause. Es war unmöglich, einen Außenstehenden zu treffen. In diesen Kreisen ließ man sich nicht aus den Augen.
Die Tür ging auf, und eine Frau im weißen Kittel kam herein. John kannte sie nicht. Sie hatte einen verwuschelten Kurzhaarschnitt und trug kein Make-up, trotzdem war ihr Gesicht so formvollendet, dass es in jede Modezeitschrift gepasst hätte.
Trevor wirkte plötzlich hellwach. Obwohl er eben erst nach seiner zweiten Operation aufgewacht war, grinste er bis über beide Ohren.
»Hallo«, sagte sie. »Wissen Sie, wo Sie sich befinden?«
»Im Himmel mit einem Engel Gottes«, antwortete er und lachte noch lauter als bisher.
Hat der Kerl sie noch alle? fragte sich John, bevor ihm einfiel, was er ihm zu verdanken hatte. Die Frau wirkte ungerührt. Sie schien daran gewöhnt zu sein, dass die Patienten ihr Aussehen kommentierten.
»Passen Sie auf, dass Ihre Nähte nicht reißen. Sie wurden wegen einer Schusswunde am Bauch operiert.«
Sie informierte Trevor über seinen Gesundheitszustand. Seine Verletzungen hörten sich schlimmer an als die von John. Sein Bettnachbar würde eine Weile nicht selbstständig essen können.
Trevor hörte aufmerksam zu und stellte ein paar Fragen. Dann erkundigte er sich, ob sie den Arzt bitten könne, die Dosis an Schmerzmitteln zu erhöhen.
Jetzt war sie es, die auflachte. »Entschuldigen Sie, ich habe mich gar nicht richtig vorgestellt: Ich bin Ihre Ärztin. Ich bin Chirurgin in der Notfallambulanz und habe Sie operiert.«
»Oje, da muss ich mich entschuldigen«, sagte Trevor.
»Schon in Ordnung«, antwortete sie. »Und natürlich bekommen Sie mehr Morphium. Ich werde mit der Krankenschwester sprechen und dafür sorgen, dass sie die Dosis anpasst.«
Das Gespräch wurde unterbrochen, weil die Tür aufging. Der Mann, der hereinkam, trug einen dunklen Anzug und hatte sein typisches schiefes Grinsen aufgesetzt. John wusste nie genau, ob es freundlich oder herablassend war.
Die Ärztin drehte sich sichtlich verärgert um. »Ich habe Sie doch gebeten, draußen zu warten.«
»Sie haben mir versprochen, dass ich mit ihnen reden kann.«
Sie seufzte. »Da haben Sie schlecht zugehört. Ich habe Ihnen versprochen, dass Sie zu ihnen können, sobald ich zu dem Schluss komme, dass ihr Zustand es erlaubt.«
Er zuckte mit den Achseln. »Auf mich machen sie einen fitten Eindruck.«
»Und dieses Urteil stützen Sie auf Ihre langjährige medizinische Expertise?«
John genoss den Augenblick. Es kam nicht oft vor, dass jemand Brodwick in die Schranken wies. Der Chef war merklich irritiert, behielt jedoch sein Lächeln bei und versuchte es auf die sanfte Tour.
»Ich bitte um Verzeihung. Natürlich müssen Sie diese Entscheidung treffen. Mir reichen fünf Minuten.«
Sie schüttelte den Kopf. »Vergessen Sie es. Fahren Sie nach Hause und legen Sie sich schlafen. Wenn keine Komplikationen auftreten, können wir ein Gespräch für morgen Nachmittag anvisieren. Frühestens.«
Brodwick hob die Arme in einer beschwichtigenden Ich-ergebe-mich-Geste. In der einen Hand hielt er eine blaue Mappe, in der anderen einen Laptop. »Okay, dann machen wir das so. Aber das hier könnten Sie ihm in der Zwischenzeit doch schon mal geben, oder?«, sagte er und deutete mit einem Kopfnicken auf Johns Bett.
Die Ärztin nahm die Mappe entgegen und legte sie zusammen mit dem Laptop auf den Nachttisch, während Brodwick wieder auf den Flur verschwand. Dann widmete sie sich ihrem Patienten. »Ich habe in Ihrer Akte gelesen, dass Sie Probleme mit Kopfschmerzen hatten und das Bewusstsein verloren haben.«
»Ja, das stimmt«, sagte John und griff sich erneut an den Hinterkopf.
»Haben Sie jetzt Schmerzen?«
»Nein, sie kommen und gehen. Im Augenblick spüre ich nichts.«
Die Ärztin notierte etwas auf dem Block, den sie in der Hand hielt. Ihre besorgte Miene gefiel John nicht.
»Wir werden morgen früh Röntgenaufnahmen von Ihrem Kopf machen. Aber jetzt möchte ich, dass Sie sich ausruhen, alle beide.«
Ein paar Minuten später schlief Trevor. John streckte die Hand nach der Mappe aus, die Brodwick für ihn dagelassen hatte. Die Bewegung verursachte Schmerzen in seiner Brust, und er hoffte, dass die Drainage nicht herausgerutscht war. Die Ärztin hatte die Deckenbeleuchtung herabgedimmt, daher musste er die Leselampe anmachen, um ordentlich sehen zu können.
Die Mappe enthielt Post, die unter seinem richtigen Namen an seine alte Adresse in New York geschickt worden war. Das Büro hatte sie für ihn aufbewahrt. Er überflog die Schreiben von der Zahnarztpraxis, der Bank und dem Finanzamt und konzentrierte sich dann auf die beiden Briefe, die von Hand adressiert worden waren.
Der eine, ein dünner Umschlag, enthielt nur ein Foto. Darauf zu sehen war er selbst zusammen mit den Kollegen von der Mordkommission in New York. Einige Männer trugen Nikolausmützen. Die dunkle Holztäfelung und der Tresen mit der irischen Flagge im Hintergrund verrieten, dass das Foto in ihrer Stammkneipe gemacht worden war, nur einen Block vom Polizeirevier entfernt.
John drehte das Foto um und las die Widmung.
Keine Ahnung, ob das ankommt, wir kennen deine neue Adresse nicht. Aber so oder so: Viel Glück im privaten Sektor, du verdammter Verräter.
Das war die offizielle Version. Dass er in eine unbekannte Stadt gezogen war, um einen Job in einer geheimnisvollen Sicherheitsfirma anzutreten, die Personenschutz für Führungskräfte organisierte.
John lächelte. Es war lange her, dass er an das Leben in New York gedacht hatte. Er musterte sich selbst auf dem Foto. Seine Arme auf den Schultern der Kollegen sahen so dünn aus. Um in seine Rolle als Krimineller zu passen, hatte er wie ein Irrer trainiert. Inzwischen schaute er sich morgens nach dem Duschen gern im Spiegel an. Er mochte seine neuen Oberarme und seinen Waschbrettbauch.
Auch sein Gesicht auf dem Foto war anders. Damals hatte er seine Haare noch, dunkel und lockig. Aus der einen Hälfte seiner Gene. Als Brodwick ihm geraten hatte, sie abzurasieren, hatte John gezögert. Er fürchtete, dass Ganiru ihn mit seiner hellbraunen Haut nicht für afrikanisch genug hielt. Sein Chef hatte das als Unfug abgetan und ihm einen Rasierer gegeben. John hatte es nicht bereut. Ohne die Haare wirkte sein Gesicht kantiger und maskuliner. Er würde nie wieder wie der schmächtige Typ auf dem Foto in der Bar aussehen.
John steckte das Foto zurück in die Mappe und öffnete den letzten Umschlag. Er war braun, wattiert und mit ausländischen Briefmarken beklebt. Er angelte den Inhalt heraus und breitete ihn auf seinem Schoß aus: ein Zeitungsausschnitt, ein USB-Stick und ein handgeschriebener Brief.
Es handelte sich um einen Gruß aus einem Paralleluniversum, das er fast vollständig ausgeblendet hatte. Der Brief stammte von seiner Mutter, die er seit über zwanzig Jahren nicht gesehen hatte – und die in Schweden geblieben war, als sein Vater John nach der Trennung mit nach New York genommen hatte.
Widerwillig hob er ihn auf und fing an zu lesen.
John!
Dieses Mal musst du nach Hause kommen.
Weiter kam er nicht, bevor ihn das schlechte Gewissen mit voller Wucht packte. Hinter der ungelenken Handschrift konnte er die Stimme seiner Mutter hören, und ihm stiegen sofort die Tränen in die Augen. Die Worte trafen ihn direkt ins Herz und zwangen ihn, sich in einem neuen Licht zu betrachten. Was er sah, war nicht schmeichelhaft. Ein rückgratloser Mensch, der den Kopf in den Sand gesteckt und die Wahrheit gewählt hatte, die ihm den größten Vorteil bot.
Er überlegte, ob er den Rest des Briefes lesen sollte, ließ es aber sein. Stattdessen widmete er sich dem Zeitungsartikel. Er stammte aus der Nya Wermlands-Tidningen und war erst vor wenigen Wochen erschienen. Er las den Text unter dem Foto von zwei Männern, die ernst in die Kamera blickten.
Der Polizeichef von Värmland zusammen mit Bernt Primer, angehender Leiter der neuen Polizeigruppe für unaufgeklärte Verbrechen. »Solche Cold-Case-Initiativen wurden sowohl im Ausland als auch in anderen Teilen Schwedens mit guten Ergebnissen getestet«, begründet Bernt Primer das Unterfangen. Die Gruppe beginnt ihre Arbeit im Herbst, und ihre erste Aufgabe wird es sein, den Fall der vermissten AckWe-Erbin Emelie Bjurwall vor zehn Jahren neu aufzurollen.
John war klar, weshalb sie diesen Fall ausgewählt hatten – er würde das größte Medienecho hervorrufen. Die schwedischen Polizeibehörden schienen genauso großen Respekt vor der öffentlichen Meinung zu haben wie die Organisationen, für die er selbst gearbeitet hatte. Das FBI und das NYPD verpassten nie eine Gelegenheit für gute Publicity und gingen mitunter sehr weit, um schlechte zu vermeiden.
Er legte den Artikel beiseite und merkte, wie müde er war. Die Ärztin hatte ihm Ruhe verordnet. Doch er wusste, dass er sowieso nicht würde schlafen können, und streckte die Hand nach dem Laptop aus, den Brodwick mitgebracht hatte. Wenn er schon nicht in der Lage war, den Brief seiner Mutter zu lesen, konnte er sich wenigstens die Dateien auf dem USB-Stick ansehen, den sie ihm geschickt hatte.
Die Ermittlungen waren sehr umfassend, was sich in der großen Zahl von Dateien und Dokumenten widerspiegelte, die auf dem kleinen Metallteil gespeichert waren. Die Medien hatten sich auf die Story gestürzt, und wie in solchen Fällen üblich hatte die Polizei daraufhin immer mehr Ressourcen eingesetzt. Die Modefirma, die das verschollene Mädchen hätte erben sollen, war schon vor zehn Jahren ein schwedischer Exporterfolg gewesen. Inzwischen gab es in jeder größeren amerikanischen Stadt mindestens einen Laden für AckWe-Jeans und – Streetwear. Wahrscheinlich sah es im Rest der Welt genauso aus.
Als Erstes las John einen Wikipedia-Artikel über das Unternehmen, der sich in den Unterlagen befand. Es fiel ihm erstaunlich leicht, den Text in seiner alten Muttersprache zu verstehen. Hin und wieder stolperte er über einen Begriff, aber meistens konnte er die Bedeutung aus dem Zusammenhang ableiten. Zum Glück hatte er in der Vergangenheit öfter schwedische Filme geguckt und seine Sprachkenntnisse immer wieder aufgefrischt.
Die Firma war bereits 1931 von den Nachkommen einer Einwandererfamilie gegründet worden, die Denimstoff nach Värmland mitgebracht hatte. Der Name AckWe war eine Anspielung auf die Landeshymne. Emelie Bjurwall, die Tochter, hätte das Unternehmen in vierter Generation übernehmen sollen. John betrachtete ein altes Foto, auf dem sie zusammen mit ihrer Mutter Sissela im Rahmen einer Ladeneröffnung in London für die Fotografen posierte. Sie war nicht älter als zehn Jahre alt, lächelte aber bereits geübt in die Kamera. Die Bildunterschrift zitierte sie mit der Aussage, wie schön sie die AckWe-Klamotten finde und wie sehr sie sich drauf freue, das Familienunternehmen eines Tages selbst zu leiten.
Die Informationen zum Verschwinden des Mädchens waren eher spärlich. In dem Wikipedia-Artikel stand nur, dass sie 2009 unter unklaren Umständen im Gebiet Tynäs auf der Insel Hammarö außerhalb von Karlstad verschwunden sei.
John schloss den Artikel und suchte nach einer Zusammenfassung des Falls, irgendetwas, das ihm einen Überblick verschaffen konnte. Nachdem er eine Weile in den verschiedenen Dateien herumgeklickt hatte, fand er eine chronologische Auflistung der Ermittlungen. Ausgangspunkt war das vermutliche Opfer.
Das letzte Lebenszeichen von Emelie Bjurwall war ein Foto, das auf ihrer Facebook-Seite gepostet worden war. Es zeigte die Tätowierung auf dem linken Unterarm des Mädchens. Das Motiv bestand aus drei Quadraten mit Häkchen, wobei das letzte direkt am Handgelenk nicht tätowiert, sondern mit einem spitzen Gegenstand in die Haut geritzt worden war.
Anhand der Blutgerinnung hatte die Gerichtsmedizin festgestellt, dass die Wunde verhältnismäßig oberflächlich war und Emelie noch gelebt haben musste, als sie ihr zugefügt worden war. Ob sie auf dem Foto tot war oder lebte, war allerdings nicht auszumachen gewesen. Genauso wenig, ob sie selbst oder jemand anders das Foto gemacht hatte.
Dagegen hatte Facebook Daten freigegeben, dank derer man die Position des Handys im Moment des Hochladens mit ziemlicher Exaktheit bestimmen konnte. Die Markierung auf der Karte in einem der Dokumente hatte einen Radius von nur hundert Metern. Der eingekreiste Bereich war die Spitze einer Landzunge namens Tynäs auf der Karte, nur einen halben Kilometer von dem Haus entfernt, in dem Emelie am Abend ihres Verschwindens auf einer Party gewesen war.
Die Angaben des Mobilfunkanbieters bestätigten die Informationen von Facebook. Emelies Telefon hatte mit den Empfangsmasten in der Umgebung kommuniziert, bis irgendwann spät in der Nacht der Kontakt abbrach. Dann war entweder der Akku leer gewesen, oder jemand hatte das Handy ausgeschaltet.
John verfolgte die Versuche der Polizei von Karlstad, ein möglichst klares Bild vom Ablauf des Abends vor dem Verschwinden des Mädchens zu erstellen. Laut übereinstimmenden Zeugenaussagen hatte sie die Party gegen Mitternacht verlassen, und das Foto war um 1.48 Uhr auf Facebook veröffentlicht worden.
Der Kern der Ermittlungen bestand darin herauszufinden, was während dieser kritischen zwei Stunden geschehen war.
6. Karlstad, 2009
6.
KARLSTAD, 2009
Nicht einmal zwanzig Minuten nachdem Sissela die Polizei kontaktiert hatte, klingelte es am Gartentor. Wenn Frau Bjurwall rief, sprangen alle sofort. Das galt offensichtlich auch für die Ordnungsmacht. Heimer war von uniformierten Beamten ausgegangen, aber wer auch immer den Anruf entgegengenommen hatte, schien der Angelegenheit höchste Priorität eingeräumt und direkt die Kripo eingeschaltet zu haben.
Er kannte den jüngeren der beiden Polizisten aus dem Bootsclub. Bernt Primer hieß er, und sie hatten einmal zusammen Nachtwache gehalten. Heimer hatte ihm seine Nimbus 405 Flybridge gezeigt, während sie an den Anlegern in der Nähe der Lövnäs-Kirche patrouillierten. Dass er bei der Polizei war, hatte Primer ihm nie erzählt. Oder Heimer hatte nicht richtig zugehört. Er erinnerte sich, dass sie ein paarmal zusammen zum Fischen rausgefahren waren, aber er hatte bald die Nase voll gehabt von Primer und seinem ewigen Geschwafel. Er kannte den halben Bootsclub und hatte über jeden eine Geschichte auf Lager.