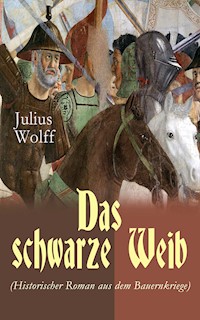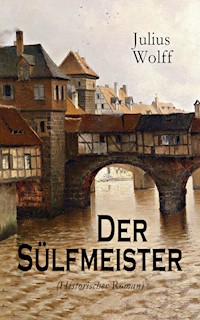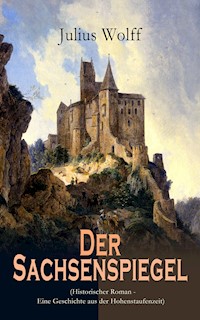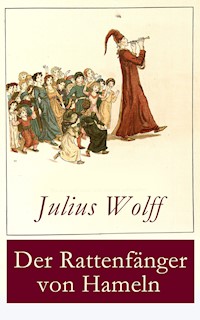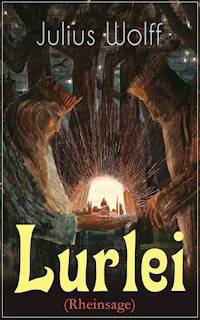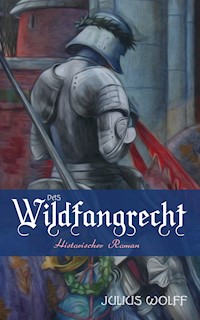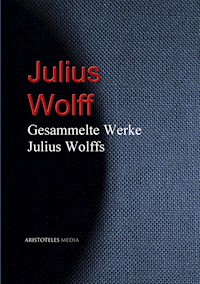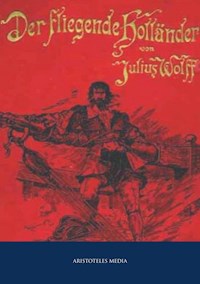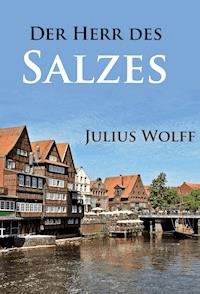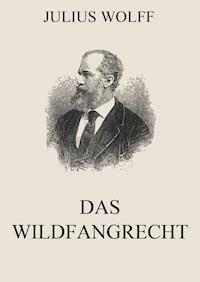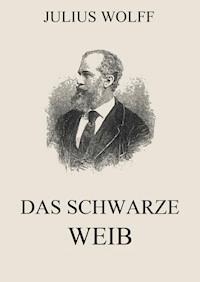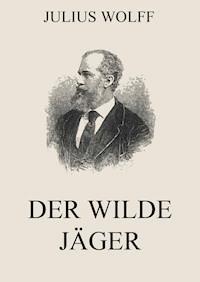0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Sülfmeister - der Herr des Salzes Eine alte Stadtgeschichte Salz - das weiße Gold im mittelalterlichen Lüneburg. Ein spannender historischer Roman, dessen Schauplatz Lüneburg ist. Noch heute können einige im Buch beschriebene Örtlichkeiten in der Stadt besucht werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 700
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Der Sülfmeister
Der Sülfmeister – Der Herr des SalzesI. BandErstes KapitelZweites KapitelDrittes KapitelViertes KapitelFünftes KapitelSechstes KapitelSiebentes KapitelAchtes KapitelNeuntes KapitelZehntes KapitelElftes KapitelZwölftes KapitelDreizehntes KapitelVierzehntes KapitelFünfzehntes KapitelSechzehntes KapitelSiebzehntes KapitelAchtzehntes KapitelNeunzehntes KapitelZwanzigstes KapitelEinundzwanzigstes KapitelII. BandErstes KapitelZweites Kapitel Drittes Kapitel Viertes Kapitel Fünftes Kapitel Sechstes Kapitel Siebentes Kapitel Achtes Kapitel Neuntes Kapitel Zehntes KapitelElftes Kapitel Zwölftes Kapitel Dreizehntes Kapitel Vierzehntes Kapitel Fünfzehntes Kapitel Sechzehntes Kapitel Siebzehntes KapitelAchtzehntes Kapitel Neunzehntes Kapitel Zwanzigstes Kapitel Einundzwanzigstes KapitelZweiundzwanzigstes KapitelImpressumDer Sülfmeister – der Herr des Salzes
Eine alte Stadtgeschichte
Julius Wolff
Historischer Roman
I. Band
Erstes Kapitel
Als man zählte und schrieb nach Gottes Geburt vierzehnhundert und danach im vierundfünfzigsten Jahr am Mittwochen nach Quasimodogeniti, da wanderten zwei junge Handwerksburschen munter fürbaß durch die Lüneburger Heide.
Der eine war von gedrungener Gestalt mit dunklem Krauskopf und braunen Augen, die einen scharfen, fast stechenden Blick hatten. Der andere war hochaufgewachsen mit kräftigem Gliederbau, hatte blondes Haar und unter einer freien Stirn helle, freundliche Augen. Jeder trug seine fahrende Habe mit sich; der größere ein schwerbepacktes Felleisen auf dem Rücken und darunter an der Hüfte noch einen prallgefüllten Beutel aus bräunlichem Ziegenfell, der kleinere nur einen Ranzen über der Schulter, der ihn nicht sonderlich zu drücken schien. Jedem stak ein langes Dolchmesser im Gürtel, aber dem Blonden hing auch ein Schwert an der Seite, fast zu kostbar für einen Handwerksburschen, und seinen niedrigen Filz zierte ein grüner Wacholderzweig, den er sich gestern schon, da sie auf dem Wege von Celle nach Uelzen die große Heide betraten, als ersten Gruß der Heimat gepflückt hatte. Sein Gesell hatte, auf den Wanderstab gestützt, ihm dabei lächelnd zugeschaut und dann gesagt: »Jeder nach seiner Gunst und Gaben! Schusterpech ist schwarz, für mich hat ein Rabe hier einen Kopfputz hingelegt.« Damit hatte er sich die Feder an den Hut gesteckt und weitergesprochen: »Hoffentlich hat es nichts Übles zu bedeuten, Bruder Böttcher, wenn ich mit diesem Zeichen aus der Schwinge des Galgenvogels in deine Vaterstadt einziehe.« »Gott verhüt' es!« hatte der Böttcher geantwortet, und dann waren sie weitergewandert.
Sie hatten sich frühmorgens in Celle getroffen, als sie beide zu gleicher Zeit aus demselben Tore hinausschritten, und sich gegenseitig nach ihrem Wohin und Woher gefragt. Der Schuster wollte nach dem hochberühmten mächtigen Lübeck, den Böttcher aber zog es nach vierjähriger Wanderschaft in die Heimat zurück nach Lüneburg. Sie hatten also den gleichen Weg, kamen beide aus dem Rheinland und waren froh, sich einander anschließen und Freuden und Fährnisse der Wanderung teilen zu können.
In Uelzen waren sie nach starkem Marsche gestern spät abends angelangt, jeder hatte für sich allein in der Herberge seines Handwerks übernachtet und heute morgen pünktlich mit dem verabredeten Glockenschlage sich am Tore wieder eingefunden, um die große Fahrstraße nach Norden selbander weiterzuziehen. Unterwegs hatte der Blonde viel Gutes und Schönes von Lüneburg erzählt und seinem Begleiter wacker zugeredet, vorerst einmal hier sein Glück zu versuchen; er könnte ja nach vierzehn Tagen wieder weitergehen, wenn es ihm nicht gefiele, aber es würde ihm schon gefallen, denn in Lüneburg gingen die Leute auch nicht barfuß; es käme durch die gesegnete Sülznahrung und den großen Frachtverkehr viel Geld in die Stadt, da wären dreißig Bürgerfamilien, die Grafengut besäßen, und es ließe sich da so gut und lustig leben wie in jeder anderen reichen Hansestadt, selbst Lübeck nicht ausgenommen. Der Schusterknecht hatte den Ruhmredigen groß angesehen und bloß gefragt: »Aber so lustig wie am Rheine doch wohl nicht, Bruder Lüneburger?« Darauf ließ sich wenig entgegnen; aber der Schuster war schon entschlossen und sagte: »Will's versuchen, Gilbrecht Henneberg! Will das Handwerk grüßen und sehen, ob ein wohlgewanderter Korduaner in Lüneburg ehrliche Arbeit und gutes Auskommen findet.«
»Warum solltest du denn unter ehrlichen Leuten nicht ehrliche Arbeit finden, Timotheus Schneck?« fragte der Böttcher.
»Nenne mich Timmo«, sagte der Schuster, »das hör' ich lieber.«
»Ist mir auch recht«, sagte Gilbrecht, und sie nahmen den Weg zwischen die Füße.
Es war ein lauer Apriltag. Zerrissene Wolken jagten, vom Südwind getrieben, am Himmel dahin, sandten bald hier auf die beiden Gesellen, bald fern am Horizont in breitem Streifen einen Regenschauer hernieder und gönnten zuweilen auch der Sonne wieder einen flüchtigen Blick auf das feuchte Land. Meist aber blieb das Wetter trübe, und so weit die Augen der Wanderer reichten, dehnte sich endlos die rotbraune Heide. Erst hatte der Weg durch Waldungen von Kiefern, Birken und Eichen geführt, an deren Stelle bald offene Heidestrecken in freundlichem Wechsel mit Wiesengründen und bewaldeten Hügeln getreten waren; dann hatten sich in der leicht und lang gewellten Ebene zerstreut wie Inseln im Meere nur kleine Trupps noch laubloser, von bläulichem Duft umschleierter Wipfel gezeigt; nun aber lag die Heide weithin baumlos vor den Schreitenden da, ernst, schwermütig, farbensatt in einem tiefen Violett und Braunrot, das zu dem dunklen Grau des Himmels so großartig ruhevoll stimmte. Das dürre Heidekraut, von Moos und Flechten durchwachsen, bedeckte alles umher, und dazwischen nestelten sich niedrige Wacholdersträucher mit ihren stachligen Nadeln, das einzige Grün jetzt in der einförmigen Landschaft.
Der junge Wandergesell, der die Heide seine Heimat nannte, schaute mit Entzücken um sich, und das Herz schlug ihm in Freuden. Denn was er hier sah, war ihm von Kindesbeinen an vertraut und lieb.
Er kannte die Heide, wenn sie über und über in roter Blüte stand, von Bienen durchsummt, von Lerchen durchschmettert, er kannte sie in nebelgrauen Novembertagen, wenn sie wie ein großes Brachfeld düster und dunstig in trauriger Öde lag, oder wenn der Regen sie peitschte, der Sturm sie durchbrauste, und kannte sie auch in ihrem blendend weißen Schneegewande, wenn durch die klare Winterluft meilenweit der letzte Baum am Rande sich scharf und deutlich zeichnete. Dieses Flachland, in dem nichts zu sehen war als Himmel und Heide, in silbergrauer, unermeßlicher Ferne eins in das andere verschwimmend, und von dessen eigentümlichen Reizen und stillem Zauber der kaltblütige Genosse neben ihm nichts zu empfinden schien, hatte sich dem hier Geborenen mit der stillen Größe des Bildes tief in die Seele geprägt, so daß er es nie und nirgends vergessen konnte. Selbst als er in der breiten Flut des Rheinstromes den Widerschein der herrlichen Ufer erblickte, mußte er an die kleinen Wassertümpel in dem schwarzen Moorboden der Lüneburger Heide denken, kaum groß genug, daß sich ein Stückchen Wolke oder ein paar goldene Sterne darin spiegeln konnten. Und nun sah er sie wieder, die braune Heide, und sein Fuß schritt über den holprigen Grund, über die zahllosen kleinen Hügelchen mit den struppigen Krautbüscheln zu den lieben Seinen zurück, die ihn nicht erwarteten, und die endlich wieder in die Arme zu schließen jetzt sein sehnlichster Wunsch war. Kein Wunder, daß er tüchtig ausgriff und mit Wonne den würzigen Erdgeruch einsog, der nach den Frühlingsregenschauern von seiner Heimat Boden aufstieg.
Tausend Erinnerungen wurzelten ihm hier zwischen dem Heidekraut, dicht gesät von seiner Kindheit frohen Tagen, wie er mit seinesgleichen die Gegend durchschweift, die Fuhrleute geleitet, die Imker besucht hatte, die mit ihren Bienenkörben die Heide durchzogen und ihre fleißigen Schwärme bald hier, bald dort auf der Blütenfülle weiden ließen. Und dann, wie ein Traumbild in der Luft, baute sich die alte, vieltürmige Stadt vor seinen Sinnen auf und in ihr das hochgiebelige Vaterhaus mit jedem Raum von unten bis oben, in dem er sich selber als Kind mit Kindern gehen und stehen und springen sah oder zusammengehockt unter der Treppe im dämmerigen Winkel, Heimlichkeiten brütend, flüsternd und kichernd – ein goldschimmernd Märchengespinst.
Und da – weit vor ihm, da regte sich etwas Lebendiges; schnell war es heran, nun sah er es deutlich; geliebte Gestalten kamen ihm entgegengeschritten. Er kannte sie wohl, den hohen, ernsten Vater und die Mutter, die liebe Mutter, die Brüder und das blonde Schwesterlein – oh, er hätte mit offenen Armen auf sie losstürzen, hätte aufjauchzen mögen, wenn er allein gewesen wäre, allein auf der endlosen Heide.
Es waren die Geister der Heimat, die den Wanderer umfingen, die Wunderkraft der Heimkehr aus der Fremde, die ihn so mächtig ergriff, daß ihm das Herz davon voll war hier auf der Heide. –
Nach einer kurzen Mittagsrast unter freiem Himmel, bei der sie sich mit einem einfachen Imbiß aus der Tasche und einem mäßigen Trunk gestärkt hatten, begegnete den Fußgängern ein Zug von vier Frachtwagen, jeder mit vier starkknochigen Gäulen bespannt, denen an Kumt und Geschirr allerlei bunter und blanker Flitter hing. Neben jedem Gespann schritten zwei bewaffnete Knechte, und vier Männer, augenscheinlich die Fuhrherren, ritten im Harnisch, je ein Paar vor und eins hinter dem Wagen zu besserer Umsicht und zum Schutz gegen Straßenräuber. Gilbrecht kannte einen der vordersten, redete ihn an und fragte, was sie geladen hätten und wohin sie reisten.
»Viskulen-Gut nach Pest«, war die Antwort.
»Lebt der alte Herr noch?«
»Ei wohl! Gesund wie ein Fisch, und der Junker ist auch wieder da.«
»Junker Balduin?«
Der Fuhrmann nickte. »Und –« Gilbrecht hatte noch eine Frage, aber der Fuhrmann ritt schon weiter.
Auch Timmo wechselte mit den Knechten Gruß und Scherzwort; dann klingelte und klapperte der Frachtzug an den zur Seite Stehenden langsam vorüber.
»Mein Spielgesell Balduin ist auch wieder da«, sagte Gilbrecht, »wie er wohl aussehen mag?«
»Nun, in vier Jahren wird aus einem Stadtjunker noch kein Bischof«, sprach Timmo. »Wenn man so ein paar Jahr in der Fremde gewesen ist und dort viel Neues gesehen hat und kommt dann wieder heim, so meint man, es müsse auch zu Hause alles neu und verändert sein. Und wenn man's bei Lichte besieht, ist alles beim alten geblieben, dieselben Häuser, die gleichen Gesichter, derselbe Tritt und Trott, und nicht lange dauert's, so ist man auch wieder derselbe, als wäre man gar nicht fortgewesen. Wenn das Herumlaufen in der Welt nicht so lustig wäre, hätt ich's schon lange satt, aber ich muß Abwechslung haben, und dann die Mädchen, die sind auch in jeder Stadt anders, das kannst du glauben, ich weiß Bescheid.«
»Was du sagst!« lächelte Gilbrecht.
»Wo hast du denn deine Allerschönste sitzen? Natürlich am Rheine. Oder hast du schon vor vier Jahren mit einer kleinen Lüneburgerin Handtreu getauscht? Das wäre dumm genug gewesen.«
»Vor vier Jahren war ich achtzehn.«
»Und sie?«
»Ach was! Ich weiß von keiner ›sie‹«, sagte Gilbrecht und schwieg still und besann sich, ob er denn wirklich keine wüßte, und dann mußte er sich unwillkürlich nach den Frachtwagen umsehen.
Nun schritten sie wieder eine lange Strecke schweigsam nebeneinanderher, als Timmo plötzlich stehenblieb und, sich verpustend, sprach: »Höre, Bruder Böttcher, wenn ich's nicht deinen Worten schon glaubte, so müßt' ich's an deinen Siebenmeilenschritten merken, daß du in Lüneburg zu Hause bist. Hast du es denn gar so eilig, in Mütterleins warmes Nest zu kommen?«
»Es geht dir zu rasch?« lachte Gilbrecht. »Ja, Bruder Korduaner, sieh mal den Kirchturm da hinten, den kenn' ich, der winkt und winkt in einem fort, ich soll mich sputen und kommen. Das ist Sankt Johannes in Modestorp.«
»In Modestorp?«
»Es ist Lüneburg, mein liebes Lüneburg!« rief Gilbrecht und schwenkte den Hut. »Wir nennen die Kirche nach einem alten Dorfe, das längst in der Stadt aufgegangen ist, und an dessen Stelle sie steht. Es ist der höchste von den beinah hundert Türmen der Stadt und geradesoviel Fuß hoch wie Tage im Jahre sind.«
»Hundert Türme!« staunte der Schuster. »Du möchtest dein Lüneburg wohl zu einem neuen Wunder der Welt herausstreichen?«
»Wirst es ja sehen!« erwiderte kurz der Böttcher.
»O nun, nichts für ungut! Ich verdenke dir's nicht, daß dich die Heimkehr freut, seit dir der Lüneburger Ratsherr in Celle gute Mär von Eltern und Geschwistern gesagt hat.«
»Als ich Herrn Albrecht von der Mölen vorgestern zufällig auf der Gasse traf, kannte er mich natürlich nicht, aber ich kannte ihn gleich und mußte doch fragen.«
»Versteht sich! Landsleute sind sich immer die Nächsten in der Fremde.«
»Der Ratsherr war freilich schon über zwei Monate weg von Lüneburg«, sprach Gilbrecht nachdenklich, »war in Wien gewesen beim Kaiser, und jetzt hielten ihn in Celle noch Geschäfte beim Herzog Friedrich, den sie den Frommen nennen.«
»Beim Kaiser? Seid ihr denn Freie Reichsstadt?«
»Nein, Herzog Friedrich ist unser Landesherr, und der Streit um die Erbfolge hat Gut und Blut genug gekostet«, sagte Gilbrecht. »Aber«, fuhr er fort, »der Ratsherr schien seiner Geschäfte wenig froh zu sein. Er bestellte mich in seine Herberge und gab mir dort einen Brief, den er mittlerweile geschrieben hatte, an den Herrn Bürgermeister in Lüneburg. Hüte ihn wohl! sagte er mir dabei, er ist wichtig.«
»Einem Ratsherrn dünkt manches wichtig, wofür ein Schuster keinen Pfifferling gibt«, sagte Timmo. Gilbrecht krauste die Stirn und schwieg.
Als sie spät nachmittags die Landwehr überstiegen, die sich mit ihrem Damm in drei Viertelstunden Entfernung um Lüneburg zog, wies Timmo nach der Stadt hin und sagte: »Du, ich glaube, in Lüneburg brennt es; sieh nur den dicken Qualm da links.«
»Das ist ja die Sülze«, beruhigte Gilbrecht, »wo die große Salzquelle ununterbrochen aus der Erde zutage kommt und aus einem trichterförmigen Schachte, dem Sode, geschöpft wird. Da stehen vierundfünfzig Siedehütten, in denen die flüssige Sole Tag und Nacht zu Salz eingedampft wird.«
»Und die Solquelle ist Eigentum eurer Stadt?« fragte Timmo.
»In alten Zeiten gehörte sie den Landesherren, aber die brauchten Geld, viel Geld und immer wieder Geld; da verkauften sie nach und nach die Solquelle an Klöster und Stifte und reiche Prälaten diesseits und jenseits der Elbe bis nach Walkenried hin. Den geistlichen Herren wurde aber der Betrieb des Salzwerkes zu unbequem, darum verpachteten sie die Einkünfte daraus in ganzen Pfannen oder in Pfannenteilen an Bürger unserer Stadt auf lange Jahre, zumeist in Erbpacht. Die Pächter heißen Sülfmeister und bilden eine eigene, hochangesehene Gilde. Im Reiche nennt man sie spottweise auch Salzjunker.«
»Salz ist ein gemein und billig Gewürz«, sagte Timmo, »ist denn der Ertrag so groß?«
»Als ich auf Wanderschaft ging«, sprach Gilbrecht, »gab es jährlich über fünfundzwanzigtausend Wispel Salz, und zum Eindampfen brauchten sie nahe an dreißigtausend Klafter Holz. Solche Zahlen vergißt kein Lüneburger.«
»Dreißigtausend Klafter Holz! Da ließe sich mancher Braten dran braun machen.«
»Die Heide weiß auch davon zu erzählen«, sagte Gilbrecht, »sie hat ihre Wälder dazu hergeben müssen, und jetzt lassen sie das Holz aus Mecklenburg kommen und haben einen eigenen Kanal, die Schalfahrt, dazu angelegt, auf der sie einen Zoll erheben.«
»Du machst mich neugierig auf dein Lüneburg«, sagte Timmo, »und ich fange an, dir zu glauben, denn mit den hundert Türmen scheint es seine Richtigkeit zu haben; ich kann sie nicht zählen, die alle so stolz über die Giebel hinausragen, und die Giebel sehen selber wie lauter Türme aus; es macht sich gar herrlich und hochgewaltig.«
»Nicht wahr? Siehst du die sechs da dicht nebeneinander? Das ist das Rathaus; ein schöneres und besonders ein größeres findest du in der ganzen Welt nicht.«
»Oho!«
»Nichts oho! Ich sage dir, du hast noch nirgend anderswo ein solches Rathaus gesehen. In seinem höchsten Turm ist ein schönes Glockenspiel, das alle Stunden eine feierliche Weise klingen läßt, den alten Wahlspruch der Stadt Lüneburg.«
»So? Wie heißt denn der?«
»Er ist lateinisch und lautet: Da pacem Domine in diebus nostris! das heißt auf deutsch: Gib Frieden, Herr, in unsern Tagen.«
»Ein guter Spruch!« sagte Timmo. »Mag er euch frommen!«
»Der Berg da hinten unmittelbar an der Stadt, mit dem Turme drauf, ist der Kalkberg. Da oben stand früher eine herzogliche Burg; aber die haben die Lüneburger dreizehnhundertzweiundsiebzig in einer Fehde mit Herzog Magnus erstürmt und gebrochen und nur den Turm stehen lassen.«
»Der Berg mit dem Turme nimmt sich gut aus als Hintergrund für die unter ihm liegende Stadt«, sprach Timmo; »und Lüneburg vom Berge aus gesehen muß ein krausbuntes, stattliches Bild geben.«
»Oh, prächtig!« rief Gilbrecht. »Von dort oben kannst du weit, weit in die Heide sehen. Ach, und wenn sie blüht, der Anblick! Ja, Lüneburg! Mein liebes Lüneburg!«
Es fing an zu dämmern, und die Wanderer eilten, um die Stadt noch vor Toresschluß zu erreichen; aber die Dämmerung war schneller als sie. Gilbrecht wußte den Weg zum Sülztore; dort kannte er den Torwart Kaspar Rulle, der würde, wenn der Meisterssohn seinen Namen nannte, nicht viel Umstände machen und die beiden Ankömmlinge mit ihren Bündeln willig einlassen, ohne daß sie erst das Handwerkszeichen aus einer Werkstatt zu holen brauchten.
Ungefähr hundert Schritte vor dem Tore machten sie halt, um sich gehörig instand zu setzen, daß jeder nach seines Handwerks Gebrauch und Gewohnheit in die Stadt einzöge. Sie reinigten ihre Kleider von den Spuren des Weges, dann nahm Gilbrecht das Felleisen vom Rücken, schnürte es auf, langte sein Schurzfell heraus und schnallte es so über das Felleisen, daß der Kreuzriemen nachher gerade über seinem Kopf zu sehen war. Timmo schlang den Tragriemen über die linke Schulter, so daß ihm sein Ranzen am linken Ellbogen hing. Den Stock führte jeder in der Rechten. So und nicht anders mußten sie in jede Stadt einziehen; das war ihnen eingeprägt worden, als sie vom Stande eines Jungen feierlich losgesprochen und zum Knecht und Gesellen gemacht waren, und kein ehrbarer Handwerksknecht im ganzen Reich wich jemals von diesen peinlich genauen Vorschriften im geringsten ab.
Als sie nun an den mächtigen Turm herankamen, hörten sie, wie die beiden großen Torflügel eben knarrend zugeschoben wurden und Riegel und Ketten dahinter rasselten und klirrten. Aber in dem einen Torflügel war noch ein besonderes kleines Pförtchen für Fußgänger; das erreichten sie gerade noch im letzten Augenblick vor seinem Schluß, und wie Gilbrecht als der erste hineinsprang und jubelnd rief: »Hurra! Ich bin drin in Lüneburg!« stand er dicht vor dem graubärtigen Torwart, der fast erschrocken zurückprallte wie vor einem räuberischen Überfall und zornig ausrief: »Holla! Sachte, Gesindel! Was soll das bedeuten? Was wollt Ihr? Wer seid Ihr?« Schnell griff er mit der einen Hand nach seiner Hornlaterne, die am Boden stand, und mit der anderen nach seinem kurzen Spieß, der daneben griffbereit an der Wand lehnte.
Gilbrecht lachte vergnügt, Timmo aber machte dem Alten seine Reverenz und sprach laut und lustig: »Timotheus Schneck, Schusterknecht aus Darmstadt, bringt Gruß und Glück der guten Stadt Lüneburg aus allen vier Winden!«
»Und ich«, sprach Gilbrecht, »bin Böttcherknecht und ein Lüneburger Kind.«
»Daß du ein Böttcher bist, seh' ich«, sagte der Torwart, ihm ins Gesicht leuchtend, »aber ein Lüneburger Kind? – Das kann jeder sagen.«
»Aber nicht beweisen, Kaspar Rulle! Ich bin Gilbrecht, der zweite Sohn des ehrsamen Böttchermeisters Gotthard Henneberg in der Roten-Hahn-Straße.«
»Was? Dem Sülfmeister sein Junge, der Gilbrecht bist du? Zeig mal her! – Ja, die Nasen ist's, und weil du mich kennst, will ich's glauben.«
»Ihr laßt uns doch ohne Handwerkszeichen ein, nicht wahr? Für den da sag' ich gut«, bat Gilbrecht.
»Gutsagen!« brummte der Alte. »Ich sage für keinen Menschen gut, geschweige denn für einen Schusterknecht.«
»Na, na«, machte Timmo. »Schusterknechte –«
»Haben das Maul zu halten! Sonst heißt es: Marsch, wieder 'raus!« schnauzte der Bärbeißige. Dann beleuchtete er auch Timmo mit der Laterne und musterte ihn mit strenger Amtsmiene, während er überlegte, ob er es wohl auf sich nehmen könne, einen fremden Wanderburschen ohne Handwerkszeichen in die Stadt einzulassen, denn er fühlte als Torwächter eine schwere Verantwortlichkeit, der er auch äußerlich eine möglichst achtunggebietende Würde schuldig zu sein glaubte.
»Aus Darmstadt?« fragte er noch einmal und pflanzte sich breitbeinig vor Timmo hin, den Spieß mit der ausgestreckten Rechten fest auf den Boden stoßend.
»Immer noch aus Darmstadt«, sagte Timmo.
»Und du willst hier in Lüneburg Arbeit nehmen?«
»Wenn Ihr nichts dagegen habt und ich erst einmal darin bin«, antwortete Timmo.
»Geduld, Schusterknecht aus Darmstadt! Wenn ich nicht will, kommst du nicht 'rein«, fuhr der Alte wieder auf ihn los und wandte sich dann zu Gilbrecht: »Ich will mal ein Auge zudrücken wegen des Handwerkszeichens, weil du ein Henneberg bist; ich wollte nur, du brächtest uns den Frieden binnen. Geht in Gottes Namen hinein mit Eurem Sack und Pack und tut Eure Pflicht und Schuldigkeit, sonst soll's Euch nicht gut gehen. – Vorwärts!«
Nun leuchtete er den beiden durch das dicke Torgewölbe bis zur Wachtstube an der Stadtseite, wünschte ihnen gute Herberge und ging hinein.
»Das fängt gut an«, sagte Timmo, »sind sie hier alle so höflich?«
»Kaspar Rulle ist der gutmütigste Mensch in ganz Lüneburg«, entgegnete Gilbrecht.
»Na, dann freu' ich mich auf die anderen«, lachte Timmo.
Im letzten Dämmerschein des Tages schritten die beiden Gesellen durch die nächste Gasse, und Timmo fragte: »Sage mal, ist denn dein Vater auch ein Sülfmeister?«
»Bewahre!« sagte Gilbrecht. »Der Alte hat sich versprochen, er wollte sagen Böttchermeister.«
»Er sagte aber Sülfmeister«, wiederholte Timmo.
»Dummes Zeug! Ich möchte nur wissen, was er mit dem Frieden meinte, den ich binnen bringen sollte.«
»Vielleicht in dem Briefe von dem Ratsherrn in Celle.«
»Meiner Treu! Daran hatt' ich nicht gedacht; aber wie Ruh und Frieden sah Herrn Albrechts von der Mölen Gesicht nicht aus, als er mir das Schreiben übergab.«
Sie gingen weiter durch die Schlägertwiete, aber an der nächsten Ecke sprach Gilbrecht: »So, dies ist die Grapengießerstraße, und die nächste ist die Altstadt, die gehst du hinab an zwei, drei Querstraßen vorbei, dann kommst du zur Herberge der Schusterknechte; das Herbergsschild hängt groß genug in die Straße hinein, kannst gar nicht fehlen, wenn du die Augen aufsperrst.«
»Ein Hesse bin ich zwar, aber kein blinder«, sagte Timmo, »will's also schon finden.«
»Nun denn viel Glück ins Feld!« sprach Gilbrecht, »und wenn du Arbeit gefunden hast und eingeehrt wirst, so komm' ich und trinke mit, und zu meiner Einfahrt kommst du auch.«
»Soll ein Wort sein!« sagte der Schuster und schritt in die Gasse hinein. Gilbrecht wandte sich rechts und eilte dem Vaterhause zu. –
›Ob der Alte nicht doch am Ende ein Sülfmeister ist, wie der Torwart herausplatzte‹, überlegte Timmo beim Weitergehen, ›der Junge hat auch schon so was Salzjunkermäßiges an sich. Wie er mir hier die Wege wies! Es klang ungefähr so, wie such, Pudel, such! Konnte doch mitgehen und mich hinbringen, aber Meistersöhnchen Muttersöhnchen. – Patsch dich! Hier hat's geregnet; hundert Türme haben sie, aber kein Dreckmeisteramt, das seine Schuldigkeit tut; aber es hat alles sein Gutes, desto mehr Schuhzeug brauchen sie hier. Timmo Schneck, halt die Ohren steif, Lüneburg ist ein sauberes Städtchen, hundert Türme und dreißigtausend Klafter Holz jährlich. Und wie hier die Luft schmeckt! Ich glaube salzig, ja wahrhaftig, ganz salzig, darum auch der Durst. Herbergsschild, wo hängst du?‹ Plötzlich blieb er an einer Straßenecke stehen: ›Da! Nun hab' ich die Querstraßen nicht gezählt und weiß nicht, ob dies die zweite oder die dritte ist; dunkel ist's auch und kein Hund auf der Gasse, den man fragen könnte.‹ Da öffnete sich eine Haustür, und ein heller Lichtschein fiel auf die Straße; in der Tür erschien ein Mann, auf den Timmo nun zuschritt mit der Frage, ob er hier nach der Altstadt käme.
»Schon wieder ein Schuster mehr in Lüneburg!« war die Antwort.
»Ein Korduaner, mit Verlaub!«
»Natürlich, das sagt ihr alle und bleibt das Buntleder so lange schuldig wie das Schwarzleder. Und was so ein Drahtklemmer für eine Nase haben muß, daß er sich immer, wo es nichts kostet, an einen Lohgerber wendet.«
»Ach so!« lachte Timmo. »Darum! Nun ein Wunder ist's just nicht, wenn der Schuhmacher den Lohgerber riecht. Aber diesmal war's Zufall oder Himmelsfügung, die ich mir zum guten Zeichen nehmen will.«
»Das tu nur, Korduaner! Hast wohl auch schon manchen Meister reich gemacht?« neckte der Lohgerber.
»Das will ich meinen!« rief Timmo. »Übrigens, Meister, Ihr wißt ja: Wenn der Schuster stirbt, kriegt der Gerber das Fell.«
»Da hat er was rechts!« lachte der Meister.
»Aber nun sagt mir doch, wo die Herberge ist«, mahnte Timmo etwas ungeduldig.
»Ja so! Richtig! Die Gasse hier ist die Altstadt und rechter Hand die Schusterschenke«, sagte der Gerber, »und wenn du kein Eimbecker bezahlen kannst, so trink Blaffertbier, ist gerade gut jetzt.«
»Vielen Dank, Meister! Wo Schuster und Fuhrleut' trinken, ist's Bier am besten.« Damit ging Timmo ab und dachte ›Lustige Leute, diese Lüneburger!‹
Bald klopfte er in der Herberge an die Stubentür, trat ein und sagte: »Schönen guten Abend, Frau Mutter! Ist der Herr Vater nicht da!«
Die er so begrüßte, war eine ältere, aber noch rührige Frau mit rundem rotem Kopf und gluhen Augen darin; ihr vorderes Kinn – sie hatte deren nämlich zwei – war etwas stoppelig. Von ihrem Haar war nichts zu sehen, denn sie hatte ein gelbes Tuch um den Kopf geschlungen, daß der Knoten gerade auf dem Scheitel saß und die zwei langen Zipfel wie ein paar Hörner steif zu beiden Seiten standen. »Der Herr Vater ist nicht zu sprechen«, sagte sie, »er hat sich zuschanden gemacht, hat einen Hexenschuß im Kreuz und liegt zu Bette; aber die Herbergsmutter hat auch noch keinem ehrlichen Schusterknecht ein Bein ausgerissen. Kannst fragen wen du willst in der Stadt, ob die alte Hombroksche nicht überall einen Stein im Brette hat.«
»So wollt' ich Euch ganz freundlich angesprochen haben, Frau Mutter«, sagte Timmo, indem er sich mit geschlossenen Hacken vor sie hinstellte, den Hut in der Hand und den Ranzen unter dem linken Arm, »von wegen des Handwerks, ob Ihr mich und mein Bündel heute wollet beherbergen, mich auf der Bank und mein Bündel unter der Bank; ich will mich halten nach Handwerks Gebrauch und Gewohnheit, wie es einem ehrlichen Schusterknecht zukommt, mit keuschem Mund und reiner Hand.«
»Sei willkommen wegen des Handwerks!« sagte die Alte. »Lege dein Bündel unter die Bank und deinen Filz auf dem Herrn Vater seinen Tisch; ich will den Altschaffer rufen lassen, daß er dich umschaut.«
Timmo tat, wie ihm geheißen war, und ruhte sich. Als aber der Altgesell kam, erhob er sich wieder, setzte den Hut auf, ging dem Eintretenden entgegen und legte seine linke Hand auf dessen rechte Schulter. Der Altgesell machte es ebenso und fing an:
»Hilf Gott, Fremder! – Schuster?«
»Stück davon«, antwortete Timmo.
»Wo streichst du her bei dem staubigen Wetter?«
»Immer aus dem Land, das nicht mein ist.«
»Kommst du geschritten oder geritten?«
»Ich komme geritten auf zwei Rappen aus eines guten Meisters Stall. Die Meisterin hat sie mir gesattelt, die Jungfer hat sie mir gezäumt, und beschlagen hab' ich sie mir selber.«
»Worauf bist du ausgesandt?«
»Auf ehrbare Beförderung, Zucht und Ehrbarkeit.«
»Was ist Zucht und Ehrbarkeit?«
»Handwerks Gebrauch und Gewohnheit.«
»Wann fängt selbige an?«
»Sobald ich meine Lehrjahre ehrlich und treu ausgestanden.«
»Wann endigt sich selbige?«
»Wenn mir der Tod das Herz abbricht.«
»Was trägst du unter deinem Hut?«
»Eine hochlöbliche Weisheit.«
»Was trägst du unter deiner Zunge?«
»Eine hochlöbliche Wahrheit.«
»Was frommt unserem Handwerk?«
»Alles, was Gott weiß und ein Schustergeselle.«
Nun nahmen sie beide den Hut ab, der Altschaffer reichte dem Fremden die Hand und sprach: »Sei willkommen wegen des Handwerks! Wie heißt du? Und was ist dein Begehr?«
»Ich heiße Timotheus Schneck, bin aus Darmstadt gebürtig und wollte dich gebeten haben, du wolltest mir Handwerksgewohnheit widerfahren lassen und mich umschauen, es steht heute oder morgen wieder zu verschulden, ist es nicht hier, so ist es anderswo.«
»Ich hab's mein Tag noch keinem ehrlichen Gesellen abgeschlagen«, sprach der Altschaffer, »will auch an dir nicht anfangen noch aufhören. Wie steht's mit der Kundschaft?«
»Geburtsbrief und Dankelbrief, alles in Ordnung.«
»Wo hast du deinen Lehrbraten verschenkt?«
»In der guten Stadt Darmstadt. Da habe ich gesehen eine Stube mit vier Winkeln, einen Tisch mit vier Ecken und darauf eine offene Lade. Ich habe auch gesehen hochlöblichen Willkomm und Schenkkännel mit Bier, daraus habe ich getrunken einmal oder vier, hätte ich mehr getrunken, so würde es mein Schade nicht gewesen sein.«
»Du hast vielleicht mehr vergessen, als ich gelernt habe; aber wir wollen die Meistertafel ansehen, welcher Meister darauf geschrieben steht.«
»Von mir wird er nicht viel lernen; das Land auf und nieder laufen, Kleider und Schuhe zerreißen, dem Herrn Vater Bier oder Wein austrinken, einmal viel, ein andermal wenig, je nachdem es der Beutel vermag.« Timmo sprach die althergebrachten bescheidenen Worte durchaus nicht in bescheidenem Ton und mit demütigem Gesicht, sondern sein Auftreten und seine Haltung ließen deutlich genug durchblicken, wie fest er von seiner eigenen Vortrefflichkeit überzeugt war.
Der Altgeselle beachtete das aber nicht; er schloß einen Schrein auf und brachte die Meistertafel.
»Es hat sich nur einer darauf einschreiben lassen, daß er einen Knecht braucht«, sagte er, »Daniel Spörken, ein ehrbarer Meister, aber es hält keiner lange bei ihm aus.«
»Warum nicht?« fragte Timmo.
»Mit der Meisterin ist schwer auszukommen, sie ist manchmal wie vom Satan besessen.«
»Wenn's weiter nichts ist«, lachte Timmo, »den treib' ich ihr aus.«
»Sieh dich vor, Bruder Darmstädter!« warnte der Altschaffer, »ich habe dir's gesagt; aber wenn du mit wohlbedachtem Mute, freiem Willen und guter Vernunft darauf bestehst, so will ich hingehen und dich bei ihm umschauen. Laß dir unterdes die Zeit nicht lang werden bei einer Kanne Bier, und wenn ich wiederkomme, so sei bedeckt mit dem Hut und nicht mit dem Tischblatt.«
»Ich bedanke mich freundlichst«, sagte Timmo.
Nun öffnete der Altschaffer die Tür und rief ins Nebengemach: »Frau Mutter, der Fremde hat das Handwerk bewiesen, nun wollen wir ihm auch Handwerksgerechtigkeit erweisen. Gebt ihm die Vorschenke, ich gehe ihn umschauen und komme bald wieder.« Er nahm aus Timmos Hand die Kundschaft, warf einen Blick in die Briefe und sprach dann: »Also mit Verlaub, der Filz ist mein, verzieh einen Streich.« Damit setzte er den Hut auf und ging.
Die Herbergsmutter stellte eine Kanne Bier und einen zinnernen Becher auf den Tisch, und Timmo fragte: »Eimbecker oder Blaffertbier?«
Die Alte sah ihn verwundert an und sagte: »Blaffertbier.«
»Aha!« machte Timmo, schenkte sich ein und trank. »Nicht übel, Mutter Hombroksche!«
Die Herbergsmutter sah ihn wieder mit einem Blicke an, der besagen mochte: ich wollte dir's auch nicht geraten haben, es anders zu finden; aber sie sagte bloß: »Wohl bekomm's!«
Timmo bedankte sich, und nun begannen sie einen kleinen Schnack, wobei sich Timmo nach allerlei Lüneburger Verhältnissen erkundigte. Er dachte: mußt doch mal auf den Busch klopfen von wegen des Böttchers, und sagte. »Hab' auch einen mitgebracht aus der Fremde, einen Lüneburger.«
»Einen Lüneburger? So? Wen denn?«
»Einen Böttcherknecht, Gilbrecht Henneberg mit Namen,«
»Den Sohn des Sülfmeisters?« fragte schnell die Alte.
Hast du nicht gesehen! kicherte Timmo in sich hinein, da ist er schon wieder, der Sülfmeister. »Jawohl, ganz recht!« sagte er laut. »Sind wohl haushäbige Leute?«
»Ei ja«, meinte Mutter Hombrok, »es rührt von der Frau her, die hat von ihrem Vater selig eine halbe Pfanne geerbt. Da mußte sich ihr Mann in der Sülfmeistergilde einschreiben lassen, aber sein Böttcherhandwerk treibt er nach wie vor mit redlichem Fleiße, obwohl sie's gar nicht nötig hätten. Weil er aber der einzige ist in der Gilde, der das tut und das in Lüneburg noch niemals vorgekommen ist, so heißt er in der ganzen Stadt kurzweg der Sülfmeister. Amtsmeister bei den Böttchern ist er auch.«
»Amtsmeister ist er auch?«
»Versteht sich, und was für einer! Der hält Zucht und Ordnung am Hause und im Amte, in der Werkstatt und bei der Morgensprache.«
»Hat er noch mehr Kinder?«
»Viere, drei Jungen und ein Mädchen, und die Ilsabe, seine Tochter, das ist ein Prachtmädel, mit der wird mal keiner betrogen«, sagte die Alte mit einem Nachdruck, als wäre sie dieses Prachtmädels leibliche Mutter, und schlug dabei mit ihrer Hand auf den Tisch, daß der Zinnbecher wackelte.
Timmo faßte rasch nach dem Becher, um den Trunk zu retten, und fragte: »Hat sie denn schon einen?«
»Weiß nicht«, sagte die Alte, »aber schön ist sie, und Geld hat sie auch, denn ich glaube, der Sülfmeister hat sein Mehl gemahlen und hat gewiß schon einen hübschen Batzen vergraben. Die Mutter, die Meisterin, ist eine vom Stande, und sie haben sie dem Meister erst nicht geben wollen, aber«, fuhr sie mit blinzelnden Augen fort und fuchtelte dabei mit der gespreizten Hand in der Luft herum, »wenn eine erst einmal so bis über die Ohren rechtschaffen in einen verliebt ist, da hilft dann nichts, das kenn' ich!«
»Ja, ja, Mutter Hombroksche!« lächelte pfiffig der Schuster, »traut's Euch zu! Auch mal jung gewesen! He?«
Sie lachten beide, und die Alte schmunzelte: »Na ja, freilich, Schusterchen! Warum denn nicht? Die Hombroksche konnte sich sehen lassen, sag' ich dir vor – ja, 's ist schon eine Weile her.«
So plauderten sie, bis der Altgeselle wiederkam und sprach:
Ich bin gegangen Nach deinem Verlangen, Nach meinem Vermögen, Soweit das Handwerk redlich gewesen.
Meister Spörken läßt dir auf vierzehn Tage Arbeit zusagen. Nimm mit einem armen Meister vorlieb, weil ein reicher nicht da ist. Ich wünsche viel Glück in die Werkstatt! Laß dir den Tisch nicht zu schmal, die Stube nicht zu eng und der Fenster nicht zu wenige sein.«
»Schönen Dank, Bruder Altschaffer! Was hast du denn dem Meister gesagt?«
»Ich habe gesagt: Meister, ich habe einen fremden Gesellen, er schläft gern lange, ißt gern früh Suppe, macht gern klein Tagewerk, nimmt gern groß Wochenlohn; ich wünsche viel Glück zum fleißigen Gesellen.«
»Das hast du gut gemacht«, lachte Timmo.
»Übrigens ist es hier Handwerksgebrauch«, fuhr der Altgeselle fort, »wenn ein Fremder umschauen läßt und erhält Arbeit, so bezahlt er zwei Kannen Bier; erhält er keine Arbeit, so bekommt er ebensoviel zum Tore hinaus.«
»Frau Mutter!« rief Timmo schnell, »zwei Kannen Eimbecker!«
Da saßen nun die beiden Schuhmachergesellen und tranken in Frieden das gute Bier. Der Altschaffer nannte nun auch seinen Namen, der Asmus Troffehn lautete, und sagte, daß er aus Hamburg gebürtig sei. ›Also nicht weit her‹, dachte Timmo, sagte es aber nicht. Sie erzählten sich mancherlei und beredeten miteinander, wie sie es mit der Einfahrt halten wollten, und der Altschaffer belehrte den Zugewanderten, wieviel Schilling er als Auflage, wieviel Harnischgeld und wieviel Wachs er zu den Kerzen auf dem Altar der Brüderschaft in der Sankt-Cyriaks-Kirche geben müßte. Auch ihre Erfahrungen von der Wanderschaft tauschten sie aus, und Timotheus Schneck wußte die lustigsten Geschichten und die abenteuerlichsten Dinge zu erzählen, daß der Altschaffer manchmal ungläubig den Kopf schüttelte. Aber Timmo kam nicht in Verlegenheit, sein Mundwerk ging wie ein Mühlrad, und die braunen Augen funkelten vor Vergnügen, wenn er wieder eine neue Schnurre vorbrachte, immer noch toller als die vorige. Denn er hatte schon an vielen Orten und für die vornehmsten Leute Stiefel und Schuhe genagelt und genäht, hatte schon einen Aufstand mitgemacht und mehr als eine Bönhasenjagd, er war sogar schon einmal mit auf grüne Heide gegangen und wußte wohl Bescheid mit solchen widerspenstigen Heimlichkeiten. Und zur Fastnacht war er überall der größte Lustigmacher und der keckste Spaßvogel und vollends bei den Mädchen, ach! Bei den Mädchen, da war er immer und überall Hahn im Korbe gewesen. »Wieviel gute Montage habt ihr denn hier?« fragte er mit einer herausfordernden Gönnermiene.
»In jedem Quartal einen«, sagte Asmus Troffehn.
»Mehr nicht?« rief Timmo und warf den Kopf hoch, »und das laßt ihr euch gefallen?«
»Es ist so von alters her«, erwiderte Asmus; »habt ihr denn mehr gehabt in Darmstadt oder in Frankfurt?«
»In Frankfurt machten wir jeden vierten Montag blau und waren damit noch nicht zufrieden, wollten jeden zweiten haben, kamen aber nicht durch damit, das heißt«, fügte er selbstbewußt hinzu, »wir wollten's nicht auf die Spitze treiben, weil wir im übrigen ein gutes Leben hatten, besonders das Getränk, das schmeckte.«
»So? Gutes Bier in Frankfurt?«
»Wein, Wein!« rief Timmo und schnalzte mit der Zunge, »ich sage dir, Bruder Hamburger, in Frankfurt ist mehr Wein in den Kellern, als in Lüneburg Wasser in den Brunnen. Habt ihr denn auch eine Weinglocke hier?«
»Wirst sie gleich hören«, sagte Asmus, »wenn wir sie auch hier nicht Weinglocke nennen. Um neun Uhr müssen die Trinkstuben leer werden, sommers um zehn.«
»I, das wäre ja noch schöner! Fällt mir nicht ein!« prahlte Timmo. »Höre, Bruder Hamburger, das muß anders werden, wenn ich in Lüneburg bleiben soll, und wenn ihr mir folgt, so will ich's euch schon zeigen, wie man sich Freiheit schafft.«
»Nur fein gemach, Bruder Darmstädter! Meister Spörken ist zwar ein Sanftmütiger, aber Bürgermeister und Rat halten strenges Regiment und fackeln nicht.«
»Ich merke schon, ihr scheint hier gut unter der Fuchtel zu stehen«, höhnte Timmo, »da tut es not, daß mal einer kommt, der ein wenig aufmuckt, und sollst mal sehen, Bruder, ich bin der Mann dazu!«
»Kannst ja mal mit deiner Frau Meisterin den Anfang machen«, lächelte der Altgesell, »aber nimm dich in acht, daß du nicht den kürzeren ziehst.«
»Ich den kürzeren ziehen?« rief Timmo. »Das wäre das erstemal in meinem Leben.«
»Weißt du«, sagte Asmus, »wie sie den Meister Daniel spottweis in der Stadt nennen: Daniel in der Löwengrube, und seine Frau ist die Löwin darin, eine rechte wilde Katze.«
Timmo lachte laut auf.
»Horch!« machte Asmus, »die Bürgerglocke! Nun muß ich fort.«
»Das ist doch nicht dein Ernst«, sagte Timmo, »wir trinken noch eine Kanne, ich bezahle sie.«
»Nein, nein«, sprach der Altschaffer fest, »du hältst mich nicht. Komm, stoß an mit dem Rest! Hilf Gott von Hamburg! Und noch einmal viel Glück in die Werkstatt!«
Sie stießen an, und Timmo bedankte sich.
»So!« sprach Asmus und erhob sich, »nun lege dich aufs Ohr, wirst wohl ungewiegt schlafen nach dem Marsch von Uelzen her. Morgen, Glocke sechs, komm' ich und bringe dich ein in – in die Löwengrube. Gute Nacht, Bruder Darmstädter!«
»Gute Nacht, Bruder Altschaffer!« brummte Timmo, ging dann auch hinaus und sagte zur Herbergsmutter:. »Frau Mutter, ich wollte Euch gebeten haben, daß Ihr mir hinaufleuchtet, wo dem Herrn Vater seine Betten stehen.«
»Komm, mein Söhnchen!« sagte die Alte und ging ihm die Treppen vorauf. »Hier!« sprach sie oben und öffnete die Kammertür, »schlupf unter, mein Häschen, und laß dir was Liebliches träumen von Bier oder von Wein oder von schönen Jungfräulein.«
»Vielen Dank, Frau Mutter! Aber das Eimbecker war doch besser als das Blaffertbier.«
»Hast 'ne feine Zunge«, lächelt die Alte. »Morgen früh wecke ich dich, denn Zeit und Stunde warten nicht auf uns«, sagte sie mit einem freundlichen Ernste.
»Grüßt den Herrn Vater von mir mit seinem Hexenschuß«, sprach Timmo.
»Will's ausrichten, mein Junggesell!« sagte die Mutter Hombroksche und stieg langsam die Treppe hinab, die in der nächtlichen Stille des Hauses leise stöhnte unter ihren Tritten und ächzte.
Zweites Kapitel
Ziemlich am nordöstlichen Ende der Stadt, in der Roten-Hahn-Straße, wohnte der Amtsmeister der Böttchergilde, Meister Gotthard Henneberg, in einem aus braunen Backsteinen erbauten Hause, dessen nach Osten schauender, in vier rechtwinkligen Abstufungen aufgeführter Giebel vorn an der Straße stand, wie dies bei allen Häusern Lüneburgs der Fall war. Jede dieser vier Abstufungen hatte die Höhe eines Geschosses, das von dem darüber- und darunterliegenden durch ein doppeltes Gesims getrennt war, und in dem sich auf Säulen ruhende Stichbogen für die Fenster und Luken befanden. Hinter dem davorgesetzten Giebel, auf dessen Spitze eine Wetterfahne stand, war das glatte, steile Dach, und nur so weit dieses reichte, waren noch Kammern und Bodenräume; die übrigen, kleineren und paarweis gekoppelten Fensterwölbungen der Giebelfront, also die höchsten und die äußersten zu beiden Seiten, waren verblendet, und dahinter war nichts als die freie Luft. Die Gesimse, die Bogengurte und die Säulen waren alle rund gemauert und in hervortretenden Wülsten so gedreht und gewunden, daß sie ganz dicken Schiffstauen glichen. Die Haustür, zu der ein paar Stufen emporführten und vor der sich ein Beischlag, das heißt ein zu beiden Seiten mit hochlehnigen Steinbänken umhegter Vorplatz befand, war spitz gewölbt und mit fünf solcher gedrehten steinernen Wülste eingefaßt, so daß sie einem kleinen Kirchenportal ähnelte.
Diese Bauart war in der ganzen Stadt gleich; nur daß die Häuser der vornehmen Geschlechter mit allerlei Zierat, mit menschlichen Figuren, Köpfen und Bildnissen, von gemauerten Schiffstaukränzen umrahmt, mit Tiergestalten, Blumen und Laubwerk, in Stein gehauen, reicher geschmückt waren und kunstvoll gemeißelte und bemalte Familienwappen zeigten. Dadurch, daß sie den Giebel mit seinen vier bis sechs treppenartigen Abstufungen alle vorn und alle den gleichen bräunlichen Farbton hatten, erhielt die Stadt ein ganz eigentümliches und doch keineswegs einförmiges Gepräge, weil die Giebel bald höher und spitzer, bald breiter und niedriger und auch in ihrer Ausschmückung voneinander verschieden waren.
Die Häuser hatten auch alle ihren besonderen Namen, den manche nur einem launigen Einfall ihrer Besitzer verdankten. In der Heiligen-Geist-Straße zum Beispiel hatten sich vier Nachbarn darüber geeinigt, die ihrigen Sonne, Mond und Stern zu nennen. Meister Gotthard Hennebergs Haus in der Roten-Hahn-Straße, in dem seit Menschengedenken das Böttcherhandwerk betrieben wurde, hieß das Goldene Ei, nach einem großen, steinernen, über der Haustür eingemauerten Ei, das früher einmal vergoldet gewesen war. Neben dem Ei über der Tür befand sich die Hausmarke, ein Kreuz, dessen Spitze in einem breiten Beil endigte, und dessen Querbalken an jedem Ende ein lateinisches H trug; vielleicht hatte der Erbauer Heinrich Henneberg geheißen. Diese Hausmarke wurde jedem Gefäß eingebrannt, das aus der Werkstatt im Goldenen Ei hervorging, und solcher Beilkreuze fuhren jährlich eine ganze Menge in die Welt.
In dem Hause herrschte Friede, Fleiß und Frömmigkeit, und der Segen blieb nicht aus. Wenn es nicht ein Verstoß gegen die strenge Handwerksordnung gewesen wäre, so hätte Meister Henneberg wohl mehr als zwei Knechte und einen Lehrjungen halten können, so viel hatte er zu tun, alle die Salztonnen, die Fässer und Bottiche fertig zu schaffen, die von ihm verlangt wurden. Der eine der beiden Gesellen war sein ältester Sohn, Arnold, der andere ein fremder, zugewanderter aus Soest, namens Jakob, und der Lehrjunge wieder sein jüngster Sohn, Lutke. Wer beim Meister Henneberg arbeitete, der lernte das Handwerk gründlich, aber viel freie Zeit gab es nicht, und die täglichen Arbeitsstunden, die genau vorgeschrieben waren, wurden streng eingehalten. In alledem Lärm, den die Böttcherei mit Hämmern und Klopfen, mit Stoßen und Schneiden hervorbrachte, waltete der stille Ordnungssinn und die liebevolle Fürsorge der Hausfrau, der die blühende Tochter fleißig zur Hand ging, so wohltuend und ersprießlich, daß es in der Wirtschaft an nichts fehlte, was gerechte und bescheidene Ansprüche der Hausgenossen fordern durften.
Als in der Dämmerung des Tages von Gilbrechts Heimkehr, die ja niemand voraussehen konnte, die Vesperglocke läutete, band der Meister sein Schurzfell ab und machte Feierabend. Seine Gehilfen folgten dem Beispiel. Jakob und Lutke brachten das Handwerkszeug an den gehörigen Ort und schufen in der Diele zwischen den angefangenen und fertigen Tonnen, den Schneidebänken, den Vorräten an Stab- und Bodenholz, den Reifen und Spänen, welche die Werkstatt in buntem Durcheinander füllten, einen freien Durchgang von der Haustür zu den drei Stufen, die rechter Hand in die Wohnstube führten, und weiter bis zu der schweren Wendeltreppe im Hintergrunde.
Die sehr geräumige Diele ging in ihrem größeren Teile durch zwei Stockwerke, und alles Holz, aus dem sie gezimmert war, die Wände mit ihren Pfosten und Riegeln, die Decke mit ihren dicken Trägern und Balken, und die Türen und Treppen hatten eine natürliche dunkelbraune Färbung. An der linken Seite lief in zwei Drittel Höhe über dem Fußboden eine mit der Treppe verbundene breite Galerie mit durchbrochenem Geländer; sie führte in ein paar abgeschlagene Kämmerchen, die in den oberen Raum der Diele hineingebaut waren und aus dieser ihr spärliches Licht durch kleine Fenster empfingen. Auf dem Balken unter dem Geländer stand der Böttcherspruch eingeschnitten:
Noch keine größere Kunst erfunden,
Als Holz mit Holz zusammengebunden.
Meister Gotthard schloß die Haustür, begab sich langsam, bedächtigen Schrittes in die Wohnstube, setzte sich dort in seinen großen hölzernen Lehnstuhl mit dem strohgeflochtenen Sitz und pfiff leise vor sich hin.
Frau und Tochter, die nähend bei der Lampe am Tische saßen, hörten dieses Pfeifen gern, denn sie wußten, daß es ein besonderes, stilles Vergnügtsein des Meisters bedeutete, und störten ihn darin auch nicht mit Fragen, denn sie wußten ferner, daß er dann selten Antwort gab. Als Ilsabe, sein drittes Kind, bei solcher Gelegenheit einmal gefragt hatte, warum er so lustig pfiffe, hatte er noch vergnügter, ja, halb verschmitzt gelächelt, hatte sie mit seinen ungeheuren Böttcherfäusten bei den kleinen roten Ohren gefaßt und auf das wenige Stirnhaar seines Lieblings einen Kuß gedrückt. Meister Gotthard war überhaupt, wenn auch kein schweigsamer, so doch auch kein sehr gesprächiger Mann, und sein oberster Grundsatz beim Reden war: das Wort soll Kraft und Macht haben oder nicht gesprochen werden.
Auch Arnold trat bald in das Zimmer, warf einen befremdlichen Blick auf den noch leeren Tisch und dann auf seine Schwester, die nun heiter sprach: »Mutter, Arnold meint, es wäre Essenszeit.«
»Ich?« sagte Arnold. »Ich habe gar nichts gesagt.«
»Solchen Hungerblick verstand man auch ohne Worte«, lachte Ilsabe, erhob sich, nahm der Mutter in zarter Weise das Nähzeug aus den Händen und legte es samt dem ihrigen wohlgeordnet beiseite. Dann begann sie den Tisch zu decken. Sechs Teller aus Birkenholz ohne Rand, neben jedem ein Messer und vor jedem ein schlichter, zinnerner Becher, das war das Tischgerät zum Abendessen. Nur vor des Vaters Platz am oberen Ende des Tisches stellte sie statt eines Bechers einen hohen Zinnkrug, auf dessen Deckel das wohlgeformte Bild eines Schützen stand und auf dessen Rundung des Meisters Name mit Tag und Jahr eingeritzt war. Den Krug hatte Meister Gotthard einmal beim Papagoyen-Schießen mit der Armbrust als Preis gewonnen. Auch ein anderes Messer bekam der Vater, ein größeres als die übrigen, mit einem kräftigen Griff daran aus Hirschhorn. Dann trug sie die einfache Kost auf und brachte zuletzt eine Schenkkanne voll Eimbecker Bier, füllte daraus des Vaters Krug und die Becher, und nun war alles zum Zulangen bereit. Sie rief Jakob und Lutke herein, die auf den ersten Ruf so schnell erschienen, als hätten sie schon dicht hinter der Stubentür gelauert. Der Meister rückte sich seinen Lehnstuhl an den Tisch heran und saß in seiner Kraft und Würde gleichsam thronend als König seiner Familie.
Ein ruhiges, verständiges Gespräch, auch heitere Scherze, freundlich gemeint und gut aufgenommen, hatte der Meister gern bei Tisch, hörte aber lieber zu, als daß er selber an der Unterhaltung einen hervorragenden Anteil nahm. Den Seinigen allgemeine Lebensregeln und weise Ermahnungen mit aufs Butterbrot zu geben, war ebensowenig seine Sache, wie er Klatschereien und Hecheleien über den liebsten Nächsten duldete, mochte dieser auch noch so weit von seinem Hause und von seinem Herzen wohnen. Nur schweigsam sollte es bei Tische nicht hergehen, als wenn Friede und Eintracht gestört wären. Ein fröhlich Gespräch nannte der Meister die beste Würze beim Mahle; das liebe Gut in grübelnden Gedanken oder in verhaltenem Groll zu sich zu nehmen, das, meinte er, bekäme nicht und schlüge nicht an. So floß auch am heutigen Abendtisch die Unterhaltung in ruhigem Gleise munter dahin, ohne daß etwas Wichtiges zur Sprache kam. Als aber das einfache Mahl beinah beendet war, erschallten drei harte, langsame Schläge gegen die Haustür. Alles schwieg und horchte.
»Da klopft ein Böttcher«, sprach der Meister; »Lutke, sieh nach!«
Lutke ging hinaus, konnte aber aus der Tür auf die dunkle Straße hinaus nichts erkennen als eine männliche Gestalt, die auf der Schwelle stand und flüsternd fragte: »Arnold, bist du es?«
»Ich heiße Lutke«, sagte der Junge nicht allzu freundlich.
»Lutke! Du? Junge, bist du gewachsen!« sprach der Fremde und trat ein. »Kennst du mich denn nicht? Auch nicht an der Stimme? Bin ja dein Bruder Gilbrecht.«
»Gil –!« Gilbrecht wollte Lutke rufen, kam aber nicht dazu, denn – »Pscht!« machte der Bruder und hielt ihm die Hand vor den Mund. »Schrei doch nicht! Wo sind sie?«
»Gerade bei Tisch«, flüsterte Lutke, »komm!«
Ahnte denn niemand da drinnen etwas von dem, was hier draußen vorging? Mutterherz, klopfst du nicht rascher? Schwester Ilsabe, fährt dir's nicht wie ein Blitz durch den Blondkopf: Das könnte am Ende...? Sie lauschen wie im Bann eines Ereignisses, das etwas Seltsames bringt und die Luft mit einer zitternden Spannung füllt, aber eine bestimmte Erwartung stieg keinem auf. Sie hörten nahende Schritte die Stufen empor, eine Hand tastete nach der Klinke, und jetzt – jetzt stand da in der Tür ein Wandergesell mit Sack und Pack, den Hut in der Hand, und sprach mit volltönender, leise bebender Stimme: »Glück herein! Gott ehr' ein ehrbar Handwerk! Guten Abend, Vater und Mutter!«
Starr, mit weit aufgerissenen Augen, mit stockendem Herzschlag saßen sie da, aber nur einen Augenblick, dann überströmte es sie alle auf einmal, dann umfaßte sie alle zugleich das plötzliche Bewußtsein eines kaum denkbaren Glückes, und – »Gilbrecht! Gilbrecht!« riefen und jauchzten sie, flogen von den Sitzen und stürzten auf ihn los, und Ilsabe hing zuerst an ihres lieben Bruders Halse.
Dann ging er reihum. Die Mutter ließ ihn lange nicht von sich, und als er zum Vater kam, drückten sich zwei wackere starke Hände, und zwei treue Augenpaare schauten eines in das andere. Der Meister sprach: »Frau, wenn ein Böttcherknecht gewandert kommt und bittet um Herberge, so soll es ihm nicht versaget, sondern nach Gewohnheit ein Lager, Essen und Trinken gegeben werden. Lege ab, Gilbrecht, und sei willkommen am Tisch!«
Sie rissen ihm fast das Gepäck vom Rücken, der eine das Felleisen, der andere den Ziegenfellbeutel. Ilsabe nahm den Hut und von dem Hute das Wacholdersträußchen und steckte es sich vorn an das Mieder. Das Schwert aber schnallte sich Gilbrecht selber ab und stellte es schnell in den Winkel, als sollte es der Vater nicht sehen. Der hatte es aber schon gesehen, doch er sagte nichts.
Nun wurde zusammengerückt; Gilbrecht mußte sich zwischen Vater und Mutter setzen, und Ilsabe, die verschwunden war, kam wieder mit einem prächtigen Schinken, den sie vor Gilbrecht auf den Tisch stellte. Arnold blickte in die Schenkkanne hinein und dann auf den Vater. Dieser nickte ihm zu und hielt die flache Hand zwei Fuß über den Tisch, was Arnold richtig deutete: so hoch einen Humpen! Lutke mußte wieder springen, und bald stand auf dem Tische ein voller Steinkrug, der sehr hochnäsig auf die Schenkkanne neben sich herabsah.
Gilbrecht hieb tapfer ein und hatte auf alle Fragen, mit denen er bestürmt wurde, nur ein Nicken oder Schütteln, ein gemütliches Brummen als Antwort, bis der Meister dazwischen fuhr: »So laßt ihn doch ruhig essen, und stört ihn nicht!«
Sie folgten dem Befehle wie immer, wenn der Meister sprach, und machten nun über das erfreuliche, kraftstrotzende Aussehen des zum Manne gewordenen Bruders halblaute Bemerkungen, die er natürlich alle hörte und belächelte. Seelenvergnügt saß er da mit rastlos arbeitenden Kinnladen, die rechte Faust mit dem Messer auf dem Tische haltend, die linke Hand am Kruge, schaute sich die Seinigen der Reihe nach an, und die lachenden blauen Augen glänzten in herzinniger Freude und unsäglichem Behagen. Er war ja wieder zu Hause, mitten im Kreise seiner Liebsten auf Erden, streckte die Füße unter seines Vaters Tisch, fühlte die Hand der Mutter hin und wieder auf seiner Schulter und wandte der Glücklichen dann sein strahlendes Antlitz zu mit einem Blick voll unendlicher Liebe und Dankbarkeit. Wie gut es ihm auch in der Fremde ergangen war, so war er doch nirgends gehegt und gehätschelt worden, hatte nirgends so sicher und breit im Schoße des Glücks gesessen wie hier auf diesem Stuhle zwischen Vater und Mutter.
Die Familie Henneberg war ein stämmiger Schlag Menschen, alle hochgewachsen, markig und von gesunder Farbe. Eine unverkennbare Ähnlichkeit war auf den Gesichtern aller ausgeprägt in der breiten Stirn, der etwas stark hervortretenden Nase und dem kräftigen Kinn; dazu hatten sie alle blondes Haar, in das sich beim Meister schon reichliches Grau mischte. Sein bartloses Gesicht war leicht gefurcht, aber die großen, klaren Augen unter den dichten Brauen fügten seinem etwas herben und derben, fest und rund in sich abgeschlossenen Wesen den Ausdruck von Geradheit und Herzensgüte hinzu, so daß die machtvolle Erscheinung des ernsten Mannes nichts Einschüchterndes, vielmehr etwas Vertrauenerweckendes hatte. Wie die Söhne dem Vater glichen, so war die Tochter das holde Ebenbild der Mutter, der man ihrem Aussehen nach die Mutterschaft über diese Enakskinder kaum glauben mochte. Lutke war ja noch jung und etwas schmächtig vom schnellen Wachsen, aber Ilsabe mit ihrer vollen und doch schlanken Gestalt in herrlich blühender Jugendkraft war solcher Brüder würdig. Gilbrechts Blicke ruhten auf ihr, als könne er sich nicht satt sehen an der Anmut und Schönheit, zu der sich die Schwester entwickelt hatte, seit er vor vier Jahren von der damals Sechzehnjährigen geschieden war. Ilsabe bemerkte die stumme Huldigung des Heimgekehrten wohl und freute sich im stillen, daß ihr das Bruderherz treu geblieben war, denn Gilbrecht, nur zwei Jahre älter als sie, war immer ihr Lieblingsbruder gewesen schon seit den Kinderspielen; sie hatte sein und er ihr vollstes Vertrauen besessen in allen großen und kleinen Angelegenheiten, von denen die jungen Gemüter berührt wurden. Hätten sich jetzt die beiden Geschwister in die Seele blicken können, so würde jedes dort des anderen Hoffnung und Vorsatz gelesen haben, das solle alles wieder so sein und nun erst redet und noch mehr, noch viel mehr als früher.
Aber auch der hungrigste Mensch wird endlich einmal satt, wenn er nur lange genug ißt, und Gilbrecht hatte dem, was auf seines Vaters Tische stand, alle Ehre angetan. Jetzt mußte er erzählen. Und er fing mit dem Anfang an. Wohin er zuerst gewandert und daß er – jetzt durfte er's ja wohl eingestehen, ob auch der Vater dabei lächelnd Frau Johanna drohte – mit den Mutterpfennigen, die ihm diese heimlich eingebunden hatte, doch noch weitergekommen war, als mit des Vaters wohlbemessenem Reisegeld. Dann, wo er zuerst Arbeit gefunden hatte, wie sie gewesen war, und so weiter und so weiter, die ganzen vier Jahre durch. Wie er als Meisterssohn nur drei Jahre zu lernen gebraucht hatte, so hätte er auch nur drei Jahre zu wandern gebraucht, aber als er an den Rhein gekommen war, da hatte es ihm dort so gut gefallen, daß er ein ganzes Jahr zugegeben hatte. Achtzehn Monate war er dort geblieben, erst in Elfeld, dann in den berühmten Delsanschen Kellereien zu Hochheim und zuletzt in der großen Weinhandlung des Herrn Christoffer Hoherath in Mainz. Diese großen rheinischen Geschäfte hielten sich ihre eigenen Faßbindereien unter besonderen, selbständigen Böttchermeistern, und da war Gilbrecht auch ein Dichtbinder geworden für Weinfässer mit eisernen Bändern und hatte dabei die Küferei gelernt mit allen Hantierungen und manchen Geheimnissen bei Behandlung der verschiedenen Weine. Endlich hatte es ihn aber doch heimwärts gezogen nach seinem lieben Lüneburg und zu Eltern und Geschwistern, und nun, schloß er, wolle er hierbleiben und das Handwerk treiben mit eisernen oder hölzernen Bändern, wie es gerade vorkomme und von ihm verlangt werde.
Das hörten sie alle gern; nur einer machte dabei ein trauriges Gesicht. Das war Jakob, denn er sagte sich: Nun wirst du wohl fort müssen aus dem guten Brot, denn mehr als zwei Gesellen darf ja der Meister nicht halten. Meister Gotthard sah seines Knechtes Betrübnis und sagte zu ihm: »Habe keine Sorge, Jakob! Außer der Zeit schicke ich dich nicht fort, und sollst auch gute Förderung von mir haben. Der Gilbrecht mag eine Weile ausruhen, wenn er nicht bei einem anderen Meister eintreten will.«
»Das tue ich nicht«, sprach Gilbrecht, »will mir die Zeit schon vertreiben, und wenn ich auch nicht dein dritter Knecht sein darf, so werde ich doch manchmal ein wenig mit zugreifen oder Arnold ablösen dürfen, wenn er sich mal einen guten Montag mehr machen will.«
Dieses Wortes freuten sich wieder alle, namentlich auch Ilsabe und zuallermeist Arnold, aus freilich ganz besonderen Gründen, die mit blauen Montagen nichts zu schaffen hatten.
Nun stand Gilbrecht auf, holte das Schwert aus der Ecke, bot es seinem Vater und sprach: »Hier, Vater! Das bringe ich dir mit, es soll eine gute Klinge sein, du verstehst dich ja besser darauf als ich.«
»Hm! Hm!« machte der Vater und beschaute die Waffe mit sichtlichem Wohlgefallen, zog blank, versuchte, wie ihm der Griff in der Hand lag, wog es und bog es und sagte dann: »Hast recht, eine gute Klinge! Ich danke dir, Gilbrecht!«
Etwas Willkommeneres hätte ihm der Sohn nicht mitbringen können, denn des Meisters einzige Liebhaberei waren Waffen jeglicher Art, in deren Gebrauch er für einen Handwerksmeister außerordentlich geübt war. Er besaß davon eine kleine Sammlung, die er nun mit Freuden um ein so schönes und wertvolles Stück bereichert sah.
Gilbrecht kramte in seinem Gepäck herum und brachte daraus allerlei hübsche Sachen zum Vorschein, wie sie in Lüneburg nicht oder wenigstens nicht so zu haben waren. Die verteilte er als Geschenke an die Seinigen und erregte damit bei allen herzliche Freude. Der Mutter überreichte er einen schönen Buchbeutel für den Kirchgang. Die gelbseidene Tasche, in die man das Gebetbuch steckte, war an einem Brettchen aus Eichenholz befestigt, das auf der einen Seite mit Pergament beklebt war. Auf dem Pergament war ein Gebet geschrieben und das Bild der Heiligen Jungfrau mit dem Kinde in bunte Seide gestickt, das Ganze bedeckt von einer dünnen, durchsichtigen Hornplatte. Ilsabe erhielt eine lederne Gürteltasche mit einer feinen Silberkette, und in der Tasche steckte etwas ganz Wunderbares, noch nie Gesehenes – ein Blatt Papier, das mit einigen Bibelsprüchen aus den Psalmen – nicht beschrieben, sondern bedruckt – ja, ja! – bedruckt war. Sie wollten's nicht glauben, mußten sich aber doch überzeugen, daß diese Buchstaben von keiner Menschenhand geschrieben waren. Das war das Neueste, was es in der Welt gab, und Gilbrecht erzählte nun von der höchst merkwürdigen Erfindung, die ein Mainzer Bürger namens Johann Gutenberg gemacht hatte. Schon vor Jahr und Tag war eine verworrene Kunde davon nach Lüneburg gedrungen, aber man hatte das für einen Schwank gehalten, von einem müßigen Mönch oder verlogenen Landfahrer ausgeheckt, darüber gelacht und es bald vergessen. Aber hier war nun der Beweis, und Ilsabe war nicht wenig stolz darauf, daß ihr Bruder Gilbrecht dieses Wunder mit nach Lüneburg brachte und sie die erste war, die ein greifbares Stück davon besaß und zeigen konnte.
Dem Bruder Arnold stülpte Gilbrecht eine Pelzkappe aus Otterfell auf und sagte dabei lachend: »Ein rechter Dickkopf bist du dein Lebtag gewesen, sieh zu, ob sie paßt.« Sie saß wie für ihn gemacht.
Als er zum Jüngsten kam, hielt er mit der linken Hand etwas hinter sich auf dem Rücken und kratzte sich mit der rechten am Ohr, indem er sprach: »Jung Lutke, mein Ziegenschurz, mit dir ist es mir absonderlich ergangen. Ich dachte nicht, daß du in den vier Jahren ein so stattlicher Reifenmörder werden würdest, sah dich immer noch als den zwölfjährigen Tintenklexer der Klosterschule vom Heiligen Tal und habe dir nun ein Ding mitgebracht, womit sich eigentlich ein Mann wie du nicht mehr abgibt; Tand nennen sie es im Reiche, bloß um die Nürnberger zu ärgern, die dergleichen machen. Da, nimm hin das Spielzeug!« Damit gab er ihm einen Hering, aus Holz geschnitzt und angemalt; den konnte man in zwei Teile auseinanderziehen, inwendig war er hohl und bildete eine Büchse für Federn. Lutke nahm den Holzfisch, hielt ihn am Schwanz hoch und rief: »Seht doch! Seht doch! So natürlich, als wäre er am Heringsstegel bei der Abtsmühle gekauft; danke, Bruder Gilbrecht! Ich nehme ihn doch!«
Bald saßen sie wieder alle um den Tisch herum, denn während der Unruhe des Schenkens und Beschenktwerdens war der fast geleerte, hohe Steinkrug plötzlich wieder voll geworden, aber wie, das wußte kein Mensch in der Welt außer einem einzigen, rosigen, blondzöpfigen Mädchen.
»Balduin Viskule ist auch wieder hier, hab' ich unterwegs erfahren«, begann Gilbrecht, zu seiner Schwester gewandt, »wie sieht er denn aus?«
Aber Ilsabe bückte sich unter den Tisch und hatte dort etwas zu suchen, so daß die Mutter für sie antwortete: »Schlank und rank ist er geworden, hübsch und ansehnlich; er bleibt nun auch hier in seines Herrn Vaters großem Handelswesen.«
Als Ilsabe wieder auftauchte, hielt sie das Wacholdersträußchen in der Hand, das ihr wohl von der Brust entfallen sein mußte, obwohl das niemand bemerkt hatte. Das Blut war ihr vom Bücken in den Kopf gestiegen, sie sah ganz rot aus. »Und ist die Hilke auch so schön geworden wie du, lieb Schwesterlein?« fragte Gilbrecht.
»Hübsch ist sie«, sprach Ilsabe, »sehr hübsch, aber Hilke hört sie sich nicht gern mehr nennen, sage nur Hildegund, wenn du sie siehst.«
»Ich denke morgen«, sagte Gilbrecht. »Ja so! Vater, ich habe noch etwas mitgebracht, einen Brief an den Herrn Bürgermeister Springintgut.«
»Wo denn her?« fragte Meister Gotthard.
»In Celle traf ich zufällig den Ratsherrn Herrn Albrecht von der Mölen –«
»Bürgermeister, zweiten Bürgermeister«, unterbrach ihn der Vater.
»Also den zweiten Herrn Bürgermeister«, fuhr Gilbrecht fort, »und der gab mir den Brief und machte dabei kein heiteres Gesicht.«
Der Meister nickte gedankenvoll und schwieg.
»Vater, was gibt es denn hier?« fragte der Sohn. »Der alte Torwart Kaspar Rulle sagte zu mir: ›Ich wollte, du brächtest uns den Frieden binnen.‹ Ist denn kein Friede mehr in Lüneburg?«
»So recht nicht«, sagte der Meister; »die Schulden der Stadt sind ins Unerschwingliche gewachsen schon von alters her durch die vielen Fehden und großen Bauten; jetzt betragen sie vier Tonnen Goldes. Da hat der Rat von den Sülzbegüterten die volle Hälfte ihrer Einkünfte als Ungeld gefordert, und das wollen sie nicht geben. Der Streit zieht sich schon ein paar Jahre hin, und der Bischof von Verden hat schon mehr als einmal einen Vergleich zustande zu bringen gesucht, aber vergeblich; der Rat gibt nicht nach und die Prälaten auch nicht. Die haben nun den Rat beim Kaiser verklagt, und seine Sache scheint nicht gut zu stehen. Herr Albrecht von der Mölen ist nach Wien zu Hofe gefahren und an das Reichsgericht.«
»Das hat er mir erzählt«, warf Gilbrecht ein. »Morgen früh will ich dem Herrn Bürgermeister den Brief übergeben.«
»Es sollte mich wenig freuen«, meinte der Vater, »wenn du bei deiner Heimkehr unserer Stadt eine schlimme Botschaft brächtest. Ich fürchte, wir gehen einem heißen Kampf entgegen«, schloß er nach einer kurzen Pause, während alle schwiegen, und blickte nach dem Schwert hin, das Gilbrecht ihm geschenkt hatte, und das an einem Schrank lehnte.
Gilbrecht folgte dem Blick seines Vaters und gewahrte jetzt erst den Schrank aus Nußbaumholz mit krauser Arbeit und reichem Schnitzwerk. »Das ist ja Großvaters Schrank!«, rief er überrascht aus.
»War es, Gilbrecht, war es«, sprach ernst Frau Johanna, »Großvaters Name steht im Buch der Toten, seit zwei Jahren schon, und der Schrank ist ein Erbstück von meinem lieben Vater, Gott hab' ihn selig!«
»Das hab' ich nicht gewußt«, sagte Gilbrecht; »der liebe Großvater! Er war immer so gut gegen mich. Woran ist er denn gestorben?«
»An einem Herzschlag«, sprach die Mutter traurig, »er hat einen raschen, sanften Tod gehabt.«
Ilsabe winkte dem Bruder mit den Augen zu, aber dieser fuhr fort: »Mit Verlaub, Vater, nun bist du Sülfmeister geworden, nicht wahr?«
»Wer hat dir das gesagt?« fragte der Vater.
»Kaspar Rulle am Sülztore. Als ich meinen Namen und mich deinen Sohn nannte, rief er: Aha! Vom Sülfmeister. Ich glaubte, er hätte sich nur versprochen, aber nun kann ich mir's erklären.«
»Es ging nicht anders«, sagte Meister Gotthard, »die Mutter erbte vom Großvater eine halbe Pfanne, und da ließen sie nicht nach, ich mußte in die Gilde.«
»Nun, das ist ja kein Unglück«, lächelte Gilbrecht, »aber ich freue mich, daß du das Handwerk darum nicht aufgegeben hast.«
»Arbeit ist das letzte, was ich entbehren möchte«, erwiderte der Meister.
Ilsabe wandte das Gespräch und sagte: »Also am Rhein, Gilbrecht, am Rhein hat dir's am besten gefallen?«
»Ja, Schwesterlein«, sprach Gilbrecht begeistert, »am Rhein! Da gilt das Wort: die Luft macht frei, das heißt die Luft am Rhein. Ich wollte, du könntest den herrlichen Strom einmal sehen mit seinen Bergen und Burgen und seinen lustigen Städten und Dörfern, da geht einem das Herz auf.«
»Ja«, sagte Meister Gotthard, »ich hab' ihn auch gesehen auf meiner Wanderschaft in jungen Jahren; er ist es wert, daß man ein paar Sohlen daran abläuft.«
»Ich habe auch auf seinen beiden Ufern zwischen Bingen und Mainz und zwischen Rüdesheim und Hochheim manchen Fußstapfen stehen«, sprach Gilbrecht und fing wieder an, von dem fröhlichen Leben am Rhein zu erzählen, daß sie ihm gern zuhörten.
»Ich wollte, ich wäre ein Mannsbild!« rief Ilsabe hingerissen von Gilbrechts lebendiger Schilderung, »dann ging' ich auch in die Fremde und wanderte singend bergauf und bergab. Es muß herrlich sein, sich die Welt besehen zu können.«
»Gewiß, liebe Schwester! Aber sage, was du willst, daheim ist es doch am schönsten«, lächelte Gilbrecht und erfaßte die Hand der Mutter, die ihm den zärtlichen Druck innig erwiderte.
Bald erinnerte Frau Johanna, daß es Schlafenszeit sei, sie wollte dem Wegemüden das Lager rüsten. Aber Arnold sagte. »Laß nur, Mutter! Dazu ist morgen Zeit. Gilbrecht schläft diese Nacht in meinem Bett, ich lege mir einen Strohsack auf den Fußboden.«
Des waren sie zufrieden. Man wünschte sich gute Nacht, und die vier jungen Leute gingen hinauf in ihre Kammern. Auch Ilsabe, die neben dem Gemach der Eltern schlief, begab sich zur Ruhe.
Als sie allein waren, legte Frau Johanna die Hände auf ihres Mannes Schultern, sah ihm in die Augen und sagte: »Er ist uns wiedergekommen so rein, wie er gegangen war; Gotthard, ich bin so glücklich!«
»Ich auch, Johanna, aber man muß das den Jungen nicht merken lassen«, sprach Gotthard. Dann gingen sie, und der Meister nahm das neue Schwert mit in die Kammer und stellte es für die Nacht neben sich.
Gilbrecht lag schnell in des Bruders Bett und streckte sich. Arnold sagte, während er sich sein Lager zurechtpackte: »Gilbrecht, keiner ist froher als ich, daß du wieder da bist. Nun werde ich ja wohl auch endlich zu meinem eigenen Feuer und Rauch kommen. Was meinst du dazu?«
»Ja!« brummelte Gilbrecht wie im Traume, und in der nächsten Minute schlief er den Schlaf des Gerechten.
Drittes Kapitel
»Vor drei Tagen hat dir Herr Albrecht von der Mölen den Brief gegeben?« fragte der worthabende erste Bürgermeister Herr Johann Springintgut den vor ihm stehenden jungen Böttcherknecht.
»Ja, hochedler Herr! Am Montag war es«, antwortete Gilbrecht.
Der Bürgermeister öffnete das Schreiben und begann zu lesen.
Es war in seinem Hause am Markte. Gilbrecht, dem kein Sitz angeboten wurde, ließ seine Augen in dem reich ausgestatteten Zimmer umherschweifen und dann auf der schlanken Gestalt des Bewohners ruhen, dessen strenge Züge sich beim Lesen zusehends verfinsterten. Er sprang, nachdem er zu Ende gelesen, vom Stuhle auf und maß das Zimmer mit hastigen Schritten unruhig und erregt, daß das Papier in seiner Hand bebte.
»Ich danke dir!« sagte er dann kurz. »Nein! Ich danke dir nicht für diesen Brief!« verbesserte er sich zornig.
Gilbrecht blickte ihn fest und ruhig an, und der Bürgermeister sagte etwas gelassener: »Was red' ich? Du kannst ja nichts dafür. Weiß dein Vater von diesem Schreiben?«
»Ja«, sprach Gilbrecht, »ich hab' es ihm gestern abend erzählt!«
»So! Hast's ihm schon erzählt. Weiß sonst noch jemand davon in Lüneburg?«
»Auch ein fremder Schusterknecht, mit dem ich von Celle hierher gewandert bin«, sagte Gilbrecht.
»Ein fremder Schusterknecht! Hm!« grollte der Bürgermeister. »Daß so junges Volk nicht den Mund halten kann und alles gleich ausplappern muß! Hat dir Herr Albrecht nicht Schweigen geboten?« fragte er herrisch.
»Nein, Herr Bürgermeister! Mit keinem Worte.«
Wahrscheinlich von den überlauten Reden angelockt, betrat jetzt die Frau Bürgermeisterin das Zimmer, warf einen erstaunten Blick auf den ihr Unbekannten und dann einen fragenden auf ihren Gatten.
»Ein Henneberg ist es«, sagte dieser, »ein Sohn des Sülfmeisters.«