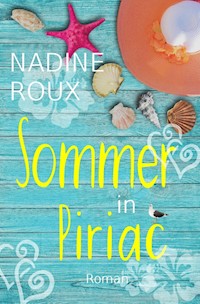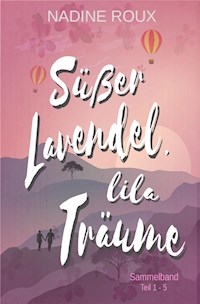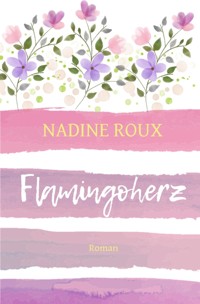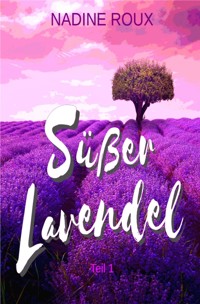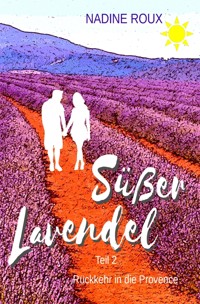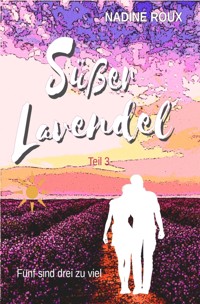2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein kleines Dorf in der Camargue und seine großen Dramen: Ein spektakulärer Fund hätte den Tellmuschelfischer reich machen können, aber er wurde sein größtes Verderben. Zwei Männer prügeln sich nach einem Stierkampf und zwischen ihnen steht ein Geheimnis, das alles verändern könnte. Nach der folgenreichen Jagd auf eine verbotene Delikatesse verstricken sich zwei Brüder in Schuld. Und dann schwebt noch seit zwanzig Jahren diese alte Geschichte über der Gemeinde: Wie kam der Ring des Tellmuschelfischers ins Meer und wer hat ihn heute?
Acht Geschichten, ein roter Faden. Ein Buch über Menschen im Mikrokosmos einer der markantesten Landschaften Frankreichs.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Der Tellmuschelfischer
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenDer Tellmuschelfischer
Nach dem Tod ihres Großvaters kehrt Louise in die Camargue zurück und sieht ihren Opa plötzlich mit anderen Augen. Damit hat auch Gaston Rossignol etwas zu tun.
-1-
Tellines in Öl. Tellines als Aquarell. Und schließlich kleine tellines als längst vergilbte Bleistiftzeichnungen, die mein Großvater wie selbstverständlich nie gerahmt, sondern mit Klebeband an der Wand befestigt hatte. Die Tellmuschel ist überall. Ich lasse meinen Blick im Raum umherwandern, den Kopf in beide Hände gestützt, als könne ich so besser nachdenken. In dem winzigen Wohnraum ist es dunkel und still. Hier hat alles begonnen und hier findet es nun ein Ende, wie ein Fluss, der sich durch das Land windet und dann doch im Meer verschwindet. Ein erloschenes Lebenslicht.
Vor mir auf dem Tisch liegt ein Briefumschlag, in den eilig das hineingesteckt worden war, was mir jetzt Kopfzerbrechen bereitet. Ich denke, ich möchte es nicht haben, aber ich habe es und ich werde es so leicht nicht los. Der violette Abend legt sich langsam über den Hafen von Le Grau-du-Roi, es wird wohl regnen.
Der Winter, das ist etwas, was ich mit dem Norden verbinde, mit Paris. Nicht enden wollender Regen, ein tiefer Himmel und die Kette von Fahrzeugen, die ihn zischend zu Staub fährt. Vom Tod meines Großvaters erfuhr ich durch den Notar, bei dem er sein Testament hinterlegt hatte. Das Papier glitt mir aus den zitternden Fingern. Mein Großvater, mein Papet war einsam und allein gestorben, ein Nachbar hatte ihn gefunden. Er schloss nie die Haustür ab, so als hatte er schon in jungen Jahren gewusst, dass er einmal auf diese Weise sterben und gefunden werden würde. Bei meinem Chef erbat ich drei Tage Urlaub, die er nur zähneknirschend genehmigte, da eine Kundin seines Cafés zuhörte.
Vom Gare de Lyon aus trug mich der Zug durch Frankreich, der Sonne entgegen, die nur gnadenloser wurde, je näher man der Küste kam. Licht kann wie Hohn erscheinen, wenn alles in einem drin trostlos und traurig ist. Ich wollte nur, dass der Zug mich irgendwohin brachte, egal wohin, mich trug wie der Herbstwind ein verlorenes Blatt. Ich lehnte meinen schweren Kopf an das Fenster und fühlte mich eins mit dem Himmel, hinter dem vielleicht nun mein Großvater wartete und hinabschaute.
Jemand griff mir an den Ellenbogen, vorsichtig aber spürbar.
„Pardon, Mademoiselle. Sie haben etwas verloren.“ Der Mann aus der Reihe gegenüber hielt mir meinen Schal hin und lächelte mich an. Seine schwarz gerahmte Brille bewegte sich dabei auf der Nase. Im Halbschlaf dachte ich, dass ich ihn vielleicht kannte und erinnerte mich an die Sommer im Süden, an uns spielende Kinder, ob er wohl eines von ihnen gewesen war. Doch ich konnte die Erinnerungslücke nicht füllen.
„Danke“, sagte ich schwach und dämmerte wieder weg.
Ich weiß, wie absurd es ist, beim Aussteigen aus der Bahn in Le Grau-du-Roi mitten im Winter eine Welle Hitze zu erwarten, die angereichert ist mit den Ausdünstungen der Landschaft. Salzmarsch. Betäubender Oleander. Meeresluft. Aber ich erwartete genau das und die Kälte schockierte mich. Der Himmel war leergefegt von einem Mistral, der durch meinen Mantel hindurchging und der trügerische Sonne mitbrachte, die Farben gestochen scharf malte.
Der Ort war beinahe menschenleer, kein Hinweis auf den Trubel des Juli. Nur ein paar Fischerboote bewegten sich im Hafen, einige Fischer flickten ihre Netze, beobachtet von den Möwen, deren Geschrei durch die leeren Gasse hallte.
Mir war früher nie aufgefallen, wie schäbig das kleine Häuschen meines Großvaters eigentlich war. In erster Reihe am Hafen, am rive gauche. Das war ihm immer wichtig, am rive gauche zu wohnen, ein Junge vom linken Ufer des Kanals zu sein. Dort, wo die richtigen Fischer wohnten und nicht die Touristen. Der Putz bröckelte und die Fenster waren beinahe blind. Als ich die Tür aufschloss, kam der Nachbar auf mich zu, die Hände knetend, die Schultern hochgezogen. Ich ahnte, was kommen würde.
„Mademoiselle, es tut mir leid wegen Ihrem Großvater. Mein Beileid. Er war ein feiner Kerl, wissen Sie.“ Als ich nur nickte und schwieg, redete er weiter, der Schnurrbart zuckte nervös, als sei er ein Körperteil. „Er war ganz friedlich, als ich ihn fand. Ganz friedlich. Ich kann Ihnen das Grab zeigen, wenn Sie möchten. Es ist sehr schön gemacht, sehr schön.“
„Vielleicht später. Ich möchte zuerst das Haus sehen.“
„Ja, natürlich, gehen Sie nur hinein.“
Er schlüpfte hinter mir durch die Tür, was mir nicht gefiel. Das Haus roch wie immer, wie damals in den langen Sommern meiner Kindheit, die ich hier verbracht hatte.
„Schauen Sie sich nur um, es ist alles noch so, wie er es hinterlassen hat. Wir haben nichts verändert, absolut nichts verändert. Sehen Sie, hier auf dem Sessel saß er, mit der Lesebrille noch in der Hand. Ganz friedlich, wirklich ganz friedlich.“
Abrupt drehte ich mich um. „Danke, Monsieur. Ich finde mich zurecht.“ Einen Moment stockte der Mann, aber er bewegte sich nicht. „Ich würde jetzt gerne alleine sein“, sagte ich schließlich. Ein Satz, den ich noch nie gebraucht hatte. Ich, die sowieso für gewöhnlich allein war. „Wenn ich Fragen habe, komme ich zu Ihnen herüber.“
Als die Tür im Schloss klickte, ließ ich mich am Küchentisch fallen. Es war ein so kleines Haus, das mir als Kind viel größer erschienen war. Ein einziger Raum im Erdgeschoss und zwei kleine Kammern, wenn man die schmale Treppe hinaufging. Durch ein Fenster fiel ein einzelner Sonnenstrahl auf eines der Bilder an der Wand. Tellmuschel, Aquarell. Früher hatte ich die Bilder gar nicht bemerkt, sie waren wie ein Stück Wand, etwas, das immer da gewesen war. Aber ich erinnerte mich an meinen Großvater, wie er manchmal an regnerischen Tagen an eben diesem Küchentisch saß und malte. Immer Tellmuscheln in den schönsten Farben und Formen, mit raffinierten Rillen, die wie echt erschienen. In dem schwachen Licht der Lampe konnte er schlecht sehen und hatte sich immer so sehr über das Blatt gebeugt, dass seine Nase es beinahe berührte. Ich hörte meine Kinderstimme: „Für wen malst du das?“
Dann nahm er die Brille ab und setzte mich auf seinen Schoß. Es gab nur uns beide, Großvater und mich. „Das ist für die Oma, wenn sie zurückkommt.“
„Wann kommt die Oma denn zurück? Ich möchte sie auch kennenlernen.“
Dann wurde sein Blick trübe und wanderte in die Ferne. „Irgendwann. Sie wird zurückkommen.“
Neben all den Muschelbildern gab es nur zwei andere, oben in seinem Schlafzimmer, das ich betrat wie ein Eindringling. Sein Boot als Bleistiftzeichnung, die Gabrielle. Der Name meiner Großmutter. Und die Skizze des Rings, der der Beginn des Unglücks gewesen war. Er hatte ihn nie richtig hinbekommen, immer wieder radierte er daran herum, übermalte die Farben schließlich mehrfach und fing letztlich auf der Rückseite des Papiers neu an. Die Konturen schienen noch durch, als sei es gestern gewesen.
Der Ring. Der Fund, der ihn hätte reich machen können. Jeder Fischer hofft, irgendwann einen Fisch zu fangen, in dessen Magen ein Schmuckstück verborgen ist oder jene eine Auster zu öffnen, die den Schatz einer kirschgroßen Perle festhält. Jeder kannte diese Geschichten, jeder hatte von jemandem gehört, der von einem anderen gehört hatte, dem das passiert sei. Die Perle der Tellmuschelfischer waren Ringe von Touristen, die sie im wilden Wasser am Strand von Espiguette verloren und nicht mehr wiedergefunden hatten. Oftmals blieben die Schmuckstücke jahrelang verschwunden und tauchten dann plötzlich wie durch eine Laune der Natur am Meeresboden auf. So wie der Ring meines Großvaters.
Ich sehe es vor mir, wie der kleine Mann mit dem geraden Rücken in seinem Neoprenanzug bis zur Brust durch das Wasser watete, den tellinier vor sich herschiebend wie einen Rasenmäher unter Wasser. Als Kind konnte mich das Bild herrlich amüsieren, ich stand am Strand und lachte unbemerkt, während Papet sich mit großem Ernst durch die Wellen kämpfte, stundenlang, und die münzgroßen Muscheln aus dem Meeresboden schürfte wie Gold in einem Sieb. Er arbeitete immer sehr gründlich und erklärte mir alle Arbeitsschritte. Ganz besonders wichtig war ihm, dass man die Ausbeute durch ein Sieb schüttelte, durch das die kleinen Muscheln wieder herausfielen.
„Das sind Babymuscheln, die müssen noch wachsen“, erklärte er mir dann, nicht ohne den anderen Fischern am morgendlichen Strand einen bösen Blick zuzuwerfen. Ich verstand erst einige Jahre später, was es mit denen auf sich hatte, als ich bemerkte, wie einsam mein Großvater war und wie oft er auf der Straße aggressiv angesprochen wurde.
„Hé, Papet! Hast Du wieder Babymuscheln ausgesetzt?“ Es folgte ein spöttisches Lachen und mein Großvater drückte meine Hand fester, ohne sich umzudrehen. Ich war entsetzt, dass jemand anderes außer ich ihn Papet nennen durfte. Ein Junge, kaum älter als ich, mit einer Zahnlücke und einer Brille auf der Nase, die in seinem Gesicht fremd wirkte.
„Hör nicht hin, Louise. Sie sind böse. Wir machen alles richtig mit den Muscheln, wir schon.“
Mein Großvater war ein stolzer Mann und es gehörte zu seiner Tellmuschelfischerehre, dass er niemals die kleinen Muscheln verkaufte. Während viele anderen Fischer mit ihren Geräten nur nah am Strand in der Brandung schürften, wo sich die jungen Muscheln im Sand versteckten, war mein Großvater der einzige, der weiter draußen mit den Wellen kämpfte - der Neoprenanzug mit dreißig Kilo Blei beschwert, damit seine Füße am Boden blieben - um nur jene zu ernten, die alt genug waren. Er verdiente weniger als die anderen und er stritt oft mit ihnen.
-2-
In der einsamen Dunkelheit des Abends nahm ich eines der Tellines-Bilder von der Wand und strich über die Farbe. Er hatte sie gut gemacht, die Bilder. Abbilder seiner Leidenschaft, seines Lebensinhaltes. Ich würde in diesem Haus schlafen müssen, um am folgenden Tag in aller Frühe den Notar aufsuchen zu können. Dabei wusste ich bereits, was in dem Testament stand, es gab keine andere Option, denn ich war seine einzige Familie. Das Haus gehörte mir. Das Boot gehörte mir. Die Enge meiner alten Kammer im Obergeschoss bedrückte mich und ich floh für einen Moment nach draußen, in die fischige Frische des nächtlichen Hafens. Die Möwen schliefen bereits, die Fahrzeuge schliefen, die Menschen schliefen. Ich musste sehr lange in der Küche gesessen haben. Wenn man in Gedanken ist, verrinnt die Zeit wie Sand zwischen den Fingern.
Der Mistral hatte sich gelegt, er heulte nicht mehr durch die Straßen, sondern säuselte wie jemand ein Schlaflied vor sich hin. Der blanke Stein des Kais fühlte sich kalt an, als ich mich daraufsetzte. Ganz ohne die mir bekannte Wärme des Sommers, die er speicherte und bis weit in die Nacht hinein abgab. Vor mir flackerten die Lichter im Wasser des Hafenbeckens, so wie immer, und ich fragte mich, ob das alles ist, was ewig ist. Flackernde Lichter im Hafen. Der Mistral. Die Möwen am Tag. Ich wünschte mir Ewigkeit nicht für solch banale Dinge, sondern für die großen, wichtigen. Für meine Familie. Ein Kloß im Hals verhinderte, dass mir ein Schluchzen entfuhr. Nun hatte ich niemanden mehr und es war meine Schuld. Ich hätte mich besser um alle kümmern sollen und nicht versuchen, in Paris Karriere zu machen. Allen hatte ich erzählt, dass ich in Paris an der Sorbonne studiere, aber das ist lange vorbei. Am Ende landete ich wie die meisten als Kellnerin in einem Café und hoffte, dass mir einmal ein Millionär begegnete, der mir den Traum von einem besseren Leben erfüllte, der Sterne an meinen grauen Pariser Himmel klebte.
Ich war bei meinem Vater aufgewachsen, die Sommermonate hier in Le Grau-du-Roi ausgenommen. Meine Mutter verschwand, als ich fünf war, etwa zur gleichen Zeit wie ihre Mutter, meine Großmutter. Gabrielle. Es hieß, dass sie auf einem Landgut im Corrèze arbeitete, meine Mutter. Das hatte mir mein Großvater erzählt. Er aß für sein Leben gerne Walnüsse und zusammen bastelten wir kleine Boote aus den Schalen. Er öffnete sie immer vorsichtig mit seinem Opinel und verschlang die Nuss samt Scheidewand.
„Die hat uns deine Mutter geschickt, sind die nicht köstlich?“ Er ließ dann immer noch eine Nuss in seinem Mund verschwinden und kleine Stückchen blieben in einem Bart hängen. „Sie schickt uns liebe Grüße und sagt, sie habe bald alles geschafft.“
„Warum muss sie denn dort arbeiten?“, fragte ich quengelnd, denn ich wollte meine Mama endlich zurückhaben.
„Bis sie genug Geld verdient hat, um euch ein schönes Haus zu kaufen.“
Ich wusste, welches Haus er meinte. Für mich war klar, dass wenn meine Mama zurückkam, wir Paris verlassen würden und zu Opa nach Le Grau zogen. Gegenüber am rechten Ufer des Kanals gab es ein wunderschönes Haus, das ganz weiß war und fein verzierte Balkone hatte. Wenn mein Großvater davon sprach, dass sie uns ein schönes Haus kaufen würde, war für mich eindeutig, dass er nur das meinen konnte. Auch wenn es am rive droite lag. Aber meine Mutter kam nicht zurück, sie kam nie mehr zurück. Mein Vater hatte es mir von Anfang an gesagt, aber ich dachte, er log, ich wollte, dass er log und nicht mein Großvater. Das war alles falsch, er hätte nicht derjenige sein sollen, der log. Aber er tat es und das verletzte mich. Erst heute, nach seinem Tod, denke ich, dass er es nur zu meinem Besten getan hat und dass er vielleicht sogar selber daran glaubte. Immerhin war meine Mutter seine Tochter und es war doch unwahrscheinlich, dass meine Großmutter und meine Mutter so kurz hintereinander einfach die Familie verlassen hatten.
Die Walnüsse kaufte er immer auf dem Markt, in einer weißen Plastiktüte. Ich hatte es gesehen.
An diesem Abend vor einigen Tagen saß ich also am Hafen und die flackernden Lichter verschwommen vor den Augen. Ich sah noch das Dokument aus der staubigen Schublade der Nachtkommode vor mir, das ich vorhin gefunden hatte. Die Scheidungsurkunde von Gabrielle und Gustave Moreau, erster Juli neunzehnhundertachtundneunzig. Es passte nicht in mein Weltbild, dass sich Großeltern scheiden lassen konnten. Eltern vielleicht, oder man selber. Aber nicht die Großeltern. Und alles hatte mit diesem Ring zu tun.
„So schnell sieht man sich wieder.“
Es dauerte, bis ich den Mann erkannte. Er war schließlich nicht der Einzige, der eine Brille mit einem schwarzen Rand trug.
„Darf ich?“ Er lächelte mich wieder an und setzte sich neben mich auf die kalten Steine des Kais, ehe ich antworten konnte. „Gut, dass Sie Ihren Schal wiederhaben, es ist doch recht kühl hier.“
Ich seufzte und verstand, dass ich ihn nicht so einfach loswerden würde und vielleicht wollte ich das auch nicht, an einem traurigen Abend wie diesem.
„Was treibt Sie an die Küste?“, fragte ich und hoffte, meine Stimme klang nicht allzu trist.
„Familienbesuch.“
Wie bei mir. Nur dass meine Familie ein paar hundert Meter von hier unter der Erde lag.
„Sie wohnen auch in Paris?“, fragte er mich und kannte die Antwort doch schon. Ich hatte das Bedürfnis, irgendjemandem von meinem Leid zu erzählen, wissend, wie sehr ich selber es hasste, wenn fremde Menschen mir im Café ihre Lebensgeschichte erzählten.
„Ja, ich arbeite dort. Ich bin für drei Tage in Le Grau, mein Großvater ist gestorben.“
Als meine Stimme wegbrach, herrschte für einen Moment Stille, eher der Fremde sagte: „Das tut mir leid. Ihr Großvater war ein guter Kerl. Streitsüchtig aber gut.“
Ich hörte nur die ersten beiden Sätze und fuhr herum.
„Sie kannten ihn?“ In der Dunkelheit versuchte ich sein Gesicht zu studieren, seine feinen Züge mit den Bildern meiner Kindheit abzugleichen. War er doch einer von ihnen?
„Das kann man wohl sagen.“ Sein Kiefer war ganz starr, als er das sagte und ich wollte nicht hören, welche Geschichte dahintersteckte.
„Ich muss das Haus verkaufen und sein Boot auch“, sagte ich schnell. Ein passenderer Themenwechsel gelang mir nicht. „Es gibt viel zu tun.“
Der Mann stand auf und ein Hauch seines Aftershaves wehte zu mir herüber. Es roch teuer. Ich war überrascht, als er sich noch einmal zu mir herunterhockte und mir ein Kärtchen in die Hand drückte, das ich im Dunkeln nicht lesen konnte.
„Ruf mich an, wenn du Hilfe brauchst, Louise.“ Er war schon halb über die Brücke verschwunden, als er noch einmal in die Nacht rief: „Es tut mir wirklich leid wegen deinem Großvater.“
Zurück im Haus warf ich die Karte auf den Küchentisch zu all den anderen Papierangelegenheiten und streifte seinen Namen mit den Augen: Gaston Rossignol, Immobilienmakler.
Die Erinnerungslücke schloss sich von selbst.
Der Junge, der sich herausgenommen hatte, meinen Großvater Papet zu nennen und dessen freches Gesicht eine Brille trug, die in ihm fremd wirkte. Der Junge, der selbst zu den Tellmuschelfischern gehörte, die dem Meer die Babymuscheln entrissen und teuer an die Touristenrestaurants verkauft hatten. Der Gaston Rossignol. Ich nahm die Karte vom Tisch und entsorgte sie.
-3-
Das Unglück war überraschend über meine Großeltern hereingebrochen, wie eine einzelne Mittelmeerwelle an einem schönen Sommertag, die einen Salzwasser schlucken und für den Bruchteil einer Sekunde eine Ahnung von Todesangst schmecken ließ. Es war in dem Jahr, bevor ich meinen Großvater erstmals den Sommer über besuchen kam, demnach bevor meine Mutter uns verlassen hatte. Ich kenne die Geschichte nur aus seiner Erzählung und ich weiß nicht, ob sie stimmt. Dabei habe ich ihm immer geglaubt. Bis ich glaubte, es besser zu wissen. Er hatte für meine Mutter gelogen und auch die Sache mit dem Ring könnte einer dieser Fischer-Fabeln sein. Wieso sollte ausgerechnet mein Großvater eines Tages derjenige sein, der tatsächlich seine Perle im Ozean fand und damit hätte reich werden können? Seine Schilderung ist mir immer noch lebendig in den Ohren. An langen Sommerabenden saßen wir oft draußen in dem kleinen Hinterhof, wenn es im Haus zu warm zum Schlafen war. Dann schnitt er mir ein Stück Wassermelone auf und ich aß sie ganz langsam, um den Moment des Zubettgehens noch weiter herauszögern zu können. Er saß dann neben mir auf der Bank und flickte manchmal Netze, in die er die Muscheln packte, wenn er sie verkaufte. Wenn er von dem Ring erzählte, glänzten seine Augen und ich weiß nicht, ob es vor Erregung oder vor Traurigkeit war, seine Stimme war immer unverändert.
Er habe die Muscheln sieben wollen, an diesem einen Januartag, der so kalt war wie kein Januartag je zuvor gewesen war und dann – ha! Dann schimmerte plötzlich etwas hell zwischen all den Muscheln und ha! Da dachte er doch tatsächlich, dass es nur eine weitere Glasscherbe war, Meeresglas, geschliffen von Salzwasser. Aber ha! Weit gefehlt, er hielt doch tatsächlich und ganz wirklich plötzlich einen Ring in seinen Händen, einen richtigen Klunker aus Gold und mit einem Diamanten, einem echten Diamanten, der größer war als jede Tellmuschel. An dieser Stelle schlug er sich an die Stirn, als konnte er es immer noch nicht glauben, all die Jahre später.
„Was hast du damit gemacht?“, musste ich ihn immer fragen, damit er weitererzählte. Es war unser Ritual.
Er ließ die Netze auf seine Knie sinken und sah mich an.
„Ich habe ihn deiner Großmutter gegeben.“ Es klang immer feierlich für meine Kinderohren. Heute weiß ich, dass er es mit Entsetzen gesagt hatte, denn das war der Beginn des Unglücks.
Meine Großmutter Gabrielle – ich stelle sie mir immer größer als mein Großvater vor, mit Rock und Schürze und adrettem, grauem Haarknoten, erfuhr am Tag danach, als sie ihren Freundinnen von dem Fund erzählte, dass im vergangenen Sommer in dem einzigen Schmuckgeschäft der Gegend eingebrochen worden war.
Mein Großvater erzählte es mir nur einmal, als ich alt genug dafür war, und überließ die restliche Geschichte meinem Gefühl, dem Gefühl einer Vierzehnjährigen.
Ich reimte mir alles zusammen.
Ich malte mir das Schlimmste aus.
Ich weinte in meinem Bett, ganz leise, um ihn nebenan nicht zu wecken. Ich musste doch an ihn glauben, er war doch kein schlechter Mann, es konnte nicht sein. Meine Großmutter hatte unrecht gehabt, sie muss sich getäuscht haben, sie hätte ihn einfach nur fragen müssen, statt das Ding ins Meer zu schleudern und ihre Koffer zu packen.
Ich hätte sie gerne kennengelernt und ich bilde mir noch heute ein, dass ich dann die Wahrheit wissen würde, dass ich mir sicher sein würde, dass er es nicht war.