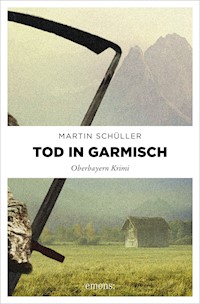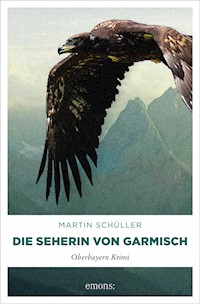Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Oberbayern Krimi
- Sprache: Deutsch
Eine offene Tür wird für Sebastian zur tödlichen Bedrohung. Denn hinter dieser Tür ist ein brutaler Mord geschehen, und der mitleidlose Täter wartet nur darauf, dass Sebastian in die Falle tappt. Sebastian wird zu Figur in einem diabolischen Spiel, dessen Regeln nur der Mörder kennt. Die einzige Chance seine Unschuld zu beweisen, ist, selbst den Täter zu stellen. Die Jagd nach dem "Teufel von Garmisch" entwickelt sich zu einem komplizierten Fall für Kommissar Schwemmer und sein Team. Denn der Mörder hat viele falsche Spuren gelegt. Kommissar Schwemmer hat auch im dritten Teil der Garmisch-Reihe von Martin Schüller nichts von seinen liebenswürdigen Eigenschaften eingebüßt. In Kombination mit einem bis zur letzten Seite spannenden Fall, einem teuflisch-schlauen Täter und einer Menge oberbayerischer Charaktere ein unschlagbares Leseerlebnis.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 463
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Martin Schüller, Jahrgang 1960, kam über die Musik zum Schreiben. Im Emons Verlag erschienen von ihm bisher sieben Kriminalromane, zuletzt »Tod in Garmisch« und »Die Seherin von Garmisch«. Neben Hörspielen und Romanen verfasste Schüller auch sechs Bücher der Emons-TATORT-Reihe.
www.schuellerschreibt.de
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.
© 2012 Hermann-Josef Emons Verlag Alle Rechte vorbehalten Umschlag: Fotomontage: fotolia.com/Bettina Eder und photocase.de/luxuz::. Umschlaggestaltung: Tobias Doetsch, Berlin eBook-Erstellung: CPI – Clausen & Bosse, LeckISBN 978-3-86358-153-4 Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de
Ich hab’ im Traum geweinet,
mir träumte, du lägest im Grab.
Heinrich Heine
Nichts ist wahrer als die Unvernunft der Liebe.
EINS
Man kann sich die Welt vorstellen. Man kann sie erleben. Man kann sie fühlen. Man kann sie fürchten. Und man kann sie formen. Erst dann kann man herrschen. Aber das fällt niemandem in den Schoß. Man muss es sich erkämpfen. Es empfiehlt sich eine gute Bewaffnung.
* * *
Sebastian zog seine Daunenjacke an und nahm den Autoschlüssel vom Haken. Der Fernseher dröhnte vom Wohnzimmer her durch die Diele. Sein Vater saß regungslos im Sessel, aber Sebastian gab sich nicht der Illusion hin, unbemerkt die Wohnung verlassen zu können.
»Möcht amol wissn, wo du scho wieder hinwuillst, mitten in der Nacht«, sagte sein Vater, ohne den Kopf zu bewegen.
»Fahr halt noch ein bisschen rum«, antwortete Sebastian.
»Wos?«, rief sein Vater.
»Nur noch kurz an die Luft«, sagte Sebastian und öffnete die Wohnungstür.
»Schmarrn!«, war das Einzige, was sein Vater dazu sagte.
Sebastian zog die Tür hinter sich zu und lief die Treppen hinunter. Im Kellergeschoss öffnete er die schwere Stahltür zur Tiefgarage.
Die Garage war der wenige Luxus, den das Haus an der Ludwigstraße bot, abgesehen davon, dass es zentral lag. So zentral, dass sein Vater bequem zu Fuß ins Wirtshaus gehen konnte. Wahrscheinlich hatte er die Wohnung nur deshalb gekauft, nach Mutters Tod.
Hinter ihm fiel die Garagentür ins Schloss, und er stieg in den R5, dessen dunkles Rot irgendwann einmal fast elegant gewirkt hatte, aber mit den Jahren recht schmuddelig geworden war. Er fuhr noch, das reichte Sebastian. Er machte sich nichts aus Autos. Er machte sich ohnehin aus wenig etwas.
Nur aus Sanne, aus Sanne machte er sich etwas.
Er polierte die Gläser seiner Brille mit einem Papiertaschentuch, bevor er den Motor anließ. Im Hals spürte er den Kloß, den er immer spürte, wenn er unterwegs zu Sanne war. Er räusperte sich, während er den Wagen aus der Garage steuerte.
Du bist dreißig, dachte er, und du benimmst dich wie ein bescheuerter Teenager. Wobei er sich eigentlich nicht mal als Teenager so bescheuert benommen hatte.
Aber er konnte es nicht ändern. Sanne war in sein Büro gekommen und hatte sich als neue Kollegin vorgestellt. Und da war etwas in ihren Augen gewesen, das er noch nie gesehen hatte. Ein Funkeln. Ein Funkeln, das er niemandem sonst gönnte. Das er nur für sich haben wollte.
Sebastian räusperte sich erneut, aber der Kloß verschwand nicht. Das Rolltor öffnete sich, er fuhr die Rampe hoch und bog auf die Ludwigstraße. Die Ampel an der Hauptstraße zeigte Rot. Der Parkplatz vor dem Irish Pub war gefüllt. Fast ein Dutzend Raucher stand vor der Tür unter den Heizpilzen. Ein nicht mehr ganz junges Paar ging Arm in Arm vor ihm über den Zebrastreifen. Der Mann drückte der Frau zärtlich einen Kuss aufs Haar. Sebastian versuchte, es zu ignorieren. Als die Ampel grün wurde, legte er den etwas widerspenstigen ersten Gang ein und fuhr geradeaus in Richtung Garmisch.
Trotz seiner dicken Jacke fror er. Sein Gehirn schien aus zwei Teilen zu bestehen, die nichts miteinander zu tun hatten. Die eine Hälfte ließ ihn funktionieren, seine Arbeit machen, auf seinen Vater aufpassen, wie er es seiner Mutter versprochen hatte.
»Du lässt ihn nicht allein, versprichst mir das, Bastl?«, hatte sie ihn jedes Mal angefleht, wenn er sie in der Klinik besucht hatte. Dabei kannte sie doch die Wahrheit: dass er und sein Vater noch nie irgendeinen Draht zueinander gehabt hatten, nicht mal in seiner Kindheit. Und seit er sein Studium abgebrochen hatte, schon überhaupt nicht mehr.
Dann war Mutter gestorben, zerfressen vom Krebs.
Und jetzt war es, wie es war. Er hatte sein Versprechen nicht gebrochen, auch wenn es ihm jeden einzelnen Tag schwerfiel. Er trauerte dem schäbigen Hof in Gerold nicht nach, aber es war arg anstrengend, eine so enge Wohnung mit dem alten Mann zu teilen.
In dieser Hälfte seines Gehirns war auch abgespeichert, was geschehen war, als er Sanne zum Essen eingeladen hatte.
Sie hatten im »La Vie« gesessen, und er hatte den ganzen Abend über in das Funkeln gestarrt. Gut unterhalten hatten sie sich. Er hatte ihr von sich erzählt, was es zu erzählen gab, sogar warum ihn im Büro alle »Milli« nannten.
Sie hatte nicht gelacht.
Und am Ende, vor ihrer Haustür, in seinem Wagen, hatte er sie geküsst.
Das heißt, er hatte es versucht. Denn sie hatte ihm eine gescheuert, dass ihm die Brille von der Nase geflogen war.
Er hatte sie angerufen, noch in derselben Nacht, hatte versucht, sich zu entschuldigen, um eine zweite Chance gebeten, nein, nicht gebeten – gefleht. Bei den ersten Malen hatte sie ihm höflich erklärt, dass er ein netter Kollege sei, sie aber außer freundschaftlichen Gefühlen rein gar nichts für ihn empfinde. Aber schon bei seinem dritten Anruf war ihr Ton entschlossener gewesen und schließlich scharf geworden. Am Ende hatte sie sich verbeten, weiter von ihm belästigt zu werden.
Sie hatte den Abend nie wieder erwähnt. Im Büro ging sie ihm aus dem Weg. Sie grüßte kühl. Wenn sie – was selten vorkam – zusammen an einem Projekt arbeiten mussten, blieb sie professionell distanziert. Wie er auch.
All das war in der einen Hälfte seines Hirns gespeichert.
Die andere Hälfte war ausgefüllt von dem Funkeln ihrer Augen.
Und diese Hälfte war es auch, die ihn seit Wochen immer wieder dazu brachte, durch die Nacht zu ihrem Haus zu fahren.
Wenn dort Licht brannte, parkte er in der Nähe, nicht direkt davor, aber in Sichtweite. Dann verbrachte er die Zeit mit nichts anderem, als zu ihren Fenstern hochzustarren, bis das Licht dahinter erlosch.
Manchmal sah er ihre Silhouette hinter den Gardinen. Dann durchfuhr ihn ein Strahl, der gleichzeitig heiß und kalt war. Das waren die Momente, deretwegen er hier war. Die Sekunden, in denen sie ihm gehörte.
Er unterquerte die Gleise am Bahnhof und fuhr weiter in Richtung Grainau, um die großen Gebäude des US-Resorts herum und aus dem Ort hinaus. Er passierte das Einkaufszentrum gegenüber dem Campingplatz, wo auch GAP-Data lag, die Firma, in der Sanne und er arbeiteten. Dahinter bog er links ab nach Untergrainau. Dort, am Zigeunerweg, wohnte sie. Wie die meisten Häuser hier lag auch ihres ein wenig von der Straße und den Nachbarn entfernt.
Auf der Straße parkte kein Wagen. Wer hier jemanden besuchte, stellte sein Auto auf dem Grundstück ab. Ihr Citroën stand immer hinter dem Haus.
Er hoffte, dass er auch heute dort stand, denn er wusste, dass sie die nächsten drei Tage Urlaub genommen hatte vor der Messe in Köln.
Mit einem Blick in den Rückspiegel versicherte er sich, dass er allein auf der Straße war, bevor er den R5 ausrollen ließ und rückwärts in den Waldweg gegenüber ihrem Haus rangierte. Er schaltete den Motor aus. Zwischen den Büschen war er vor den Blicken von der Straße her einigermaßen verborgen. Ein- oder zweimal war ein später Jogger vorbeigekommen, der ihn bemerkt hatte. Und einmal hatte eine alte Nachbarin aus ihrem Dachfenster auf ihn heruntergeschaut.
Von hier aus war nur der erste Stock von Sannes Haus zu sehen, und dort, hinter den Gardinen des großen Fensters, brannte Licht.
Sie war zu Hause.
Sebastian schlug den Kragen seiner wattierten Jacke hoch und schloss den obersten Knopf. So gut es ging, ignorierte er die Kälte, die in ihm hochkroch.
Nach ein paar Minuten meinte er, eine Bewegung an den Gardinen zu sehen, aber er war sich nicht sicher.
Sein Atem hinterließ milchige Streifen auf der Seitenscheibe, die im Licht des zunehmenden Mondes weiß leuchteten. Er kurbelte die Scheibe einen Spalt weit auf. Kalte Luft strömte herein.
Es war still. Lange geschah nichts. Ein Auto näherte sich von der Bundesstraße her. Es fuhr vorbei, und bald umfing ihn wieder die Stille der Nacht. Erneut eine Bewegung an den Gardinen, dieses Mal bewegten sie sich ganz zweifellos.
Er stellte sich vor, wie sie durch ihr Wohnzimmer ging. Was mochte sie anhaben? Am liebsten sah er sie in einem Kimono vor sich, einem nachtblauen, obwohl er natürlich nicht die geringste Ahnung hatte, ob sie einen solchen besaß. Aber ein nachtblauer Kimono schien ihm das Passendste, um ihren schlanken Körper zu umhüllen. Ihre Haare würden sanft über die Schultern fallen, und das goldene Blond würde einen herrlichen Kontrast zu der knisternden dunklen Seide bilden.
Er quälte sich ein verzerrtes Lächeln ab, während er versuchte, die Tränen zu unterdrücken. Er fühlte sich krank und lächerlich. Lächerlich krank und krank vor Lächerlichkeit. Es war ein schwacher Trost, dass niemand wusste, was er hier tat. Er öffnete die Tür und stieg aus. Keine Bewegung hinter den Gardinen, kein Geräusch.
Leise schloss er die Fahrertür und überquerte langsam die Straße, hin zu dem kleinen Tor im Gartenzaun.
Das hatte er noch nie gewagt. So nahe war er dem Haus noch nie gewesen seit der Abfuhr, die sie ihm erteilt hatte.
Er stand da und starrte in den mondbeschienenen Vorgarten. Plötzlich war da ein Geräusch. Ein leiser, aber scharfer Schlag. Dann wieder Stille. Es war aus dem Haus gekommen.
Er machte einen weiteren Schritt auf das Haus zu und kniff die Augen zusammen. Konnte es sein, dass die Haustür offen stand?
Wieder näherte sich ein Auto, diesmal aus Richtung Grainau. Bevor die Scheinwerfer ihn erreichen konnten, trat er durch das Törchen in den Schatten einer Tanne im Vorgarten.
Der Wagen fuhr vorbei, ohne seine Geschwindigkeit zu verringern. Sebastian ging weiter auf das Haus zu. Nach ein paar Metern gab es keinen Zweifel mehr: Die Tür stand einen Spaltbreit offen.
Er sah zum Fenster hoch. Die Gardinen hingen reglos. Er hatte keine Ahnung, was er tun sollte. Die beiden Hälften seines Gehirns rangen miteinander. Die eine wollte ihn von hier fortlotsen, zurück in den Wagen, zurück nach Hause, ins Warme, ins Bett oder auch nur neben seinen Vater vor den Fernseher.
Die andere Hälfte hielt ihn fest.
Dort war die Tür. Ihre Tür. Sie stand offen. Musste er sich nicht kümmern? Was war das für ein Geräusch gewesen? War es nicht seine Aufgabe, sicherzustellen, dass Sanne nichts zustieß? Jedermann konnte hinein in ihr Haus, solange die Tür offen stand.
Genau, sagte die andere Hirnhälfte. Geh hin, zieh die Tür zu, fahr heim.
Er näherte sich der Tür. Seine Rechte umfasste den Griff. Ein paar Sekunden zögerte er, dann drückte er die Tür auf und betrat das Haus.
* * *
Balthasar Schwemmer zog die Flasche mit dem badischen Weißburgunder aus dem Kühler und kontrollierte die Füllhöhe. Sie erschien ihm unbefriedigend. Er teilte den Rest sorgfältig zwischen Burgls und seinem Glas auf, dann warf er einen Blick auf seine Armbanduhr.
»Ist elf durch«, sagte er bedauernd.
»Noch eine bestellen wir jedenfalls nicht«, sagte Burgl lächelnd.
Er sah sich um. Sie waren die letzten Gäste im »Husar«. Der Abend war, wie eigentlich immer hier, sehr erfreulich verlaufen. Sie hatten sich vorweg einen Prosecco mit Holundersirup gegönnt und zur Eröffnung ein Hirschcarpaccio mit Preiselbeeren. Sie hatten es geschafft, nur wenig über seine Arbeit zu reden. Im Moment gab es ohnehin nicht viel zu erzählen. Die Tatsache, dass er nicht mehr Leiter der Garmischer Dienststelle war, weil man sie aufgewertet und ihm einen Polizeidirektor vor die Nase gesetzt hatte, war als Thema zwischen ihnen durch. Burgl hatte aufmerksam auf jede Andeutung von Ärger geachtet, und es hatte einige Zeit gedauert, bis er sie davon überzeugt hatte, dass es ihn überhaupt nicht ärgerte, den Organisationskram nach oben abzugeben, solange er ungestört weiter seine Kriminalabteilung leiten konnte. Schließlich hatte man ihn nicht degradiert. Ärgern tat ihn nur, dass er sich Frau Fuchs’ Dienste nun mit dem neuen Chef teilen musste, was mitunter zu Wartezeiten bei der Kaffeeversorgung führte.
Er hatte sich für das Böfflamott mit Karotten und Spätzle als Hauptgang entschieden, Burgl für in Butter gebratene Atlantik-Seezunge mit Blattspinat. Den Rest des Abends hatten sie mit Urlaubsplanungen und -erinnerungen verbracht.
Auf die Crème brûlée hatte er schweren Herzens verzichtet, als er Burgls Blick auf seine leicht spannenden Hemdsknöpfe in Tischkantenhöhe bemerkt hatte – was sie aber keineswegs davon abgehalten hatte, sich eine Calvados-Crêpe mit Bourbonvanilleeis zu bestellen.
Es war ein Abend gewesen, wie man ihn sich für einen dreiunddreißigsten Hochzeitstag wünschen konnte.
»Noch was hinterher?«, fragte er lächelnd, und Burgl lächelte zurück.
Er bat noch einmal um die Getränkekarte, und sie studierten die aufgelisteten Spirituosen.
»Deutscher Maltwhisky?«, fragte Burgl. »So was gibt’s?«
Schwemmer wiegte den Kopf. »Ich hab mal einen probiert, der war so lala.«
»Oh, dieser ist aber ganz was Besonderes«, sagte die Bedienung freundlich. »Von einem alteingesessenen fränkischen Obstbrenner. In Zwetschgenbrandfässern gelagert. Davon sind überhaupt nur tausend Flaschen gebrannt worden.«
Schwemmer fuhr leicht zusammen, als er den Preis las, aber Burgls begeisterter Blick ließ ihn zwei bestellen.
»Übrigens hab ich neulich Ferdi Schurig im Ort getroffen«, sagte Burgl, als die Bedienung den Malt servierte.
Schwemmer runzelte leicht ärgerlich die Stirn und griff nach seinem Glas. Er hatte kein Interesse daran, sich von der Erinnerung an Ferdinand Schurig – den flotten Ferdi, wie man ihn damals nannte – den wunderschönen Abend verderben zu lassen. Ohne zu antworten, schwenkte er das Glas unter der Nase und atmete den phantastisch fruchtigen Duft des Whiskys ein.
»Er ist wieder da«, sagte Burgl leichthin. »Er wohnt jetzt in Partenkirchen und hat eine Praxis in Hechendorf aufgemacht.«
»Hechendorf.« Schwemmers Blick wurde misstrauisch. Er starrte Burgl an, die genussvoll den ersten Schluck Whisky im Mund hin- und herrollte.
»Ferdi …«
»Ja. Der, mit dem ich studiert hab.«
Schwemmer merkte, wie seine Hände kalt wurden.
Der flotte Ferdi. Der Mann – ach was, das Arschloch, an dem fast ihre Verlobung gescheitert war. Den es leider nur nach Würzburg und nicht, wie Schwemmer gehofft hatte, nach Timbuktu verschlagen hatte. Der mit seinem sportlichen Körper, der blond-blöden Lockenmähne und dem amerikanisch breiten Unterkiefer jede Kommilitonin ins Bett bekommen hatte, die er wollte.
Und Burgl hatte er gewollt.
Und nun war dieser Ferdi »wieder da«.
»Hast du vor …«, fing er an, dann wusste er nicht weiter.
»Was denn?« Eine kleine, besorgte Falte stand auf Burgls Stirn und machte sie noch schöner. »Wir haben einen Kaffee getrunken und geredet. Er ist geschieden … Probier den Whisky, er ist toll.«
Schwemmer nickte und nahm einen eiligen Schluck. Er versuchte, sich auf den Geschmack zu konzentrieren, aber es gelang ihm nicht.
»Du, der hat übrigens einen Drohbrief gekriegt.«
»Drohbrief? Von mir nicht.«
Burgl lachte kopfschüttelnd. »Hausl, also wirklich … Wahrscheinlich von diesem Spinner, diesem einsamen Rächer, der in Partenkirchen umgeht.«
»Aha …« Der Rächer. Das war eines der wenigen ungelösten Probleme der Kripo Garmisch. Ein Wutbürger, der seine Mitmenschen mit perfiden kleinen Racheakten terrorisierte, wenn sie falsch parkten oder sich sonst wie nicht an die Regeln hielten, die der Rächer für wichtig erachtete.
»Ja, sein Hund ist ihm aus dem Garten ausgebüxt, und es hat den halben Tag gebraucht, bis er ihn wiedergefunden hat. Und vor ein paar Tagen lag ein anonymer Brief im Kastl. Wenn der Hund noch einmal allein unterwegs sei, dann wär er fällig.«
»Soll den Brief auf die Wache bringen«, sagte Schwemmer und ärgerte sich sofort. Jetzt forderte er sie auch noch selbst auf, mit Ferdi zu reden.
Ferdi Schurig, dachte er. Ausgerechnet.
* * *
»Hallo?«, rief Sebastian in die dunkle Diele hinein. Er erhielt keine Antwort. Mit zitternden Fingern tastete er nach dem Lichtschalter. Als er ihn fand, wurde er geblendet vom Licht einer vielstrahligen Halogenschiene an der Decke.
Seine Brille beschlug leicht in der warmen Luft der Diele. Hastig nahm er sie ab und wischte die Gläser trocken.
Es war nichts Besonderes zu sehen. Ein Schuhschrank mit sehr vielen Klappen; eine Garderobe, daran drei oder vier sportliche Blazer und die elegante Steppjacke mit Pelzkragen, in der er Sanne schon einmal im Büro gesehen hatte. Hinter der Garderobe eine offene Tür zur dunklen Küche.
Er warf noch einen Blick auf die mondbeschienene Straße hinaus. Kein Mensch war zu sehen. Zögernd betrat er die Diele.
»Hallo?«, rief er noch einmal, aber er bekam wieder keine Antwort.
Was machst du hier?, fragte die eine Hälfte seines Gehirns. Was wirst du sagen, wenn sie dich fragt, was du hier willst?
Er wusste keine Antwort, aber der anderen Gehirnhälfte wäre sie ohnehin egal gewesen. Langsam schloss er die Haustür hinter sich.
Er war drin. In ihrem Haus.
Die Terrakottafliesen des Bodens glänzten wie frisch gewischt. Langsam ging er auf die Garderobe zu. Sein Mund war trocken, die Beine fühlten sich an, als würden sie ihn nicht mehr lange tragen können, aber das kannte er schon. Er wusste, sie würden durchhalten.
Er streckte die Hand nach der Steppjacke aus und strich zärtlich über den Pelzkragen, hielt die Hand an die Nase und genoss den Duft, der daran haftete. Er trat näher heran und presste sein Gesicht in den Pelz. Der Duft umfing ihn, und er meinte, in ihrem Parfüm auch ihren eigenen, salzigen Geruch zu spüren.
Er merkte, dass er mit den Tränen kämpfte, und riss sich von der Jacke los.
Idiot, dachte er. Du bist ein Idiot. Du benimmst dich wie ein Idiot. Sie hält dich für einen Idioten. Weil du ein Idiot bist.
GEH WEG!
Aber er schaffte es nicht. Er konnte jetzt nicht weggehen. Konnte es einfach nicht.
Er warf einen Blick in die Küche. Auch hier nichts Ungewöhnliches. Reste einer Brotzeit standen auf dem Tisch, ein leeres Weinglas.
Er drehte sich um, ging zurück in die Diele und griff nach dem Stiegengeländer.
»Scheiß drauf«, murmelte er, dann ging er in den ersten Stock hinauf.
Oben waren zwei Türen, beide geschlossen. Noch einmal rief er »Hallo?«, dann klopfte er an die rechte Tür.
Keine Antwort. Er versuchte die Klinke. Die Tür war unverschlossen. Es war das Bad, es war leer.
Als er an die linke Tür klopfte, bemerkte er, dass sie nur angelehnt war. Das Wohnzimmer. Das Licht brannte. Aber auch hier war niemand. Er trat ein.
Die Stereoanlage war an, aber es lief keine Musik. Es war still. Ein großer Flachbildschirm hing an der Wand. Daneben stand ein alter Sekretär, darauf ein Mac. Er zeigte als Bildschirmschoner das Logo ihrer Firma, GAP-Data. Daneben lagen ein iPad und ihr Handy.
Auf dem niedrigen Glastisch vor der Ledercouch standen eine Flasche Pernod und ein Wasserkännchen. Daneben ein Glas. Es war umgefallen.
Eine kleine Lache stand auf dem Glastisch. Er tupfte den Finger hinein und roch daran. Anis.
Pernod hatte sie auch vor dem Ende ihres einen gemeinsamen Abends getrunken. Als die Stimmung noch gut gewesen war zwischen ihnen.
Als sie noch nicht ahnte, was er für sie fühlte.
Aber das ahnte sie ja immer noch nicht. Er lächelte traurig und stellte das Glas auf. Neben dem Fernseher war eine weitere Tür. Er nahm an, dass sie ins Schlafzimmer führte.
Sollte er sie tatsächlich öffnen?
Zögernd ging er im Raum umher. In dem großen Bücherregal standen ein paar gerahmte Fotografien. Er griff nach der erstbesten. Sanne am Strand unter Palmen. Mit einem durchtrainierten dunkelhäutigen Mann, der seinen Arm besitzergreifend um sie gelegt hatte. Ihr Bikini war so winzig, dass Sebastian ihn erst auf den zweiten Blick entdeckte.
Er nahm das nächste Bild. Sanne auf einem Pferd. Daneben, auch auf einem Pferd, ein blonder Mann. Sportlich. Gut aussehend. Elegant gekleidet, soweit Sebastian das beurteilen konnte. Er wusste nicht wirklich, was beim Reiten so zu tragen war. Der Mann auf dem Foto hatte auf jeden Fall eine andere Kragenweite als er. Er hatte Stil. Er hatte Geld. Er hatte Sanne.
Sebastian stellte das Bild ins Regal zurück. Unschlüssig sah er zur Schlafzimmertür. Wahrscheinlich war sie einfach ins Bett gegangen und hatte vergessen, das Licht auszumachen. Wenn er jetzt dort hineinging, würde er sie nur wecken.
Aber da war dieser scharfe Schlag gewesen, den er gehört hatte. Der ihn überhaupt erst veranlasst hatte, das Haus zu betreten. Wenn nun wirklich etwas passiert war? Er räusperte sich.
»Hallo …? Sanne?«, rief er und hoffte, die richtige Lautstärke getroffen zu haben. »Ich bin’s. Der Sebastian. Sebastian Polz. Der Milli … aus dem Büro …«
Hinter der Tür rührte sich nichts. Noch einmal rief er. Wieder ohne Reaktion.
Es half nichts. Er trat an die Tür und klopfte leise.
* * *
In Burgls Blick stand eine Mischung aus Mitleid und Ärger.
»Hausl, es ist bald fünfunddreißig Jahre her. Ich hatte wirklich gedacht …« Mit einem Kopfschütteln brach sie den Satz ab und trank von ihrem Whisky.
»Es ist mir nie egal gewesen«, murmelte Schwemmer.
Die Bedienung hatte sich diskret zurückgezogen. Wahrscheinlich war der Wechsel der Schwingungen zwischen ihnen im ganzen Raum spürbar.
»Ich dachte, wir sind nicht eifersüchtig?« Sie lächelte, aber es klang ernst.
»War ich auch nie. Außer auf diese Sportskanone.«
»Ich bitt dich! Fünfunddreißig Jahre! Ferdi ist auch nicht mehr der Jüngste.«
»Soll das heißen, bei einem Jüngeren müsst ich mir Sorgen machen?«
»Vielleicht …« Sie lachte. »Aber das darf doch heute alles keine Rolle mehr spielen, Hausl.«
»Nein, darf es nicht«, brummte Schwemmer in sein Glas.
»Ich trau mich gar nicht, weiterzuerzählen«, sagte Burgl.
Schwemmers Augenbrauen schossen in die Höhe. Wie, weiter? Was würde da denn noch kommen?
»Vielleicht sollte ich es dir gar nicht sagen …«
»Kommt nicht in Frage«, sagte Schwemmer. »Raus damit.«
»Tja … er hat mich gefragt, ob ich nicht Partnerin in seiner Praxis werden will.«
Schwemmer sah sie verwirrt an. »Heißt das, du willst wieder arbeiten?«
»Ich hab’s noch nicht entschieden. Wär halt eine schöne Gelegenheit.«
»Brauchen wir denn Geld?«
»Nein …«
»Eben«, sagte Schwemmer.
»Eben was? Ich hab die Gelegenheit, mit minimalem Aufwand selbstständig zu arbeiten. Ohne Risiko, ohne Investitionen. Wenn ich keine Lust mehr hab, lass ich es wieder.«
»Wieso willst du wieder arbeiten? Du hast doch immer gesagt –«
»Ja, ja. Stimmte ja auch. Es hat mich belastet –«
»Zu sehr«, unterbrach Schwemmer sie. »Und ich kann das nachvollziehen.«
»Ja. Dein Job ist nämlich auch belastend.«
»Aber ich komm damit klar. Du hast –«
»Ich hatte damals einfach genug. Und jetzt eben nicht mehr.«
»Du hast nicht mehr genug? Genug was? Sorgen?«
»Quatsch. Genug zu tun. Die Auszeit war toll. Aber jetzt hab ich das Gefühl …« In einer vagen Geste breitete sie die Arme aus.
»Als ich noch in Ingolstadt war –«, sagte Schwemmer.
»Herr Erster Kriminalhauptkommissar Schwemmer! Jetzt kommen Sie mir nicht mit Ihren Ingolstadt-Geschichten! Ich war dabei, wie Sie wissen sollten!« Burgl versuchte, ihren Zwischenruf mit einem Lachen zu entschärfen, aber es gelang nicht recht. »Entschuldige«, sagte sie leise.
»Als ich noch in Ingolstadt war, haben wir bei den komplizierten Fällen immer mit dem Dr. Kögl als forensischem Psychiater zusammengearbeitet. Er war zuständig, wenn’s um die richtig Abgedrehten ging.«
»Ja, ich erinner mich an ihn. Er war gut.«
»Sehr gut sogar. Genau wie du.«
»Ich hab ihn mal kennengelernt.«
»Ich weiß.«
»Und?«
»Er ist tot. Leberzirrhose.«
Burgl kniff die Lippen zusammen und hielt ihr Glas hoch. »Wohlsein«, sagte sie und kippte den restlichen Whisky hinunter.
»Ich meine nicht, dass du zu viel trinkst.«
»Sondern?«
»Dass man manchmal weniger aushält, als man meint.«
»Das weiß ich! Ich bin Psychologin!«
Schwemmer hob die Achseln und griff nach seinem Glas. Es war fast leer. Die Bedienung sah in den Raum und warf ihm einen fragenden Blick zu.
»Zahlen bitte«, sagte Schwemmer und rang sich ein Lächeln ab.
»Ich wollt uns wirklich nicht den Abend verderben«, sagte Burgl und schob ihre Hand über den Tisch an seine heran. Er legte seine Finger auf ihre.
»Aber ausgerechnet Ferdi Schurig«, murmelte er.
* * *
Auch auf sein zweites, etwas lauteres Klopfen erhielt Sebastian keine Antwort. Er drückte die Klinke und öffnete die Tür. Der Raum dahinter war finster. Das Licht aus der Wohnstube erhellte nur die ersten Meter hinter der Tür. Er erkannte das Fußende eines Bettes, das auf einem dicken, unruhig gemusterten Teppich stand. Er wagte nicht, das Licht anzuschalten.
»Sanne?«
Keine Antwort. Regungslos blieb er stehen und lauschte. Er meinte, leise Atemzüge zu hören. Langsam gewöhnten sich seine Augen an das Dunkel, und er erkannte immer mehr Details. Den Nachttisch neben dem Kopfende, eine Kommode. Schließlich war er sicher, sie im Bett liegen zu sehen. Oder vielmehr: auf dem Bett. Sie war nicht zugedeckt. Sie war bekleidet. Ihr Kopf lehnte am Kopfende des Bettes.
Und ihre Augen waren offen.
»Sanne?«
Sie regte sich nicht. Irgendwas stimmte nicht mit ihren Augen. Sie wirkten wie schwarze Löcher. Und ihr Kopf schien von einer dunklen Aura umgeben.
Er tastete nach dem Lichtschalter und drückte darauf.
Was er sah, ließ ihn um Atem ringen. Er konnte es nicht glauben, nicht verstehen. Wankend suchte er Halt am Türrahmen, musste gegen Brechreiz ankämpfen.
»Sanne …«, sagte er noch einmal, leise und sinnlos.
Sie war tot. Ihre Augenhöhlen waren leer. Dort, wo das Funkeln gewesen war, klafften zwei blutschwarze Löcher. An der Wand hinter ihrem Kopf waren Gewebe, Knochensplitter und Blut verteilt.
Noch nie in seinem Leben hatte Sebastian sich so hilflos und ausgeliefert gefühlt. Er starrte auf die Katastrophe, auf den Tod, auf das Ende von allem.
Als er aus den Augenwinkeln eine Bewegung wahrnahm, gelangte das nicht bis zu seinem Reaktionszentrum. Und den Schlag auf den Hinterkopf, der ihn in die Ohnmacht schleuderte, nahm er fast dankbar entgegen.
* * *
Es ist nur auf den ersten Blick ein Fehler gewesen, die Haustür offen zu lassen. Ich mache keine Fehler. Wenn ich etwas tue, dann ist es richtig. Es ist richtig, weil ich es getan habe. Und wenn das dann dazu führt, dass ein Mensch zu einer Figur im großen Spiel wird, das ich spiele, dann ist das kein Fehler. Jedenfalls nicht meiner.
* * *
Sebastian wehrte sich gegen das Wachwerden, denn es bereitete Schmerzen. Die heftigsten tobten in seinem Schädel, aber auch in den Rücken fuhr ihm ein heftiger Stich, als er versuchte, seine Position zu ändern. Er lag kopfunter. An der Wange spürte er einen groben, staubigen Teppich. Er wollte sich aufstützen, aber sein rechter Arm ließ sich nicht bewegen. Es war fast völlig dunkel. Seine Brille war weg. Der linke Arm gehorchte ihm. Immerhin. Fahrig tastete er herum, aber die Brille fand er nicht. Irgendwo über ihm war ein wackliger Halt. Er griff danach und versuchte, sich hochzuziehen. Sein Kopf stieß irgendwo gegen, und er schrie auf vor Schmerz.
Nur ganz langsam wurde ihm klar, wo er sich befand. Er lag in seinem R5, kopfüber im Fußraum vor dem Beifahrersitz. Was seine Linke umklammert hielt, war das Lenkrad. Mit Mühe gelang es ihm, sich aufzurichten. Er lag nun quer auf den Vordersitzen.
Sein rechter Arm war eingeschlafen und völlig taub. Er hob ihn mit der Linken an, und er fiel einfach wie gelähmt wieder an ihm herunter.
Schwerfällig rutschte er hoch in Sitzposition und tastete wieder nach der Brille. Er hatte sechs Dioptrien und sah ohne sie ungefähr so viel wie ein Mensch unter Wasser. Aber die Brille war nicht zu finden. Mit zusammengekniffenen Augen sah er zum Himmel. Der Mond war verschwunden, aber er glaubte zu erkennen, dass der R5 noch zwischen den Büschen stand, wo er ihn verlassen hatte.
Stück für Stück setzte seine Erinnerung wieder ein, und das trug nicht dazu bei, dass es ihm besser ging. Er sah zum Haus hinüber. Das Licht im ersten Stock war aus.
Für einen Moment keimte die Hoffnung in ihm, alles sei nur ein böser Traum gewesen, aber dann tastete er über seinen Hinterkopf und fühlte eine riesige Beule.
Sanne war tot. Ermordet. Und er war niedergeschlagen worden – von ihrem Mörder. Er hatte sich mit dem Mörder im selben Zimmer befunden. Er konnte glücklich sein, noch zu leben.
Konnte er?
Nein. Er konnte nicht. Sanne war tot. Das Funkeln war fort. Die Augen, in denen es geleuchtet hatte, waren geraubt worden.
Übelkeit übermannte ihn. Er stieß die Fahrertür auf und erbrach sich auf den lehmigen Boden. Krämpfe schüttelten ihn, und wieder verlor er das Bewusstsein.
Das Nächste, was er hörte, war der Klingelton seines Handys. Es läutete ausdauernd, aber er schaffte es nicht, hochzukommen. Das Handy verstummte, aber schon Sekunden später läutete es erneut.
Sebastian zwang sich auf. Es würde sein Vater sein, der ihn suchte. Er hatte keine Ahnung, was er ihm sagen sollte. Das Handy lag im Handschuhfach. Er nahm es heraus und hielt sich das Display dicht vor die Augen. »Unbekannter Teilnehmer«, meinte er entziffern zu können. Vaters Nummer wurde immer angezeigt. Er starrte das Gerät an, bis es zu klingeln aufhörte. Aber wieder dauerte die Pause nur ein paar Sekunden.
Er nahm das Gespräch an, ohne sich zu melden.
»Bist du endlich wach, Sebastian?«, sagte eine Stimme.
»Wer ist da?«, wollte er fragen, aber er brachte nur ein unartikuliertes Krächzen hervor.
»Überanstreng dich nicht. Entspann dich.« Die Stimme war kühl, fast gelangweilt. Sie klang seltsam, irgendwie elektronisch verändert.
Sebastian hustete. »Polizei«, stieß er hervor. »Hilfe!«
»Nein, Sebastian«, sagte die Stimme. »Nicht die Polizei.«
»Warum nicht? Doch! Wer ist da eigentlich? Ich brauch Hilfe!«
»Das weiß ich, Sebastian. Aber du brauchst eine andere Art von Hilfe, als du denkst. Und du brauchst viel mehr Hilfe, als du dir vorstellen kannst.«
»Sanne! Sanne ist tot! Um Gottes willen …« Er begann zu schluchzen.
»Auch das weiß ich, Sebastian. Schließlich habe ich sie getötet.«
Dieses Mal schaffte er es nicht, die Fahrertür aufzustoßen. Er kotzte gegen die Seitenscheibe.
»Bist du noch da, Sebastian?«, fragte die Stimme.
»Polizei …«, war alles, was er hervorbrachte.
»Aber Sebastian, hör mir doch zu! Was willst du denn bei der Polizei?«
»Sie haben Sanne umgebracht. Mörder …!« Er rang um Atem.
»Geh nicht zur Polizei. Denn die wird wissen wollen, wie deine Fingerabdrücke in das Haus gekommen sind. Vielleicht finden sie ja auch deine Haare und deinen Speichel auf der toten Susanne Berghofer. Oh … du nennst sie ja Sanne.«
»Aber ich hab nichts getan!«, stieß Sebastian hervor. Sein Kopf dröhnte von dem Schlag und dem Schock, und er versuchte verzweifelt, die Situation zu erfassen.
Die Stimme erklärte sie ihm geduldig.
»Was wird die Polizei wohl glauben, wenn ausgerechnet du sie zu der Frau führst? Wo doch deine Spuren überall sind? Auf der Tatwaffe sind deine Fingerabdrücke. Du hast sogar Schmauchspuren an der Hand.«
Sebastian sah ungläubig auf seinen rechten Arm, der immer noch bewegungsunfähig an ihm herabhing. Hastig legte er das Handy in den Schoß und hob mit der linken seine rechte Hand an die Nase. Und tatsächlich nahm er den metallischen Geruch von Schwarzpulver wahr. Er griff wieder nach dem Handy.
»Aber ich hab die Waffe gar nicht!«, sagte er atemlos.
»Natürlich nicht. Ich hab sie. Und ich kann dafür sorgen, dass man sie findet. Wo immer ich will. Und wann immer ich will.«
Sebastian ließ das Handy sinken. Er zwang sich, ruhig zu atmen. Sechs, sieben, acht Atemzüge gönnte die Stimme ihm, bis er sie leise aus dem Handy hörte.
»Bist du noch da, Sebastian?«
Er nahm das Gerät wieder auf. »Ja«, sagte er.
»Du hast sie sehr geliebt, da besteht kein Zweifel. Aber es ist ein Fehler, sehr zu lieben, Sebastian. Es verursacht Schmerzen.«
»Ja«, war alles, was er sagen konnte.
»Schön, dass wir uns einig sind. Ich bin gern einig mit anderen. Leider ist es mir nur selten vergönnt.«
Sebastian musste sich zwingen, nicht zu schreien.
»Du wirst deine Brille vermissen«, sagte die Stimme. »Sie liegt im Schlafzimmer auf dem Nachttisch. Der Schlüssel steckt in der Haustür.«
»Haustür? Sie wollen, dass ich da noch mal reingehe?«
»Ich will gar nichts, Sebastian. Tu, was du willst. Dies ist ein freies Land.«
* * *
Schwemmer stöhnte auf, als das Telefon auf dem Nachttisch zu läuten begann. Die Leuchtziffern des Weckers zeigten zehn vor vier. Gute Nachrichten waren um diese Zeit nicht zu erwarten.
»Schwemmer.«
»Ja … hallo …«, stammelte eine männliche Stimme. »Ich … ähm … Hallo, Balthasar …«
»Wer ist denn da?«, fragte Schwemmer irritiert. Er hatte mit der Wache gerechnet.
»Ja, hier ist der Ferdi. Ferdi Schurig. Eigentlich wollt ich ja die Burgl sprechen …«
»Jetzt?«, kreischte Schwemmer. »Kommt nicht in Frage!«
Neben ihm richtete Burgl sich im Bett auf und schaltete ihre Nachttischlampe an. »Was ist denn?«, fragte sie verschlafen und rieb sich die Augen.
»Ja, ich wollt ja eigentlich nicht wirklich die Burgl … eigentlich wollt ich, dass sie mit dir spricht … und da kann ich natürlich jetzt auch direkt …«
»Sag mal, tickst du noch ganz richtig?«, entfuhr es Schwemmer.
»Nein, äh, ja, mein ich. Es ist nur … Gisa ist tot. Ich hab sie eben gefunden. Ich glaub, er hat sie vergiftet.«
»Tot? Vergiftet? Dann ruf verdammt noch mal sofort die 110 an. Du willst einen Mord melden und rufst bei Burgl an? Bist du noch ganz dicht?«
»Da hab ich ja schon angerufen … aber die haben gesagt …«
»Was?«, zischte Schwemmer.
»Die haben gesagt, sie kümmern sich im Lauf des Tages drum.«
Schwemmer traute seinen Ohren nicht. »Die kümmern sich im Lauf des Tages um einen Mord? Das glaubst du doch selber nicht!«
»Doch! Sie haben gesagt, wegen einem Hund …«
Schwemmer stöhnte auf und schlug sich mit der Hand vor die Stirn.
»Was ist los?«, fragte Burgl.
Schwemmer hielt ihr das Telefon hin. »Für dich«, sagte er.
* * *
»Hallo?«
Die Stimme schwieg. Die Verbindung war beendet.
Er befand sich in einem Alptraum. In einem fürchterlich realen Alptraum.
Sanne war tot. Sie lag verstümmelt auf ihrem Bett. Neben ihr lag seine Brille.
Und er hatte eben mit ihrem Mörder gesprochen.
Woher hat er meine Handynummer?, dachte er panisch und tastete nach seiner Brieftasche. Sie war nicht in der Innentasche der Jacke, wo er sie immer aufbewahrte. Er durchsuchte alle Jacken- und Hosentaschen, öffnete das Handschuhfach und durchwühlte die Ablagen in den Türen und der Mittelkonsole. Vergeblich. Der Mörder hatte seine Papiere, seine Scheckkarten, seine Visitenkarten.
Und mehr noch: seine Notizzettel; ein paar Dutzend, vollgekritzelt in winziger Schrift. Eine Art Tagebuch, das er führte, wenn er ein wenig Zeit hatte – wenn er allein an seinem Tisch in der Cafeteria saß zum Beispiel. In den letzten Monaten hatte er sich angewöhnt, seine Gedanken zu notieren. Aber seine Gedanken hatten sich in den letzten Monaten ausschließlich um Sanne gedreht.
Er hatte keine Ahnung, was er tun sollte. Also blieb er einfach sitzen und versuchte, die Optionen durchzudenken.
Er konnte die Polizei rufen. Aber der Mörder hatte ja recht: Man würde ihn sofort verhaften. Und nicht nur das – er hätte keine Chance, seine Unschuld zu beweisen. Es waren Spuren von ihm in der Wohnung. Er konnte versuchen, die Fingerabdrücke an den Bildern und dem Pernod-Glas zu beseitigen, aber wahrscheinlich würde er dabei nur neue Spuren hinterlassen. Die fanden heute doch alles. Außerdem würde der Mörder schon dafür gesorgt haben, dass es genug zu finden gab. Hatte er nicht von Speichel gesprochen und von Haaren?
Und von der Tatwaffe.
Aber bisher kannte niemand seine Fingerabdrücke. Und auch eine DNS-Probe hatte er noch nie abgeben müssen. Vielleicht gab es also eine Chance für ihn, davonzukommen.
Doch wenn er nicht die Polizei rief, dann musste er hier weg, bevor er auffiel. Er hielt sich das Handydisplay vor die Augen. Fast vier Uhr. Bald würde der erste Verkehr einsetzen.
Er starrte hinaus in die Dunkelheit. Ohne seine Brille konnte er nicht fahren. Unmöglich in dieser Finsternis. Das bedeutete: Er musste noch einmal ins Haus. Noch einmal in das Zimmer. Noch einmal zu der toten Sanne. Zu ihren toten Augen.
Ich schaff das nicht, dachte er. Das ist zu viel.
Aber dann öffnete er die Fahrertür und stieg aus.
ZWEI
»Grüß Gott«, sagte Schafmann fröhlich, als er Schwemmers Büro betrat.
Schwemmer brummte irgendwas zur Antwort.
Schafmann warf einen Blick auf seine Armbanduhr. »Es ist Viertel vor zehn«, sagte er. »Die Morgenmuffelzeit ist vorbei.«
»Dann betrachte mich heute eben als Ganztagsmuffel«, antwortete Schwemmer.
»Na servus. Soll ich fragen, oder möchtest du nicht drüber reden?«
»Ich möchte nicht drüber reden.«
»Und wie lang wird das dauern?«
»Keine Ahnung.«
»Oha. Darf ich denn dienstlich werden?«
»Ich bitte darum.«
Schafmann setzte sich. »Krieg ich trotzdem einen Kaffee?«
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!