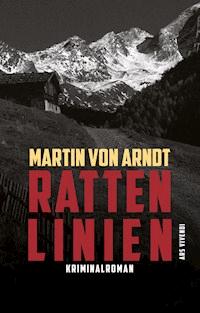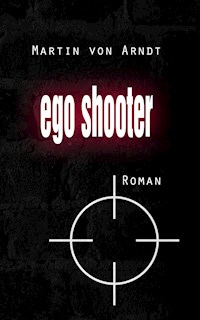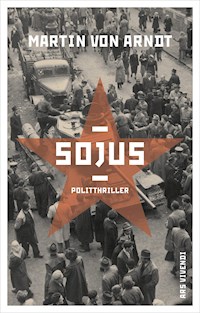Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ars vivendi Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Wer sendet ihm Monat für Monat anonym ein leeres Blatt Papier als Einschreibebrief? Und was will ihm der Absender damit sagen? Gibt es etwa ein dunkles Geheimnis in seiner eigenen Vergangenheit oder in seiner Familie? Diese Fragen stellt sich der Gitarrist Julio, der seit Jahren davon lebt, Klassiker der Rockmusik für chinesische Schnellimbisse aufzubereiten: Smells like teen spirit. Mit Geschmacksverstärker. Julio beschließt, den Briefen auf den Grund zu gehen. Es wird eine Reise, die ihn auf sich selbst zurückwirft, sein Leben ziemlich durcheinander schüttelt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 185
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MARTIN VON ARNDT
Der Tod ist ein Postmann mit Hut
ROMAN
Vollständige eBook-Ausgabe der 2009 erschienenen Originalausgabe
eBook veröffentlicht bei ars vivendi verlag GmbH & Co. KG, Bauhof 1, 90556 Cadolzburg
©2022 Alle Rechte vorbehalten
www.arsvivendi.com
eISBN 978-3-7472-0510-5
Coverbild unter Verwendung von Grafiken von Stefan Schweihofer / [email protected] und [email protected]
Fonts: Delicious: A font by Jos Buivenga (exljbris, www.exljbris.com); TheMix: A font by Luc de Groot
Ah, look at all the lonely people.
I.Zwischen Malmö und Mailand
1.
Der Tod ist ein Postmann mit Hut. Jeden ersten Mittwoch im Monat bringt er mir ein Einschreiben. Er hält mir sein tragbares Terminal hin und einen Stift, der aussieht wie ein krumm geschlagener Zimmermannsnagel, und ich krakle einen großen Kreis, dazu inmitten des Kreises einen Haken von rechts nach links und einen von oben nach unten, etwas, das aussieht wie eine gewagte, eine gewogene und doch für zu leicht befundene Unterschrift. Dann deutet er, der mich längst duzt und den ich nicht mehr sieze (aber ich vermeide auch jede direkte Anrede), ein Lächeln an und fährt mit dem Zeigefinger flüchtig an seine Kopfbedeckung, einen Tirolerhut. Ich biete ihm Wacholderschnaps an, den ich zuvor in ein Stamperl gegossen habe (und von dem ich selbst nicht trinke), er stürzt das Destillat, indem er den Kopf in den Nacken wirft und dabei die Augen zukneift, bleckt die Zähne, schnalzt einen vollendeten Knacklaut mit der Zunge, lächelt, führt den Zeigefinger abermals flüchtig an den Hut und dreht sich auf der Schwelle. Ich sehe ihm noch einen Moment nach, seinem hatschenden Gang, den die scherenförmigen Beine verursachen, und ziehe mich mit dem leeren Glas und dem Einschreiben zurück in meine Wohnung. Dann setze ich mich damit an den Tisch. Ich rücke mit dem Stuhl ein wenig ab, um ein Bein übers andere zu schlagen. Ich warte. Warte und betrachte die mal volle, mal halbvolle oder leere Wacholderflasche oder das Schnapsglas. Ich zähle die Fliegen unter der Zimmerdecke. Insektensütterlin. Ein stilles Mobile. Ich warte. Eine Stunde oder auch zwei. Das Einschreiben sehe ich nicht an.
Wenn es soweit ist, dem Außenstehenden mag es vorkommen wie ein Bereitgewordensein, rücke ich mit dem Stuhl an den Tisch heran und öffne das Kuvert mit dem Zeigefinger. Meine Bewegungen sind so achtsam, daß ich nicht einmal das Reißen der Papierfasern höre. Vielleicht diesmal, jubelt etwas in mir einem neuen Ausgang des Spiels entgegen. Aber nein. Wieder nur das einmal gefaltete leere Blatt. Das Monat für Monat wiederkehrende weiße Papier, ein anonymes Schreiben in einem Standard-Umschlag. Heute wie letzten Monat. Wie vorletzten Monat. Heute wie immer.
Ich atme aus, lege es langsam zurück auf den Tisch, lange nach einer Schachtel Zigaretten und trete auf den Balkon. Auf dem Dach des gegenüberliegenden Hauses putzt sich eine braun-grau gesprenkelte Taube das Brustgefieder. Anschließend sind die Flügel dran, ein kompliziert wirkender Vorgang, der Mutlosigkeit in mir aufsteigen läßt.
Diese Mutlosigkeit, eine moralische Schwäche vielleicht oder auch einfach eine psychische Überwältigung: Sie kommt wiederkehrend und unversehens über mich. Sie überkommt mich beim Schuheputzen, bei häuslichen Kleinreparaturen. Alles wird schwarz, alles wird schwer, unerträglich schwer, zu schwer für mich, unerträglich für mich, und dann weiß ich, es ist genug, ich halte dieses Leben, mein Leben, das Leben schlechthin, nicht mehr aus. Ich muß mich befreien, mich freischwimmen. Nicht schwimmen, tosende Wogen überwinden, wie Mao gesagt haben soll.
Es fällt mir schwer, eine Zigarette anzustecken, die Luft ist regengeschwängert. Der Tag hängt tropfnaß an einer Wäscheleine und fällt gelegentlich, von Windstößen erfaßt, in den Rasen, um dort Lachen um sich her zu bilden und so lange liegenzubleiben, bis eine vierschrötige Hausfrau ihn aufhebt, kräftig durchschüttelt und unter lautem Schimpfen zurück auf die Leine befördert.
Ich rauche und sehe um mich. Die Berge starren zurück, in ihrem undurchdringlichen Schmutzigblau. Längst empfinden wir Überdruß, einander anzusehen, die Berge und ich.
Der Tag zappelt wieder. Innerhalb weniger Minuten wird sich der Himmel mit schwerem Gewölk überziehen, es wird zu dunkeln beginnen, trotz der Morgenstunde, und dann wird ein heftiges Gewitter über der Stadt liegen, das sie an allen Enden zusammendrückt und neu faltet.
Seit Tagen nieselt es. Wolken ziehen um die Gebirgsnasen und kitzeln sie. Dann und wann niesen sie und es platzen Regengüsse in die Straßen, die das Wasser auf dem Asphalt speichern. Autos geraten ins Schleudern, vergraben sich ineinander. Die Sirenen der Ambulanzen heulen Somewhere over the Rainbow, immer die Strophe, ohne die Bridge. Innsbruck deprimiert mich, denke ich wieder einmal, ich hätte es lassen müssen. Plötzlicher Zahnschmerz, den der Rauch, den ich inhaliere und durch die Mundhöhle wehen lasse, noch verstärkt. Die Taube spreitet ihre Federn, zeigt einen makellos wirkenden weißen Rückenflaum. Nach getaner Arbeit versenkt sie den Kopf unter den Fittichen.
Ich kehre zurück ins Wohnzimmer, mein Blick fällt auf Hose, Krawatte und Sakko. Schwarz, zerknüllt, liegen sie auf, liegen sie neben dem Bett.
2.
Gestern haben wir den Grantler begraben. Der Regen hatte eine Pause gemacht, gerade lange genug, um ihm auf der Gitarre seinen Lieblingssong zu spielen, Eleanor Rigby. ›Ah, look at all the lonely people‹. Ich verzichtete auf meine China-Triller und flüchtete mich, kaum war der Schlußakkord verhallt, mit den anderen unter das Vordach der Aussegnungshalle. Drinnen waren schon die Melodien der nächsten Leich zu hören.
»Bei dem Wetter sterb ma noch alle«, sagte einer mit Tirolerhut, der mein Postmann hätte sein können, und versuchte, weiter weg von der nach allen Richtungen spritzenden Traufe zu kommen. Dabei schob er mich in den Regen. Dem Grantler hätt’s gefallen, dachte ich. Er liebte die Stadt unter einer Decke aus Regenwolken. Ich stellte mir vor, wie er da oben in der Nässe saß, Hut und Mantel hatte er abgelegt, und lachte und sich freute über das Wetter.
Ich beschloß, kein Taxi zu nehmen, und ging am Fluß entlang nach Hause. Mit dem immer selben Abstand lief vor mir eine etwa fünfzigjährige Joggerin im fliederfarbenen Trainingsanzug. Wurde ich schneller, erhöhte sie das Tempo, blieb ich stehen, um mir die Schuhe zu binden, hörte ich, wie auch sie ihren Tritt verzögerte. Dabei intonierte sie atemlos und mit viel zu hoher Stimme Kirchenlieder, unterbrochen von bellendem Husten. Entweder sie verschluckte sich an ihrem Speichel oder an den Regentropfen. Ich hoffte auf eine dicke Schmeißfliege oder einen Schmetterling, der ihrem Segne du, Maria, segne mich, dein Kind, daß ich hier den Frieden, dort den Himmel find! aus weit geöffnetem Mund endgültig den Garaus machte.
Der Inn floß braungelb und rasch dahin, als müßte er sich selbst etwas beweisen. Er schlingerte dabei. Vielleicht war er drauf und dran, sich zu übergeben. An der alten Brücke standen Menschentrauben, die bunte Regenschirme hielten und stumm in den Fluß starrten. Der leckte gierig an den Ufersteinen und begann, hin und wieder die Böschung zu erklettern. Ich stellte mich dazu, um nur endlich außer Hörweite der joggenden Gottesbraut zu geraten. Ohne Regenschirm. Und ohne Kapuze. Am Kragen war mein Jackett vollständig durchfeuchtet und hatte eine tiefschwarze Farbe angenommen. Es begann, nach Friedhof zu riechen.
Zuhause warf ich die klammen Sachen irgendwohin und legte mich ins Bett. Ich war gefaßt auf eine schwere Erkältung, aber sie blieb aus. Ich schlief den Tag, die Nacht, ich wartete nicht auf den Postmann, aber ich wußte, er würde pünktlich sein. Es war die Nacht auf Mittwoch. Den ersten Mittwoch im Monat.
3.
Zurück am Tisch schiebe ich das Blatt zurück in seinen Umschlag, versehe ihn mit Monats- und Jahreszahl, lege ihn zu den anderen auf den Stapel in der Schublade und schließe sie. Ich setze mich und beginne zu schreiben: Gestern haben wir den Grantler begraben. Zaghaft schreibe ich, mit müden Gedanken.
Ein müder Mensch sei ich, notiere ich. Notiere, was Ines einer Freundin am Telefon sagte, als sie von mir erzählte. Nicht in dem Sinne müde, daß ich irgendjemandes oder irgendetwas müde sei, auch nicht meines Daseins. Nicht in dem Sinne, als könnte mir das Leben keine Überraschungen mehr bereiten, als langweilte es mich zutiefst, als könnte ich zielsicher die Bahn vorhersehen, in der mich die Ereignisse treffen. Im Gegenteil, das Leben bereite mir jeden Tag mehr Überraschungen, mehr als mir lieb sei, und ich sei auch kein guter Augur.
Einfach nur ein allzeit müder Mensch, sagte sie, dachte sie, schreibe ich, langsam, mit müden Gedanken. Dann werde ich schneller. Immer schneller. Wie immer, wenn ich mein ›Nächtebuch‹ führe, denn meine Nächte sind die besseren Tage, so schreibe ich. Ich suche, die Zeit urbar zu machen. Alles was bleibt, sind diese Zeilen auf weißem Papier. Darum dreht sich die Welt. Meine Welt.
4.
Das erste Einschreiben erhielt ich vor fast zwei Jahren, an meinem vierzigsten Geburtstag. Mein Postmann verglich damals noch den Namen auf dem Kuvert mit dem in meinem Personalausweis, in den er Einsicht nehmen wollte. Er stutzte, als er sah, daß ich Deutscher bin, zuckte mit den Schultern, murmelte umständlich etwas auf tirolerisch, vielleicht ein Wort des Verzeihens, ich sei deswegen ja noch kein schlechter Mensch, und griff sich an die Kopfbedeckung. Dann händigte er mir gegen meine Unterschrift einen Umschlag aus, der keinen Absender trug, ich sah den Hut im Treppenhaus untertauchen und glaubte, als er endgültig verschwunden war, an einen dieser österreichischen Sonderwege. Tragen sie hier eben Hut, die Einschreibeboten, keine Mütze, keine Kappe, sondern Tirolerhut. Hier ist eben alles ein wenig Folklore, dachte ich.
Das leere Papier entnahm ich dem Kuvert, während ich mir die Zähne putzte. Ich studierte es von beiden Seiten, biß auf die Zahnbürste, um auch die rechte Hand freizubekommen, und durchsuchte den Umschlag so lange, bis ich sicher sein konnte, daß er nichts weiter enthielt, und mir portionsweise Schaum den Rachen hinabrann. Bestimmt ein Versehen, der Absender würde sich gehörig ärgern, wenn er zuhause feststellte, daß die wichtigen Unterlagen noch immer auf seinem Schreibtisch lagen und er nichts oder so gut wie nichts für sein Geld verschickt hatte. Er würde sich vornehmen, künftig konzentrierter ans Werk zu gehen und einen neuen Umschlag bereitlegen.
Trotz des ersten Impulses warf ich das Einschreiben nicht weg. Es stand doch so zweifelsfrei mein Name auf dem Adressatenfeld und keiner auf dem, das dem Absender vorbehalten bleibt, daß ich mich anmaßend, ja, pietätlos gefühlt hätte, dieses Dokument einfach zu vernichten. Und ich wartete auch vergeblich auf weitere Geburtstagsgeschenke, nimmt man einmal den gehetzten, aber nett gemeinten Anruf meiner geschiedenen Frau aus, die im Urlaub auf den Malediven war, und deren durch Funkunterbrecher zersplitterte Silben ich kaum verstand. Wie sonst hätte ich mir ihr »Spiel schön« zum Abschied erklären können.
Ich vergaß den Brief. Die folgenden Tage war ich in eine neue Produktion eingebunden: ›Chop-Suey-Classics‹. Ich war froh, im Studio den möglichen Nachwehen einer Geburtstagsdepression entgehen zu können. Ich spielte sanfter und exakter als sonst, meine Finger liebkosten den Walnußhals meiner Gibson Super 400, als gälte es, mit dieser Gitarre mein Leben zu verteidigen, zu rechtfertigen, zu entschuldigen.
Seit langem lebe ich davon, oder besser: damit, eigentlich lebe ich damit, Klassiker der Unterhaltungsmusik für chinesische Schnellimbisse zu bearbeiten. Running up that Hill, Eleanor Rigby, In-a-gadda-da-vida. Meine CDs heißen ›Achtzehn Kostbarkeiten‹ und ›Glück für die ganze Familie‹.
»Aber Chop-Suey-Classics«, so schwatzte mein Produzent Paintner in liebenswürdigem Legato und wedelte sich mit einem Satz Noten die schlechte Kellerluft seines engen Studioraums zu, »wird der endgültige Durchbruch. Breakthrough, undsoweiter undsoweiter!« Jetzt hätten wir einen international agierenden Vertrieb, einen Globalplayer (die erste Silbe sprach er österreichisch, die zweite englisch aus). Überall zwischen Malmö und Mailand werde von jetzt an zu meinen CDs gegen wenig Geld Huhn Sezuan und Bami Goreng gereicht, und krachend und lachend verspeise das junge Publikum Krabbenchips, während es von meinen China-Trillern umschmeichelt werde. Smells like teen spirit. Mit Geschmacksverstärker.
»Aber kannscht dir das vorstellen, Alter?«
Ich konnte es nicht. Ich wollte es nicht. Ich dachte an Schlachtfabriken, an Klumpen aus Blut und Federn, bekleckerte mein Hemd mit Kaffee, und drängte darauf, mit den Aufnahmen zu beginnen. Es ist nicht so, daß ich mich für diesen Lebensunterhalt schämte. Auch wenn ich die von Mutter eingepeitschten Gedanken nicht ganz habe abstellen können, daß ich dafür nicht jahrelang Jazzgitarre hätte studieren müssen. Es war ja nicht einmal meine Idee. Als sich meine Frau von mir trennte und ich bis zur Scheidung finanziell auf mich selbst gestellt war, bewarb ich mich auf eine Annonce:
›Paintner. Musikproduktionen. Studiogitarrist und Arrangeur gesucht. Livetauglichkeit unwichtig‹.
Das war gut, denn livetauglich war ich noch nie. Bei Musicalproduktionen, in denen man die Musiker ohnehin nur erahnen konnte, stellten mich die Regisseure immer so, daß mich die Lichtkegel, selbst wenn sie streuten oder außer Kontrolle zu geraten drohten, kaum mehr erreichen konnten. Weder mein Gesicht mit der viel zu großen Nase, noch die Körperform oder meine Haltung waren gemacht für die Scheinwerfer, deren Licht reflektiert wurde von meiner Stirn, die von Jahr zu Jahr ein wenig höher geworden war und eine streng nach hinten sich verjüngende Wulst auf meinem Schädel entblößte.
Einmal spielte ich in meinem Halbdunkel aus Protest mit dem Rücken zum Publikum. Ich rechnete mit einem Rausschmiß, aber der Regisseur schüttelte mir nur leutselig wie immer die Hände (er hielt mich für seinen zweiten Dramaturgen), und der zweite Dramaturg meinte trocken: »Nicht schlecht. Das machen wir jetzt immer so.«
5.
Paintner, ein Mann unschätzbaren Alters, der 40 sein konnte, oder aber Mitte 50, saß in einem ausgebauten Hobbyraum, den er hartnäckig ›Produktionszimmer‹ nannte (»Aber geh’ ma doch in mein Produktionszimmer«), und starrte, während ich ihm auf der Gitarre vorspielte, auf die flackernde Neonröhre eines ›Achtung-Aufnahme‹-Schildes. Als ich fertig war, nickte er zweimal kräftig und sah auf meine Hände, die rot waren wie immer, auch wenn die aufgekratzten Stellen bereits verschorften. Ich war nervös. Ich hatte ja ein Vorstellungsgespräch.
»Aber ein Wunder, daß Sie mit den Griffeln überhaupt Gitarre spielen können.«
Ich stellte das Instrument ab und klemmte meine Hände zwischen die Innenseiten meiner Schenkel.
»Aber gut. Gutgut. Ja, das wär das Richtige. Arrangieren kannscht sicher auch, undsoweiter undsoweiter?« fragte er, ging zu einem Plattenspieler, der auf einem leise surrenden Tischkühlschrank stand, und legte den Tonarm behutsam in eine Rille. Die ersten Töne von Eleanor Rigby waren zu hören.
»Aber jetzt die Frage aller Fragen: kannscht auch Chinesisch?«
Ich sah ihn an. Paintner lachte gekünstelt. Und viel zu lang. Meckernd lachte er, aber nicht ziegisch, eher wie ein rostiger Fuchsschwanz, der nach dem Frühjahrsschlag in einem Holzstamm vergessen worden ist und nun unter Aufbietung roher Gewalt aus seinem halb überwachsenen Gefängnis befreit werden mußte. Paintner verstummte und lehnte sich genüßlich in seinen Sessel zurück.
»Spielen mein ich, spielen. So Verzierungen, so süßliche. Halt das ganze Ding-Ding-Dong vom Chinamann, verstehscht?«
Ich holte tief Luft durch die Nase, nahm Paintners Aura als Schweinsbraten-mit-Knödeln-Geruch wahr. An der Wand flimmerte orangefarben ›Achtung Aufnahme‹. Ah, look at all the lonely people.
Ich hatte den Job.
6.
Wie die beiden zuvor, so war auch das dritte Einschreiben an ›Julio C. Rampf‹ adressiert. Eine offenbar amerikanische Variante meines Namens; ein Phänomen, das mich kein bißchen weiterbrachte bei der Suche nach dem Absender. Ich kannte keinen Amerikaner.
Als wir den Vertrag aufsetzten, stutzte Paintner das erste Mal, als er meinen Geburtsort las. Mit schielendem Blick sagte er: »Ach, Braunschweig.« Er lehnte sich in seinen Sessel zurück und begann zu rezitieren:
»Es war ein Sänger aus Braunschweig Der spielte so gern auf dem Bahnsteig Griff kühn in die Saiten Sich selbst zu begleiten Ein Zug zermalmt’ ihn zu Fleischteig.«
Während ich ihn lachen hörte, sah ich zur Decke, zählte Weberknechte. Bei sieben verstummte Paintner plötzlich. Ich blickte zu ihm hinüber, sein dunkelgebräuntes Skilehrergesicht bekam tiefe Falten, dann kniff er die Augen dreimal hintereinander zu, setzte sich auf und schlug mit der flachen Hand auf den Schreibtisch.
»Aber toll. Wir lassen den Rampf am End’ weg, ischt ja schlimm. Julio Christian, da muscht dich nicht mal an einen Künstlernamen gewöhnen. Julio Christian, klingt wie ein südamerikanischer Gitarrentraum. Schad, daß ma nur Chinesisch köcheln, was?«
Während Paintner wieder herausplatzte mit seinem faustgroßen Lachen, suchte ich ihm zu erklären, daß der Name nicht ›Chulio‹, sondern ›Julio‹ ausgesprochen werde, mit J wie Julia. Oder Jedermann. Paintner wimmerte noch in ausklingenden Lachstößen, blinzelte, dann lächelte er beseligt. Und nennt mich seither ›Kchrischtian‹.
II.Rucola und Ameisen
7.
Längst war ich vierzig Jahre alt. 40 1/6, um genau zu sein. Vor 366 Tagen hatte Ines ein letztes Mal bulgarisches Rosenwasser auf die überall in unserer gemeinsamen Wohnung aufgestellten Blumensträuße gesprüht (weil die Rosen, wie sie betonte, sonst heutzutage gar nicht mehr richtig dufteten), sie hatte die Schlüssel zurückgegeben und mir drei beglaubigte Kopien unserer Scheidungsurkunde auf den Küchentisch gelegt.
»Ich hab für dich gleich ein paar mitgemacht, die braucht man doch immer.«
Ines trank ihren Kaffee wie üblich nicht ganz aus und stellte die Tasse in die Spüle (mit dem verbliebenen Rest der Flüssigkeit bekleckerte ich Tage später, wie üblich und als wäre inzwischen nichts geschehen, den Boden vor der Spülmaschine). Dann lehnte sie ihre Stirn flüchtig an meine – ich roch das Rosenwasser – und sagte: »Den Gummibaum und die Blumen behältst du.«
Ich nickte. Ich habe nicht nur den Gummibaum behalten.
Zwei schwere schwarze Müllsäcke hatte mir Ines in den Keller gestellt, sie wolle die Gelegenheit wahrnehmen, ihr Leben auszumisten. Unser Leben auszumisten, dachte ich. Wahllos zusammengesammelte Muscheln, speckige Metrokarten aus den europäischen Kapitalen, Visa, unachtsam eingesteckte touristische Prospekte von Nirgendwo, und der hünenhafte Plüschpanda, Teil einer meiner Bühnendekorationen, den ich ihr zum Geburtstag gestohlen hatte: Fälle für den Restmüll. Die Muscheln verstaubten auf meinen Schränken, der Panda wachte über mein Bett. An den Wänden hingen noch immer die Bilder aus den ersten Jahren unserer Ehe.
Wenn sich Ines zu einem Besuch ankündigte, tätigte ich zuvor einen Inspektionsgang durch die Wohnung, um auch wirklich alle Erinnerungsstücke an unsere gemeinsame Zeit zu verbergen. Ich mochte ihr keine Gelegenheit geben, den Kopf zu senken, ihn sachte einmal nach hier, einmal nach dort zu schütteln, und mit leiser Enttäuschung in der Stimme zu murmeln: »Ach, Lio, vorbei ist vorbei.«
Vorbei ist vorbei. 40 1/6. Ich hörte Nous de la lune von den Young Gods. Ich dachte an Selbstmord. Oder dachte nicht daran. Und wenn ich nicht daran dachte, dann allein deswegen, weil ich kein Verlangen danach hatte, tatsächlich meinem Vater nachzueifern. Ihm, der mir alles eingebrockt hatte. (Inklusive meines Rufnamens, den schon meine Lehrerinnen nicht oder nur überkorrekt aussprechen konnten oder wollten, und dadurch minutenlang anhaltendes Zischen aus schokoladeverschmierten Kindermündern provozierten, das den Gastarbeiter-Kehllaut nachahmte wie das Fauchen eines besoffenen Tigers, um schließlich in dem glucksenden Vokalausbruch ›Ujo‹ zu enden – ›Chchchchchchchch-újo‹, das also war mein Name, bis ich darauf bestand, ›Lio‹ genannt zu werden; mein Name, den mir Vater vermacht hatte, ein glühender Verehrer der Comics von Gummipferd Jimmy, Caramba!, ich weiß bis heute nicht, ob es ein Glück war, daß Mutter bewirkte, mich wenigstens nach dem Reiter zu benennen, nicht nach dem Roß).
40 1/6. Meine Tage gingen in einem Gleichmaß dahin, und ich verstand es nicht, ihnen Persönlichkeit abzutrotzen. Ich stand auf (zu früh), ich kochte Kaffee (der mir nicht schmeckte), ich legte mich wieder ins Bett, obwohl ich wußte, daß mir das moralisch ganz und gar nicht gut tun würde. Ich stand wieder auf (zu spät), ging in einen Schnellimbiß und aß übermäßig oder nur einen Bruchteil meiner Bestellung. Den Weg zur Trafik konnte ich mir gerade noch verbieten, ich wollte wenigstens hierin stark bleiben vor mir, schließlich hatte ich mir das Rauchen abgewöhnt; wenn ich es auch nur getan hatte, weil ich vor Ines wieder einmal als ein neuer Mann dastehen wollte, fest in seinen Entschlüssen, der sich auch das Schwerste, das, was sie nie geschafft hatte, vornehmen und zur Ausführung bringen würde.
8.
Mutters Beerdigung war das letzte Mal, daß ich mit Ines in Deutschland war, das letzte Mal, daß wir überhaupt zusammen weggefahren waren. Schon während wir im Nachtzug nach Norden saßen, wußte sie, daß sie mich verlassen würde, nur noch die Beerdigung wollte sie abwarten und mir zwei Trauermonate zugestehen. Ines war mit mir gekommen, weil sie mich nicht allein lassen wollte, mich nicht allein lassen konnte mit meinen widerstreitenden Gefühlen zu einem Zeitpunkt, da mir ansonsten nicht einmal mehr das Nikotin beistehen würde.
Der Kontakt zu meiner Mutter war eher sporadisch gewesen. Von einem Moment auf den nächsten war ich für keine Nachfolgetournee in Frage gekommen, die europäische Musicalindustrie lag in Trümmern, glaubte man den Musikagenturen. Zwischen Mutter und mir blieb am Telefon nichts, auch nicht ihr halbstundenlanges Schelten, ich hätte meine Jugend, ihr Geld für meine Ausbildung, ja, mein Leben vergeudet und sollte jetzt wenigstens nicht werden wie mein Vater. Und auf Nachwuchs spekulieren könne sie wohl auch nicht mehr, meine Ines und ich, wir sollten die Welt ruhig Rucola und Ameisen überlassen, Kinder seien heute wohl einfach nicht mehr in Mode.
All dies war einmal, war das Verbindende, das unsere Telefonate wie von selbst bestritten hatte.
Jetzt, nachdem wir Begrüßungsworte ausgetauscht und uns wechselseitig über unsere Gesundheit, das Deutschland- und Österreichwetter informiert hatten, schwiegen wir. Einen Vierteleuro lang schwiegen wir. Dann sagte sie: »Kippelst du wieder mit dem Stuhl?«
»Nein.«
»Ich hör doch, wie er knarzt.«
Ich atmete aus, stellte die vorderen Stuhlbeine unendlich leise auf dem Boden ab.
»Wirklich nicht?«
»Aber nein.«
»Du sollst nicht mit dem Stuhl kippeln. Du schlägst dir noch den Schädel ein.«
Noch ein Vierteleuro verschwand in der Stille. Schließlich sagte ich: »Mutter, ich leg jetzt auf.«
»Ja«, antwortete sie, »das tu.«
Dann legte sie vor mir auf.
9.
Wahrscheinlich hatte das mit Mutter schon damals angefangen, bei Vaters Beerdigung. Pillen, morgens drei, mittags zwei, abends vier, etwas Sedierendes, zum Einschlafen, zum Durchschlafen, zum Besserschlafen, vielleicht zum Aufwachen. Gegen die Angst vor dem Versagen, dem Verzagen, dem Sterben, weil alle in dieser Familie so jung starben, sterben, stürben. Selbstmedikation gegen den Tod.