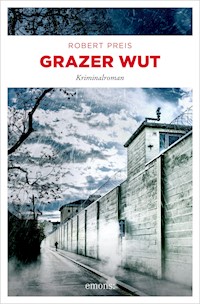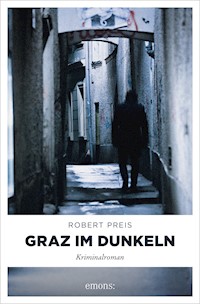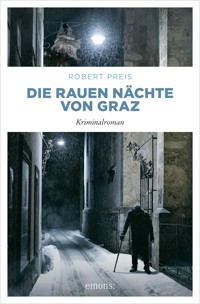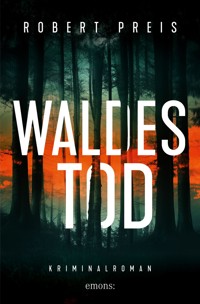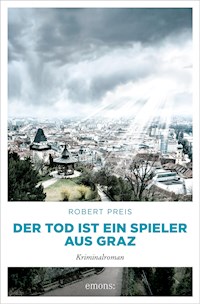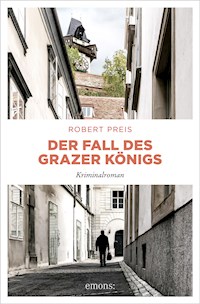Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Armin Trost
- Sprache: Deutsch
Showdown beim Aufsteirern Der Tod eines bekannten Volksmusikers erschüttert Österreich. Als ein zweiter Künstler stirbt, verfällt das Land in Schockstarre. Die Polizei kommt nicht voran, und Chefermittler Armin Trost ist untergetaucht. Dafür treiben nun seltsam finstere Kerle ihr Unwesen. Sogar vom Teufel selbst ist die Rede. Und dabei steht doch das größte Brauchtumsfest im ganzen Land vor der Tür: das "Aufsteirern".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 388
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Robert Preis wurde 1972 in Graz geboren und ist dort aufgewachsen. Nach dem Publizistik- und Ethnologiestudium in Wien lebt er heute mit seiner Familie wieder in der Nähe seiner Heimatstadt. Er ist Redakteur einer Tageszeitung und Autor zahlreicher Sachbücher und Romane.
www.robertpreis.com
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
Lust auf mehr? Laden Sie sich die »LChoice«-App runter, scannen Sie den QR-Code und bestellen Sie weitere Bücher direkt in Ihrer Buchhandlung.
© 2019 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv und Karte: Niki Schreinlechner,
www.nikischreinlechner.at
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Susanne Bartel
eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-556-5
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Einem Bundesland, das in der Lage ist, ein solches Verbum hervorzubringen, mangelt es garantiert nicht an Selbstbewusstsein.
Tageszeitung »Der Standard« über das Wortkonstrukt »Aufsteirern«
All of a sudden, there shined a shiny demon in the middle of the road.
Aus dem Song »Tribute« von Tenacious D
Prolog
»Sie hören die Mittagsglocken der katholischen Filialkirche von St. Ilgen.« Ö-Regional, »Mittagsjournal«
1986, Hochschwabgebiet
Das sanfte Rauschen der Kiefern im Wind wird begleitet von einem Grollen und Poltern im Hintergrund. Lawinen, die vom Ebenstein, Brandstein oder Höllkogel abgehen und die Luft zum Vibrieren bringen. Doch auch ein unheimliches Rasseln und Scheppern mischt sich darunter. Ein Geräusch, das nicht hierhergehört. Selbst am helllichten Vormittag kann es einem angst und bange werden. Auf den Felsen, die da und dort aus dem Schnee emporragen wie bleiche Knochen, schimmert immer noch der Morgentau.
»Host eam scho gsehn?«
»Na. Aber es kann nimmer lang dauern.«
Die beiden Burschen hocken in einer tiefen Schneemulde und werfen vorsichtige Blicke in das in einem weißen Zauber eingebettete Knochenmeer.
»Host eigentlich gor ka Angst?«
»Waß net. Du vielleicht?«
»Waß net.«
In diesem Moment taucht ein Schatten vor ihnen auf, es raschelt im Unterholz, ächzt im tiefen Schnee, die beiden Buben kreischen auf und laufen los. Sie rennen zurück in die winzige Blockhütte, die am Rand des Waldes als Unterstand für verirrte Wanderer errichtet wurde und wie eine Rettungsburg am Ende der Welt anmutet. Sie reißen die schief in den Angeln hängende Holztür auf, knallen sie hinter sich zu und hocken sich direkt dahinter auf den Boden.
Ihre Augen müssen sich erst an das diffuse Zwielicht im Inneren der Hütte gewöhnen. Spärliches Licht fällt durch die Spalten, die sich zwischen den Brettern, aus denen die Wände bestehen, im Lauf der Jahre aufgetan haben. Das Grollen und Poltern der Lawinen verstummt, und auch das Rasseln und Scheppern endet abrupt.
»Oida«, schnauft der Kleinere der beiden atemlos, obwohl sie keine zehn, elf Schritte durch den Schnee gelaufen sind. »Mir ham an Fuchtler gsehn.«
»Oida, jo. So groß war er.« Der andere hebt seinen Arm waagerecht bis auf Schulterhöhe.
»Na ja. A bisserl klana vielleicht.«
»Es seids so deppert. Jetzt herts auf und kummts her do. Mir miassn spüln.«
Jemand flüstert: »Fuchtelmänner gibt’s gor kane.« Und vom Kamin her ist ein Kichern zu vernehmen.
Minuten später knistert das Feuer, und sein Widerschein tanzt auf den vier jugendlichen Gesichtern. Der eine Bursche beginnt, mit dem Fuß auf den Boden zu stampfen. »Der Teifl«, schreit er, »der Teifl is do!« Dann entlockt er seiner Harmonika einen wehmütigen Klang.
»Jo«, ruft nun ein zweiter, »der Teifl is do!« Und seine Gitarre heult ins Dämmerlicht.
Dann folgt die Klarinette. Und plötzlich setzt wieder das Rasseln und Scheppern ein, das jetzt alle anderen Geräusche überlagert und bis weit hinaus ins Meer der Felsknochen zu hören ist. Zunächst lässt es die Instrumente der anderen verstummen, ehe es selbst zurückhaltender wird, bis es nur noch als Wispern in der Hütte zu hören ist.
»Jo, der Teifl is do. Aber den Teifl gibt’s gor net«, raunen die vier, und das Gesicht dieser letzten, so scheppernden Apparatur – einer Stange mit Schellen und Trommeln dran – starrt die Musiker an. Einen nach dem anderen. Die Fratze eines Teufels zeigt am Ende eines langen Stabs schamlos ihre Zähne, am Ende eines merkwürdigen Instruments, das man hierzulande Teufelsgeige nennt.
Und so spielen die Burschen noch den ganzen Abend. Bis in die Nacht hinein. Von außen ist bald nur noch der Schein des Feuers durch die Bretterritzen zu sehen. Rundherum bloß Wald. Und Berg. Und Schnee auf dem Gestein. Und Finsternis. Und ein Schatten, der im Mondlicht die Hütte umkreist.
Und drinnen das vermeintlich ausgelassene Lachen der Buben. Ein Lachen, das ihrer Angst spottet.
Lemberg
Quetschn:Steirische Harmonika – sie hat weniger Tonarten als das Akkordeon, dafür klingt sie kräftiger, besonders im Bass.
2019, auf der Teichalm
Noch zwei Wochen bis zum Aufsteirern in Graz, dem größten Volkskulturfest im ganzen Land
1 Wenn der Teufel tanzt, dröhnen die wilden Schläge seiner Hufe auf den Brettern des Tanzbodens. Jungfrauen wirbeln herum und schlagen leblos gegen die Wände.
Die Lichtbahnen der Scheinwerfer schneiden durch dampfende Luft und offenbaren die Leichen, die sich an den Rändern der Schatten sammeln, während ein irrwitziges Lachen alle Musik übertönt.
Wenn der Teufel tanzt, dann am liebsten im Paradies. Dort findet er sein bestes Publikum: Entsetzen. Panik. Und die nackte Angst.
Wir halten deshalb fest: Es ist nie alles so, wie es scheint. Manchmal wird von einem Augenblick auf den anderen das wunderbarste Idyll zur reinsten Hölle. Das kann schnell gehen. Als hätte jemand einen Knopf gedrückt.
Oder einen Abzug.
Auf den ersten Blick zeigen sich das Land und der Himmel über der Hölle von ihrer besten Seite. Im Wiesenmeer, das über den Hügeln der Teichalm wie eine Tuchent liegt, wiegen sich die gelb-weißen kleinen Blüten der Kamille sanft im Wind. Keine starken Böen, nur ein willkommenes Lüfterl weht unter dem wolkenlosen Himmel. Ende August.
Doch nicht nur das Gelb-Weiß der Kamille wendet sich der Sonne zu, dazwischen sprenkeln auch Grüppchen violetten Wiesensalbeis und hell schimmernde Schafgarben das Idyll. Schmetterlinge flattern, Libellen brummen im Tiefflug, Grillen zirpen unsichtbar und dazu der Duft nach frischen Kuhfladen.
Der leichte Luftzug macht den Sommer nicht mehr ganz so schwerfällig und träge, wenngleich der Wind selbst hier am Berg nicht richtig auffrischt. Dafür hängt die Sonne schon etwas tiefer, lässt die Farben kräftiger erscheinen.
Dann gesellt sich ein Geräusch hinzu. Anfangs ist der Klangteppich nahezu undefinierbar, wird aber bald bedrohlich lauter.
Nach und nach sind Einzelheiten auszumachen. Einmal scheppert es, dann ein Kollern wie von Kieselsteinen. Jemand hustet. Ja, es klingt, als näherte sich eine gewaltige Armee.
Der zweite Blick führt über die Wiese hinweg und lässt die Silhouetten erkennen. Immer mehr tauchen zwischen den Halmen und Blättern und Stängeln auf und lassen den Boden unter sich beben. Ein weiteres Geräusch setzt ein, eines, das so gar nicht in die Gegenwart passt. Denn wer auf einer Blumenwiese abseits von Siedlungen und temporären Live-Konzert-Zeltlagern sitzt, hört in der Regel nur selten solche Töne. Man kennt sie aus Videoclips oder aus Erzählungen von Leuten, die wiederum Leute kennen, die bei Konzerten dabei waren.
Jetzt setzt das rhythmische Zupfen einer Gitarre ein und wird überlagert von der verspielten Melodie der Ziehharmonika und untermalt vom bassigen, massigen Posaunensound.
Das Lied kennt jeder im Land, und schon nach den ersten Takten ist die Wiese nur noch Kulisse. Füße stampfen über die Erde, als wär sie bloß ein Tanzboden, und schwitzige Hände klatschen willenlos, aber euphorisch, als stünden die dazugehörigen Körper unter dem Einfluss einer mystischen Konditionierung.
Es sind die drei Gestalten an der Spitze der Menge, die musizieren, und bald wird auch ersichtlich, dass ihnen ein regelrechter Menschenauflauf folgt. Ein ganzes Heer an fröhlichen, aufgeregten, rotbackigen Männern, Frauen, Kindern, das im Takt der Musik hinterdreinstolpert, als spielte ihm Till Eulenspiegel den Verstand aus dem Kopf. Aufgebrezelte Figuren, die in ihrer Farbenpracht und trachtigen Einfalt mit der Realität der Gegenwart nichts mehr gemein haben und stattdessen wie Statisten der steirischen Variante einer Fruchtsaft-Werbung aussehen. Oh, happy day. Alle sind glücklich. Fröhlich. Zurechtgemacht. Gekampelt und frisiert, wie man hierzulande sagt.
Im Hintergrund die herrlichen Berggipfel der Umgebung. Hochlantsch. Sommeralm. Brandlucken. Sehen aus wie aufgestellte Kartonwände, auf die Fotos einer Traumlandschaft aufkaschiert wurden. So unwirklich.
Rund um die drei Musikanten, die fesch mit schwarzen Schnallenschuhen, grünen Socken, schwarzen Knickerbockern, weißen Hemden und roten Gilets ausstaffiert sind, drängen sich Fotografen und Kameraleute. Die Musiker lachen frisch-fröhlich musizierend und spazieren vor den Objektiven auf und ab, und just, als die ihnen folgende Schar die Worte fast schon selbst herausbrüllen will, weil ihr Herz es so verlangt, beginnen die drei zu singen. Wobei, eigentlich nur zwei von ihnen, denn der mit der Posaune kann ja nicht.
Weiße Zähne, hochgezogene Brauen, Krähenfüße an den Augenwinkeln und dieses ganz bestimmte Neigen des Kopfes, das zeigen soll, dass etwas aus tiefstem Herzen kommt. Kernige Männer im besten Alter, die genau wissen, was sie tun. Und mit jedem Akkord, jedem Refrain, jedem Zunicken und Zuzwinkern locken sie ihre Zuhörer tiefer hinein in ihr Reich. Die Lemminge folgen auf Schritt und Tritt. Glauben ihnen jedes Wort. Kaufen ihnen alles ab. Sind betört und verkauft.
Fanwanderung, so heißt das, wenn die Tausendschaft, die auch aus mehr als tausend Leuten bestehen kann, hinter den drei Musikanten – die sich wie im gleichnamigen Märchen von Ludwig Bechstein auch tatsächlich »Die drei Musikanten« nennen – über die Alm spaziert und dabei deren Lieder mitgrölt, die zuweilen so populär sind, dass sie sogar in Fußballstadien gespielt werden. Volksmusik eben. Und das Volk schunkelt mit.
Am Ziel der Fanwanderung wartet ein weißes Zelt im Blütenmeer. Zu Würsteln und Bier wird dort aufgespielt, und Dutzende Helfer verkaufen T-Shirts, CDs – sogar noch Kassetten für die greisen Ford-Escort- und Opel-Ascona-Fahrer unter den Fans –, Bieröffner und allerhand weiteren Schnickschnack, der genauso zum Repertoire der weit über die Grenzen hinaus bekannten Volksmusikgruppe gehört wie die Lieder, die sie zwischendurch auch noch spielt.
Doch noch sind sie nicht im Zelt. Marschieren gerade über die Wiese. In einer Eintracht, deren Choreografie stutzig machen sollte. Niemand schwitzt, keiner stolpert. Alles wirkt präzise einstudiert, weshalb man sich die Gesichter genauer ansehen sollte, vielleicht durch eine verzerrende Linse, damit der Blick auch auf Einzelheiten gelenkt wird und nicht nur auf das scheinbar perfekte Ganze. Denn wer genau hinsieht, der erkennt die Unebenheiten. Die Warzen auf den Nasenflügeln. Die rot geränderten Augen. Die Essensreste zwischen den Zähnen. Die dicken, aus Muttermalen wuchernden Haare. Der aus dem viel zu engen Oberteil hervorquellende rot gefleckte Busen, die weichen Hautlappen unter dem Kinn der Altwerdenden, die abgekauten Fingernägel mit ihren schwarzen Schmutzrändern, die Kernölflecken auf Blusen, ein aufgesprungener Hemdknopf über dem Fettring der Körpermitte, wie Pudding schwabbelnde Trizepse an kurzen Weibern. Dann nähert sich ein verzerrtes Mannsbild, dessen Vogelgesicht den Mund aufreißt und lacht, und man sieht hinein und kann auch die hinterste Amalgamfüllung erkennen.
Aus der Nähe sieht das Wandervolk nicht mehr kameratauglich friedlich und fröhlich aus. Eher wie die stampfende, brüllende Vorhut eines Heers der Unterwelt.
Die unschuldige Wiese, das Paradies, bebt und erzittert unter ihr. Die Kamille, die gegen Magenschmerzen hilft. Der Salbei mit seinem ätherischen Öl. Die Schafgarbe, der man nachsagt, Achilles geheilt zu haben, weshalb Pflanzenmorphologen und Botaniker sie Achillea millefolium nennen.
Aber selbst wenn es noch Schamanen oder Kräuterhexen in der Nähe gäbe, die mit dem Wissen der Altvorderen um die heilenden Pflanzenkräfte etwas anzufangen wüssten, gegen das, was nun kommt, ist kein Kraut gewachsen. Nicht einmal in der Steiermark.
Das Geräusch, das Ursprungsgeräusch – ein kalter Knall – geht im musikalischen Spätsommertag unter. Doch das Geschoss, ein metallener Fremdkörper, fliegt über die Teichalmwiese hinweg wie ein Alptraum. Mit freiem Auge nicht sichtbar, aber eine vage Erinnerung zurücklassend. Und so dringt das Projektil nicht nur in das Idyll ein und zerstört die Wald- und Wiesenromantik, es durchschlägt auch den Schädel des Harmonikaspielers.
Als es am Hinterkopf austritt, lässt es die Schädeldecke platzen, kleine graue Weichteile gehen vermengt mit blutroten Partikeln als feiner Sprühregen auf die Fangemeinde nieder.
Der Harmonikaspieler hört schlagartig auf zu singen. Nur ein irritierendes, lang gezogenes »Iii« vibriert noch in seinen Stimmbändern. An seiner Schläfe tritt eine Ader hervor. Der rechte Rand seiner Oberlippe zittert, als zöge jemand an einem unsichtbaren Barthaar.
Keinen Schritt macht er mehr. Und spielen kann er auch nicht. Einen Moment sieht er wie die groteske Version einer Puppe aus, deren Batterien der Saft ausgegangen ist. Das »Iii« verstummt, sein Kiefer klappt nach unten. Die Lider flattern, die Augäpfel rollen, als hätte sie jemand aus der Verankerung gerissen. Schließlich geben die Knie nach, und der schwere Körper sackt über seinem Instrument zusammen. Und schweigt. Nur die Finger seiner rechten Hand zittern noch. Als wollten sie partout das Lied zu Ende spielen.
Fast alle bleiben stehen.
Erst ein paar rhythmische Töne später erkennt der Posaunist, dass etwas nicht stimmen kann. Er ist als Einziger weitergegangen, da er sich in dem Moment, als das Projektil seinen Kameraden traf, weggedreht hat. Jetzt steht er irritiert ein paar Meter abseits und wendet sich wieder um. Als er den Freund am Boden liegen sieht, werden seine schiefen Töne der ausklingenden Melodie zur seltsamen musikalischen Untermalung des sich ausbreitenden Entsetzens.
Sogar die Grillen zirpen jetzt nicht mehr. Und die Schmetterlinge sind auch fort. Ganz entgegen allen Legenden haben sie heute kein Glück gebracht.
»Wos?«, fragt der Gitarrenspieler, erwartet aber freilich keine Antwort.
Der Posaunist ist noch geistreicher und ruft: »Oida!«
Aber natürlich kann es ihnen niemand verübeln, sich in diesem Moment des Schocks nicht eloquent auszudrücken. Soeben haben sie noch auf ihrer eigenen Fanwanderung musiziert. Vor mehr als tausend Menschen. Vor Kameras, Handys und Fotoapparaten. Sind über eine idyllische Wiese auf der Teichalm marschiert. Mitten im Sommer. Perfekte Bilder. Große Gefühle. Ein Karrierehöhepunkt, der bald im ORF ausgestrahlt werden sollte. Vielleicht sogar im ZDF. Und dann das. Der Harmonikaspieler ist tot. Im Idyll. Jetzt bekommt er auch einen Namen: Sepp Tiefenbrunner ist tot. Woran kein Zweifel besteht, denn ihm fehlt der halbe Hinterkopf. Hinter ihm kniet ein Mann am Boden, kichert und starrt verstört auf das Blut an seinen Händen.
Erst mit Verzögerung setzen die hysterischen Schreie der Fans ein. Einige rennen zu Tiefenbrunner hin, schrecken dann aber zurück aufgrund der Tatsache, dass um ihn herum eine Blutlache immer größer wird. Andere laufen davon, ohne zu wissen, wohin. Sternförmig rennen sie auseinander. Aber die meisten ducken sich, hocken sich hinter Steine oder drücken sich in Mulden oder ins hohe Wiesengras. Denn schnell wird zur Erkenntnis, dass Tiefenbrunner erschossen wurde. Und vielleicht schießt der Schütze ja weiter. Immer weiter. Wie bei den Terroranschlägen im Fernsehen, wo Attentäter wild um sich feuernd durch Straßen rennen. Nur dass diesmal eben die Alm der Schauplatz ist. Das Idyll. Die Steiermark, wo alles Böse woanders passiert.
Was niemandem in dem Tumult auffällt, ist die Silhouette in dem kleinen Wäldchen hinter dem Teichalmsee, gute vier-, fünfhundert Meter entfernt. Wie sie ihr Gewehr absetzt, es in der Tasche verschwinden lässt, diese schultert und sich zwischen Gebüsch und Baumschatten aus dem Blickfeld entfernt.
Indes legt sich ein Jammern über die Alm, ein Teppich aus Stöhnen und Weinen und Klagen, wie er an diesem Bilderbuchtag in dieser Bilderbuchgegend nicht unpassender sein könnte, breitet sich aus. Das Lieblingslied des Teufels, der nun zufrieden davonhumpelt. Für heute hat er genug getanzt. Aber er hat Gefallen daran gefunden.
2 Die Nachrichten sollten beruhigen und waren doch beängstigend. Immer wenn das Handy vibrierte, setzte ihr Herzschlag kurz aus. Vor Aufregung vor dem, was kommen würde. Und jedes Mal wurde sie mit einer kryptischen Nachricht überrascht.
Einmal lautete sie: »Macht euch keine Sorgen. Die Welt sieht durch mich hindurch.« Dann wieder: »Ich halte mich bedeckt. Sicher ist sicher.«
Die Nachricht, die dem Fass den Boden ausschlug, wie man bei ihr zu Hause gerne sagt, lautete: »Ich sehe euch. Alles.« Da wäre sie am liebsten auf die Straße gerannt und hätte seinen Namen gebrüllt. Lauthals »Armin Trost« zu schreien hätte sie befreit. Und: »Komm heraus!« Und: »Du Arsch!«
Aber so ist sie nicht. Ihre Emotionen der Welt zu offenbaren entspricht nicht Annette Lembergs Naturell.
Außerdem hat sie Mitleid. Sie weiß, wie sehr Trost leidet. Seit dieser Furor über sie alle hinweggezogen ist, ist nichts mehr wie früher. Der Leiter der Mordgruppe zog sich zurück, war anfangs wochenlang vollständig von der Bildfläche verschwunden und tauchte erst in Form von sporadischen Nachrichten wieder auf.
Niemand in der Direktion rechnete noch ernsthaft mit seiner Rückkehr, man ging davon aus, Trost wäre ein gebrochener Mann. Umso angespannter ist die Atmosphäre jetzt, da er seit Wochen wie eine graue Eminenz im Hintergrund agiert. Wie ein Späher, den nie jemand zu Gesicht bekommt. Ein Schatten, der verschwunden ist, sobald man in seine Richtung sieht. Wie ein Gerücht, das sich dann und wann in Erinnerung ruft.
Selbst Lemberg sieht mittlerweile ein, dass der Versuch, mit Trost Kontakt aufzunehmen, sinnlos ist. Er antwortet nicht, schreibt nie zurück. Eine Einbahnstraße. Kommunikation, die nur in eine Richtung angedacht ist. Offenbar will er die Kontrolle behalten. Niemand darf ihm zu nahe kommen, so lautet die unausgesprochene Vereinbarung.
Eine völlig absurde Situation, denn wie soll das funktionieren? Wie soll ein Chefinspektor, der Leiter der Mordgruppe ist, untertauchen? Da sein und doch nicht. Wie soll das gehen?
Natürlich hat niemand Zweifel an seinen herausragenden Fähigkeiten als Kriminalist, die ihm in der Vergangenheit schon so viele Ehrbezeugungen eingebracht haben. Immer wieder gab es Stimmen in den Chefetagen, die ihn auf der Karriereleiter weiter nach oben reichen wollten, hinaufhieven in Sphären, wo er nur noch Reden für wichtige Anlässe verfasst hätte und mit farbigen Epauletten herumgerannt wäre. Aber das wollte Trost nie. Er wollte jagen, nach Tätern, nach Hinweisen und Andeutungen suchen. Das und die Verhöre und Beschattungen übten einen Reiz auf ihn aus, dem er nicht widerstehen konnte. Bis zu diesem Tag vor ein paar Monaten. Heute sind sich alle einig darin, dass nicht einmal ein Mann wie er ein solches Erlebnis vergessen und einfach weitermachen kann.
Er hat alles verloren. Seine gesamte Familie. Während er in diesem merkwürdigen Dorf im Tal der Geister gefangen gehalten wurde, massakrierten sie seine drei Kinder, die Frau, anschließend noch den Hund. Er kam zu spät. Zündete sein Baumhaus an. Fuhr davon. Mit grimmigem Zorn. Kam nicht darüber hinweg. Niemand kommt über so etwas hinweg. Dass er jetzt untergetaucht ist und von der Welt nichts wissen will, verstehen alle.
Nur Lemberg nicht.
Dass ihre Reaktion kindisch und trotzig und egoistisch ist, das weiß sie, das wirft sie sich auch selbst vor. Aber so läuft das doch normalerweise nicht. Wenn man seine komplette Familie verliert, lässt man normalerweise das bisherige Leben hinter sich und versucht einen Neuanfang oder ertränkt seine Trauer im Alkohol. Oder man stürzt sich in die Arbeit, lädt sich Alltagsproblemchen auf, Termine und Berge von Dingen, die einen ablenken. Aber nie und nimmer ist man beides, weg und hier. Da und dort. Irgendetwas daran ist doch faul.
Aber natürlich ist »normalerweise« ein Wort, das in einer Situation wie dieser unangebrachter nicht sein könnte. Denn was ist schon normal daran, dass einem die Familie genommen wurde?
Mitunter beschäftigt sie der Gedanke daran, wie Trost sich fühlen muss, so sehr, dass sie ganz bei ihm ist und ihr Körper zu einer reg- und leblosen Hülle wird.
Trotz des Schmerzes, den sie zu verstehen versucht, ist sie allerdings auch hellhörig für ihre Umgebung. Balthasar Gierack, der Leiter des LKA, des Landeskriminalamtes Steiermark, kommt ihr zum Beispiel wirklich seltsam vor. Anfangs schien er zwar ebenso besorgt wie sie, was Trosts Situation betraf, jetzt aber wirkt er geradezu glücklich über den Ist-Zustand. Natürlich, jetzt hat er freie Bahn, ist den extravaganten, introvertierten Inspektor los. Jenen Mann im Team, der ihm regelmäßig die Show gestohlen hat. Etwas Besseres als ein gebrochener, unbrauchbarer Armin Trost hätte Gierack gar nicht passieren können.
Sie schüttelt den Kopf. Widerlich, wie leicht es Männern manchmal fällt. Wie nonchalant sie über Schicksalsschläge eines Kollegen hinweggehen, als würden sie als siegreiche Feldherren über die Opfer einer Schlacht steigen. Wenn es um die eigene Karriere geht, scheinen solche Tragödien für sie nichts weiter als Randnotizen zu sein.
Und was ist mit ihnen? Trosts Team? Mit Lemberg und dem Grafen? Denkt denn keiner daran, wie das mit ihnen weitergehen soll? Nahezu täglich verspricht Gierack, Abhilfe zu schaffen, zwei, drei qualifizierte Leute seien in Ausbildung, doch mit jeder Woche werden die Aktenberge auf ihren Schreibtischen höher.
Und das Gerede über Trost? Die Leute reden doch, Herrgott noch mal. Stellen Fragen. Was soll man ihnen nur sagen? »Ja, also, mein Kollege, der ist mal kurz untergetaucht …«
Gut, irgendwann werden auch die Fragen seltener und das Dunkel der Geschichte langsam zur Normalität. Wird nicht mehr angesprochen. Stillschweigend hingenommen.
Aber der Gipfel des Vergessens ist, dass auch Trosts Nachrichten seltener werden. »Bin weg«, so lautete die vorletzte. Sekunden später vibrierte ihr Handy neuerlich, und sie las seine bislang letzte SMS: »Aber doch immer da.« Das war vor einigen Tagen. Und Annette Lemberg ärgert sich immer noch darüber.
3 »Was macht denn der Hubschrauber da? Schafft uns sofort das Ding vom Hals.«
Das hat er noch nie gesehen. Journalisten im Hubschrauber, kaum dass die Absperrbänder gespannt sind. Das kennt er bislang nur aus Amerika, wo sie Verfolgungsjagden live im Fernsehen senden.
Die lauten Rotorblätter lenken Reinhard Maria Hinterher ab, der von allen wegen seines peniblen Äußeren nur der »Graf« genannt wird. Er tastet seine Hosentaschen nach dem Notizblock ab, blickt schließlich auf und bemerkt, dass er ihn schon in der Hand hält. Dabei rutscht sein erdbraunes Sakko zu Boden, das er sich vorher über den Unterarm geworfen hat. Sein Blick fällt auf seine frisch gewienerten Lederschuhe, und er entdeckt Wiesenspuren an ihnen, kleine Spritzer, die einen seiner Ansicht nach in der Stadt sofort ungepflegt erscheinen lassen. Er spürt, wie der vom Hubschrauber erzeugte Wind seine Frisur durcheinanderbringt, und fuchtelt, seinen Notizblock haltend, mit den Armen durch die Luft.
»Haut ab! Haut endlich ab!«
Er kann kaum noch einen vernünftigen Gedanken fassen und macht dann eine Entdeckung, die ihn endgültig die Fassung verlieren lässt. Zwischen den uniformierten Beamten, den Feuerwehrleuten und Rettungskräften, den Kriseninterventionsteams, den Spurensicherern der Tatortgruppe und den letzten Schaulustigen steht doch tatsächlich LKA-Chef Balthasar Gierack, die Hände in die Hüften gestemmt und so breitbeinig, als würde er ein Schlachtschiff befehligen. Oder eine Galeere. Jedenfalls bestens sichtbar für die Kameraleute, die auch sogleich auf ihn zusteuern.
Wie hat er es in so kurzer Zeit nur hierhergeschafft? Gierack kämpft nie an der Front, isst vielmehr so oft mit wichtigen Leuten zu Mittag, dass der Stadt die wichtigen Leute und das Essen eigentlich bald ausgehen müssten. Oder ist in Besprechungen. Oder in Linz. Ja, in Linz, weil er von dort stammt und ihn von dort auch seine Frau ständig anruft, um ihm wütend klarzumachen, dass sie nicht jedes Wochenende nach Graz fahren will, weswegen er selbst häufig nach Oberösterreich pendelt. Auch so eine absurde Situation. Aber wenn etwas passiert, taucht Balthasar Gierack ganz plötzlich auf, als stünde sein Wagen stets mit laufendem Motor vor der Direktion. Gierack ist allzeit bereit für die erste Reihe. Für die Kameras.
»Was für ein Affe«, schimpft der Graf für Gierack unhörbar und wendet sich angewidert ab.
»Also bitte, du hast gerade eben aber nicht den Chef gemeint, oder?«
Annette Lemberg hockt auf der Wiese und betrachtet die Leiche, die so auf der Harmonika liegt, als würde sie diese liebevoll umarmen.
Wer unvorbereitet auf seine Kollegin trifft, denkt der Graf, etwa wenn er um die Ecke geht und sie plötzlich vor sich stehen sieht, der ist zu bedauern. Denn zweifelsohne, denkt er weiter, gibt es niemanden, der sie in einer solchen Situation nicht anstarren würde. Nicht einmal der selbstbewussteste Mann hätte den passenden Spruch auf den Lippen. Er würde nur stottern oder dämlich grinsen.
Aber der Graf ist nicht unvorbereitet. Er sieht sie jeden Tag. Was die Sache nicht leichter macht. Etwa in Momenten wie diesen, wenn sie ihn kaum beachtet. Die Frau mit den Audrey-Hepburn-Augen und dem zu einem unschuldigen Pferdeschwanz gebundenen Haar, der ihren Hals so zur Geltung bringt, dass nicht nur Vampire schwach werden könnten, richtet ihre Aufmerksamkeit ausschließlich auf das Musikinstrument.
Es handelt sich um eine Steirische Knopferlharmonika, eine Quetschn, darüber hat sie zuvor einer der Kollegen von der Spurensicherung unterrichtet. Im Unterschied zu einem herkömmlichen Akkordeon verfügt sie über Knöpfe statt Tasten und ist ein diatonisches, also ein wechseltöniges Instrument, das auf Zug und Druck unterschiedlich klingt. Und nicht nur das. Diese Luxusvariante ist mit hirschledernen, extrabreiten Schulterriemen ausgestattet, in denen die Arme der Leiche immer noch stecken. Die Beschläge der Harmonika sind aus echtem Silber, die Knöpfe aus Elfenbein und die Furniere aus Olivenholz sowie indischem und steirischem Apfel. »Außerdem hat Tiefenbrunner seinen Namen eingravieren lassen, was den Wert des Instruments, vor allem jetzt, wo er tot ist, ins Unermessliche steigen lässt«, hat der Kollege gemutmaßt und die Harmonika auf mindestens dreißig-, vierzigtausend Euro geschätzt, »wenn nicht mehr«.
Über das Instrument hat er, so wie Lemberg jetzt, fast die Leiche vergessen, wenngleich die auch ihren Reiz hat. Schließlich handelt es sich um einen nicht unbekannten Volksmusiker, Sepp Tiefenbrunner, neunundvierzig Jahre alt und – typisch steirisch – so gar nicht perfekt aussehend. Schiefe Zähne, gebrochene Nase, Augen, die zu weit aus den Höhlen ragen, und ein übergroßer Kehlkopf. Was aber auch die, die ihn nicht persönlich kannten, wissen: Der Tiefenbrunner Sepp war einer von den ganz Netten. »A klasser Bursch.« Auch typisch steirisch halt.
Mit diesem Wissen ausgestattet untersucht Lemberg nun ihrerseits den Tatort nach Spuren, die sie weiterbringen können. Was schwierig genug ist, denn von ihr scheint eine schnelle Aufklärung erwartet zu werden.
Seit sie eingetroffen sind, ruhen die erwartungsvollen Blicke der Fanwanderer auf ihr, die noch immer zu Dutzenden ringsum stehen. Und weil sie Augen und Ohren offen hält, hört sie auch die Stimmen: »Wer war’s? Habts ihn schon, den Täter, den Oarsch?«
Die Verantwortung dafür, den Mörder zu finden, ruht auf ihren schmalen Schultern. Ein übellauniger Graf ist also das Letzte, was sie in diesem Moment gebrauchen kann.
»Du weißt doch, wie der Gierack ist«, versucht sie ihn zu beruhigen. »Der braucht die Aufmerksamkeit eben. Lass ihn einfach und konzentrier dich lieber auf deine Arbeit.« Auch sie ist mürrisch, als sie sich das Einschussloch im Kopf des Musikers ansieht. Im Hintergrund bauen Polizisten einen Paravent auf, um die Leiche vor neugierigen Blicken zu schützen. Wie die Bühnenarbeiter eines Theaters. Wurde auch Zeit, denkt sie sich.
Nachdem Lemberg Fotos mit dem Handy gemacht hat, sieht sie am Grafen, an Gierack, den Einsatzkräften, Journalisten und Schaulustigen vorbei den Hügel hinauf. »Lass uns lieber schauen, wo der Schütze gestanden haben muss.«
Der Graf folgt ihr schweigend, scheint noch immer ein wenig beleidigt, weil sie ihn zuvor gemaßregelt hat.
Zwei Beamte begleiten die beiden, während sie durch die Leute und über die Blumenwiese stapfen. Mittlerweile ist es schwül geworden, und am Horizont drohen bereits finstere Wolkentürme. Lemberg blickt sich so beiläufig wie möglich um, versucht, kein Detail zu übersehen. Dazu die Unsicherheit: Beobachtet sie, oder wird sie vom Täter beobachtet?
»Kaum ist es einmal richtig warm, kracht’s auch schon wieder«, hört sie den Grafen plötzlich sagen, und ihre Intuition verkriecht sich.
Lemberg schnalzt mit der Zunge. »Möchtest du jetzt allen Ernstes über das Wetter reden?«
»Warum denn nicht? Hat da jemand vielleicht schlechte Laune?«
»Ich versuche bloß zu arbeiten.« Und nach einer Weile: »Du bist ja auch nicht gerade bester Stimmung.«
Schweigend gehen sie weiter und halten die beiden Polizisten, die sie begleiten, auf Distanz. Beim Gehen streift der Graf mit seinem Oberarm den von Lemberg, was diese mit einem weiteren Zungenschnalzen quittiert.
»Was ist jetzt schon wieder?«, fragt er.
»Nichts. Ich mag das nur nicht. Es ist ohnehin schon so heiß, und ich muss nachdenken. Kannst du nicht einfach geradeaus gehen?«
»Soll ich Abstand halten? Ich meine, generell?« Der Graf bleibt stehen. »Ist es das, was du willst?«
Lemberg dreht sich um. Sichtlich genervt. »Reini …«
»Nein, raus damit. Soll ich dich in Ruhe lassen? Mich vielleicht versetzen lassen? Ist es das?«
Sie wendet sich den Beamten zu, die ebenfalls stehen geblieben sind und ihnen aufmerksam zuhören. »Ich weiß, das ist jetzt superinteressant, aber könntet ihr uns trotzdem mal einen Augenblick allein lassen? Wir kommen schon ohne euch zurecht. Der Täter wartet bestimmt nicht auf uns.« Sie dreht sich wieder zum Grafen um. »Und du bekommst von mir auch keine Antwort.«
Beide sehen sich schweigend an und warten, bis sich die Polizisten entfernt haben.
»Ich weiß eh, dass es wegen ihm ist«, nimmt der Graf nach einer Weile wieder den Faden auf. »Aber es ist nun einmal so, wie es ist. Armin Trost ist nicht da. Keiner weiß, wann er wieder auftauchen wird. Und ob überhaupt.«
»Spinnst du? Was fängst du jetzt damit an?«
»Aber ich hab doch recht.«
»Womit denn, hm? Und es geht dich im Übrigen gar nichts an, ob mich das quält oder nicht. Wir sind schließlich nicht verheiratet. Wir sind nicht einmal …«
Pause. Die Miene des Grafen verfinstert sich.
»Was?«
»Nichts.«
Er blickt auf seine Schuhspitzen, wendet sich ab und geht ein paar Schritte weiter. »Kommst du jetzt, oder was?«
»Reini …«
»Hör bloß auf.«
Der Rest ist Schweigen, bis der Graf in einen Kuhfladen steigt und die Contenance verliert. Er schimpft, ballt die Hände zu Fäusten, blickt zum Himmel, als säße dort jemand, der ihm – ausgerechnet ihm – Böses will. Und während er unter Flüchen den Schuh an der trockenen Wiese abwischt, die Finger dabei abwehrend gespreizt, als könnte sich die Sohle selbstständig machen und ihn jeden Moment attackieren, dreht Lemberg sich im Kreis.
Auf der Anhöhe ist auf den ersten Blick nichts Verdächtiges auszumachen, und weil sie kein Comanche ist, versucht sie gar nicht erst, auf abgeknickte Äste oder Fußabdrücke zu achten, was auf dem Trampelpfad der Grazer Erholungslustigen ohnehin sinnlos gewesen wäre.
»Wozu sind wir eigentlich hierhergelatscht?«, schimpft der Graf jetzt. »Du hast doch nicht im Ernst geglaubt, dass wir hier indianermäßig eine Spur finden. Die Kollegen von der Tatortgruppe konnten die Entfernung, von der aus der Täter geschossen haben muss, auf gerade einmal drei- bis achthundert Meter eingrenzen. Wenn man dann noch den möglichen Einschusswinkel bedenkt, weil man ja nur mehr schwer sagen kann, wie genau der Tiefenbrunner gestanden ist, reden wir von einer Fläche, so groß wie ein paar Fußballfelder, wo der Täter gestanden haben könnte. Hier sind Tausende Abdrücke von Weideviechern und Wanderern, niemand hat in dem Chaos den Kerl gesehen, und nirgendwo gibt es Kameras. Verzeih den rüden Ausdruck, aber eine Nadel im Heuhaufen ist ein Lercherlschaß dagegen. Wir können nur warten, bis die Fahndung etwas ergibt. Und das wird sie, das wissen wir. Es braucht nur Zeit.«
Lemberg blickt bergab Richtung Teichalmsee. Der Paravent steht dort wie ein modernes Kunstwerk, völlig fehl am Platz. Etwa fünfzig Meter daneben fuchtelt Gierack vor einer TV-Kamera herum und analysiert wohl, was seiner Meinung nach geschehen ist. Sie muss schmunzeln, weil sie sich daran erinnert, was er ihr einmal über Fernsehinterviews gesagt hat. »Einfach irgendwas reden und gestikulieren. Nach ein paar Sekunden hört sowieso niemand mehr zu. Die Reporter nicht und die vor den Fernsehern sowieso nicht.«
Rund um den Tatort stehen immer noch vereinzelte Schaulustige und Fanwanderer. Zwischen ihnen liegt der Leichnam Tiefenbrunners, der das Idyll stört. An dieser Stelle wird bald ein Meer von Kerzen leuchten. Und irgendwann wahrscheinlich ein Gedenkstein oder ein Marterl errichtet werden, an dem alljährlich getanzt und musiziert werden wird. Dann trampelt wieder alles und jeder auf der Wiese herum. Und steigt dabei in Kuhfladen. Wie der Graf. Der den Dreck von seinem Schuh immer noch in die Wiese wischt. Und dem deutlich anzusehen ist, dass es ihm vor sich selber graust.
Lembergs Lächeln gefriert, als ihr Blick auf einen weiteren Kuhfladen fällt. Einen mit einem Schuhabdruck. Der eindeutig nicht vom Grafen stammt, der ja wohl nicht gleich in zwei Kothaufen getrampelt sein wird. Aber das ist es nicht allein, was ihre Aufmerksamkeit erregt, denn hier heroben dürfte alle paar Minuten jemand in die Scheiße eines Rindviehs steigen. Nein, neben dem Kuhfladen liegt ein Plastikbeutel. Eins der durchsichtigen Dinger, die auch die Tatortgruppe zur Asservatensicherung verwendet. Sämtliche Fundstücke werden in solche Tüten gesteckt. Beweismittel. So wie dieses. Sie hebt es mit spitzen Fingern auf und betrachtet es. Ein weißer Knopf, könnte aus Horn sein. Von einem Trachtenjanker abgerissen. Oder einer Lederhose. Oder einem Hemd. Vielleicht hat sich der Täter hier positioniert und geschossen. Ist möglicherweise beim Aufstehen an einer Wurzel hängen geblieben, gestolpert.
Sie macht ein Foto von dem Knopf in dem Beutel und ruft dem Grafen zu: »Schau dir diese Schlamperei an! Die von der Spurensicherung haben das hier einfach liegen lassen.«
»Wer?«
»Na, die Dumpfbacken von der Spurensicherung.«
»Das glaube ich nicht«, hört sie nun eine Stimme hinter sich. »Weil die Dumpfbacken von der Spurensicherung noch gar nicht hier waren.«
Lemberg dreht sich um und steht einer Gruppe von Kollegen in weißen Overalls gegenüber.
Der erste von ihnen, Waldemar Dietrich, Leiter der Tatortgruppe, macht einen weiteren Schritt auf sie zu. »Und wenn ich mich nicht irre, haben Sie beide hier nichts verloren, solange wir nicht fertig sind. Tatorte sind mein Revier. Sie dürfen dann später meine Ergebnisse auswerten und, wenn Sie sie denn verstanden haben, Leute verhaften.« Er streckt ihr eine Hand entgegen. »Wenn ich also bitten darf, das ist mein Beweisstück. Und wenn Sie mich noch einmal Dumpfbacke nennen …«
4Große Trauer bei den Fans der Drei Musikanten. Heute Nachmittag kam es während einer Fanwanderung der bekannten Volksmusikgruppe auf der Teichalm zu einem dramatischen Zwischenfall. Nach einem Schuss aus dem Hinterhalt ging der Musiker Sepp Tiefenbrunner tödlich getroffen zu Boden. Für ihn kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unglücksstelle. Außerdem wurde mindestens ein weiterer Teilnehmer der Veranstaltung schwer verletzt.
Die Suche nach dem Täter blieb bislang erfolglos. Wie die Polizei versichert, läuft die Fahndung auf Hochtouren. Über eine Spur oder erste Hinweise ist allerdings nichts bekannt.
Die Polizei ermittelt intensiv im Umfeld des Ermordeten. Tiefenbrunner wurde neunundvierzig Jahre alt, hinterlässt zwei erwachsene Kinder und eine Ehefrau. In ganz Österreich kam es zu spontanen Trauerbezeugungen, so etwa ziert ein Kerzenmeer den Vorplatz des Grazer Doms. Der geplante Auftritt der Drei Musikanten beim Aufsteirern, das in zwei Wochen in Graz stattfinden soll, wurde abgesagt.
Onlineausgabe der »Großen Tageszeitung«
5 »Warum nicht? Sag’s mir halt. Warum denn nicht?«
»Ralf, ich bitte dich. Jetzt verlier doch nicht gleich wieder die Nerven. Lass uns in Ruhe darüber nachdenken und die richtigen Schlüsse ziehen.«
»Schlüsse? Was ist mit dir? Welche Schlüsse willst denn ziehen, wenn jemand tot ist? Die haben den Tiefenbrunner erschossen. Mitten auf der Teichalm. Das ist quasi so, als hätten sie einen von uns beiden erschossen.«
Kevin Nord hebt die Augenbrauen, eine Geste, die ihm besonders gut steht. Seine markigen Züge und der Farbkontrast von dunklem Haar und blasser Haut lassen ihn wie eine Comicfigur wirken. Bei bestimmtem Licht kann man durchaus denken, dass er sich die Brauen mit einem Stift nachzieht und sich perfekte Blässe über die Augenringe schminkt. Nord passt sich damit perfekt seinem künstlichen Umfeld an, denn das Büro im zehnten Stock des Grazer Media Towers sieht aus wie in einem Möbelhaus. Der gläserne Schreibtisch ist bis auf den aufgeklappten Laptop leer. Nirgendwo liegt Papier, das Sakko Marke Boss hängt nicht einfach am Kleiderständer, vielmehr ist es arrangiert. Als würde jemand ganz besonders darauf achten, jede persönliche Note zu vermeiden.
Das Fenster hinter dem Schreibtisch ist bodentief und gibt einen atemberaubenden Blick auf die Stadt frei: die Conrad-von-Hötzendorf-Straße entlang bis zum Schloßberg mit dem Uhrturm, der von hier unnatürlich nah erscheint.
Nord zupft an seinem weißen Hemd, dessen Ärmel er trotz der sommerlichen Schwüle, die in der Stadt besonders an den Nachmittagen unerträglich wird, nicht hochgekrempelt hat. Zu seiner anthrazitfarbenen Hose trägt er Schuhe, die dermaßen blank poliert sind, dass sich in ihnen die Umgebung spiegelt.
»Was meinst du mit ›einer von uns beiden‹? Seit wann tragen wir Lederhosen und jodeln, außer es ist gerade das Wochenende vom Aufsteirern?«
»Lass den Scheiß, Kevin. Wir haben ein Riesenproblem. Jetzt ist nicht die Zeit für Witze.«
Ralf Tiger kann sich nicht entschließen, auf dem durchsichtigen Gästestuhl Platz zu nehmen, schon allein deshalb nicht, weil er die gläserne Konstruktion noch nie leiden konnte. Ja, tatsächlich, der Stuhl ist aus Glas, und Tiger befürchtet, dass er auch genauso filigran ist, wie er aussieht, und damit nichts für ihn, die kleinere, rundlichere, weniger smarte Version von Kevin Nord. Jene, die von der Empfangsdame stets etwas freundlicher begrüßt wird, weil sie glaubt, weniger von ihm zu befürchten zu haben. Ralf Tiger lächelt ehrlicher und häufiger als Kevin Nord, ist generell sensibler und nahbarer, was seine Umwelt betrifft, weniger berechnend und herablassend. Sein größtes Manko ist jedoch seine Nervosität, die sich stets vor einem wichtigen Termin einstellt. So wie jetzt. Tigers Nervenkostüm scheint ziemlich dünn zu sein, während Nord kaum ruhiger wirken könnte.
»Schon gut. Was erwartest du denn von mir? Dass ich fahrig im Zimmer auf und ab renne und mir die Fingernägel runterbeiße?«
Die Anspielung auf seine kurzen Nägel ignoriert Tiger.
»Im Ernst, was willst du denn machen? Vielleicht das ganze Fest abblasen?«
»Das nicht«, erwidert Tiger und zieht ein Stofftaschentuch aus seiner Hosentasche hervor. »Aber ich hab dir wer weiß wie häufig gesagt, dass wir keine Stars einladen sollen. Das Aufsteirern war immer schon ein Volksfest. Eine Brauchtumsveranstaltung. Eine –«
»Wusste ich’s doch, dass du jetzt wieder damit anfangen würdest. Ich wusste, wusste, wusste es.« Heftig trommelt Nord mit dem Zeigefinger auf die Glasplatte seines Schreibtischs. »Als ob die Teichalmsache irgendetwas mit uns und dem Aufsteirern zu tun hätte.«
»Diese Teichalmsache …«, Tiger betont das letzte Wort und wischt mit dem Tuch über seine glänzende Stirn. Die Geste wirkt fahrig und bringt ihn fast aus dem Konzept. »Also, die Teichalmsache hat insofern etwas mit uns zu tun, als dass wir nun unsere Sicherheitsmaßnahmen erhöhen müssen. Und das, obwohl wir jetzt schon die halbe Stadt auf den Kopf stellen, denn nein, es reicht ja nicht, dass hunderttausend Leute kommen, es müssen noch mehr sein. Dazu ein Staraufmarsch wie bei der Heli-Fischer-Show und mittendrin Kevin und Ralf, die wie Siegfried und Roy weiße Löwen bändigen und in silbern glitzernden Lederhosenkostümen einen auf Tracht und Tradition machen.«
»Weiße Tiger.«
»Was?«
»Siegfried und Roy haben weiße Tiger gebändigt. Gerade du müsstest das doch wissen.«
Tigers kurzer giftiger Blick bringt Nord fast zum Lachen.
»Ach, leck mich.«
Mit drei, vier Schritten ist Ralf Tiger an der Tür, als Nord ihm nachruft: »Das kannst du vergessen, Ralf. Ich sag dem Mountblanc bestimmt nicht ab. Das ist es doch, was du willst. Den würden wir nie mehr kriegen, wenn wir das tun, das weißt du. Mountblanc kommt, und die Veranstaltung wird größer. Aber das wäre sie so oder so geworden. Alles, was gut ist, wächst. So ist das nun einmal.«
Tiger will etwas sagen, überlegt es sich aber anders und knallt stattdessen die Tür hinter sich zu.
Nord wendet sich der Glasfront zu und betrachtet die Stadt von oben. Seine Stadt. Die Wutausbrüche seines Geschäftspartners machen ihm kaum mehr etwas aus, er ist in Gedanken schon ganz woanders. »Wie kommt er bitte auf silbern glitzernde Lederhosen?«, sinniert er halblaut. »Wir sind ja nicht beim Life Ball. Obwohl …«
6 Durch die großen Fenster fällt gelbes Licht auf die Kieselsteine im Garten. Von dort sind Leute im Inneren des Hauses zu erkennen, die sich unbeholfen und mechanisch bewegen, als folgten sie einer nicht gerade eleganten Choreografie.
Die Köpfe gesenkt, einige ein Glas Martini schwenkend, sitzen und stehen sie da wie Beteiligte eines künstlerischen Arrangements. Ein Mann lehnt am rustikalen Kamin. Eine Gruppe ist in die Couch gesunken, jemand bietet Knabbergebäck an. Wie die Szene eines Films, da die Gestalten sich alle paar Momente erheben oder setzen, sich die Hände geben oder einander umarmen. Oder wie ein seltsamer, stummer Tanz. Als würde ihnen jemand, der sich außerhalb des Blickfelds befindet, sagen, wann sie sich wie zu bewegen hätten.
Nach und nach treffen immer mehr Menschen in dem Haus ein, das nun das von Sepp Tiefenbrunners Witwe ist. In der Einfahrt, neben der sich Büsche im Dunkel verlieren, parken große Limousinen, Sportwägen, Geländeautos.
Soeben rollt ein Ungetüm auf vier Rädern heran, ein silberfarbener SUV von enormen Ausmaßen. Er hält direkt vor den Eingangsstufen des Anwesens. Ein breitschultriger, sportlicher Kerl springt aus dem Fahrzeug, wischt sich die Haare zurück, betrachtet sich im Seitenspiegel. Und hopst dann um die Kühlerhaube, als wäre er voller Vorfreude auf das, was nun kommt. Doch zwei Schritte vor der Eingangstür hält er inne, als hätte er sich plötzlich seines Aufenthaltsortes und des Grunds seines Besuchs besonnen. Lässt die Arme, die Schultern, den Kopf hängen. Atmet kräftig aus. Und läutet.
Die Tür öffnet sich. »Moritz …«
Die Reaktion auf sein Erscheinen war abzusehen, sie gehört zu seinem Alltag. Man kennt sein Gesicht, seine Anwesenheit ruft selbst bei den selbstbewusstesten Menschen einen Anflug von Ehrfurcht hervor, und zumindest die ersten Momente der Begegnungen sind meist von Sprachlosigkeit geprägt. Moritz Mountblanc, genannt der »Fels«, ist jemand, den man kennt. Aus dem Fernsehen. Den Zeitungen. Er ist ein Stern. Ein Star. Und für viele eben auch ein Fels. Weil er so groß ist. So stark. Und so unbekümmert.
Jeder kennt seine Geschichte. Als armer Sohn einer Bauernfamilie, deren Hof abgebrannt war, sang er sich durch die Wirtshäuser. Als damals Vierzehnjähriger brachte er seine Familie durch. Mehr noch. Er machte sie binnen weniger Jahre steinreich. Heute füllen seine Shows Fußballstadien. Seine Lieder kann jeder mitsingen. Sie sind Hymnen. Und der »Fels«, der Bursche, der aus dem Nichts kam, ist ein Halbgott am Musikerhimmel.
Jetzt steht er plötzlich inmitten der Trauergäste und winkt ab. Er wolle keinen Auftritt, nicht im Mittelpunkt stehen. Er sei nur wegen Luise da, der Frau des Verstorbenen. Für die Familie Tiefenbrunner. Er wolle mit ihr trauern. In diesen schweren Stunden bei ihr sein.
Bald fügt er sich ins Ensemble ein, stellt sich dazu und wird Teil des Stilllebens. Die anderen, die vor ihm da waren, sind nun noch erschütterter, denn dass die Stille so allmächtig ist, dass sie sogar die Gegenwart von Mountblanc zu verschlucken vermag, das trifft sie wie die endgültige Erkenntnis, dass etwas geschehen ist, das nicht mehr rückgängig, nicht wiedergutzumachen ist.
Irgendwann nach dem dritten oder vierten Glas Wein bemerkt Mountblanc eine Bewegung in seinem Augenwinkel. Draußen, wo das milchige Licht der Gartenbeleuchtung in den Schatten der Nacht versickert.
Er steht auf, gibt vor, frische Luft schnappen zu wollen, tritt auf die Veranda und lehnt sich gegen die Brüstung. Er zieht an einem Zigarillo, ein leichter Wind verweht die feine Rauchwolke. Ein Ast knackt. Ein Gebüsch raschelt im Schattenreich. Und ein schwarzer Umriss steuert auf ihn zu.
Der »Fels« bleibt ruhig. »Sie wissen, dass Sie sich auf einem Privatgrundstück befinden?«, ruft er über die Brüstung.
Keine Antwort. Stattdessen nähert sich die Silhouette eines Mannes. Der »Fels« nimmt noch einen Zug von dem Zigarillo, wenngleich er gegen den Drang ankämpfen muss, so schnell wie möglich das Weite zu suchen.
»Sie wissen bestimmt auch, dass es hier von Bodyguards und Polizisten nur so wimmelt?«
Die Erkenntnis, dass sich der Fremde unbemerkt an ihnen vorbeigeschlichen haben muss, trifft Mountblanc unvermittelt. Er richtet sich auf und wartet angespannt. Kurz bevor die unbekannte Gestalt ins weiche Licht tritt, bleibt sie stehen.
Noch einmal versucht es der »Fels« mit einschüchternden Worten. »Und Sie wissen vermutlich auch, dass heute der denkbar ungünstigste Zeitpunkt für Autogrammjäger und Paparazzi ist?«
Als der Schatten immer noch nicht spricht, wendet sich Mountblanc zum Gehen. »Na gut, Sie wollen es anscheinend nicht anders. Dann hol ich halt die Kavallerie.«
»Das bin ich.«
»Ah, der Schatten spricht. Was sind Sie?«
»Die Kavallerie.«
»Lustig. Aber ohne Pferde, oder wie?«
Ein Geräusch, wie wenn jemand kurz auflacht. Es klingt wie Luftschnappen.
»Damit haben Sie recht. Pferd habe ich keines.«
»Aha.« Der »Fels« blickt sich um. »Das erklärt aber immer noch nicht, was Sie hier zu suchen haben.«
»Auch damit haben Sie recht. Verzeihen Sie mir bitte meinen unorthodoxen Auftritt. Aber wissen Sie, ich beobachte gerne. Schaue mir die Leute an. Alles schaue ich mir an. Am liebsten habe ich es, wenn sich die Leute unbeobachtet fühlen. Eigentlich wollte ich gerade ins Haus gehen.«
»Und was hat Sie davon abgehalten?«
»Sie.«
»Ich?«
»Ja, Sie. Ihr Erscheinen.«
»Interessant. Darf man fragen, welche Erkenntnisse Sie daraus gezogen haben?«
»Nein, dürfen Sie nicht. Das heißt, fragen dürfen Sie schon, aber Antwort werden Sie keine bekommen. Nicht einmal Sie.«
»Verdächtigen Sie mich etwa, oder was?«
»Also, das überrascht mich jetzt. So schnell wollte ich gar nicht zum Punkt kommen. Wissen Sie, normalerweise komme ich selten schnell zum Punkt.«
»Dann ist das nur ein Vorwand, und eigentlich wollen Sie doch nur ein Autogramm von mir? Das lässt sich einrichten.«
»Interessant. Sie glauben also, ich müsste Sie mögen?«
Der »Fels« bläst heftig Rauch aus, seine Verblüffung ist nicht zu übersehen. »Na ja«, sagt er, »die meisten tun das. Mich mögen.« Mit einem Schlag verliert er die Lust an dem seltsamen Gespräch und dreht sich zur Verandatür um.
Er hat das manchmal. Plötzliche Stimmungsschwankungen. Hatte er eben noch Interesse an seinem Gegenüber, ist es von einem Moment auf den anderen verflogen. Ähnlich dem Blutzuckerspiegel, der nach dem Essen manchmal binnen Sekunden anzusteigen scheint und einen auf die Couch zu einem Nachmittagsschläfchen treibt. Wenn sein Interesse verschwunden ist, kann er sich nur mehr abwenden und das Weite suchen. Wie viele Menschen er damit schon restlos vergrault hat, weiß er nicht. Aber ist das nicht einerlei? Es kommen so viele nach und stehen Schlange. Es gibt nichts, was ihn davon abhalten kann, ein Gespräch zu beenden. Das Leben ist einfach zu kurz für närrische Gespräche. Für nichtssagende Floskeln. Für …
»Stopp.«
Der »Fels« hält inne und sieht – wieder aus den Augenwinkeln –, wie abermals Bewegung in den Schatten kommt. Dieser macht einen Schritt auf den Lichtkegel einer Gartenlampe zu, die ihn als Gestalt enttarnt, die der Steirer gemeinhin als zerlempert bezeichnen würde. Ein Kerl mit sich kräuselnder roter Mähne und einem Bart, der an Robinson Crusoe erinnert. Die Lederjacke, die er trotz des milden Abends trägt, sieht aus, als hätte er sie schon eine halbe Ewigkeit nicht mehr abgelegt.
»Verzeihung, das galt nicht nur Ihnen. In der Schärfe vor allem dem Hund.«
»Hund?« Und als Mountblanc sich suchend umblickt, fällt ihm auf, dass ganz in der Nähe ein zweiter Schatten lauert. Einer, den er nie und nimmer bemerkt hätte, wenn ihn der Fremde nicht darauf hingewiesen hätte.
»Jedenfalls«, hebt der seltsame Kerl im Garten nun an, »wenn wir zwei mit jemandem zu tun haben, dann kehrt unser Gesprächspartner uns in der Regel nicht den Rücken zu. Wir mögen das nicht. Finden es unhöflich. Sie nicht auch?«
Mittlerweile graben sich nicht nur Falten des Erstaunens in Mountblancs Stirn, auch tiefere, schroffere Furchen des Zorns zeichnen sich ab. »Darf ich Ihnen eine Gegenfrage stellen?«
»Eine ist gestattet.«
»Haben Sie hier draußen gewartet, bis der erste Trauergast auf die Veranda kommt, oder was? Bis der Täter zu Ihnen kommt?«