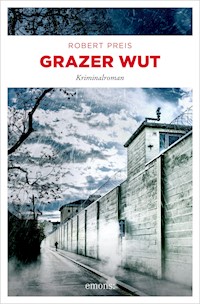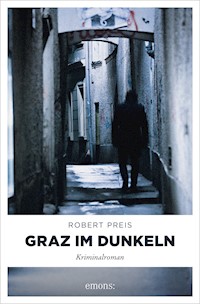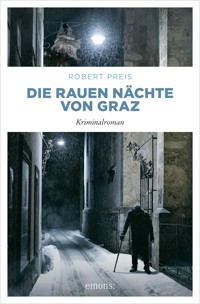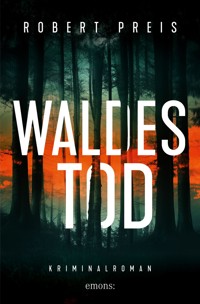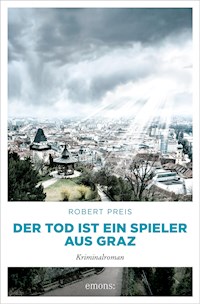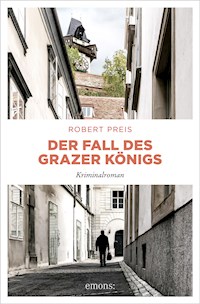Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Armin Trost
- Sprache: Deutsch
Als in Graz Menschen spurlos verschwinden und Leichenteile auftauchen, wird Armin Trost aus seiner beruflichen Auszeit reaktiviert. Zusammen mit seinen Kollegen Schulmeiser und Lemberg macht er Jagd auf einen wahnsinnigen Serienkiller. Dabei wird der Druck der Medien von Tag zu Tag stärker, der öffentliche Hass auf Ausländer, die mit den Taten in Verbindung gebracht werden, steigt. Schließlich führen ihn seine Ermittlungen auf den Balkan doch bis zur Lösung des Falls hat Trost nicht nur einmal mit dem Leben abgeschlossen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 413
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Robert Preis wurde 1972 in Graz geboren und ist dort aufgewachsen. Nach dem Studium in Wien und einem längeren Auslandsaufenthalt in Kroatien lebt er heute mit seiner Familie wieder in der Nähe seiner Heimatstadt. Er arbeitet als Journalist bei einer Tageszeitung und hat bereits zahlreiche Sachbücher und Romane geschrieben.www.robertpreis.com
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2014 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: Marija Kanizaj, www.kanizaj-marija.com Umschlaggestaltung: Tobias Doetsch Lektorat: Susanne Bartel eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-86358-616-4 Originalausgabe
Mit Unterstützung durch das Land Steiermark
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de
Für Mike, Mango und Niki
Die Triebkraft des Aberglaubens ist die Angst vor dem Zufall.
Eva Kreissl, Grazer Volkskundlerin
Wehe, wenn sie losgelassen.
Friedrich von Schiller, »Das Lied von der Glocke«
Prolog
November 1991/Ostslawonien
Es waren grauenhafte Geschichten, die über die Ebene in Richtung Norden rollten und schließlich auch über ihr Dorf herfielen wie gemeine Bestien. Alles kaputt. So viele Tote. Und dann noch die Gerüchte von den Massakern ganz in der Nähe.
Die Frau schleppte sich durch den lang gezogenen öden Ort: eine Schule, eine Taverne, Bauernhöfe. Selbst hier, in dieser unbedeutenden Ansammlung von Häusern entlang einer unbedeutenden endlos geraden Straße, war so vieles zerstört worden.
Die Fassaden der Wohnhäuser muteten mit ihren aufgerissenen Mauern wie Gesichter an. Gesichter, die traurig in den grauen Tag stierten. Die wenigen Menschen, die hier geblieben waren, duckten sich bei jedem Geräusch hinter Autowracks, die wie die Tierkadaver im Straßengraben lagen. Manchmal zogen kahl geschorene Halbstarke in Tarnanzügen und mit entschlossenen Gesichtern hinter Waffen versteckt durch das Dorf. Doch deren Suche nach etwas Brauchbarem kam ihr vor wie ein schlechter Witz. Nichts gab es hier mehr. Nichts zu essen, nichts zu bauen, keine jungen Mädchen, keine jungen Männer. Nur noch Altes, Unnützes, Zerstörtes.
Den letzten jungen Mann, den sie sogar gekannt hatte, hatte sie vor ein paar Tagen gesehen. Er hockte in den Trümmern seines Hauses, wimmerte und bellte wie ein geprügelter Hund. Sein Körper zitterte so stark, dass sie fürchtete, er hätte zu starkes Fieber, um es mit Umschlägen, Tees oder Säften lindern zu können. Es waren die einzigen Arzneimittel, die es hier noch gab. Obwohl sie wusste, wie gefährlich es in diesen Tagen war, sich Männern zu nähern – egal, ob man sie kannte oder nicht –, packte sie eine plötzliche Entschlossenheit. Vielleicht würde ihr die Linderung seiner Schmerzen helfen, ihre eigenen zu vergessen.
Das Risiko, der Mann könnte ihr etwas antun, war ihr beinahe egal. Und tief im Innern war sie ohnehin überzeugt davon, dass dies einer Erlösung gleichkäme. Sie stolperte über Trümmer auf ihn zu und hoffte, dass es tatsächlich nur Steine, Möbelstücke und Stoffreste waren, die unter ihren Schritten knirschten.
Wie schnell alles gegangen war, wie schnell sich die Leute – Freunde, Nachbarn, Bekannte und Verwandte – einfach gegenseitig umbrachten. Sie warfen einander vor, anders zu sein, fremd, obwohl sie doch alle wissen mussten, dass sie gleich waren. Jahrelang hatten sie Seite an Seite gelebt, gelacht, getanzt. Dieselben Feste gefeiert, dieselben Scherze gemacht, denselben Schnaps getrunken, alles dasselbe, und doch …
Jetzt lag der Geruch von Hass in der Luft. Die Aussicht auf plötzlichen Ruhm schürte uralte Gefühle, die Gier nach Macht hatte aus gutmütigen, von Rakija und Bier benebelten Gesichtern drogenzerfetzte Fratzen gemacht. Uralte Reiche waren heraufbeschworen, alte Legenden an die Oberfläche gezerrt worden wie Götzenbilder. Würde diese Raserei jemals aufhören?
Als sie schließlich vor dem bibbernden jungen Mann stand, war dessen merkwürdiges Bellen verstummt. Stattdessen schluchzte und heulte er wie ein kleines Kind. Sein Körper schwankte vor und zurück wie ein Papierschiffchen, das in der Drau vor sich hin treibt. Doch statt dem jungen Mann zu helfen, fiel nun auch die Frau auf die Knie, weinte und zitterte am ganzen Körper. Sie konnte den Blick nicht abwenden von dem, was hinter den Trümmern zum Vorschein gekommen war. Sie kannte den Mann tatsächlich von früher. Von vor ein paar Tagen. Nein, von Geburt an.
Alles hatte sich plötzlich verändert.
Sie hatte sein Leid verstanden und gewusst, dass das Zittern niemals enden würde. Das Zittern ihrer beider Seelen.
Teil 1
Schrecken
1
Jänner 2014, Graz
Hin und wieder scheint es fast so, als folge der Zufall einem großen unerschütterlichen Plan. Fast so, als wäre die Wirklichkeit nichts anderes als eine konstruierte, frei erfundene Geschichte.
Da war zum Beispiel die von einem Treppensturz verletzte Schulter, welche die Frau hinaus in die Kälte trieb, da das Spazierengehen ihre Schmerzen linderte. Seite an Seite mit ihrem Ehemann – den gesunden Arm in seinen untergehakt, den Kopf wegen einer Platzwunde weiß verbunden – schlenderte sie die Baiernstraße entlang, jenen mäanderförmigen Asphaltkanal am Fuße des Bergrückens, der den Westen der Stadt Graz umschloss. Hier waren die Gehsteige zuweilen so schmal, dass entgegenkommende Fußgänger auf die Straße ausweichen mussten, die ihrerseits stellenweise nur einspurig war. Die Gartenzäune der Häuser, durchweg Villen aus dem 19. Jahrhundert, standen oft direkt neben dem Asphalt.
Der Nebel, der in Graz vor allem während der dunklen Jännerwochen oft gezwungen war, bis in die Mittagsstunden zu verweilen, verlieh der Luft einen feuchten Geschmack, die Straßen schimmerten spiegelglatt.
Die Menschen, die sich an diesem Ort zu dieser Zeit ins Freie wagten, gingen meist geduckt, ihr Atem stieg in kleinen Wölkchen von den Gesichtern empor. Die Umstände ließen den gemeinen Grazer auf das Zu-Fuß-Gehen verzichten. Stattdessen fuhr er auch kürzeste Distanzen mit dem Auto oder schimpfte auf die öffentlichen Verkehrsbetriebe, »die eine grottenschlechte Verbindung« boten. Zudem schimpfte er natürlich auf die Politik, die nichts gegen die in verlässlicher Regelmäßigkeit überschrittenen Feinstaubgrenzwerte in der Stadt unternahm. Dennoch war in den Medien nie von »Smog« die Rede. »Smog« war woanders – und noch eine Spur schlimmer. Ganz sicher nicht in Graz.
Doch durch die diesige Baiernstraße irrten nicht nur die lädierte Frau und ihr Ehemann, sondern noch eine weitere Person, die plötzlich aus den Nebelschwaden auftauchte. Direkt hinter dem Schloss Eggenberg – UNESCO-Weltkulturerbe und Anziehungspunkt für in Bussen herangekarrte Touristen – schälte sich die in ein weißes Nachthemd gehüllte Gestalt in gebückter Haltung aus der milchigen Dunstglocke wie ein Bühneneffekt.
Über das Nachthemd hatte sie sich einen Umhang geworfen, das lange feuchte Haar verdeckte ihr Gesicht. Zudem waren ihre Füße bloß, was deshalb ganz deutlich zu erkennen war, weil diese eine merkwürdige Laune der Natur darstellten und man gar nicht anders konnte, als sie zu bemerken: Sie waren vollkommen verdreht, sodass die Zehen nach hinten zeigten. Bei raschem Hinsehen hätte der Eindruck entstehen können, als würde sich die Gestalt verkehrt herum bewegen, wenngleich dem natürlich ganz und gar nicht so war.
Das Areal des Schlosses Eggenberg war an dieser Stelle durch eine etwa vier Meter hohe Mauer abgeschottet und ließ keinen Blick auf den prächtigen Park mit seinem englischen Garten zu, der sogar als Gartendenkmal bezeichnet wurde. Jeder Grazer wusste, was sich hinter der Mauer verbarg: die selige Ruhe vermeintlich stehen gebliebener Zeit, schreiende Pfaue und das Prunkanwesen der ehemaligen Adelsfamilie, die zu gewaltigem Ruhm gelangt war, als einst der Kaiser in Graz residiert hatte. Und wie es sich für den Adel ziemte, hatten auch die Eggenberger einen gewaltigen Spleen. Kein Fenster, keine Tür, kein Raum war gedankenlos angelegt worden. Nichts war beim Bau des Schlosses dem Zufall überlassen worden, alles war dem strengen Diktat höherer Mächte gefolgt.
Doch vor den Mauern, im Schatten des Bergkammes, der früher Grafenberg und heute Plabutsch genannt wurde, war alles das genaue Gegenteil: zufällig.
Auch die so seltsam gekleidete Gestalt schien nur zufällig aufgetaucht zu sein. Eben noch hier und plötzlich einfach weg. Eben noch hatte sie auf dem schmalen Gehsteig kurze trippelnde Schritte gemacht, und plötzlich war sie fort gewesen. Wie vom Erdboden verschluckt. Und mit ihr der Ehemann an der Seite der Frau.
Zusammen mit der Verwunderung kroch Gänsehaut über ihren Körper. Aus ihren ungläubigen Rufen – »Ich habe doch eben noch seine Hand in meiner gespürt!« – wurden bald hysterische Schreie. Sie rannte die Schlossmauer auf und ab und brüllte den Namen ihres Mannes in den immer dichter werdenden Nebel hinein. Ein Kerl von Mitte vierzig, ein durchaus kräftiger Mensch mit breiten Hüften und dicken Knien, der konnte sich vor ihren Augen doch nicht in Luft auflösen, Herrgott noch mal!
Aber dann hielt sie inne und erinnerte sich daran, wie sich ihr Mann wortlos von ihr gelöst hatte und auf die fremde Gestalt mit den verdrehten Füßen zugeeilt war, als zöge ihn ein unsichtbares Band zu ihr. Sekunden später waren beide spurlos verschwunden.
Sie schüttelte ungläubig den Kopf, aber ihr Unterbewusstsein ließ sie sich das Trugbild einprägen. Jede Einzelheit musste fest in ihrem Gehirn verankert, nichts durfte vergessen werden. Dann brüllte sie den Namen ihres Mannes wieder in die Nebelwand.
Ein paar Minuten später wurde die Frau bereits von den Insassen eines vorbeifahrenden Rettungswagens betreut, die in Leberkäse- und Wurstsemmelgeruch gehüllt aus dem Wagen gesprungen waren, um der Frau, die in der Kälte auf der Straße auf und ab lief, zu helfen. Sie waren auf dem Weg zu einem der sich in der Nähe befindenden Krankenhäuser gewesen.
Das Rettungsteam bestand aus zwei Sanitätern. Zunächst suchten sie mit ihr die Gegend nach dem Verschwundenen ab, doch bald war ihnen klar, dass die Frau verwirrt war. Sie wollte sich nicht beruhigen, schrie immerzu und zitterte am ganzen Leib. Einer der Sanitäter verdrehte die Augen und stellte eine Schnelldiagnose, die er dem Kollegen mittels Zeichensprache mitteilte: eine kreisende Bewegung des Zeigefingers vor seiner Stirn.
Auch die herbeigerufene Polizei war bald vor Ort, und sogar einige Passanten – wahrscheinlich von den Schreien angelockte Bewohner der nahen Wohnanlage – trotzten der klirrenden Kälte und näherten sich gaffend. Der Nebel schloss sich um ihre Beine und ließ nur ihren Oberkörper frei, was sie wie unheimliche Geister erscheinen ließ.
Unter gewaltigen Schluchzern erzählte die Frau den Beamten schließlich eine Geschichte, die davon handelte, dass das saubere Nachthemd und der verdrehte Körper der plötzlich aufgetauchten fremden Gestalt ganz unzweifelhaft auf die Torfrau hindeuteten, einen unerbittlichen, grausamen Dämon, der in manchen Gegenden des Landes schlicht Törin genannt wurde. Die Legende der schweigsamen Törin besagte, dass sie des Nachts meist an Bächen in tiefen Wäldern anzutreffen sei. Dort wasche sie Wäsche, und wer sie dabei störe, den bestrafe sie grausam mit Würgen und Schlägen. »Hör auf, hör auf!«, brülle sie dann wie von Sinnen und ersticke ihre Opfer gnadenlos. Mit unendlicher Kraft und Brutalität.
Irgendwann begannen sich alle Anwesenden wieder zu zerstreuen. Die Gaffer. Die Polizisten. Und die nach ihrem Mann schreiende Frau mit den Rettungssanitätern. Nur der Nebel setzte sich immer hartnäckiger zwischen Burgmauern und Bergrücken fest und machte keine Anstalten, sich zu verziehen.
Es waren Fotos gemacht worden, Beamte waren ausgeschwärmt, um den Mann zu suchen, obwohl mittlerweile jeder die Vermutung hegte, dass niemand verschwunden war. Gut möglich, dass die Frau, die seltsames Zeug über Sagengestalten stammelte, nach ihrem Treppensturz, von dem sie ihnen ebenfalls erzählt hatte, nicht mehr alle Tassen im Schrank hatte.
Im Davonfahren warf einer der Polizisten noch einmal einen Blick durch die Rückscheibe und fühlte sich unwohl bei dem Anblick. Wie gesagt, der Nebel wollte an diesem Tag nicht und nicht weichen.
2
Hinter den fast raumhohen Fenstern breitete sich die Stadt aus, doch auf das Panorama konnte man gut und gerne verzichten. Der Himmel ähnelte mit seinem konturlosen Hellgrau einer Betonwand, die Äste der Bäume ragten wie Mahnmale in die schmutzige Luft, aus Autos und Menschenmündern dampfte es weiß. Der Tag hätte kaum unansehnlicher sein können. In dem Raum selbst, einem recht geräumigen Zwei-Bett-Zimmer des Unfallkrankenhauses, das sich im Besitz einer Versicherungsgesellschaft befand, war es viel zu warm und stickig.
Der erste Beamte, ein bei jeder Bewegung ächzender Kerl mit Schweißflecken unter den Achseln und ebensolchen Perlen auf der hohen Stirn, hatte seine Jacke gleich nach dem Eintreten ausgezogen. Obwohl er sich nicht schnell, sondern eher bedächtig bewegte, schien er sich dennoch über Gebühr anzustrengen. Nach der Jacke warf er auch sein Sakko über eine Stuhllehne und wickelte sich seinen Schal umständlich vom Hals, ehe er der im Bett liegenden Frau die Hand reichte, ohne ihr dabei in die Augen zu sehen. Sein Händedruck war kräftig, trotzdem bekam man seine Hand nicht richtig zu fassen, sodass er insgesamt den Eindruck einer zwar massigen, aber nicht greifbaren Erscheinung vermittelte. Er bot keine Anhaltspunkte, an denen man gerne verweilen würde.
Die Begleiterin des Mannes hatte sich allem Anschein nach mit ihrem Kollegen abgefunden. Mit einem nur angedeuteten, aber durchaus als freundlich zu wertenden Lächeln wartete sie den Begrüßungshändedruck ab, ehe auch sie sich ihrer Jacke, ein Wintermantel mit einem Besatz aus falschem Pelz an der Kapuze, entledigte und sie über die Lehne eines weiteren Stuhls neben dem Bett legte. Es kam ihr befremdlich vor, überhaupt hier zu sein, wenngleich ihr der Besuch schon nach wenigen Minuten Kraft gab. So kränklich sie sich nämlich selbst fühlte, ging es ihr bei dem Anblick der Frau gleich wieder besser. Fast hätte sie sich ob dieses Gedankens bei der Frau entschuldigt, doch dann entsann sie sich, dass niemand in ihre Gedanken hineinsehen konnte. Sie gehörten nur ihr, und das war auch gut so, denn hätte jemand gesehen, was in ihr vorging, hätte man sie womöglich gleich wieder nach Hause geschickt. Stattdessen war ihr vor Kurzem nach ein paar Therapieeinheiten gestattet worden, in die Mordgruppe zurückzukehren.
Welche Rolle Kollege Schulmeister bei dieser Entscheidung gespielt hatte, wusste sie nicht genau, aber sie war sich ziemlich sicher, dass er um ihren Verbleib in der Abteilung gekämpft hatte. Irgendwo tief in seinem umfassenden Inneren musste auch er ein Organ besitzen, das einem Herzen nicht unähnlich war. Aber vielleicht hatte sie ihre Wiedereinberufung in den Dienst auch nur dem Umstand zu verdanken, dass er sie vor nicht allzu langer Zeit vor einer Hexe gerettet und dabei splitterfasernackt gesehen hatte und nun begierig darauf hoffte, dass sich diese Situation eines Tages wiederholen würde.
Wie auch immer, Annette Lemberg war ihm dankbar dafür, dass er ein gutes Wort für sie eingelegt hatte, nachdem sie Befehle missachtet und damit sich selbst und Kollegen in Gefahr gebracht hatte. Einen Abteilungswechsel in eine weniger aufregende Einheit hätte sie strikt abgelehnt. Wegen Armin Trost, natürlich wegen ihm. Einmal mehr bedauerte sie, dass ihr unmittelbarer Vorgesetzter immer noch außer Gefecht gesetzt war. Offiziell hieß es, er sei im Krankenstand, doch inoffiziell wurde gemunkelt, man wolle keine besonders großen Anstrengungen unternehmen, um ihn zurückzuholen.
Sie wusste, dass ihm dieser Fall gefallen hätte, schließlich schien es wieder um eine Hexe zu gehen.
»Bereit, Kollegin?«, riss sie Schulmeister aus ihren Gedanken.
Sie nickte, realisierte überrascht, dass sie bereits auf einem Stuhl neben dem Bett Platz genommen hatte, stellte die Aufnahmefunktion ihres Smartphones ein und legte es mit erdbeerroten Ohren auf den kleinen Beistelltisch. »Bereit, wenn Sie es sind.« Unglaublich, wie tollpatschig sie beide auftraten. Von außen musste es wirken, als würden sie das erste Mal gemeinsam eine Zeugenaussage aufnehmen. Der eine in seiner ganzen Art einfach nur überbordend unansehnlich und die andere, sie selbst, abweisender und abwesender als eine Litfaßsäule.
Die Frau in dem Bett musterte die beiden, die sich als Johannes Schulmeister und Annette Lemberg von der Mordgruppe des Landeskriminalamtes vorgestellt hatten, mit blassem Gesicht. Selbst Schulmeisters wegwerfende Handbewegung und die auflockernd gemeinte, aber keineswegs bei ihr so ankommende Bemerkung: »Wir kommen nicht nur bei Mord, sondern auch bei Totschlag«, hatten ihr den Argwohn nicht nehmen können. Mit zusammengepressten Lippen beobachtete sie, wie die beiden sich anschlichen. Mit ihren einstudierten Bewegungen, ihren eingespielten Handgriffen und ihren perfekt aufeinander abgestimmten Sätzen kamen sie immer näher. Ihre auf der Decke gefalteten Hände begannen vor Aufregung zu zittern.
3
»Frau Schneider«, hob Johannes Schulmeister nun räuspernd und gurgelnd an, wobei das Fettgewebe unter seinem Kinn in Bewegung geriet, »ich weiß, Sie haben es den Kollegen schon erzählt, aber könnten Sie auch uns bitte noch einmal schildern, was gestern passiert ist?« Schnell fuhr er sich mit seiner Zunge über die trockenen Lippen und sah dabei für einen Sekundenbruchteil aus wie ein Reptil.
Die Frau musste mehrmals schlucken, eine Krankenschwester, die sich ebenfalls noch im Zimmer befand, reichte ihr ein Glas Wasser, dann erzählte sie erneut alles, was bis zum Erscheinen des Rettungswagens geschehen war.
Schulmeister massierte sich währenddessen intensiv das Gesicht. Er schien einem komplizierten Gedanken nachzuhängen, doch Annette Lemberg wusste, dass er das nur deshalb tat, weil er kurz davor stand einzuschlafen. Auch sie musste immer wieder ein Gähnen unterdrücken, der Unterkiefer tat schon weh von der Anstrengung. Außerdem störten die Aufnahme zwei Nachrichten, die sie dazu aufforderten, begonnene Quizduelle mit irgendwelchen Avataren weiterzuspielen.
Das Handyspiel war in vielerlei Hinsicht ihre einzige Gemeinsamkeit mit Schulmeister, mit dem sie seit Tagen Runde um Runde ausfocht. Derzeitiger Stand: siebenunddreißig zu einunddreißig für Schulmeister, sieben unentschieden. Sie musste schmunzeln. Nie hätte sie es für möglich gehalten, doch Schulmeisters Nähe hatte irgendwann in den letzten Wochen begonnen, ihr gutzutun. Sie gab ihr die Sicherheit, dass das Gerüst der Welt noch Bestand hatte – wenngleich Schulmeister nicht gerade den attraktivsten Winkel dieser Welt darstellte. In keinerlei Hinsicht.
»Noch einmal ganz langsam, Frau Schneider. Die Person, die Sie gestern gesehen haben, trug ein weißes Nachthemd und ging bloßfüßig?«, fragte Schulmeister nun.
»Ja.«
»Und es handelte sich zweifellos um eine Frau?«
»Ja, nein. Also ich bin mir nicht sicher …«
»Hören Sie, so kommen wir nicht weiter. Also: Mann oder Frau?«
»Frau. Nein, es könnte auch ein Mann gewesen sein. Meine Güte, es war nebelig, und ich bin immer noch angeschlagen.«
»Das sehe ich.«
»Mein Kollege spielt nur auf Ihren Kopfverband an«, warf Lemberg sofort ein.
»Ich weiß schon, was Ihr Kollege gemeint hat«, entgegnete Frau Schneider patzig. »Jedenfalls war die Person etwas größer als ich und trug ein Nachthemd, sodass ich im ersten Moment dachte, es müsse sich um eine Frau handeln. Aber mittlerweile bin ich mir nicht mehr so sicher. Jedenfalls ist mein Mann zu ihr gegangen, im Nebel verschwunden und anschließend nicht mehr aufgetaucht.«
»Sie haben die Person«, Schulmeister blätterte in einem Notizblock, »Törin oder auch Torfrau genannt. Ich kenne eine solche Figur nur aus der Sagenwelt. Haben Sie die gemeint?«
Die Frau seufzte und ließ ihren Blick hilfesuchend durch den Raum schweifen. »Ja, aber …«
»Das ist schon in Ordnung, Frau Schneider.«
Hätte sie ihn nicht besser gekannt, Lemberg wäre davon überzeugt gewesen, jetzt den Ansatz eines Lächelns auf Schulmeisters Lippen wahrzunehmen.
»Und was ist das Besondere an der Figur der Törin? Ich habe die Information, dass Sie auf diesem Gebiet eine Art Expertin sind.«
»Ich bin in der Diözese für Brauchtum zuständig, natürlich kenne mich da auch mit heidnischen Dingen aus.«
»Und was ist nun das Besondere an dieser Figur?«
Sie schienen die Aufmerksamkeit der Frau zu verlieren, die nun aus dem Fenster starrte. Erst die behutsame Frage der Krankenschwester, ob es ihr gut gehe, holte sie zurück ins Jetzt.
»Das Weib ist brutal und böse. So wird es in den Geschichten jedenfalls geschildert. Ganz ähnlich wie die Drud oder die Percht, vielleicht einen Hauch weniger verspielt. Die verdrehten Beine haben mich darauf gebracht, so etwas fällt einem ja auf. An so eine Figur erinnert man sich.« Die Frau fixierte mit zitternden Lippen ihre Finger und seufzte, als müsse sie all ihren Mut zusammennehmen. Als sie fortfuhr, blickte sie Schulmeister an, ohne zu zwinkern. »Die Törin wäscht Wäsche, und wer sie dabei stört oder sich über sie lustig macht, wird sterben. Der Legende nach verfügt sie über enorme Kräfte, ist extrem schnell und kann ihren Kopf, ihre Füße, ihren gesamten Körper verdrehen. Sie ist der perfekte Alptraum.«
Schulmeister und Lemberg wechselten einen Blick, der Bände sprach.
»Ich kenne viele dieser Sagen«, fuhr die Frau fort, »und erzähle sie auch den Kindern. Aber vielleicht bin ich wirklich zu stark auf den Kopf gefallen. Vielleicht bilde ich mir alles nur ein, und die Welt ist gar nicht so böse.« Ihre Augen füllten sich mit Tränen.
Es war unschwer zu erkennen, dass Schulmeister das Gespräch nicht behagte. »Nun, Ihr Mann ist jedenfalls verschwunden, und wir suchen nach ihm. Hatte er in letzter Zeit Probleme, gab es Leute, die ihn bedrohten oder ihm nachstellten?«
»Überhaupt nicht, gar nicht«, erwiderte die Frau rasch.
»Wirklich keine Idee?«
»Nein.«
»Hatten Sie vielleicht miteinander Probleme? Gab es Auseinandersetzungen?«
Sie schüttelte den Kopf. Plötzlich drückte wieder ein unsichtbares Gewicht auf ihren Brustkorb, Tränen standen in ihren Augen, doch sie schluckte die Gefühle hinunter und zwang sich, die Nerven zu bewahren.
Schulmeister murmelte eine Bemerkung, die eher unhöflich als beruhigend wirkte, und reichte Frau Schneider mit plötzlicher Hast und der Bitte, sich bei ihm zu melden, falls ihr doch noch etwas einfiele, seine Visitenkarte. Dann drehte er sich um und griff nach seinen Jacken.
Annette Lemberg musste nur die Stirnfalten der Frau betrachten, um zu wissen, dass sie freiwillig nie wieder etwas von ihr hören würden. Sie steckte ihr Smartphone ein, reichte Frau Schneider ihrerseits die Hand und nickte auch der Krankenschwester zum Abschied zu.
Die Patientin beobachtete vom Bett aus, wie die beiden Beamten sich aus dem Raum stahlen wie die Mitglieder eines Chors nach einer verpatzten Schulaufführung. Ihr Abgang wirkte grotesk. Er wälzte sich schnaufend und keuchend hinaus wie ein zu groß geratenes Kriechtier, sie trippelte hinter ihm her und musste sich immer wieder einbremsen, um ihm nicht auf die Fersen zu steigen. Die Polizistin war schon fast aus dem Zimmer, als sie ihr noch eine Frage hinterherrief: »Ist es denn schon sicher, dass mein Mann nicht mehr lebt?«
Annette Lemberg hielt inne, drehte sich um und machte widerwillig wieder zwei, drei Schritte auf das Bett zu. »Wie kommen Sie darauf?«
»Na, weil Sie von der Mordgruppe sind.«
Umständlich beschwichtigte sie die Frau, erklärte ihr, dass Leib und Leben der eigentliche Titel ihrer Abteilung sei und es durchaus vorkomme, dass sie mit lebendigen Menschen zu tun hätten, eigentlich viel häufiger als mit toten. Gerade als sie merkte, dass sie sich hoffnungslos in Erklärungen verstrickt und verheddert hatte, wies die Krankenschwester sie an, sie möge das Zimmer doch bitte verlassen, die Patientin brauche jetzt Ruhe. Lemberg kam der Bitte gerne nach.
Hinter ihr wurde das Fenster geöffnet, und eiskalte Luft strömte in den Raum. Sie war zwar besser als der Körpergeruch der Anwesenden und die drückende Hitze, doch mit ihr strömte der betonfarbene Tag herein und legte sich zentnerschwer aufs Gemüt.
Die Patientin wandte sich ab und starrte in den Himmel. Nein, diese beiden Polizisten machten nicht den Eindruck, als könnten sie ihren Mann finden. Sie machten ja nicht einmal den Eindruck, als würden sie ernsthaft nach ihm suchen wollen. Wieder stiegen ihr Tränen in die Augen. Wenn sie ihnen doch nur bessere Hinweise hätte geben können.
4
Mit den Ellbogen auf dem Fensterbankerl abgestützt verfolgte die hochbetagte Magda – wie jeden Tag den ganzen Tag, wie sie zu sagen pflegte – das Geschehen auf der Vinzenzgasse. Da lachten türkische Schulkinder und warfen sich für Magda unverständliche Wortfetzen zu. Sie wunderte sich, dass die Kinder angeblich nicht einmal dann, wenn sie die Algersdorferschule betraten, Deutsch redeten. Man hörte ja so allerhand. Zum Beispiel, dass es in Graz bereits Schulen gab, wo Deutsch nur noch die Muttersprache der Lehrer war. Wie die Zeit doch verging. Wie sich alles veränderte. Wie das Viertel verkommen war und die ganze rechte Murseite vernachlässigt wurde. Ganz 8020 wurde langsam zum Ausländerviertel, zum Balkan.
Früher hatte es in Eggenberg überall Einfamilienhäuser und dazwischen Betriebe gegeben, mit denen man etwas anfangen konnte. Ein Fahrradmechaniker, ein Schlüsseldienst, ein Greißler. Was heißt schon ein Greißler? Als 1968 der Coop-Großmarkt in der Eggenberger Allee eröffnete, mussten gleich fünf Konsum-Filialen und etliche Krämerläden zusperren. Allein ums Eck in der Georgigasse gab es drei kleine Lebensmittelbuden, in denen man nicht einmal gleich bezahlen musste. Man konnte alles aufschreiben lassen oder einen Fassungszettel schicken, dann wurde das Essen sogar einmal wöchentlich geliefert. Das waren noch Zeiten gewesen. Magda seufzte bei der Erinnerung.
Ja, gut, da waren auch die Delogiertensiedlung und die paar Hochhäuser, die gebaut worden waren, bevor sich eine Tageszeitung mit einer Kampagne dagegen gewehrt hatte, dass ganz Graz mit Wolkenkratzern zubetoniert wurde. Und große Angst vor der Stadtautobahn hatte es auch gegeben, aber die war dann ja doch nicht gebaut worden, weil stattdessen die Tunnel durch den Plabutsch gebohrt worden waren.
Heute war jedenfalls alles schlechter als damals. Überall Wettbüros und Kebabbuden, und die Fenster der leer stehenden Geschäftsflächen waren mit Plakaten zugeklebt. Du meine Güte, was waren das für Zeiten gewesen, als direkt gegenüber auf der anderen Straßenseite noch das Fahrradgeschäft gewesen war. Da war was los gewesen. Immer wer zum Tratschen.
Magda beobachtete viel. Den Pfarrer zum Beispiel. Den kannte jeder, nicht nur hier in der Vinzenzgasse, sondern in ganz Graz und in ganz Österreich und vielleicht sogar noch in ganz anderen Ländern, weil er den Armen, den Ausländern half. Auch den Bettlern, die zuweilen in der Innenstadt alle paar Meter ihre Verstümmelungen zur Schau stellten und auf ein paar Cent hofften.
Die alte Magda war überzeugt, dass der Pfarrer einmal ein Heiliger werden würde oder zumindest ein Seliger. Aber das würde er nicht mehr miterleben und sie auch nicht. Ja, er würde einmal geehrt werden, obwohl sein Engagement eigentlich ein Witz war. Er holte die Armen in die Stadt und verteidigte sogar die, die nicht arbeiteten. Ein Hohn für alle Österreicher, die Steuern zahlten und fleißig waren und Steuern zahlten und, ja, eben fleißig waren.
Und dann war da noch der Davor, der nette Kellner vom »Kirchenwirt«, der Magda manchmal ein warmes Mittagessen durchs Fenster reichte. Der Davor war einer von den Guten unter den Ausländern. Ja, die gab’s auch, die besseren Fremden. Die Fleißigen. Die, die sich integrieren wollten. Davor war so einer, ein Jugoslawe mit Manieren. Ja, so was gab es. Ob er jetzt aus Kroatien, Bosnien oder sonst woher kam, wusste Magda nicht, für sie war er ein Jugoslab, ein Jugo, aber sie meinte das nicht böse.
Eigentlich kam Davor nicht nur manchmal zu ihr, sondern jeden Tag. Nur heute nicht beziehungsweise heute wieder nicht, so musste man schon fast sagen. Eigentlich merkwürdig, wo er es doch sonst immer ankündigte, wenn er ein paar Tage fortmusste.
Mit zittrigen Fingern griff Magda nach der Tasse Pfefferminztee auf dem Fensterbankerl neben dem Polster für die Ellbogen. Mit gespitzten rissigen Lippen nippte sie vorsichtig an dem dampfenden Getränk, dann begannen ihre Augen wild zu flackern. In Todesangst.
Die Tasse entglitt Magdas Fingern und landete auf dem Gehsteig. Das Porzellan zerbrach in Dutzende von Einzelteile, und Magdas Schreie hallten durch die Gasse. »Davor, dein Kopf! Davor!«
Einige Passanten blieben stehen und blickten sich verwundert um, doch niemand näherte sich oder fragte, ob sie Hilfe benötigte, denn schließlich war allgemein bekannt, dass man sich Verrückten nicht nähern sollte. Und wer so brüllte, musste verrückt sein. Wer sich also darum scherte, handelte sich nur Probleme ein, und davon hatten die meisten ohnehin genug.
Doch Magda hätte keine Hilfe nötig gehabt, vielmehr Davor. Andererseits, war es nicht schon zu spät für Hilfe, wenn jemand den Kopf eines anderen in einen Plastiksack stopfte?
Magda hatte genau gesehen, wie ein Mann aus dem Haus hinter der Kirche kam, wo die Obdachlosen wohnten, einen Kopf beim Schopf packte und diesen fest in einen Plastiksack drückte, wie um auch wirklich sicherzugehen, dass er nicht mehr herausrutschen konnte. Die hektische Bewegung hatte nur einen Sekundenbruchteil gedauert, aber Magda war überzeugt davon, dass es Davors Kopf gewesen war. Sie würde Davor überall erkennen. Davor war immer für sie da, er war kein Ausländer wie die anderen, sondern einer von den guten. Einer, der ihr half, wenn sie Hilfe benötigte. Und der jetzt tot war, da gab sich Magda keinen Illusionen hin.
Ihr Mund wurde trocken, sie fand keine Worte. Lauft ihm nach, er hat Davors Kopf abgesägt, wollte sie schreien, blieb aber stumm. Sogar die Luft zum Atmen wurde ihr knapp.
Hastig entfernte Magda sich vom Fenster. Plötzlich hatte sie große Angst vor dem Mann und vor Davor. Was, wenn der Kopf durch das Fenster hereinkam? Auf sie zurollte, sie zu Fall brachte, auf sie draufrollte und sie mit toten Augen anstarrte? Magda war sich sicher, dann würde ihr Herz vor Schreck stehen bleiben.
Keuchend hangelte sie sich entlang der Küchenmöbel, auf denen noch Krümel vom Frühstücksbrot und aufgeweichte Teesackerl lagen, in Richtung Kühlschrank. In der jetzigen Situation konnte es nicht schaden, ein Glas Milch zu trinken, auch wenn die schon sauer war, denn das schmeckte sie ohnehin nicht mehr. Sie hatte schon vor Jahren den Geschmacksinn verloren. Der Beginn ihres kontinuierlichen Zerfalls. Zuletzt hatten die Arthritis- und Gichtschmerzen an den großen Zehen wieder zugenommen. Ihre Augen konnten in der Dunkelheit der Wohnung auch kaum mehr etwas sehen, überhaupt war sie auf einem schon seit Jahren quasi blind.
Seit den frühen Morgenstunden lief in Magdas Wohnung der Fernseher. Im Moment die Barbara-Karlich-Show in einer solchen Lautstärke, dass die Nachbarn mit Besenstielen gegen die Decke geklopft hätten, hätte es denn welche gegeben. Aber Magda war in dem alten Haus fast allein. Außer ihr gab es nur noch ein paar Fremde, die dann und wann auftauchten und schließlich von der Polizei abgeholt wurden. Seltsame Leute, derentwegen sie sich kaum noch aus der Wohnung wagte.
Sie hörte die Karlich noch etwas über Beziehungen sagen, dann wurde es um sie immer dunkler und dunkler, und die Wohnung drehte sich erst langsam, dann schneller und immer schneller. Als sie auf dem Fußboden lag, bemerkte sie, dass etwas auf ihrer Brust sie anstarrte. Ein Kopf. Davors Kopf. Vor Schreck blieb Magda das Herz stehen.
5
Die Straßenbahnlinie eins hielt an der Endstation Eggenberg. Die Türen öffneten sich, eiskalte Luft flutete den Fahrgastraum und stand im verschwenderischen Widerspruch zur hochgedrehten Sitzheizung. Der Mann, ein Student in den Zwanzigern, erhob sich umständlich mit eingegipstem Bein. Wenn alles gut ging, würde er den Gips in wenigen Minuten oder Stunden – je nach Wartezeit – endlich los sein. Dann wäre auch das Mit-Stricknadeln-sich-an-der-Wade-Kratzen Vergangenheit. Humpelnd näherte er sich der geöffneten Falttür. In der einen Hand hielt er beide Krücken, während er mit der anderen seine Manteltasche nach seinem Mobiltelefon abtastete, als sein Blick auf eine Sitzbank oder vielmehr auf das fiel, was auf der Sitzbank lag. Er blieb stehen und blickte das Etwas erstaunt an.
Es sah aus, als hätte jemand ein Stück Fleisch liegen gelassen. Hatte hier jemand etwa einen Körperteil verloren, in unmittelbarer Nähe des Krankenhauses? Mit verzogener Miene, wie man sie in Erwartung einer schrecklichen Szene in einem Horrorfilm macht, bewegte sich der Mann auf das seltsame Objekt zu. Tatsächlich, da lag ein sauber abgetrenntes blutverschmiertes menschliches Ohr auf der Sitzbank einer Straßenbahn.
»Wäää!«, rief der junge Mann entsetzt und stolperte einen Schritt zurück.
6
Er trug eine Fellmütze mit Ohrenklappen und einen Mantel, der an manchen Stellen mit Stoffresten zusammengeflickt war. Mit einer Hand stützte er sich auf einen Stock, die andere hielt er bettelnd von sich gestreckt. Erbarmungswürdig zog er ein Bein hinter sich her, verrenkte sich bei jedem Schritt, und sein Körper schaukelte dabei wie bei schwerem Seegang. An der Kreuzung versuchte er, mit den Autofahrern Sichtkontakt aufzunehmen, und wiederholte minutenlang immer nur ein Wort. »Bitte, bitte, bitte.« Wie ein Mantra. »Bitte.« Einmal stieß er mit seinem Gehstock auch gegen eine Autotür, was ihm wüste Beschimpfungen einbrachte, aber die Ampelphasen waren einfach zu kurz, um Kleingeld zu erbetteln.
Die Wirtin aus dem Beisl an der Ecke hatte den Mann schon länger beobachtet. »Sag, was trägt der da um den Hals?«, fragte sie einen Gast, der daraufhin ohne Antwort aufstand und hinaus auf die Straße ging.
Durch die Scheibe verfolgte die Wirtin, wie der Gast den Bettler vom Gehsteig aus anbrüllte, was das da um seinen Hals sollte. Als der Humpelnde mit seinem Zeigefinger auf seine eigenen Augen zeigte und dann in Richtung des Gastes, bekam die Wirtin eine Gänsehaut. Die beiden Männer wechselten ein paar weitere Worte, und als der Gast wieder in die Schankstube zurückkam, wischte er sich mit der Handfläche mehrmals von links nach rechts über die Stirn.
»Das ist ein Finger. ›Gegen böses Blick‹, sagt er, der Trottel.«
»Ein echter Finger?«
Verwundert starrte er sie ein paar Sekunden an. »Das hab ich nicht gefragt.«
Die Wirtin zuckte mit den Achseln. »Muss wohl so sein, weil einer aus Plastik nichts gegen böses Blick nützen würde.«
Mit zusammengezogenen Augenbrauen ließ sich der Gast zurück auf die Sitzbank fallen und widmete sich wieder grübelnd seinem Krügerl Bier.
7
Der Gast mit Namen Bruno Hass war Lehrer in Frühpension, der gerne lange Spaziergänge machte und ab und zu im Beisl auf ein steirisches Hopfengetränk vorbeischaute. Stets eines, niemals zwei, und immer ein steirisches. Aber andere Biere gab es hier auch nicht.
Immer wählte er einen Platz mit Blick auf die Straße, obwohl dort nur Autokolonnen, rote Ampeln, vom Wind fliegende Zeitungsseiten, Hunde, die an Hausmauern ihr Geschäft verrichteten, und Menschen, die sogar im Sommer ihre Köpfe tief hinter Mantelkrägen verbargen, zu sehen waren. Eine ganz normale Kreuzung eben, nur Dahingehetze, Fortwollen und die Traurigkeit von denen, die dableiben mussten.
Ein Wahnsinn, wie viel Armut es bei uns gibt, dachte er bei sich und meinte damit nicht die Armut, die man sehen konnte, die Armut der Bettler und grölenden Taugenichtse mit den Bierflaschen in der Hand, die einem ihr Leid förmlich aufs Auge drückten. Bruno Hass dachte dabei vielmehr an die echten Österreicher, an die, die man nicht sah, die zu Hause wohnten und kein Geld zum Heizen, keine Arbeit und keine Zukunft hatten. Aber von denen redete ja keiner.
»Gegen böses Blick«, die Worte gingen ihm immer wieder durch den Kopf. Zuerst hatte er ihnen noch keine Bedeutung beigemessen. Vor allem die Ausländer vom Balkan lernten einfach nie richtig Deutsch, egal wie lange die auch hier waren. Ihr Deutsch blieb stets so schlecht wie am ersten Tag. Schon häufig hatte er sich darüber mit Ferdinand unterhalten, dem alten Ferdl, seinem Freund aus der Zeit beim Bundesheer, und das war jetzt schon fast vierzig Jahre her. In den frühen Achtzigern, ein Wahnsinn, wie die Zeit verging.
»Ferdl«, sagte er jetzt wieder, »verstehst du, warum die Trottel einfach nicht unsere Sprache lernen? Die kennen kein Sie, reden nur im Infinitiv: ›Du geben Geld, ich nix haben Arbeit.‹ Und richtig schlimm wird es, wenn sie dazwischen ein bisschen umgangssprachlich werden und ›Oida‹ oder ›Wos is‹ sagen. Na, die hab ich schon gefressen.«
Der Ferdl schaute seinen Kameraden von einst grinsend an, erwiderte aber nichts.
»Was schaust denn so deppert, was ist? Willst streiten? Sicher willst streiten, wozu sonst bist denn gekommen, außer zum Streiten. Es ist immer dasselbe mit dir, immer wenn du da bist, streiten wir.«
»So ein Blödsinn, ich will überhaupt nicht streiten. Außerdem bin ich nur deshalb da, weil du mich gerufen hast.« Dennoch schien es, als würde sich Ferdinand über das Wiedersehen freuen. »Ich finde es übrigens amüsant, wie du immer wieder den ehemaligen Lehrer heraushängen lässt.«
»Der Infinitiv war es, ich hab es gleich gewusst, nur wegen dem Infinitiv bist du so. Jaja, wegen dem Infinitiv und nicht wegen des Infinitivs, lach nur. Wir reden hier so, wie wir wollen. Aber ich weiß zumindest, wie es richtig heißt, im Gegensatz zu den meisten anderen. Der Trottel dort draußen, der so tut, als würde er humpeln und betteln, der kann sonst gar nichts. Ab und zu drischt er noch auf ein Auto ein, aber das war’s dann auch. Der macht sich nicht einmal die Mühe, irgendwas an seinem jämmerlichen Dasein zu ändern. Das regt mich wirklich auf.«
Ferdinand rückte näher und legte einen Arm um Brunos Schulter. Er hatte gemerkt, dass sein Freund drohte weinerlich zu werden. Diese Stimmungen hatten damals begonnen, als er seine Stelle als Volksschullehrer in Gösting verloren hatte. Als einer der wenigen Männer in einer Volksschule war Bruno Hass sehr beliebt gewesen, und einige Mütter hatten sich regelrecht, regelmäßig und gar nicht regelkonform sogar in ihn verschaut. Ja, das war gegen die unausgesprochenen Regeln gewesen, war aber geduldet worden, denn Hass war beliebt, bei den Müttern, den Kollegen und nicht zuletzt sogar bei den Schülern, was bei einem Lehrer keine Selbstverständlichkeit ist.
Wie der engagierte Pädagoge wusste, wurden allzu häufig solche Menschen Lehrer, die im Innern ihres Wesens keine Kinder mochten. Und schon gar nicht mehr als maximal zwei auf einmal. Eine gesamte Klasse war ein Gegner, den es zu bezwingen galt. Hass war nie so gewesen und hatte seinen Beruf frei nach dem Motto ausgeübt: »Wenn ich schon etwas tun muss, dann mache ich es gerne«.
Für das jähe Ende seiner Karriere und damit auch für sein Selbstvertrauen und das Vertrauen in die Gesellschaft im Allgemeinen hatte eine junge Kollegin gesorgt, die eins seiner Gespräche mit Ferdinand mitbekommen hatte. Hass hatte Ferdl schon öfter darum gebeten, ihn nicht in der Schule zu besuchen, Arbeit und Freizeit müsse man trennen, aber Soldaten verstanden halt nur Befehle und keine Bitten. Also war der Ferdl einfach aufgetaucht, als er im Lehrerzimmer die Schulaufgaben kontrollierte.
»Verschwinde«, zischte Bruno Hass ihn an. »Ich bin ja bald fertig, dann komme ich auch heim. Aber jetzt geh.«
Doch so leicht ließ sich Ferdinand nicht abwimmeln. Die beiden diskutierten, Bruno geriet in Rage, brüllte den anderen an und fuchtelte mit den Armen herum. Als Ferdinand sich dann endlich erbarmte und verschwand, war es bereits zu spät. Die junge Kollegin hatte alles gesehen und gehört.
Keine zehn Minuten später rief ihn die Direktorin zu sich. Sie musterte ihn mit besorgtem Gesichtsausdruck und riet ihm, sich doch ein paar Tage freizunehmen und sich zu entspannen. Er willigte ein. Es schien das Beste zu sein.
Doch während seiner Auszeit machte in der Schule ein Gerücht die Runde. Einige Mütter, vielleicht aus Eifersucht auf den Ferdinand, initiierten sogar einen Elternabend, eine Abstimmung und einen Brief an den Landesschulrat und drohten nicht zuletzt mit einem Zeitungsartikel. So kam es, wie es kommen musste, und Bruno Hass, der ehemals so beliebte Volksschullehrer, wurde mit knapp fünfzig Jahren gebeten, die Schule nicht mehr zu betreten. Gar keine Schule mehr, um genau zu sein.
»Du hast recht«, sagte Ferdinand sanft. »Ich finde, du solltest etwas unternehmen. Sonst tut ja keiner etwas, alle schauen nur zu.«
Wie gut ihm Ferdinands Worte taten. Die Nähe zu einem anderen Menschen war für Bruno Hass bei Weitem nicht alltäglich.
Nach der Grundausbildung hatten sich ihre Wege getrennt. Bruno hatte sich durch die Weltgeschichte geschlagen, als Hausmeister, Aushilfskellner, auf dem Bau, sogar eine Zeit lang auf einem Schiff hatte er gearbeitet, auf einem Ausflugsdampfer auf der Donau, einen Sommer lang als Holzarbeiter am Semmering, einen Winter lang als Liftbügelhalter in Schladming. Letzteres wäre eigentlich ein guter Job mit hohem Spaßfaktor gewesen, wäre Hass nicht schon kurz nach Weihnachten hinausgeworfen worden, weil er einer deutschen Urlauberin allzu heftig an den Hintern gegriffen hatte.
»Blöde Gans.«
»Wie bitte?«
»Ach, nix.«
Er wurde erst mit knapp dreißig Lehrer, aber dafür mit Leib und Seele. Und Ferdinand? Den hatte er seit dem Bundesheer nicht mehr gesehen, erst nach vielen Jahren war er wieder aufgetaucht. Aus heiterem Himmel, und plötzlich hatte er gewusst, dass er ihn schon immer sehr gemocht hatte. Schade nur, dass sie sich erst so spät wiedergetroffen hatten.
Hass’ Stimme bekam einen bitteren Ton. »Was soll man gegen das Gesindel denn machen? Das ist doch schon überall. In der Herrengasse sitzen sie alle paar Meter und schauen blöd aus der Wäsch, die Ausländer. Die kommen in Bussen zu uns, tun so, als hätten sie eine furchtbare Behinderung, und am Abend sind sie alle wieder verschwunden. Ich möcht einmal sehen, wo die wohnen. Wenn die wirklich so arm wären, bräuchten sie nämlich nicht auf der Straße sitzen. Das gibt’s schon lange nicht mehr. Aber unsere Kirchenleute, die sind ja nur mehr für die Ausländer zuständig. Die alten Mütter und die alten Hackler, die eigenen Leute sind allen längst schon wurscht. Beim eigenen Volk hört die Toleranz auf. Wenn die nichts mehr zum Kauen haben, sieht das keiner. Über vierzehntausend Delogierungen in einem Jahr in Österreich, das hab ich in einer Zeitung gelesen. Allein in Graz gibt es mehr als fünfundzwanzigtausend Arbeitslose, Menschen, die mit knapp sechshundert Euro auskommen müssen, weil sogar ihr Existenzminimum gepfändet wurde. Aber da schauen sie alle weg, die feinen Kerle im Politikerzwirn. Zum Speiben ist das. Und sagen darfst du ja auch nichts mehr. Rutscht dir einmal ›Neger‹ oder ›Tschusch‹ oder ›Zigeuner‹ raus, dann schauen dich alle schief an. ›Indianer‹ und ›Eskimo‹ sind mittlerweile auch verboten. Genauso wie ›Behinderter‹, nix. Wirst sehen, wir werden noch den Tag erleben, an dem man auch nicht mehr ›Frau‹ sagen darf, bei ›Weib‹ schaun sie eh schon deppert.«
Ferdinand nahm Brunos Hand und drückte sie so lange, bis Bruno ihm direkt in die Augen sah. Eine fast schon liebevolle Geste wie unter Brüdern – oder mehr. »Ich finde«, sagte Ferdinand leise, »es ist keine Lösung, wenn du hier in dieser Spelunke sitzt und darauf wartest, dass sich etwas ändert. Geh raus, mach was! Aber so, dass es etwas bringt. Dass die Leute hellhörig werden.«
Hass starrte in sein leeres Glas und nickte plötzlich so heftig, dass sein Kinn gegen den Rand schlug. Verärgert wischte er das Krügerl vom Tisch, das zum Glück nicht zerbrach.
Die Wirtin, deren Laune umgeschlagen war, seit Hass begonnen hatte, Selbstgespräche zu führen, warf ihm nun einen argwöhnischen Blick zu. »Wenn du jetzt randalierst, kannst du dich gleich verziehen!«, rief sie ihm von der Schank aus zu und hoffte, dass er einfach gehen würde. Nicht dass Hass einen besonders furchterregenden Eindruck machte, aber etwas an ihm war ihr plötzlich unheimlich. Er war nicht sehr groß mit grauem Stoppelbart und grauen Haaren und grauer Haut. Sogar die Augen waren grau und die Pullover, die er trug, sowieso. Er war ein Mann, den man nur mit einer Farbe beschreiben konnte, und das betraf, wie die letzten Minuten gezeigt hatten, offenbar auch sein Innenleben. Aber die grauen Unscheinbaren waren bekanntlich auch unberechenbar. Sie wollte keinen Ärger. »Kannst ja morgen wiederkommen«, versuchte sie es beschwichtigend.
Hass stand bedrohlich langsam auf und kam näher. Draußen auf der Straße hinter der großen Scheibe inzwischen nichts als endlose Autokolonnen, der humpelnde Bettler und die Pestsäule am anderen Eck der Kreuzung, die an finstere Zeiten erinnerte. An mittelalterliche Angst. Und Angst hatte die Wirtin jetzt plötzlich auch ein wenig. Hass blickte im Näherkommen immerzu über seine Schulter, so als würde er jemanden fixieren. Bruno Hass, ein grauer verhärmter Mann, der die Fähigkeit besaß, mit einem Mal gruselig zu wirken, so als stünde ein Geist an seiner Seite.
8
Ohne sich um das am Boden liegende Glas zu kümmern, setzte Hass sich an die Schank und rieb sich das offenbar immer noch schmerzende Kinn. »Ich sag dir mal was«, begann er so leise, dass ihn die Wirtin kaum verstand, »weißt du, was das Arge ist, das wirklich Arge? Die führen sich auf wie die Wilden, es werden immer mehr von denen, und keiner tut was.« Seine Stimme hatte jetzt wieder die übliche Lautstärke. »Hast du das von dem in der Zeitung gelesen, der in der Baiernstraße verschwunden ist? Und das von dem Ohr in der Straßenbahn? Und der da draußen hat einen Finger am Hals hängen. Kommt dir da kein Verdacht? Na, was glaubst, wer so was macht? Einer von uns? Sicher nicht. Ich sag dir, der Bettler da draußen ist einer von denen. Wer weiß, vielleicht hat der ihn sogar umgebracht und ihn dann zerschnitten. Ich trau denen alles zu, das sag ich dir, aber nachfragen wird keiner, denn das ist ja ein Bettler, der ist arm und darf alles. Und eingesperrt wird er auch nicht, weil das nur Geld kostet und der eh keine Strafen bezahlen kann. Als ich noch ein Bub war, hat es so etwas hier nicht gegeben. Aber heute sind ja alle deppert, sag ich dir. Alle deppert.« Hass schaute die Wirtin lange an, ohne ein einziges Mal zu blinzeln. »Findest du nicht auch?«
Entgeistert fuhr sie auf. Was hatte er gesagt? Himmelherrgott, sie hatte ihm gar nicht richtig zugehört, nur auf seine geballte Faust gestarrt, die schwer auf der Schank lag. Seine Hände waren mit hervortretenden Adern überzogen. »Was?«
»Na, dass alle deppert sind.«
Sie leckte sich eine Schweißperle von der Oberlippe. »Ja, das finde ich auch, sicher finde ich das.«
Er nickte lächelnd, betrachtete seine Finger mit den abgebissenen Nägeln und blähte die Backen auf, als hätte er eine Entscheidung getroffen, die ihm schwergefallen war. Dann fuhr er plötzlich hoch und starrte auf den leeren Barhocker neben sich. »Ja, ja, ich komm ja schon, hetz mich bloß nicht, verdammt noch einmal.«
Als Hass zur Tür ging, musste er schon wieder lächeln. Die Wirtin nahm wahrscheinlich an, er sei betrunken, dabei hatte er nur ein Krügerl intus. Ein einziges. Den Ferdinand hatte sie wahrscheinlich gar nicht gesehen, und er würde sich auch hüten, ihn ihr vorzustellen, denn Ferdinand war sein Freund. Nur seiner. Seine ganz persönliche Erinnerung.
9
Auf der Straße schlenderte er ein paar Meter weiter und lehnte sich gegen eine Hausmauer. Er beobachtete den Bettler eine Weile und konnte sein Glück kaum fassen, als dieser die Kreuzung verließ und Richtung Stadt stolperte. Hass folgte ihm, bog wie der Bettler in die Seitengasse ein und achtete nicht mehr auf Ferdinands Warnungen, er solle sich die Sache doch besser noch einmal durch den Kopf gehen lassen und nichts überstürzen. Das sah Ferdinand mal wieder ähnlich, jetzt einen Rückzieher zu machen, wo es richtig losging.
Er war so hastig um die Ecke gebogen, dass er mit dem Bettler zusammenstieß. Der Gehstock fiel in weitem Bogen ins Gebüsch, und der Humpelnde lag schneller auf dem Boden, als er aufschreien hatte können. Bruno Hass schaute kurz nach links und rechts, die Luft war rein, und begann dann, den Kerl mit Tritten in die Region zwischen Brustkorb und Becken zu malträtieren. Als er die Hand traf, die sich der Nichtsnutz schützend vor den Bauch hielt, erklang ein Knacken wie von einem brechenden Ast, und beim letzten Tritt hätte ihm der Idiot fast auf die Schuhe gekotzt. Hass überlegte noch, ob er dem Mann ins Gesicht spucken sollte, ließ es dann aber bleiben und machte sich davon. Ihm grauste vor der verachtenswerten Gestalt auf dem Boden. Nicht einmal gewehrt hatte sich der Mann, schon nach den ersten Tritten hatte der Stinker mit den Augen gerollt und gestöhnt. Was für ein Versager.
Selbst Ferdinand, der sich die ganze Zeit über zurückgehalten hatte, war jetzt begeistert. »Das war großartig!«, rief er, und seine Augen glänzten.
»Stimmt«, keuchte Bruno Hass, während er schon die Alte Poststraße in Richtung Norden entlangrannte, »das war es tatsächlich.« In sein Seitenstechen mischte sich ein unbeschreibliches Glücksgefühl. Den Finger an der Halskette seines Opfers, der alles ausgelöst hatte, hatte er längst vergessen.
10
Die Annenpassage war nur noch ein Schatten ihrer selbst. Einst war sie als blühende Einkaufswelt unter der Erde gefeiert worden, damals strömten die Massen zwischen Bahnhof und Innenstadt nur so hindurch. Tag für Tag wälzten sich Tausende von Geschäft zu Geschäft und machten die Passage zur Goldgrube für eine Versicherungsgesellschaft mit Sitz in Wien.
Mittlerweile waren die Fassaden zugeklebt, und nur noch wenige Geschäfte glaubten den Durchhalteparolen, die alle paar Monate via Medien verkündet wurden. Es solle neue Konzepte geben, Maßnahmen zur Wiederbelebung. Wer’s glaubte …
Da die Stadt in unmittelbarer Nähe einen Verkehrsknotenpunkt verwirklicht hatte, der die unterirdische Straßenbahnstation aber weder mit dem Bahnhof noch mit der Einkaufspassage verband, bestand kein Grund mehr, durch die ehemalige Einkaufswelt zu flanieren. Nur noch zwielichtige Gestalten, Trunkenbolde, verirrte Touristen oder in Reminiszenzen schwelgende Grazer, die nicht begreifen konnten, dass sich die Einkaufstempel der Stadt mittlerweile anderswo befanden, waren hier anzutreffen.
In einer finsteren Ecke steckte eine von Zigarettenqualm und Dosenbierdunst eingehüllte Gruppe ihre Köpfe zusammen. Etwas Kleines, in Zeitungspapier Gewickeltes machte die Runde. Jemand warf einen längeren Blick in das kleine Paket, schrie angeekelt auf und wurde von den anderen sofort angewiesen, still zu sein, sonst würde es was auf die Fresse geben. Einer lachte nervös, ein anderer rülpste beherzt, dann wechselte ein Geldschein seinen Besitzer, und ein Schlüsselbund klimperte. Die genuschelte Frage »Un das hilft?« wurde energisch bejaht und mit Schulterklopfen untermauert.
Schließlich zerstreute sich die Gruppe, und ein krumm gehendes Männchen fuhr mit dem Paket in der Hand mit der Rolltreppe auf den Bahnhofsvorplatz. Es stolperte auf die Bahnhofshalle zu, stürzte aber ausgerechnet vor einer Gruppe Pensionisten, die soeben mit dem Reisebus aus St. Pölten für einen Tagesausflug nach Graz gekommen waren, bäuchlings auf den Boden.
Starke Hände griffen dem Gestürzten unter die Arme und halfen ihm auf, eine Frau bückte sich nach dem Paket, das dem krummen Mann aus der Hand gefallen war, und wollte es ihm reichen, als sich das Zeitungspapier entfaltete. Die Frau schnappte nach Luft, das Paket fiel abermals zu Boden, jemand schrie, mehr zornig als betroffen, so etwas sei doch eine Frechheit.
Als zwei Ordnungswache-Beamte in ihren Uniformen im Ostblock-Stil zu der Gruppe stießen, stellten sie fest, dass zwischen den Leuten auf dem Boden ein Fleischklumpen lag.
»Eine Nase«, sagte einer der Umstehenden aufklärend, aber jeder, der einen längeren Blick wagte, konnte eindeutig erkennen, dass es sich um eine menschliche Nase handelte.
»HatmirzehnEurokostundisgegndnbösnblick«, lallte das Männchen. Zehn Euro gegen den bösen Blick.
»Na, super, jetzt ist mir schlecht«, stöhnte einer der St. Pöltener Pensionisten.
11
Das Panzerglas schützte sie. Kamen Leute von der Straße herein, konnten sie nur mittels einer Gegensprechanlage mit ihr in Kontakt treten. Erst wenn sie den entsprechenden Knopf betätigte, öffnete sich die Tür mit einem Summen.
Die Polizeibeamtin, eine kurzhaarige Frau Anfang zwanzig, tastete dennoch unsicher nach ihrer Halskette. Aus einem nicht zu nennenden Grund hatte sie heute ein Gefühl, dass etwas passieren würde. Schon als sie mit der Tramway in den Dienst gefahren war, hatte sie es gespürt. Im zufälligen Aufblicken an einer Haltestelle hatte sie im Licht einer Straßenlaterne eine Anzeigetafel bemerkt, auf der ihr die Zahl 13 ins Auge stach. Seitdem hatte sie das beunruhigende Gefühl nicht mehr verlassen.