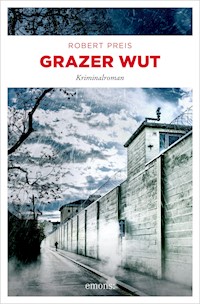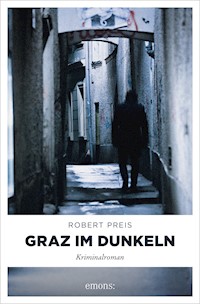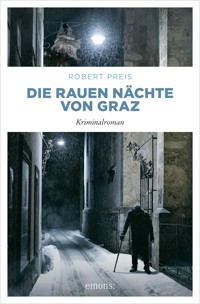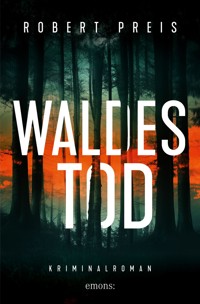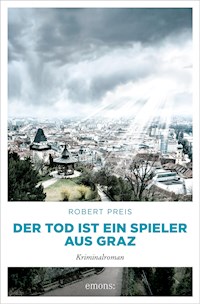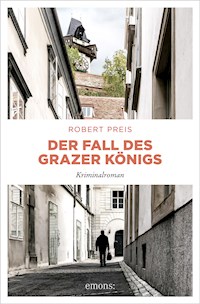Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Leykam
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Graz im Jahr 1809. Ein paar hundert Männer verteidigen den Schlossberg vor den Angriffen der übermächtigen Truppen Napoleons. Doch während die Bevölkerung vom Leid des Krieges heimgesucht wird, geschehen unfassbare Dinge in der Stadt. Kinder verschwinden, Menschen werden krank – und eine alte Angst kehrt zurück. Vier Männer gehen den Vorfällen auf den Grund und öffnen dabei die Wunden ihrer eigenen Vergangenheit. Mitten im Krieg ziehen sie in ihre persönliche Schlacht. Hinaus aufs Land. Hinauf auf den Schöckel. Auf jenen Berg, der bis dahin von den Menschen gemieden wurde. Wegen der Räuber, der Wölfe – und der Hexen. Stein für Stein, Szene für Szene lässt Robert Preis, Graz im Jahre 1809 wieder aufleben und erzählt eine packende Geschichte, die den Leser in den Bann zieht und bis zur letzten Zeile gefangen hält.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 363
Veröffentlichungsjahr: 2009
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cover
"hidden"Titel
Robert Preis
DAS GERÜCHT VOM TOD
Roman
Leykam
Dieses Buch ist meinen Eltern, Theresia und Johannes Preis, gewidmet.
Mai 1809
Der Krieg gegen Napoleon hielt Einzug in Oberitalien. Angeführt von des Kaisers Bruder Erzherzog Johann kämpften die Österreicher erfolgreich gegen den Vizekönig von Italien, einem Verbündeten der Franzosen. Fünf Schlachten im April zeigten durchaus militärisches Geschick des Erzherzogs und seiner Berater. Tausende Franzosen wurden getötet oder gefangen genommen, der überraschte Gegner bis nach Verona zurückgedrängt. Doch dann erhielten die siegreichen Soldaten einen überraschenden Befehl: Weil Napoleons Truppen Wien bedrohten, wurde die erfolgreiche Italien-Armee vom Kaiser zum Rückzug aufgefordert. Die Einheiten trennten sich bei dem Manöver und wurden nun bald ihrerseits verfolgt. Sie flohen teilweise über Kärnten, teilweise über Slowenien, versuchten auch noch verzweifelt, die Tiroler zu schützen, und verloren auf diese Weise Schlacht um Schlacht. Im Kanaltal wurden nach heldenhaftem Kampf Sperren gestürmt, es kam zu zahlreichen Scharmützeln und regelrechten Massakern. Viele seiner fähigsten Offiziere musste Johann in diesen Tagen sterben sehen, das Leben Tausender Österreicher endete auf dem Schlachtfeld. Die Spur der Verwüstung zog sich innerhalb weniger Tage durchs halbe Habsburgerreich.
Schon näherten sich die Truppen des Vizekönigs Graz, der Stadt im Herzen des Herzogtums Steyermark.
Doch hier sollte ihr Vormarsch enden.
Und ihre Angst beginnen.
Ein Gerücht – schnelle Worte
Matthäus stellte den Schubkarren ab, wischte sich den Schweiß aus den Augen und blickte sich um. Seit Tagen tat er wie die meisten Grazer nichts anderes, als Material auf den Schloßberg zu karren, um ihn zu befestigen. Auf diesem Berg in der Mitte der Stadt befand sich die Festung. Ein steinernes Ungetüm aus blankem Fels.
Um die Geschütze zu vergraben und Wälle zu errichten, mussten nicht nur notdürftige Mulden ins Gestein geschlagen werden, auch allerlei Holzlatten und Ziegelwerk, mitunter sogar Erdreich, wurden auf den Berg gekarrt. Seit Tagen schuftete Matthäus deshalb wie ein Tier.
Er war ein kräftiger Mann von erstaunlicher Größe. Sein kleiner viereckiger Kopf wurde von breiten Schultern getragen. Ein Kerl wie Matthäus musste sich vor nichts fürchten, mochte man meinen. Und doch machte ihm vieles Angst. Zum Beispiel die Geschichten, die von den Leuten zur Zeit gerne erzählt wurden. In fieberhafter Eile bauten die Leute Gerüste, errichteten kleinere Palisaden und schufteten immer dann, wenn Offiziere in der Nähe waren. Drehten die sich um, flüsterten sie einander aber zu, von gnadenlosen und grausamen Franzosen. Der Teufel selbst sei ihr Begleiter.
Matthäus wusste auch von der Unsicherheit in der Stadt. Denn sobald man wusste, dass die Franzosen im Anmarsch waren, wusste auch jeder, dass die Spione des Feindes längst hier sein mussten. Jeder Fremde wurde verdächtigt, argwöhnisch beobachtet.
Das Allerschlimmste waren aber gar nicht die Gerüchte über die fremden Soldaten und ihre Kundschafter. Es war die Stadt selbst, die sich verändert hatte, wie Matthäus mit zunehmender Besorgnis feststellen musste. Er sah es in den Gesichtern der Menschen, die nur noch Masken zu sein schienen. Hastige Blicke, verzogene Mundwinkel. Matthäus, der Schmied, bildete sich ein, dass man die Angst riechen konnte. Und Matthäus bildete sich vieles ein.
In Wahrheit wehte wohl nur eine Luftböe aus den übel riechenden, nur langsam versickernden Abwässern des Stadtgrabens zwischen die Häuser hindurch. Seit Jahrzehnten waren die Stadtmauern nun schon dem Lauf der Zeit überlassen worden. Den Ort vor feindlichen Übergriffen zu schützen, fiel hier niemandem ein. Als gäbe es für kein Heer der Welt einen Grund, in diese Talsenke zu ziehen, die sich Richtung Süden trichterförmig in eine weite Ebene öffnete. Als habe sich dieser Ort im Lauf der Zeit aus dem Gedächtnis der Welt gelebt. Nein, so eine Stadt brauchte tatsächlich keine starke Mauer mehr.
Und doch: Mehr als zehntausend Franzosen waren nun im Anmarsch. Ihnen gegenüber standen nicht mehr als 900 tapfere Männer, großteils im Töten völlig ungeübte Bauern, Handwerker und Bürger, die erst seit einem knappen Jahr Mitglieder des Landwehrregiments waren. Und mitten unter ihnen er, Matthäus der Schmied.
Alles, was Erzherzog Johann ihnen hinterlassen hatte, war folgender Auftrag: bis zum letzten Mann zu kämpfen, die Festung nicht aufzugeben, so lange die Kräfte reichten.
So lange die Kräfte reichten.
Wer weiß, vielleicht würden Napoleons Truppen ja vorbeiziehen wie einst die Türken? Matthäus schüttelte den Kopf. Die Alten in den Wirtshäusern erzählten sich, dieser Ort habe noch nie eine Schlacht erlebt. Diese Stadt bleibe stets verschont. Er schauderte beim nächsten Gedanken. Denn die Alten glaubten auch zu wissen, warum, denn diese Stadt sei verflucht.
Er hatte die beiden Kinder nicht bemerkt, die ihn von einer Straßenecke aus beobachteten. Sie standen da, als habe sein Anblick sie so sehr erschreckt, dass jeder weitere Schritt unmöglich wurde. Sie waren schmutzig, ihre Kleider zerrissen und die bloßen Zehen blutig gescheuert. Als der Schmied zu ihnen hinübersah, steckten sie die Köpfe zusammen, tuschelten und kicherten.
„Puh“, machte Matthäus und riss die Augen so weit auf, dass das Weiß darin seinem vor Staub und Dreck ganz grau gewordenen Gesicht einen dämonischen Ausdruck verlieh. Die Buben schraken auf und liefen schreiend davon.
Wie sehr würde die Stadt darunter leiden? Hatten die Mütter dieser Burschen etwas zu befürchten? Die Väter?
„Matthäus Wilhelm Bergmann, was stehst du da herum und schaust in den Himmel, als gäbe es kein Morgen?“
Er fuhr herum und sah in die liebevoll blickenden Augen seiner Frau. Hildas Mundwinkel umspielte ein schadenfrohes Lächeln. Es amüsierte sie, den großen, starken Kerl dabei ertappt zu haben, wie er gedankenversunken vor sich hin starrte. Es hatte fast etwas Mütterlich-Herrisches an sich, wie sie sich, die Arme in die Hüften gestemmt, breitbeinig vor ihm aufbaute und ihn schalt. Obwohl das natürlich grotesk aussah. Nicht nur, weil sie fast um eine ganze Kopflänge kleiner war als er, sie war auch eine überaus zarte Frau, deren braunes Haar von einem Kopftuch bedeckt war. Sie trug ein weit ausladendes Kleid mit Schürze. Er machte unwillkürlich einen Schritt auf sie zu und lächelte zurück. In diesem Augenblick riss sich ein kleiner Bub von ihr los und stürmte auf ihn zu. Matthäus packte den Buben, warf ihn in die Luft, fing ihn auf und schüttelte ihn, wobei er ein Geräusch machte, das zugleich ein Lachen und ein Knurren war. Er grub sein Gesicht in den Bauch des Kindes, bis es sich vor Lachen fast verschluckte. Am liebsten, ja, am liebsten hätte Matthäus mit seinem Sohn Theo jetzt zum Spaß gerauft.
Der Bub versuchte auch sogleich auf seine Schultern zu klettern, doch Matthäus stellte ihn vor sich hin, legte eine Hand auf die Stirn des Kleinen, streckte den Arm aus und ließ den Buben auf diese Weise hoffnungslos gegen sich ankämpfen. Irgendwann gab Theo auf und Matthäus strich ihm lachend über die verschwitzten Locken. Aber das Lachen war ein wenig abwesend. Als blickte Matthäus durch seinen Sohn hindurch und hinein in einen anderen Gedanken.
Hilda streckte ihrem Mann ein in ein Tuch gewickeltes Stück Brot entgegen. Sie umarmten sich und er spürte, wie sie in seinen Armen bebte und schluchzte. Er nahm ihr Gesicht in seine rissigen Hände und küsste sie auf den Mund. Ein kurzer, trockener Kuss. Sie erschrak, denn sich in der Öffentlichkeit zu küssen, so etwas hatten sie noch nie gemacht. So etwas gehörte sich auch nicht, auch nicht für Eheleute.
Matthäus kümmerte sich jedoch nicht darum und betrachtete weiterhin seine Frau. Sie war schmal geworden, fand er. Knochiger. Ihr ohnehin spitzes Kinn und die große, blasse Nase, auf der feine, blaue Äderchen zu sehen waren, verstärkten diesen Eindruck. An den Seiten, über ihrem Ohr, bemerkte er graue Haare. Sie blickten einander lange an, so lange, bis Matthäus über ihre Schulter sah und eine Gruppe Halbwüchsiger bemerkte, die unter lautem Stöhnen und Schreien einen Karren die Sporgasse hinauf auf den Berg zogen.
„Geh nach Hause, es dämmert schon“, sagte er. „Verriegel die Tür, mach niemandem auf.“
Er hatte noch etwas hinzufügen wollen. Etwas darüber, wie es in seinem Herzen aussah, vielleicht auch etwas, das ihnen Mut machen sollte. Doch da waren die beiden schon wieder um die nächste Hausecke verschwunden. Er küsste den kleinen Lederbeutel, den er um den Hals trug, und der ein Haarbüschel seiner Frau enthielt.
Matthäus drehte sich um. Seine dichten Augenbrauen beschatteten braune, tief in den Höhlen liegende Augen. Zu anderen Zeiten wäre es ein wunderbar lauer Juniabend gewesen. Er glaubte, Krähen zu hören, und suchte den schmalen Streifen Himmel über sich ab. Er sah ein dünnes Wolkenband. Der Himmel färbte sich violett. Und dann fuhr er herum. Er hatte einen Moment lang geglaubt, ganz dicht an seinem Ohr einen fremden Atem zu spüren.
Hilda hielt den Buben fest an der schwitzenden Hand. Mit der anderen umfasste sie die Spitzen ihres Kopftuchs, das sie sich tief ins Gesicht gezogen hatte. Es wurde rasch dunkler, als sie gebückt durch die Gassen hetzte. Sie drückte sich an die Wand, um Kutschen auszuweichen, immer wieder klapperten Pferde vorüber, auf denen wild gestikulierende und schreiende Soldaten saßen. Eine Gruppe Männer, deren nackte Oberkörper vor Schweiß glänzten, rollte eine Haubitze über den Hauptwachplatz.
Die Frau lief durch die Murgasse, in der die uralten Handwerksfamilien der Tuch-, Seiden- und Schnittwarenhändler ihre Läden längst verriegelt hatten. Sie zwängte sich vorbei an den schwer beladenen Karren voller Holzplanken, die dazu dienen sollten, die Brücke über die Mur zu verbarrikadieren, und lief auf die andere Seite des Flusses. Dort rannte sie über den Vorstadtplatz in Richtung jenes Gebietes, das nur „der Lend“ genannt wurde, weil dort auch die Floße und Plätten mit Brennholz anlegten.
Die Dämmerung war bereits weit fortgeschritten, als die Frau des Schmieds ins Halbdunkel einer menschenleeren, engen Seitengasse einbog. Sie hatte plötzlich das Gefühl, noch schneller laufen zu müssen, als taste etwas Fürchterliches nach ihr. Es war hoffnungslos, sich dagegen zu wehren. In letzter Zeit setzte ihr diese unbestimmbare Angst immer häufiger zu. Ihre Augenlider flatterten, ihr Kopf bewegte sich ruckartig. Sie erinnerte sich an Matthäus’ Worte „Verriegel die Tür“, als sie zitternd und laut atmend versuchte, den Schlüssel ins Schloss zu stecken. Warum hatte er so besorgt geklungen?
Dann fiel ihr der Schlüssel laut klimpernd auf die Steinstufe vor dem Haus. Ihr wurde mit einem Mal kalt, obwohl sich die schwüle Luft nicht bewegte. Warum konnte er nicht wenigstens zum Schlafen nach Hause kommen?
Und dann brach plötzlich die Dunkelheit über sie herein. Sie glaubte ein Flüstern zu hören, ein Kichern – und im selben Moment vermisste sie den Druck der kleinen Hand ihres Buben …
Die Finsternis schien wieder geringer zu werden und die Kälte in ihrem Körper verwandelte sich in Hitze. In einen heißen Strom.
Der Bub stand nicht mehr neben ihr.
„Theo!?“
Sie rannte die Straßen zurück bis zur Brücke. Dann in die andere Richtung, wo sich die Straße in mehrere ungepflasterte, von tiefen Fuhrwerksrillen durchzogene Wege aufteilte. Doch niemand war zu sehen. Keine Menschenseele. Das Dämmerlicht war dichter geworden. Konzentrierter. Als entzöge ihm etwas seine Kraft und ließe es nur in die Richtung dringen, in die sie gerade blickte. Ihr war, als stünde die Zeit still.
Als befände sich nur sie allein auf der Welt. Sonst niemand. Schon gar nicht ihr Sohn.
Als sie aus Leibeskräften nach ihrem Kind zu schreien begann, mit einer grellen, sich überschlagenden Stimme, fühlte sie, dass sie es für immer verloren hatte.
Und doch nahm niemand Notiz von ihr, denn das Geläut der Kirchenglocken dröhnte durch die Stadt. Die Vorhut des Feindes hatte soeben die südlichen Ebenen der Stadt erreicht, drängte die letzten Widerständler zurück – verrückte Burschen, verzweifelte Bauern – und kündigte eine Armee an, deren Stärke und Unerbittlichkeit beinah auf der ganzen Welt gefürchtet waren.
Schauergeschichten
Den Gerüchten zu entgehen, war in diesem Frühjahr unmöglich. Dabei hätte so mancher wer weiß was darum gegeben, sie nicht zu hören. Aus den Wirtshäusern drangen sie hinein in die schattigen Gassen, mit Holzkarren brachten sie die Bauern von den Feldern ins Rumoren der Märkte. Und immer wieder standen Leute beisammen, lauschten einem Bericht und warfen dann unsichere Blicke umher. Es herrschte eine Unruhe in der Stadt, die fast hysterisch schien. Kein Wunder eigentlich, denn rundherum war alles auf der Flucht.
Auch er, Major Franz Xaver Hackher, der Befehlshaber auf dem Schloßberg und dieser Tage ranghöchster Offizier der gesamten Stadt, kannte die Berichte, die Napoleons Armee vorauseilten. Es waren ausgebildete Krieger, die da auf sie zumarschierten. Menschen, denen der Krieg die einzige Möglichkeit bot, zu einer warmen Mahlzeit zu kommen. Und genau darauf setzte Napoleon auch. Schnelle Kampfeinheiten, die keine Zeit damit vergeudeten, so etwas wie eine Feldküche mitzuschleppen. Stattdessen mussten die besetzten Länder die Heerscharen verköstigen. Taten sie es nicht, wurden sie bestraft. Die Franzosen kannten keine Gnade, nicht mit Mann, nicht mit Frau – nicht einmal mit Kindern. Alles brannten sie nieder, alles zerstörten sie, als wollten sie mit den Leben auch alle Hoffnung auslöschen. Für alle Zeit.
Von allen Seiten drangen die Franzosen tiefer ins Reich der Habsburger vor. Auch in den zerklüfteten Bergen der Obersteiermark, rund um den Wallfahrtsort Mariazell, war die Sperre der Österreicher längst überrannt worden, und immer weniger Menschen erreichten völlig erschöpft Graz. Es schien, als ließe man ganz mit Absicht hie und da jemanden fliehen, der dann atemlos Bericht erstattete. Von Blut, von Gräueln, von mordenden Soldaten. Die Franzosen zogen von Dorf zu Dorf, plünderten und brandschatzten – und sie liebten es, wenn ihnen die Gerüchte vorauseilten.
Doch Hackher ließ das alles nicht an sich heran. Er verdrängte die Berichte darüber, dass überall Menschen davonliefen. Für ihn zählten nur die Fakten. Der Berg, den er zu verteidigen hatte, war genau genommen ein 122 Meter hoher Felsen, 460 Meter lang, zwischen 20 und 140 Meter breit. Dolomitgestein. Wenig Holz, das brennen konnte …
Blass blickte der Major durch sein Fernrohr. Alles war nur eine Sache der richtigen Organisation. Wieder und immer wieder ging er in Gedanken durch, wie viele Männer auf welcher Flanke den Schloßberg sichern mussten, damit die Bastion zu halten war. Kam ihm ein Gedanke, wies er seine Adjutanten an, die Männer sofort anzutreiben, ihn umzusetzen. Er sprach in knappen Sätzen. Unmissverständlich.
Der Regen hatte aufgehört, es wurde wärmer. Sogar die Nächte werden bis zum Angriff der Feinde angenehm lau sein, dachte er. Und Hackher war überzeugt davon, dass sie sich auch nur die Nächte aussuchen würden, um anzugreifen.
Er atmete langsam aus und registrierte dabei etwas, das er von sich nicht kannte: ein Zittern des Brustkorbs.
Hackher stand an der Mauer, zu deren Füßen sich die Stadt ausbreitete, und betrachtete die vom Fackelschein beleuchteten Häuser, die teilweise beunruhigend nah an das steinerne Bollwerk heranreichten. Immer und immer wieder spielte er alle Möglichkeiten durch. Und er dachte an die Gerüchte, die er gehört hatte.
Er wusste nun, dass bis vor wenigen Jahren noch kein Heerführer so nah an Graz herangekommen war wie der türkische Sultan Suleiman fast 300 Jahre zuvor. Vom Schloßberg aus hatten die Österreicher die Armee des „Prächtigen“, wie sie Suleiman nannten, beschossen. Aus Zorn darüber zerstörte dieser zwei Kirchen in angrenzenden Ortschaften. Dieses Scharmützel hatte die Grazer veranlasst, ihre Stadtbefestigung auszubauen. Zehn Bastionen, sechs Stadttore und ein tiefer Graben machten sie fortan mit ihrer Renaissancefestung im Inneren zur Hauptfeste des Herzogtums. So nannten die adeligen Herrscher sie zumindest immer ganz gern. Hauptfeste. Als wollten sie die Grazer dadurch beruhigen. Oder sich selbst.
Die Stadt wäre jedenfalls heute gut befestigt gewesen – wenn man diese Mauern all die Jahre hindurch vor dem Verfall bewahrt hätte. Doch das Einzige, was seit den Einfällen der Türken geschehen war, waren ein paar Rangeleien mit einheimischen Bauern, die sich darüber ärgerten, dass die Erntesteuern immer absurder wurden. Sogar Holzscheite hatten die Stadtgardisten zuweilen als Maut verlangt, wenn die Bauern für die Wochenmärkte in die Stadt zogen. Kein Wunder, dass es manchmal zu Schlägereien kam, wenn die Fahne am Rathaus wieder einmal einen dieser Wochenmärkte kennzeichnete. Vor allem, wenn die wortkargen und als eigenbrötlerisch geltenden Schöcklbauern ihr berühmtes Landbrot verkaufen wollten, war die Stimmung oft aufgeheizt.
Rund um die beiden Jahrmärkte – dem Mittfastenmarkt vor Ostern und dem herbstlichen Ägydimarkt – kam es ebenfalls ab und an zu Auseinandersetzungen, aber nichts weiter Aufregendes.
Kein Grund jedenfalls, die Festung instandzuhalten oder gar auszubauen. Und dann ließ Kaiser Joseph II. vor fast dreißig Jahren noch dazu nicht nur die meisten Klöster schleifen, er erklärte Graz auch noch zur freien Stadt. Der Geist der Aufklärung hatte von Graz Besitz ergriffen und begann durch das Tal zu wehen. Die Bürger entledigten sich der finsteren Ecken im Stadtbild, so gut es ging, pflanzten Bäume am Glacis, ließen zu, dass rund um die Festungsmauern neue Häuser errichtet wurden, erfreuten sich des Friedens und ließen die steinernen Mauern der dunklen Vergangenheit verfallen. Diese neue Leichtigkeit, das friedliche Einerlei des Alltags hätte der Beginn einer besseren Zeit sein sollen.
Doch es kam anders. Nichts war leicht, friedlich und besser geworden, denn nun ritt bereits zum dritten Mal innerhalb weniger Jahre ein feiner Herr in französischer Uniform auf Graz zu.
Es war drei Uhr in der Früh am 30. Mai des Jahres 1809, als die Vorhut des Grafen Broussier zum ersten Mal im Süden der Stadt gesichtet wurde. Broussier war jener Offizier, der den Truppen Johanns seit Italien gefolgt war, sie in der Piaveschlacht besiegt hatte und auf Rache nach den empfindlichen Niederlagen in Fontana Fredda sann. Tausende seiner Männer hatten den Tod gefunden. Nun sollte es dem Feind ebenso ergehen.
Hackher selbst konnte die Franzosen in der Ferne noch nicht ausmachen, aber er hatte keinen Zweifel an der Echtheit der Nachricht. Diese berüchtigte Dragoner-Vorhut ritt im gestreckten Galopp durch die Nacht, wirbelte mit Krummsäbeln durch die Luft und konnte stundenlang ein derart hohes Tempo im Kampf gehen, dass den meisten Gegnern schlichtweg die Luft ausging.
Hackher dachte auch an die Größe der Armee, die den Reitern mit Einbruch des nächsten Tages folgen würde. Sie marschierte von Slowenien kommend über die Hügel des Südens im Eiltempo auf die Stadt zu. Er schauderte, hoffte aber sogleich, dass es zu dunkel gewesen war, als dass irgendjemand sein Zögern, dieses Innehalten bemerkt hätte.
Der Major stand inmitten seiner jetzt schon erschöpften, schmutzigen Truppe auf dem oberen Festungsplatz, dem höchsten Punkt des Schloßbergs im Zentrum der Stadt. Er war 42 Jahre alt und hatte eine ganze Menge Schlachten und Belagerungen erlebt. Er hatte in Mantua gekämpft, in Ulm und in Cuneo. Er galt als erfahrener, gerechter und strenger Offizier. Doch obwohl er wusste, wie stark eine belagerte Stadt sein konnte, wenn sie auch nur von einer Handvoll besonnener Männer verteidigt wurde, erschütterte sogar ihn, was er hier vorgefunden hatte. Unter seinem Befehl standen zwar auch Landwehrmänner, doch die Farben ihrer grünen Anzüge und grauen Hosen waren kaum noch zu erkennen. Dieser von Johann im Jahr davor eingerichtete Armeeverband, der alle wehrfähigen Männer zum Dienst mit der Waffe verpflichtete, war nichts als ein abgerissener Haufen zerlumpter Kerle. Hackher hielt, wie im Übrigen auch sein Kaiser, wenig davon, das gemeine Volk zu bewaffnen. Tatsächlich hatten die meisten die eleganten breitkrempigen Hüte bereits abgelegt, die Schuhe hatten viele gleich zu Hause gelassen oder längst eingetauscht. Viele waren bettelarme Bauern, verwegene Burschen, aber echte Soldaten mit Ehrgefühl und Stolz gab es nur wenige unter ihnen. Der Major war sogar versucht gewesen zu bedauern, dass die Schwerverbrecher vor wenigen Tagen nach Ungarn verschifft worden waren. Man hätte hier jeden richtigen Kerl gebrauchen können.
Die Finsternis wurde nur durch den tanzenden Lichtschein einiger Fackeln erhellt. Der Himmel war klar, die Sterne leuchteten. Als das aufgeregte Glockengeläut verstummt war, erhob Hackher seine Stimme zu den schattenhaften Gestalten ringsherum, und sie hallte überraschend kräftig über den Platz. Er hatte so etwas noch nie gemacht – zu seinen Männern geredet. Angesichts der Tatsache, dass es sich hier aber um einen nahezu aussichtslosen Kampf handelte, erinnerte er die Männer an die Worte Johanns, bevor dieser mit Tausenden Männern über die ungarische Straße Richtung Osten abgezogen war. Bis zum letzten Atemzug sollten sie kämpfen, diese Festung so lange wie nur irgend möglich halten. Er, Hackher, wisse, dass nicht einmal jeder Zweite von ihnen ein Gewehr habe, aber es gebe Steine, Holzlatten, Messer. Alles sei im Kampf erlaubt – nur sterben nicht.
Matthäus, der sich unter den Zuhörern befand, verstand Hackhers Vorhaben so: Bis auf Weiteres sollten alle Zugänge und Brücken in die Stadt verbarrikadiert und bewacht bleiben. Hackher wollte verhandeln, versuchen, Zeit zu gewinnen. Auf ein Zeichen hin sollten die Wachen dann aber zurück in die Festung rennen, denn die Stadt würde den Franzosen überlassen, damit sie keinen Schaden davontrage. Sie kämen dem Schloßberg zwar nahe – aber sie würden nicht siegen.
Alle wussten, wie riskant dieses Manöver werden würde, denn kaum einer der Männer hatte jemals einem Franzosen gegenübergestanden. Einem richtigen Soldaten.
„Sie werden uns fressen“, sagte der Schatten neben Matthäus und spuckte auf den Boden.
„Ich gebe uns einen halben Tag, dann macht sich hier jeder von uns in die Hosen und rennt nach Hause.“
Jemand räusperte sich, Matthäus erwiderte nichts.
Er erinnerte sich an den Blick seiner Frau, als sie sich verabschiedet hatte. War es klug gewesen, sich zum Festungsdienst zu melden? War es nicht die Pflicht des Mannes, für Frau und Kind zu sorgen?
Er schwitzte.
Die Stimme des Majors drang zu ihm, als stünde der Mann auf der anderen Seite des Flusses. Es war seltsam, einen Offizier so reden zu hören. Fast hätte man meinen können, er fühlte sich seinen Männern zugehörig. Als sei er einer von ihnen. Was für ein dummer Gedanke.
Matthäus blickte sich um. Wenn sie so beisammenstanden, machte das einen imposanten Eindruck. Sein Herz hämmerte bei dem Gedanken an den bevorstehenden Wahnsinn. Er war der Bürgerbastei zugeteilt worden, dem niedrigsten Punkt der Festung. Sogar aus umliegenden Häusern konnten die Franzosen hineinschießen. Fiel die Bürgerbastei, fiel der Berg.
Ob er seine Frau noch einmal sehen würde?
Er versuchte sich vorzustellen, was die Franzosen aufbieten würden, um den Berg zu stürmen. Sein Mund wurde trocken. Der Major sprach immer noch, erinnerte wieder daran, standhaft zu bleiben, und redete von Stolz und Ehre und Vaterland. Er erinnerte auch an die Pflicht der Väter, ihre Frauen und Kinder zu verteidigen. Und daran, dass jeder gnadenlos erschossen würde, der zu dessertieren versuchte. Er redete unentwegt.
Und Matthäus dachte daran, welch merkwürdige Spiele das Schicksal beherrschte. Er würde bald um sein Leben kämpfen, vom Tod nur durch ein paar steinerne Mauern getrennt. Seine Frau könnte ihm vom Hauptwachplatz aus zurufen, so nah waren sie einander. Und doch lebten sie beide in unterschiedlichen Welten.
Nachdem der Major seine Ansprache endlich beendet hatte, rückten die Gestalten ab, zurück in die Dunkelheit.
Es lag ein bedrückendes Schweigen in der Luft, als die Männer ihre Stellungen bezogen.
Hackher selbst versuchte dort, wo sich die Dunkelheit der südöstlichen Hügel mit jener des Himmels traf, einmal mehr eine Armee auszumachen, aber es gelang immer noch nicht. Dann schaute er hinunter auf die Stadt. Ein erwachsener Mann fürchtet sich nicht vor der Finsternis. Doch selbst er, der Soldat, musste zugeben, dass die Nächte an diesem Ort ganz besonders waren. Er erinnerte sich an die Geschichten, die man sich hier erzählte, als stünden die wirklich dunklen Zeiten erst bevor. Man sagte sich, die schrecklichsten Gestalten kämen stets von jenem Berg herunter, der im Norden der Stadt wegen seines flachen Gipfels weithin bekannt war. Dem Schöckl. Und es war das erste Mal, dass nun auch der edle Major Hackher aus Wien sich diesem Berg zuwandte.
Ganz bewusst hatte er es bislang vermieden hinzusehen, fast wie ein kleiner Bub, der mit der Hand seine Augen verdeckt, weil er Angst hat vor den unheimlichen Augen eines Bildnisses, die einen immer verfolgen, egal, von wo aus man das Bild betrachtet. Hackher starrte hinauf auf den Schatten. Es war kein schöner Berg, kein besonders hoher, der sich da im Grau der Nacht am Horizont abzeichnete, aber die seltsame Kraft, die von diesem Ort auszugehen schien, entging ihm nicht.
Und Hackher war einen Augenblick lang fast unsicher, welcher Feind der größere war – Napoleons Heerscharen oder die Armeen der Nacht.
Armeen der Nacht, manchmal hatte er merkwürdige Gedanken.
Er schüttelte den Kopf. Als er sich abwandte, bemerkte er, dass einige der Soldaten ihn beobachtet hatten und nun verlegen ihre Blicke senkten.
Hackher räusperte sich, bellte einen Befehl und stapfte steif davon.
Und während oben auf dem Felsen die Männer auf Schlaf verzichten mussten, wurden in der Stadt zu ihren Füßen Gerüchte wispernd verbreitet. Über die Pflastersteine wurden sie von klappernden Holzpantoffeln getragen, von quietschenden Wagenrädern durch den Matsch gefahren.
Hohe Mächte
Die frische Brise verdrängte die abgestandene Luft und ließ Albert Mohr tief durchatmen. Sein Nacken schmerzte so sehr, dass er zunächst kaum den Kopf zu bewegen vermochte, und sein Mund war über Nacht so trocken geworden, dass er sich jetzt mit der Zungenspitze sein Zahnfleisch befeuchten musste. Er wischte mit dem Finger den körnigen Rest des Schlafs aus den Augen.
Dass er überhaupt eingeschlafen war, wunderte ihn jetzt. Mohr erinnerte sich an die Aufregung der letzten Stunden. An die hastige Suche nach Verstecken im Haus, daran, dass er Medikamente und Essensvorräte unter Holzdielen gestopft und die Ersparnisse in einer kleinen Kiste auf dem Dachboden verstaut hatte. Immer wieder war er, der Apotheker, zu seiner Tochter gerannt, um ihr zu versichern, dass alles wieder gut werde. Doch immer, wenn er sich umdrehte, um einen weiteren Handgriff zu tun, kämpfte er mit den Tränen.
Er hatte das seit einigen Jahren. Dieses Mit-den-Tränen-Kämpfen. Natürlich war das früher anders gewesen. Doch drei Tage, nachdem Margarethe zur Welt gekommen war, war seine Frau gestorben. Und die Leute mochten sagen, was sie wollten, aber er hatte sie geliebt. Obwohl sie nur ein Mädel vom Land, eine Bauerntochter, gewesen war. Er hatte sie geliebt: im Stall, an der Böschung der Mur, einmal sogar im Hinterzimmer der Apotheke, die damals noch seinem Vater gehört hatte. Die Freude über die Schwangerschaft war dann auch unermesslich gewesen. Zumindest im ersten Moment, bis er sie hinunterschluckte und dabei den bitteren Geschmack der Wirklichkeit schmeckte. Als sie einander ansahen, das Bauernmädchen immer noch mit Freudentränen in den Augen, und eine Entscheidung trafen, machte ihr Leben einen Satz in eine Richtung, die sie beide nicht abschätzen konnten. Sie hielten einander zitternd an den Händen und der junge Mann Albert Mohr, gerade einmal 20 geworden, wusste zum ersten Mal nicht wirklich, was er sagen sollte.
„Auf keinen Fall können wir es meinen Eltern sagen“, stellte er kategorisch fest.
Dafür hatte seine Geliebte Verständnis. Verständnis.
Er sah sie deshalb nur umso verliebter an. Ihre Haut roch süßlich, ihr Atem ein wenig nach Knoblauch, doch er mochte das.
Und dann kam alles anders.
Sein Vater war gestorben und hatte ihm die Apotheke in der Murvorstadt hinterlassen. Wenige Monate später war auch die Mutter ins Grab gefolgt. Sie hatten beide an derselben Krankheit gelitten, dem Älterwerden.
Albert Mohr war der jüngste Sohn seiner Eltern, und er kannte sie eigentlich nur als alte Menschen. Über den Verlust der Familie – auch die beiden Brüder, die irgendwo im deutschen Reich gegen die Franzosen kämpften, hatte er seit Jahren nicht mehr gesehen – tröstete ihn nun die enorme Verantwortung hinweg. Für seine Apotheke. Für seine eigene Familie.
Er holte das Bauernmädchen zu sich in die Stadt, heiratete es an einem verregneten Vormittag in der Kirche Maria Straßengel im Norden von Graz und versuchte, das boshafte Getuschel der Stammkundschaft so gut es ging zu ignorieren. Während seine Frau rundlich wurde, zog sich Albert Mohr aber auch selbst immer mehr zurück. Er schämte sich ein wenig wegen ihres Dialekts.
Freilich, so etwas würde Mohr niemals öffentlich zugeben, schließlich waren Loyalität, Anstand und Korrektheit gewissermaßen immer schon Familienleitsätze gewesen. Insgeheim aber, nun ja … Wie das wohl weitergehen würde? Eine Bäuerin in einer Apotheke? Ein Mädel vom Land mit einem Bürger? Ob es das Geschäft schädigte? Ob es ihm selbst schadete? Sogar, wenn er solche Gedanken nur ganz flüchtig dachte und dabei allein vor dem Spiegel über der Waschschüssel beim Rasieren stand, sogar in diesem privaten Moment spürte er, wie ihm das Blut in den Kopf schoss. Er schämte sich vor sich selbst.
Und dann kam wieder alles anders. Sie brachte ein Mädchen zur Welt und sie nannten es Margarethe. Wäre es ein Bub geworden, dann hätte er Theophrastus geheißen, wie der Grieche, den sie in seiner Zunft den Vater der Botanik nannten. Oder wie Theophrastus Bombast von Hohenheim, den sie auch Paracelsus nannten. Der Mann imponierte ihm am Allermeisten, weil er sich gegen die Dünkel der Alchemisten zur Wehr gesetzt hatte. Aber nein – ausgerechnet – es wurde ein Mädchen. Margarethe. Wie banal.
Doch die Enttäuschung darüber währte nur kurz und steigerte sich zur Bitterkeit über Gott und die Welt. Denn obwohl die Geburt einwandfrei verlaufen war, starb seine Frau noch im Wochenbett. Und nach ihrem Tod schwand das Lächeln aus Albert Mohrs Gesicht. Es wurde sogar so gründlich weggewischt, als habe er es nie gelernt.
Und nicht nur das: Immer häufiger füllten sich seine Augen mit Tränen – und das von einem Moment zum anderen. Manchmal nahm er die Bestellung einer Kundschaft freundlich entgegen, hielt seinen Kopf dabei so schief, wie er es immer tat, fixierte sein Gegenüber, nickte, stieg auf die Leiter, holte die Salbe aus einer der tiefen Schubladen im Regal, und als er sich umdrehte, hatte er Mühe, die Fassung wiederzufinden. Er tat dann immer so, als sei ihm etwas ins Auge geflogen, ein Staubkorn, eine Mücke, dabei hätte er tatsächlich am liebsten losgeweint. Er zitterte außerdem ganz ohne Grund. Manchmal atmete er auch zu schnell.
Er dachte oft an früher. An viel früher. In letzter Zeit wieder häufiger.
Jetzt stand er vor dem offenen Fenster, hielt sich an der Fensterbank fest und lehnte sich so weit hinaus, wie es ihm möglich war. Man hätte hinauslaufen mögen, sich in den Gastgarten hocken und einen Becher Wein trinken, vielleicht sich – ja soweit könnte man gehen – vielleicht sich sogar wieder einmal ein Lächeln auf die Lippen zaubern lassen, so gutmütig und wohltuend erhellten die ersten Sonnenstrahlen den Tag. Doch dann streifte plötzlich wieder ein Luftzug aus dem Inneren des Zimmers seine Nase. Ein Geruch, der von ungewaschenen Körpern erzählte, von Erbrochenem, Schweiß und Krankheit. Von seltenen Tees, unaussprechlichen Tropfen und fremden Salben. Von tröstenden Worten, Beschwichtigungen und – Geheimnissen.
Er zwang sich dennoch hinabzublicken auf die schmale Gasse vor seinem Fenster, die den Murvorstadtplatz und die gedeckte Brücke verband. Das führte ihn schließlich endgültig zurück in die bittere Ungewissheit der Gegenwart. Denn vor dem Haus des Apothekers Albert Mohr zog soeben die Grande Armée vorüber, die Soldaten Napoleons.
Sie waren am Hotel „Zum Schwarzen Elephanten“, aus dessen Fenstern sich ebenfalls die Leute gelehnt hatten, vorübermarschiert. Es war eine seltsame Prozession. Schweigende Männer jeden Alters in loser Zweierreihe. Die meisten trugen hohe schwarze Helme, schmutzig weiße Hosen und blaue Jacken. Viele von ihnen hatten Lumpen um ihre Füße gewickelt, manche waren überhaupt barfüßig. An den Spitzen ihrer Bajonette steckten die Vorräte der Bauern der Umgebung, die sie geraubt hatten. Geflügel, Brot und Käse baumelten über den Köpfen der Soldaten. Mohr betrachtete auch die blanken Spitzen mancher Bajonette und stellte – ganz sachlich, fast schon fachmännisch interessiert – fest, dass die metallenen Klingen so lang waren, dass sie einen menschlichen Körper spielend leicht durchbohren konnten. Eine Marotte seinerseits. Er versuchte den Dingen immer einen praktischen Sinn zu geben. Das nahm ihnen manchmal auch den Schrecken. Das blanke Metall schwankte im Gleichklang der Schritte.
Mohrs Blick traf sich mit jenem eines Mannes, der auf der gegenüberliegenden Straßenseite stand. Ein einzelner, französischer Soldat, der – warum auch immer – etwas abseits seiner Kameraden stand. Dennoch war zu erkennen, dass er dunkle Augen hatte, die zu tief in ihren Höhlen lagen. Seine Lippen waren unförmig, die untere zu dick, die obere zu dünn, und sein Kinn schob sich fast vor die Nasenspitze. Der Mann war hager, braun gebrannt und auffallend groß. Sein schulterlanges Haar hatte er zu einem Zopf gebunden, was ihn eitel erscheinen ließ, fast geckenhaft.
Der Franzose musterte Mohr, doch seine Züge verrieten weder Hass noch Geringschätzung, nicht einmal allzu großes Interesse. Er sah ihn vielmehr aus Mangel an Alternativen an. Als interessiere ihn diese Stadt und dieser ganze Auflauf gar nicht. Ja, es lag geradezu etwas Teilnahmsloses in diesen Augen. Als habe der Lauf der Zeit und der Dinge etwas in ihm absterben lassen.
Mohr riss sich von dem Blick los, doch es kostete ihn Mühe, am Fenster stehen zu bleiben. Er fühlte sich ertappt, spürte den Schweiß an seinem Haaransatz.
Von der Spitze der grimmigen Prozession hallten die Hufe der Pferde von einer Gruppe Husaren über den Murvorstadtplatz. Säbel und Pistolen schepperten an den ledernen Gurten und Sätteln. Die Männer sahen so eindrucksvoll aus wie auf Gemälden. Stolz und mutig, und niemand zweifelte daran, dass sie keine Scheu davor hatten, jederzeit die blanke Waffe zu ziehen, vom Pferd zu springen und sich mit wildem Geheul in den Kampf zu stürzen.
Mohr fiel auch auf, dass die Kavalleristen älter waren als die Fußsoldaten. Unter dem Fußvolk der Franzosen hatte er Gesichter bemerkt, deren Jugend bis zu ihm hinauf in den zweiten Stock sichtbar war. Erst jetzt stellte er außerdem fest, dass ihn einige der Vorübergehenden argwöhnisch beobachteten. Als sehe er so aus wie ein selbstmörderischer Heckenschütze.
Einige nickten aber auch zu ihm hinauf und kicherten dabei. Diesmal blieb Mohr unbeeindruckt und verfolgte weiter, wie sich die Franzosen der Brücke näherten.
Noch am Vortag hatten die Österreicher den Durchgang zwischen den Kramläden auf der Brücke mit allerlei Gerümpel versperrt. In diesem Augenblick trat eine Handvoll österreichischer Soldaten von einem an der Uferböschung vertäuten Floß auf die Franzosen zu. Man konnte deutlich sehen, wie sehr sie darauf Wert gelegt hatten, adrett und eindrucksvoll zu wirken. Das Resultat war nahezu beschämend, fand Mohr. Hackhers Männer sahen müde und abgekämpft aus, das schulterlange Haar war glatt zurückgestrichen und sie hatten zerknitterte Jacken an. Immerhin versuchten sie sich offenbar nichts von ihrer Nervosität anmerken zu lassen. Er hatte auch den Eindruck, als bemühten sie sich unentwegt, ihrem Drang, sich zu verbeugen, zu widerstehen.
Die beiden Gruppen unterhielten sich einige Zeit miteinander und schließlich stieg ein Franzose theatralisch vom Pferd. Die Österreicher legten ihm ein Tuch über den Kopf, verbanden ihm damit die Augen und nahmen ihn in ihre Mitte. Sie begleiteten ihn zum Floß.
Mohr schrak auf, als er plötzlich ein Flüstern aus dem Inneren des Zimmers hörte.
„Was ist los?“
Er fuhr herum.
Obwohl er das Fenster und die Vorhänge geöffnet hatte, lag der hintere Teil des Zimmers immer noch in düsterem Halbdunkel. Seine Augen mussten sich erst wieder daran gewöhnen. Margarethe hatte sich im Bett aufgesetzt. Ihr braunes Haar klebte an den bleichen Wangen, die dunklen Augen blickten ihn ausdruckslos an. Als habe sie nicht soeben geflüstert, als gehöre ihr die eigene Stimme nicht. Als spräche eine andere aus ihrem Körper. Als sei sie in Wahrheit weit, weit fort.
„Es ist nichts, mein Mädchen“, versuchte er seine Tochter zu beruhigen. „Die Franzosen sind da. Sie verhandeln mit den Leuten vom Berg.“
Sie stöhnte und ließ sich wieder auf ihr Kissen fallen. Das Haar floss über die Bettkante und selbst im Dämmerlicht des Zimmers war die Blässe ihres Gesichts auffällig. Sie hatte schwarze Augenringe. Durch die blassen Lippen zogen sich feine Risse. Es bereitete dem Mädchen mittlerweile offenbar schon große Anstrengung, sich aufzusetzen. Manchmal dachte er, sie habe seine Traurigkeit geerbt, und dass es ihr an Lebensfreude mangle. Doch tief im Innern wusste er, dass da mehr war. Dass etwas viel Boshafteres von ihr Besitz ergriffen hatte.
Mohr wandte sich wieder der Straße zu. Der Franzose, dem sie die Augen verbunden hatten, stieg soeben bereitwillig mit den Österreichern auf das Floß. Was auch immer sie vorhatten, es schien nichts zu passieren, wovor man sich als Zivilist unmittelbar fürchten musste. Der Tross der Soldaten war zum Stehen gekommen. Einige hatten sich hingehockt, andere stützten sich nur müde auf ihre Gewehre. Die Pferde der Husaren schnaubten. Dicke Rossäpfel fielen auf die Straße und verbreiteten schnell einen intensiven Gestank.
Mohr wandte sich um und ging auf das Bett zu. Wie sie so dalag, schlank, zart und blass wie eine Märchenprinzessin, erinnerte Margarethe ihn sehr an seine Frau. Dass seine Tochter wirklich große Ähnlichkeit mit ihr hatte, bewies ihm auch immer wieder die Reaktion der Leute. Manchmal stutzte eine ältere Kundschaft, wenn Margarethe im Geschäft war. Mohr seufzte. Stets an frühere Tage erinnert zu werden, kostete eine Menge Kraft.
Er erinnerte sich daran, wie damals, als seine Frau im Sterben lag, Nonnen ein und aus liefen. Das Flattern ihrer Nonnentrachten und Schleier machte dasselbe Geräusch wie die Wäsche, die zum Trocknen auf Seilen hing und vom Wind bewegt wurde. Pfarrer waren dabei, ein Bader, sogar ein Arzt aus dem Bürgerspital. Mohr glaubte sich daran zu erinnern, dass er stundenlang nur auf einem einfachen Stuhl im Salon gesessen hatte und die Leute grußlos an ihm vo-rübergeeilt waren. Er ließ sie gewähren, ließ sie alles tun, was nötig war.
Allein, es half nichts.
Später hatte er seine Tochter so gut es ging allein großgezogen. Und jetzt, keine 16 Jahre alt, war auch Margarethe krank geworden.
Wenn er nur wüsste, wie er ihr helfen konnte. Der Atem des Mädchens rasselte. Fahrig fuhr er sich durchs Haar. Was geschah hier nur? Verlor er alle Menschen, die ihm lieb und teuer waren? Er spürte, wie seine Augenränder heiß wurden, doch er unterdrückte die Tränen. Stattdessen schob er den Kragen ihrer Bluse sanft auf die Seite und klopfte ihren Brustkorb ab. Er schloss die Augen, während er auf diese Weise versuchte, der merkwürdigen Krankheit auf den Grund zu gehen. Er hatte von dieser Methode, dem Perkutieren, einmal gehört. Sie soll von einem Arzt aus Graz namens Auenbrugger erfunden worden sein. Dieser Arzt war der Sohn eines Wirts und Nachbarn Albert Mohrs. Er war erst vor ein paar Wochen in Wien gestorben.
Mohr hatte einmal von ihm reden gehört, bei einem dieser Empfänge für einen ehemaligen hochrangigen Offizier, der sich in Graz zur Ruhe gesetzt hatte. Das heißt, in Wahrheit hatte Mohr – als er bemerkt hatte, dass eine Runde über den Arzt in Wien sprach – es sich nicht verkneifen können, dezent anzumerken, dass er dessen Nachbar gewesen sei. Gewissermaßen. Nicht Haus an Haus, aber immerhin, ganz in der Nähe. Es hätte ein anregendes Gespräch werden können, stattdessen hatte dem niemand mehr etwas hinzuzufügen. Der Dialog verebbte, bis sich das Gesprächsthema änderte, Albert Mohr sich bald fehl am Platz fühlte und sich empfahl.
Mohr mochte Empfänge nicht. Dieses Anbiedern, dieses Gezwungene-Gespräche-Führen und dieses Verdrängen der Tatsache, dass man auch als Bürger, selbst als Apotheker, immer zu spüren bekam, kein Adeliger und eben deshalb weniger wert zu sein. Beim Nachhausegehen hatte er Mühe, den Weg zu finden, wegen der Tränen, die ihn wieder einmal überwältigten. Er konnte sich nicht einfach niedergeschlagen fühlen, er war immer gleich zu Tode betrübt. Die Einsamkeit schien ihn dann förmlich zu erdrücken.
Er konnte nichts Ungewöhnliches an der Lunge seiner Tochter erkennen und ärgerte sich ein wenig. Man brauchte viel Feingefühl, um mit dieser simplen Klopfmethode etwas zu erkennen. Manchmal gelang es ihm, manchmal nicht. Er war kein Arzt, aber wenigstens zu versuchen, sich so viel Wissen wie nur irgend möglich anzueignen, kam ihm allemal menschlicher vor, als sein Kind jeden Tag zur Ader zu lassen. Dennoch: Welche Möglichkeiten blieben ihm noch? Es ging dem Mädchen immer schlechter und er konnte nichts daran ändern.
Als er die Augen öffnete, blickte ihn seine Tochter unverwandt an.
Sie sagte: „Sie werden auch weiterhin nichts finden, Vater. Es ist nicht Ihre Schuld.“
Ihre Stimme war nicht mehr als ein Flüstern.
„Es ist die Frau, die mich krank macht.“
Ihre Augen suchten nervös die dämmrige Umgebung des Raumes ab.
„Sie ist eine Hexe, wisst Ihr.“
Mohr hörte sein Blut rauschen. Die Zeit verging nicht.
Hexen …
Die Tür flog auf und Mohr sprang von der Bettkante hoch. Er schnappte nach Luft, wollte schreien, doch dann rührte er sich nicht mehr. Aus dem Treppenhaus blitzte etwas Metallenes ins Zimmer, gefolgt von einem Soldaten.
Das Bajonett zeigte auf seine Brust.
Während der erste Franzose sich vor dem Apotheker aufbaute, stellte sich ein zweiter ans Fenster und ein weiterer inspizierte die Einrichtung des Zimmers. Er betastete den Kronleuchter, betrachtete sich kurz im Spiegel, der in einem Kastanienholzrahmen steckte. Die Bohlen knarrten unter seinen Schritten.
Mohr versuchte, dem Fremden nicht in die Augen zu sehen, versuchte, nicht einmal zu atmen, nichts Falsches zu tun. Und doch fiel ihm gleich etwas auf: Der, der am Fenster stand, war besser gekleidet. Sein blauer Frack war sauber, seine Stiefel glänzten. Der Soldat, der ihm das Bajonett an die Brust hielt, hatte dagegen nicht einmal richtiges Schuhwerk. Lumpen umhüllten seine Füße, die enge Hose wies Risse auf und die Knöpfe seines Hemdes standen offen. Sein Atem roch säuerlich nach Wein. Der zweite Soldat, der nun die quietschende Schranktür öffnete und missbilligend feststellte, dass alles voller Damenkleider war, trug zwar Schuhe, doch sie schienen nicht zueinanderzupassen. Seine Kleidung war voller brauner Flecken und Mohr stellte bestürzt fest, dass es sich um getrocknetes Blut handeln musste. Der Mann war außerdem unrasiert und eine hässliche Narbe zog sich quer über die linke Wange. Und nun erkannte Mohr auch den Mann, der am Fenster stand, wieder. Es war jener große Hagere, der ihn zuvor von der anderen Straßenseite aus beiläufig gemustert hatte.
Die Lade des Nachttischkästchens wurde geöffnet, doch sie enthielt nur Taschentücher. In einer Truhe befand sich Bettzeug, auf einem schmalen Wandtisch stapelten sich ein paar Bücher. Mohrs Blick fiel auf Gutsmuths „Spiele zur Übung und Erholung“. Es war ein Hohn, dass ausgerechnet seine Tochter dieses Buch besaß, wo sie doch kaum noch ins Freie kam und jede Anstrengung vermeiden musste.
Er erblickte auch Ausgaben von Jonathan Swifts „Gullivers Reisen“ und Fenelons „Seltsame Abenteuer des Telemach“. Den Faible für das Lesen hatte er an seiner Tochter immer schon mehr geduldet als gemocht. Wer weiß, vielleicht hatte sie diese Zurückgezogenheit in die Stille, diese ständige Anstrengung der Augen letztlich so kränklich gemacht.
Auf dem Wandtisch waren außerdem noch eine Kerze, ein Becher Wein, ein Porzellanlöffel zum Einnehmen der Arzneimittel. Mohr konnte nicht anders, als sich alles genau anzusehen. Als wolle er sich noch einmal all seine Habseligkeiten einprägen, bevor er sterben musste.
Aber er starb nicht. Jedenfalls noch nicht. Der Mann am Fenster stand aufrecht, fast steif. Er hatte trotz der eingefallenen Wangen und des düsteren Blicks etwas Überhebliches, als sei er von höherem Stand als die beiden anderen. Der Griff der Pistole an seinem Gürtel und des Säbels an seiner Hüfte und eines Messers, das in einer Scheide steckte, blitzte auf. Quer über seinen Oberkörper trug er einen Munitionsgurt, der sich mit dem Riemen einer ledernen Schultertasche kreuzte. Der Stutzen in seiner Hand war kürzer als die Gewehre der beiden anderen. Seinen Hut hatte er abgenommen, so sah man, dass sein Haar bereits schütter an den Schläfen und grau über den Ohren wurde.
Einer der Soldaten wühlte mittlerweile in einer Lade in Margarethes Unterwäsche. Die Franzosen sahen sich an und musterten dann das Mädchen im Bett. Mohr fand, dass sie es eine Spur zu lange taten. Der Mann, der das Zimmer durchsuchte, kam näher und räusperte sich. Er ließ Margarethe nicht aus den Augen, als er fragte: „Krank?“
„Ja“, erwiderte Mohr schnell. Zu schnell, wie er gleich fand. „Todkrank.“ Er errötete.
Margarethe blickte kurz zu ihm auf.
Die beiden Soldaten wechselten abermals einen Blick, ehe sich der Dritte endlich vom Fenster löste und den anderen etwas zurief. Er eilte ihnen mit zackigem Schritt voraus aus dem Zimmer und drehte sich dabei nicht mehr um. Von der Seite sah er seltsam aus, denn er hatte ein vorspringendes Kinn. Dabei schüttelte er den Kopf, als fände er alles, diese Leute, dieses Zimmer, das Haus und die ganze Stadt, einfach nur lächerlich. Mohr hatte bis zuletzt das Gefühl, dieser Mann könne sich in einer plötzlichen Anwandlung dazu entschließen, ihn und seine Tochter einfach aufspießen zu lassen.
Tatsächlich zeigte immer noch ein Bajonett auf den Apotheker. Die beiden Soldaten blickten ihn lange an.
„Krank“, wiederholte der eine wieder und schnaufte verächtlich durch die Nase.
Mohr nickte langsam.