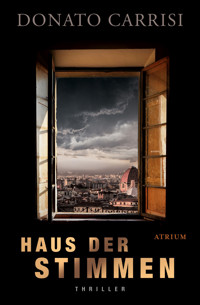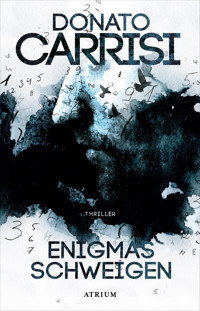8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
In einer Waldlichtung bergen Spurensicherer menschliche Gliedmaßen: die Arme von sechs vermissten Mädchen. Für Profiler Goran Gavila und Sonderermittlerin Mila Vazquez steht fest, dass sie es mit einem extrem kaltblütigen Serientäter zu tun haben. Aber sie ahnen noch nicht, wie perfide der gesichtslose Mörder zu Werke geht. Wie ein Marionettenspieler benutzt er andere dazu, seine grausamen Phantasien Wirklichkeit werden zu lassen. Und auch sie selbst sind längst Figuren eines beängstigenden Spiels geworden, in dem der Gesuchte allen seine makabren Regeln diktiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Inhalt
Impressum
1. Brief
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
2. Brief
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
3. Brief
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Abhörprotokoll Nr. 7
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Epilog
Nachwort
Danksagung
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Übersetzung aus dem Italienischen von Christiane von Bechtolsheim und Claudia Schmitt
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
1. Auflage 2010
ISBN 978-3-492-95682-6
© Longanesi, Mailand 2009 Titel der italienischen Originalausgabe: »Il Suggeritore« Deutschsprachige Ausgabe: © Piper Verlag GmbH, München 2010 Umschlagkonzept: semper smile, München Umschlaggestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich
Justizvollzugsanstalt■■■■■■■■■
Landgerichtsbezirk Nr.45
Dr. Alphonse Bérenger
(Gefängnisdirektor)
An den
Oberstaatsanwalt
J.B. Marin
23. November d.J.
Betreff: Streng vertraulich
Sehr geehrter Herr Marin,
gestatten Sie, dass ich mich wegen eines seltsamen Falles an Sie wende. Er betrifft einen unserer Häftlinge.
Der Mann ist bei uns ausschließlich unter seiner Häftlingsnummer RK-357/9 bekannt, da er sich seit dem ersten Tag hartnäckig weigert, seine Personalien anzugeben.
Seine Festnahme erfolgte am 22. Oktober. Die Polizei hat ihn nachts auf einer Landstraße in der Gegend von ■■■■■■■■■ aufgegriffen, weil er allein und unbekleidet umherirrte.
Der Abgleich seiner Fingerabdrücke mit unserer Datenbank ergab, dass er weder in frühere Verbrechen noch in bislang ungelöste Fälle verwickelt ist. Da er sich jedoch auch vor dem Untersuchungsrichter kategorisch weigerte, irgendwelche Angaben zu seiner Person zu machen, wurde er zu einer Haftstrafe von vier Monaten und achtzehn Tagen verurteilt.
Während seines gesamten bisherigen Aufenthalts in der JVA hat sich der Häftling Nummer RK-357/9 strikt an die Gefängnisordnung gehalten und stets ein sehr diszipliniertes Verhalten an den Tag gelegt. Davon abgesehen ist er ein kontaktscheuer Sonderling.
Das dürfte auch der Grund dafür sein, dass sein eigentümliches Verhalten lange unbemerkt blieb und erst kürzlich einem unserer Wärter auffiel: Der Häftling reinigt jeden Gegenstand, mit dem er in Berührung gekommen ist, und poliert ihn mit einem weichen Lappen; sämtliche Kopf- und Körperhaare, die er im Laufe eines Tages verliert, werden gewissenhaft von ihm eingesammelt und entsorgt, Besteck und Kloschüssel nach Gebrauch auf Hochglanz gebracht.
Der Mann leidet also an einem Sauberkeitswahn. Oder aber – und das scheint mir persönlich die plausiblere Erklärung – er möchte unter keinen Umständen organisches Material hinterlassen.
Ich hege deshalb den ernsten Verdacht, dass der Häftling RK-357/9 ein Gewaltverbrechen begangen hat und verhindern möchte, anhand von DNA-Proben identifiziert zu werden.
Bis heute hat der Mann die Zelle mit einem anderen Häftling geteilt, wodurch er seine biologischen Spuren relativ leicht verwischen konnte. Inzwischen habe ich ihn jedoch aus der Gemeinschaftszelle entfernen und in Einzelhaft unterbringen lassen.
Aus gegebenem Anlass möchte ich Sie bitten, entsprechende Ermittlungen einzuleiten und zu beantragen, dass der Häftling Nummer RK-357/9 durch richterlichen Bescheid zur Abgabe einer biologischen Probe (Mundhöhlenabstrich, Blutentnahme) aufgefordert bzw. gezwungen wird.
Ein Eilverfahren scheint mir in diesem Zusammenhang dringend angeraten, denn der Häftling wird heute in 109 Tagen (am 12. März) entlassen.
Mit freundlichen Grüßen,
Dr. Alphonse Bérenger
(Gefängnisdirektor)
1
Ein Ort in der Nähe von W.5.Februar
Der große Nachtfalter flog ihn durch die Dunkelheit. Geschickt wich er den Gefahren der Berge aus, die friedlich wirkten wie Schulter an Schulter schlafende Riesen. Über ihnen der samtene Himmel. Unter ihnen dichter Wald.
Der Pilot sah sich nach seinem Passagier um und deutete auf ein riesiges weißes Loch am Boden, ähnlich einem beleuchteten Vulkankrater. Der Hubschrauber schwenkte und flog darauf zu. Sieben Minuten später landete er auf dem schmalen Seitenstreifen einer Landstraße. Die Straße war gesperrt, ringsum wimmelte es von Polizisten. Ein Mann in dunkelblauem Anzug holte den Passagier unter dem laufenden Rotor ab und hatte dabei alle Mühe, seine flatternde Krawatte zu bändigen.
»Herzlich willkommen, wir haben schon auf Sie gewartet!« Er musste schreien, um das Knattern der Rotorblätter zu übertönen.
Goran Gavila erwiderte nichts.
»Kommen Sie, ich erkläre Ihnen alles unterwegs«, fuhr Kommissar Stern fort.
Sie schlugen einen Trampelpfad ein und entfernten sich von dem lärmenden Helikopter, der sich bereits wieder in die Höhe schraubte und kurz darauf vom nachtblauen Himmel verschluckt wurde.
Der Nebel glitt wie ein Leichentuch von den Bergen und entblößte ihre Konturen. Die Gerüche des Waldes ringsum verschmolzen mit der nächtlichen Feuchtigkeit, die an den Kleidern emporkroch und sich kalt an die Haut schmiegte.
»Leicht hat er es sich nicht gemacht, das kann ich Ihnen sagen. Wer das nicht gesehen hat …«
Kommissar Stern redete im Gehen; er war Goran ein paar Schritte voraus und bahnte ihm den Weg durchs Gestrüpp. »Es fing alles heute Morgen an, so gegen elf. Zwei Jungen führen ihren Hund spazieren, schlagen diesen Weg ein und folgen ihm bergauf durch den Wald. Oben angekommen, treten sie auf die Lichtung hinaus, und da gerät der Hund völlig aus dem Häuschen. Ein Labrador, müssen Sie wissen. Die sind bekannt dafür, dass sie gern graben … Jedenfalls nimmt das Tier Witterung auf, gräbt ein Loch – und fördert den ersten zutage.«
Goran war bemüht, Schritt zu halten, während sie auf dem steilen Pfad immer tiefer ins Unterholz eindrangen. »Natürlich laufen die Kinder sofort los und verständigen die örtliche Polizei«, fuhr der Beamte fort. »Die ist augenblicklich zur Stelle, nimmt den Ort in Augenschein, vermisst, sucht nach Indizien – was man eben so macht, Routinearbeit. Irgendwann kommt einer auf die Idee, weiterzugraben und nachzusehen, ob noch mehr zu finden ist. Dabei stoßen sie auf den zweiten. Daraufhin werden wir eingeschaltet: Wir sind jetzt seit drei Uhr hier. Im Moment kann niemand absehen, was da noch alles vergraben liegt. So, wir sind da …«
Vor ihnen öffnete sich eine kleine, von gewaltigen Scheinwerfern erhellte Lichtung – die leuchtende Krateröffnung. Die Düfte des Waldes verflogen auf einen Schlag und wichen einem beißenden Geruch.
Goran hob den Kopf, schnupperte kurz und sagte: »Phenol.«
Ein Kreis aus kleinen Gräbern. Und rund dreißig Männer in weißen Schutzanzügen, die mit kleinen Schaufeln in der Erde gruben. Einige durchkämmten das Gras, während andere fotografierten und sorgfältig jedes Fundstück katalogisierten. Alles bewegte sich wie in Zeitlupe. Jeder Handgriff saß, jede Geste war wohlüberlegt, jede Aktion erfolgte mit traumwandlerischer Sicherheit, und über allem lag eine ehrfurchtsvolle Stille, die nur hin und wieder vom Klacken eines Blitzlichts durchbrochen wurde.
Goran Gavila entdeckte die Kommissare Sarah Rosa und Klaus Boris. Auch Hauptkommissar Roche war da.
Als dieser ihn sah, kam er mit großen Schritten auf ihn zugeeilt, doch Goran ließ ihn gar nicht erst zu Wort kommen. »Wie viele?«, fragte er, bevor Roche auch nur den Mund aufmachen konnte.
»Fünf. Und jedes ist genau fünfzig Zentimeter lang, zwanzig breit und fünfzig tief. Was vergräbt man deiner Meinung nach in solchen Löchern?«
In allen ein und dasselbe.
Der Kriminologe sah sein Gegenüber erwartungsvoll an.
Die Antwort kam prompt: »Linke Arme.«
Gorans Blick schweifte über die Leute von der Spurensicherung, die das absurde Gräberfeld untersuchten. Sie förderten verweste Körperteile zutage, doch das wunderte ihn nicht, denn das eigentliche Verbrechen, um das es hier ging, hatte lange vor dieser irreal anmutenden Nacht stattgefunden.
»Sind es die Mädchen?«, fragte Goran, aber diesmal kannte er die Antwort bereits.
»Dem Barr-Test zufolge handelt es sich um Personen weiblichen Geschlechts und weißer Hautfarbe, zwischen neun und dreizehn Jahre alt.«
Kinder.
Roches Stimme verriet nicht die geringste Regung, als er den Satz aussprach.
Debby. Anneke. Sabine. Melissa. Caroline.
Die Geschichte hatte fünfundzwanzig Tage zuvor begonnen: Aus einem angesehenen Internat für Sprösslinge reicher Eltern war eine Schülerin verschwunden. Zunächst dachten alle, sie sei abgehauen. Das Mädchen war zwölf Jahre alt und hieß Debby. Ihre Klassenkameraden hatten sie zuletzt gesehen, als sie bei Unterrichtsende das Klassenzimmer verließ. Man war erst bei der allabendlichen Zusammenkunft im Mädchenschlafsaal auf ihr Fehlen aufmerksam geworden. Alles deutete darauf hin, dass es sich um einen dieser Fälle handelte, denen die Lokalzeitungen einen halben Artikel auf der dritten Seite widmen; danach nur noch kurze Pressenotizen in Erwartung des sicheren Happy Ends.
Doch dann verschwand Anneke. Aus einem kleinen Dorf. Anneke war zehn Jahre alt. Zunächst nahm man an, sie hätte sich bei einem ihrer zahlreichen Ausflüge mit dem Mountainbike im Wald verirrt. Die Suchtrupps wurden tatkräftig von der örtlichen Bevölkerung unterstützt. Aber die Suche war erfolglos geblieben.
Noch bevor man richtig begriff, was eigentlich los war, passierte es erneut. Die dritte hieß Sabine, sie war die jüngste. Neun Jahre alt. Diesmal war es in der Stadt passiert, an einem Samstagabend. Das Mädchen war mit seinen Eltern auf dem Rummelplatz, wie viele andere Kinder. Es kletterte auf das Holzpferd eines Karussells. Bei der ersten Runde winkte die Mutter ihr zu. Sie winkte auch bei der zweiten Runde. Bei der dritten Runde war Sabine verschwunden.
Drei vermisste Kinder innerhalb von nur drei Tagen – erst da fiel auf, dass es hier nicht mit rechten Dingen zugehen konnte. Sofort wurden die Ermittlungen aufgenommen, in großem Stil. Von Anfang an war die Rede von einem oder mehreren Sexualverbrechern, vielleicht sogar einer Bande. Obwohl es für einen konkreten Tatverdacht keinerlei Anhaltspunkte gab. Die Polizei richtete eine Sonderrufnummer ein, unter der jeder, der etwas wusste, sich melden konnte, auch anonym. Hunderte von Hinweisen gingen ein. Doch von den Mädchen keine Spur. Da die Kinder zudem in ganz verschiedenen Gegenden verschwunden waren, konnten sich die örtlichen Polizeidienststellen nicht einigen, wer für die Ermittlungen zuständig war. Man hatte die Mordkommission unter Kriminalhauptkommissar Roche eingeschaltet, auch wenn die sich normalerweise nicht um Vermisste kümmerte. Aber bevor es zu einer Massenhysterie kam, machte man lieber eine Ausnahme.
Roche und seine Leute steckten bereits mitten in dem Fall, als das vierte Kind verschwand.
Melissa war mit ihren dreizehn Jahren die Älteste. Wie die meisten Mädchen in dem Alter hatte auch sie striktes Ausgehverbot – ihre Eltern wollten um jeden Preis verhindern, dass sie dem Triebtäter zum Opfer fiel, der das Land in Angst und Schrecken versetzte. Nur, dass die Ausgangssperre genau auf ihren Geburtstag fiel und Melissa für diesen Abend bereits etwas vorhatte. Also heckte sie mit ihren Freundinnen einen kleinen Fluchtplan aus, um in einem Bowling Center feiern zu können. Die Freundinnen kamen alle wohlbehalten dort an. Nur Melissa erschien nicht.
Danach begann eine chaotische Jagd nach dem Monster, an der sich auch die Bürger des Landes beteiligten, bereit, den Täter notfalls zu lynchen. Die Polizei richtete an allen Ecken und Enden Straßensperren ein. Personen, die bereits wegen Sexualdelikten eingesessen hatten oder unter dem Verdacht standen, sich an Kindern vergangen zu haben, wurden noch schärfer als sonst kontrolliert. Die Eltern trauten sich nicht einmal mehr, ihre Kinder zur Schule zu schicken. Viele Einrichtungen wurden wegen Schülermangels vorübergehend geschlossen. Die Menschen verließen ihre Wohnungen nur noch, wenn es absolut notwendig war, und ab einer gewissen Uhrzeit waren Dörfer und Städte wie ausgestorben.
Zwei Tage lang gab es keine neuen Vermisstenanzeigen. Manch einer dachte schon, die vielen Sicherheitsvorkehrungen hätten zu dem erhofften Erfolg geführt und den Triebtäter entmutigt. Doch das war ein Irrtum. Die Entführung des fünften Mädchens war besonders spektakulär. Das Kind wurde im Schlaf aus dem Bett geholt, ohne dass seine Eltern, die nebenan schliefen, das Geringste mitbekommen hätten.
Fünf kleine Mädchen, die alle innerhalb einer Woche verschwunden waren. Dann siebzehn lange Tage des Schweigens. Bis jetzt. Bis hier – zu diesen fünf in der Erde vergrabenen Armen.
Debby. Anneke. Sabine. Melissa. Caroline.
Goran blickte auf die im Kreis angeordneten Gräber. Fünf Hände, die einen makabren Ringelreigen tanzten. Man glaubte fast, die Mädchen singen zu hören.
»Ab sofort ist klar, dass es sich nicht mehr um Vermisstenfälle handelt«, sagte Roche und winkte die anderen zu einer kurzen Besprechung zu sich.
Das war eine Angewohnheit von ihm. Rosa, Boris und Stern versammelten sich um ihren Chef, verschränkten die Hände im Rücken und starrten auf den Boden, während sie ihm zuhörten.
»Ich denke an den, der uns heute Abend hierhergeführt hat und der für alles, was hier vor sich geht, verantwortlich ist«, begann Roche. »Wir sind hier, weil er es gewollt hat, weil er es sich so ausgedacht und für uns in die Wege geleitet hat. Denn diese ganze Vorstellung, meine Herrschaften, gilt niemand anderem als uns. Einzig und allein uns. Er hat sie gründlich vorbereitet. Sich auf den Augenblick, auf unsere Reaktion gefreut. Er wollte uns in Staunen versetzen. Uns zeigen, wie groß und mächtig er ist.«
Die anderen nickten. Wer immer der Täter war, er hatte ungestört agieren können.
Roche bemerkte, dass Goran, den er längst als Vollmitglied der Mordkommission betrachtete, abgelenkt war; sein starrer Blick verriet, dass ihm etwas durch den Kopf ging.
»Und du, Goran? Was meinst du als Kriminologe zu dieser Geschichte?«
Goran wandte leicht den Kopf ab: »Die Vögel«, sagte er. Mehr nicht.
Zuerst begriff niemand, was er meinte.
Aber das störte ihn nicht weiter: »Als ich hier ankam, ist es mir nicht aufgefallen«, fuhr er fort. »Ich habe es erst jetzt bemerkt. Seltsam. Hört nur …«
Aus dem dunklen Wald stieg das Gezwitscher Tausender Vögel.
»Sie singen«, sagte Rosa überrascht.
Goran wandte sich nach ihr um und nickte.
»Das liegt an den Scheinwerfern«, meinte Boris. »Sie verwechseln das Licht mit dem Tageslicht. Deshalb singen sie.«
»Ihr denkt, das ergibt keinen Sinn.« Diesmal sah Goran die anderen an, während er sprach. »Aber ich sage euch, es ergibt doch einen Sinn. Fünf in der Erde vergrabene Arme. Körperteile. Ohne Leib. Was ist daran schrecklich? Nüchtern betrachtet, eigentlich noch gar nichts. Ohne Körper kein Gesicht. Ohne Gesicht kein Individuum, kein Mensch. Wir müssen uns nur fragen: Wo sind die Mädchen? Denn sie sind ja nicht hier, in diesen Gräbern. Wären sie es, könnten wir ihnen in die Augen sehen, sie als Menschen wahrnehmen. Aber so? Seien wir ehrlich. Was wir heute Nacht gefunden haben, sind keine Menschen. Es sind Teile … Also empfinden wir auch kein Mitleid. Und das sollen wir auch nicht. Wir sollen nur Angst empfinden. Leidtun dürfen uns diese kleinen Opfer nicht. Er möchte uns lediglich mitteilen, dass sie tot sind. Meint ihr nicht, hinter dieser Mitteilung steckt ein Sinn? Tausende Vögel, die mitten in der Nacht von einem unwirklichen Licht zum Singen gebracht werden … Wir sehen sie nicht, aber sie sind da. Was sind diese Tiere? Einfache Lebewesen, einerseits. Andererseits aber auch etwas ganz und gar Unwirkliches, Ausgeburten einer Sinnestäuschung, einer Illusion. Vor Illusionisten aber gilt es sich in Acht zu nehmen. Das Böse tritt bisweilen in Gestalt der simpelsten Dinge auf und führt uns damit hinters Licht.«
Schweigen. Dem Kriminologen war es wieder einmal gelungen, die symbolische Bedeutung von etwas, so unscheinbar es auch sein mochte, prägnant herauszustellen; zu beleuchten, was andere oft übersahen oder – wie in diesem Fall – überhörten. Kleine Details, Nebensächlichkeiten, Nuancen. Den Schatten, der die Dinge umgibt, die dunkle Aura, hinter der sich das Böse verbirgt.
Jeder Mörder hat seinen persönlichen Stil: eine genau definierte Vorgehensweise, die ihm Befriedigung verschafft und auf die er stolz ist. Um ihn zu fassen, muss man sich seine Sicht der Dinge zu eigen machen, was sehr schwierig ist. Ebendeshalb hatte man Goran gerufen. Seine Aufgabe war es, dem scheinbar unerklärlichen Bösen mit den beruhigenden Erkenntnissen der Wissenschaft zu Leibe zu rücken und ihm Einhalt zu gebieten.
In dem Augenblick kam einer der Tatortbeamten auf sie zu; er wirkte ratlos und wandte sich direkt an Roche: »Herr Hauptkommissar, es ist noch ein Arm dazugekommen. Damit sind es sechs.«
2
Der Musiklehrer hatte gesprochen.
Was an sich noch nichts Besonderes war. Viele allein lebende Menschen führen Selbstgespräche, wenn sie sich in den eigenen vier Wänden aufhalten. Auch Mila Vasquez dachte zu Hause manchmal laut.
Nein. Die Neuigkeit war etwas anderes. Und sie belohnte Mila für eine ganze Woche Arbeit. Seit einer Woche beobachtete sie aus ihrem auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkten, eiskalten Auto heraus das braune Haus. Seit einer Woche spähte sie mit einem kleinen Fernglas jede Bewegung des dicken, käsig aussehenden Mannes um die vierzig aus, der seelenruhig in seinem kleinen Reich umherwanderte und dabei ein ums andere Mal die gleichen Handlungen ausführte, als würde er den roten Faden zu einer Geschichte spinnen, deren Handlungsmuster nur er allein kannte.
Der Musiklehrer hatte gesprochen. Aber das wirklich Neue daran war, dass er diesmal einen Namen ausgesprochen hatte. Mila hatte ihn Buchstabe für Buchstabe auf seine Lippen treten sehen. Pablo. Das war für sie die Bestätigung, der Schlüssel zu dieser geheimnisvollen Welt. Jetzt war sie sicher. Der Musiklehrer hatte einen Gast.
Noch vor knapp zehn Tagen war Pablo ein Kind wie viele andere gewesen, ein achtjähriger Junge mit braunen Haaren und lebhaften Augen, der am liebsten auf seinem Skateboard durch die Siedlung düste. Hatte Pablo für seine Mutter oder seine Großmutter etwas zu erledigen, tat er es auf dem Skateboard. Er verbrachte Stunden auf dem Ding, immer die Straße rauf und runter. Für die Nachbarn, die ihn vor dem Fenster vorbeifahren sahen, war der kleine Pablito – wie er von allen genannt wurde – ein fester Bestandteil der Viertels.
Vielleicht war das der Grund, warum an jenem Februarmorgen niemand etwas sah, in der kleinen Vorstadtsiedlung, wo jeder jeden kannte und die Häuser ebenso wie die Tage ihrer Bewohner einander glichen. Ein dunkelgrüner Volvo Van – der Musiklehrer hatte bewusst ein Familienauto gewählt, wie sie hier zu Dutzenden vor den Häusern standen – tauchte in der menschenleeren Straße auf. Die Stille eines ganz gewöhnlichen Samstagmorgens, unterbrochen nur vom leisen Knirschen des Asphalts unter den Autoreifen und vom lauten Schrammen eines Skateboards, das zunehmend an Schnelligkeit gewinnt … Sechs lange Stunden mussten vergehen, bevor jemand merkte, dass von den Geräuschen dieses Samstags eines fehlte. Und dass der kleine Pablo an diesem sonnigen Morgen von einem widerlichen Schatten verschluckt worden war, der ihn von seinem heiß geliebten Skateboard getrennt hatte und nicht wieder herausrücken wollte.
Das vierrädrige Brett hatte reglos inmitten des Gewimmels von Polizeibeamten gelegen, die unmittelbar nach der Vermisstenanzeige das Stadtviertel in Beschlag nahmen.
Das war vor knapp zehn Tagen passiert. Und für den kleinen Pablo war es vielleicht schon zu spät. Zu spät für seine zerbrechliche Kinderseele. Zu spät, um ohne Trauma aus dem Albtraum zu erwachen.
Jetzt lag das Skateboard zusammen mit anderen Gegenständen, Spielzeug, Kleidern, in ihrem Kofferraum. Fundstücke, an denen Mila auf der Suche nach einer Fährte geschnuppert hatte und die sie schließlich zu diesem braunen Haus geführt hatten. Hier wohnte der junge Musiklehrer, der an einer höheren Schule unterrichtete und sonntagmorgens in der Kirche Orgel spielte. Der Vizepräsident des Musikvereins, der jedes Jahr ein kleines Mozartfestival organisierte. Der nichtssagende, schüchterne Junggeselle mit Brille, beginnender Glatze und schweißigen, weichen Händen.
Mila hatte ihn genau beobachtet. Das war ihr besonderes Talent.
Sie hatte ein konkretes Ziel vor Augen gehabt, als sie zur Polizei gegangen war, und diesem Ziel widmete sie sich seit Abschluss der Polizeischule mit Haut und Haar. Dabei ging es ihr weniger um die Verbrecher oder gar um das Gesetz. Nein, es gab einen anderen Grund, warum sie seit sieben Jahren unermüdlich jeden Winkel durchforstete, in dem widerliche Schatten sich ausbreiteten und alles Leben verfaulen ließen.
Als Mila Pablos Namen auf den Lippen seines Kerkermeisters las, spürte sie einen Stich im rechten Bein. Vielleicht rührte er daher, dass sie während des langen Wartens auf dieses Zeichen immer nur im Wagen gesessen hatte. Oder aber er kam von der Wunde in ihrem Oberschenkel, die sie mit zwei Stichen selbst genäht hatte.
Ich werde den Verband noch mal erneuern, nahm sie sich vor. Aber später, nicht jetzt. Und parallel zu dem Vorsatz reifte in ihr der Entschluss, auf der Stelle in das Haus einzudringen. Den Bann zu brechen und dem Albtraum ein Ende zu bereiten.
»Beamtin Mila Vasquez an Zentrale: Habe mutmaßlichen Entführer des kleinen Pablo Ramos ausgemacht. Wohnt in braunem Haus, Viale Alberas, Nummer 27. Mögliche Gefahrensituation.«
»Verstanden, Kollegin Vasquez. Wir ziehen ein paar Streifenwagen ab und schicken sie dir, aber das dauert mindestens dreißig Minuten.«
Zu lange. So viel Zeit blieb ihr nicht. So viel Zeit blieb Pablo nicht. Mila fürchtete, hinterher den Satz »Es war leider zu spät« verantworten zu müssen, und das trieb sie dazu, sich allein dem Haus zu nähern.
Die Stimme des Polizeifunkgeräts war nur noch als leises Krächzen im Hintergrund zu hören, während sie – die Pistole mit beiden Händen vorgestreckt und sich nach allen Seiten umblickend – zu dem Palisadenzaun rannte, der das frei stehende Haus nur nach hinten begrenzte.
Eine riesige Platane überragte das Dach. Im Nu stand Mila vor dem Tor, das zum Hintereingang führte. Sie presste sich an die Holzpfähle und lauschte. Hin und wieder drangen Fetzen eines Rocksongs an ihr Ohr, vom Wind irgendwoher aus der Nachbarschaft herangetragen. Mila spähte über das Tor und sah einen gepflegten Garten mit Geräteschuppen und einem roten Gummischlauch, der sich quer über den Rasen zu einem Sprenger schlängelte. Ein Gasgrill, Gartenmöbel aus Plastik. Alles ganz normal. Eine malvenfarbene Tür mit Mattglas. Mila fasste mit einer Hand über das Tor und hob vorsichtig den Riegel an. Die Angeln quietschten, und sie öffnete das Tor gerade so weit, dass sie durchschlüpfen konnte.
Danach schloss sie es wieder; niemand, der aus dem Haus nach draußen sah, sollte eine Veränderung bemerken. Alles musste sein wie immer. Dann schlich sie auf das Haus zu, wie sie es in der Ausbildung gelernt hatte, jeden ihrer Schritte genau abwägend und immer auf Zehenspitzen, um keine Spuren im Gras zu hinterlassen. Dabei war sie angespannt wie eine Feder und hätte notfalls blitzschnell reagieren können. Wenige Sekunden später stand sie bereits neben dem Hintereingang, und zwar auf der Seite, von der aus sie keinen Schatten werfen würde, wenn sie sich vorbeugte, um ins Hausinnere zu spähen. Und genau das tat sie. Durch das Mattglas erkannte sie zwar keine Einzelheiten, aber die Umrisse der Möbel ließen darauf schließen, dass es sich um das Esszimmer handelte. Mila streckte vorsichtig die Hand nach der Türklinke aus und drückte sie nach unten. Das Schloss schnappte auf. Die Tür war nicht abgeschlossen.
Der Musiklehrer musste sich ziemlich sicher fühlen. Mila würde schon bald erfahren, warum.
Bei jedem Schritt gaben ihre Gummisohlen auf dem Linoleumboden ein quietschendes Geräusch von sich. Sie zwang sich, so leise wie möglich aufzutreten, aber schließlich zog sie die Schuhe aus und ließ sie neben einer Kommode stehen. Barfuß erreichte sie die Tür zum Gang. Jetzt hörte sie ihn sprechen.
»Dann bräuchte ich noch eine Packung Küchenpapier und eine Flasche Fliesenreiniger … Ja, genau den. Außerdem bringen Sie mir bitte sechs Dosen Hühnersuppe, ein Pfund Zucker, die neue Fernsehzeitschrift und eine Schachtel Light-Zigaretten, die Marke dürfen Sie sich aussuchen …«
Die Stimme kam aus dem Wohnzimmer. Der Musiklehrer tätigte seine Einkäufe per Telefon. War er zu beschäftigt, um das Haus zu verlassen? Oder wollte er seinen Gast keine Sekunde aus den Augen lassen?
»Ja, Viale Alberas Nummer 27, danke. Und bringen Sie gleich das Restgeld mit, ich habe leider nur fünfzig Euro im Haus.«
Mila ging der Stimme nach und kam dabei an einem Spiegel vorbei. Es war ein Zerrspiegel, wie man sie von Jahrmärkten kennt. Als sie neben der Zimmertür stand, streckte sie die Arme mit der Pistole aus, holte tief Luft und sprang mit einem Satz über die Türschwelle. Sie rechnete damit, ihn zu überraschen, möglicherweise von hinten, vor dem Fenster stehend und noch den Telefonhörer in der Hand. Eine perfekte, lebende Zielscheibe.
Doch sie hatte sich getäuscht. Das Wohnzimmer war leer, der Telefonhörer lag ganz normal auf der Gabel. Sie begriff, dass in diesem Zimmer niemand telefoniert hatte, und im selben Augenblick spürte sie die eiskalte Berührung einer Pistole im Nacken. Er stand hinter ihr.
Der Musiklehrer hatte sich perfekt abgesichert: Das kreischende Gartentor, der quietschende Linoleumboden waren Alarmsignale, die ihm mögliche Eindringlinge anzeigten. Das vorgetäuschte Telefonat war der Köder, mit dem er seine Beute anlockte. Und der Zerrspiegel bot ihm die Möglichkeit, sich unbemerkt anzupirschen. Alles war Teil eines Hinterhalts.
Sie spürte, wie er von hinten die Hand nach ihrer Dienstwaffe ausstreckte. Mila überließ sie ihm. »Du kannst mich erschießen, aber es wird dir nichts bringen. In ein paar Minuten sind meine Kollegen hier. Gib lieber auf, du hast nicht die geringste Chance.«
Er antwortete nicht. Sie hatte das Gefühl, ihn aus den Augenwinkeln zu sehen, und es kam ihr so vor, als würde er lächeln.
Der Musiklehrer trat einen Schritt zurück. Die Pistole hatte sie jetzt nicht mehr im Nacken, aber noch immer spürte sie die magnetische Anziehungskraft zwischen ihrem Kopf und der Kugel im Lauf. Der Mann ging langsam um sie herum und trat endlich in ihr Blickfeld. Er starrte sie einen Moment lang an, ohne sie jedoch wirklich zu sehen. Mila hatte das Gefühl, in seinen Augen den Vorhof der Hölle zu erblicken.
Der Musiklehrer drehte sich um und wandte ihr furchtlos den Rücken zu. Er ging sicheren Schritts auf das Klavier zu, das an der Wand stand. Setzte sich auf den Hocker davor und blickte auf die Klaviatur. Die beiden Pistolen legte er ganz links ab. Dann hob er kurz die Hände, bevor er sie erneut auf die Tasten senkte.
Während sich Klänge von Chopin im Raum ausbreiteten, rang Mila nach Luft, sämtliche Muskeln und Sehnen ihres Halses waren angespannt. Die Finger des Musiklehrers glitten leicht und anmutig über die Tasten. Und die süßen Klänge zwangen Mila, der absurden Darbietung wie hypnotisiert zu folgen.
Doch dann gab sie sich einen Ruck und begann langsam rückwärts zu gehen, bis sie sich wieder im Korridor befand. Von der Melodie verfolgt, machte sie sich daran, hastig die Zimmer zu durchsuchen. Sie ging alle ab, eins nach dem andern. Das Büro. Das Bad. Die Speisekammer.
Bis zu der geschlossenen Tür.
Mila stemmte sich mit der Schulter dagegen. Da ihre Schenkelwunde schmerzte, verlagerte sie das ganze Gewicht auf das Schultergelenk. Bis die hölzerne Tür nachgab.
Zunächst drang nur das dämmrige Licht des Korridors in den Raum, dessen Fenster zugemauert schienen. Mila folgte dem blassen Lichtstrahl in die Dunkelheit, bis sie einem Paar glänzender Augen begegnete, die ihren Blick wie versteinert erwiderten. Sie gehörten tatsächlich Pablito, der, die Beine an den mageren Oberkörper gezogen, auf dem Bett kauerte und nichts als eine Unterhose und ein Hemdchen trug. Er versuchte zu begreifen, ob er Angst haben musste, ob Mila auch zu seinem Albtraum gehörte oder nicht.
Sie sagte, was sie immer sagte, wenn sie ein Kind wiederfand. »Wir müssen gehen.«
Er nickte kurz, streckte ihr die Arme entgegen und umschlang ihren Hals. Mila lauschte angespannt auf die Musik, die unterdessen weiterspielte und sie zur Eile mahnte. Was, wenn das Stück nicht lange genug andauerte und ihr keine Zeit blieb, das Haus zu verlassen? Eine seltsame Furcht erfasste sie. Sie hatte ihr Leben und das der Geisel aufs Spiel gesetzt. Und jetzt hatte sie Angst. Angst, noch einmal etwas falsch zu machen. Angst, beim letzten Schritt, dem, der sie aus diesem verdammten Haus hinausbringen sollte, noch zu stolpern. Oder zu entdecken, dass dieses Haus sie nie mehr gehen ließ, dass es sich wie ein Spinnennetz über sie legte und auf ewig gefangen nahm.
Doch die Tür ließ sich öffnen, und draußen wurden sie vom Tageslicht empfangen, das zwar noch etwas fahl, aber ungeheuer beruhigend war. Als ihr Herz langsamer schlug und sie sich nicht mehr um die Pistole zu kümmern brauchte, die sie in dem Haus zurückgelassen hatte, als sie Pablo noch fester an sich drückte, um ihm alle Angst zu nehmen, da näherte sich der Kleine ihrem Ohr und flüsterte: »Kommt sie denn nicht mit?«
Mila blieb wie angewurzelt stehen, ihre Füße waren auf einmal bleischwer. Sie wankte, verlor jedoch nicht das Gleichgewicht. »Wo ist sie?«, fragte Mila überraschend ruhig, weil ein entsetzlicher Verdacht ihr die Kraft dazu gab.
Das Kind hob den Arm und deutete mit dem Zeigefinger zum zweiten Stockwerk hinauf. Das Haus starrte sie aus seinen Fenstern an und lachte ihr mit der offen stehenden Tür höhnisch ins Gesicht.
Doch da wich die Angst von ihr. Mila legte die letzten Meter zu ihrem Wagen zurück, setzte den kleinen Pablo auf dem Rücksitz ab und sagte im Ton eines feierlichen Versprechens: »Ich bin gleich zurück.«
Dann ließ sie sich abermals von dem Haus verschlucken.
Mila stand am Fuß der Treppe. Sie wusste nicht, was sie dort oben erwartete. Die Hand auf dem Geländer, stieg sie langsam hinauf. Auch jetzt waren es die Klänge Chopins, die sie bei ihrer Erkundung begleiteten. Ihre Füße erklommen Stufe um Stufe, während sie sich an den Handlauf klammerte, der sie von jedem weiteren Schritt zurückhalten wollte, wie ihr schien.
Völlig unerwartet brach die Musik ab. Mila erstarrte, während ihre Sinne auf Hochtouren arbeiteten. Dann der trockene Knall eines Schusses, ein dumpfer Schlag und das dissonante Klimpern der Klaviertasten. Mila rannte jetzt ins obere Stockwerk hinauf. Vielleicht war das ja auch nur eine Falle. Die Treppe machte eine Krümmung und ging in einen engen Korridor mit einem dicken Teppich über. Am Ende ein Fenster, davor eine menschliche Gestalt. Zartgliedrig, schmal, im Gegenlicht; sie stand mit den Füßen auf einem Stuhl, den Hals und die Arme nach einem Strick ausgestreckt, der von der Decke baumelte. Mila sah, dass sie den Kopf in die Schlinge stecken wollte, und schrie.
Die Gestalt versuchte, sich zu beeilen. Denn so war es ihr beigebracht worden, so hatte er es ihr eingetrichtert. Wenn sie kommen, musst du dich umbringen. Sie – das waren die anderen, die Außenwelt, all jene, die nichts verstehen und niemals verzeihen würden.
Mila stürzte auf die Frau zu, doch plötzlich hatte sie das Gefühl, in die Vergangenheit einzutauchen. Vor vielen Jahren, in einem anderen Leben, war diese Frau ein Mädchen gewesen.
Mila erinnerte sich genau an sie, an ihr Foto. Sie hatte es gründlich studiert, sich ihr Gesicht Zug um Zug eingeprägt, jedes Fältchen im Geist nachgezeichnet, jede Besonderheit, ja selbst den kleinsten Makel der Haut in ihr Gedächtnis eingebrannt.
Und dann diese Augen, deren gesprenkeltes Blau so leuchtend war, dass sich das Blitzlicht der Kamera ungebrochen darin spiegelte. Die Augen eines zehnjährigen Kindes, Elisa Gomes. Das Foto war ein Schnappschuss, den der Vater bei irgendeinem Fest aufgenommen hatte, während das Kind Geschenke auspackte. Mila hatte sich die Szene vorgestellt, den Vater, der seine Tochter beim Namen rief, damit sie sich nach ihm umdrehte. Und Elisa, wie sie ihm das Gesicht zuwandte und noch nicht einmal Zeit hatte, überrascht zu sein. Was mit bloßem Auge normalerweise gar nicht zu erkennen war, hatte die Kamera eingefangen und verewigt: den wundervollen Entstehungsmoment eines Lächelns, die Sekunde, bevor es auf den Lippen erblüht und die Augen wie aufgehende Sterne zum Strahlen bringt.
Deshalb hatte sich Mila auch nicht darüber gewundert, dass die Eltern von Elisa Gomes ihr ausgerechnet dieses Foto gaben, als sie um ein neueres Bild der Tochter bat. Sicher, die Aufnahme war aufgrund des Gesichtsausdrucks, den Elisa darauf zeigte, eher ungeeignet gewesen; mit einem solchen Bild ließ sich am Computer nicht rekonstruieren, wie sich die Gesichtszüge des Kindes im Lauf der Jahre verändern würden. Milas Kollegen hatten sich beschwert, aber ihr war das egal gewesen. Für sie hatte dieses Bild etwas Besonderes, eine bestimmte Energie. Und genau die galt es zu suchen. Nicht eins von hundert Gesichtern, ein Mädchen unter tausend anderen. Sondern genau dieses Mädchen mit genau diesem Leuchten in den Augen. Sofern es ihm nicht längst jemand geraubt hatte …
Mila fing die junge Frau im letzten Moment auf, indem sie ihre Beine umschlang und sie daran hinderte, sich mit ihrem ganzen Gewicht in die Schlinge fallen zu lassen. Die Frau wehrte sich, strampelte und schrie – bis Mila sie bei ihrem Namen nannte.
»Elisa«, sagte sie mit unendlich sanfter Stimme.
Und die junge Frau erkannte sich wieder.
Sie hatte vergessen gehabt, wer sie war.
Die langen Jahre der Gefangenschaft hatten ihre Identität zunichtegemacht, Stück für Stück, Tag um Tag. Bis dieser Mann ihre ganze Welt ausmachte und der Rest der Welt sie vergessen hatte. Niemand würde kommen und sie retten, niemals.
Elisa sah Mila voller Verwunderung an, beruhigte sich langsam und ließ sich schließlich aus diesem verdammten Haus führen.
3
Sechs Arme. Fünf Namen. Mit diesem Ergebnis hatte der Suchtrupp die Waldlichtung verlassen und war zum Einsatzwagen am Rand der Landstraße zurückgekehrt. Ein gut funktionierendes Polizeiteam erkennt man nicht zuletzt daran, dass es selbst in Extremsituationen in der Lage ist, frisch aufgebrühten Kaffee und Sandwichs zu offerieren. Nur, dass an diesem kalten Februarmorgen niemand so recht Lust hatte, über das Büffet herzufallen.
Stern zog eine Schachtel Pfefferminzpastillen aus der Jackentasche. Er schüttelte sie, ließ zwei Pastillen in seinen Handteller fallen und warf sie sich in den Mund. Er behauptete, damit könne er besser denken. »Wie ist das möglich?«, fragte er dann mehr sich selbst als die anderen.
»Himmel, Arsch …«, entfuhr es Boris, aber so leise, dass niemand ihn hörte.
Rosa suchte nach einem Punkt innerhalb des Mannschaftswagens, auf den sie ihre Aufmerksamkeit lenken konnte. Goran verstand sie: sie hatte eine Tochter in diesem Alter. Daran denkst du als Erstes, wenn du es mit einem Verbrechen an Kindern zu tun hast. An deine eigenen Kinder. Und du fragst dich, was wäre, wenn … Aber du denkst den Satz nicht zu Ende, weil allein schon der Gedanke schmerzt.
»Er wird sie uns stückchenweise finden lassen«, meinte Hauptkommissar Roche.
»Ist das ab jetzt unser Job? Leichenteile einsammeln?«, fragte Boris gereizt. Er war ein Mann der Tat. Sich mit der Rolle des Totengräbers abfinden zu müssen, ging ihm gegen den Strich. Er brauchte einen Schuldigen. Und die anderen, die bei seinen Worten zustimmend nickten, offenbar auch.
Roche beruhigte sie: »Nein, das Wichtigste ist natürlich immer noch die Verhaftung des Täters. Aber wir haben auch die Aufgabe, nach den sterblichen Überresten seiner Opfer zu suchen. Dem können wir uns nicht entziehen, so traurig es ist.«
»Da steckt eine Absicht dahinter.«
Alles starrte auf Goran, der das gesagt hatte.
»Dass der Labrador die Witterung aufgenommen und zu graben angefangen hat, war kein Zufall, sondern geplant. Unser Mann hat die beiden Jungen mit dem Hund beobachtet. Er wusste, dass sie ihn im Wald ausführen. Und genau aus diesem simplen Grund hat er seinen kleinen Friedhof dort angelegt. Er wollte uns zeigen, dass er sein Werk vollendet hat. Das ist alles.«
»Soll das heißen, wir kriegen ihn nicht?«, fragte Boris fassungslos und voller Wut.
Goran seufzte. »Du weißt selbst, wie diese Fälle ausgehen …«
»Aber es war nicht das letzte Mal. Er wird noch einmal töten, habe ich recht?« Diesmal war es Rosa, die sich innerlich aufbäumte. »Bislang ist alles glatt für ihn gelaufen. Er wird es noch mal versuchen.«
Goran wusste es nicht. Und selbst wenn er diesbezüglich eine Meinung gehabt hätte, wäre ihm nicht klar gewesen, wie er den Kollegen seine innere Zerrissenheit hätte begreiflich machen sollen, den Zwiespalt zwischen dem scheußlichen Gedanken an die Morde und dem zynischen Wunsch, der Täter möge noch einmal zuschlagen. Eins stand jedenfalls fest – und das wussten alle: Nur wenn der Täter weitermachte, hatten sie eine Chance, ihn zu fassen.
Hauptkommissar Roche warf einen Blick in die Runde: »Wenn wir die Leichen der Mädchen finden, haben die Eltern wenigstens eine Beerdigung und ein Grab, an dem sie weinen können.« Typisch Roche. Stets darum bemüht, fast allem eine positive Seite abzugewinnen. Im Übrigen war der Satz eine Art Generalprobe. So oder so ähnlich würde er sich nachher auch der Presse gegenüber äußern, um den Fall zu entschärfen und nebenbei das eigene Image aufzupolieren. Zuerst die Trauer, der Schmerz. Damit gewann man Zeit. Dann die Ermittlungen und die Täter.
Goran wusste jedoch, dass ihm das diesmal nicht gelingen würde und dass sich die Journalisten wie Geier auf jeden Brocken stürzen würden, den Roche ihnen hinwarf, um die Geschichte anschließend mit den schamlosesten Details auszuschmücken. Vor allem aber würden sie ihnen ab diesem Moment nichts mehr nachsehen. Jede Geste, jedes Wort würde die Bedeutung eines Versprechens, eines feierlichen Gelöbnisses bekommen. Roche war überzeugt, die Journalisten im Zaum halten zu können, indem er sie häppchenweise mit dem fütterte, was sie hören wollten. Und Goran ließ ihn in diesem naiven Glauben.
»Ich denke, wir sollten diesem Typen einen Namen geben, bevor es die Presse tut«, sagte Roche.
Goran war derselben Meinung, wenn auch aus anderen Gründen als der Hauptkommissar. Wie alle Kriminologen, die für die Polizei tätig waren, hatte er seine eigenen Methoden. Eine bestand darin, dem Kriminellen ein Aussehen zu geben, um der zunächst noch schwer fassbaren, schemenhaften Gestalt menschliche Züge zu verleihen. Denn gerade bei besonders brutalen, monströsen Verbrechen wird leicht übersehen, dass der Täter, genau wie das Opfer, ein Mensch ist, ein Mensch, der häufig ein ganz normales Leben führt, einer Arbeit nachgeht und mitunter sogar Familie hat. Und ein Mensch hat Schwachpunkte und kann gefasst werden. Ein namenloses Monster nicht.
Im Einsatzwagen schlug Boris als Namen für denjenigen, der das Gräberfeld angelegt hatte, Albert vor – in Erinnerung an einen früheren Fall. Die Anwesenden quittierten seinen Vorschlag mit einem Lächeln, und damit war die Entscheidung gefallen.
Von nun an würden die Mitglieder der Ermittlungsgruppe diesen Namen benutzen, wenn sie von dem Mörder sprachen. Und ganz allmählich würde dieser Albert ein Antlitz bekommen. Eine Nase, zwei Augen, ein Gesicht, ein eigenständiges Leben. Jeder von ihnen würde ihn sich auf seine Weise vorstellen, und dann würde er bald mehr als nur ein flüchtiger Schatten sein.
»Albert, hm …« Am Ende der Besprechung überlegte Roche immer noch, ob der Name auch medienwirksam genug wäre. Er sprach ihn mehrmals vor sich hin, ließ ihn sich auf der Zunge zergehen. Ja, das könnte hinhauen.
Aber es gab noch etwas, was dem Hauptkommissar Kopfzerbrechen bereitete. Er wandte sich damit an Goran: »Soll ich dir was sagen? Boris hat vollkommen recht. Himmel noch mal! Ich kann meine Leute nicht zwingen, Leichenteile einzusammeln, damit uns so ein übergeschnappter Psychopath in aller Öffentlichkeit als Idioten hinstellt!«
Goran wusste, dass Roche mit »seine Leute« in Wahrheit vor allem sich selbst meinte. Er war es, der Angst davor hatte, keine Erfolge vorweisen zu können. Und er war es auch, der fürchtete, man werde der Polizei Versagen vorwerfen, wenn es ihm nicht gelang, dem Täter Einhalt zu gebieten.
Außerdem war da noch die Geschichte mit dem sechsten Arm. »Ich werde vorerst nicht bekannt geben, dass es ein sechstes Opfer gibt.«
Goran sah ihn befremdet an. »Wie sollen wir dann herausfinden, um wen es sich handelt?«
»Keine Sorge, ich habe an alles gedacht.«
Mila Vasquez hatte in ihrer relativ jungen Karriere neunundachtzig Fälle von vermisst gemeldeten Personen gelöst. Dafür war sie mit drei Medaillen und einer ganzen Reihe sonstiger Ehrungen ausgezeichnet worden. Sie galt als Expertin auf ihrem Gebiet und wurde häufig als Beraterin angefordert, selbst aus dem Ausland.
Die Operation an diesem Vormittag, in deren Verlauf sie gleichzeitig Pablo und Elisa befreit hatte, war als »aufsehenerregender Erfolg« bezeichnet worden. Mila hatte nichts dazu gesagt, aber es ärgerte sie. Ihr wäre es lieber gewesen, sie hätte auch ihre Fehler bei der Operation eingestehen können. Zum Beispiel hatte sie das braune Haus betreten, ohne Verstärkung abzuwarten. Sie hatte die Situation falsch eingeschätzt und nicht mit Hinterhalten gerechnet. Auch dass sie dem Mann erlaubt hatte, sie zu entwaffnen und ihr seine Pistole in den Nacken zu drücken, war ein Fehler gewesen. Damit hatte sie nicht nur ihr eigenes, sondern auch das Leben der Geiseln aufs Spiel gesetzt. Und außerdem hatte sie nicht verhindert, dass der Musiklehrer Selbstmord beging.
Aber all das war von ihren Vorgesetzten unterschlagen worden, die lediglich ihre Verdienste betont und sich im Übrigen für die rituellen Fotos zur Verfügung gestellt hatten. Mila war auf diesen Bildern nie zu sehen. Offiziell, weil sie im Hinblick auf zukünftige Ermittlungen lieber anonym bleiben wollte. In Wirklichkeit hasste sie es, fotografiert zu werden. Sie ertrug es nicht einmal, sich im Spiegel zu betrachten. Nicht, weil sie nicht hübsch gewesen wäre, im Gegenteil. Aber sie hatte mit ihren zweiunddreißig Jahren so viele Stunden im Kraftraum verbracht, dass sie jede Spur von Weiblichkeit, jede Kurve, jede Rundung eingebüßt hatte. Als wäre das Frausein ein Übel gewesen, das sie hatte bekämpfen müssen. Zwar wirkte sie nicht maskulin, obwohl sie häufig Männersachen trug, aber sie hatte einfach nichts an sich, woran man ihre geschlechtliche Identität ablesen konnte. Und das war gewollt. Ihre Kleidung war unauffällig – Jeans, nicht allzu eng anliegend, gut eingelaufene Turnschuhe, Lederjacke – Kleidung eben, mehr nicht. Ihre Funktion war es, ihre Blößen zu bedecken. Mila verlor keine Zeit damit, sie auszusuchen, sie kaufte sie und basta. So war sie, und so wollte sie sein. Unsichtbar unter den Unsichtbaren.
Vielleicht war es deshalb auch kein Problem, dass sie die Umkleideräume im Revier mit ihren männlichen Kollegen teilte.
Mila stand schon zehn Minuten da und starrte in ihren offenen Spind, während sie noch einmal die Ereignisse des Tages Revue passieren ließ. Da war noch etwas gewesen, was sie dringend erledigen musste, aber im Moment dachte sie über andere Dinge nach. Ein stechender Schmerz im Oberschenkel riss sie jäh aus ihren Gedanken. Die Wunde war wieder aufgebrochen, sie hatte vergeblich versucht, das Blut mit einer Monatsbinde und Klebeband zu stillen. Zu dumm, dass die Hautfetzen um den Schnitt herum so kurz waren, andernfalls wäre sie mit Nadel und Faden zu Werke gegangen. Vielleicht hätte sie sich diesmal wirklich von einem Fachmann verarzten lassen sollen. Das Problem war nur, dass sie nicht die geringste Lust hatte, ins Krankenhaus zu gehen. Zu viele Fragen. Sie beschloss, sich fürs Erste einen Druckverband anzulegen, in der Hoffnung, die Blutung damit zu stillen; später wollte sie es dann noch einmal mit Nähen versuchen. Allerdings musste sie, um eine Infektion zu vermeiden, unbedingt ein Antibiotikum einnehmen, und dafür brauchte sie ein Rezept. Sie würde es sich bei einem Typen, der sie bisweilen über die Neuzugänge unter den Obdachlosen am Bahnhof informierte, besorgen – gefälscht, versteht sich.
Bahnhöfe – es ist schon seltsam mit den Bahnhöfen, dachte Mila. Für die meisten von uns sind sie lediglich Durchgangsstation, für einige werden sie jedoch zur Endstation. Sie kommen an, steigen aus und bleiben. Für immer. Bahnhöfe sind eine Art Vorhölle, in der sich die verlorenen Seelen drängen und darauf warten, dass sie jemand erlöst.
Jeden Tag verschwinden im Durchschnitt zwanzig bis fünfundzwanzig Personen. Mila kannte die Statistik. Diese Menschen tauchten irgendwann plötzlich unter. Ohne jede Vorwarnung und ohne Gepäck. Einfach so, als hätten sie sich in Luft aufgelöst.
Mila wusste, dass es sich zum Großteil um Leute handelte, die sich gerade so durchschlugen oder vom Dealen lebten, häufig straffällig wurden und im Gefängnis ein und aus gingen. Neben ihnen gab es aber auch diejenigen – eine merkwürdige Minderheit –, die irgendwann beschlossen, für immer zu verschwinden. Wie die Familienmutter, die zum Einkaufen in den Supermarkt ging und einfach nicht zurückkehrte, oder der Sohn oder Bruder, der einen Zug bestieg und nie am Zielbahnhof ankam.
Mila glaubte, dass es für jeden einen Weg gab. Einen Weg, der nach Hause führte, zu geliebten Menschen und zu geschätzten Dingen. Für gewöhnlich war es ein Leben lang derselbe Weg. Doch es konnte passieren, dass dieser Weg abbrach. Manchmal begann er woanders von Neuem. Oder kehrte nach verschlungenen Umwegen zu der Stelle zurück, an dem er abgebrochen war. Oder er verlief einfach im Nichts. Manchmal aber verlor er sich auch im Dunkel.
Mila wusste, dass mehr als die Hälfte derjenigen, die verschwanden, wieder zurückkehrte und eine Geschichte mitbrachte. Andere hatten nichts zu erzählen und nahmen einfach ihr früheres Leben wieder auf. Wieder andere hatten weniger Glück, von ihnen blieb nur eine stumme Leiche. Und schließlich gab es auch die, von denen man nie wieder hörte.
Unter ihnen waren viele Kinder.
Manche Eltern würden ihr Leben dafür geben, zu erfahren, was passiert ist. Was sie falsch gemacht haben. Welche Unachtsamkeit die Lawine des Schweigens ins Rollen gebracht hat. Wo ihr Kleines abgeblieben ist. Wer es ihnen weggenommen hat und warum. Es gibt Menschen, die sich an Gott wenden und ihn fragen, wofür er sie so hart bestraft. Menschen, die sich bis an ihr Lebensende mit der Suche nach einer Antwort quälen oder ihr Leben aufgeben, um ihren Fragen ausweichen zu können. Manche wünschen sich sogar, vom Tod des eigenen Kindes zu erfahren, weil sie nur noch weinen möchten. Ihr größter Wunsch ist es nicht, sich mit dem Schicksal abzufinden, sondern endlich nicht mehr hoffen zu müssen. Denn die Hoffnung tötet noch langsamer als die Wahrheit.
Mila jedoch glaubte nicht an das Märchen von der befreienden Wirkung der Wahrheit. Das war Unsinn, sie hatte es am eigenen Leib erfahren, als sie das erste Mal jemanden aufspürte. Auch an dem Nachmittag, als sie Pablo und Elisa nach Hause zurückgebracht hatte. Für den Jungen hatte es Freudenjubel gegeben, Hupkonzerte und Autokorsos in der ganzen Siedlung. Für Elisa nicht. Zu viel Zeit war vergangen.
Mila hatte die junge Frau nach ihrer Rettung in eine Sondereinrichtung gebracht, wo Sozialhelfer sich ihrer annahmen. Sie bekam eine warme Mahlzeit und saubere Kleidung. Meistens fielen die Kleider ein, zwei Größen zu weit aus. Vielleicht lag es daran, dass die Vermissten in den Jahren des Vergessens geschrumpft waren und man sie erst in allerletzter Minute aufgefunden hatte, kurz bevor sie sich ganz aufgelöst hätten. Elisa sagte kein Wort, während sie umhegt und umsorgt wurde. Und auch als sie erfuhr, dass Mila sie nach Hause bringen würde, schwieg sie.
Die junge Polizistin starrte immer noch in ihren Spind. Vor ihren Augen tauchten die Gesichter der Eltern von Elisa Gomes auf, wie sie geschaut hatten, als ihre Tochter plötzlich vor der Tür stand. Sie waren unvorbereitet gewesen und auch etwas verlegen. Vielleicht hatten sie geglaubt, Mila würde ihnen ein zehnjähriges Mädchen zurückbringen. Stattdessen sahen sie sich einer erwachsenen Frau gegenüber, mit der sie nichts mehr gemein hatten.
Elisa war ein intelligentes und für ihr Alter ungewöhnlich reifes Kind gewesen. Mit sechzehn Monaten hatten sie bereits zu sprechen begonnen. Ihr erstes Wort war »May« gewesen, der Name ihres Teddybärs – ihr letztes »morgen«, das hatte ihre Mutter auch nie vergessen. »Wir sehen uns morgen«, hatte Elisa vor der Haustür gesagt, bevor sie gegangen war, um bei einer Freundin zu übernachten. Nur, dass dieser Morgen nie angebrochen war. Nicht für Elisa Gomes. Ihr »Gestern« dagegen dauerte ewig, und nichts hatte darauf hingedeutet, dass es irgendwann aufhören sollte.
Während dieses nicht enden wollenden Tages hatte Elisa für ihre Eltern als zehnjähriges Kind weitergelebt, mit einem Zimmer voller Puppen und einem Berg Weihnachtsgeschenke vor dem Kamin. Sie würde bis in alle Ewigkeit so bleiben, wie sie sie in Erinnerung hatten.
Und auch wenn Mila Elisa wiedergefunden hatte, ihre Eltern würden weiter auf das kleine Mädchen warten, das ihnen abhandengekommen war. Ohne je Ruhe zu finden.
Nach einer Umarmung, die ebenso gezwungen wirkte wie die Tränen und die Rührung, die sie begleiteten, hatte die Mutter sie ins Haus gebeten und ihnen Tee und Kekse vorgesetzt. Sie war mit ihrer Tochter umgegangen wie mit einem Gast. In der stillen Hoffnung vielleicht, Elisa würde nach diesem Besuch wieder gehen und sie und ihren Mann mit dem mittlerweile vertrauten Gefühl des Beraubtseins, der Leere, zurücklassen.
Mila verglich die damit einhergehende Traurigkeit immer mit einem alten Schrank, den man am liebsten hinauswerfen möchte, aus irgendeinem Grund aber stehen lässt. Sein typischer Geruch durchdringt das ganze Zimmer, er stört einen, doch er gehört nun mal dazu. Mit der Zeit gewöhnt man sich daran, und am Ende gehört er auch zu einem selbst.
Elisa war nach Hause zurückgekehrt, und ihre Eltern hätten die Trauer ablegen und sich für das Mitleid bedanken müssen, das ihnen in all diesen Jahren zuteilgeworden war. In den Augen der anderen gab es für sie keinen Grund mehr, traurig zu sein. Wie also hätten sie es wagen können, in aller Öffentlichkeit zu jammern? Worüber hätten sie sich beklagen sollen? Darüber, dass eine Fremde in ihrem Haus herumlief?
Als Mila nach einer Stunde belangloser Plauderei aufgestanden war, um sich zu verabschieden, hatte sie in den Augen der Mutter einen Hilferuf gelesen. Was mache ich jetzt?, schrie sie ihr stumm entgegen, und Mila begriff, dass die Frau panische Angst davor hatte, der Wirklichkeit ins Auge zu sehen.
Doch auch sie, Mila, hatte mit einer Tatsache zu kämpfen. Der Tatsache, dass die Auffindung von Elisa Gomes purer Zufall gewesen war. Wäre ihrem Entführer nicht zehn Jahre später eingefallen, für »Familienzuwachs« zu sorgen, indem er den kleinen Pablo entführte, hätte nie jemand erfahren, wie die Dinge wirklich gelaufen waren. Und Elisa wäre weiter in der Welt gefangen geblieben, die ihr Kerkermeister in seinem Wahn eigens für sie geschaffen hatte. Zunächst als Tochter und später als treu ergebene Ehefrau.
Mit diesem Gedanken schloss Mila den Spind. Denk nicht mehr dran, sagte sie zu sich selbst. Vergessen ist das beste Heilmittel.
Das Revier leerte sich langsam, und auch sie zog es nach Hause. Sie würde duschen, eine Flasche Portwein öffnen, auf dem Gasherd Kastanien rösten. Danach würde sie sich aufs Sofa setzen und den Baum vor ihrem Wohnzimmerfenster betrachten. Und mit ein wenig Glück würde sie dabei ziemlich schnell einschlafen.
Genau in diesem Moment steckte ein Kollege den Kopf zur Tür des Umkleideraums herein und ließ sie wissen, dass Kriminalhauptkommissar Morexu sie sprechen wollte.
Ein nass glänzender Schmierfilm überzog die Straßen an diesem Februarabend. Goran stieg aus dem Taxi. Er besaß kein Auto, hatte nicht einmal einen Führerschein. Wenn er irgendwohin musste, ließ er sich von anderen chauffieren. Nicht, dass er nicht versucht hätte, Auto zu fahren, er konnte es sogar. Aber für jemanden, der wie er die Angewohnheit hatte, tief in Gedanken zu versinken, war es nicht ratsam, sich hinter ein Steuer zu klemmen. Und so verzichtete Goran darauf.
Nachdem er den Taxifahrer bezahlt hatte, fischte er sich als Erstes eine Zigarette aus der Jackentasche. Er zündete sie an, zog zweimal daran und warf sie weg. Dieses Prozedere war zu einem Ritual geworden, seit er beschlossen hatte, mit dem Rauchen aufzuhören. Eine Art Kompromiss mit sich selbst, um der Nikotinsucht ein Schnippchen zu schlagen.
Sein Blick fiel auf sein Spiegelbild in einem Schaufenster. Er betrachtete sich ein paar Sekunden lang. Den ungepflegten Bart, der sein stets müde wirkendes Gesicht umrahmte. Die Ringe unter den Augen, das zerzauste Haar. Ihm war klar, dass er sich kaum um seine äußere Erscheinung kümmerte. Das war auch nicht seine Aufgabe, dafür war eigentlich jemand anders zuständig, nur dass dieser Jemand schon vor einiger Zeit von seinem Amt zurückgetreten war.
Was an Goran am meisten auffiel – das sagten alle –, war das lange geheimnisvolle Schweigen, in das er immer wieder versank. Und seine riesengroßen, wachsamen Augen.
Es war beinahe Abendessenszeit. Langsam stieg er die Treppe seines Hauses empor, betrat seine Wohnung und lauschte. Es vergingen ein paar Sekunden, bis er die vertraute Stimme von Tommy hörte, der in seinem Zimmer spielte. Er ging hin, sah ihm jedoch nur von der Tür aus zu, denn er hatte nicht den Mut, ihn beim Spielen zu unterbrechen.
Tommy war neun Jahre alt und so unbekümmert, wie Kinder es eben sind. Er hatte braune Haare und liebte – neben der Farbe Rot – Basketball und Eis, auch im Winter. Er hatte einen besten Freund, Bastian, mit dem er im Garten der Schule tolle Safaris veranstaltete. Sie waren beide bei den Pfadfindern, und diesen Sommer würden sie gemeinsam ins Zeltlager gehen. In letzter Zeit sprachen sie von nichts anderem.
Tommy sah seiner Mutter unwahrscheinlich ähnlich, von seinem Vater hatte er nur eins: die riesengroßen, wachsamen Augen.
Als er Gorans Anwesenheit bemerkte, drehte er sich um und lächelte. »Du kommst spät«, sagte er vorwurfsvoll.
»Ich weiß. Tut mir leid«, verteidigte sich Goran. »Ist Frau Runa schon lange weg?«
»Ihr Sohn hat sie vor einer halben Stunde abgeholt.«
Das hörte Goran nicht gern. Frau Runa war jetzt schon seit ein paar Jahren ihre Haushälterin. Eigentlich hätte sie wissen müssen, dass er es nicht mochte, wenn Tommy allein zu Hause bleiben musste. Aber das gehörte zu den vielen kleinen Haken, die das Leben manchmal so kompliziert machten. Goran schaffte es nicht, alles allein zu organisieren. Ihm schien es, als hätte die einzige Person, die diese geheimnisvolle Macht besaß, vergessen, ihm beim Weggehen das Buch mit den entsprechenden Zauberformeln dazulassen.
Goran nahm sich vor, bei Gelegenheit ein ernstes Wort mit Frau Runa zu sprechen und klarzustellen, dass sie abends dazubleiben hatte, bis er nach Hause kam. Tommy las wohl seine Gedanken, denn er machte ein betrübtes Gesicht. Deshalb versuchte Goran sofort, ihn abzulenken, und fragte: »Hast du Hunger?«
»Ich habe einen Apfel und Cracker gegessen und ein Glas Wasser getrunken.«
Goran schüttelte belustigt den Kopf. »Kein sehr üppiges Abendessen.«
»Nein, das war auch nur zwischendurch. Jetzt will ich was Richtiges.«
»Spaghetti?«
Tommy klatschte begeistert mit den Händen. Goran streichelte ihm über den Kopf.
Dann bereiteten sie gemeinsam die Pasta zu und deckten den Tisch. Mittlerweile waren sie ein erprobtes Team, in dem jeder seine Aufgaben erfüllte, ohne den andern um Rat fragen zu müssen. Sein Sohn lernte schnell, und Goran war stolz auf ihn. Die letzten Monate waren für sie beide nicht leicht gewesen.
Ihr gemeinsames Leben drohte auseinanderzubrechen. Und er versuchte, die größer werdenden Risse geduldig zu kitten. Das Vakuum durch Ordnung zu ersetzen. Regelmäßige Mahlzeiten, ein genauer Tagesplan, feste Gewohnheiten. Alles in ihrem Leben wiederholte sich auf ein und dieselbe Art und Weise, ein ums andere Mal. Das gab Tommy Sicherheit.
Am Ende hatten sie gemeinsam gelernt, mit der Leere zu leben – ohne deshalb die Realität zu leugnen. Im Gegenteil, wenn einer von ihnen das Bedürfnis hatte, darüber zu sprechen, dann wurde darüber gesprochen.
Nur nannten sie die Leere nie beim Namen. Den hatten sie aus ihrem Wortschatz gestrichen. Sie behalfen sich auf andere Weise, griffen zu Umschreibungen. Es war seltsam: Der Mann, der es nicht versäumte, jedem Serienkiller, mit dem er zu tun hatte, einen Namen zu geben, wusste nicht mehr, wie er die Person nennen sollte, die einmal seine Frau gewesen war, und hatte zugelassen, dass sein Sohn die eigene Mutter depersonalisierte. Fast so, als wäre sie eine Gestalt aus den Märchen, die er ihm abends vorlas. Ein Kobold, eine Fee, eine Prinzessin.
Tommy war mittlerweile sein einziger rettender Anker in der normalen Welt, das Gegengewicht, das ihn davor bewahrte, in den Abgrund zu rutschen, den er dort draußen Tag für Tag erforschte.
Nach dem Abendessen zog sich Goran in sein Arbeitszimmer zurück. Tommy folgte ihm. So machten sie es jeden Abend. Goran setzte sich in seinen alten Bürosessel, und sein Sohn legte sich bäuchlings auf den Boden und nahm seine Phantasiegespräche wieder auf.
Goran ließ den Blick über seine Bibliothek schweifen. Die Bücher über Kriminologie, Verbrechensanthropologie und Rechtsmedizin standen hübsch aneinandergereiht in den Regalen. Einige waren in Damast gebunden und hatten mit goldenen Lettern geprägte Titel. Bei anderen handelte es sich um schlichtere oder auch ganz billige Ausgaben. Sie alle enthielten Antworten. Das Schwierige war jedoch, die Fragen zu finden, wie er seinen Studenten an der Universität immer erklärte. Diese Schriften waren gespickt mit entsetzlichen Bildern: grässlich zugerichtete Körper, zerstückelte, verbrannte, mit Wunden übersäte Leichen. Alles erbarmungslos auf Hochglanzpapier festgehalten und mit präzisen Bildunterschriften versehen. Das menschliche Leben auf ein kaltes Forschungsobjekt reduziert.
Goran hatte seinem Sohn bis vor Kurzem strikt verboten, sein Heiligtum zu betreten, aus Angst, Tommy würde der Neugier nicht widerstehen können, eins der Bücher aufschlagen, und entdecken, wie brutal das Leben sein konnte. Doch eines Tages hatte Tommy das Verbot übertreten, und Goran hatte ihn, genau wie jetzt auf dem Boden liegend und in einem dieser Bücher blätternd, angetroffen. Er konnte sich noch genau erinnern: Tommy betrachtete das Foto einer jungen Frau, die man im Winter aus einem Fluss gezogen hatte. Sie war nackt, ihre Haut war blau verfärbt, der Blick starr.
Erstaunlicherweise hatte Tommy überhaupt nicht verstört gewirkt, sodass Goran, anstatt ihn zu schimpfen, sich im Schneidersitz neben ihn setzte.
»Weißt du, was du da anschaust?«
Tommy schwieg eine ganze Weile unbeirrt und zählte dann gewissenhaft auf, was er sah. Die schmalen Hände, die Haare, die mit Raureif überzogen waren, den starren Blick. Danach begann er sich auszumalen, wovon die junge Frau lebte, wer ihre Freunde waren und wo sie wohnte. Da war Goran bewusst geworden, dass Tommy in diesem Foto alles bis auf eins sah: den Tod.
Kinder sehen den Tod nicht. Weil ihr Leben nicht länger als einen Tag dauert, vom Aufwachen bis zum Schlafengehen.
Und noch etwas begriff Goran bei dieser Gelegenheit: Er würde seinen Sohn nicht vor dem Bösen in der Welt beschützen können. Wie er ihm auch nicht hatte ersparen können, was seine Mutter ihm antat.
Hauptkommissar Morexu war nicht wie die anderen Vorgesetzten Milas. Er scherte sich einen Dreck um den Ruhm und die Fotos in der Presse. Aus diesem Grund erwartete sie eine gehörige Standpauke, weil sie im Haus des Musiklehrers so stümperhaft vorgegangen war.
Morexu war ein sprunghafter, launischer Mensch, unfähig, sich länger als zwei Sekunden zu beherrschen. Er konnte zornig sein und unglaublich mürrisch dreinblicken und im nächsten Moment lächeln und die Freundlichkeit in Person sein. Außerdem pflegte er, um keine Zeit zu verlieren, mehrere Dinge auf einmal zu tun. Wollte er beispielsweise jemanden trösten, so legte er ihm die Hand auf die Schulter und schob ihn gleichzeitig zur Tür. Oder er telefonierte und kratzte sich dabei mit dem Hörer die Schläfe.
Diesmal jedoch hatte er keine Eile.
Zunächst ließ er Mila vor seinem Schreibtisch stehen, ohne ihr einen Stuhl anzubieten. Dann musterte er sie, wobei er die Beine unterm Tisch ausstreckte und die Arme vor der Brust verschränkte, und sagte: »Ich weiß nicht, ob Ihnen klar ist, was Sie heute geleistet haben …«
»Doch, ja. Ich habe viel falsch gemacht«, entgegnete Mila, um ihm zuvorzukommen.
»Im Gegenteil. Sie haben drei Menschen das Leben gerettet.«
Mila verschlug es einen Moment die Sprache.
»Drei?«
Der Hauptkommissar richtete sich auf und starrte auf ein Blatt, das vor ihm lag.
»Im Haus des Musiklehrers wurde diese Notiz gefunden. Anscheinend hatte er geplant, noch ein Kind zu entführen.« Morexu reichte Mila die fotokopierte Seite eines Taschenkalenders: Dort stand ein Name.
»Priscilla?«, fragte sie.
»Priscilla«, wiederholte Morexu.
»Wer ist das?«
»Ein kleines Mädchen, das Glück gehabt hat.«
Mehr sagte er nicht. Weil er mehr nicht wusste. Es gab weder einen Nachnamen noch eine Adresse noch ein Foto. Nichts. Nur diesen Namen. Priscilla.
»Hören Sie also auf, sich Selbstvorwürfe zu machen«, fuhr Morexu fort und fügte, noch bevor Mila etwas entgegnen konnte, hinzu: »Ich habe Sie heute in der Pressekonferenz beobachtet und hatte den Eindruck, Ihnen würde das alles gar nichts bedeuten.«
»Es bedeutet mir auch nichts.«
»Verdammt noch mal, Vasquez! Die Menschen, die Sie da gerettet haben, werden Ihnen bis ans Ende ihrer Tage dankbar sein, ist Ihnen das klar? Von ihren Familien ganz zu schweigen!«
Sie haben den Blick von Elisa Gomes’ Mutter nicht gesehen, hätte Mila gerne erwidert. Doch sie nickte nur.
Morexu betrachtete sie kopfschüttelnd. »Seit Sie bei uns sind, habe ich nicht eine Klage über Sie gehört.«
»Und ist das gut oder schlecht?«
»Wenn Sie das nicht von selbst begreifen, stimmt etwas nicht, Mädchen. Aus diesem Grund bin ich auch der Ansicht, dass Ihnen ein wenig Teamarbeit guttun würde.«
Da war Mila allerdings anderer Meinung. »Warum? Ich erledige meine Arbeit – mein Job ist das Einzige, was mich interessiert. Und ich komme gut damit zurecht. Ich bin es nicht anders gewöhnt. Mit anderen zusammenarbeiten, würde bedeuten, meine Methoden an sie anpassen zu müssen. Wie könnte ich ihnen erklären, dass …«
»Gehen Sie, und packen Sie Ihre Koffer«, fiel Morexu ihr ins Wort.
»Warum so eilig?«
»Sie reisen noch heute Abend ab.«
»Soll das eine Art Strafe sein?«
»Nein, es ist weder eine Strafe noch ein Urlaub. Die Kollegen brauchen Ihren Rat. Sie sind inzwischen ziemlich populär …«
Mila wurde ernst: »Worum geht es?«
»Um die fünf Mädchen.«
Sie hatte in den Fernsehnachrichten von der Sache gehört, wenn auch nur mit halbem Ohr. »Warum ich?«, fragte sie.
»Weil es offenbar ein sechstes Mädchen gibt, von dem man noch nicht einmal den Namen weiß.«
Mila hätte gerne mehr erfahren, aber Morexu hielt das Gespräch für beendet. »Hier«, sagte er, reichte ihr eine Akte und wies damit gleichzeitig zur Tür. »Die Zugfahrkarte liegt bei.«
Mila ergriff die schmale Mappe und ging zur Tür. Bevor sie den Raum verließ, drehte sie sich noch einmal zu Morexu um: »Priscilla, ja?«
»So ist es.«
4
The Piper at the Gates of Dawn, 1967. A Saucerful of Secrets, 1968. Ummagumma war ’69 rausgekommen, ebenso der Soundtrack zu More. 1971