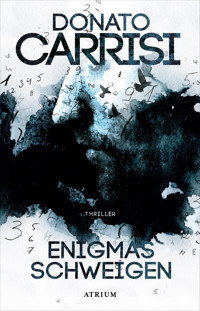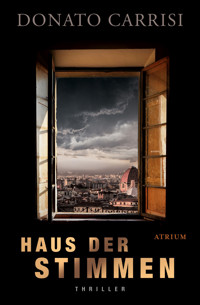
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atrium Verlag AG
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Der Nr. 1-Bestseller-Thriller aus Italien Der renommierte Psychologe Pietro Gerber erhält einen Anruf von einer australischen Kollegin. Sie bittet ihn, ihre Patientin Hanna Hall zu übernehmen, die während einer Hypnosesitzung behauptet hat, als Kind jemanden umgebracht zu haben. Da diese mysteriöse Erinnerung irgendwo in der Toskana verortet ist, reist die Patientin nun nach Italien, um der Wahrheit auf die Spur zu kommen. In den gemeinsamen Hypnosesitzungen mit Gerber taucht Hanna immer tiefer in ihre Erinnerungen ein. Doch Gerber wird stutzig: Ihre Vergangenheit scheint erstaunlich eng mit seiner eigenen Geschichte verwoben zu sein. Eine schreckliche Wahrheit drängt ans Licht, die sein Leben auf den Kopf zu stellen droht …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 393
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Donato Carrisi
Haus der Stimmen
Thriller
Aus dem Italienischen von Susanne Van Volxem und Olaf Roth
© Atrium Verlag AG, Zürich, 2023
Alle Rechte vorbehalten
Die Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel La casa delle voci bei Longanesi & C., Mailand
© Donato Carrisi, 2019
Aus dem Italienischen von Susanne Van Volxem und Olaf Matthias Roth
Covergestaltung: semper smile, München
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
ISBN978-3-03792-190-6
www.atrium-verlag.com
www.facebook.com/atriumverlag
www.instagram.com/atriumverlag
Für Antonio.
Meinen Sohn, mein Gedächtnis, mein ganzes Sein.
23. Februar
Ein Streicheln im Schlaf.
An der Grenze zum Wachsein, kurz vor dem Abgrund ins Vergessen, die zarte Berührung von kühlen Fingern auf der Stirn. Und ein sanftes, trauriges Wispern.
Ihr Name.
Das Mädchen riss die Augen auf. Eine plötzliche Furcht überkam sie. Jemand war zu ihr gekommen, während sie gerade einschlief. Vielleicht einer der ehemaligen Hausbewohner, mit denen sie hin und wieder ein paar Worte wechselte und die sie rascheln hörte wie die Ratten entlang der alten Mauern.
Doch diese Geister waren in ihrem Kopf, nicht dort draußen.
Auch Ado – der arme kleine Ado – kam sie manchmal besuchen. Aber im Gegensatz zu den Geistern sprach er nie mit ihr.
Nein, ihre Furcht hatte einen handfesten Grund.
Denn abgesehen von ihren Eltern kannte niemand auf der Welt da draußen ihren Namen.
So wollte es die Regel Nummer 3.
Die Vorstellung, gegen eine der fünf Regeln ihrer Eltern verstoßen zu haben, erschreckte sie. Sie hatten ihr immer vertraut. Sie durfte sie nicht enttäuschen. Vor allem jetzt nicht, wo Papa versprochen hatte, ihr das Jagen mit Pfeil und Bogen beizubringen, und Mama es endlich erlaubt hatte. Doch dann überlegte sie: Konnte es überhaupt ihre Schuld gewesen sein?
Regel Nummer 3: Sag niemals einem Fremden deinen Namen.
Weder hatte sie einem Fremden ihren Namen gesagt, noch konnte ihn jemand auf andere Art erfahren haben. Auch weil sie seit Monaten keine Menschenseele mehr in der Nähe des Bauernhofs gesehen hatten. Sie lebten vollkommen abgeschieden mitten auf dem Land, bis zur nächsten Stadt war es ein Fußmarsch von zwei Tagen.
Sie befanden sich in Sicherheit. Nur sie drei.
Regel Nummer 4: Komm niemals einem Fremden zu nahe und lass keinen Fremden zu nahe an dich heran.
Wie also hatte jemand sie beim Namen rufen können?
Es musste das Haus selbst gewesen sein, es gab keine andere Erklärung. Manchmal knackte es unheilvoll in den Balken, oder es knisterte leise. Papa sagte dann immer, das Haus würde sich auf seinen Fundamenten zurechtruckeln, wie ein altes Mütterchen mit schmerzenden Knochen in seinem Ohrensessel. Bestimmt hatte sie so ein Geräusch im Halbschlaf für ihren Namen gehalten. Ja, so musste es gewesen sein.
Ihr erregtes Gemüt beruhigte sich. Sie schloss die Augen. Schon hatte der Schlaf sie fast wieder mit seinem stillen Locken davongetragen, ins Warme, wo alles sich in nichts auflöst, als die Stimme erneut nach ihr rief.
Diesmal stützte das Mädchen sich auf dem Kopfkissen hoch und versuchte, mit den Augen die Dunkelheit zu durchdringen. Der Holzofen im Flur war schon vor Stunden ausgegangen. Nur unter der Decke war es noch warm, überall sonst hatte sich die Kälte ausgebreitet. Jetzt war sie endgültig wach.
»Wer bist du?«, hätte sie am liebsten in die Finsternis hineingerufen. Doch sie hatte Angst vor der Antwort. Oder vielleicht kannte sie sie auch schon.
Regel Nummer 5: Wenn ein Fremder dich bei deinem Namen ruft, ergreife die Flucht.
Sie setzte sich auf, tastete nach der einäugigen Lumpenpuppe, die immer bei ihr schlief, und drückte sie fest an ihre Brust. Ohne die Nachttischlampe einzuschalten, kletterte sie aus dem Bett und lief barfuß durch das dunkle Zimmer in den Flur. Nur ihre tappenden Schritte auf dem Holzboden waren zu hören. Sie musste Mama und Papa warnen.
Von der Treppe, die nach unten in die Küche führte, drang der Rußgeruch des Kamins zu ihr hoch. Sie sah den schweren Tisch aus Olivenholz vor sich, auf dem noch die Reste ihres Festmahls standen. Genau drei Stücke waren aus der Torte aus altem Brot und Zucker herausgeschnitten, die ihre Mutter gebacken hatte. Auch die zehn Kerzen, die sie vom Schoß ihres Vaters aus in einem Atemzug ausgeblasen hatte, befanden sich noch dort.
Je näher sie dem Schlafzimmer ihrer Eltern kam, umso mehr wurden ihre glücklichen Erinnerungen von bösen Vorahnungen verdrängt.
Regel Nummer 2: Fremde bedeuten Gefahr.
Sie hatte es mit eigenen Augen gesehen: Die Fremden entführten Menschen, brachten sie fort von ihren Liebsten. Niemand wusste, wo sie sich aufhielten oder was aus ihnen geworden war. Aber vielleicht war sie auch einfach noch zu jung, noch nicht reif genug, um die ganze Wahrheit zu erfahren. Sie wusste nur, dass diese Menschen nie mehr zurückkehrten.
Nie mehr.
»Papa, Mama … Da ist jemand draußen vor dem Haus«, sagte sie leise, aber in dem bestimmten Tonfall einer Erwachsenen.
Ihr Vater wurde als Erster wach, gleich darauf auch ihre Mutter. Sofort hatte das Mädchen ihre volle Aufmerksamkeit.
»Was hast du gehört?«, fragte die Mutter, während der Vater die Taschenlampe zur Hand nahm, die stets griffbereit neben seinem Bett lag.
»Meinen Namen«, erwiderte das Mädchen zögernd. Sie hatte Angst, ausgeschimpft zu werden, weil sie gegen eine der fünf Regeln verstoßen hatte.
Doch niemand machte ihr einen Vorwurf. Ihr Vater schaltete die Taschenlampe ein und schirmte sofort den Lichtstrahl mit der Hand ab, damit die Eindringlinge nicht mitbekamen, dass sie wach waren.
Die Eltern stellten keine weiteren Fragen. Sie mussten erst herausfinden, ob sie ihr Glauben schenken konnten. Aber nicht, weil sie sie für eine Lügnerin hielten; sie wussten ganz genau, dass sie in einer solchen Situation niemals die Unwahrheit sagen würde. Sie mussten lediglich sicherstellen, dass das, was sie erzählt hatte, der Realität entsprach. Dabei wünschte das Mädchen so sehr, sich alles eingebildet zu haben.
Reglos, die Köpfe leicht gesenkt, verharrten ihre Eltern schweigend und horchten in die Dunkelheit hinein. Das Mädchen musste an die Radioteleskope in ihrem Astronomiebuch denken, die den Himmel nach unbekannten Signalen absuchten – sosehr man es vielleicht hoffte, so groß war die Angst, tatsächlich ein Signal zu empfangen. Denn die Entdeckung, nicht allein im Universum zu sein, wäre, wie Papa ihr erklärt hatte, keine wirklich gute Nachricht. »Die Außerirdischen haben nicht unbedingt freundliche Absichten …«
Endlose Sekunden in absoluter Stille vergingen. Die einzigen Geräusche kamen vom Rauschen des Windes in den vertrockneten Baumkronen, dem Quietschen der rostigen Wetterfahne auf dem Dach und dem Ächzen der alten Scheune – wie ein Walfisch, der auf dem Grund des Ozeans schlief.
Plötzlich ein metallisches Klirren.
Ein zu Boden gefallener Blecheimer. Um genau zu sein: der Eimer aus dem alten Brunnen. Ihr Vater hatte ihn zwischen zwei Zypressen in der Nähe des Hühnerstalls befestigt, als eine der selbst gebauten Alarmanlagen, die er jeden Abend rund ums Haus aufstellte.
Sie wollte etwas sagen, doch bevor sie ein Wort herausbringen konnte, hatte ihr die Mutter schon die Hand auf den Mund gelegt. Vielleicht war es ein Tier, hatte sie sagen wollen, ein Marder oder Fuchs, es mussten nicht unbedingt die Fremden sein.
»Die Hunde«, flüsterte ihr Vater.
Erst jetzt begriff sie es auch. Papa hatte recht: Wenn es ein Marder oder Fuchs gewesen wäre, hätten die Wachhunde sofort zu bellen angefangen, als der Eimer scheppernd zu Boden fiel. Wenn sie es nicht getan hatten, gab es nur eine Erklärung.
Jemand hatte sie zum Schweigen gebracht.
Bei dem Gedanken, dass ihren vierbeinigen Freunden etwas passiert sein konnte, stiegen ihr die Tränen in die Augen. Mit aller Macht versuchte sie, nicht zu weinen. Eine Welle der Panik überflutete sie.
Ihre Eltern mussten nur einen Blick wechseln. Sie wussten genau, was zu tun war.
Ihr Vater sprang als Erster aus dem Bett. Rasch zog er sich an, nur seine Schuhe ließ er weg. Die Mutter folgte seinem Beispiel, doch dann tat sie etwas, das das Mädchen sprachlos machte: Sie wartete, bis der Vater außer Sichtweite war, dann schob sie die Hand unter die Matratze, holte einen kleinen Gegenstand hervor und steckte ihn hastig in ihre Hosentasche. Das Mädchen konnte nicht erkennen, was es war.
Sie wunderte sich. Mama und Papa hatten doch sonst keine Geheimnisse voreinander.
Bevor sie nachfragen konnte, drückte die Mutter ihr eine Taschenlampe in die Hand, kniete sich vor sie hin und legte ihr eine Decke um die Schultern.
»Weißt du noch, was jetzt drankommt?«, fragte sie und schaute ihr gerade in die Augen.
Das Mädchen nickte. Der feste Blick der Mutter machte ihr Mut. Seit dem Umzug auf den verlassenen Bauernhof vor gut einem Jahr hatten sie das »Manöver« – so nannte ihr Vater es – dutzendfach geübt. Jetzt kam es zum ersten Mal zum Einsatz.
»Halt deine Puppe gut fest«, sagte die Mutter, nahm ihre Hand in die eigene, die warm und stark war, und zog sie mit sich fort.
Während sie die Treppe hinuntereilten, drehte das Mädchen sich für einen Moment nach hinten um. Sie sah, wie der Vater entlang der Wände im Obergeschoss einen der Kanister ausleerte, den er aus der Abstellkammer geholt hatte. Sofort war die Flüssigkeit in den Ritzen zwischen den Dielen versickert. Zurück blieb nur ein beißender Geruch.
Als sie das Erdgeschoss erreicht hatten, zog die Mutter sie in den hinteren Teil des Wohntrakts. Holzsplitter bohrten sich in ihre nackten Füße. Das Mädchen presste die Zähne aufeinander, um nicht vor Schmerzen aufzustöhnen. Doch es war unnötig – sie mussten sich nicht mehr verstecken, denn die Fremden hatten sie längst bemerkt.
Sie hörte, wie sie draußen auf der Suche nach einem Eingang um das Haus herumliefen.
Auch früher war es vorgekommen, dass es an dem Ort, an dem sie sich sicher wähnten, eine Bedrohung gegeben hatte. Doch bisher waren sie der Gefahr immer entgangen.
Sie kamen an dem großen Holztisch mit der Geburtstagstorte und den zehn Kerzen vorbei, an der Emailletasse, aus der sie immer ihre Frühstücksmilch trank, den Holzspielsachen, die ihr Vater für sie geschnitzt hatte, der Keksdose, dem Regal mit den Büchern, aus denen sie sich abends nach dem Essen gegenseitig vorlasen. Lauter Dinge, von denen sie sich verabschieden musste, wieder einmal.
Beim Kamin angelangt, steckte ihre Mutter die Hand in den Rauchabzug, um nach der verrußten Eisenkette zu tasten, die den im Schornstein verborgenen Flaschenzug in Gang setzen würde. Endlich hatte sie sie gefunden. Mit aller Kraft zog sie daran, und langsam begann sich eine der Sandsteinplatten zu bewegen. Doch sie war zu schwer; ohne die Hilfe ihres Vaters würden sie es nicht schaffen, den Stein zu verschieben. Wo blieb er denn nur? Warum brauchte Papa so lange? Das Mädchen spürte, wie die Angst in ihr hochkroch.
»Los, hilf mir«, knurrte ihre Mutter.
Mit vereinten Kräften zogen sie an der Kette. Im Eifer des Gefechts stieß die Mutter mit dem Ellbogen einen Tonkrug vom Kaminsims. Ohnmächtig sahen sie zu, wie er auf den harten Fliesen in Stücke zersprang.
Ein dumpfes Poltern erschütterte das Haus. Kurz darauf hörten sie, wie jemand krachend gegen die Eingangstür schlug. Es klang wie ein Warnschuss, der bis zu ihnen herüberdrang.
Wir wissen, dass ihr da seid. Wir wissen, wo ihr euch versteckt habt. Und gleich werden wir euch holen kommen.
Immer heftiger zerrten Mutter und Tochter an der Kette, bis sich die Steinplatte unter dem Rost so weit bewegt hatte, dass die Öffnung groß genug war. Mit dem Lichtkegel der Taschenlampe zeigte die Mutter auf eine Holztreppe, die nach unten führte.
Die ganze Zeit hatten die Schläge gegen die Eingangstür nicht aufgehört, vielmehr wurden sie immer lauter und schneller.
Das Mädchen und die Mutter wandten sich zum Flur und sahen endlich den Vater kommen, mit zwei Weinflaschen in den Händen. Statt Korken steckten in Flüssigkeit getränkte Stoffbäusche darin. Vor einiger Zeit hatte das Mädchen im Wald beobachtet, wie der Vater eine solche Flasche in Brand gesetzt und sie gegen einen ausgedörrten Baumstamm geworfen hatte, der sofort Feuer fing.
Die Fremden schlugen noch immer mit aller Kraft gegen die Tür. Mit Entsetzen beobachtete das Mädchen, wie sich die Scharniere aus der Verankerung in der Wand lösten. Mit jedem Schlag wirkten die vier Bolzen, mit denen die Tür verrammelt war, fragiler.
Diese letzte Barriere würde die Eindringlinge nicht aufhalten können, so viel war klar.
Ihr Vater schaute erst zu ihnen, dann zur Tür und dann zurück zu ihnen. Für das »Manöver« blieb keine Zeit mehr. Ohne länger nachzudenken, nickte er ihnen zu und stellte eine der beiden Flaschen auf dem Boden ab, um in seiner Hosentasche nach Streichhölzern zu suchen.
Mit einem fürchterlichen Krachen gab die Tür nach.
Unter lautem Gebrüll stürmten mehrere schattenhafte Gestalten ins Haus. Zum letzten Mal schaute der Vater zu der Mutter und dem Mädchen, ein Blick wie eine Umarmung. In seinen Augen lag so viel Liebe, Trauer und Abschiedsschmerz, dass sie wusste, die Erinnerung daran würde ihr bis ans Ende ihrer Tage das Herz zerreißen.
Ein leichtes Lächeln, das nur für sie beide bestimmt war, umspielte seine Lippen, als er die Flasche in Brand setzte. In hohem Bogen warf er sie von sich und verschwand dann zusammen mit den Schatten in den auflodernden Flammen. Mehr konnte das Mädchen nicht erkennen, denn ihre Mutter drängte sie in die Öffnung unterhalb des Kamins. Die Eisenkette fest im Griff, folgte sie ihr nach.
So schnell es ging, kletterten sie die Leiter hinunter. Mehrmals hätten sie beinahe die Sprossen verfehlt und wären gestürzt. Von oben war das dumpfe Dröhnen einer weiteren Explosion zu hören. Aufgeregte Stimmen, die unverständliche Worte brüllten.
Als sie unten auf dem feuchten Grund angekommen waren, ließ ihre Mutter die Kette los, damit die Steinplatte über ihren Köpfen zurück an ihren Platz gleiten konnte. Doch der Mechanismus war blockiert, sodass ein schmaler Spalt offen blieb. Die Mutter versuchte, den Widerstand zu lösen, sie zog und zerrte an der Kette. Vergeblich.
Das »Manöver« sah vor, dass die Familie bei einem Angriff im Keller Schutz suchte, während über ihnen das Haus abbrannte. Vielleicht hätten die Fremden Angst bekommen und die Flucht ergriffen, oder sie hätten angenommen, die Eltern und das Mädchen seien in den Flammen umgekommen. Laut Plan hätten sie, nachdem die Gefahr vorüber war, die Falltür geöffnet und wären nach oben zurückgekehrt.
Doch irgendetwas war schiefgelaufen. Alles war schiefgelaufen. Erst war Papa nicht mitgekommen, dann hatte sich die verfluchte Steinplatte nicht richtig geschlossen. Der Qualm musste sich mittlerweile im ganzen Haus ausgebreitet haben. Schon kroch er durch den Spalt zu ihnen nach unten, um sie zu ersticken. Und aus diesem engen Loch gab es keinen anderen Ausweg.
Ihre Mutter zog sie in die äußerste Ecke der Katakombe. Wenige Meter von ihnen entfernt, unter einer Zypresse, lag Ado begraben. Der arme kleine Ado. Sie hätten ihn aus seinem Grab herausholen und ihn von hier fortbringen sollen.
Doch nun kamen sie selbst nicht mehr heraus.
Die Mutter nahm ihr die Decke von den Schultern.
»Geht’s dir gut?«, fragte sie.
Das Mädchen drückte die Lumpenpuppe an sich. Sie zitterte am ganzen Körper. Trotzdem nickte sie.
»Hör mir gut zu«, fuhr die Mutter fort. »Du musst jetzt ganz tapfer sein.«
»Mama, ich habe Angst, ich kriege keine Luft mehr«, sagte das Mädchen und hustete. »Bitte, lass uns hier weggehen!«
»Wenn wir hier weggehen, werden wir von den Fremden verschleppt, das weißt du doch. Ist es das, was du willst?« Die Stimme ihrer Mutter klang fast vorwurfsvoll. »Wir haben so viele Opfer gebracht, damit genau das nicht passiert – und jetzt sollen wir klein beigeben?«
Das Mädchen hob den Blick zur Kellerdecke. Sie konnte sie hören, nur wenige Meter entfernt. Die Fremden versuchten, das Feuer zu ersticken, um sie zu holen.
»Ich habe immer alle Regeln befolgt«, sagte sie schluchzend.
»Ich weiß, mein Liebling«, sagte ihre Mutter besänftigend und strich ihr über die Wange.
Mit lautem Stöhnen, wie ein verwundeter Riese, ergab sich das Haus der Stimmen den Flammen. Es war kaum mit anzuhören. Der Qualm, der durch den Spalt zwischen den Steinplatten drang, wurde dichter und schwärzer.
»Wir haben nicht mehr viel Zeit«, mahnte ihre Mutter. »Aber es gibt noch eine Möglichkeit, wie sie uns nicht kriegen können …«
Sie griff in ihre Hosentasche und holte ein Fläschchen hervor – den geheimnisvollen Gegenstand, den sie sogar vor dem Vater verborgen hatte.
»Ein Schluck für dich, einer für mich.«
Sie entkorkte das Fläschchen und reichte es ihr.
Das Mädchen zögerte.
»Was ist das?«
»Frag nicht. Trink.«
»Und was passiert dann?«, erwiderte sie erschrocken.
Die Mutter lächelte.
»Man nennt es das ›Wasser des Vergessens‹ … Wir werden einschlafen, und wenn wir wieder aufwachen, ist alles vorbei.«
Das Mädchen glaubte ihr nicht. Warum war das Wasser des Vergessens nicht Bestandteil des »Manövers«? Warum hatte ihr Vater nichts davon gewusst?
Die Mutter packte sie am Arm und schüttelte sie.
»Wie lautet die Regel Nummer 5?«
Das Mädchen verstand nicht, warum sie ausgerechnet jetzt die Regeln aufsagen sollte.
»Regel Nummer 5 – nun mach schon!«, rief die Mutter.
»Wenn ein Fremder dich bei deinem Namen ruft, ergreife die Flucht«, sagte sie leise.
»Und Nummer 4?«
»Komm niemals einem Fremden zu nahe und lass keinen Fremden zu nahe an dich heran«, erwiderte sie mit tränenerstickter Stimme. »Regel Nummer 3 lautet: Sag niemals einem Fremden deinen Namen.« Ihr fiel ein, wie in der Nacht alles begonnen hatte, und schluchzend fügte sie hinzu: »Aber das habe ich nie getan, ich schwöre es dir!«
Die Stimme ihrer Mutter wurde weicher.
»Mach weiter, Regel Nummer 2 …«
Sie zögerte einen Moment.
»Fremde bedeuten Gefahr.«
»Fremde bedeuten Gefahr«, wiederholte ihre Mutter fast heiter.
Dann setzte sie das Fläschchen an die Lippen, trank einen Schluck und hielt es ihr wieder hin.
»Ich hab dich lieb, mein Schatz.«
»Ich dich auch, Mama.«
Das Mädchen schaute die Mutter an, die ihren Blick erwiderte. Dann sah sie auf das Fläschchen in ihrer Hand und hob es zum Mund. Ohne zu zögern, leerte sie es bis auf den letzten Tropfen.
Regel Nummer 1: Vertrau nur Mama und Papa.
1
Für ein Kind ist die Familie der sicherste Ort auf der Welt. Oder der gefährlichste.
Pietro Gerber versuchte, das nie zu vergessen.
»Okay, Emilian. Möchtest du mir erzählen, was in dem Keller passiert ist?«
Der sechsjährige Junge, der mit seiner bleichen, fast durchsichtigen Haut an einen Geist erinnerte, verharrte in Schweigen. Er hob nicht einmal den Blick von den bunten Holzklötzen, mit denen sie gemeinsam eine Burg bauten. Gerber fuhr geduldig fort, Stein auf Stein zu setzen, ohne ihn zur Eile anzutreiben. Seine Erfahrung sagte ihm, dass Emilian von selbst den richtigen Zeitpunkt zum Reden finden würde.
Jedes Kind hat seinen eigenen Rhythmus, sagte er sich immer wieder.
Seit mindestens vierzig Minuten hockte Pietro Gerber neben Emilian auf dem regenbogenfarbenen Teppich in dem fensterlosen Zimmer, das sich im zweiten Stock eines Renaissancepalastes in der Via della Scala mitten in der Altstadt von Florenz befand.
Ursprünglich war das Haus von karitativen Florentiner Institutionen dazu bestimmt gewesen, »verlorenen Knaben und Mägdelein ein Heim zu geben« – also Kindern, die von ihren Familien ausgesetzt worden waren, weil sie sie nicht ernähren konnten. Oder auch unehelichen Kindern, Waisen und Minderjährigen, die Opfer sozialer Missstände geworden waren.
Seit der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts befand sich dort der Sitz des Jugendgerichts.
Zwischen all den prachtvollen Gebäuden ringsumher, die sich auf wenige Quadratkilometer konzentrierten und aus Florenz eine der schönsten Städte der Welt machten, fiel das Haus kaum auf. Dennoch konnte man es beileibe nicht x-beliebig nennen. Zum Ersten wegen seiner Vergangenheit: Früher einmal war es eine Kirche gewesen. Zum Zweiten wegen eines Wandgemäldes von Botticelli, das Die Verkündigung an Maria darstellte.
Und zum Dritten wegen seines Spielzimmers.
Neben den Bauklötzen, mit denen Emilian gerade spielte, befanden sich dort ein Puppenhaus, eine Modelleisenbahn, verschiedene Spielzeugautos wie Lastwagen und Bagger, ein Schaukelpferd, eine Miniaturküche für die Zubereitung imaginärer Delikatessen und zahlreiche Plüschtiere. Auch ein kleiner Tisch mit vier Stühlen und einigen Malsachen stand in einer Ecke.
Doch es war kein echtes Spielzimmer. Alles innerhalb dieser zwanzig Quadratmeter diente dazu, den wahren Charakter des Ortes zu verschleiern.
In Wirklichkeit war das Spielzimmer ein Gerichtssaal.
An einer der vier Wände hing ein riesiger Spiegel, hinter dem sich Richter und Staatsanwalt, aber auch die Beschuldigten und ihre Anwälte verbargen.
Der Raum war eingerichtet worden, damit die psychische Unversehrtheit der jungen Opfer, die innerhalb des geschützten Umfelds als Zeugen aussagen sollten, so gut wie möglich bewahrt blieb. Um die Befragung zu erleichtern, waren sämtliche Gegenstände im Zimmer sorgfältig von Kinderpsychologen ausgesucht worden. Jedes Objekt diente dazu, eine bestimmte Rolle bei der Aussage oder der Interpretation der Fakten einzunehmen.
Oft nahmen die Kinder in dem Rollenspiel den Platz ihrer Folterer ein und unterwarfen die Plüschtiere oder Puppen der gleichen brutalen Behandlung, die sie selbst erlitten hatten. Manche zeichneten lieber, als dass sie redeten, andere erfanden Geschichten und bauten darin Hinweise auf ihre Torturen ein.
Manchmal enthüllten sie auch Dinge, ohne es zu merken.
Genau aus dem Grund schauten von den Bildern an den Wänden nicht nur fröhliche Fantasiegestalten den Kindern beim Spielen zu, sondern auch unsichtbare Mikrokameras. Jedes Wort, jede Geste, jede Reaktion wurde aufgezeichnet, um später bei der Urteilsfindung als Beweis verwertet werden zu können. Doch es gab auch Details, die den elektronischen Augen entgingen. Nuancen, die Pietro Gerber, gerade einmal dreiunddreißig Jahre alt, mit größter Präzision zu erfassen gelernt hatte.
Während er weiter mit Emilian an der Burg aus bunten Holzklötzen baute, beobachtete er ihn aufmerksam, in der Hoffnung, noch das kleinste Anzeichen für eine Öffnung zu bemerken.
Die Zimmertemperatur betrug dreiundzwanzig Grad, die Deckenlampen verströmten ein bläuliches Licht, und im Hintergrund gab ein Metronom einen Takt von vierzig Schlägen pro Minute vor.
Die perfekte Atmosphäre, um sich vollkommen zu entspannen.
Wenn jemand Gerber nach seinem Beruf fragte, antwortete er nie »Kinderpsychologe mit Spezialgebiet Hypnotherapie«. Der von ihm verwendete Begriff stammte von demjenigen, der ihn all sein Wissen gelehrt hatte, und drückte am besten sein eigentliches Tun aus.
Der Kinderflüsterer.
Gerber wusste, dass viele Menschen die Hypnose für eine Art alchemistische Praxis hielten, mit deren Hilfe man sich andere gefügig machte und sie dazu bringen konnte, alles Mögliche zu sagen oder zu tun.
Tatsächlich handelte es sich lediglich um eine Technik, Menschen dabei zu helfen, in Kontakt mit sich selbst zu treten, wenn sie aus dem Gleichgewicht gekommen waren.
Man verlor die Kontrolle weder über sich noch über sein Bewusstsein – der Beweis war der kleine Emilian, der unbekümmert vor sich hin spielte. Dank der Hypnose wurde der Wachheitsgrad gesenkt, sodass über die Außenwelt keine Störungen mehr zu dem Patienten gelangten. Und durch den Ausschluss jeglicher Form von Ablenkung nahm die Wahrnehmung der eigenen Person zu.
Die Arbeit von Pietro Gerber war noch spezifischer: Er lehrte die Kinder, während sie sich in diesem Schwebezustand zwischen Spiel und Realität befanden, ihre Erinnerungen zu ordnen und das Wahre vom Unwahren zu unterscheiden.
Doch die zur Verfügung stehende Zeit mit Emilian neigte sich dem Ende zu. Der Therapeut konnte sich nur allzu gut den missvergnügten Gesichtsausdruck der Baldi vorstellen, der Jugendrichterin, die sich zusammen mit den anderen hinter der Spiegelwand befand. Sie war diejenige gewesen, die ihn als Experten zu dem Fall hinzugezogen hatte, und sie gab ihm auch die Fragen vor, die er dem Jungen stellen sollte. Gerbers Aufgabe bestand in der Entwicklung einer Strategie, mit deren Hilfe Emilian die gewünschten Informationen lieferte. Wenn er innerhalb der nächsten zehn Minuten nichts Brauchbares in Erfahrung gebracht haben würde, müsste die Sitzung auf einen anderen Termin verschoben werden. Noch wollte er sich jedoch nicht geschlagen geben. Es war bereits ihr viertes Treffen; das eine oder andere hatten sie schon erreicht, aber noch keinen echten Fortschritt gemacht.
Emilian – das Geisterkind – sollte vor Gericht die Worte wiederholen, die er eines Tages überraschend zu seiner Lehrerin gesagt hatte. Das Problem war, dass er seit damals nicht mehr von der »Sache mit dem Keller« gesprochen hatte.
Und ohne seine Aussage besaßen sie keine Beweise.
Bevor er auch diese Sitzung für gescheitert erklären musste, wollte Gerber noch einen letzten Versuch wagen.
»Es macht gar nichts, wenn du nicht über den Keller reden willst«, sagte er.
Ohne auf die Antwort des Jungen zu warten, hörte er auf, weiter an der Burg zu bauen. Stattdessen nahm er ein paar Bauklötze und begann, daneben ein anderes Gebäude zu errichten.
Emilian, der sein Tun bemerkt hatte, schaute ihn verwirrt an.
»Ich war in meinem Zimmer und habe gemalt, als ich plötzlich dieses Lied gehört habe …«, sagte er leise, ohne ihn anzuschauen.
Gerber zeigte keine Reaktion und fuhr fort zu bauen.
»Das Lied vom kleinen Naseweis, kennst du das?« Emilian fing an zu singen: »Der kleine Naseweis, / der spielt in seinem Zimmer, / da hört er eine Stimme, / die ist von einem Geist. / ›Mein lieber kleiner Naseweis, / komm, gib mir doch ein Küsschen, / dann kriegst du auch ein Eis / mit vielen leck’ren Nüsschen.‹«
»Ja, das kenne ich«, erwiderte der Psychologe und fuhr fort, die Bauklötze aufeinanderzustapeln, als wäre es ein ganz normales Gespräch.
»Also bin ich losgegangen, um zu gucken, woher die Stimme kam …«
»Und, hast du sie gefunden?«
»Sie kam aus dem Keller.«
Zum ersten Mal war es Gerber gelungen, Emilian gedanklich aus dem Spielzimmer zu bringen. Jetzt waren sie bei dem kleinen Naseweis zu Hause. Er musste ihn dort so lange wie möglich halten.
»Bist du in den Keller runtergegangen, um nachzuschauen, was sich dort befindet?«
»Ja, bin ich.«
Emilians Bestätigung war von großer Bedeutung. Zur Belohnung reichte der Psychologe ihm einen bunten Holzklotz und damit die Einladung, an der neuen Burg mitzubauen.
»Ich nehme an, es war ziemlich dunkel im Keller. Hattest du keine Angst, ganz alleine da runterzugehen?«, fragte er, um die Glaubwürdigkeit des kleinen Zeugen auszutesten.
»Nein«, erwiderte der Junge, ohne zu zögern. »Da war ja Licht an.«
»Und was hast du im Keller entdeckt?«
Diesmal kam die Antwort nicht wie aus der Pistole geschossen. Gerber hörte auf, ihm Bauklötze zu reichen.
»Die Tür war nicht abgeschlossen wie sonst«, nahm der Junge den Faden wieder auf. »Mama sagt immer, ich darf sie nicht öffnen, das ist zu gefährlich. Aber diesmal war sie nur angelehnt. Man konnte sogar durch den Spalt schauen …«
»Und, hast du?«
Der Junge nickte.
»Weißt du nicht, dass Herumschnüffeln verboten ist?«
Eine solche Frage konnte auch nach hinten losgehen. Die Gefahr bestand, dass Emilian sich gemaßregelt fühlte und innerlich zurückzog, ohne weiterzureden. Aber wenn Gerber ihn zu einer unanfechtbaren Aussage bringen wollte, musste er das Risiko eingehen. Ein Kind, das nicht erkannte, wann es eine moralisch verwerfliche Tat beging, konnte nicht als zuverlässiger Zeuge für die Taten anderer angesehen werden.
»Ich weiß, aber in dem Moment habe ich vergessen, dass man nicht herumschnüffeln soll«, verteidigte sich der Junge.
»Und was hast du in dem Keller gesehen?«
»Da waren Leute …«, sagte er nur.
»Kinder?«
Emilian schüttelte den Kopf.
»Also Erwachsene …«
Der Junge nickte.
»Und was haben sie gemacht?«, ermutigte ihn der Psychologe zum Weitersprechen.
»Sie hatten keine Kleider an.«
»So, wie wenn man zum Baden ins Schwimmbad geht? Oder wie beim Duschen?«
»Wie beim Duschen.«
Auch diese Aussage war von großem Wert für den Verlauf des Verfahrens. Für Kinder war die Nacktheit von Erwachsenen normalerweise ein Tabu. Doch Emilian hatte seine Scheu überwunden.
»Und sie hatten Masken an«, fügte er noch hinzu, ohne dass Gerber danach gefragt hätte.
»Masken?«, entgegnete der Psychologe in gespieltem Erstaunen, denn er kannte die Geschichte schon von Emilians Lehrerin. »Was denn für Masken?«
»Aus Plastik, mit einem Gummiband hintendran. Sie haben nur das Gesicht bedeckt«, sagte der Junge. »Es waren Tiere.«
»Tiere?«, wiederholte der Psychologe.
Der Junge begann aufzuzählen:
»Eine Katze, ein Schaf, ein Schwein, eine Eule … und ein Wolf.« Er zögerte kurz. »Ja, ein Wolf«, bestätigte er dann.
»Warum trugen sie deiner Meinung nach diese Masken?«
»Sie haben gespielt.«
»Und was war das für ein Spiel? Kanntest du es?«
Der Junge dachte einen Moment nach.
»Sie haben so Sachen aus dem Internet gemacht.«
»So Sachen aus dem Internet?« Gerber wollte, dass Emilian sich präziser ausdrückte.
»Leo, mein Schulfreund, hat einen großen Bruder, der ist schon zwölf. Einmal hat der Bruder von Leo uns was im Internet gezeigt. Die Leute in dem Video waren alle nackt und haben sich ganz komisch umarmt und geküsst.«
»Hat dir das Video gefallen?«
Emilian zog eine Grimasse.
»Und dann hat der Bruder von Leo noch gesagt, wir sollen nicht darüber reden, weil das ein Spiel nur für Erwachsene ist.«
»Verstehe«, sagte der Psychologe, ohne seinen Tonfall zu verändern. »Du bist sehr tapfer, Emilian, ich hätte mich bestimmt zu Tode erschreckt.«
»Ich hatte keine Angst, weil ich die Leute kannte.«
Der Psychologe war auf der Hut. Jetzt durfte er keinen Fehler machen, die Situation war äußerst delikat.
»Du wusstest also, wer die Leute mit den Masken waren?«
Der Junge schien die Burg für einen Moment vergessen zu haben. Er schaute zum Spiegel hinüber. Hinter der Glasscheibe warteten fünf Menschen schweigend auf seine Antwort.
Eine Katze, ein Schaf, ein Schwein, eine Eule. Und ein Wolf.
Gerber wurde bewusst, dass er Emilian nicht helfen konnte. Er hoffte, dass der Kleine mit seinen gerade einmal sechs Jahren Lebenserfahrung den Mut finden würde, die wahren Namen der Protagonisten dieses Albtraums zu nennen.
»Papa, Mama, Opa, Oma. Und Pater Luca.«
Für ein Kind ist die Familie der sicherste Ort auf der Welt. Oder der gefährlichste, wiederholte Pietro Gerber in Gedanken.
»Sehr gut, Emilian. Jetzt zählen wir zusammen von hinten nach vorne: zehn, neun, acht …«
2
Als die Verhandlung zu Ende war, warf Gerber einen Blick auf sein Handy, das er leise gestellt hatte, und sah eine unbekannte Nummer auf der Anrufliste. Während er noch darüber nachdachte, ob er sofort zurückrufen sollte, schoss Anita Baldi ihre erste Frage ab.
»Und, was meinst du?«
Die Untersuchungsrichterin hatte nicht einmal abgewartet, bis Gerber die Bürotür hinter sich geschlossen hatte. Wahrscheinlich hatte ihr die Frage schon auf der Zunge gebrannt, seit Emilian seine Aussage gemacht hatte.
Der Psychologe wusste, dass die Richterin sich so schnell wie möglich mit ihm darüber austauschen wollte. Doch die eigentliche Frage war eine andere.
Hatte Emilian die Wahrheit gesagt?
»Kinder haben oft eine lebhafte Fantasie«, erklärte er. »Manchmal erfinden sie Dinge, die ihnen angeblich passiert sind, auch wenn man dabei nicht von echten Lügen sprechen kann. Sie glauben dann felsenfest, diese Dinge erlebt zu haben, egal, wie absurd sie erscheinen. Ihr Vorstellungsvermögen ist so ausgeprägt, dass sie nicht in der Lage sind, die Realität von der Imagination zu unterscheiden.«
Der Richterin schien seine Erklärung nicht zu genügen.
Statt hinter ihrem Schreibtisch Platz zu nehmen, trat sie ans Fenster und riss es trotz des dunklen, kalten Wintermorgens sperrangelweit auf, als befänden sie sich im Hochsommer.
»Da drüben sitzt ein junges Paar, das Ewigkeiten darauf gewartet hat, ein Kind adoptieren zu können, zwei reizende Großeltern, die jeder Enkel fürs Leben gern hätte, und ein Priester, der sich seit Jahren bemüht, Kinder wie Emilian aus ihren grauenhaften Familienverhältnissen zu befreien und ihnen eine Zukunft voller Liebe zu ermöglichen … Und dieser süße kleine Fratz erzählt uns was von einem ebenso orgiastischen wie gotteslästerlichen Ritual.«
Die Richterin versuchte offensichtlich, ihre Enttäuschung hinter Sarkasmus zu verstecken. Gerber konnte ihre Frustration gut verstehen.
Emilian war in Weißrussland geboren; der Hypnotiseur hatte seine Akte mehrfach gelesen. Den Papieren zufolge war er im Alter von zweieinhalb Jahren seiner biologischen Familie weggenommen worden, nachdem er dort alle erdenklichen Varianten von Gewalt erlebt hatte. Mama und Papa hatten ihren Spaß dabei gehabt, seinen Überlebenswillen auf die Probe zu stellen, als wäre seine Kindheit ein Survival Game. Tagelang ließen sie ihn ohne Essen oder weinend in den eigenen Exkrementen wühlend zurück. Zum Glück, sagte sich Gerber, hatten Kinder unter drei Jahren noch kein Erinnerungsvermögen. Doch es wäre keinesfalls ungewöhnlich, wenn sich irgendwo in Emilians Bewusstsein noch Spuren dieser Folterzeit ausmachen ließen.
Pater Luca hatte ihn in einem Waisenhaus entdeckt, wo er ihm unter Dutzenden von Kindern sofort aufgefallen war. Emilian wies eine starke Entwicklungsverzögerung auf und konnte kaum sprechen. Der Geistliche, der eine Vermittlungsagentur für Fernadoptionen mit Schwerpunkt auf der ehemaligen Sowjetunion leitete, hatte eine Familie für ihn gefunden: ein junges Ehepaar aus seiner Gemeinde, das es nach erheblichem Bürokratieaufwand und finanziellen Belastungen endlich geschafft hatte, den Jungen nach Italien zu holen.
Nach nur einem Jahr, das er in einer normalen Familie verbracht hatte, war Emilians Entwicklung vergleichbar mit der von Gleichaltrigen und sein Italienisch halbwegs fließend. Doch als endlich alles zum Besten zu stehen schien, hatte er plötzlich Anzeichen von Magersucht gezeigt.
Das Geisterkind war so dünn geworden, dass seine Adoptiveltern ihn, ohne Kosten zu scheuen, von einem Arzt zum nächsten gebracht hatten. Keiner hatte ihm helfen können. Allerdings begründeten sie alle seine Essstörung mit der Erfahrung von Gewalt und Vernachlässigung während seiner frühen Kindheit.
Trotz ihrer Misserfolge, die richtige Behandlung für den Jungen zu finden, hatten die Eltern nicht aufgegeben. Die Adoptivmutter hatte sogar ihren Beruf an den Nagel gehängt, damit sie sich ausschließlich um den Sohn kümmern konnte. In Anbetracht dieser Vorgeschichte war Baldi verständlicherweise verstimmt über den neuerlichen Schicksalsschlag, den die Eheleute zu erleiden hatten.
»Ich glaube, wir haben keine andere Wahl«, gab Gerber zu bedenken. »Wir müssen uns weiter anhören, was Emilian zu sagen hat.«
»Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob ich mir das noch länger antun will«, sagte die Richterin verbittert. »Als Kind bleibt dir kaum etwas anderes übrig, als den zu lieben, der dich zur Welt gebracht hat, auch wenn er dir wehtut. Emilians Vergangenheit in Weißrussland ist wie ein schwarzes Loch, aber jetzt befindet er sich in einer völlig anderen Situation. Er hat gerade entdeckt, dass er eine mächtige Waffe besitzt: die Liebe seiner neuen Familie. Diese Waffe setzt er hemmungslos gegen sie ein, so wie seine biologischen Eltern es bei ihm gemacht haben. Und das nur, weil er wissen will, wie es ist, selbst der Peiniger zu sein.«
»Das Opfer, das zum Henker wird«, nickte Gerber, der noch immer kerzengerade vor ihrem Schreibtisch stand.
»Ja, genau!«, rief die Richterin und stach mit dem Zeigefinger in die Luft vor seinem Gesicht. Sie musste offensichtlich Dampf ablassen.
Anita Baldi war die erste Richterin, mit der Gerber als blutiger Anfänger zusammengearbeitet hatte, weshalb sie sich diesen informellen Ton ihm gegenüber erlauben konnte. Der Psychologe hatte jedoch nie gewagt, es ihr gleichzutun. Mit den Jahren hatte er ihr Wissen und ihre Wutanfälle zu schätzen gelernt; wahrscheinlich war sie der gerechteste und empathischste Mensch, dem er in seinem beruflichen Umfeld jemals begegnet war. Sie stand kurz vor der Pensionierung, hatte nie geheiratet und ihr ganzes Leben den Kindern gewidmet, die sie selbst nie bekommen hatte. An den Wänden ihres Büros hingen Bilder von den kleinen Opfern, die diesen finsteren Ort hatten aufsuchen müssen, und in dem Wust an juristischen Unterlagen auf ihrem Schreibtisch lagen bunte Bonbons verstreut.
Mitten in dem Papierhaufen befand sich auch Emilians Akte. Gerber starrte auf die rote Mappe. Für das Geisterkind hatte es nicht ausgereicht, das Land, die Stadt und den Namen zu wechseln, um ein neues Leben zu bekommen. Diesmal irrte sich Anita Baldi.
»Die Sache ist leider nicht so einfach«, sagte er. »Ich fürchte, da liegt noch mehr im Argen.«
Die Richterin beugte sich vor.
»Wie kommst du darauf?«
»Haben Sie den Blick des Jungen gesehen, als er in Richtung Spiegel geschaut hat?«
Noch bevor er den Satz zu Ende gesprochen hatte, war ihm klar, dass Anita Baldi keinen Schimmer hatte, worauf er hinauswollte.
»Ja, habe ich. Und?«
»Obwohl er sich in Trance befand, wusste Emilian genau, dass er von der anderen Seite des Spiegels aus beobachtet wurde.«
»Willst du damit sagen, er hat den Trick durchschaut?«, fragte sie erstaunt. »Dann ist es also noch wahrscheinlicher, dass er nur Theater gespielt hat«, schloss sie zufrieden.
Gerber war überzeugt, eine Erklärung für das Verhalten des Jungen zu haben.
»Emilian wollte, dass wir dort sind, und er wollte auch, dass seine neue Familie dort ist.«
»Warum?«
»Den Grund kenne ich noch nicht, aber ich werde es herausfinden.«
Die Richterin dachte über seine Worte nach.
»Wenn Emilian gelogen haben sollte, dann mit einer ganz bestimmten Absicht. Und genauso, wenn er die Wahrheit gesagt hat«, erklärte sie schließlich. Nun hatte auch sie begriffen, worauf der Psychologe anspielte.
»Vertrauen wir ihm und warten wir ab, wohin er uns mit seiner Geschichte führen will«, bekräftigte Gerber. »Es kann gut sein, dass nichts dabei herauskommt und er sich selbst widerlegt. Oder aber das Ganze läuft auf etwas hinaus, das wir im Moment nicht mal erahnen können.«
Sie würden nicht lange warten müssen. Bei Verfahren mit Minderjährigen mahlten die Mühlen der Justiz deutlich schneller als sonst; die nächste Anhörung war bereits für die darauffolgende Woche anberaumt.
Ein Donnerschlag erschütterte den Renaissancepalast. Über der Stadt braute sich ein Gewitter zusammen, und sogar vom dritten Stock aus konnten sie die Stimmen der aufgescheuchten Touristen auf der Via della Scala hören, die Schutz vor dem Unwetter suchten.
Pietro Gerber wusste, er würde sofort loslaufen müssen, wenn er nicht vollkommen durchnässt in seiner Praxis ankommen wollte, obwohl diese nur ein paar Querstraßen entfernt lag.
»Wenn es weiter nichts gibt …«, sagte er nur und wandte sich zur Tür, in der Hoffnung, dass die Richterin ihn gehen ließ.
»Wie geht es eigentlich deiner Frau und deinem Sohn?«, wechselte Anita Baldi unbeeindruckt das Thema. »Alles gut bei euch?«
»Ja, danke, alles gut«, erwiderte er hastig.
»Sieh zu, dass das Mädchen dir erhalten bleibt … Wie alt ist Marco jetzt?«
»Zwei.« Er schaute zum Fenster hinaus.
»Die Kinder vertrauen dir, das sehe ich«, nahm die Richterin den Gesprächsfaden wieder auf. »Du bringst sie nicht nur dazu, sich zu öffnen, sondern auch, sich in Sicherheit zu fühlen.« Sie machte eine bedeutungsschwangere Pause.
Warum müssen die Leute immer diese bedeutungsschwangeren Pausen machen, fragte sich Gerber. Jenes kurze Verharren war das Vorspiel zu einem Satz, den er nur allzu gut kannte.
»Er wäre stolz auf dich gewesen«, sagte die Richterin prompt.
Bei dem Gedanken an Herrn B. versteifte sich Pietro Gerber innerlich.
Zu seiner Erleichterung begann in dem Moment das Handy in seiner Tasche zu klingeln. Er holte es hervor und schaute aufs Display.
Schon wieder dieser unbekannte Anrufer, der ihn bereits während der Anhörung versucht hatte zu erreichen.
Wahrscheinlich ein Elternteil oder jemand vom Jugendamt, der sich nach seinem Schützling erkundigen will, dachte er. Doch dann bemerkte er die internationale Vorwahl. Vielleicht einer dieser lästigen Callcenter-Mitarbeiter, die ihm alle naselang »ein unwiderstehliches Angebot« unterbreiten wollten? Wer auch immer es war: Der Anruf lieferte ihm den perfekten Vorwand, sich zu verabschieden.
»Wenn Sie nichts dagegen haben …«, sagte er und wedelte vielsagend mit dem Handy.
»Natürlich, geh nur«, entließ Anita Baldi ihn endlich mit einem Winken. »Grüß mir deine Frau und gib Marco einen Kuss von mir.«
In der Hoffnung, es noch vor dem Wolkenbruch zurück in die Praxis zu schaffen, stürmte Gerber die Treppen des Jugendgerichts hinunter.
»Entschuldigung, was haben Sie gesagt?«, fragte er noch im Laufen den unbekannten Anrufer.
Störgeräusche, Unterbrechungen – die Verbindung war alles andere als stabil. Bestimmt lag es daran, dass die Mauern des historischen Gebäudes so dick waren.
»Warten Sie, ich kann Sie nicht hören«, rief er in das Mikrofon seines Handys hinein.
Kaum stand er auf der Straße, entlud sich das Gewitter. Zahlreiche Passanten, die Schutz vor dem sintflutartigen Regen suchten, drängten sich neben ihn unter das Vordach des Palazzos. Den Kragen seines alten Burberry hochgeschlagen, die Hand am Ohr, bemühte er sich zu verstehen, was die weibliche Stimme von ihm wollte.
»Ich habe gesagt, mein Name ist Theresa Walker, wir sind Kollegen«, wiederholte die Frau. Sie sprach Englisch, aber mit einem Akzent, den der Psychologe noch nie gehört hatte. »Ich rufe Sie aus Adelaide in Australien an.«
Erstaunt registrierte Gerber, dass der Anruf buchstäblich vom anderen Ende der Welt kam.
»Was kann ich für Sie tun, Dr. Walker?«, sagte er und eilte mit großen Schritten los.
»Ich habe Ihre Telefonnummer auf der Webseite der WHO gefunden«, erklärte die Frau. »Ich möchte Ihnen einen Fall übergeben.«
»Wenn Sie noch einen Augenblick warten können: In fünf Minuten bin ich zurück in meiner Praxis, von dort aus kann ich besser telefonieren«, entgegnete er, während er über Pfützen springend in eine enge Gasse bog.
»Ich kann nicht warten«, sagte die Frau leicht alarmiert. »Sie kann jeden Moment kommen.«
»Wer kann jeden Moment kommen?«, fragte der Psychologe. Eine dunkle Vorahnung beschlich ihn.
Und als hätte der Himmel seine Schleusen geöffnet, prasselte das Wasser auf die Stadt nieder.
3
Ein Schauer, der sich den Rücken hinunterschlängelt.
Gerber fand kein anderes Bild, um das ungute Gefühl zu beschreiben, das ihn ergriffen hatte. Vielleicht war das der Grund, weshalb er plötzlich unter einem der vielen Torbögen Schutz suchte.
Er brauchte Klarheit.
»Was wissen Sie über SA?«, fuhr Dr. Walker fort.
SA, oder auch: Selektive Amnesie.
Gerber war verblüfft. Das Thema wurde unter seinen Kollegen kontrovers diskutiert; es gab keine einhellige Meinung. Manche Psychologen hielten die Selektive Amnesie für eine schwierig zu diagnostizierende psychische Störung, andere verneinten entschieden ihre Existenz.
»Nicht viel«, erwiderte er wahrheitsgemäß.
»Aber wie sehen Sie das Ganze?«
»Eher kritisch«, gab er zu. »Meine Berufserfahrung hat mich gelehrt, dass es unmöglich ist, einzelne Erinnerungsfetzen zu isolieren.«
Für die Verfechter dieser streitbaren These handelte es sich um eine Form der Selbstverteidigung, derer sich die menschliche Psyche unbewusst bediente. Das Phänomen kam vor allem in der Kindheit vor, etwa bei Adoptivkindern, die vollkommen vergaßen, dass sie nicht bei ihren leiblichen Eltern aufwuchsen. Oder bei Kindern, die schwere Traumata oder Missbrauch erlitten hatten und sich an diese Erfahrungen nicht mehr erinnern konnten. Einmal hatte auch Gerber einen solchen Fall gehabt: ein Junge, der beobachtet hatte, wie der Vater erst die Mutter und dann sich selbst umbrachte. Jahre später war der Psychologe ihm wiederbegegnet. Er besuchte inzwischen das Gymnasium und war fest davon überzeugt, dass seine beiden Eltern eines natürlichen Todes gestorben waren.
Dennoch hatte diese Erfahrung nicht genügt, um Gerber von seiner Position abzubringen.
»Ich habe auch erst nicht daran geglaubt«, sagte Dr. Walker unvermutet. »Dieser vermeintliche Gedächtnisverlust hat keinerlei organische Ursachen, wie etwa eine Hirnverletzung. Und nicht einmal ein Schock kann als Erklärung dienen, denn wenn der Gedächtnisverlust auftritt, liegt das traumatische Ereignis in der Regel schon lange zurück.«
»Ich würde sagen, er ist in erster Linie Ergebnis einer bewussten Entscheidung«, pflichtete Gerber ihr bei. »Deswegen sollte man auch nicht von Amnesie sprechen.«
»Die Frage ist, ob man wirklich beeinflussen kann, dass man etwas vergisst«, gab die Frau zu bedenken. »Das hieße ja, die Psyche würde zur Überwindung eines Traumas eigenmächtig beschließen, es zu negieren. Sie würde diese schwere Belastung also nur vor uns verbergen, damit uns ein Weiterleben möglich ist.«
Die meisten Menschen wären heilfroh, wenn sie ihre schlimmen Erfahrungen vergessen könnten, dachte Gerber. Auch für die Pharmaindustrie blieb es ein ewiger Wunschtraum, eine Pille zu erfinden, die alles Schlechte vergessen machte. Doch der Hypnotiseur wusste genauso gut, dass erst solche Erlebnisse – selbst die allergrausamsten – den Menschen zu demjenigen machten, der er war. Sie gehörten zu ihm, auch wenn er alles daransetzte, sie zu verdrängen.
»Ich habe von SA-Patienten gehört, bei denen die Kindheitserinnerungen im Erwachsenenalter plötzlich wieder hochgekommen sein sollen – und zwar ohne jede Vorwarnung«, warf der Psychologe ein. »Die Folgen waren angeblich absolut unvorhersehbar, um nicht zu sagen – verheerend.«
Der letzte Satz schien einen wunden Punkt bei Dr. Walker berührt zu haben, da sie nichts erwiderte.
»Aber warum fragen Sie mich das alles?«, fragte Pietro Gerber, der nun auch in seinem Unterstand keinen Schutz mehr vor den herabfallenden Wassermassen fand. »Was ist das für ein seltsamer Fall, den Sie mir übergeben wollen?«
»Vor ein paar Tagen kam eine Frau namens Hanna Hall in meine Praxis. Sie wollte eine Hypnotherapie bei mir machen, um Ordnung in ihre turbulente Vergangenheit zu bringen. Während der ersten Sitzung ist jedoch etwas Merkwürdiges passiert.«
Dr. Walker machte eine längere Pause. Gerber nahm an, dass sie nach den richtigen Worten suchte, um die Situation angemessen zu beschreiben.
»In all den Jahren meiner Berufspraxis habe ich so etwas noch nie erlebt«, fuhr die Psychologin fort. »Die Sitzung hatte sehr vielversprechend begonnen, die Patientin sprach auf die Therapie an und arbeitete gut mit. Auf einmal jedoch fing Hanna an zu schreien …« Sie hielt inne, als könnte sie nicht weitersprechen. »Die Erinnerung an einen Mord während ihrer Kindheit war in ihr Bewusstsein zurückgekehrt«, erklärte sie schließlich.
»Ich verstehe nicht … Warum haben Sie ihr nicht geraten, zur Polizei zu gehen?«, entgegnete Gerber.
»Hanna Hall hat nicht präzisiert, wie sich das Verbrechen zugetragen hat«, erwiderte die Kollegin. »Doch ich bin sicher, an der Geschichte ist etwas Wahres dran.«
»Okay – aber warum erzählen Sie mir das?«
»Weil das Mordopfer in Italien begraben liegt, an einem unbekannten Ort in der Toskana. Und niemand hat etwas davon gewusst.« Wieder machte Theresa Walker eine Pause, bevor sie weitersprach. »Hanna Hall behauptet, sich nicht mehr an das Vorgefallene erinnern zu können, und deshalb will sie nach Italien fahren. Sie möchte rekonstruieren, was damals passiert ist.«
Diese Hanna Hall würde nach Florenz kommen. Auch wenn er die Frau nicht kannte, versetzte ihn die Nachricht in Alarmbereitschaft.
»Entschuldigen Sie, aber wir sprechen von einer Erwachsenen, nicht wahr?«, sagte er schnell. »Ich fürchte, da liegt ein Missverständnis vor: Ich bin Kinderpsychologe. Sie müssen sich jemand anderen suchen.«
Er hatte nicht die Absicht, die Kollegin zu brüskieren, doch ohne zu wissen, warum, behagte ihm die Angelegenheit ganz und gar nicht.
»Die Frau braucht Hilfe. Und ich kann von hier aus nichts für sie tun«, wischte Theresa Walker seinen Einwand beiseite. »Wir können nicht einfach ignorieren, was sie gesagt hat.«
»Wir?« Gerber war verärgert. Warum sollte er sich für den Fall verantwortlich fühlen?
»Sie wissen besser als ich, dass es nicht gut ist, eine Hypnotherapie abzubrechen«, insistierte Dr. Walker. »So etwas kann schwere psychische Belastungen nach sich ziehen.«
Nicht nur das, wusste Gerber. Damit verstieß der behandelnde Psychologe eindeutig gegen die Berufsethik.
»Meine Patienten sind höchstens zwölf Jahre alt«, versuchte er noch einmal, sich herauszureden.
»Hanna Hall behauptet, der Mord sei vor ihrem zehnten Lebensjahr passiert.« Seine Gesprächspartnerin ließ nicht locker.
»Könnte es sich vielleicht um eine krankhafte Lügnerin handeln – haben Sie das schon mal in Erwägung gezogen?«, probierte Gerber eine andere Taktik. »Ich würde wirklich empfehlen, einen Psychiater zu konsultieren.«
»Sie sagt, das Mordopfer sei ein Junge namens Ado …«
Der Satz blieb in der regenschweren Luft hängen. Pietro Gerber spürte, wie ihn die Widerstandskraft verließ.
»Vielleicht ein armes, unschuldiges Kind, das weiß der Himmel wo begraben ist und es verdient hätte, dass endlich die Wahrheit ans Licht kommt«, fuhr die Kollegin mit ruhiger Stimme fort.
»Na gut … Was soll ich tun?«, seufzte der Psychologe.
»Hanna Hall hat niemanden mehr auf der Welt. Sie besitzt nicht mal ein Handy, stellen Sie sich das vor! Trotzdem hat sie versprochen, sich gleich nach ihrer Ankunft in Florenz bei mir zu melden. Ich werde sie dann sofort an Sie verweisen.«
»Ja, aber was soll ich tun?«, wiederholte Gerber.
»Ihr zuhören«, erwiderte Dr. Walker schlicht. »Im Körper dieser Frau steckt ein Kind, das sich aussprechen möchte. Jemand muss mit ihm in Verbindung treten und ihm zuhören.«
Die Kinder vertrauen dir, das sehe ich.
Genau das hatte Anita Baldi vor weniger als einer Stunde gesagt.
Du bringst sie nicht nur dazu, sich zu öffnen, sondern auch, sich in Sicherheit zu fühlen.
Herr B. hätte nicht gekniffen.
»Dr. Walker, sind Sie sicher, dass sich der ganze Aufwand nach so vielen Jahren überhaupt lohnt? Auch wenn wir mithilfe der Hypnose erreichen sollten, dass die Frau sich daran erinnert, was damals mit diesem Ado passiert ist, wird ihre Erinnerung nicht authentisch sein. Zu viele Jahre sind seitdem vergangen, zu viele andere Erfahrungen haben sich darübergelegt. Ein ganzes Leben steht dazwischen.«
»Hanna Hall sagt, dass sie weiß, wer den Jungen umgebracht hat.«
Gerber erstarrte. Erneut überkam ihn der unangenehme Schauer, den er bereits zu Beginn ihres Telefonats verspürt hatte.
»Und wer soll das gewesen sein?«, hörte er sich fragen.
»Sie selbst.«