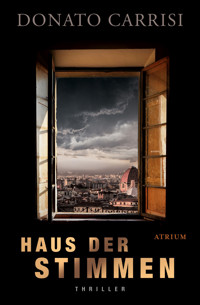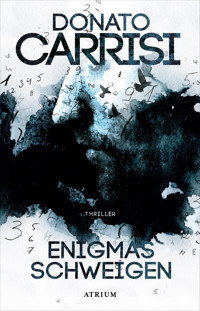
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atrium Verlag AG Zürich
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Auf einem einsamen Bauernhof weist alles auf einen brutalen Mord an einer ganzen Familie hin – nur von den Leichen fehlt jede Spur. Als ein Verdächtiger festgenommen wird, scheint die Lösung nah. Der am ganzen Körper tätowierte Mann aber, den die Medien ›Enigma‹ nennen, schweigt hartnäckig und gibt den Ermittlern Rätsel auf. Ihre einzige Hoffnung liegt auf der ehemaligen Polizistin Mila Vasquez. Auf Drängen ihrer früheren Vorgesetzten übernimmt sie die Ermittlungen und findet bald heraus, dass Enigmas Tätowierungen Koordinaten in einem ominösen Videospiel darstellen. Auf der Suche nach Anhaltspunkten für den Mord vertieft sich Mila immer weiter in die so geheimnisvolle wie gefährliche virtuelle Schattenwelt ihres Gegenspielers …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 433
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Donato Carrisi
Enigmas Schweigen
Thriller
Aus dem Italienischen von Susanne Van Volxem und Olaf Matthias Roth
© Atrium Verlag AG, Zürich, 2020
Alle Rechte vorbehalten
Die Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel Il Gioco del Suggeritore bei Longanesi & C., Mailand.
© Donato Carrisi 2018
Aus dem Italienischen von Susanne Van Volxem und Olaf Matthias Roth
Covergestaltung und Motiv: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
ISBN978-3-03792-156-2
www.atrium-verlag.com
www.facebook.com/atriumverlag
www.instagram.com/atriumverlag
Für Antonio,
meinen Sohn und mein weiteres Leben
Für Luigi Bernabò,
meinen Freund
Ein heftiges Unwetter war aufgezogen, als der Anruf in der Notrufzentrale der Polizei einging. Eine Frau rief von einem Handy aus an und verlangte panisch nach einem Streifenwagen, der zu einem abseits gelegenen Bauernhof etwa fünfzehn Kilometer außerhalb der Stadt kommen sollte.
Mechanisch notierte der diensthabende Polizist Datum und Uhrzeit: dreiundzwanzigster Februar, neunzehn Uhr siebenundvierzig. Auf seine Frage nach dem Grund ihres Anrufs erwiderte die Frau, ein Fremder sei in den Hof eingedrungen. Er befinde sich draußen im Dunkeln, im Regen. Ihr Mann sei vor die Tür gegangen, um ihn zu verjagen, aber der Unbekannte habe darauf nicht reagiert. Er sei immer noch da und starre stumm herüber.
Die Frau konnte den Eindringling nicht näher beschreiben. Wegen des strömenden Regens, der die Sicht erschwerte, und dem Flackern der Blitze war er kaum zu erkennen. Er sei in einem alten grünen Kombi gekommen, fügte sie hinzu. Und ihre beiden Töchter hätten große Angst.
Der Polizist nahm die Adresse auf und versicherte der Frau, er würde jemanden vorbeischicken, bat sie aber, Geduld zu haben, da es wegen des Unwetters zahlreiche Unfälle und Überschwemmungen gegeben hatte.
Erst um fünf Uhr morgens stand ein Streifenwagen zur Verfügung, gut neun Stunden nach dem Anruf. Die Polizisten brauchten unverhältnismäßig lange für die Strecke zum Bauernhof, da in der Nacht ein Fluss über die Ufer getreten war und die Fahrbahn an mehreren Stellen unter Wasser gesetzt hatte.
Als die beiden Beamten kurz nach Sonnenaufgang ihr Ziel erreicht hatten, bot sich ihnen ein friedlicher Anblick. Ein weiß getünchtes Holzhaus im Kolonialstil, daneben ein Silo zur Lagerung von Äpfeln. Ein riesiger Bergahorn, der seinen Schatten auf den Vorplatz warf. Eine Hollywoodschaukel unterhalb der Veranda und zwei nahezu identische rosafarbene Fahrräder, die an einem Geräteschuppen lehnten. An dem roten Briefkasten war ein Namensschild mit der Aufschrift »Familie Anderson« angebracht.
Nichts, was an ein Unheil denken ließ. Höchstens die Stille, die nur vom Kläffen des an seine Hütte geketteten Mischlingshundes unterbrochen wurde.
Die Polizisten riefen laut nach den Bewohnern des Bauernhofs, ohne eine Antwort zu erhalten. Da offenbar niemand zu Hause war, schienen sie nicht mehr gebraucht zu werden. Bevor sie wieder fuhren, ging einer der beiden Beamten zur Vergewisserung die Eingangsstufen hoch und klopfte an die Tür. Er stellte fest, dass sie nur angelehnt war. Als er einen Blick durch den Türspalt warf, bemerkte er das Chaos.
Per Funk ließen sich die Polizisten von der Zentrale einen Durchsuchungsbefehl geben. Erst dann traten sie ein.
Die Tische und Stühle im Erdgeschoss waren umgekippt, der Fußboden übersät von den Splittern des zu Bruch gegangenen Inventars. Überall lagen Glasscherben. Doch es kam noch schlimmer.
Die erste Etage glich einem Meer aus Blut.
Sämtliche Kissen und Decken waren von der mittlerweile geronnenen Flüssigkeit durchtränkt. Blutspritzer überzogen die Alltagsgegenstände, hier einen Hausschuh, dort eine Haarbürste, die Gesichter der Puppen in den Kinderzimmern. Am Boden waren lang gezogene Blutspuren zu sehen, an den Wänden rote Handabdrücke – Hinweise auf verzweifelte Fluchtversuche. Das reinste Massaker.
Am verstörendsten aber war für die Polizisten, was sie nicht vorfanden.
Es gab keine Leichen.
Von den Bewohnern des Hauses, den vier Familienmitgliedern – Vater, Mutter und zwei achtjährigen Zwillingsmädchen –, waren nur die Fotos geblieben, gerahmte Porträts auf Kommoden, Regalen oder an der Wand. Die Andersons mit ihren lächelnden Gesichtern waren zu Zeugen ihres eigenen Gemetzels geworden.
Gegen acht Uhr morgens wimmelte es auf dem idyllischen Fleckchen Land nur so von Polizisten. Während die Ermittlungsteams, unterstützt von ihren Spürhunden, das Gelände auf der Suche nach menschlichen Überresten durchkämmten und jeden noch so versteckten Winkel, jede noch so unscheinbare Bodensenke unter die Lupe nahmen, widmete sich die Spurensicherung dem Schlachtfeld im Inneren des Bauernhauses und versuchte, die Ereignisse zu rekonstruieren.
Mehrere Zielfahndungskommandos waren im Einsatz. Die Jagd galt der verdächtigen Person, von der Ms. Anderson bei ihrem Notruf gesprochen hatte. Von der sie nur das Geschlecht gewusst und weder das Erscheinungsbild noch irgendein Detail hatte beschreiben können, das die Identifizierung erleichtert hätte. Der einzige brauchbare Hinweis war der grüne Kombi, den die Frau erwähnt hatte. Aber ohne die Marke und das Nummernschild war auch diese Spur praktisch nutzlos.
Noch am Vormittag ging eine dürre Pressemeldung zu der Tat und den laufenden Ermittlungen an die Medien. Doch sie reichte aus, um die Gemüter zu erhitzen. Bereits um die Mittagszeit waren die Andersons nicht mehr nur irgendeine Familie, sondern die Opfer einer Tragödie, die Millionen von Menschen im ganzen Land in Atem hielt.
Das Geheimnis der vermissten Familie.
Zugespitzt wurde das Drama durch die Tatsache, dass die Familie aufs Land gezogen war, wo sie fernab jeder Zivilisation gelebt hatte. Ohne Strom und Internet. Nicht einmal einen Telefonanschluss hatte es in dem Haus gegeben. Die einzige Ausnahme war ein Handy, das für Notfälle angeschafft und nur dieses eine Mal benutzt worden war, um Hilfe zu holen.
Die wenigen makabren Details, die an die Öffentlichkeit durchgesickert waren, genügten, um Panik zu verbreiten. Die Angst ging um, dass sich das Vorgefallene wiederholen könnte, auf welche Weise auch immer. Jeder sehnte ein rasches Ende der Ermittlungen herbei, das – natürlich – in der Verhaftung des Mörders gipfeln sollte. Doch die Polizei hatte nichts vorzuweisen, was über die bereits bekannten Fakten hinausging. Trotz des erheblichen personellen und technischen Aufwands kamen die Ermittler lediglich zu dem Schluss, dass der Mörder die Leichen mit dem Kombi weggeschafft haben musste – um Gott weiß was mit ihnen anzustellen.
Zu wenig, um auf ein rasches Ende zu hoffen.
Obwohl die Ermittler davon ausgingen, dass der Täter den Fluchtwagen bereits abgestoßen hatte, kontrollierten sie die Videos der Verkehrssicherheit, die unmittelbar vor und nach dem Anruf von Ms. Anderson aufgenommen worden waren. Sie vertrauten darauf, dass der Wagen wegen seines älteren Baujahrs nicht zu übersehen war. Zudem wurde eine Hotline eingerichtet, bei der sich Zeugen melden konnten, die einen alten grünen Kombi bemerkt hatten. Wie zu erwarten, gingen unzählige Anrufe bei der Polizei ein, von denen keiner hilfreich war.
Bis auf einen.
Am späten Nachmittag meldete ein anonymer Anrufer einen VW-Passat, Baujahr 1997, auf dem Gelände eines ehemaligen Schlachthofs, der in einer unbenutzten Lagerhalle stand. Als die Fahnder den Wagen mit ihren Spürhunden näher untersuchten, konnten sie die blutgetränkten Sitze bereits durch die Fensterscheiben erkennen.
Gefasst auf einen grauenvollen Fund, hebelten sie den Kofferraum auf. Fündig wurden sie auch hier nicht, doch noch während die Männer die Fundstelle für die Spurensicherung absperrten, brachen die Hunde plötzlich in Gebell aus. Sie witterten etwas in der Schlachterei.
In weniger als dreißig Minuten war der ganze Block gesichert. Kurz darauf drangen schwer bewaffnete Spezialkräfte in den Gebäudekomplex ein. Die Trupps verteilten sich über das Grundstück und durchsuchten jeden Winkel, jedes mögliche Versteck. Das Echo von Stiefelknallen, Hundegebell und Kommandoschreien erfüllte das verlassene Gelände. Bis einer der Einsatzbeamten über Funk »etwas im dritten Stock« meldete. Sofort stürmten die Trupps an den genannten Ort.
In einem dunklen Zimmer, umgeben von alten Computern und anderem Elektroschrott, entdeckten sie einen Mann. Reglos stand er vor einer Wand aus schwarzen Monitoren. Nackt, die Hände erhoben. Langsam drehte er sich zu den Polizisten um, die mit Maschinenpistolen auf ihn zielten und ihn mit ihren grellen Taschenlampen blendeten.
Abgesehen von dem ungewöhnlichen Versteck versetzten zwei weitere Besonderheiten an dem Mann die Beamten in Erstaunen. Sein undefinierbares Alter. Und die über seinen ganzen Körper, inklusive Gesicht und Schädel, verteilten Tätowierungen.
Zahlen über Zahlen.
Der Mann leistete keinen Widerstand. Schweigend ließ er sich die Handschellen anlegen. Neben ihm lag eine Sichel, blutbefleckt. Höchstwahrscheinlich die Tatwaffe.
Die Gefangennahme des mutmaßlichen Täters war keine achtundvierzig Stunden nach Eingang des Notrufs von Ms. Anderson erfolgt. Nach ihrer anfänglichen Ratlosigkeit hatte die Polizei den Fall zu einer unerwartet raschen Lösung geführt, wenn auch nur dank eines anonymen Hinweises. Vor einem Wald aus Mikrofonen dankte der Polizeichef offiziell dem unbekannten Tippgeber für seinen Dienst an der Gerechtigkeit und verkündete, dass das Böse ein weiteres Mal besiegt worden sei. Trotz der fehlenden Leichname der Andersons sei ihr schrecklicher Tod inzwischen traurige Gewissheit und durch die Festnahme des Tätowierten Sicherheit und Ordnung wiederhergestellt, die Bevölkerung könne aufatmen. Die Ermittlungen seien abgeschlossen und der Zeitpunkt gekommen, in Würde der Opfer zu gedenken und, wo auch immer sich ihre sterblichen Überreste befänden, für ihre Seelen zu beten.
Niemand ahnte, dass die Zeit der Angst tatsächlich gerade erst begonnen hatte.
ENIGMA
1
Der Brief kam im Februar, wie jedes Jahr.
Der Inhalt war immer der gleiche: Man informierte sie, dass das Krankheitsbild unverändert und die weitere Entwicklung nicht absehbar sei. Das Schreiben endete stets mit den Worten: »Die Gesundheitsschäden des Patienten sind irreversibel.«
Der Satz beinhaltete die unausgesprochene Aufforderung, eine Entscheidung zu treffen, ob die künstliche Beatmung und Ernährung ein weiteres Jahr fortgesetzt oder dem vegetativen Zustand des Patienten nicht besser ein für alle Male ein Ende bereitet werden sollte.
Mila legte den Brief in eine Schublade und schaute aus dem Küchenfenster. Der See spiegelte die Abendsonne in seltsamen Grauabstufungen, und auf der Wiese nahe der Brücke jagte Alice dem vom Wind aufgewirbelten Laub hinterher. Die beiden Linden neben dem Haus hatten wegen des harten Winters schon vor längerer Zeit ihre Blätter verloren. Woher wohl das Laub kam, fragte sie sich. Eigentlich konnte es nur vom Wald am anderen Ufer herübergeweht worden sein.
Alice trug einen dicken Pullover und einen Schal, der wie ihre Haare im Wind flatterte. Es war so kalt, dass ihr Atem in kleinen Wolken aufstieg, trotzdem wirkte sie zufrieden. Mila hingegen war froh, zu Hause im Warmen zu sein. Sie war dabei, einen Gemüseauflauf für das Abendessen vorzubereiten, und im Ofen befand sich bereits ein Apfelkuchen, der die Küche mit seinem aromatischen Duft nach Zimt erfüllte. In den letzten Monaten hatte sie eine erstaunliche Entdeckung gemacht. Sie, die Essen immer nur als lästiges Übel betrachtet hatte, um dem Körper die erforderlichen Nährstoffe zu liefern, hatte inzwischen begonnen, ihre Mahlzeiten regelrecht zu genießen. Und Alice war darüber sicher noch erstaunter als sie, denn Kochen war etwas, was andere Mütter taten, aber nicht ihre.
Im letzten Jahr hatte sich viel getan. Nicht nur die neuen Gewohnheiten hatten ihren Alltag verändert, ihr ganzes Leben war ein anderes.
Bei ihrer letzten Ermittlung hatte sich Mila großen Gefahren ausgesetzt. Die Vorstellung, bei einem Einsatz ums Leben zu kommen, hatte sie bis dahin nie eingeschränkt. Für sie war es stets ein Risiko gewesen, das jeder normale Polizist auf sich nahm. Aber nach jener existenziellen Erfahrung war sie ins Nachdenken gekommen. Zum ersten Mal war sie gezwungen gewesen, sich mit einer ganz simplen Frage zu befassen: Was würde aus Alice werden, wenn sie tot wäre?
Es war schon schwierig genug für ihre Tochter, ohne Vater aufzuwachsen. Aber ganz allein?
Also hatte sie beschlossen, ihre Uniform an den Nagel zu hängen. Inzwischen schien es Jahrhunderte her, dass Mila Vasquez sich mit Leib und Seele der Fahndung nach vermissten Personen gewidmet hatte.
Sie hatte sich nie für eine gewöhnliche Polizeibeamtin gehalten. Schon ihre Persönlichkeit war alles andere als gewöhnlich. Sonst hätte sie sich wohl kaum dafür entschieden, den Schatten hinterherzujagen.
Im Alter von etwa sechzehn Jahren hatte Mila bemerkt, dass sie sich von anderen Menschen unterschied: Sie konnte keine Gefühle empfinden. Lange Zeit hatte sie sich für diese Eigenschaft geschämt, die sie nicht zuletzt daran hinderte, Beziehungen einzugehen, und sie in den Augen der anderen oft als seltsam erscheinen ließ. Als sie mit Mitte zwanzig endlich den Mut fand, sich einer Psychologin anzuvertrauen, hatte diese dem Phänomen sogleich einen Namen gegeben: Alexithymie. Eine Art emotionaler Analphabetismus. Tatsächlich war Mila unfähig, andere Menschen zu lieben. Sie konnte nicht mal ihre Gefühle deuten oder beschreiben. Im Grunde war es so, als hätte sie keine.
Irgendjemand hatte es »Seelenkälte« genannt. Allmählich hatte sie begriffen, was die Ursache für diesen düsteren Wesenszug war. Sie hatte verstanden, dass sie selbst eine Art Tor, ein geheimer Zugang zu etwas Dunklem, Unheilvollem war. Und nun, da die Schleuse einmal geöffnet war, konnte sie nicht mehr geschlossen werden.
Aus dem Dunkel komme ich. Und ins Dunkel kehre ich zurück …
Als Polizistin hatte sie in ihrer Behinderung eine willkommene Verbündete gesehen, die ihr ermöglichte, ihre Fälle mit der nötigen Distanz zu betrachten. Besonders hilfreich war sie ihr bei der Suche nach vermissten Kindern, bei der jede Form von emotionaler Betroffenheit die Objektivität des Fahnders einschränkte. Oft genug neigten die Kollegen dazu, einen Fall aufzugeben, um die schreckliche Wahrheit nicht erfahren zu müssen, die fast immer am Ende einer Ermittlung stand.
Mila wusste: Ein vermisstes Kind zu suchen, war wie einem farblosen Regenbogen zu folgen. Am Ende wartete kein Goldschatz, sondern ein stummes Monster, das sich in Blut und Unschuld gesuhlt hatte.
Die Alexithymie war Fluch und Segen zugleich. Das Fehlen jeglicher Empathie bewirkte eine gefährliche Nähe zu den Monstern, die sich an den Qualen ihrer Opfer labten, ohne einen Funken Mitleid zu empfinden. Um sich von ihnen abzugrenzen, hatte Mila sich häufig insgeheim mit einer Rasierklinge beholfen, mit kleinen Akten der Selbstzerstörung, die sie tief in ihrem Inneren den Schmerz der anderen spüren ließen. Letztlich waren die Narben auf ihrem Körper so etwas wie der Beweis dafür, dass sie sich mit den von ihr gesuchten Vermissten identifizierte. Das körperliche Leiden ersetzte das seelische und bewirkte, dass sie sich wegen ihrer Indifferenz weniger schuldig fühlte.
Das einzige Mal, dass sie etwas gespürt hatte – etwas Menschliches –, war während der Schwangerschaft gewesen. Eine beglückende Erfahrung, die zu ihrer beider Nachteil mit der Geburt geendet hatte. Danach war es Mila nie mehr gelungen, ihre Rolle als Mutter auszufüllen, weder im guten noch im schlechten Sinne. Es entsprach einfach nicht ihrem Naturell. Ihre Fürsorge für Alice glich der für eine Pflanze. Und doch kümmerte sie sich um ihre Tochter auf die für ihre Verhältnisse bestmögliche Art.
All das gehörte jedoch der Vergangenheit an. Vor ungefähr einem Jahr hatte Mila beschlossen, dass es Zeit war, diesem emotionalen Stillstand etwas entgegenzusetzen. Sie hatte das Haus am See gemietet und war mit Alice vor der Welt geflüchtet.
Es war nicht einfach gewesen. Sie mussten sich erst aneinander gewöhnen. Aber mit der Zeit stellten sie fest, dass sie sich nicht vollkommen fremd waren. Auch wenn Mila oft mit der Versuchung zu kämpfen hatte, sich im Bad einzusperren, eine Rasierklinge aus der Schachtel im Spiegelschrank zu holen und sich an einer bereits geschundenen Stelle ihres Körpers zu ritzen. Um mit dem Blut einen Schmerz aus sich herauszupressen, der sie daran erinnerte, dass sie ein Mensch war. Denn manchmal zweifelte sie daran.
Während Mila an diesem ungemütlichen Tag Ende Februar ihrer Tochter beim Spielen zusah, fragte sie sich unwillkürlich, wie viel von ihr wohl in Alice steckte. Ihre Tochter war zehn Jahre alt. Nicht mehr lange, und die Hormone würden ihr Leben durcheinanderwirbeln. Die unschuldigen Kinderspiele würden gnadenlos beiseitegeschoben. Und auch Alice würde, wie alle anderen, von einem Tag auf den anderen vergessen, was es bedeutete, Kind zu sein. Zugleich aber würde sie sich für immer nach dieser Zeit sehnen.
Die Sorge ihrer Mutter war freilich eine ganz andere. Mila befürchtete, dass mit Alices Pubertät, genau wie bei ihr, die »Seelenkälte« aufkommen könnte. Es gab keine wissenschaftlichen Erkenntnisse darüber, ob Alexithymie erblich war, aber die Statistiken ließen darauf schließen. Die Alternative war, dass Alice genetisch nach ihrem Vater kam, aber auch das konnte Mila nicht akzeptieren.
Nicht nach diesem Mann. Nicht nach ihm, sagte sie sich und dachte an den Brief aus dem Krankenhaus. Nie sprach sie seinen Namen aus. Er verdiente es nicht, auch nur gedacht zu werden. Nicht mal Alice nannte ihn jemals.
Als hätte sie die Blicke ihrer Mutter gespürt, drehte sich das Mädchen zu ihr um. Hinter der Fensterscheibe gab Mila ihr ein Zeichen, ins Haus zu kommen.
»Im Baum ist ein Eichhörnchennest«, verkündete Alice, als sie vollkommen verfroren hereinkam.
Mila legte ihr stumm eine Wolldecke um die Schultern. Eine andere Mutter hätte ihre Tochter mit einer wärmenden Umarmung empfangen. Alice aber hatte keine andere Mutter, Alice hatte sie.
»Keine Spur von Finz?«, fragte sie schließlich.
Alice zuckte mit den Schultern.
Ihr Desinteresse an dem Verschwinden der Katze beunruhigte Mila. War das etwa schon ein Symptom?
»Was gibt es zum Abendessen?«, wechselte ihre Tochter das Thema.
»Gemüseauflauf, danach Apfelkuchen.«
Alice musterte sie neugierig.
»Wenn ich den Gemüseauflauf aufgegessen habe, kann ich dann den Kuchen mit in meine Höhle nehmen?«
Ihre »Höhle« war eine Art Unterschlupf aus Decken, den sie sich am Ende der Treppe gebaut hatte. Sie verbrachte viel Zeit dort, las mithilfe einer Taschenlampe oder hörte Musik auf einem alten iPod – seit Kurzem hatte sie eine wahre Leidenschaft für Elvis Presley entwickelt.
»Das sehen wir dann«, sagte Mila, die sich so schnell nicht erweichen ließ.
»Meinst du, dass er dieses Wochenende kommt?«
Die Frage verstörte Mila. Früher hatte Alice sie selten gestellt, aber jetzt war es schon das dritte Mal innerhalb eines Monats, dass sie nach ihm fragte. Warum versteifte sich Alice so darauf, dass ihr Vater sie besuchen kommen würde? Mila hatte ihr erklärt, dass das nicht passieren würde, dass dieser Mann schon seit Jahren im Koma liege und nicht mehr aufwachen würde. Jedenfalls nicht in diesem Leben. Vielleicht in der Hölle. Aber Alice hatte sich nun mal in den Kopf gesetzt, dass ihr Vater früher oder später auftauchen und sie Zeit miteinander verbringen würden, wie eine richtige Familie.
»Das wird nicht passieren«, sagte Mila zum x-ten Mal und sah das kleine Leuchten in den Augen ihrer Tochter erlöschen.
Alice straffte die Schultern unter der Wolldecke und setzte sich in den alten Sessel neben dem Kamin, in dem bereits ein Feuer prasselte. Sie vertiefte das Thema nie.
Mila wusste Dinge, die sie lieber nicht gewusst hätte. Die niemand wissen sollte. Unsagbare Dinge. Über das Böse, das Menschen ihresgleichen antaten. Und Alice sollte auf keinen Fall erfahren, dass auch ihr Vater zur Spezies der Sadisten gehörte, dafür war es noch zu früh. Sie hatte dafür gesorgt, dass ihre Tochter so spät wie möglich von dem finsteren Geheimnis erfuhr, das sich hinter ihrer Geburt verbarg. Und genauso wenig von der Grausamkeit, die die Welt beherrschte.
Sie musste sie beschützen.
Da es nicht in ihrer Macht stand, das Dunkel gänzlich aus ihrem Leben fernzuhalten, hatte sie alle Brücken hinter sich abgebrochen. Auch wenn sie noch immer eine Pistole in ihrem Nachttisch aufbewahrte, musste sie nicht mehr auf die Jagd gehen. Wenn sie aufhörte, das Dunkel zu suchen, würde das Dunkel auch nicht mehr nach ihr suchen, so ihre feste Überzeugung.
Aus den Augenwinkeln nahm sie eine Veränderung vor dem Fenster wahr. Ein Aufblitzen, die Spiegelung der untergehenden Sonne in der Windschutzscheibe eines herannahenden Autos. Mila spürte ein vertrautes Kribbeln im Nacken. Eine ungute Vorahnung stieg in ihr auf.
Die Limousine mit den abgedunkelten Scheiben hielt auf dem Vorplatz vor dem Haus, gleich neben ihrem Hyundai. Mila beobachtete die Szene durch das Küchenfenster. Ein paar Sekunden, in denen der Motor noch weiterlief, regte sich gar nichts. Dann öffnete sich die hintere Wagentür, und Joanna Shutton stieg aus.
Die Frau machte dem Chauffeur ein Zeichen, im Auto zu warten. Mit der einen Hand richtete sie ihre Haare, die in weichen Wellen auf den beigefarbenen Mantel fielen. In der anderen trug sie eine Aktenmappe. Leicht schwankend, da ihre Pfennigabsätze immer wieder im Rasen versanken, trat sie auf das Haus zu.
Wenn die Untersuchungsrichterin die Mühe auf sich nahm, höchstpersönlich bei ihr aufzukreuzen, musste es ernst sein. Eine Parfümwolke wehte ihr entgegen, als sie die Haustür öffnete. Für einen Moment fühlte sie sich unbehaglich, weil sie ihre ehemalige Vorgesetzte in Jogginganzug und Pantoffeln empfing.
Die Shutton musterte sie mit schiefem Blick, bevor sie sich ein Lächeln abrang.
»Ich wollte nicht stören«, entschuldigte sie sich wenig überzeugend. »Ich hätte mein Kommen gerne vorher angekündigt, aber wir konnten leider deine Telefonnummer nicht ausfindig machen.«
»Wir haben kein Telefon.«
Die Untersuchungsrichterin schaute sie an, als hätte sie etwas Beleidigendes gesagt, enthielt sich aber jeden Kommentars.
Mila wich nicht einen Zentimeter von der Tür. Sie wollte von Anfang an klarstellen, dass zwischen ihrem früheren und ihrem jetzigen Leben ein tiefer Graben lag, der nur schwer zu überwinden war.
Die Shutton hielt ihrem kühlen Blick stand. Die Chefin der Polizeidienststelle war eine selbstbewusste Frau, die sich nicht die Butter vom Brot nehmen ließ. Und doch war sie intelligent genug zu wissen, wann man Kompromisse eingehen musste. Nicht von ungefähr wurde sie »die Richterin« genannt.
»Ich habe einen langen Weg hinter mir, Vasquez. Deswegen möchte ich dich bitten, mir wenigstens eine Tasse Tee anzubieten, bevor du mich wieder wegschickst.«
Mila fixierte sie und beschloss, sich wenigstens anzuhören, was die Shutton ihr zu sagen hatte. Wobei sie sich schwor, sich nicht von ihr einwickeln zu lassen und sie nach dem Tee wieder dorthin zu schicken, wo sie hergekommen war.
Sie machte den Herd aus, weil das Abendessen nun warten musste, und legte einen Deckel auf den Topf. Dann nahm sie den Apfelkuchen aus dem Ofen und stellte ihn zum Abkühlen aufs Fensterbrett. Alice schickte sie nach oben.
»Warum darf ich nicht bleiben?«, protestierte das Mädchen. Sie bekamen so gut wie nie Gäste, und der Besuch der fremden Frau versprach eine willkommene Abwechslung.
»Ich will, dass du dir ein heißes Bad einlaufen lässt«, erwiderte die Mutter bestimmt. »Morgen musst du in die Schule.«
»Darf ich vorher noch ein bisschen Elvis in meiner Höhle hören?«
»Meinetwegen«, stimmte Mila zu. Ihr war jedes Mittel recht, um zu verhindern, dass Alice mitbekam, was die Shutton ihr mitzuteilen hatte.
Mit einer dampfenden Tasse Tee in der Hand kehrte sie zur Richterin zurück. Die Frau trank in kleinen, hastigen Schlucken und stellte die Tasse auf dem niedrigen Tisch vor dem Sofa ab, auf dem sie Platz genommen hatte. Die geheimnisvolle Aktenmappe hatte sie neben sich gelegt.
»Schön habt ihr’s hier«, sagte sie und ließ ihren Blick umherschweifen.
Das Feuer knisterte im Kamin und erfüllte das Zimmer mit seinem warmen Schein.
»Mein Vater war ein leidenschaftlicher Angler. Er hatte eine Hütte am See. Als wir klein waren, mussten meine Schwester und ich unendlich lange Wochenenden mit ihm in den Wäldern verbringen.«
Mila konnte sich die Shutton beim besten Willen nicht in Trekkinghose und Wanderschuhen vorstellen. Vielleicht betonte sie ihre Weiblichkeit deswegen so stark, weil ihr Vater sich eigentlich einen Sohn gewünscht hatte.
»Wir angeln nicht. Meine Tochter und ich sind Vegetarierinnen.«
Kommentarlos nahm die Richterin ihre Bemerkung zur Kenntnis. Mila beobachtete sie schweigend und fragte sich, wann sie sich endlich dazu durchringen würde, sie um den Gefallen zu bitten, dessentwegen sie gekommen war.
»Deine Entscheidung, alles hinzuwerfen, hat mich ziemlich erstaunt, weißt du das?«, sagte sie stattdessen. »Ich hätte gedacht, eine knallharte Polizistin wie du würde einen Ausstieg niemals in Erwägung ziehen.«
»Vermisst ihr mich etwa?«, fragte Mila mit provozierendem Unterton.
»Viele Kollegen haben es bedauert, dass du gegangen bist.«
»Aber Sie nicht …?«
»Stimmt«, erwiderte die Shutton ohne falsche Scheu.
Immer noch kein Wort zur Aktenmappe. Wenn sie weiterhin um den heißen Brei herumredete, dann wohl nur, weil sie es sich nicht leisten konnte, unverrichteter Dinge wieder nach Hause zu fahren. Milas Neugier wuchs, endlich das Anliegen ihres Besuches zu erfahren.
»Habt ihr keinen Fernseher? Ich sehe hier gar keinen«, sagte die Richterin und machte eine ausladende Geste.
Mila schüttelte den Kopf.
»Auch kein Internet?«, fragte die Shutton erstaunt.
»Wir haben Bücher. Und ein Radio.«
»Also hast du die Nachrichten gehört …«
Bevor Mila etwas sagen konnte, kam die Shutton ihr zuvor.
»Der Fall Anderson … Sagt dir das was?«
»Ihr habt den Tätowierten doch geschnappt. Ich dachte, damit wäre die Sache erledigt.«
Die Richterin lächelte schwach und schlug die Beine übereinander.
»Am Tatort und im Auto des Verdächtigen war so viel Blut, dass man von einem wahren Massaker sprechen kann«, sagte sie betont forsch. »Die Tatsache, dass der Mann die Mordwaffe bei sich hatte, hat dem Staatsanwalt die Arbeit sehr erleichtert: Er hat nicht eine Sekunde gezögert, Anklage auf mehrfachen Mord zu erheben.«
»Also wird wohl auch kein Anwalt dieser Welt den Mann aus der Scheiße, in die er sich manövriert hat, wieder raushauen können«, sagte Mila, um der Frage auszuweichen. »Wo ist das Problem?«
»So einfach ist es leider nicht«, gab die Shutton zu. »An dem Ort, wo wir ihn festgenommen haben, befanden sich ein Klappbett, ein paar Klamotten, ein Campingkocher und Konserven. Er hat wie ein Penner inmitten von ausrangierten Computern gelebt. Deswegen und wegen der Zahlen haben die Medien ihn ›Enigma‹ getauft.«
»Woher hatte er sie?«
Die Frage schien die Shutton aus dem Konzept zu bringen.
»Was?«
»Die Computer.«
»Was spielt das für eine Rolle? Er wird sie irgendwo zusammengeklaubt haben, aus Müllcontainern oder verlassenen Büros auf dem Schlachthofgelände. Scheint ein echter Hort für ausgediente Elektrogeräte zu sein.« Die Shutton nahm einen weiteren Schluck Tee, als wollte sie ihre Nerven beruhigen. »Die Presse will das Ganze natürlich zu einer Riesensache aufbauschen, aber ich werde nicht zulassen, dass irgendein dahergelaufener Irrer zum Promi wird.«
Mila begriff, dass die Shutton das eigentliche Problem noch immer nicht genannt hatte. Da war noch etwas, mit dem die Richterin haderte.
»Ihr wisst nicht, wer er ist, stimmt’s?«
Die Shutton nickte.
»Nirgendwo eine Übereinstimmung – weder in den Datenbanken noch im DNA-Archiv noch bei den Fingerabdrücken. Aber der wahre Clou ist ein anderer. Als das mit den Tattoos öffentlich wurde, hat sich niemand gemeldet, der ihn identifizieren konnte. Niemand! Keiner hat ihn je zuvor gesehen – kannst du dir das vorstellen?« Ihr war anzuhören, wie die Wut in ihr stieg. »Wie kann jemand, der von Kopf bis Fuß tätowiert ist, noch dazu ausschließlich mit Zahlen, inklusive Handflächen und Fußsohlen, völlig unbemerkt durch die Gegend laufen?« Die Shutton begann, an den Fingern abzuzählen: »Erstens: Niemand hat ihn registriert oder fotografiert, nicht mal aus Versehen. Zweitens: Die Überwachungskameras, die man inzwischen in jeder hinterletzten Ecke der Stadt findet, haben ihn nicht ein Mal erfasst. Drittens: Außerhalb des Lagers, wo wir ihn nach dem Hinweis des anonymen Anrufers aufgespürt haben, gibt es nicht eine Spur von ihm … Aus welchem Loch, zum Teufel, ist dieser Mann hervorgekrochen? Warum hat er sich versteckt? Woher hatte er die Sachen, die er brauchte? Wie hat er sich etwas zu essen besorgt? Und wie hat er es geschafft, die ganze Zeit unsichtbar zu bleiben?«
»Natürlich redet er nicht mit euch«, ergänzte Mila lapidar.
»Seit wir ihn gefunden haben, nicht ein Wort.«
»Will sagen: Es besteht die Gefahr, dass die Leichen der Andersons niemals gefunden werden …«
Für einen Moment hüllte die Shutton sich in Schweigen. Das Zeichen für Mila, dass sie mit ihrer Bemerkung ins Schwarze getroffen hatte.
»Die Zahlen auf seinem Körper sind der einzige Hinweis, den wir haben«, gab die Richterin zu.
Endlich nahm sie die Aktenmappe, öffnete sie und begann, auf dem Couchtisch Fotos auszubreiten, die den Körper des Mannes zeigten und von Bild zu Bild detaillierter wurden.
»Wir wissen, dass der Mann sich die Tätowierungen selbst gestochen hat. Mit Blick auf den Zustand der Tinte wissen wir auch, dass es nach und nach passiert sein muss … Zurzeit versuchen wir herauszufinden, ob sich hinter den Zahlen irgendeine Logik verbirgt oder ob es einfach nur die Obsession eines Irren war.«
Der Versuch, den Mann als Verrückten darzustellen, ließ Mila erahnen, dass die Shutton Angst vor dem hatte, was er tatsächlich sein könnte.
»Haben Sie schon ein Persönlichkeitsprofil erstellen lassen?«
Noch während sie die Frage formulierte, wunderte sich Mila über sich selbst. Hatte sie sich nicht geschworen, sich auf keinen Fall in die Sache hineinziehen zu lassen? Stattdessen hatte sie sich von ihrem Jagdinstinkt überrumpeln lassen.
Die Shutton nahm ihre Reaktion prompt als Zugeständnis und beeilte sich, auf ihre Frage zu antworten.
»Die Vielzahl an Spuren macht ihn eindeutig zum Tatverdächtigen. Das Ganze wirkt vollkommen unorganisiert, als hätte er aus einem Impuls heraus gehandelt … Dabei wirkt er überaus kühl und gelassen. Kontrolliert. Als hätte er das alles vorhergesehen und würde sich, während wir verzweifelt mehr über ihn herauszufinden versuchen, köstlich amüsieren.«
Mila betrachtete die Fotos auf dem Tisch, unterdrückte jedoch den Impuls, sie in die Hand zu nehmen. Die Zahlen auf der Haut des Mannes, die stets aus einer oder höchstens zwei Ziffern bestanden, bedeckten fast jeden Millimeter seines Körpers. Manche waren winzig klein, andere größer oder etwas in die Breite gezogen.
Es lag eine Methodik in diesem über Jahre vollendeten Werk, eine Akribie, die sie zutiefst beunruhigte. Er ist nicht einfach irgendein Psychopath, sagte sie sich. Ein Schauer lief ihr über den Rücken.
»Warum sind Sie zu mir gekommen?«, fragte sie und riss ihren Blick von den Fotos los, als wollte sie sich von einem Fluch befreien. »Ich habe keine Ahnung, wie ich Ihnen helfen könnte.«
»Hör zu, Vasquez …«
»Nein, das tue ich nicht«, erwiderte Mila brüsk, um jede Diskussion im Keim zu ersticken. »Ich weiß, was Sie vorhaben: Sie brauchen jemanden, der Ihnen hilft, die Leichen der Andersons zu finden. Eine Fahnderin, die sich seit längerer Zeit zurückgezogen hat und im Falle eines Scheiterns die Reputation der Polizei nicht allzu sehr beschädigen kann, kommt Ihnen da gerade recht.«
Tatsächlich würde die Polizistin, die nur durch ein Wunder den allerletzten Einsatz ihrer Karriere überlebt hatte, die Aufmerksamkeit der Presse auf sich ziehen und damit erst einmal vom Fall ablenken. Mila fühlte Übelkeit in sich aufsteigen.
»Falls Sie es immer noch nicht begriffen haben sollten, Ms. Shutton: Ich werde Ihnen nicht helfen. Weil ich für immer mit dieser Scheiße abgeschlossen habe.«
»Ich bin nicht hergekommen, um dich zu fragen, ob du die Andersons für uns suchen kannst«, erwiderte die Richterin in aller Seelenruhe.
Mila zögerte.
»Ich bin hergekommen, Vasquez, weil du vermutlich der einzige Mensch bist, der das Rätsel um Enigmas Identität lösen kann.«
Mila wusste nicht, was sie sagen sollte.
Die Shutton hatte sich von ihrer Verunsicherung nicht beeindrucken lassen und seelenruhig begonnen, in den Fotos herumzuwühlen.
»Zwischen all den tätowierten Zahlen haben wir auch ein Wort gefunden, ein einziges. Auf dem linken Arm, kaum zu erkennen zwischen den anderen Zahlen und der Ellbogenbeuge, steht das hier …«
Endlich hatte sie das gesuchte Foto gefunden und reichte es ihr. Zögernd nahm Mila es entgegen. Als sie das Foto genauer betrachtete, erschauderte sie.
Vier Buchstaben. Ein Name.
Ihr Name.
2
Wohl wissend, dass sie kein Auge zumachen würde, hatte Mila die Nacht auf dem Sofa verbracht, auf dem Joanna Shutton sie ein paar Stunden zuvor mit einer Wahrheit konfrontiert hatte, die sie niemals hätte wissen wollen.
Vermutlich bist du der einzige Mensch, der das Rätsel um Enigmas Identität lösen kann.
Die Worte der Richterin hallten noch immer in ihr nach. »Du musst ihm nicht gegenübertreten«, hatte die Shutton ihr versichert. »Es reicht, wenn du dir anhörst, was wir über ihn wissen, und uns sagst, wenn es dich an etwas erinnert. Danach kannst du alles wieder vergessen.«
»Wieso seid ihr so sicher, dass es sich ausgerechnet um meinen Namen handelt?«, hatte sie protestiert. »›Mila‹ kann tausend Dinge bedeuten, genauso wie die Zahlen, von denen ihr auch nicht wisst, was sie meinen.«
»Vielleicht irren wir uns ja, aber wir haben die Pflicht, es zumindest zu versuchen.«
Indem sie an ihr Pflichtgefühl appellierte, hatte die Shutton einen Volltreffer gelandet.
Mila beobachtete, wie die Flammen im Kamin allmählich erstarben, bis das Feuer ganz ausgegangen war und sie in einer Eiseskälte zurückließ, die ihr wohlvertraut war. In der Stille des Hauses waren die Geräusche aus dem Wald gut zu hören. Der Wind, der gegen die Baumkronen peitschte, um sich seinen Weg zu bahnen, das Plätschern der Wellen am Seeufer.
Alice hatte gespürt, dass etwas nicht in Ordnung war, und schien beunruhigt. Mila fühlte sich schuldig, weshalb sie dem Wunsch ihrer Tochter nachgegeben hatte, ausgerüstet mit Taschenlampe, Lieblingsbüchern, iPod mit Elvis-Songs und bewacht von den lächelnden Gesichtern ihrer Stofftiere, in ihrer Deckenhöhle zu schlafen.
Das Dunkel war zurückgekehrt, um sie zu suchen. Mila musste eine Entscheidung fällen, die auch ihre Tochter betreffen würde. Eine Entscheidung, die notfalls rückgängig gemacht werden konnte.
Es war alles so gut gelaufen – bis zu diesem Moment. Warum hatte sie der Richterin bloß die Tür aufgemacht? Es war, als hätte sie gemeinsam mit ihr ein unheilvolles Etwas ins Haus gelassen, das keinen Namen hatte, sich von Wut und den Schreien unschuldiger Opfer ernährte und sich nicht mehr vertreiben ließ. Mila konnte es auch jetzt noch spüren.
Der Schlächter der Andersons hatte sich ihren Namen auf die Haut tätowiert.
Der Gedanke quälte sie. Doch nicht die Tatsache selbst erschreckte sie, sondern das Wissen, dass jemand anders seine Haut mit solchen Zeichen versah. Wie oft hatte sie sich selbst geritzt, um eine Ahnung von menschlicher Regung zu bekommen, einen Schmerz zu empfinden, der dem Mitgefühl nahe kam, zu dem sie nicht in der Lage war. Die Ähnlichkeit oder, schlimmer noch, die Nähe zwischen ihr und diesem Monster schockierte sie. Es konnte kein Zufall sein. Er weiß es. War das der Grund, warum er versuchte, sie in die Sache hineinzuziehen?
Fragen und Zweifel überkamen sie, und eine Stimme in ihrem Inneren verlangte, sie sollte alles so schnell wie möglich vergessen, die Worte der Shutton und den Fall Anderson aus ihrem Hirn verbannen und sich in die selbst gewählte Einsamkeit zurückziehen, um mit ihrer Tochter ihr neues Leben weiterzuführen. Schließlich könnte niemand sie dazu zwingen, das Rätsel um Enigma zu lösen.
Denn eines wusste Mila genau: Dieses Tattoo war eine Einladung.
Ich lasse mich nicht manipulieren, sagte sie sich. Die Vorstellung, sich mit diesem Mann zu befassen, obwohl sie ihm nicht mal von Angesicht zu Angesicht begegnen musste, setzte ihr zu. Und doch sehnte sich ein Teil von ihr, irgendwo tief in ihrem Unterbewusstsein, danach, sein Geheimnis zu lüften.
Ich will sehen, was sich hinter dem Vorhang verbirgt, dem Magier in die Augen schauen und seine Tricks entlarven.
Das Dunkel rief nach ihr, sie spürte es, konnte es nicht ignorieren, sosehr sie sich auch bemühte. Denn selbst wenn es Mila gelang, ihre zweite Natur in Schach zu halten, so war sie doch nicht in der Lage, sie zu beherrschen.
Mit dem Morgengrauen wichen ihre letzten Widerstände, gemeinsam mit den Schatten der Nacht. Trotz der langen Nacht war Mila hellwach. Sie wusste, selbst wenn sie Enigmas Botschaft ignorierte, würde sie dieser Fall früher oder später aus dem warmen Nest vertreiben, das sie sich so mühevoll am Seeufer gebaut hatte, lauschig und behaglich wie die Höhle von Alice. Also konnte sie die Sache auch angehen.
Sie versuchte, sich einzureden, dass sie es für die Andersons tat, damit ihre Leichen gefunden wurden und sie ein würdiges Begräbnis erhielten. Aber wenn sie ehrlich war, musste sie zugeben, dass das nicht stimmte. Die Vorstellung, das Rätsel zu lösen, faszinierte sie. Nicht der mögliche Ruhm war es, der sie reizte. Nein, es war die absurde Überzeugung, dass sie die Welt zu einem sichereren Ort machen könnte, wenn sie den Kampf gegen das Dunkel aufnahm. Nicht zuletzt um ihrer Tochter willen.
Sie beschloss, Alice mit dem Duft von frisch gebackenen Pancakes zu wecken. Ihre Höhle hatte sie sich mithilfe von Decken, Wäscheklammern und einer Leine auf dem oberen Treppenabsatz gebaut, direkt vor der Speichertür. Mila schob das rot-grün karierte Plaid beiseite, das als Eingangstür diente. Ein Sonnenstrahl fiel in das Versteck.
Alice hob den Kopf mit den verstrubbelten Haaren vom Kissenberg auf den Eichendielen. Sie hatte wieder mal mit den iPod-Stöpseln in den Ohren geschlafen. Verwundert rieb sie sich die Augen und starrte auf das Tablett in Milas Händen.
»Pancakes? Heute ist doch gar nicht Samstag.«
Intuitiv hatte das Mädchen gespürt, dass die Veränderung ihrer täglichen Routine etwas zu bedeuten hatte.
Mila lenkte sofort vom Thema ab.
»Heute gehst du nach der Schule zu Jane. Ich werde gleich ihrer Mutter Bescheid sagen.«
»Warum denn das?«
»Ich muss in die Stadt und komme erst heute Abend zurück. Das ist doch okay für dich, oder?«
Alice blickte erneut auf die Pancakes, ohne etwas zu erwidern. Ihre Tochter schien zu glauben, sie hätte ihr Lieblingsfrühstück nur deswegen zubereitet, weil sie ein schlechtes Gewissen hatte. Und sie hatte ja recht: Tatsächlich suchte sie nach einer Rechtfertigung dafür, ihr neues Leben so einfach aufzugeben.
»Gehst du zu ihm?«
Mila seufzte.
»Nein, ich gehe nicht zu deinem Vater.«
»Okay.«
Wie immer begnügte sich Alice mit der erstbesten Antwort. Trotzdem würde sie ihre Tochter zum Psychologen bringen müssen, wenn diese Fixierung nicht allmählich aufhörte.
»Auf jeden Fall bin ich rechtzeitig zum Abendessen wieder da.«
»In Ordnung, Mama.«
Mila horchte auf. Alice nannte sie fast nie »Mama«. Und wenn sie es doch einmal tat, verspürte sie stets einen Stich, weil sie sicher war, dass ihre Tochter ihr damit etwas Wichtiges mitteilen wollte, sie die Botschaft aber nicht verstand.
Sie reichte ihr das Tablett mit den Pancakes, dem Ahornsirup und einem Glas Milch.
»Finz ist heute Nacht wieder nicht nach Hause gekommen«, sagte sie. »Vielleicht müssen wir im Wald nach ihm suchen.«
Alice nahm einen Bissen und schwieg.
»Zieh dich bitte an, wenn du gegessen hast. Der Schulbus kommt in einer halben Stunde«, sagte Mila und ging sich fertig machen.
Tief unten in ihrem Kleiderschrank bewahrte sie eine Kiste auf. Sie zog sie hervor und holte nacheinander ihre Springerstiefel, eine schwarze Jeans, einen Rollkragenpullover und eine Lederjacke hervor – Kleidungsstücke, mit denen sie sich früher unsichtbar gemacht hatte. Ein dunkler Fleck unter tausend anderen, angepasst an die unendliche Farbenvielfalt der Erde.
Doch tief unten in der Kiste befand sich noch etwas, das sie lange nicht benutzt hatte: Das Handy stammte aus Zeiten, als von Smartphones noch keine Rede war. Doch es schien nach wie vor zu funktionieren, stellte sie fest, als sie das Kabel in eine Steckdose steckte, um den Akku aufzuladen. Sie musste dringend ein paar Anrufe tätigen. Der erste galt der Shutton.
»Zwölf Stunden«, sagte sie, kaum hatte die Richterin sich am anderen Ende der Leitung gemeldet. »Danach bin ich draußen.«
Sie fuhr mit ihrem alten Hyundai zum Bahnhof. Der Zug ging um halb acht. Dreißig Minuten später hatte sie die Stadt erreicht. Sie hatte kaum den Fuß auf den Bahnsteig gesetzt, als der Lärm sie bereits umhüllte. Ihr neues Leben am See hatte sie vergessen lassen, was es bedeutete, ohne die Stille zu leben. Plötzlich fühlte sie sich eingeengt.
Neben einem Kiosk auf dem Bahnhofsvorplatz wartete wie verabredet Simon Berish. Ihr alter Freund hatte sich nicht verändert, kleidete sich noch immer wie ein echter Gentleman. Er sah sie schon von Weitem und hob einen Arm, um ihr zu winken.
»Ich habe nicht damit gerechnet, dich so schnell wiederzusehen.« Er wirkte irgendwie enttäuscht.
»Ich auch nicht«, erwiderte Mila.
Sie hatten sich Lebewohl gesagt, als sie den Polizeidienst quittiert hatte. Sie erinnerte sich noch gut an ihr letztes Gespräch. Auch wenn Mila es nicht explizit erwähnt hatte, schloss die Absicht, mit allem Schluss zu machen, ihn mit ein. Berish hatte es akzeptiert. Am Ende hatten sie sich verabschiedet wie immer, aber in dem Bewusstsein, sich nie mehr wiederzusehen.
»Hast du Zeit für einen Kaffee?«, fragte er.
»Ich fürchte, nein. Die Richterin hat zu meinen Ehren in zwanzig Minuten ein Briefing anberaumt.«
Ohne zu insistieren, führte Simon sie zu seinem Auto. Am Himmel ballten sich graue Wolken. Es hatte geregnet, und auf dem Asphalt hatten sich zahlreiche Pfützen gebildet. Berish lief voran. Mila hatte den Verdacht, dass er ihrem Blick ausweichen wollte. Aber sie kannte ihn gut genug, um zu wissen, dass er nicht mehr lange würde an sich halten können. Tatsächlich ließ er sie nicht warten.
»Ich kann es immer noch nicht glauben, dass die Shutton dich überredet hat, zurückzukommen«, sagte Berish irritiert.
»Ich bin nicht ›zurückgekommen‹«, entgegnete Mila. »Ich bin nur für ein paar Stunden hier.«
»Ich hatte sogar deine Telefonnummer gelöscht. Als mein Handy heute Morgen geklingelt hat, wusste ich nicht, dass du es bist, sonst wäre ich nicht rangegangen.«
Er gab vor, verärgert zu sein, doch Mila wusste, dass er es nur zu ihrem Besten tat. Um ihr die Entscheidung zu erleichtern, hatte Berish ein Jahr zuvor ihre Nachfolge in der »Vorhölle« angetreten – so nannten sie die Vermisstenstelle. Es war sicher nicht der begehrteste Job im Polizeipräsidium, er hatte ihr damit die Zweifel nehmen wollen: Ihre Arbeit würde nicht umsonst gewesen sein und die Vermissten auf den Fotos im »Saal der verlorenen Schritte« nicht in Vergessenheit geraten.
Sie gingen auf einen Kleinwagen zu, dessen Fenster einen Spaltbreit geöffnet waren, um Luft hereinzulassen. Berish wühlte in seiner Jackentasche nach dem Schlüssel. Im Fond des Wagens war bereits Hitchs Schnauze zu sehen.
»Hallo, mein Süßer«, sagte Mila.
Der Hovawart war alt geworden, hatte sie aber sofort erkannt. Immerhin einer, der sich freute, sie zu sehen, dachte Mila.
»Und, wie ist das Leben so am See?«, fragte Simon kurz darauf, während er den Wagen durch den Freitagmorgenverkehr Richtung Dienststelle steuerte.
»Anders, und das reicht mir.«
Im Innenraum des Autos war ein süßlicher Duft wahrzunehmen – nach Maiglöckchen und Jasmin. Vielleicht hatte sich auch in Berishs Leben etwas verändert?
»Und wie geht es Alice? Fühlt ihr euch nicht ein bisschen einsam da draußen?«
»Alice wird erwachsen, und wir sind keineswegs einsam. Wir haben sogar eine Katze, einen kleinen Tiger. Sie heißt Finz.«
Bei dem Wort »Katze« gab Hitch ein Knurren von sich.
»Ihr tut gut daran, so weit draußen zu leben, hier ist alles noch viel schlimmer geworden«, sagte Berish. »Glaub bloß nicht an das Märchen von der gesunkenen Kriminalitätsrate, an den neuen Frieden zwischen den Banden und ähnlichen Bullshit.«
Sie nannten es »die Shutton-Methode«, und tatsächlich hatte sie unerwartete Früchte getragen. Mila wusste, dass man in der Stadt seit ein paar Jahren, seit die Richterin im Amt war, deutlich besser lebte, doch das hatte ihre Entscheidung wegzuziehen nicht umstoßen können.
»Immerhin kann man jetzt abends ausgehen, während sich früher nach Einbruch der Dunkelheit kein Mensch mehr auf die Straße getraut hat«, musste Berish zugeben. »Aber so richtig dran glauben kann ich immer noch nicht.«
Mila hatte nicht vergessen, dass man vor ein paar Jahren noch riskierte, ausgeraubt zu werden, wenn man sich abends nach sechs Uhr noch vor die Tür getraut hatte, und das war noch das Harmloseste gewesen.
»Wo sind sie bloß hin, die ganzen Kriminellen, Diebe, Vergewaltiger, Drogenhändler? Klar, inzwischen können wir ins Kino oder in die Eisdiele gehen, ohne uns fragen zu müssen, ob wir heil wieder nach Hause kommen. Aber keiner wundert sich, was aus diesem ganzen Hass geworden ist, der hier vorher herrschte …«
»Hast du eine Idee?«, fragte Mila, während sie die Hochhäuser im Seitenspiegel an sich vorbeiziehen sah, eins höher als das andere.
»Oberflächlich betrachtet, scheint alles normal, sauber und blitzeblank zu sein … Aber schau dich mal ein bisschen im Netz um, und du wirst sehen, dass überhaupt nichts in Ordnung ist«, bemerkte Berish. »Die sind alle voller Wut, auch wenn man nicht weiß, weshalb. Und wenn sich die Wut aus dem Netz auf die Straßen überträgt, halten wir das bloß für Zufall … Vorgestern hat einer einen Elfjährigen blutig geprügelt, nur weil der ihm aus Versehen vor sein Smartphone gelaufen ist, als er gerade ein Foto machen wollte.«
Berish, das wusste Mila, war nicht bloß ein frustrierter Bulle. Er kannte sich aus mit dem, was er sagte. Jahrelang hatte er die besten Verhöre der ganzen Dienststelle geführt. »Alle wollen sie mit Berish reden«, hieß es unter den Kollegen, »selbst die größten Schwerverbrecher.« Simon kannte die Stadt und ihre Bewohner besser als jeder andere.
»Dieser Enigma hat uns gerade noch gefehlt«, sagte der Polizist und warf ihr einen schrägen Blick zu. »Ich weiß, dass du seinetwegen hier bist.«
Mila hatte ihm den Grund für ihren Besuch in der Stadt nicht genannt. Sie hatte nur gesagt, dass die Dienststelle sie um eine Einschätzung gebeten hatte, ohne näher ins Detail zu gehen.
»Was hältst du von der Sache?«, fragte sie.
»Das Ganze gefällt mir überhaupt nicht«, erwiderte Berish besorgt. »Die Dienststelle steht Kopf, und ich habe das Gefühl, dass man uns nicht alles sagt, dass sie etwas vor uns verbergen …«
Mila schwieg.
»Nach dem geheuchelten Entsetzen über den Tod der Andersons wird jetzt im Netz die Sau rausgelassen. Die Zivilisiertesten unter den Hetzern regen sich über die Polizei auf, weil die erst Stunden nach dem Hilferuf eine Streife zum Hof geschickt hat. Andere wettern gegen die Andersons selbst: wie man nur fernab von jeglicher Zivilisation mit zwei Kindern in der Pampa leben kann, ohne Strom … Aber die Schlimmsten sind die, die diesen tätowierten Psychopathen feiern.« Berish senkte die Stimme. »Sie bejubeln seine Tat, als wäre er ihr Sektenführer. Verstehst du, der Horror endete nicht etwa in jener Nacht auf dem Bauernhof, im Gegenteil, er verbreitet sich wie ein Tsunami weiter und wird noch viel mehr Zerstörung bringen. Du denkst, diese Fanatiker sind nur eine kleine Minderheit, doch dann stellst du fest, dass es ganz normale Büroangestellte sind, der Student von nebenan, der nette Familienvater … Und das Allerschlimmste ist, dass sie sich offen äußern, dass sie keine Skrupel haben, das unter dem eigenen Namen zu tun.«
»Wie erklärst du dir das?«
Simon Berish kratzte sich an der ergrauten Schläfe.
»Ich habe Dutzende von Mördern verhört und zum Geständnis gebracht: Irgendwann kommt immer der Moment, in dem sie sich für ihre Tat schämen, selbst die Härtesten unter ihnen. Normalerweise passiert das, wenn sie den Namen des Opfers nennen. Es dauert nur einen Moment, aber du kannst es in ihren Augen sehen … Vielleicht sind wir wirklich bessere Menschen und die Kriminellen weniger geworden, wie die Shutton behauptet, aber eins steht fest: Die allgemeine Moral ist völlig verkommen.«
Wie gut sie daran getan hatte, den Kontakt zu ihm abzubrechen. Eine Freundschaft zwischen zwei Polizisten »funktionierte« einfach nicht mehr, sobald einer von beiden die Uniform an den Nagel gehängt hatte. Berish konnte nur noch über ein Thema reden: Mord und Totschlag und was es sonst noch so an Elend gab. Klar, er wusste, dass es dienstliche Gründe waren, die sie in die Stadt geführt hatten. Aber hätte sie ihn übers Wochenende in ihr Haus am See eingeladen, sie hätten sich wohl nichts zu sagen gehabt.
Berish hielt etwa zwanzig Meter vor dem Eingang des Polizeipräsidiums. Mila streichelte Hitch ein letztes Mal über die Schnauze, dann stieg sie aus.
»Wann fährt dein Zug heute Abend?«, fragte ihr alter Freund in einem Ton, der keinen Widerspruch duldete.
»Um sieben.«
»Okay, ich hole dich um halb sieben ab und bringe dich zum Bahnhof.«
3
Das Meeting fand in einem Konferenzraum im vierten Stock des Polizeipräsidiums statt. Blaue Plastikstühle waren in mehreren Reihen aufgestellt worden. Davor ein Rednerpult und ein Monitor. Die Fenster gingen auf den Hof hinaus und waren mit einem Sichtschutz versehen, dessen Lamellen halb geöffnet waren. Trotz des Rauchverbots in öffentlichen Räumen, das seit über dreißig Jahren bestand, roch es noch nach kaltem Rauch.
Mila erkannte den abgestandenen Geruch sofort wieder, als sie eintrat. Sie musste nur einmal tief durchatmen, um die Uhr zurückzudrehen und in ihr altes Leben einzutauchen.
Sofort richteten sich die Blicke sämtlicher Anwesender auf sie. Neben der Shutton in ihrem makellosen Nadelstreifenkostüm standen Bauer und Delacroix, die beiden mit dem Fall betrauten Ermittler. Bauer war blond und dick, mit buschigem Schnauzer und finsterem Gesichtsausdruck. Der dunkelhäutige Delacroix schien der Aufgewecktere von beiden zu sein. Außerdem waren anwesend: ein mittelalter Mann in einem blütenweißen Hemd – den Mila als den zuständigen Rechtsmediziner identifizierte – und eine junge Kollegin in der Uniform der Spurensicherung. Sie hatte das spitze, leicht verkniffene Gesicht einer stolzen Polizistin. Auch Corradini hatte sich im Konferenzraum eingefunden, der persönliche Referent der Richterin, der in seinem dunklen Anzug eher wie ein Manager aussah. Mila hatte ihn nie kennengelernt, aber immer dann im Fernsehen gesehen, wenn die Dienststelle sich wieder einmal mit der Klärung eines Falles brüsten konnte. Er war der Stratege hinter der »Shutton-Methode«.
Keiner der Anwesenden begrüßte sie. Nur die Richterin ging ihr entgegen, um sie zu empfangen.
»Herzlich willkommen, Kommissarin Vasquez«, sagte sie mit einem Lächeln.
Mila fühlte sich unangenehm berührt. Sie war keine Kommissarin mehr und trug lediglich ein »Besucher«-Badge um den Hals. Sie konnte sich vorstellen, was in den Köpfen der anderen vor sich ging. Ob sie das Tattoo mit ihrem Namen für die Exkollegen zu einer Komplizin von Enigma machte? Oder lag es allein daran, dass sie von nun an in den Fall involviert war? Auch dass sie ihre Uniform an den Nagel gehängt hatte, sprach nicht gerade für sie. Echte Bullen zogen sich nicht zurück, so lautete die alte Devise. Entweder sie gingen in Rente oder starben im Einsatz.
Auch die Shutton schien die Anspannung zu spüren, tat aber so, als wäre alles in bester Ordnung.
»Fangen wir an.«
Die Richterin setzte sich in die Mitte der ersten Reihe und sorgte dafür, dass Mila neben ihr Platz nahm. Es behagte ihr gar nicht, so exponiert zu sitzen, aber sie hatte keine andere Wahl. Während auch die anderen sich einen Platz suchten, dimmte Corradini das Licht und stellte sich hinter das Rednerpult. Er wandte sich direkt an Mila.
»Wie Sie wissen, haben wir Sie bei Ihrem Eintreffen ein Dokument unterzeichnen lassen, in dem Sie sich zur Geheimhaltung über die hier verhandelten Dinge verpflichten. Anderenfalls droht Ihnen eine Konventionalstrafe wegen Begünstigung von Dritten und Behinderung polizeilicher Ermittlungen …«
Mila war verärgert. Es war wirklich nicht nötig, sie auf diese Selbstverständlichkeit hinzuweisen. Aber sie war nun mal inzwischen eine »Zivile« und musste diese penible Einhaltung von Formalitäten wohl oder übel akzeptieren.
»Ich werde Ihnen erklären, wie wir vorgehen, Ms. Vasquez. Aber zuerst werden die Kollegen Bauer und Delacroix den Mordfall Anderson noch einmal für Sie aufrollen, damit Sie uns Ihren ersten Eindruck schildern können.«
Mila war sich nicht sicher, ob sie eine große Hilfe sein würde. Mit einiger Wahrscheinlichkeit würde sie ihre ehemaligen Kollegen enttäuschen müssen.
»Du kannst den Vortrag jederzeit unterbrechen, um Fragen zu stellen, die dir wichtig erscheinen«, mischte sich die Shutton ein. »Wir wollen herausfinden, warum der Tätowierte dich in den Fall involvieren wollte.«
Die Richterin hatte den Anwesenden offensichtlich untersagt, den Verdächtigen bei dem Namen zu nennen, den die Medien ihm gegeben hatten. Mila aber beschloss, ihn weiter »Enigma« zu nennen.
Bauer ergriff das Wort.
»Okay, rekapitulieren wir, was in besagter Nacht auf dem Bauernhof der Andersons passiert ist.«
Auch wenn die Zusammenfassung eindeutig nur für Mila bestimmt war, wandte der Polizist sich an das gesamte Auditorium – ein unverhüllter Affront gegen die ehemalige Kollegin. Bauer nahm die Fernbedienung und schaltete den unter der Zimmerdecke angebrachten Beamer ein. Auf dem Monitor waren die Fotos vom Tatort zu sehen.
»Ausgehend von Ms. Andersons Notruf, können wir festhalten, dass der Mörder gegen acht Uhr abends auf dem Bauernhof eintraf.«
Ob die Andersons durch das Aufleuchten der Blitze während des Gewitters auf den Eindringling aufmerksam geworden waren? Falls ja, musste ihnen das Ganze wie ein Albtraum vorgekommen sein, eine Fata Morgana. Etwas, an dessen Existenz zu glauben sich das Gehirn im ersten Moment weigerte. Wer hatte ihn zuerst gesehen – Frida, Karl oder eines der Mädchen?
»Er hatte die ganze Nacht, um das Massaker anzurichten. Aber wir nehmen an, dass ihm wenige Stunden genügt haben.« Bauer drückte auf die Fernbedienung. »Erstes Element: die Sichel.« Eine Großaufnahme der Tatwaffe wurde eingeblendet. »Wir gehen davon aus, dass der Mörder sie nicht mitgebracht hat. Vermutlich hat er sie im Geräteschuppen gefunden. Möglicherweise hegte er zunächst gar keine Tötungsabsicht, sondern wollte nur einen Diebstahl begehen.«
Klinge und Griff der Sichel waren mit dunkelroten Blutflecken übersät.
»Es ist uns nicht gelungen, Fingerabdrücke auf der Waffe zu isolieren«, bemerkte die Mitarbeiterin von der Spurensicherung eifrig. »Zu viel Blut.«
»Zweites Element: das Mobiltelefon.«
Das nächste Foto zeigte das Handy, von dem aus der Notruf getätigt worden war. Es lag auf einem Hängeschrank. Durch das Fenster daneben sah man das Eingangstor des Bauernhofs und den Vorplatz.
»Von hier aus hat Ms. Anderson die Polizei angerufen. Obwohl sie wegen des starken Regens nicht gut sehen konnte, was draußen abging, hat die Frau behauptet, ihr Mann hätte vor dem Haus mit dem Eindringling geredet.«