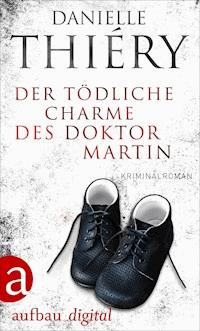
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissarin Edwige Marion
- Sprache: Deutsch
Die scharfsinnige Edwige Marion ist in der Liebe vom Pech verfolgt - und außerdem noch schwanger. Ob von Léo oder Sam weiß sie nicht genau. Die Kommissarin aus Leidenschaft beschließt, sich um einen ruhigen Verwaltungsjob in Versailles zu bewerben. Da hinterläßt ein Unbekannter auf ihrem Briefkasten ein Paar Kinderschuhe, versiegeltes Indiz eines fünf Jahre zurückliegenden Falls, der nie aufgeklärt wurde. Gegen den Willen ihres Vorgesetzten holt Marion die Akte wieder hervor, wühlt jede Menge Schlamm auf, und findet einen Täter, den sie sich schließlich wünscht, niemals überführt zu haben ...
"Eine durchwachte Nacht mit der Kommissarin - das blüht Ihnen, wenn Sie den Thriller der Hauptkommissarin Danielle Thiéry lesen." L'EXPRESS.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 539
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über Danielle Thiéry
Danielle Thiéry, geboren 1947, zwei Kinder, war Kriminalkommissarin in Paris und in den siebziger Jahren die erste Frau an der Spitze eines französischen Kommissariats. 1991 findet sie endlich die Zeit zu schreiben. Seitdem hat sie eine Fernsehserie entwickelt, an mehreren Fernsehproduktionen mitgearbeitet, einen autobiographischen Roman (Prix Bourgogne 1997) und zahlreiche Krimis (Prix Polar 1998) geschrieben.
Informationen zum Buch
Die scharfsinnige Edwige Marion ist in der Liebe vom Pech verfolgt – und außerdem noch schwanger. Ob von Léo oder Sam weiß sie nicht genau. Die Kommissarin aus Leidenschaft beschließt, sich um einen ruhigen Verwaltungsjob in Versailles zu bewerben. Da hinterläßt ein Unbekannter auf ihrem Briefkasten ein Paar Kinderschuhe, versiegeltes Indiz eines fünf Jahre zurückliegenden Falls, der nie aufgeklärt wurde. Gegen den Willen ihres Vorgesetzten holt Marion die Akte wieder hervor, wühlt jede Menge Schlamm auf, und findet einen Täter, den sie sich schließlich wünscht, niemals überführt zu haben.
»Eine durchwachte Nacht mit der Kommissarin – das blüht Ihnen, wenn Sie den Thriller der Hauptkommissarin Danielle Thiéry lesen.« L'EXPRESS.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Danielle Thiéry
Der tödliche Charme des Doktor Martin
Kriminalroman
Aus dem Französischen von Sabine Schwenk
Inhaltsübersicht
Über Danielle Thiéry
Informationen zum Buch
Newsletter
Engelsmord
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Der Aufstand der Engel
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Kapitel 77
Kapitel 78
Kapitel 79
Kapitel 80
Kapitel 81
Kapitel 82
Kapitel 83
Kapitel 84
Kapitel 85
Kapitel 86
Kapitel 87
Kapitel 88
Kapitel 89
Kapitel 90
Kapitel 91
Kapitel 92
Kapitel 93
Kapitel 94
Kapitel 95
Kapitel 96
Kapitel 97
Kapitel 98
Kapitel 99
Kapitel 100
Kapitel 101
Impressum
Engelsmord
1
Sonntag, Abenddämmerung
Der Fahrgast mit der schwarzen, trotz der milden Luft tief ins Gesicht gezogenen Mütze hat im hinteren Teil des Busses Platz genommen. Der Fahrer, der an Sonntagabenden schon so manche Unannehmlichkeit erlebt hat, ist beruhigt: Mit dem wird es keine Probleme geben. Im übrigen scheint er eingenickt zu sein, das Kinn ruht auf der Brust. Weder dem Centre médico-pédagogique des Sources, das sich am Ortseingang von Saint-Genis hinter einer Mauer aus hellgelbem Sandstein versteckt, noch der Metropole Lyon, erkennbar in der Ferne an ihrem Hochhaus, das wie ein glitzernder Phallus aus dem Stadtteil Part-Dieu emporragt, schenkt er einen Blick.
Hätte der Fahrer den einzigen Insassen seines Busses genauer betrachtet, so wäre ihm aufgefallen, daß er keinerlei Gepäck bei sich hat, nur ein in braunes Papier gehülltes Paket, das er fest an seinen Bauch drückt.
Saint-Genis. Endstation.
Place du Marché. Der Reisende steigt aus und bleibt auf dem Bürgersteig stehen, unentschlossen. Der Busfahrer wirft ihm nur einen kurzen, abwesenden Blick zu: Er hat zu tun, und mit etwas Glück wird er an diesem Sonntagabend noch den Spätfilm erwischen.
Der Unbekannte hat einen Stadtplan entdeckt. Mit leicht schlingerndem Gang steuert er darauf zu. Diese etwas seitwärts gerichtete Gangart ist störend, bringt ihn fast aus dem Gleichgewicht. Die Tafel ist schwach beleuchtet, und außer dem Pfeil, der den Standort anzeigt, ist kaum etwas zu erkennen, die Liste der Straßennamen im unteren Teil des Schildes ist fast unleserlich. Um die Rue des Mésanges, die Meisenstraße, zu finden, muß der Bote nach einem Viertel suchen, in dem die Straßen nach Vögeln benannt sind.
Allée du Rossignol, Nachtigallenallee, Rue des Moineaux, Sperlingstraße, Place de l’Alouette, Lerchenplatz, Rue des Mésanges … Von der Place du Marché kommend, bedeutet das mindestens einen Kilometer Fußmarsch.
Der Fremde ist müde, aber entschlossen. Er weiß genau, was er tun muß.
Er hört, wie sich die Bustür zischend schließt und der Motor wieder zu brummen beginnt. Das Fahrzeug wendet, und bald sieht der einsame Fußgänger durch eine Wolke von Auspuffgasen hindurch nur noch das grüne Hinterteil des Busses, auf dem ein Werbeplakat prangt. Dennoch hat er bemerkt, daß der Fahrer sich seine Schirmmütze wieder aufgesetzt hat.
Trägt Marion eigentlich manchmal Uniform? Und die Männer, die ihr unterstehen? Er zermartert sich das Hirn, um auf präzise Erinnerungen zu stoßen. Bilder tauchen auf, Gefühle. Bald bittersüß wie die Spuren getrockneter Tränen oder der ferne Widerhall erstickten Schluchzens. Bald herb und brutal wie der Schweiß, der ihm auf einmal über den Rücken läuft.
Plötzlich die Furcht: Und wenn sie nicht da ist? Überprüfen. Eine funktionierende Telefonzelle finden, die Anweisungen lesen: »Nehmen Sie den Hörer ab, führen Sie die Karte ein.« Welche Karte?
Glücklicherweise sind es zwei Zellen, die andere nimmt Münzen an.
Alles ist mühsam, sogar das Atmen, doch die Mühen schrecken ihn nicht. Er denkt nicht daran, während er aus dem Kopf eine Telefonnummer wählt, den Blick fest auf einen fernen Punkt gerichtet, hoch oben am Firmament.
Irgendwo am noch hellen Himmel ist ein Stern aufgegangen.
2
Marion hörte auf, die Tastatur ihres Macintosh zu bearbeiten, und warf sich mit einer Grimasse auf ihrem Stuhl zurück. Der Rücken tat ihr weh, und ein schleichender Krampf verspannte ihre rechte Wade. Sie gähnte und überlegte, wieviel Zeit sie noch für diese Arbeit, um die Richter Ferec dringend gebeten hatte, würde opfern müssen. Mehrere Stunden, die sie damit zubringen würde, im kalten Gerichtsjargon zu schildern, wie sich der gemeine Mord an einem zehnjährigen Mädchen zugetragen hatte, das man totgeprügelt und erwürgt hatte. Vor ihr lag über den Schreibtisch verstreut die Akte mit den brutalen Bildern, die sie zwangen, sich am Ende eines warmen, friedlichen Sonntags von der Welt draußen zu verabschieden.
Von ihrer Welt, und das war Nina, Marions Adoptivtochter, wobei die Adoption noch nicht endgültig abgeschlossen war. Sie konnte hören, wie Nina im Nachbarzimmer gerade Lisette anherrschte, ihre Großmutter mit dem stets so traurigen Gesicht. Lisette sollte Nina ein sonderbares Lied vorsingen, was ihr jedoch nicht gelang: Sie krächzte nur mit tonloser Stimme, wogegen die Kleine sogleich protestierte. Es folgte eine gedämpfte Unterhaltung, in der Ninas gereizte, manchmal aggressive Stimme den Ton angab. Seit dem frühen Nachmittag hatte Marion sie nicht ein einziges Mal lachen hören.
Durch das offene Fenster, das auf die Straße ging, drangen die vertrauten Geräusche der Nachbarschaft in das Zimmer im ersten Stock, das als Büro eingerichtet war. Hier lagerte Marion auch all das, was ihr anderswo im Weg herumstand. In einer Ecke stapelten sich seit über einem Jahr einige Kartons, über deren Inhalt sie kaum noch hätte Auskunft geben können.
Draußen hörte man das Lachen der Kinder, die ihre letzten freien Ferientage in vollen Zügen genossen. Kommissarin Edwige Marion, die alle nur Marion nannten, fragte sich, wie viele Kinder wohl fehlen würden, wenn in ein paar Tagen die Schule wieder begann. Wie die kleine Märtyrerin, deren Fotos sie vor sich ausgebreitet hatte.
Eine Minute lang oder auch zwei bemühte sie sich, die Übelkeit zu unterdrücken, die ihre Kehle hochstieg, und machte sich wieder an ihren Bericht. In Großbuchstaben tippte sie die Kapitelüberschrift:
TATORTBESICHTIGUNG
Der Körper des Opfers liegt mit dem Gesicht zum Boden, die Beine sind leicht gespreizt, die Füße nach außen gedreht. Seine Kleidung ist naß und mit abgerissenen Pflanzenteilen übersät. Der Kopf steckt in einer grünweißen Plastiktüte von Prisunic. Die Haare sind hochgesteckt, und das Genick weist eine tiefe bläulichrote, horizontal verlaufende Furche auf …
Das Telefon klingelte. Marion fuhr zusammen. Sosehr sie sich auch bemühte, ihre Ruhe wiederzufinden, das Telefon war seit Léos Tod ein Streßfaktor, der sich gänzlich ihrer Kontrolle entzog.
Auf dem Treppenabsatz hörte sie Nina poltern und mit ihrer Sirenenstimme »Telefon!« rufen. Dann die Schritte von Lisette, die in wehleidigem Ton – wie immer, wenn sie verärgert war und sich nicht traute, es zu sagen – versuchte, ihre Enkelin zum Schweigen zu bringen.
Marion sprang auf und stürzte zur Treppe. Eine jähe, unsinnige Furcht.
»Warte, Nina, geh nicht ran!«
Nina blieb unvermittelt in der Wohnzimmertür stehen, blickte zu ihrer Mutter hoch und verschränkte die Arme vor ihrem weißen Wickel-T-Shirt, auf dem ein paar längliche graue Flecken prangten.
»Warum denn nicht?« gab sie patzig zurück, während der Anrufbeantworter seinen Willkommensgruß abspulte.
»Ich will nicht gestört werden.«
»Aber vielleicht ist es Mathilde, oder Talon …«
»Die sprechen aufs Band, dann rufen wir zurück.«
Nina war alles andere als erfreut, und das sah man. Mit ihren neun Jahren war sie ein lebhaftes, spontanes Kind und mit Heiterkeits- und Wutausbrüchen gleichermaßen schnell bei der Hand.
Das Band war abgelaufen, und schon ertönte das Piepen, das anzeigte, daß der Anrufer aufgelegt hatte.
»Siehst du«, sagte Marion befangen, »das war ein Störenfried oder ein Rüpel. Ich hasse Leute, die auflegen, ohne ein Wort zu sagen.«
Lisette verzog das Gesicht. Sie mißbilligte Marions direkte Ausdrucksweise.
»Ich kann sie verstehen«, sagte sie mit zusammengekniffenen Lippen. »Ich persönlich mag diese modernen Geräte auch nicht.«
Nina, deren nackte braune Beinchen aus fransigen Shorts ragten, stieg flugs die Treppe hinauf und baute sich vor Marion auf.
»Bis wieviel Uhr arbeitest du noch?«
»Bis spät, mein Schätzchen«, antwortete Marion und zog das Mädchen an sich. »Ich muß diese Arbeit morgen früh abgeben. Aber ihr hättet doch ein bißchen rausgehen können, warum habt ihr das nicht getan?«
»Sie wollte nicht …«
Nina deutete mit einer hochmütigen Kinnbewegung auf ihre Großmutter, die nachgekommen war. Dann fügte sie, den Blick auf ihre blauen Stoffsandalen geheftet, schmollend hinzu:
»Mir ist langweilig.«
»Sieh doch ein bißchen fern.«
»Fernsehen ist total blöd. Wenn ich wenigstens eine Playstation hätte …«
»Nina«, unterbrach Marion sie, »darüber haben wir schon gesprochen.«
Nina äffte Marion nach:
»Ja, ich weiß, das ist zu teuer, Weihnachten sehen wir weiter … Das ist einfach blöd! Alle meine Freundinnen haben schon eine.«
»Nina, bitte«, schimpfte Marion. »Das reicht. In drei Tagen hast du wieder Hausaufgaben auf, da wirst du dich nicht mehr so langweilen.«
»Eben! Und ich hab noch nicht mal meine Sachen für die Schule …«
»Die kaufe ich morgen. Das hatten wir doch so abgemacht, oder? Vergiß nicht, mir die Liste zu geben.«
»Kann ich nicht mitkommen?«
»Ich glaube, das wird nicht gehen.«
»Und dann kaufst du wieder nicht das, was ich will, das ist immer so, ich hab’s satt!«
Nina war eindeutig in streitbarer Stimmung. Aber Marion spürte, daß sich hinter ihren bissigen Worten und ihrem funkelnden Blick tiefer Kummer verbarg. Ein Kummer, den sie auch in Lisettes Augen las, auf denen ein grauer Schleier lag, und an ihren Händen, die unruhig vor dem Bauch flatterten wie Vögel in einem Käfig. Seit Nina bei Marion lebte, quälte die alte Dame der Gedanke an ihre beiden anderen Enkel, Louis und Angèle, die nicht so viel Glück hatten wie ihre jüngere Schwester und dem Ende der Sommerferien im Waisenhaus der Polizei entgegensahen. Wenn Waisenkinder ein gewisses Alter überschritten haben, finden sich keine Adoptiveltern mehr, und Ninas ältere Geschwister würden wahrscheinlich kein neues Zuhause bekommen. Lisette Lemaire, die alt und häufig krank war, kam nicht darüber hinweg, daß sie nicht mehr für die Kinder tun konnte.
Wieder ließ das Klingeln des Telefons alle drei hochfahren. Nina stürzte los, doch Marion hielt sie zurück. Und wie ein Nachhall folgte dem Willkommensgruß auch diesmal der abgehackte Piepton.
»Wer ist das?« wollte Nina wissen, der die verärgerte Miene ihrer Mutter nicht entgangen war.
»Ich weiß nicht. Da hat sich bestimmt jemand verwählt.«
3
Langsam und mit großer Vorsicht biegt der Unbekannte in die Rue des Mésanges ein, und mit einem Mal macht sich die ganze Müdigkeit bemerkbar. Das Schlingern in seinem Gang wird immer heftiger, man könnte fast meinen, er sei betrunken.
Rue des Mésanges Nummer sieben. Das zweistöckige Haus ist neueren Datums, Fertigbauweise, anonym. Eins jener Häuser, in denen die wechselnden Mieter sich nicht heimisch genug fühlen, um Blumen in die Fenster zu stellen. An der Fassade kein Licht. Ist Marion nicht da? Was bedeutet die Nachricht auf dem Anrufbeantworter: »Wir sind nicht zu Hause«? Wer verbirgt sich hinter dem »wir«? Ein Mann? Ein Ehemann?
Das Tor ist geöffnet, und auf dem kurzen Weg, der zur Haustür führt, steht ein grauer Peugeot. Dann ist sie also da, hier, hinter diesen seelenlosen Mauern – es sei denn, sie hat das Haus zu Fuß verlassen.
Die Straße ist menschenleer. Aus Fenstern, die noch geöffnet sind, dringen Musikfetzen und die Geräusche eines Fernsehers.
Der Unbekannte schlüpft hinter die Hecke, die Marions Garten von dem der Nachbarn trennt. Dort sitzen Menschen beim Essen zusammen, Grillgerüche ziehen herüber. Eine Frau gähnt, erinnert daran, daß am nächsten Morgen eine neue Woche beginnt. Es ist ein Sonntagabend voller Trägheit, erfüllt vom Duft welkender Rosen.
Vorsichtig nähert sich der Besucher dem Peugeot und stemmt sich mit seinem ganzen Gewicht gegen den Wagen. Ein schrilles Alarmsignal ertönt, das ihn zurück hinter die Zypressenhecke flüchten läßt. Geduld, ein paar Sekunden Geduld. Aus einem Fenster im ersten Stock dringt plötzlich Licht, und eine vertraute Silhouette zeichnet sich ab. Marion. Sie ist zu Hause.
Und auf einmal bricht alles zusammen, die Bilder verschwimmen, die Luft wird schwer von sich vermischenden Düften: Neben Marion schüttelt eine schmächtige, zarte Silhouette ihre blonden Zöpfchen, die sich in der Fensterscheibe spiegeln. So kann man sich nicht täuschen … Der Bote preßt beide Hände auf sein Herz, das ihm allzu laut gegen die Rippen schlägt.
Dann ist es also wirklich wahr. Der Traum hat nicht gelogen. Marion hat das Kind genommen, und das Kind ist da, hier, hinter diesem Fenster.
4
Als das Telefon seinen dritten Angriff startete, hätte Marion beinahe abgehoben und wüste Beschimpfungen in den Hörer gebrüllt. Doch dieses Mal hallte gleich nach dem Piepton die Stimme von Lieutenant Talon durch den Raum. Marion nahm ab und meldete sich schnaufend.
»Alles in Ordnung, Chef?« fragte der Beamte ruhig. »Sie hören sich an, als wären Sie gerannt.«
»Nein, ich bin nur gereizt. Ich habe ein paar Anrufe bekommen, bei denen sich keiner gemeldet hat.«
»Im Ernst? Ich hoffe, Sie denken nicht …«
»Doch, genau daran denke ich, stellen Sie sich vor!«
Kaum verblaßte Erinnerungen überfielen sie und schnürten ihr die Kehle zu. Marion warf einen Blick durch die Terrassentür. Die Ruhe in der Rue des Mésanges, das gewohnte Treiben in der Nachbarschaft beruhigten sie nicht. Sie schrieb ihre Bangigkeit dem üblichen sonntagabendlichen Trübsinn zu und gab sich einen Ruck:
»Also, Talon, was gibt’s Neues?«
»Totale Flaute … Tödlich langweilig, der Bereitschaftsdienst dieses Wochenende. Ich hatte nur einen Bombenalarm im Musée Saint-Pierre – ein Bluff, aber wir haben trotzdem evakuiert – und einen Einbruch in eine Brillenfabrik. Ich frage mich, was die mit dreitausend Brillen …«
»Gut«, sagte Marion. »Und sonst?«
»Stör ich Sie vielleicht, Chef?«
Talon hatte in der Stimme seiner Vorgesetzten eine gewisse Ungeduld wahrgenommen, die fast schon an Gereiztheit grenzte. Seit einiger Zeit häuften sich diese Launen.
»Ich muß noch arbeiten.«
»Der Zoé-Brenner-Bericht?«
»Ganz genau … Bis morgen, Talon«
»Ja. Ach, Chef, fast hätte ich’s vergessen …«
Marion stieß einen resignierten Seufzer aus.
Talon fuhr fort, ohne sich aus der Ruhe bringen zu lassen:
»Wir haben einen Zeugen.«
Marion schwieg höflich. Sie hörte Nina, die sich schon wieder mit Lisette stritt, dachte an die Gefahr, die immer noch präsent war. An alles, was sie in ihrem Leben als Frau ohne Mann erwartete. Nina tauchte in der Tür auf, einen Finger im Mund, schmollend.
Talons besorgte Stimme:
»Chef?«
»Ja, ja … Einen Zeugen wofür?«
»In der Sache mit dem Friedhof …«
»Hm?«
»Gut, okay, ich sehe schon. Sie erinnern sich nicht an die Müllsäcke mit den Fleischstücken …«
Marion hüllte sich bis zum Ende von Talons Bericht in feindseliges Schweigen. Zwei Wochen zuvor hatte ein Unbekannter längs der Mauer um den Cimetière de la Guillotière sechs Müllsäcke verstreut, in denen sich Teile eines Frauenkörpers befanden, dem der Kopf fehlte und der noch nicht identifiziert werden konnte. An diesem Abend war völlig überraschend ein Zeuge aufgetaucht. Im Überschwang des für die Jahreszeit viel zu heißen Sonntags hatte er sich nach einem Dutzend Bieren unvorsichtigerweise einer Kneipenbekanntschaft anvertraut.
»Was mache ich damit?« fragte Talon, nachdem er vergeblich auf eine Antwort gewartet hatte.
»Was Sie wollen, Talon, kochen Sie sie, essen Sie sie.«
Der Beamte am anderen Ende schnalzte mit der Zunge, was bei ihm, der nur selten Gefühle zeigte, ein Ausdruck großen inneren Aufruhrs war. Er wappnete sich mit Geduld.
»Ich wollte sagen: Was mache ich mit dem Zeugen?«
»Was ist bloß mit Ihnen los, Talon? Sie wissen doch, was Sie zu tun haben! Sie stellen vielleicht dumme Fragen …«
Talon hatte geglaubt, daß Marion dabeisein wollte, wenn das zu erwartende Geständnis zu Protokoll genommen würde. Sie betrachtete den Augenblick, in dem der Verdächtige ins Wanken geriet, als einen der aufregendsten Momente einer Ermittlung. Der Verdächtige wurde zum »Täter«, und der formelhafte Ausdruck »Ermittlung gegen Unbekannt« verschwand – häufig nur durch einen klitzekleinen Satz, etwa: »Ja, ich habe Mademoiselle Soundso umgebracht.« – aus den Protokollen. Unbekannt hatte endlich einen Namen.
»Und rufen Sie mich bloß nicht an, um mir zu sagen, was er mit dem Kopf dieser armen Frau gemacht hat«, sagte sie abschließend.
Während Marion noch eine Reihe von Silben ausstieß, die man besser nicht alle verstand, legte Talon auf, und plötzlich wurde ihr bewußt, daß Nina vor ihr stand und sie vorwurfsvoll anstarrte. Sie biß sich auf die Lippen und verfluchte innerlich ihre Unbeherrschtheit. Sie würde mit der Kleinen darüber reden, ihr sagen, daß es ihr leid tat.
Nina kam ihr zuvor:
»Ich habe Hunger«, sagte sie in herablassendem Ton.
»Könnten Sie etwas kochen, Madame Lemaire? Für Nina und für sich selbst?«
Trotz wiederholter Aufforderungen seitens der alten Dame gelang es Marion nicht, sie »Omi« zu nennen.
»Und Sie, wollen Sie nichts essen?« erkundigte sich Lisette, nicht gerade begeistert von der Vorstellung, sich an den Herd zu stellen.
Marion zog eine Grimasse.
»Du lieber Himmel, nein! Mir liegt noch das Mittagessen im Magen, und ich bin schrecklich in Verzug. Im Kühlschrank ist noch kaltes Hühnchen … Sie könnten Nudeln dazu kochen.«
Lisette ergab sich unwillig, und Marion ging die Treppe hinauf, dicht gefolgt von Nina. Das Mädchen zog an ihrem beigefarbenen Baumwollhemd.
»Mama!«
Marion drehte sich gerührt um, wie immer, wenn Nina sie »Mama« nannte.
»Ja, Mäuschen?«
Nina sah ihre Mutter flehend an.
»Spielen wir was, danach?«
Marion setzte sich auf eine Stufe und zog das Kind an sich, während Lisette unten in der Küche mit den Töpfen klapperte.
»Es tut mir so leid, meine kleine Nina. Ich weiß, daß es nicht lustig ist für dich. Ich verspreche dir, daß ich in Zukunft versuchen werde, keine Arbeit mehr mit nach Hause zu bringen.«
»Das sagst du immer.«
»Nein, Nina, du übertreibst, so oft passiert das auch nicht.«
Nina beugte sich vor, um ihrer Mutter ins Ohr zu flüstern:
»Die Omi geht mir auf den Wecker.«
»Du bist ungerecht, sie tut, was sie kann.«
Marion ertappte sich dabei, wie sie ebenfalls flüsterte.
»Weißt du«, fing Nina wieder an, »ich muß dir was sagen …«
In diesem Moment baute sich Lisette in der Küchentür auf und verkündete mit einer merkwürdigen Stimme, so als hätte sie die letzten Worte ihrer Enkelin mitbekommen, daß sie die Nudeln nicht finden könne. Sie hatte offensichtlich einen schlechten Tag, und während Marion den Vorratsschrank durchwühlte, äußerte sie den Wunsch, gleich nach dem Essen nach Hause zu fahren. Als Marion ihr vorschlug, sie heimzubringen, lehnte sie ab: Sie würde ein Taxi rufen. Für gewöhnlich überredete Nina ihre Großmutter, den Vorschlag anzunehmen. Sie wußte, daß Marion sie niemals nachts allein zu Hause lassen würde, das nutzte sie aus und bettelte auf der Rückfahrt dann so lange, bis ihre Mutter einem kleinen Umweg durch das Rotlichtviertel in der Innenstadt zustimmte, wo Nina die Prostituierten bei der Arbeit beäugen konnte. Sonderbare Attraktion. Viele der Mädchen kannten die Kommissarin, was den Reiz des Ausflugs noch steigerte.
An diesem Abend schwieg Nina, und als Marion, die keine Nudeln finden konnte, Lisette einen Beutel Basmatireis in die Hand gedrückt hatte, stellte sie fest, daß Nina verschwunden war.
Die Kleine schreckte nicht einmal zusammen, als Marion sie in ihrem Arbeitszimmer entdeckte, auf dem alten Bürostuhl, den Blick auf die Fotos des grausam mißhandelten Körpers der kleinen Zoé Brenner geheftet. Vor sich hatte sie die abscheulichste Aufnahme, die gemacht worden war, gleich nachdem Marion das Mädchen auf den Rücken gedreht und ihm die Plastiktüte vom Kopf gezogen hatte. Die starken Kontraste des Abzugs unterstrichen das Weiß der aufgerissenen Augen, die blauen, fast schwarzen Blessuren an Wangen und Stirn, den halb geöffneten Mund mit den krummen Zähnchen. Eine fette Nacktschnecke an der Wange des Kindes schien jeden Moment zwischen die bleichen Lippen kriechen zu wollen.
Marion wäre gern dazwischengetreten, um Nina zu schützen, hätte die Bilder der Toten am liebsten aus ihrem Gedächtnis gestrichen. Doch die Kleine hatte hingesehen, und jetzt war es gewiß besser, nicht zu dramatisieren. Im übrigen blickte Nina mit gelassener Miene zu ihrer Mutter auf, ganz so, als hätte sie ein Album mit Familienfotos vor sich.
Marion streckte ihr die Hand entgegen.
»Nach dem Abendessen gehst du in die Badewanne«, sagte sie und schlang ihre Arme um das Kind, »das hast du mehr als nötig … Vergiß auch nicht, dir die Zähne zu putzen. Dann komme ich noch mal an dein Bett und gebe dir ein Küßchen, in Ordnung?«
Schweigend nickte Nina, die erschütterter war, als sie nach außen hin zeigte.
5
Der Bote hat lange gebraucht, um sich zu beruhigen. In seinem konfusen Hirn herrschte ein einziges Stimmengewirr. Die des Kindes, die der Polizisten, die zeitweise alles übertönten. Dann das Poltern von Stiefeln und aufgeregtes Hundegebell.
Marion hat trotz der kreischenden Alarmanlage das Haus nicht verlassen. Sie hat nur durchs Fenster gesehen. Eine gute Stunde später ist ein Taxi gekommen, und eine alte Dame ist eingestiegen. Niemand hat sie zur Tür begleitet, vielleicht wohnt sie dort. Ist sie der Grund, warum Marions Stimme auf dem Anrufbeantworter sagt: »Wir sind nicht da«? Ach was, natürlich nicht. »Wir«, das sind Marion und das Kind.
Der Unbekannte, der mit kribbelnden Beinen und so schwerem Kopf, daß er ihn kaum noch halten kann, hinter der Hecke auf den Fersen hockt, ist müde. So müde. Nur der Gedanke an das Kind gibt ihm die Kraft, wieder aufzustehen.
6
Es war nach zehn, und der Bericht für Richter Ferec war beinahe fertig. Marion tippte die Überschrift ihres Schlußkapitels und hielt inne.
Die Erinnerung an das auf dem Obduktionstisch ausgestreckte Kind ließ sie nicht los. Ganze Nächte hindurch hatte sie mit Alpträumen gekämpft. Sie hatte sich geweigert, einige scheinbar eindeutige Tatsachen anzuerkennen, und sich darauf versteift zu beweisen, daß dieser Fall von Körperverletzung mit Todesfolge einem Serienmörder zuzuschreiben war, der es auf Kinder abgesehen hatte. An diesem Abend mußte sie schwarz auf weiß zu Papier bringen, daß die Person, die dem Mädchen eine Wäscheleine um den Hals gelegt und so lange daran gezogen hatte, bis der Tod eintrat, niemand anders war als seine eigene Mutter. Sie gab sich einen Ruck und schrieb weiter, so schnell es ging, um diesen Horror endlich hinter sich zu bringen. Alles tat ihr weh, und ihre Augen brannten.
Als sie endlich so weit war, den Bericht zu unterschreiben, ließ ein Geräusch sie aufhorchen. Sie hielt in ihrer Bewegung inne und spitzte die Ohren. Es war ein schwaches, unheimliches Geräusch, wie das leise Fauchen eines Tieres, das Angst oder Schmerzen hat. Es kam aus Ninas Zimmer.
Marion blieb im Türrahmen stehen. Nina lag auf dem Bauch, den Kopf zum Fenster gedreht, den zarten, schmalen Rücken unter dem hochgerutschten Schlafanzugoberteil zur Hälfte entblößt, die Beine leicht gespreizt auf der Decke. Regungslos.
Die Bilder des Mädchens, dessen Martyrium Marion gerade beschrieben hatte, schoben sich über das Bild der schlafenden Nina. Sie sah die blutbefleckten, schlammverschmierten Kleider, die tiefe Furche im Nacken, die Tüte über dem Kopf, die nackten Füße und die zum Himmel gedrehten Handflächen. Sie hörte den herabrieselnden Regen, der die Ufer des großen Tümpels überschwemmte, roch den Schlamm, die Erde und die vermoderten Blätter. Ein namenloses Entsetzen raubte ihr den Atem, und sie öffnete den Mund, um wieder Luft zu bekommen, aufzuschreien. Doch aus dem rosa-weißen Kopfkissen drang jetzt ein tränenerstickter, kummervoller Seufzer, wie das Maunzen eines verlorenen Kätzchens. Ninas Rücken bebte. Das Bild der kleinen Toten verblaßte, und der warme Körper ihrer Tochter nahm wieder seinen Platz in dem Zimmer ein, das nach Lavendelseife roch und nach dem Leder der neuen Schultasche, die Lisette ihr zum Schulanfang geschenkt hatte. Wieder ein leises Schluchzen, ein Schnüffeln, erstickt im feuchten Kopfkissenbezug. Nina weinte.
Lautlos ging Marion um das Bett herum und mußte sich dabei ihren Weg durch die auf dem Boden verstreuten Spielsachen und Bücher bahnen. Sie hockte sich neben dem Kopf ihrer Tochter nieder und strich vorsichtig die blonden Strähnen zurück, hinter denen Nina ihre Tränen verbarg. Dann begann sie, zusammenhangslos daherzureden, sagte Worte, die eher dem, der sie ausspricht, Erleichterung bringen, als den zu beruhigen, an den sie gerichtet sind. Marion glaubte, daß Nina traurig war wegen dieses unausgefüllten Sonntags und wegen ihrer Mutter, die der eigenen Tochter ein Gerichtsverfahren vorgezogen hatte. Sie dachte, daß die Fotos des toten Mädchens Nina schockiert hatten und daß sie einen Alptraum gehabt hatte. Sie sagte, es sei alles ihre Schuld, und schwor, sich zu bessern. Doch es war verlorene Liebesmühe, das Schluchzen wurde nur heftiger. Marion fuhr fort in ihrem Monolog, bat um Verzeihung, wollte mehr über diesen unendlichen Kummer wissen.
Ninas Aufschrei ließ sie erstarren:
»Ich will Mama, ich will meine Mama!«
Nina war an dem Tag, an dem ihre Eltern beerdigt wurden, in Marions Leben getreten. Das traurige Ereignis hatte die junge Frau schlagartig dreißig Jahre zurückversetzt, und sie sah sich selbst vor einem anderen Sarg stehen, der düster war und unendlich groß, von einer blauweißroten Fahne bedeckt und umringt von einer Schar graugekleideter Herren, die von einem Helden sprachen und von einer Waise.
An jenem Morgen, auf einem Friedhof im Norden Frankreichs, hatte Marion beschlossen, Nina zu adoptieren. Die Adoption sollte nicht die Erinnerung an ihre Eltern auslöschen, im Gegenteil. Marion erzählte ihr häufig von ihnen, besonders von ihrem Vater, dessen Vorgesetzte sie gewesen war. Die fast gleichgültig wirkende Gelassenheit, die Nina jedes Mal, wenn von ihren Eltern die Rede war, an den Tag legte, hatte etwas Überraschendes, aber Marion mußte zugeben, daß sie darüber nicht unglücklich war.
An diesem Abend war die Realität aus irgendeinem Grund über Nina hereingebrochen. Sie, die von sich aus beschlossen hatte, Marion »Mama« zu nennen, verlangte nun voller Verzweiflung die ihre zurück. Hilflos wartete Marion darauf, daß sie all ihren Kummer aus sich herausgeweint hätte. Sie begnügte sich damit, sich neben ihre Tochter zu legen, sich an sie zu schmiegen, sie in den Arm zu nehmen und zu wiegen, in der Hoffnung, daß sie die Kraft ihrer Liebe spüren könnte. Tatsächlich kam Nina allmählich wieder zur Ruhe. Dann zerriß ihre hohe, noch tränenerfüllte Stimme die Stille:
»Ich weiß, daß meine Mama gestorben ist. Aber ich erinnere mich nicht richtig an sie. Warum weiß ich denn nicht mehr, wie sie war, Marion?«
Marion schnürte es die Kehle zu, während sie sich alle Mühe gab, ihre Angst zu verbergen.
»Das ist normal, mein Engel, du warst noch so klein.«
»Warum ist sie gestorben?«
Es war das erste Mal, daß Nina diese Frage so klar stellte. Marion, die darauf nicht gefaßt war, fragte sich, ob dies der richtige Zeitpunkt war, Nina von der Ermordung ihrer Eltern zu erzählen.
»Deine Eltern hatten einen Unfall«, sagte sie ausweichend, »und derjenige, der dafür verantwortlich war, ist auch gestorben.«
Wieder wurde es still, eine Stille so leicht wie Marions Atem im Haar der Kleinen, die mit dieser Antwort zufrieden schien.
Sie zog die Nase hoch und nahm die Hand ihrer Mutter, um sie mit aller Kraft zu drücken und an ihr Gesicht zu halten, so als wolle sie sich vor einer Gefahr schützen.
»Du bist jetzt meine Mama.«
»Ja, Nina, das bin ich. Aber deine richtige Mama darfst du nicht vergessen.«
»Ich werde sie aber doch nie wiedersehen … Warum darf ich sie dann nicht vergessen?«
»Du mußt dich an sie erinnern. Sie hat dich geliebt, sie hat euch alle drei geliebt, und dein Papa auch.«
»Wo sind sie jetzt?«
»Auf dem Friedhof, in Lille.«
»Ach ja, ich weiß wieder! Sie waren in den Särgen?«
»Ja, mein Schatz.«
»Dann sind sie immer noch da, oder? Können wir zu ihrem Grab fahren?«
»Ich werde mit dir hinfahren.«
»Mit Angèle und Louis?«
»Mit Angèle und Louis.«
Nina schwieg. Plötzlich zuckte sie und mußte laut schlucken. Da war noch etwas, das ihr auf dem Herzen lag.
»Ich will nicht, daß Omi mitkommt. Sie ist nicht nett.«
»Warum sagst du das? Hat sie dir irgend etwas getan?«
»Sie sagt, daß du nicht meine richtige Mutter bist und daß es nicht normal ist, daß ich dich Mama nenne. Ich habe geantwortet, daß du meine Mutter bist, weil die andere tot ist. Die Omi kapiert überhaupt nichts.«
»Hör mal zu, Liebes, so etwas darfst du nicht sagen. Du mußt auch versuchen, sie zu verstehen. Deine Mama war ihre Tochter, und sie ist traurig wegen Louis und Angèle, die so weit weg sind.«
»Könnten sie nicht bei uns wohnen?«
Marion vermied es, nein zu sagen, um Ninas Nöte nicht noch zu vergrößern. Aber ja sagte sie auch nicht. Nina plus zwei Jugendliche, und dann auch noch …
»O Gott …« murmelte sie.
An diesem Abend ging wirklich alles schief. Die Situation begann ihr über den Kopf zu wachsen, und es war höchste Zeit, daß sie einmal ein ernstes Wörtchen mit Lisette sprach. Während sie noch nach einer Antwort suchte, die die Kleine zufriedenstellen würde, ohne ihr allzu viel zu versprechen, bemerkte sie mit einem Mal ihren ruhigen, regelmäßigen Atem. Nina war eingeschlafen wie ein Stein, der in die Tiefen des Wassers sinkt.
Den Kopf auf die Hände gestützt, wußte Marion nicht, ob sie sich einen dieser lauten, befreienden Weinkrämpfe gestatten sollte, bei denen mit den Tränen für einen Moment auch der Streß fortgespült wird, oder ob sie lieber eine Schlaftablette nehmen sollte, um wenigstens für ein paar Stunden die düsteren Wolken zu vergessen, die am Horizont aufzogen. Sie war in ihr Arbeitszimmer zurückgegangen und starrte auf die Fotos der kleinen Zoé. Ihr Bauch fühlte sich so an, als drückte jemand mit einer schweren Stange darauf. Vorsichtig massierte sie ihre angespannten Bauchmuskeln und versuchte, nicht an die umwälzenden Veränderungen zu denken, die sich hier, unter ihren Fingern, anbahnten. Wie sollte sie das alles nur schaffen? Wie sollte sie dieses Leben weiterführen, mit Nina und einem Baby?
Konnte sie Kinder großziehen, während sie ständig von den Bildern anderer Kinder heimgesucht wurde, mit deren gepeinigten, massakrierten, vergewaltigten Körpern sie täglich in Berührung kam?
An diesem Abend wußte sie mit Gewißheit, daß sie sich, wenn sie Kriminalkommissarin bliebe, nur eine Zukunft für ihre Kinder würde vorstellen können: eine üble Begegnung mit einem Mörder, einem nichtswürdigen Pfarrer oder einem pädophilen Lehrer. Das war unerträglich. Sie hatte Nina auf den ersten Blick geliebt, hatte sie zur Tochter haben wollen, ohne auch nur eine Sekunde zu zweifeln oder zu zögern. Doch eine Mutter zu sein, die letztlich an der Menschheit verzweifelte, hieße, sich selbst und vor allem ihren Kindern ein Leben zu bieten ohne Lachen und ohne Träume. Das war Betrug.
Sie richtete sich wieder auf, verblüfft, wie offensichtlich das alles war.
Marion hatte ihren Bericht auf Diskette gespeichert, um ihn am nächsten Morgen im Büro auszudrucken, und ihren Computer ausgeschaltet. Hektisch wühlte sie in ihrer Aktentasche und zog ein paar Blätter daraus hervor: eine Liste der freien Stellen, die die Direktion der Polizeiverwaltung allen Kommissaren, unabhängig von Herkunft und Dienstgrad, anbot. Sie überflog rasch die ersten Seiten, ohne allzu genau hinzusehen: die Kripo, das war nichts mehr für sie. Genausowenig wie die Grenzpolizei … Zuviel Außendienst, zuviel körperlicher Einsatz. Auf der vorletzten Seite, gleich vor dem Spionageabwehrdienst, fand sie, was sie suchte: den polizeilichen Staatsschutz.
Ja, genau, der Staatsschutz. Großartig … Mal sehen, murmelte sie. Lyon … Nein, das ist zu nah. Weg von hier, alle Verbindungen müssen gekappt werden, ein Bein, das brandig geworden ist, legt man nicht in Gips. Marseille? Nein. Bordeaux, Toulouse … Hier, Versailles.
Sie ließ ihre Gedanken schweifen, versuchte, sich das Schloß vorzustellen (das sie bislang nur auf Fotos gesehen hatte), seine Gärten und Springbrunnen … Nina auf einem Pferd, während der Kleine glucksend unter einem Rasensprenger umherhüpfte. Sie sah sich in einer hellen Wohnung mit Zierleisten und Stuck, großen französischen Fenstern und einem Kamin bäuchlings vor dem prasselnden Feuer liegen, ein Buch in der Hand. Kein Krimi, bloß nicht, eher ein Liebesroman oder ein historischer Roman. Bei der Vorstellung, einen geruhsamen Posten zu haben, auf dem sie vor bösen Überraschungen gefeit wäre, umspielte ein Lächeln ihren Mund. Alles in ihrem Leben wäre geplant und organisiert. Sie würde ruhige Abende mit Nina verbringen, zwischen einer politischen Kundgebung und einer Versammlung streikender Brummifahrer. Sie würde Berichte über die einschlägigen Kreise von Versailles und Umgebung verfassen und irgendwann, auch wenn es dauern würde, bestimmt in der Lage sein, Perspektiven zu entwickeln, die nicht mehr nur vom Anblick entstellter Körper geprägt waren. Eigentlich ein ganz normales Leben, das ihr die Möglichkeit geben würde, sie über den fehlenden Mann an ihrer Seite hinwegzutrösten. Es sei denn, sie würde am Ende doch noch einen aufgabeln, schließlich hätte sie ja mehr Freizeit. Einen leitenden Angestellten oder einen Lehrer. Jemand Solides, dessen Vergangenheit und dessen Bekanntschaften man nicht zu fürchten brauchte. Er würde die Vaterschaft für die Kinder übernehmen, und sie würde ihm Kräutertees kochen.
Sie schaltete ihren Computer wieder ein und begann, ohne länger über dieses ungewohnte Traumleben nachzudenken und damit einen Meinungsumschwung zu riskieren, ihren Versetzungsantrag zu tippen.
Hiermit möchte ich Ihnen mitteilen, daß ich mich um die Stelle des stellvertretenden Direktors des polizeilichen Staatsschutzes im Departement Yvelines bewerbe. Et cetera. Schnell noch mal durchgelesen, es bleibt dabei, Unterschrift …
Als sie wieder aufblickte, hatte sich die Stange, die ihr die Eingeweide zusammendrückte, wie von Zauberhand aufgelöst. Zwischen Versailler Parkett und Kindergelächter. Dem Gelächter ihrer Kinder. Sie ließ ihren Blick durchs Zimmer schweifen und war froh, daß sie all die aufeinandergestapelten Kartons noch nicht ausgepackt hatte. In Wirklichkeit wußte sie sehr genau, was sich darin befand: zehn Jahre Polizeidienst mit all seinen Erinnerungen, Beutestücken und Geschenken, all dem Tand und den wertlosen Kleinigkeiten, die das Dasein eines Polizisten begleiten und die stets gewissenhaft aufbewahrt werden wie lächerliche Trophäen. Diese Kartons aufzumachen hieße die Büchse der Pandora zu öffnen, die Toten aufzuwecken. Sie würde sie so, wie sie waren, mitnehmen und in einem anderen Arbeitszimmer, das gar kein richtiges Arbeitszimmer mehr wäre, übereinanderstapeln. In einer großen Wohnung. Nein, einem Haus, das wäre besser für die Kinder: ein kleines Häuschen aus hellem Sandstein, mit türkisfarbenem Keramikfries um die Fenster, marineblauen Fensterläden, einem Dreirad im winzigen Hof …
Zum zweiten Mal an diesem Abend schrillte die Alarmanlage ihres Dienstwagens. Während sich ihr Magen wieder zusammenkrampfte, lauschte sie auf das gellende, synkopische Geräusch und trat ans Fenster. Im Garten nebenan nahm das Abendessen der Nachbarn kein Ende. Sie konnte sie nicht sehen, hörte aber den gedämpften Klang ihrer Stimmen. Ein Mann schrie:
»Ruhe, du Scheißkarre!«
Den Rest verstand sie nicht, schnappte nur noch das Wörtchen »Polente« auf und vermutete, daß sie der Gegenstand des sich erhebenden Gelächters war.
Von ihrem Fenster im ersten Stock aus nahm sie rasch die menschenleere Umgebung in Augenschein, und sie wollte es gerade wieder schließen, um über die Techniker herzuziehen, die es nicht schafften, diese Alarmanlage ein für alle Mal richtig einzustellen, als ihr plötzlich so war, als hätte sich an der Zypressenhecke etwas bewegt.
»Ist da jemand?« fragte sie mit gedämpfter Stimme, um Nina nicht zu wecken.
Ein leichter Wind war aufgekommen, und sein Rauschen in den drei Birken auf dem Rasen war die einzige Antwort, die sie erhielt. Aber im Garten war jemand, da war sie sich sicher.
Sie holte ihre RMR 73 aus der Schublade, in der sie sie eingeschlossen hatte, vergewisserte sich, daß das Magazin voll war, und schob die Waffe hinter den Gürtel ihrer Jeans. Sie zog ihre Nikes an, die sie nicht mehr benutzte, seit sie mit dem morgendlichen Jogging aufgehört hatte, und ging ins Erdgeschoß hinunter. Von der Terrassentür im Wohnzimmer aus starrte sie, ohne Licht zu machen, angespannt nach draußen. Sie sah nichts, kam aber nicht umhin, den zweifachen Alarm ihres Wagens und die anonymen Anrufe miteinander in Zusammenhang zu bringen. Und da sie nicht mehr an Zufälle glaubte, bedeutete das für sie: Achtung, Gefahr …
Die Alarmanlage war nach den vorgeschriebenen dreißig Sekunden wieder verstummt.
Marion trat ins Freie, ohne sich zu verstecken oder besondere Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, sie legte nur die Hand auf den Kolben ihres Revolvers. Mit geübtem Blick suchte sie die Umgebung ab, überprüfte die Schlösser und Türen ihres Autos, die Hecke und die Straße, die wie ausgestorben war.
Während sie langsam wieder umkehrte, stieg ihr der durchdringende Geruch nach gegrillten Würstchen und Zwiebeln, der in der Luft hing, in die Nase. Da war niemand. Und dennoch hatte sie ein so sonderbares Gefühl, daß sie wie angewurzelt stehenblieb. Da war niemand, aber es war jemand dagewesen. Etwas Ungewöhnliches spielte sich hier ab, dessen war sie gewiß, etwas gänzlich Unnormales, das ihr bisher entgangen war und das dennoch vonstatten ging, hier, in unmittelbarer Nähe. Lange blieb sie so stehen, die Nase wie ein Jagdhund schnuppernd in der Luft, fröstelnd im Wind, der sanft über ihre Haut strich. Als sie sich schließlich entschloß, wieder ins Haus zu gehen, sah sie das Paket. Auf dem grünen Briefkasten, der scheußlich war und unsinnig groß. Sie näherte sich und untersuchte es, ohne es zu berühren. Es war von unbestimmter Form, eingewickelt in grobes Packpapier, einfach so, ohne Klebeband, ohne Mitteilung; es machte stutzig, ohne wirklich besorgniserregend zu sein. Sie rief sich einige Grundregeln in Erinnerung, die sie in ihrem Beruf gelernt hatte: niemals ein verdächtiges Paket berühren, das ebensogut das Präsent eines schüchternen Verehrers wie die tödliche Rache eines Verurteilten sein konnte. Seit die Polizei erneut massiv gegen Terroranschläge mobil machte, gab es auch wieder häufiger Bombenalarm; Marion war zwar noch nie selbst ins Visier geraten, doch andere hatten durchaus schon Briefbomben oder Sprengstoffpakete bekommen. Sie wußte, was sie in solch einem Fall zu tun hatte: den Minenräumdienst rufen, sich auf die Spezialisten verlassen. Und sich zum Gespött der Leute machen, wenn es sich – was ja ein Glück wäre – nur um einen geschmacklosen Scherz handelte. Dann streifte sie der Gedanke, daß ihr womöglich der Schlächter der jungen Frau vom Friedhof das fehlende Puzzleteil geschickt hatte: den Kopf des Opfers. Aber dafür war das Paket viel zu klein, und während sie es weiter betrachtete, konnte sie sich einfach nicht vorstellen, daß eine Gefahr davon ausging.
So nahm sie es schließlich an sich – obwohl sie genau wußte, daß das eine Dummheit war – und wickelte es rasch auf. Es dauerte einige Sekunden, bis sie erkannte, ja wiedererkannte, was sie in den Händen hielt. Das erste, was sie sah, war die Asservatenkarte mit dem Wachssiegel darauf, die an einer Schnur hing, welche einen durchsichtigen Plastikbeutel verschloß. Auf dem beigefarbenen Kärtchen standen Talons Name und Unterschrift. In dem Beutel weder ein Kopf noch eine Bombe mit Zeitzünder. Nur ein kleines Paar Kinderschuhe. Bezaubernde kleine rote Schuhe.
Im Schneidersitz auf dem Bett kauernd, betrachtete Marion ungläubig, was ihr ein Unbekannter vor die Haustür gelegt hatte. Nun wußte sie, daß die Alarmanlage nicht ohne Grund zweimal losgegangen war. Jemand hatte bewußt dafür gesorgt, daß sie ansprang. Wenn sie sich versteckt und gewartet hätte, hätte sie vielleicht den Boten sehen können, wie er sich durch die Rue des Mésanges davonschlich. Doch die kleinen Schuhe hatten sie in viel zu große Verwirrung gestürzt. Sie starrte darauf, als würden sie jeden Moment zu sprechen beginnen.
Es waren fast neue purpurrot schimmernde Lackschuhe, elegant geschnitten und mit leuchtend roten Satinschleifen verziert. Die mit gleichmäßigen Stichen vernähten Ledersohlen hatten kaum ein paar Kratzer. Innen, auf dem feinen cremefarbenen Ziegenleder, prangte in altmodischen Lettern der Name des Schuhfabrikanten: Pierre Ducas, Place des Célestins, Lyon. Von den Füßen, die diese Schuhe getragen hatten, war nur ein zarter, kaum sichtbarer Abdruck zurückgeblieben. Es waren Mädchenschuhe, Größe 26.
Die Erinnerungen, die an diese beiden niedlichen Accessoires geknüpft waren, brachen wie eine Sturzwelle über Marion herein. Trotz der Zeit, die seitdem vergangen war, waren alle Gefühle wieder da, unverändert, mit derselben Heftigkeit. Der Schleier, der sich im Lauf der Jahre darübergelegt hatte, war zerrissen und hatte die Bilder, die Ängste, die Empörung wieder freigegebem. Marion blätterte in ihrer Erinnerung wie in einem vertrauten Buch, das lange Zeit im Regal gestanden hatte, erschrocken über die Genauigkeit dessen, was sie nun noch einmal durchlebte.
Sie brach in Tränen aus.
7
Montag
Marion setzte Nina um acht Uhr bei den Lavots ab. Die Kleine war aufgestanden, ohne zu protestieren, und der nächtliche Kummer schien keinerlei Spuren hinterlassen zu haben. Als sie das Kind Mathilde Lavot übergab, der an jedem Hosenbein ein braunhaariger Wildfang hing – ihre beiden drei- und sechsjährigen Kinder, die sie in Lateinamerika adoptiert hatte –, trauerte sie schon im voraus den Stunden nach, die sie ohne Nina verbringen würde. Doch als sie wenig später neben Lieutenant Lavot hinter dem Steuer ihres Wagens saß, wich das Bedauern rasch einem regelrechten Glücksgefühl. Mit diesem Widerspruch mußte sie tagtäglich zurechtkommen.
Capitaine Lavot setzte sich, ganz der Möchtegern-Playboy, seine Ray-Ban auf die Nase, ohne Marion dabei aus den Augen zu lassen. Er war noch im Vollbesitz seiner Sommerbräune, die er sich mit Hilfe einer hocheffektiven Höhensonne bis Weihnachten erhalten würde, aber die gehaltvollen Speisen – mexikanische Tacos, brasilianische Feijoadas und andere fett- und stärkehaltige Köstlichkeiten –, die ihm seine Mathilde zubereitete und auf die er ganz versessen war, schlugen sich bereits in einem Bäuchlein nieder, das immer sichtbarer über den Gürtel seiner Jeans schwappte.
»Was glotzen Sie mich so an?« fragte Marion barsch.
»In atemloser Bewunderung erstarrt …«
Sie zuckte die Schultern und brachte den Wagen dicht hinter einem Geländewagen so abrupt zum Stehen, daß ihr Beifahrer sich an den Griff über seiner Tür klammerte.
»Schlechte Laune, Chef?«
»Wie immer um diese Uhrzeit, das müßten Sie doch inzwischen wissen … Ich glaube, heute ist es allerdings noch schlimmer als sonst!«
»Warum?«
Marion hatte nicht die geringste Lust, Lavot ihr Herz auszuschütten, auch wenn er ohnehin schon eine Menge über sie wußte. Morgens war sie einfach grantig, besonders montags und ganz besonders an diesem Montag. Sie hatte zwei Stunden geschlafen, unruhig, mit wirren Träumen. Sie konnte nicht länger so tun, als wäre nichts. Sie mußte sich entscheiden: das Kind behalten oder abtreiben, zum Gynäkologen gehen oder … Jedenfalls irgend etwas tun. Als sie mit Migräne und einem Gefühl der Übelkeit aufgewacht war, hatte sie sich erst gefragt, was die roten Kinderschuhe auf ihrer Decke machten, bis ihr plötzlich alles wieder eingefallen war. Dann hatte Nina die Milch überkochen lassen, ihre Kakaoschale zerdeppert, genörgelt, weil es kein Nesquick mehr gab, ihr Brot wiederhaben wollen, das sie, wie sollte es anders sein, mit der Marmeladenseite nach unten hatte fallen lassen … Und zum krönenden Abschluß hatte sie selbst, wie jeden Morgen, ihren Kaffee erbrochen. Aber all das war vollkommen uninteressant für Lavot, der nichtsdestotrotz mit dem ihm eigenen Feingefühl nachhakte:
»Die Kleine hat mir gesagt, daß Sie sich ständig übergeben. Wenn ich nicht alles über Sie wüßte, könnte ich denken, Sie sind …«
»Erbarmen!« rief Marion aus. »Können wir über was anderes reden? Weil, wirklich, allein der Gedanke …«
»Sehen Sie …«
Lavot behielt sie weiter im Auge, wobei er weitaus lockerer tat, als ihm in Wirklichkeit zumute war. Er war ein treuer Weggefährte und hätte sich für Marion in Stücke schneiden lassen. Im übrigen war er ein Mann von Charakter, der niemals log, höchstens notgedrungen oder aus Mitgefühl, etwa wenn es um sein Liebesleben ging. Marion war schon fast so weit, ihm die Wahrheit zu sagen, als eine plötzliche Hitzewallung sie zwang, erst einmal das Fenster herunterzukurbeln. Der Lärm des stockenden Verkehrs mit seinen Hupkonzerten drang in den Wagen.
»Heh, was soll das!« schrie Lavot auf. »Es ist saukalt! Wissen Sie, daß es heute morgen gefroren hat?«
Marion lachte ihn aus.
»Bei wieviel Grad friert es denn in Ihrem Stadtteil? Bei zehn Grad über Null?«
Aus dem Radio knatterte eine abgehackte Nachricht. Eine ferne Stimme fragte nach dem Standort einer Polizeistreife. Entnervt stellte Marion das Gerät ab.
»Ich frage mich wirklich, was mit Ihnen los ist!« empörte sich der Polizeibeamte. »Sie sind total zimperlich geworden, und mit Ihren Launen ist es schlimmer als je zuvor. An der Front kämpfen wir auch nicht mehr, das letzte Mal, daß es richtig zur Sache ging, ist schon Monate her …«
»Ich bin alleinerziehende Mutter«, verteidigte sich Marion.
»Tja, und ich finde eben, das paßt nicht zu Ihnen. Mir waren Sie vorher lieber. Und das hier jetzt kapier ich erst recht nicht!«
»Was?«
»Daß wir wie zwei Idioten im Stau stehen bleiben!«
8
Fünf Minuten später traf der Wagen alles andere als unbemerkt auf dem Hof des Polizeigebäudes ein, nachdem er einen guten Kilometer auf dem Bürgersteig zurückgelegt hatte, einem halben Dutzend Bussen sowie einem Mülltransporter mit knapper Not ausgewichen war und unzählige Passanten in panische Angst versetzt hatte. Das ganze untermalt vom fröhlichen Heulen des Martinshorns und dem Kreischen der mißhandelten Gangschaltung. Marion hatte wieder ein bißchen Farbe bekommen, und Lavot frohlockte, obwohl er halb taub und schweißgebadet war. Der Haltegriff über dem Fenster hatte seiner Umklammerung nicht standgehalten und sich aus der Verankerung gelöst. Lavot hielt ihn Marion hin:
»In meinem Horoskop war von einer Glanzleistung die Rede … Die halten nichts mehr aus, diese Karren!«
«Made in France! Ich geh hoch zum Chef …«
Sie durfte jetzt nicht mehr warten, sich keine Chance geben, doch noch zu kneifen. Bloß nicht den »Jungs« begegnen, lieber gar nicht erst den Aufzug nehmen.
Während Lavot einen Abstecher machte, um den Schließern vom Gewahrsamsdienst hallo zu sagen und nachzusehen, wie voll es in den Zellen war, erklomm Marion im Laufschritt die fünf Stockwerke. Das Sekretariat war leer; Paul Quercy saß gewiß schon in seinem Büro, aber sie war ohnehin nicht darauf erpicht, ihn zu sehen. Einmal kurz den Stempel unten auf ihren Versetzungsantrag gedrückt, und schon landete das Papier in dem Fach, aus dem der Kripochef es in ein paar Minuten herausfischen würde. Er selbst, ohne daß andere ihr erst noch lästige Fragen zu ihrer Entscheidung stellen könnten. Sie würde es ihm erklären, er würde sie verstehen.
Den Jungs würde es schwerer fallen.
9
Ein Stockwerk tiefer waren alle schon da – alle, bis auf diejenigen, die morgens nicht so recht aus den Federn kamen, dafür aber nachmittags als erste zu gähnen begannen. Richtige Arbeitstiere, die ihren Beruf liebten, wurden immer seltener. Marion war noch eins, und sie wußte genau, daß ihr Versetzungsantrag niemals bis in die fünfte Etage gelangt wäre, wenn sie erst im vierten Stock hereingeschaut hätte.
Die erste Stunde nach Dienstantritt war der Moment, den Marion am meisten genoß. Wenn die frische, nach Eau de Toilette duftende Truppe den unrasierten Nachteulen begegnet, die sich mit blau schimmernden Wangen und nikotingelben Fingern auf den Heimweg machen. Ihr Parfum ist der Geruch nach Tabak, nach schmutzigen Gewahrsamszellen und manchmal nach Alkohol. Der Geruch der Nacht, der Spielhöllen, der Puffs. Die Düfte vermischen sich, während die Kaffeemaschine dampfenden, bitteren Espresso ausspuckt. Man liest zerknitterte Zeitungen, L’Equipe oder die Regionalpresse, in der bisweilen ein Fall, der die Dienststelle beschäftigt hat, Schlagzeilen macht.
Auch dieser Montagmorgen bildete keine Ausnahme – bis auf den unangenehmen Geruch nach Lösungsmittel, der in den Räumen hing, seit man die Büros gestrichen hatte, ein Wunder, das auf Paul Quercys Konto ging. Marion konnte diese Mischung nicht ertragen und stürzte in ihr Büro, ohne irgend jemanden zu begrüßen, aus Angst, demjenigen auf die Schuhe zu spucken.
Ein Beamter mit langen Haaren in einer braunen Drillichhose, der einen rotgesichtigen Typen in Handschellen vor sich herschob, sah sie mit angelegten Ellbogen vorbeihasten. Verärgert brummelte er ihr ein »Tag, Chef« hinterher.
»Hat die ihr Frauendings, oder was?« meinte er grinsend zu Talon, der gerade vorbeikam.
Der Beamte verzog keine Miene.
Der andere fragte weiter:
»Was mache ich mit dem Dressman hier?«
Er deutete auf seinen schwankenden Begleiter.
»Du bringst ihn zum Duschen und genehmigst dir auch gleich eine, wenn du weißt, was ich meine.«
Talon hielt sich ostentativ die Nase zu, ehe er mit stoischer Miene an Marions Tür klopfte, taub für den langhaarigen Capitaine, der ihn als »Arschloch« und »Schleimer« bezeichnete. Er trat ein, ohne auf eine Antwort zu warten. Marion versuchte gerade vor dem weit geöffneten Fenster den Aufruhr in ihren Eingeweiden niederzukämpfen.
»Tag, Chef. Bericht.«
Langsam beruhigte sich Marions Magen, und sie konnte das Fenster schließen. Sie drehte sich um.
»Hauptversammlung, in einer Viertelstunde«, sagte sie, ohne Talon anzusehen.
Sie hatte sich entschieden, eben im Auto. Wegen Lavot und seines Verdachts, den die anderen natürlich ebenfalls hegten; daran hatte sie nicht den leisesten Zweifel.
Talon spürte, daß ihnen eine böse Überraschung bevorstand, und setzte schnellstens seine grauen Zellen in Bewegung.
»Warten wir nicht die Besprechung mit dem Chef ab?«
»Nein. Ich habe eben eine Nachricht auf meinem Schreibtisch gefunden: Heute gibt’s keine Besprechung, Quercy ist in Paris.«
Marion sah Talon aus den Augenwinkeln an, während sie auf der Suche nach der Diskette mit dem Zoé-Brenner-Bericht in ihrer Tasche wühlte.
»Hier«, sagte sie, und warf die viereckige Plastikhülse auf den Schreibtisch, »drucken Sie das aus und lassen Sie es noch heute vormittag Richter Férec zukommen.«
»Aber …«
»Und daß mir bloß nicht noch jemand damit ankommt.«
»Gut. Was den Friedhof-Fall betrifft …«
Marion seufzte absichtlich laut, um Talon, der gerade ausholen wollte, zu stoppen. Er tat gleichgültig, doch sie sah, daß er innerlich brodelte wie ein Milchtopf, der jede Sekunde überkocht. Sie erinnerte sich noch, wie sie ihn das erste Mal gesehen hatte. Hier, oder vielleicht auch im Rauschgiftdezernat eine Etage tiefer. Er war ein junger, eifriger Polizeibeamter gewesen, gepflegt, ja fast übertrieben herausgeputzt. Er hatte gerade eine Fortbildung im Ausbildungszentrum des FBI in Quantico hinter sich – in den States, wie er damals sagte – und glaubte felsenfest an die Überlegenheit der amerikanischen Methoden. Vier Monate jenseits des Ozeans hatten ihn vergessen lassen, daß es auch in Frankreich – im Vergleich zu Amerika natürlich nur ein Häufchen Fliegendreck – manchmal hoch hergehen konnte. Marion war seine Homosexualität, die er mit großer Mühe hinter einem tadellosen, distanzierten Auftreten verbarg, nicht entgangen. Heute war sein Haar länger, ungepflegter, und seine Wangen wiesen suspekte Spuren auf, die darauf hindeuteten, daß es mit dem Rasieren wohl etwas schneller gegangen war. Sein Hemd – wie immer pastellfarben – war zerknittert, seine Markenbrille voller Fettflecken, und seine Schuhe waren seit langem nicht mehr mit Schuhcreme in Berührung gekommen. Nach vier Jahren bei der Kripo – vielleicht waren es auch fünf – sah Talon genauso aus wie die anderen. Man hätte meinen können, daß die Polizei nicht in der Lage war, mehr als ein Beamtenmodell hervorzubringen, einen Prototypen, der sich nur ganz allmählich weiterentwickelte.
Der Lieutenant versuchte es ein zweites Mal:
»Der Zeuge, das ist der Typ, den Sie draußen im Gang gesehen haben. Ein Penner, der in der Rue des Haies in einer Art besetztem Haus lebt … Seit gestern abend wird er ausgenüchtert. Der ist jetzt reif fürs Verhör.«
Er hielt für einen Augenblick inne, so als versuchte er, sich an etwas zu erinnern.
»Ach ja, das hatte ich vergessen: Der Doc möchte, daß Sie zu ihm kommen. Er hat den Körper wieder zusammengesetzt und will, daß Sie ihn sich mal ansehen.«
»O Gott!«
Marion wurde wieder übel. Sie polterte los:
»Jetzt hören Sie endlich auf, von Ihren Fleischstücken zu reden, verdammt noch mal! Ich habe Ihnen doch gesagt, daß ich mich einen Dreck darum schere. Das ekelt mich an, ich will nichts mehr davon hören! So! Sind Sie jetzt zufrieden?«
Talon sammelte seine Unterlagen ein, nahm die Diskette an sich und stand gemächlich auf. Er brauchte diese Sekunden, um schließlich in unpersönlichem, professionellem Ton sagen zu können:
»Hauptversammlung, das heißt …«
»Alle, Talon, die ganze Abteilung, ich meine, alle, die da sind.«
»Darf ich erfahren …?«
»Sie werden es gleich erfahren, zusammen mit den anderen.«
Draußen prallte Talon mit Lavot zusammen, und es kam ihm so vor, als hätte der Capitaine an der Tür gelauscht oder durchs Schlüsselloch gelugt.
In Marions Büro war jetzt eine Art Röcheln zu hören, ein lautes Hicksen, das sogleich vom Radio übertönt wurde, Europe 1, auf volle Lautstärke gedreht. Jean-Pierre Elkabach unterhielt sich mit Daniel Cohn-Bendit. Die beiden Beamten wechselten bestürzte Blicke.
»Was ist hier eigentlich los? Ich verstehe überhaupt nichts mehr«, beklagte sich Talon.
Lavot zuckte die Achseln.
»Nichts«, sagte er, »sie kotzt.«
10
Von den zwanzig Polizeibeamten, die zu Marions Abteilung gehörten, waren nicht einmal drei Viertel anwesend. Angesichts der ständigen Urlaube, Krankschreibungen und abgebummelten Überstunden entsprach das so ziemlich dem Durchschnitt. Als Paul Quercy Marion Anfang des Jahres gebeten hatte, sich zusätzlich um alle schweren pädophilen Vergehen zu kümmern, um das Kommissariat für Sexualdelikte zu entlasten, das durch die rapide Ausbreitung des Internets völlig überfordert war, hatte Marion personelle Verstärkung verlangt, einen neuen Anstrich ihrer Büros und einen Besprechungsraum, der diesen Namen verdiente. Ihre Forderungen waren erfüllt worden, wenn auch nicht ohne Widerstand. Die Beschlagnahmung des Zimmers, das bislang als Ruheraum, Küche, Bar und manchmal auch als Spielsalon für wachhabende Beamte gedient hatte, sorgte für große Verblüffung. Marion hatte gewußt, daß die leiseste Andeutung ihres Plans sofort zu heftigem Protestgeschrei und Aktionen seitens der Gewerkschaft geführt hätte. So hatte sie, die eigentlich immer Dialog und klare Absprachen predigte, die Räumlichkeiten mit Unterstützung ihrer Gefolgsleute und mit Quercys Segen in einer Nacht-und-Nebel-Aktion okkupiert und eigenhändig umgewandelt: Das Zimmer war düster und eng, aber anständig ausgerüstet, namentlich mit Audio- und Videogeräten, was auch für längere Verhöre ausgesprochen praktisch war.
Marion ging zunächst wie immer zwischen ihren Leuten, die sich von ihren aufregenden Wochenenden erzählten, auf und ab. Nur Talon und Lavot, die mit dem schlimmsten rechneten, sagten keinen Ton. Schließlich kehrte sie, die Hände auf dem Rücken verschränkt, zur Tür zurück, und die beiden Beamten sahen, daß sie ein Paket umklammert hielt. Sie drehte sich um und räusperte sich.
»Meine Herren!«
»Und was ist mit uns? Sind wir etwa aussätzig?« zischte eine junge Beamtin ihrer Nachbarin zu, dem zweiten weiblichen Mitglied der Abteilung.
»… und Damen!« fuhr Marion fort und warf der jungen Frau einen scharfen Blick zu. »Ich will Sie nicht lange aufhalten. Es gibt zwei Dinge, die ich Ihnen sagen möchte, oder besser, zwei Neuigkeiten, von denen ich Sie in Kenntnis setzen möchte.«
Endlich wurde es still, und alle Blicke richteten sich auf die zierliche Gestalt, die wie immer eine schwarze Jeans und eine weiße Hemdbluse trug, unter der man einen spitzenbesetzten cremefarbenen Büstenhalter erahnen konnte. Man musterte ihr zerzaustes Haar, das kürzer war und nicht mehr so blond wie vor dem Sommer, ihre Augen, die blitzten, weil sie gar nicht anders konnten, und die dennoch etwas von ihrem siegesgewissen Funkeln verloren hatten. Vielleicht wegen der dunklen Ringe, die zusammen mit den geschwungenen Augenbrauen zwei fast perfekte Kreise bildeten.
»Erstens: Ich bin schwanger. Ich sage Ihnen das, weil ich glaube, daß einige von Ihnen so etwas schon vermuteten, und Sie wissen ja, daß ich Gerüchte hasse.«
Die Männer gaben keinen Mucks von sich. Kein Gemurmel war zu hören, nichts, nur ein kaum hörbares Kichern aus der Ecke, wo die beiden jungen Frauen saßen. Talon verzog keine Miene, während Lavot ihm mit einem bedeutungsvollen Blick zu verstehen gab, daß seine Ahnung richtig gewesen sei.
»Zweitens«, fuhr Marion fort, ohne Luft zu holen, »ich gehe. Ich verlasse diese Abteilung.«
Dieses Mal hätten die Reaktionen kaum lebhafter sein können. Nur Lavot und Talon in der ersten Reihe waren wie erstarrt. So als hätte Marion angekündigt, daß sie ins Kloster gehen oder die Königin von England heiraten würde.
»Wohin wechseln Sie, Chef?« wagte einer der Beamten im hinteren Teil des Raumes zu fragen.
»Zum polizeilichen Staatsschutz, nach Versailles«, behauptete sie ohne den geringsten Zweifel an ihrem Vorhaben.
Wieder hagelte es ungläubige Reaktionen. Marion konnte nicht alles verstehen, aber es war nicht zu übersehen, daß das Ziel ihrer Versetzung das Meinungsbarometer wesentlich stärker ausschlagen ließ als die Ankündigung ihrer Schwangerschaft. Die Vorstellung, daß sie anderswo als bei der Kripo arbeiten könnte, schien so absurd, daß sogar jemand die Vermutung äußerte, sie habe sich eine Disziplinarstrafe eingehandelt.
»Das soll wohl ein Scherz sein, Chef«, sagte Lavot schließlich mit tonloser Stimme. »Warum haben Sie uns nichts gesagt?« Sprich: uns, Ihren treuen Gefolgsleuten, Ihren Freunden? Talon beugte sich vor.
»Was ist los? Wollen Sie nicht mehr mit uns zusammenarbeiten? Sie haben die Nase voll von uns, ist es das?«
Marion hatte den Eindruck, daß der für gewöhnlich so beherrschte Talon die Fassung verlor und daß Lavots Stimme merkwürdig bebte.
Sehr schnell wurde das Gemurmel von einer Frage beherrscht: Wer würde ihre Nachfolge antreten? So waren nun einmal die Gesetzmäßigkeiten: Kaum hast du angekündigt, daß du gehst, bist du auch schon weg, man hat dich sofort vergessen. Bloß keine Verbitterung, du hast es selbst so gewollt, dachte Marion.
»Das hat nichts mit Ihnen zu tun«, stellte sie klar, nachdem sie mit einer Handbewegung für Ruhe gesorgt hatte. »Sie sind ein tolles Team, aber ich möchte weiterhin anständige Arbeit leisten, und mit zwei kleinen Kindern wird mir einfach die innere Bereitschaft fehlen. Offen gesagt, habe ich auch Lust, ihnen ein bißchen Zeit zu widmen und … Lust auf einen Tapetenwechsel. Ich hoffe wirklich, daß Sie mich verstehen können.«
Um ihrer Rührung Herr zu werden, legte sie das Paket auf den erstbesten Tisch und packte es aus. Der Plastikbeutel mit den roten Kinderschuhen kam zum Vorschein. Sie hielt ihn über dem Kopf in die Höhe, um die Jungs, die sich noch immer mit gedämpften Stimmen über die Neuigkeit austauschten, auf sich aufmerksam zu machen.
»Bitte! Da ist noch etwas.«
Alle Blicke waren auf den Beutel über Marions Kopf gerichtet.
»Fällt Ihnen hierzu irgend etwas ein?«
Talon sah sofort die Asservatenkarte mit seinem Namen und seiner Unterschrift darauf. Er runzelte beunruhigt die Stirn und fragte sich, ob er nun über einen verpfuschten Fall ausgefragt werden würde. Durch einen Lichtreflex auf dem Plastikbeutel konnte er den Inhalt nicht sehen, und als er Marion das sagte, riß sie ihn mit einem Ruck auf. Sie zog zwei hübsche rote Schühchen daraus hervor und zeigte sie der versammelten Runde. Ein kaum hörbares Raunen ging durch die Reihen, so als zweifelte man plötzlich an Marions Verstand.
Dabei war es nur ein Versuchsballon. Vielleicht hatte ja einer der Jungs eine Idee oder einen Tip, was den Unbekannten betraf, der ihr die Schuhe vor die Tür gelegt hatte. Doch die Reaktionen ließen auf nichts dergleichen schließen.
So verließ sie rasch den Raum, dicht gefolgt von Lavot und Talon, die ihr nicht von der Seite wichen. Auch die anderen kamen nach und nach aus dem Besprechungsraum, und Marion konnte noch den einen oder anderen Kommentar aufschnappen.
»Wenn ich vorher mit Ihnen darüber geredet hätte«, erklärte sie ihren beiden Untergebenen mit einem matten Lächeln, »hätten Sie es geschafft, mich umzustimmen, ich kenne Sie doch. Ich will meine Meinung nicht ändern. Aber ich habe Sie sehr gern, das wissen Sie. Ich werde Sie nicht vergessen.«
»Ich gehe mit Ihnen«, verkündete Talon.
»Das sehen wir dann, immer mit der Ruhe.«
Als sie durch die Tür ihres Büros trat, um endlich allein zu sein, wurde das Geraune im Flur von einer klaren Stimme übertönt. Marion hörte die Frage, die allen auf der Zunge lag:
»Wer ist eigentlich der Vater?«





























