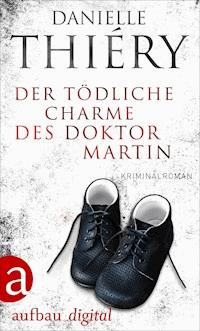Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissarin Edwige Marion
- Sprache: Deutsch
Ein Alptraum für die Kommissarin. Léo Lunis ist neu in Marions Truppe. Und er ist der Mann ihres Lebens. Doch in der Stadt geschehen schreckliche Dinge: Eine Frau wird vergewaltigt, ein Mann wird erschossen, und alle Spuren führen zu ihrem neuen Lieutenant und Liebhaber. Wieder einmal sieht die impulsive Kommissarin keinen anderen Ausweg, als auf eigene Faust zu ermitteln, und bezahlt um ein Haar mit dem Leben ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 430
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Über Danielle Thiéry
Danielle Thiéry, geboren 1947, zwei Kinder, war Kriminalkommissarin in Paris und in den siebziger Jahren die erste Frau an der Spitze eines französischen Kommissariats. 1991 findet sie endlich die Zeit zu schreiben. Seitdem hat sie eine Fernsehserie entwickelt, an mehreren Fernsehproduktionen mitgearbeitet, einen autobiographischen Roman (Prix Bourgogne 1997) und zahlreiche Krimis (Prix Polar 1998) geschrieben.
Informationen zum Buch
Ein Alptraum für die Kommissarin.
Léo Lunis ist neu in Marions Truppe. Und er ist der Mann ihres Lebens. Doch in der Stadt geschehen schreckliche Dinge: Eine Frau wird vergewaltigt, ein Mann wird erschossen, und alle Spuren führen zu ihrem neuen Lieutenant und Liebhaber. Wieder einmal sieht die impulsive Kommissarin keinen anderen Ausweg, als auf eigene Faust zu ermitteln, und bezahlt um ein Haar mit dem Leben …
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Danielle Thiéry
Die fatale Lust der Mademoiselle Julie
Roman
Aus dem Französischen von Sabine Schwenk
Inhaltsübersicht
Über Danielle Thiéry
Informationen zum Buch
Newsletter
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Impressum
Für den kleinen Prinzen …
1
Um 23 Uhr 32 stieg Julie Rouvres aus dem Bus der Linie 46. Sie schlug den Kragen ihrer roten Jacke hoch, hielt ihn unter dem Kinn zusammen und sah zum Himmel. Endlose, bleigraue Wolkenkolonnen zogen vorüber. Es hatte den ganzen Tag geregnet, jetzt war Wind aufgekommen. Nachdem sie vier Stunden lang Pizza serviert hatte, fühlte sie sich schmutzig, ihre Haare verströmten einen widerlichen Geruch nach heißem Öl, Parmesankäse und Zigarettenrauch, von dem auch ihre Kleider durchdrungen waren. Sie ging schneller, um sich noch waschen zu können, ehe Johan kommen würde, ihr Verlobter. Verlobter! Es wollte ihr selbst noch nicht so richtig in den Kopf, daß sie verlobt war. Als sie Johan kennengelernt hatte, war sie davon ausgegangen, daß er wie alle anderen nur eine kurze Episode in ihrem Leben darstellen würde. Dabei war Julie hübsch, sympathisch und intelligent – sie studierte seit drei Jahren Medizin. Aber die Männer blieben nie länger als ein paar Tage bei ihr, ein paar Wochen vielleicht, wenn sie Ausdauer hatten. Es mochte an ihrer mangelnden Leidenschaftlichkeit im Bett liegen. Sie hatte wirklich alles ausprobiert, um zum Orgasmus zu kommen, was anderen Frauen ja angeblich gelang, indem sie einfach die Beine spreizten und die Hüften im Takt dazu bewegten. Sie hatte Ärzte aufgesucht, die als kompetent in diesen Dingen galten, sogar einmal einen Allzweck-Psychologen angerufen, der im Radio sein Unwesen trieb. Alles umsonst. Nichts war passiert, außer daß die verdrießlichen Liebesspiele sie mit der Zeit regelrecht anwiderten. Daß es mit ihr und Johan nach vier Monaten immer noch funktionierte, hatte mit Sex nicht das geringste zu tun.
»Irgendwann kommt das von selbst«, versicherte ihr die beste Freundin. »Du wirst sehen. Irgendwann kommt der Typ, auf den du richtig abfährst.«
Julie wollte an all das nicht denken. Johan würde ihr Mann werden, auch wenn das Bild eines anderen manchmal in ihrem Kopf herumspukte und sie aufwühlte.
Sie beschleunigte ihren Schritt. Auf der Brücke, die über die Autobahn führte, fegte der Wind unter ihren kurzen Rock, strich kalt über ihre Schenkel.
»Die verlegen diese Bushaltestelle jedesmal ein Stück weiter nach hinten!«
Sie schimpfte, wie so oft, über die unbequemen öffentlichen Verkehrsmittel, die viel zu langsam waren, überfüllt und stickig, wenn nicht sowieso gerade gestreikt wurde. Ihr kam jener Abend vor einer Woche in den Sinn, als sie sich dank eines völlig unangebrachten Streiks der Lyoner Busfahrer im Regen auf dem Bürgersteig wiederfand. Kein Taxi weit und breit und niemand, der sie hätte heimbringen können. Doch das Schicksal hatte es gut mit ihr gemeint und einen Schutzengel vorbeigeschickt: einen Streifenwagen, dessen Fahrer ihr nicht nur einen mindestens sieben Kilometer langen Fußmarsch ersparte, sondern auch ihr Herz höherschlagen ließ.
Die Erinnerung an diese aufregende Autofahrt ließ sie zusammenzucken. Der Polizist hatte ziemlich Gas gegeben und das Funkgerät dabei unentwegt seine Meldungen ausgespuckt. Und um das Gewimmel aus Taxis und Autos zu umgehen, die sich vor der Zufahrt zur Presqu’île, der Halbinsel zwischen Saône und Rhone, drängelten, hatte der Mann schließlich das Martinshorn eingeschaltet. Mit zitternden Beinen und feuchten Händen hatte Julie auf dem Beifahrersitz gesessen, während es tief in ihrer Magengrube sonderbar kribbelte.
Als sie einen Blick über das Brückengeländer warf, stellte sie fest, daß trotz der späten Uhrzeit reger Verkehr herrschte. Ein dicker Laster, dem zwischen den Stäben des Metallgeländers ihre gehetzte Silhouette aufgefallen war, hupte wild und blendete mehrmals auf. Am Ende der Brücke mußte sie noch eine Baustelle passieren, ein großer Gebäudekomplex entstand dort, Marke sozialer Wohnungsbau, dessen Mieträume sich wohl kaum von ihren eigenen unterscheiden würden: genauso sauber, genauso banal. Die Wohnungsbaugesellschaft hatte vor, mindestens einen Hektar Baufläche zu füllen; monatelang würde man also noch an graffitiverschmierten Bretterzäunen entlanggehen, über schlammige Pfützen steigen und auf die regungslosen Schatten der großen, in der Dunkelheit kauernden Maschinen starren. Und die Zähne zusammenbeißen, um nicht hören zu müssen, wie sie vor Kälte oder Angst klapperten.
Gerade als sie die letzte Hürde nehmen wollte, die darin bestand, um den verlassenen Parkplatz des Supermarkts Atac herumzugehen und dann wieder auf die andere, beleuchtete Straßenseite zu gelangen, passierte es.
Der Mann packte sie von hinten und preßte sie an sich, sie hatte ihn nicht einmal kommen hören. Mit seinen starken Armen umklammerte er ihren schlanken Körper so fest, daß ihr die Luft wegblieb. Julie wußte, daß sie in der Falle saß und merkte, wie ihr Widerstand nachließ. Sie wäre fast ohnmächtig geworden, als sie die Lippen des Mannes an ihrem Hals spürte. Er schien sich an den fettigen Ausdünstungen ihres Körpers, dem Geruch nach Arbeit und Schweiß nicht zu stören. Der fremde Mund in ihrem Nacken biß sich in ihre zarte Haut, ein leichter, sinnlicher Biß, der sie erschauern ließ. Sie dachte kurz daran zu schreien, aber wer hätte sie gehört? Um diese Uhrzeit kam hier niemand vorbei, und angesichts der laut rauschenden Autobahn, die nur wenige Meter entfernt war, erschien jeder Versuch, sich bemerkbar zu machen, sinnlos.
Die Hände des Mannes streichelten über ihren Körper, als hätten sie noch nie einen so kostbaren Gegenstand ertastet. Sie griffen nach ihren vollen, festen Brüsten, kneteten sie mit fast mechanischen Bewegungen, die dennoch voller Leidenschaft waren. Julie spürte, wie sie taumelte, in die Knie ging, woraufhin der Mann sie noch fester an den Brüsten packte. Am liebsten hätte sie um Hilfe gerufen, die Flucht ergriffen und auf den Mann eingeschlagen, der von Sekunde zu Sekunde heftiger atmete, während sein Körper sich hinter ihrem Rücken zunehmend versteifte. Doch statt dessen war sie wie gelähmt, hatte weiche Knie und glaubte sich übergeben zu müssen. Merkwürdige Sinneseindrücke bedrängten sie und legten sich wie ein Schleier über ihre Wahrnehmung. Der Mann roch nach Tabak und verströmte zugleich einen blumigen, würzigen Duft … Sein Atem, seine Hände … Sie kannte diese Hände.
»Julie … Julie …«
Du lieber Himmel! Er flüsterte ihren Namen, er kannte ihren Namen! Und diese tiefe, männliche Stimme, so sinnlich und charmant … Sie kannte diese Stimme …
Ihr Körper reagierte, flüsterte ihr den Wunsch ein, dieser Mann möge weitermachen, möge das, was er angefangen hatte, zu Ende bringen. In der Stille der nächtlichen Baustelle spürte Julie ihr Herz schneller schlagen, hörte sich stöhnen und wimmern wie ein junger, ausgehungerter Hund. Der Mann preßte sich immer fester an sie, drang in sie ein, bog ihren Oberkörper nach vorn. Er tat dies ohne jede Gewalt, doch in seinen Gesten lag etwas unbedingt Forderndes und Drängendes. Die eine Hand löste sich von der linken Brust der jungen Frau und schob sich zwischen ihre Beine. Der rote Faltenrock der Pizzeria rutschte über ihre Hüften, Julie fühlte die frische Luft auf ihrer nackten Haut. Als der Mann ihr Geschlecht berührte, fühlte sie ihre Sinne schwinden. Das Höschen an ihren Schenkeln glitt herunter. Sie beugte sich nach vorn, stützte sich mit den Ellbogen auf ein unfertiges Mauerstück und gab sich dieser Hand ganz und gar hin, während ein überwältigendes Gefühl ihren Unterleib durchzog und ihr den Mund austrocknete. Der Mann sagte kein Wort. Er nahm sie, als gäbe es keine Alternative dazu. Zum erstenmal in ihrem Leben verlor Julie die Kontrolle über sich. Willig ließ sie den Mann gewähren und sich mitreißen von einer Welle ungeahnter Empfindungen. Als sie schließlich stöhnend nachgab, verlangsamte der Mann seinen Rhythmus, bis er fast ganz innehielt. Er zog sie an den Haaren nach hinten, ohne dabei brutal zu sein. Julie stieß einen leisen Schrei aus.
»Sag: Ich liebe dich!« befahl er ihr flüsternd.
Mit Tränen in den Augen schüttelte Julie den Kopf.
»Sag es, los, sag: Ich liebe dich!« Der Mann wurde lauter. »Sag es, dann gehe ich.«
Julies Herz tat einen Sprung, und vor ihren Augen begann es zu flimmern. Am liebsten hätte sie »Nein, geh nicht, jetzt noch nicht!« geschrien. Statt dessen hörte sie sich wie versteinert stammeln: »Ich liebe dich!«
Ihre Stimme zitterte. Eine Träne kullerte ihr über die Wange in den nervös zuckenden Mundwinkel.
Der Mann ließ sie nicht los, im Gegenteil, wieder und wieder stieß er in sie hinein und zwang ihrem Körper einen immer schnelleren, immer heftigeren Rhythmus auf, während er im gleichen Takt unaufhörlich befahl: »Sag es! Los, sag: Ich liebe dich!«
Keuchend und völlig aufgewühlt von einer bitteren Wollust, wiederholte sie, was er hören wollte. Schließlich bäumte er sich hinter ihr mit einem kurzen Stöhnen auf, dann zog er sich langsam aus ihr zurück. Mit einer Hand hielt er sie weiter fest, die andere schob er zwischen ihre Schenkel, als wollte er sie ein letztes Mal streicheln. Wie gelähmt ließ sie es geschehen und fuhr erst erschrocken zusammen, als der Mann mit seiner nassen Hand über ihr Gesicht strich und merkwürdige Zeichen darauf malte.
Dann war es vorbei. Er hatte sich von ihr gelöst, plötzlich war es kalt, der Wind fegte über ihre bloßen Hüften und ihre feuchten Schenkel. Zitternd richtete sie sich auf, wagte es jedoch nicht, sich umzudrehen. Wen würde sie entdecken? Wer verbarg sich hinter diesen Worten und Gesten? Sie schluckte und schluchzte lange, ehe sie sich ein wenig beruhigte und wieder normal atmen konnte.
Erst danach riskierte sie einen Blick über ihre Schulter, um festzustellen, daß die Straße hinter ihr leer war. Der Mann war verschwunden, still und leise wie der Wind, der über den im Bauschutt herumliegenden Müll strich. Die einzig greifbare Spur, die er hinterlassen hatte, war jene warme Flüssigkeit, die an ihren Schenkeln herablief, auf ihrem Gesicht zu trocknen begann und die sie weder zu berühren noch abzuwischen wagte.
»Hilf mir, lieber Gott!« flehte sie und blickte sich dabei hilflos, mit auf den Wangen verklebten Haarsträhnen um.
Ihre Tasche war in eine Pfütze gefallen. Sie bückte sich, um sie aufzuheben, was sie einige Kraft kostete. Sie war wie zerschlagen, ihr ganzer Körper schmerzte, als sei sie durch die Mangel gedreht worden. Da stand sie mit gespreizten Beinen am Rand der verlassenen, dunklen Baustelle und fragte sich, wie sie sich jetzt verhalten sollte. Zur Polizei gehen und Anzeige erstatten? Was würde sie dort sagen? Aus dem Studium wußte Julie sehr genau, wie eine gerichtsmedizinische Untersuchung nach einem derartigen Sexualverkehr aussah. Ein einziger Spießrutenlauf. Sie konnte die höhnischen Bemerkungen schon hören: »Ungeschützter Verkehr, Sie kennen die Folgen: Geschlechtskrankheiten, Schwangerschaft, Hepatitis, Aids.« Das kam überhaupt nicht in Frage. Wie sollte sie außerdem im Rahmen einer Strafanzeige die Lust beschreiben, die sie empfunden hatte? Und die tiefe Scham? Und wenn es ohnehin nichts zu sagen gab, warum sollte sie dann überhaupt hingehen?
Sie wollte nach Hause, sich waschen, sich bis in die letzte Pore durchscheuern, um alle Spuren dieser beschämenden Offenbarung zu beseitigen.
Der Gedanke an Johan, der vielleicht schon auf sie wartete, ließ sie erstarren. Wie konnte sie ihm das, was passiert war, erklären? Wie sollte sie ihm beichten, was sie empfunden hatte? Ein Lustgefühl, das sie mit ihm wahrscheinlich niemals erleben würde, mit ihm, der sich bestimmt nicht die Mühe machte, sie zu verstehen, sondern schnellstens die Flucht ergriffe. Julie wußte, daß sie es nicht schaffen würde, dieses Abenteuer zu verschweigen, mit ihrem Geheimnis weiterzuleben und ihre Zukunft an der Seite ihres Verlobten zu verbringen, als sei nichts geschehen. Selbst wenn sie dazu in der Lage gewesen wäre, mußte sie Johan schützen, mußte ihm verbieten, sie zu berühren, und ihm den Grund dafür sagen. Spätestens dann würde er sie mit Sicherheit verlassen.
Auf einen Schlag brach alles zusammen, ihre Pläne, ihre Zukunft, ihr ganzes Leben gingen unter wie die düsteren Umrisse der Baumaschinen vor ihren tränenverschleierten Augen.
Sie wandte der Straße und dem Licht den Rücken zu und machte sich auf den Weg, mit hängenden Schultern, unentschlossen und wie gerädert. Sie weinte lautlos, mit zusammengeschnürter, schmerzender Brust.
Mitten auf der Brücke blieb sie stehen. Unter ihr rauschte noch immer der Verkehr, ein doppeltes Lichterband, weiß und blendend auf der einen, rot auf der anderen Seite. Während sie sich am Geländer festhielt, mußte sie wider Willen an den Mann denken, und sofort zog sich ihr Unterleib zusammen.
Mit einem Finger malte sie mehrere Zeichen auf den metallenen Handlauf, ein neuer Tränenschub ließ die Lichter vor ihren Augen tanzen. Sie ritzte die Zeichen mit der Spitze des Kulis nach, den sie immer in ihrer Jackentasche trug, um jederzeit Bestellungen in der Pizzeria aufzunehmen. Schwarze Linien überzogen die rote Farbe des Geländers, von der hier und da ein paar Stückchen absplitterten und ins Leere flatterten, fortgetragen von der kühlen Brise eines Frühlings, der auf sich warten ließ. Und wie Julie sich so mitten in der Nacht an dem Geländer zu schaffen machte, wurde ihr klar, daß sie nie wieder über diese Brücke würde gehen können, ohne sich an das zu erinnern, was ihr der Mann ohne Gesicht offenbart hatte. Voller Verzweiflung gestand sie sich schließlich ein, daß sie nicht nur immer daran denken, sondern – und das war noch schlimmer – nicht mehr würde leben können, ohne auf ihn zu warten. Diese Aussicht war so unerträglich, daß sie jede Hoffnung auf eine ungetrübte Zukunft auslöschte.
Schluchzend riß sie sich die Goldkette mit dem Anhänger vom Hals, die Johan ihr zum Geburtstag geschenkt hatte, und warf sie auf die Autos, die unter ihr glücklich heimwärts strebten. Glück würde es für sie nicht mehr geben.
Blind vor Tränen und wie in Trance zog sie nacheinander ihre Schuhe und Kleider aus und ließ sie in die Tiefe fallen, wie zuvor Johans Liebesbeweis. Ihr kurzer Faltenrock schwebte einen Moment in den Abgasströmen, die die vorbeijagenden Autos erzeugten, und landete schließlich unter den Reifen eines englischen Busses, wo er sofort zerfetzt wurde und sich um die Radnabe wickelte wie ein schmutziger Lappen.
Anderthalb Sekunden später prallte Julie Rouvres nackt auf die Motorhaube eines großen Lastwagens, der nach Paris unterwegs war. Ihr Körper schlug zweimal gegen das überhitzte Metall, bevor der Laster ihn fortschleuderte. Wie eine Feder, die der Wind davonträgt. Der Flug endete auf der Leitplanke, mit gebrochenem Rückgrat.
2
Marion hastete mit ihrer Ledermappe in der Hand die Stufen des Justizpalastes hinunter. Sie war müde und verärgert. Ausnahmsweise hatte sie auf ihre übliche Arbeitskleidung – Jeans, Blouson, Paraboots – verzichtet und einen Hosenanzug aus beigefarbenem Leinen angelegt, über dem sie einen schwarzen Regenmantel trug. Seit Beginn der Woche waren die Lyoner immer wieder von unerwarteten Regenschauern überrascht worden. Zwei Stunden hatte sie vor dem Schwurgericht verbracht, wo erhitzt debattiert wurde, zwei Stunden als Zeugin einem Mordprozeß beigewohnt, bei dem die Dinge eigentlich klar auf der Hand lagen. Dennoch hatte der geschickte Verteidiger sie regelrecht auseinandergenommen, wobei ihm der miserable Vertreter des Generalstaatsanwalts unfreiwillig Schützenhilfe geleistet hatte. Das Ganze fand unter den spöttischen Blicken des Angeklagten statt, der zunächst wie ein geprügelter Hund ausgesehen und fast ihr Mitleid erregt hatte. Sie atmete tief durch und klopfte an die Scheibe des Wagens, der sie hierhergebracht hatte. Der Fahrer hatte das Funkgerät eingeschaltet und las dabei L’Equipe.
»Ich brauche ein bißchen frische Luft«, sagte sie und warf ihre Tasche auf den Rücksitz. »Holen Sie mich an der Place des Terreaux wieder ab, vor der Oper, in einer Stunde.«
Sie wollte ein Weilchen umherschlendern, bummeln, einfach mal eine Stunde blaumachen. Langsam durch die belebten Straßen der Innenstadt flanieren, die Stadt spüren, ihr Rauschen, ihren Puls. Danach würde sie wieder in das hektische Treiben ihres Alltags eintauchen, zurückkehren in das Bürogebäude, das noch ganz neu und schon völlig verdreckt war, zurück zu ihren treuen Jungs, die trotzdem so kompliziert waren wie alle Männer dieser Welt, besonders, wenn es sich dabei um Polizisten handelt. Und dann gab es natürlich Nina und Léo, ihre kleine Welt, ihr Leben…
Heute abend kommt Léo zum Essen … Was soll ich bloß kochen?
Am besten schaute sie gleich bei Rougelet vorbei, dem Metzger, bei dem man göttliches Fleisch bekam. Léo aß für sein Leben gern Fleisch, sie selbst mochte lieber Fisch und Gemüse und Nina Pommes Frites oder Nudeln. Wenn sie Kalbfleisch mit Spaghetti und Champignons machte, wären alle zufrieden. Außerdem wollte sie einen Blick in die eine oder andere Boutique werfen. Trotz des unfreundlichen Wetters kündigte sich nämlich langsam der Frühling an, und es war höchste Zeit, ihre Garderobe mal wieder aufzufrischen.
Marion überquerte die Saône und anschließend die Place Bellecour, auf der das Pferd von Ludwig XIV. den Passanten sein Hinterteil präsentierte. Von dort aus bog sie in die Fußgängerzone ein, die sich vom zweiten bis ins erste Arrondissement erstreckte. Trotz des schlechten Wetters wimmelte es in der Stadt von Menschen, vor allem vor den Kinos standen viele junge Leute lärmend Schlange. Mitten auf einer noch wenig besuchten Caféterrasse spie ein Feuerschlucker mit nacktem, schweißüberströmtem Oberkörper lodernde Flammen in den Himmel. Sein ledernes Gesicht erinnerte an einen alten Indianer. Für kurze Zeit vergaß Marion alles andere – das Schwurgericht, spöttische Mörder und miese Staatsanwälte. Erst als sie gegenüber von einem edlen Porzellangeschäft den Laden Tarte Julie entdeckte, der mit allerlei goldgelb gebackenen süßen und salzigen Köstlichkeiten lockte, bemerkte sie, daß sie das Mittagessen übersprungen hatte. Merkwürdigerweise brachte sie den Namen Julie sofort mit einem Fall in Verbindung, der im Prinzip nicht außergewöhnlich gewesen war, ihr aber trotzdem nicht aus dem Kopf ging, vielleicht, weil sie das Opfer Julie Rouvres gekannt hatte. Aus unerklärlichem Grund zog sich Marions Magen zusammen, mit dem Hunger war es vorbei, und so setzte sie ihren Weg ohne einen Imbiß fort.
Ein kurzer Halt, um die Zutaten fürs Abendessen zu besorgen, ein Abstecher in die Abteilungen von Printemps, wo es die paar Dinge gab, die Nina noch für ihre Ferien benötigte, dann bummelte sie an den Schaufenstern einiger wahnwitzig teurer Boutiquen vorbei, und schon tauchte das Hôtel de Ville auf. Marion wußte, daß der Fahrer hundert Meter weiter auf sie wartete, sie verlangsamte ihren Schritt und blieb an der Ampel gegenüber der Metrostation stehen. Auf den Bürgersteigen drängten sich die Menschen immer noch, und nur wenige Meter entfernt von ihr wartete ein Pärchen ebenso wie sie darauf, daß die Ampel für die Autofahrer auf Rot umsprang. Ein unauffälliges Allerweltspaar inmitten einer farblosen Menge. Um den Verkehr im Auge zu behalten, mußte Marion in die Richtung der beiden blicken. Der Mann war um die Dreißig, hatte langes braunes Haar, das leicht gewellt über den Kragen seiner Lederjacke fiel, und hielt eine wesentlich kleinere, schon etwas aus der Form geratene Frau in seinem Arm. Besonders hübsch war sie bestimmt nicht, wenngleich man ihr Gesicht nicht erkennen konnte, da sie es in der Brust ihres Begleiters vergrub. Zerstreut streichelte der Mann über das dünne, schon ergraute Haar der Frau, das im Nacken von einer losen Schleife zusammengehalten wurde. Marion fiel auf, wie nachlässig sie gekleidet war und daß sie älter wirkte als er. Ungewollt begegnete sie dem Blick des Mannes. Er starrte sie intensiv, fast überrascht an, so wie ein Mann eine Frau anschaut, die ihm gefällt. Doch sprach noch etwas anderes aus seinen Augen. Eine Art Selbstverständlichkeit, als würde er sie seit jeher kennen oder als habe er schon immer auf sie gewartet. Marion fand ihn weder häßlich noch besonders schön, trotzdem nicht uninteressant. Irgend etwas rief er in ihr wach, und nach einigem Nachdenken kam sie zu dem Schluß, daß ihr das Paar an diesem Tag schon einmal über den Weg gelaufen sein mußte, vielleicht auch am Vortag oder bei einer völlig anderen Gelegenheit. Gedankenverloren starrte sie auf die Rathausfassade, blickte dann auf ihre Uhr und fragte sich, ob die Autos wohl noch mal anhalten würden.
In diesem Moment veränderte sich die Situation. Eine ungewöhnliche Bewegung des Mannes veranlaßte Marion dazu, sich nochmals in seine Richtung umzudrehen. Das Paar verharrte in derselben Haltung wie zuvor, regungslos wie die Statuen hinter den hellen Sandsteinmauern des Saint-Pierre-Museums. Der Fremde fixierte Marion mit einem glühenden Blick, dem sie sich nicht mehr entziehen konnte. Sie las eine wilde Suche darin, ein Verlangen, dessen Heftigkeit sie erschütterte. Er preßte den Kopf seiner Begleiterin noch immer an sich, doch mit der anderen Hand fingerte er nun am Hosenschlitz seiner Jeans herum, die sich an dieser Stelle deutlich gewölbt hatte. Marion wußte, daß es nur einen Grund dafür geben konnte. Konzentriert und angespannt begann er, sich mit präzisen, wenn auch kaum wahrnehmbaren Bewegungen zu reiben. Gebannt sah Marion zu, wie seine Finger immer hastiger auf und ab schnellten, ohne daß der restliche Körper in irgendeiner Weise in Unruhe geriet. Niemand schien zu bemerken, was dort vor sich ging, weder die Frau, die sich an ihn schmiegte, noch die übrigen Passanten. Von dieser unglaublich dreisten Geste, die eindeutig für Marion bestimmt war, sollte niemand anders etwas mitbekommen. Endlich schaltete die Ampel auf Rot, und die Autos hielten an. Ohne jede Eile trat der Mann auf die Fahrbahn und zog die Frau mit sich. Fassungslos sah Marion ihm nach, wie er lässig die Straße überquerte, ohne die Hand von der besagten Stelle zu nehmen, wie er Fußgängern auswich und schließlich vor der Treppe zur Metrostation stehenblieb. Er hielt kurz inne, wandte sich dann zu Marion um, die sich nicht vom Fleck gerührt hatte. Während seine gleichgültige Begleiterin, die wie weggetreten war und möglicherweise unter Drogen stand, weiterhin nichts von seinem Tun bemerkte, trieb der Mann die Dinge mit ein paar raschen Handgriffen voran. Er streckte und spannte sich, den Blick auf Marion geheftet, die wie versteinert am Bordstein stand. Gleich darauf eilte er mit der willenlosen Frau im Arm die Treppe hinunter.
In Marions Kopf herrschte ein solcher Aufruhr, daß sie mehrere Sekunden brauchte, bis sie reagieren konnte. Die Ampel hatte längst wieder umgeschaltet, als sie sich zwischen die Autos stürzte und ein Hupkonzert auslöste. Sie steuerte auf die Metrostation zu, lief die Treppe hinunter, doch der Bahnsteig war leer. Sie konnte gerade noch die roten Schlußlichter des Zuges sehen, der in den Tunnel eintauchte.
Kommissarin Edwige Marion, von allen kurz Marion genannt, glaubte nicht an Schicksal. Sie wußte zwar, daß der Zufall ihr und ihren Kollegen hin und wieder zu Hilfe kam, aber sie glaubte nicht einen Augenblick lang, daß er bei diesem unseligen Ereignis mitgemischt hatte. Und so stürzte dieser Vorfall, den sie eigentlich unter ferner liefen hätte abbuchen können, wenn man bedenkt, wie viele Exhibitionisten und Perverse ihr von Berufs wegen begegneten, sie in größte Verwirrung.
3
Marion schaltete den Fernseher wieder ein, um sich noch einmal die Abendnachrichten auf TF1 anzusehen.
Sie war gegen 19 Uhr nach Hause gekommen und hatte sich sofort daran gemacht, Ninas Koffer zu packen. Das Mädchen, das seinem Aufbruch in die Ferien voller Spannung entgegensah, war ihr dabei nicht von der Seite gewichen. In den Regionalnachrichten war erneut vom »schrecklichen Tod« der Julie Rouvres die Rede gewesen.
»Selbstmord oder Verbrechen?« fragte sich der Journalist. »Die Ermittlungen unter Leitung von Kommissarin Marion …«
»Der redet von dir, Marion!« hatte Nina geschrien, mit todernstem Gesicht und wie erstarrt, ein Söckchen in jeder Hand. »Bringst du den Mann, der sie umgebracht hat, ins Gefängnis?«
»Ich weiß nicht, ob sie umgebracht worden ist, aber wenn es so ist, dann werde ich ihn verhaften, sobald ich ihn finde … Los, komm jetzt, wir gehen in die Badewanne!«
Es war besser, den Fernseher auszuschalten, sie mußte Nina schützen. Die Nachrichten konnten warten. Marion haßte den traurigen Ausdruck, der noch viel zu oft das Gesicht des Kindes überschattete, wenn von Polizisten, Verbrechen und bösen Menschen die Rede war.
»Wir beide, zusammen?« Nina war schon wieder fröhlich.
»Ja, mein Schatz … Wer als erster an der Badewanne ist, hat gewonnen!«
In ihren roten Häschen-Pantoffeln, ein Geschenk von Léo, das sie über alles liebte, war Nina, so schnell sie konnte, losgerannt. Sie hatte sich an den Wänden abgestoßen, um mit noch mehr Schwung über den Fliesenboden zu schlittern, und erreichte die Badewanne schließlich mit einer Kopflänge Vorsprung vor Marion, die sich keuchend über sie warf. Die Kleine hatte schallend gelacht. Dieses Spielchen war schon fast ein Ritual, mit dem sich Ninas Ängste vertreiben ließen.
»Gewonnen, Marion, ich hab gewonnen!«
Marion fuhr zusammen, als es an der Tür läutete, sie konnte sich einfach nicht an diesen lächerlichen Klingelton gewöhnen.
Ich muß sie auswechseln, mit diesem Gebimmel werde ich mich nie anfreunden. Ich hasse Türklingeln, Schellen, Wecker …
Das größere Problem war allerdings, sich überhaupt in diesem Haus zurechtzufinden, die Klingel stellte dabei nur ein banales Detail dar. Um Nina bei sich aufzunehmen, hatte sie sich dazu durchringen müssen, eine neue Bleibe zu suchen. Ihre kleine Altbauwohnung am Saône-Ufer zu verlassen war ihr nicht leichtgefallen. Marion liebte diese alten Häuser, in denen es nach Staub und Bohnerwachs roch, der Umzug in einen am Stadtrand gelegenen Neubau mit Garten bedeutete einen Einschnitt: Die übernommene Verantwortung für Nina ging einher mit einem Statuswechsel. Sie selbst hatte die Behörden ersucht, ihr Nina, das jüngste von den drei Kindern des Inspektor Joual, der zusammen mit seiner Frau umgebracht worden war, anzuvertrauen. Es war eine Probezeit vereinbart worden, in der die Bürokraten vom Jugendamt sich davon überzeugen sollten, daß Marion eine akzeptable Ersatzmutter abgeben würde und daß man dem Adoptionsantrag stattgeben konnte. Erste Bedingung war das Haus gewesen als Garant sozusagen für Stabilität und einen gewissen Komfort, der den Bedürfnissen eines sechsjährigen Mädchens entsprach. Die zweite Voraussetzung für Marions gesellschaftlichen Eingliederungsprozeß lehnte in diesem Moment unrasiert und offensichtlich erschöpft in einer offenen, etwas abgewrackten Lederjacke im Türrahmen, ein zerkautes Streichholz zwischen den ebenmäßigen Zähnen.
Marion lächelte, als sie sich auf die Zehenspitzen stellte, um ihn zu küssen. Seine Bartstoppeln kitzelten an ihren Lippen und ließen seinen ohnehin schon dunklen Teint noch dunkler erscheinen. Ja, das war er, Léo Lunis, dreiunddreißig Jahre alt, Capitaine bei der Kripo, seit fünf Monaten ihr Freund, ihr Geliebter, ihr Mann.
»Wenn die Frau vom Jugendamt dich sehen würde«, sagte Marion lachend, »würde sie mir Nina sofort wieder wegnehmen. Wann hast du das letzte Mal geschlafen, Léo?«
Er umschlang Marions Taille, hob sie hoch und vergrub sein Gesicht an ihrem Hals. Gierig atmete er ihren Duft ein, stöberte mit dem Mund in ihren wirren, blonden Locken, stellte sie wieder auf den Boden und bedeckte ihre Stirn, ihre Nase, ihre Ohren mit zärtlichen, ungeduldigen Küssen. Dann nahm er sie wieder in den Arm und drückte sie fest an sich. Marion seufzte und schmiegte sich mit geschlossenen Augen an Léos grauen Wollpullover.
»Es riecht gut hier«, bemerkte er, während er mit einem Fuß die Tür zumachte, damit die kühle Abendluft nicht ins Haus drang.
»Ich habe ein bißchen gekocht«, erwiderte Marion hocherfreut. »Kalbsschnitzel mit Pilzen …«
»O nein, bloß keine Pilze«, stöhnte Léo und hielt sich eine Hand vor den Bauch. »Davon wird mir immer total übel.«
Marion machte ein so enttäuschtes Gesicht, daß er in lautes Lachen ausbrach.
»Ach was, das war nur ein Witz, ich liebe Pilze … besonders aus der Dose!«
Jetzt mußte auch Marion lachen, erstaunt über seine unerwartete Albernheit und gute Laune, die so gar nicht zum erschöpften Äußeren paßten. Während sie zu ihm hochblickte und ihn betrachtete, wußte sie, daß sie in diesem Augenblick alles um sich hatte, was sie liebte. Nina, die in ihrem Zimmer spielte, und Léo in den Armen, auch er glücklich, bei ihr zu sein. Sie war gern schon zu Hause, wenn er heimkam. Trotz der Unordnung, die noch herrschte, war es angenehm und wohnlich in diesem Haus. Sie waren eine Familie. Léo warf einen kurzen Blick zu den Holzstufen hinüber, die in die erste Etage führten, und entdeckte dort die Nasenspitze von Nina, die sich hinter dem Geländer versteckt hielt.
»Wo ist Nina? Schon im Bett?«
Er zwinkerte Marion zu, sie verstand und trat hinter ihn.
»Sie muß morgen ziemlich früh aufstehen«, sagte sie, »und außerdem fit sein, denn ihre Großmutter hat ein Mammutferienprogramm für sie aufgestellt.«
Marion packte den abgewetzten Kragen von Léos Lederjacke und zog ihn nach unten, worauf ein athletischer Rücken zum Vorschein kam, auf dem sich zwei Holsterriemen kreuzten. Geschickt öffnete sie die Schnalle, nahm den Revolver – eine Magnum, Kaliber 357 – aus dem Schulterholster und legte ihn oben auf die Glasvitrine.
Das war für jeden Polizisten, der Kinder hatte, eine selbstverständliche Geste. Ein Handgriff, den Marion, als sie selbst noch klein war, hundertmal bei ihrem eigenen Vater beobachtet hatte. Nur daß er die Waffe dann meistens unter seinem Kopfkissen versteckte. »Wegen Algerien«, hatte ihr die Mutter lange nach seinem Tod einmal erklärt. Marion hatte das damals nicht verstanden und auch die Gefahren nicht gesehen, die ihrem Vater drohten, aber sie wußte, daß Schußwaffen eine Faszination auf Kinder ausübten, und zwar nicht nur auf kleine Jungs.
»Das ist schade, ich hatte eigentlich ein Geschenk für sie«, seufzte Léo und ging ins Wohnzimmer, wo sich noch einige unausgepackte Kartons stapelten.
Daraufhin ertönte hinter ihm ein leises Geräusch, nicht lauter als das Scharren einer Maus.
»Sag mal, hab ich da nicht was gehört? Wetten, daß sich da oben immer noch irgendwelches Ungeziefer herumtreibt …«
»Meinst du?« fragte Marion, die sofort mitspielte, in beunruhigtem Ton. »Und was machen wir jetzt? Meinst du, wir sollten ein paar Fallen aufstellen?«
»Heute abend nicht mehr, ich bin so erledigt, daß ich noch vor dem Essen ein kleines Nickerchen einlegen werde.«
Er ließ sich auf das Sofa fallen. Das Scharren wurde lauter, und Nina grunzte und schnalzte dazu mit der Zunge wie ein kleines vergnügtes Hausschweinchen, das nichts als Unsinn im Kopf hat. Mit einem Satz war Léo im Flur und stürmte zur Treppe.
»Was zuviel ist, ist zuviel! Jetzt geh ich doch hoch! Ihr werdet schon sehen! Paßt nur auf, ihr Ratten und Läuse!«
Nina reagierte mit einem schrillen Aufschrei. Was folgte, war ein lautes Getrampel, ein Kreischen, Schreien und Poltern und schließlich schallendes Gelächter. Marion schüttelte amüsiert den Kopf über dieses ausgelassene Toben, das Nina und auch Léo, der manchmal so düsterer Stimmung war, offensichtlich Freude bereitete. Während das Nudelwasser kochte, deckte sie den Tisch, stellte ein großes Bierglas darauf, in dem eine weiße Rose prachtvoll blühte, und zündete eine Kerze an. Schließlich wärmte sie die Champignonsauce auf, packte die Kalbsschnitzel aus und entkorkte eine Flasche Wein.
Der Radau hatte aufgehört.
»Das Essen ist fertig«, rief Marion ein paar Minuten später. »Zu Tisch, bitte!«
Als keine Reaktion kam, schlich sie leise die zwölf Stufen in die obere Etage hinauf. Dort führte die erste Tür in ihr Schlafzimmer. Der Raum gegenüber, aus dem irgendwann einmal ein Arbeitszimmer werden sollte, diente als Abstell- und Wäschekammer. Hinter dem Badezimmer lag Ninas Zimmer, wo auf einer Kommode aus Kiefernholz eine kleine, rosafarbene Lampe brannte. Marion blieb auf der Schwelle stehen und betrachtete die beiden: Nina saß auf dem Boden, mit dem Rücken an das helle Holzbett gelehnt, Léo kniete vor ihr und versuchte gerade, mit seinen ungeschickten Männerhänden eine der Barbiepuppen anzuziehen, mit denen Nina am liebsten von morgens bis abends gespielt hätte. Es fiel ihm sichtlich schwer, der langgliedrigen Zelluloidpuppe einen winzigen Büstenhalter überzustreifen. Nina sah ihm zu, wie er hochkonzentriert, mit zusammengezogenen Augenbrauen werkelte, und gab ihm hin und wieder mit größter Ernsthaftigkeit einen Tip.
Marion ging vor Glück und Zärtlichkeit das Herz auf, aber sie mußte wohl oder übel den Buhmann spielen, der die traute Zweisamkeit störte.
»Unten brennt mir gleich alles an«, sagte sie mit beherrschter Stimme.
»Wir kommen.«
Léo wandte sich zu ihr um und schenkte ihr einen liebevollen Blick aus seinen blauen Augen, in denen keine Spur von Müdigkeit mehr zu erkennen war. Marion las in diesem Blick tiefe Zuneigung, in die sich Dankbarkeit mischte.
Er stand auf und zog eine Grimasse, weil ihm die Beine eingeschlafen waren, dann hob er Nina hoch und drückte sie an sich. Das Mädchen schlang die Beine um seinen Körper, legte die Arme um seinen Hals und vergrub ihren Blondschopf an seiner Schulter, leise summend und schon halb im Schlaf. Liebevoll streichelte Léo ihr über Rücken und Hals.
»Komm schon, meine Große, wir gehen, sonst …«
»… wird Marion böse«, führte Nina mit gedämpfter Stimme seinen Satz zu Ende.
Marion! Sie nennt mich Marion, genauso wie die anderen, wie alle anderen … Ob sie irgendwann einmal Mama zu mir sagen wird?
Nina war noch nicht soweit. Sie war erst seit zwei Monaten bei ihr, und als Marion sie gefragt hatte: »Wie möchtest du mich nennen, mein Spatz?«, hatte das Mädchen sie erstaunt angesehen. »Marion, du heißt doch Marion.« Natürlich. Die Erinnerung an ihre verstorbene Mutter belastete sie noch zu sehr, sie mußte außerdem die 18 Monate, die sie im Waisenhaus der Polizei zugebracht hatte, verarbeiten und Marion erst noch kennenlernen, sehen, wie es war, mit ihr zusammenzuleben, und die Gewißheit erlangen, daß dieses gemeinsame Leben von Dauer sein würde. Eines Tages würde Nina Mama zu ihr sagen – wenn sie soweit war.
»Sie ist klasse«, verkündete Léo, als Marion nach dem obligatorischen Vorlesen – seit einer Woche war Schneewittchen der absolute Favorit – und Gute-Nacht-Küßchen ins Wohnzimmer zurückkam. »Zwei Wochen, sie wird mir fehlen.«
Marion setzte sich neben ihn. Er hatte nach dem Essen geduscht und sich umgezogen. In Jogginghose und weißem T-Shirt, die nackten Füße auf dem niedrigen Tisch, strahlte er etwas Verlassenes und Verlorenes aus, das Marion zutiefst rührte.
Ihr Blick wanderte über das schöne Gesicht mit dem Dreitagebart, in dem zwei sehr blaue Augen leuchteten. Ein paar Falten zogen sich über die hohe Stirn, und in seinem dichten, kurzen Haarschopf gewannen die grauen Strähnen langsam, aber sicher die Oberhand. Léo war ein Typ, der aus vielerlei Gründen schneller altern würde als andere. Marion hatte ihn vom ersten Augenblick an geliebt. Er war plötzlich in ihr Leben eingebrochen und hatte lange verschüttete Gefühle in ihr wachgerufen, die sie mit dieser Heftigkeit noch niemals empfunden hatte, nicht einmal bei Benjamin, dem schönen Kanadier, der eines Tages in seine kalte Heimat zurückgekehrt war. Eine Liebesbeziehung mit jemandem aus dem eigenen Team anzufangen war jedoch verpönt, grenzte an ein Tabu – damit hatte man Marion während der Ausbildung auf der Polizeischule in Saint-Cyr-au-Mont-d’Or oft genug in den Ohren gelegen. Jeden Tag aufs neue verstieß sie gegen diese ungeschriebene Regel, obwohl sie sich der Konsequenzen durchaus bewußt war.
Der Gedanke daran holte sie in die Wirklichkeit zurück.
»Wie ist es eigentlich bei dir gelaufen? War die Überwachung erfolgreich?«
Léo konnte nur mit Mühe ein Lächeln unterdrücken. Marion war eine Frau, seine Geliebte, die frischgebackene Mutter einer kleinen Adoptivtochter, vor allem aber war sie eine Polizistin, die ohne jede Vorwarnung und ohne jede Rücksicht auf die Romantik eines ganz besonderen Augenblicks zum Alltagsgeschäft zurückkehrte.
»Die Kerle haben das Treffen anscheinend abgeblasen. Morgen vielleicht … vielleicht auch nicht.«
»Wer ist heute abend dran? Lavot?« erkundigte sich Marion in verändertem Ton.
Léo richtete sich auf.
»Ja, aber ich glaube eigentlich nicht an diesen Geheimtip, der da aus dem Hut gezaubert wurde. Der Überfall liegt schon ein Jahr zurück, irgendwas stimmt da nicht. Aber was soll’s, wenn die Typen auftauchen, ruft Lavot mich an und ich fahr wieder hin. C’est la vie.«
Seufzend griff er nach der Weinflasche, die er aus der Küche geholt hatte, und schenkte sich ein Glas ein.
»Möchtest du auch einen Schluck?«
Marion schüttelte den Kopf und sah ihn nachdenklich an.
Léo deutete auf seinen Pager, der griffbereit auf dem Tisch lag.
»Darüber kann er mich erreichen, keine Angst.«
»Ich habe keine Angst! Aber früher oder später werden sie es erfahren.« Sie war angespannt bis in den großen Zeh und blickte so verwirrt drein, daß Léo lachen mußte.
»Früher oder später … Das soll wohl ein Witz sein! Es wissen doch jetzt schon alle, und sie haben es von Anfang an gewußt. Mach dir nichts vor.«
»Bist du sicher?«
»Schämst du dich etwa für mich?«
»Red keinen Unsinn.«
Sie machte eine Handbewegung, wie um diese Frage vom Tisch zu fegen, doch sie wußte, daß sie ihr nicht ewig aus dem Weg gehen konnte. Wie sollte sie Léo beibringen, daß er in absehbarer Zeit in eine andere Abteilung wechseln mußte, weil die Situation nicht mehr lange tragbar sein würde? Und daß man sie, Marion, wenn sie diese Entscheidung nicht selbst treffen würde, von höherer Stelle dazu zwingen könnte. Als hätte er es geahnt, kam er ihr zuvor.
»Nein, Marion, das kommt nicht in Frage! Ich will mit dir zusammenarbeiten. Wir sind doch ein gutes Team, oder?«
Marion reagierte auf seine zweideutige Frage mit einem verkrampften Lächeln. Sie stellte die Beine nebeneinander, schlug sie wieder übereinander und beschloß schließlich, daß der Schneidersitz am bequemsten war.
»Was ist los? Siehst du das etwa anders?«
Léos Stimme klang beunruhigt, in seinem Blick lag Befremden, so daß Marion darauf verzichtete, eine Diskussion anzufangen, die ihnen beiden nur weh tun würde.
»Nein, natürlich nicht«, sagte sie statt dessen und streichelte ihm zärtlich über die Wange.
»Komm«, flüsterte Léo und zog sie an sich.
Bald schon lagen sie halbnackt und ineinander verschlungen auf dem Sofa. Sie küßten sich leidenschaftlich, die Zeit zählte nicht mehr, alle Sorgen und Fragen waren in weite Ferne gerückt. Da vor dem großen Glasfenster noch keine Vorhänge hingen, waren sie im Lampenschein den Blicken der Leute draußen ausgesetzt – sie hätten sich auch mitten auf der Straße lieben können. Léo schien das nichts auszumachen, aber Marion, die normalerweise nicht besonders zimperlich war, konnte sich nicht entspannen. Sie wurde das unangenehme Gefühl nicht los, daß jemand sie beobachtete.
»Was hast du denn?«
»Nichts«, beteuerte Marion mit einem kurzen Blick zum Fenster, hinter dem sich nichts regte. »Ich dachte bloß gerade, daß Nina wach werden könnte.«
»Dann laß uns ins Bett gehen.«
Wie zufällig rief Nina in diesem Augenblick nach Marion und bat um etwas zu trinken.
Ich wußte es doch! Kein Wunder, daß sie Durst hat, an den Nudeln war zuviel Salz.
Auf dem Weg in die Küche brachte sie rasch ihre verrutschten Kleider in Ordnung. Léo stand ebenfalls auf, zog sein T-Shirt über, fuhr sich mit der Hand durchs Haar und machte sich an der Stereoanlage zu schaffen. Als Marion auf der Treppe war, stimmte Sade mit rauher Stimme die ersten Takte von Is it a crime an.
Sie mußte daran denken, wie ihr Leben noch vor einigen Monaten ausgesehen hatte. Einsame Abende kamen ihr in den Sinn, die geprägt waren von beklemmender Leere. Abende, an denen sie allerdings zumindest frei darüber entschieden hatte, ob sie lieber Akten wälzen oder ausgehen wollte. Der Gedanke an die Unterlagen, die sie heute abend aus dem Büro mit nach Hause geschleppt hatte und die noch immer unangerührt in ihrer Ledertasche lagen, bereitete ihr für einen kurzen Moment Gewissensbisse. Sie ahnte, daß sich bis morgen früh in dieser Hinsicht bestimmt nichts mehr tun würde. Sie verscheuchte ihr schlechtes Gewissen, als sie in Ninas Zimmer trat und die Kleine sie vertrauensvoll, wenn auch aus müden Augen anblickte. Ninas schmales Gesicht und ihr zerbrechliches Lächeln vertrieben die letzten Zweifel, was den Weg betraf, für den sie sich entschieden hatte: Sie hatte nicht auf den Mann warten wollen, der ihr ein Kind machen würde – die Kripoarbeit ließ ihr sowieso kaum Zeit für die Suche und sie wurde schließlich auch nicht jünger. Ihr Leben hatte jetzt einen Sinn, sie hoffte, jemanden glücklich machen zu können, der es brauchte. Im vollen Bewußtsein aller Probleme, die ein solcher Schritt mit sich bringen würde, hatte sie Nina in aller Form gefragt, ob sie ihre Tochter werden wolle. Das Kind hatte gezögert. Aufgewühlt hatte Marion sie antworten hören, daß ihr Vater auch Polizist gewesen und gestorben sei und daß sie so etwas nicht noch einmal erleben wolle.
»Dein Papa ist nicht gestorben, weil er Polizist war«, hatte Marion ihr vorsichtig erklärt. »Er und deine Mama sind einem Verrückten über den Weg gelaufen, und das kann jedem passieren.«
Unter den hohen Bäumen im Park des Château d’Osmoy, in dem verwaiste Polizistenkinder kurzfristig eine neue Heimat fanden, hatte sie Nina von der Tragödie ihrer Eltern erzählt. Marion hatte ihr versprechen müssen, lange zu leben, so lange wie möglich, so lange, bis Nina selbst eine alte Dame wäre. Dann hatte sie ihre kleine Hand in Marions Hand gelegt, und durch den traurigen Schleier vor ihren allzu ernsten Augen sagten ihre Blicke »Ja«. Schließlich hatte sie Marion in die Verwaltung des Waisenheims geschleppt, um dem Direktor zu verkünden, daß sie umziehen wolle. Und um ihrem Wunsch Nachdruck zu verleihen, hatte sie ihre sämtlichen Beschwerden gegen die Einrichtung aufgezählt und die Hoffnung geäußert, daß Marion es besser machen würde.
»Ich warne Sie«, hatte der Mann amüsiert angemerkt. »Die Kleine hat einen bemerkenswerten Dickschädel.«
Sade hauchte die letzten Takte von Your love is king, als Léo die Zeitschrift, in der er geblättert hatte, auf seine Knie sinken ließ und herzhaft gähnte. Er beobachtete Marion, die auf dem Boden saß, den Rücken an das Sofa gelehnt und die Augen zur Decke gerichtet. Sie wirkte abwesend, und er hatte nicht den leisesten Zweifel daran, daß ihr die Arbeit, die Straffälle und die Verbrecher durch den Kopf gingen.
»Wie war dein Tag? Du hast noch gar nichts erzählt. Was gibt’s Neues aus dem Schwurgericht?«
»Ich habe zwei schlimme Stunden im Justizpalast hinter mich gebracht. Ich bin mir sicher, daß es diesem Drecksack Breton gelingen wird, sich aus der Affäre zu ziehen. Der Staatsanwalt gibt eine erbärmliche Figur ab, er hingegen hat einen brillanten Verteidiger.«
»Das heißt, wir haben mal wieder für nichts und wieder nichts gearbeitet. Das ist schon …«
Marion fiel ihm ins Wort. »Dieser Breton ist mir im Grunde Wurst, was mich wirklich umtreibt, ist der Tod von Julie.«
Léo griff nickend nach seiner Zeitschrift.
»Ja, die Ärmste, das ist wirklich eine traurige Geschichte! Als ich heute abend nach Hause gehen wollte, saß übrigens so ein junger Typ bei Talon im Büro.«
»Du meinst bestimmt den Verlobten … von Julie natürlich, nicht von Talon!«
Léo warf Marion einen erstaunten Blick zu. Sie kicherte etwas verlegen, als wollte sie sich für ihren plumpen Scherz entschuldigen.
»Johan Laplante«, sagte sie dann. »Die beiden wollten noch dieses Jahr heiraten. Sie waren an dem Abend, an dem Julie gestorben ist, verabredet, und er hat für die Stunden vor ihrem Tod kein überprüfbares Alibi. Ich habe ihn in Polizeigewahrsam genommen.«
»Glaubst du, er könnte es getan haben?«
»Was?«
»Sie vergewaltigen, denn dazu ist es doch anscheinend gekommen.«
»Und umbringen.«
»Du gehst also ernsthaft davon aus, daß sie umgebracht worden ist?«
Marion legte den Kopf in den Nacken.
»Ja, aber ich habe nicht viele Anhaltspunkte. Ich suche noch, taste mich vor. Deswegen auch die vorläufige Festnahme des Verlobten. Bisher ist er nur Zeuge, aber wer weiß, vielleicht bewirkt eine Nacht im Knast ja, daß er seine Lage überdenkt und uns doch noch etwas Wichtiges zu sagen hat. Talon ist dabei, die Arbeiter von der Baustelle aufzuspüren und vorzuladen, außerdem alle Leute, die mit ihr im Bus saßen: den Fahrer, die Anwohner und so weiter. Jeder Verdächtige wird einem Speicheltest unterzogen, damit wir die DNA mit der DNA des Spermas vergleichen können, das man an ihr gefunden hat. Und dann …«
Mit einer müden Handbewegung gab sie Léo zu verstehen, daß die Ermittlungen sich womöglich noch monatelang hinziehen würden. Und das eventuell für nichts und wieder nichts.
Léo gähnte erneut und diesmal so heftig, daß seine Augen tränten. Marion wollte aufstehen und streckte ihm eine Hand entgegen, damit er sie hochzog.
Das Klingeln des Telefons ließ sie zusammenfahren. Ein kurzer Blick auf die Uhr, und sie wußte, daß es zehn nach zwölf war. Sofort schrillten alle Alarmglocken. Bei Neuigkeiten, die das Telefon nach Mitternacht übermittelte, standen immer entweder eine Gehässigkeit oder eine Katastrophe ins Haus. Der Apparat stand auf dem Boden, sie stürzte hin, um den Hörer abzunehmen.
»Ja, bitte?« fragte sie mißtrauisch.
Alles, was sie hörte, waren ein keuchender Atem und ein Rauschen im Hintergrund, das bald lauter, bald leiser wurde und das sie nicht sofort einordnen konnte.
»Hallo? Ich kann Sie nicht hören.«
Die Hintergrundgeräusche wurden deutlicher. Es konnte sich nur um rasende Autos auf einer Schnellstraße handeln. Der ungleichmäßige Rhythmus deutete darauf hin, daß nur geringer Verkehr herrschte.
»Léo«, nuschelte es am anderen Ende der Leitung, als hätte der Gesprächspartner etwas im Mund, vielleicht eine Zigarette zwischen den Lippen, die ihn beim Sprechen störte.
Das kann nur jemand aus dem Kommissariat sein, schoß es Marion spontan durch den Kopf. Jemand, der hier anruft, um Léo zu erreichen. Das mußte ja früher oder später passieren.
»Wer spricht da?« fragte sie mit belegter Stimme.
Aber der Unbekannte hatte bereits aufgehängt.
»Das war für dich! Ich bin mir sicher, daß es Lavot war. Hast du ihm gesagt, daß du heute abend bei mir bist?«
Léo runzelte verärgert die Stirn.
»Siehst du, ich hab’s dir ja gesagt«, fuhr Marion fort. »Wir können so nicht weitermachen! Ich wette, das hat er extra gemacht, wahrscheinlich vergeht er vor Eifersucht.«
Alarmiert durch ihre plötzliche Nervosität entgegnete Léo vorsichtig: »Glaubst du nicht, daß es wieder einer dieser Anrufe war?«
Er spielte auf die anonymen Telefonanrufe an, die Marion seit einigen Wochen in regelmäßigen Abständen abends oder auch nachts erhielt. Eine fortwährende Belästigung, die vielleicht nur das Werk eines Feiglings war, aber dennoch etwas Irritierendes, wenn nicht Beunruhigendes hatte.
»Ich habe mir eine neue Nummer zugelegt, und ich stehe auf der roten Liste. Das muß jemand sein, der irgendwas mit dir zu tun hat, der weiß, daß du fast immer hier bist, wenn du nicht arbeitest, und der außerdem direkten Zugang zu meiner Telefonnummer hat.«
»Lavot ist es nicht«, behauptete Léo. »Wenn er gewollt hätte, hätte er sein Glück mit Sicherheit direkt bei dir versucht. Anonyme Telefonanrufe sind nicht sein Ding. Warum regst du dich eigentlich so auf?«
»Natürlich rege ich mich auf!« empörte sich Marion. »Dich mag das kaltlassen. Du bist ja auch nur sporadisch da, du kommst und gehst wieder. Mich aber stört dieser Irre.«
Léo wollte etwas erwidern, doch er kannte Marion. Der Anruf hatte sie so verärgert, daß sie für den restlichen Abend aus ihrer streitsüchtigen Stimmung nicht herausfinden würde. Also griff er seine Jacke, die an einer noch nicht angeschlossenen Halogenstehlampe hing, und nahm seine Dienstwaffe wieder an sich.
Marion verschränkte die Arme und neigte mit einem verkrampften Lächeln den Kopf zur Seite.
»Darf ich wissen, was du vorhast?«
»Ich gehe nach Hause. Wie ich sehe, stellt unsere Beziehung ein Problem für dich dar, und vielleicht ist es besser …«
Marion spürte Panik in sich aufsteigen. Der Abend, der wie ein Traum begonnen hatte, würde zum Alptraum geraten. Sie konnte ihn wegen eines lächerlichen anonymen Anrufs doch nicht gehen lassen! Léo stand schon im Türrahmen, die Jacke über der Schulter und den Revolver in der Hand, als sie sich vor ihm aufbaute. Leidenschaftlich preßte sie sich an ihn.
»Bleib, Léo, bitte. Ich möchte …«
Sie blickte zu ihm auf. Der Ausdruck in ihrem Gesicht ging ihm unter die Haut.
»Ich möchte, daß du hier einziehst.«
»Bist du dir da sicher, Marion? Mit mir zusammenzuleben ist kein Zuckerschlecken, das weißt du selbst.«
»Ich weiß! Aber ich war schon immer etwas masochistisch veranlagt.«
Sie lachte leise in seinen Pullover hinein.
»Und die anderen?« beharrte Léo, als wollte er ihr zusätzliche Argumente liefern.
»Morgen sage ich ihnen, daß wir zusammenleben. Und der erste, der was zu meckern hat …«
»Kriegt eins von mir auf die Nase«, sagten sie im Chor, ehe sie losprusteten.
Léo umfaßte Marions Gesicht mit seinen Händen und strich ihre blonden Locken zurück.
»Du siehst aus wie eine Katze«, flüsterte er.
Er schwieg für einen Augenblick.
»Ich liebe dich, Marion.«
Marion konnte in seinem Blick lesen, was dieses Geständnis bedeutete. Wenn Léo »Ich liebe dich« sagte, hieß das: Ich will für immer an deiner Seite sein, Tag für Tag, ein ganzes Leben lang. Ihr wurde schwindelig, und sie fragte sich plötzlich, ob das nicht doch alles ein bißchen zu schnell ging, ob sie sich nicht erst ganz sicher sein sollten, und überhaupt … Jean-Baptiste, ihr Ex-Mann, hatte sie wegen einer anderen verlassen. Seither hegte Marion eine Aversion gegen jede Form von Paarbeziehung.
Léo schloß sie in seine Arme und küßte sie. Ein Kuß, über den Marion ihre diffusen Ängste beinahe vergaß. Er hob sie wie eine Feder vom Boden hoch und trug sie in ihr Bett. Sie liebten sich. Endlich. Doch trotz der Bedeutung und Intensität des Augenblicks bemerkte Marion bei Léo immer noch jene Zurückhaltung, für die sie keine Erklärung fand. Nicht, daß er nicht zärtlich und aufmerksam gewesen wäre, aber alles, was er tat, ja sogar was er sagte, hatte etwas fürchterlich Konventionelles. Marion fiel der Vergleich mit einem guten Schüler ein, der sein Gedicht auswendig und fehlerfrei vorträgt, aber ohne jenes Gefühl, jene Leidenschaft, die letztlich ausschlaggebend ist, oder mit einem technisch versierten Reiter, der steif im Sattel sitzt, bei Turnieren immer gut abschneidet, manchmal sogar erster wird, aber niemals unter Beifallsstürmen. Doch ihre Gefühle für Léo waren so stark, daß sie sein Verhalten für anerzogene Scham hielt, die sich mit der Zeit legen würde. Nur manchmal beschlich sie der beunruhigende Gedanke, daß er vielleicht einfach nicht so leidenschaftlich war wie sie und daß sie seiner Lauheit irgendwann überdrüssig werden könnte.
Wie aus heiterem Himmel kam ihr der Mann von der Oper wieder in den Sinn, sein Bild flackerte plötzlich auf und erregte sie extrem. Als ihr Herz wieder in normalem Rhythmus schlug, hätte sie ihrem Geliebten beinahe von dem, was ihr am Nachmittag widerfahren war, erzählt, aber dann verzichtete sie lieber darauf. Der Abend, an dem sie beschlossen hatten zusammenzuleben, war sicher nicht der geeignete Moment, ihn wissen zu lassen, daß die bloße Erinnerung an einen masturbierenden Unbekannten ein ungeahntes Lustgefühl in ihr auslöste.