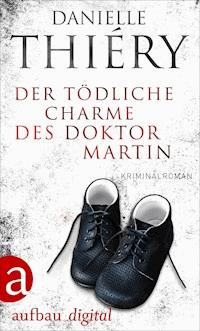Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissarin Edwige Marion
- Sprache: Deutsch
Edwige Marion, ihr neuer, viel zu netter Freund Gilles und ihre Tochter Nina freuen sich auf die wohlverdienten Ferien am Meer. Doch da bekommt Marion eine mysteriöse Lieferung von 15 Kartons ins Haus. Sie enthalten die Habseligkeiten eines alten Freundes ihres früh verschiedenen Vaters, Gustave Léman, der wenige Tage zuvor ermordet wurde. Der Inhalt der Kartons hält nicht nur ein paar unangenehme Überraschungen über Marions eigene Vergangenheit bereit, er könnte auch gewisse hohe Polizeifunktionäre in Bedrängnis bringen. Als Marion merkt, daß sie verfolgt und ihr Telefon abgehört wird, weiß sie, daß sie mal wieder auf eigene Faust ermitteln muss, um die unbequeme Wahrheit ans Licht zu zerren. Zwischen Lyon, Dijon und einem verschlafenen Dörfchen im Burgund nehmen ihre Ferien einen etwas weniger geruhsamen Verlauf als erwartet ...
"Edwige Marion wird dafür sorgen, daß Sie eine lange, grässliche, Nacht damit zubringen, Tote zu zählen, ehe Sie beim Morgengrauen erlöst werden - gerädert, aber begeistert von diesem hervorragend konstruierten Thriller. Da will man ausnahmsweise mal mehr haben von der Polizei." L'EXPRESS.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 537
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Sammlungen
Ähnliche
Über Danielle Thiéry
Danielle Thiéry, geboren 1947, zwei Kinder, war Kriminalkommissarin in Paris und in den siebziger Jahren die erste Frau an der Spitze eines französischen Kommissariats. 1991 findet sie endlich die Zeit zu schreiben. Seitdem hat sie eine Fernsehserie entwickelt, an mehreren Fernsehproduktionen mitgearbeitet, einen autobiographischen Roman (Prix Bourgogne 1997) und zahlreiche Krimis (Prix Polar 1998) geschrieben.
Informationen zum Buch
Edwige Marion, ihr neuer, viel zu netter Freund Gilles und ihre Tochter Nina freuen sich auf die wohlverdienten Ferien am Meer. Doch da bekommt Marion eine mysteriöse Lieferung von 15 Kartons ins Haus. Sie enthalten die Habseligkeiten eines alten Freundes ihres früh verschiedenen Vaters, Gustave Léman, der wenige Tage zuvor ermordet wurde. Der Inhalt der Kartons hält nicht nur ein paar unangenehme Überraschungen über Marions eigene Vergangenheit bereit, er könnte auch gewisse hohe Polizeifunktionäre in Bedrängnis bringen. Als Marion merkt, daß sie verfolgt und ihr Telefon abgehört wird, weiß sie, daß sie mal wieder auf eigene Faust ermitteln muss, um die unbequeme Wahrheit ans Licht zu zerren. Zwischen Lyon, Dijon und einem verschlafenen Dörfchen im Burgund nehmen ihre Ferien einen etwas weniger geruhsamen Verlauf als erwartet …
»Edwige Marion wird dafür sorgen, daß Sie eine lange, grässliche, Nacht damit zubringen, Tote zu zählen, ehe Sie beim Morgengrauen erlöst werden – gerädert, aber begeistert von diesem hervorragend konstruierten Thriller. Da will man ausnahmsweise mal mehr haben von der Polizei.« L'EXPRESS.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Danielle Thiéry
Der letzte Klient des Maître Renoir
Roman
Aus dem Französischen von Sabine Schwenk
Inhaltsübersicht
Über Danielle Thiéry
Informationen zum Buch
Newsletter
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Kapitel 77
Kapitel 78
Kapitel 79
Kapitel 80
Kapitel 81
Kapitel 82
Kapitel 83
Kapitel 84
Kapitel 85
Kapitel 86
Kapitel 87
Kapitel 88
Kapitel 89
Kapitel 90
Kapitel 91
Kapitel 92
Kapitel 93
Kapitel 94
Kapitel 95
Kapitel 96
Kapitel 97
Kapitel 98
Kapitel 99
Kapitel 100
Kapitel 101
Kapitel 102
Kapitel 103
Kapitel 104
Kapitel 105
Kapitel 106
Kapitel 107
Kapitel 108
Kapitel 109
Kapitel 110
Kapitel 111
Kapitel 112
Kapitel 113
Kapitel 114
Kapitel 115
Kapitel 116
Kapitel 117
Kapitel 118
Kapitel 119
Kapitel 120
Kapitel 121
Kapitel 122
Kapitel 123
Kapitel 124
Kapitel 125
Anmerkungen
Impressum
Für Pierre und Eric Meillant, vielen Dank …
Das Leben ist eine ruhige Hölle …
1
Ein Luftzug fährt raschelnd durch die vergilbten Papierfetzen, die verstreut auf dem Boden liegen. Graue Wollmäuse drehen sich träge im Kreis, während ein Stockwerk höher ein Fenster leise im Wind klappert.
Dem alten Mann mit dem nackten Oberkörper ist plötzlich kalt. Seine falschen Zähne schlagen aufeinander, und der Schmerz, der ihm die Brust zusammenschnürt und seinen linken Arm gefühllos macht, wird immer heftiger. Er schließt die Augen, preßt die trockenen Lippen zusammen. Seine Kehle brennt, er ist durstig. Hinter dem Rücken spürt er seinen Peiniger, der sich schwer atmend an etwas zu schaffen macht, und das durch Mark und Bein gehende Geräusch von Metallteilen, die aneinander reiben, läßt ihn das Schlimmste befürchten.
Unmerklich bewegt sich die Luft. Ein fauliger Atem dringt ihm in die Nase. Er ist da. Das Gesicht dicht vor dem des Alten, sieht er ihn aus seinen Fuchsaugen an. Er streckt die rechte Hand zu den Wunden hin, aus denen Blut sickert, drückt einen Fingernagel in den Krater, den ein Zigarillo gegraben hat.
Der Alte bäumt sich auf, unterdrückt einen Schrei. Lieber verrecken, als seine Qualen zur Schau stellen. Lieber sterben, als auch nur ein bißchen nachgeben. Sterben, ja, er will jetzt nur noch sterben, und zwar so schnell wie möglich.
Die linke Hand des Kerls wird sichtbar, sie umklammert den Griff eines Messers, dessen lange, gebogene Klinge an die Dolchattrappen arabischer Reiterspiele für Touristen erinnert. Aber diese Klinge ist aus Stahl, auch wenn sie kaum glänzt im langsam ersterbenden Tageslicht, das durch die schmutzigen Scheiben dringt.
»Also? Willst du die Frage noch einmal hören?«
Die Klinge, scharf wie ein Rasiermesser, nähert sich dem entstellten Gesicht, dessen unzählige Falten trotz des Dämmerlichts deutlich zu erkennen sind. Am Kinn hält sie inne, gleitet dann über die von schütteren Bartstoppeln bedeckte Wange, streicht sanft über die schmale Nase des Alten und zieht dabei eine feine, rosafarbene Spur, auf der winzige Blutstropfen perlen. Unter dem rechten Auge macht sie halt, scheint zu zögern, ehe sie einige Millimeter tief in die welke Haut der unteren Lidfalte eindringt. Der Schmerz läßt den alten Mann zusammenzucken; plötzlich wird ihm auch das Brennen der langen Schnittwunde bewußt.
»Ich will eine Antwort, sonst pflück ich dir das Auge raus. Erst das hier, und dann das andere. Kapiert?«
Der Alte lächelt unmerklich. Er hat keine Angst. Er hatte noch nie Angst, weder vor Schmerzen, noch vor dem Tod. Er ist am Ende seines Weges angelangt.
Er sammelt seine Kräfte und einen letzten Rest Speichel, indem er die Lippen bewegt, als versuchte er zu sprechen. Der Folterknecht läßt sich täuschen und beugt sich vor, um dem Geständnis zu lauschen, auf das er seit Stunden hofft. Der Speichelstrahl, der nach gebratenen Zwiebeln und Kohlsuppe riecht, landet unter seiner Nase. Von dort läuft er ihm direkt über die Lippen, die aufgrund der ständig verstopften Nase immer ein wenig geöffnet sind. Er schreckt zurück, fährt sich mit der freien Hand übers Kinn, während er wutentbrannt den stinkenden Schleim des Alten ausspuckt.
»Du alter Dreckskerl! Das wirst du mir büßen!«
»Vollidiot …« murmelt der gefesselte Mann.
Wie gern hätte er seine Verachtung und seinen Abscheu hinausgeschrien, doch seine Kräfte verlassen ihn. Der Schmerz in der Brust blockiert die Atmung. Er versucht weiterzuatmen, nur noch ein bißchen Luft zu bekommen, um den Unmut seines Peinigers gebührend auszukosten. Doch ein rötlicher Schleier legt sich über seine Augen, ein schillernder Endorphinnebel, der die Angst verhüllt und dem Tod ein wenig von seinem Schrecken nimmt. Dem Tod, denkt er, während tief in seiner Brust etwas zerbirst.
Die Klinge des Dolches kehrt an ihren Platz unter dem Auge zurück und dringt tief in die Lidfalte ein. Blut spritzt aus der Wunde, doch der alte Mann rührt sich nicht. Wutschnaubend zerschneidet der Folterknecht die Haut rings um die Augenhöhle, ohne auf den geringsten Widerstand zu stoßen.
»Ich werd dir dein Glupschauge schon zeigen … Gleich fällt’s dir in den Schoß!«
Keine Reaktion, nicht das leiseste Zeichen von Schmerz. Als er so tief in die Augenhöhle eingedrungen ist, daß er den Sehnerv berührt, geht ein Ruck durch den Körper des Alten, ein Reflex, durch den sein Kopf nach hinten kippt. Getragen von einer lauwarmen Blutfontäne springt das Auge heraus, landet auf der Hand, die das Messer hält, prallt ab und fällt mit einem leisen Klatschen auf die abgewetzten Steinplatten.
Der alte Mann bewegt sich nicht, gibt keinen Laut von sich.
Nur sein Mund öffnet sich leicht, und als der Folterer auf das gesunde Auge blickt, das starr die schmutzige Zimmerdecke fixiert, begreift er, daß der Alte ihn ein letztes Mal geschnitten hat.
2
Die Morgendämmerung erinnert an das Ende tropischer Nächte. Ein feuchter, schwüler Lufthauch bläht die Gardinen vor dem weit geöffneten Fenster, in der Ferne grollt ein Donner. Marion schlägt langsam die Augen auf. Es wird hell über den Hügeln und Feldern; das Zimmer ist von Düften erfüllt, die der jungen Frau ein tiefes Glücksgefühl geben. Eigentlich würde sie gern die Beine ausstrecken, um sich ein wenig abzukühlen, aber sie rührt sich nicht, sondern genießt das Gefühl totaler Erfüllung, in das sie der gleichmäßig atmende, dicht an sie geschmiegte Körper an ihrer Seite versetzt.
Ein Nachtvogel begrüßt den nahenden Tag mit einem besorgten Ruf; der Wind wird stärker. Der dünne Vorhang am Fenster weht zu Marion herüber, streift ihre feuchte Haut. Sie schaudert, und der Mann scheint es im Schlaf zu spüren, denn seine Hand, die entspannt auf ihrer Hüfte ruht, bewegt sich unmerklich. Die junge Frau hat es bemerkt und wird sogleich von einem Verlangen erfüllt, das sie alles andere vergessen läßt: Sie will, daß Leben in diese Hand kommt, daß diese Hand sie dort berührt, wo sie ganz Frau ist. Ihr Bauch beginnt zu beben, wird heiß. Sie rückt näher. Kaum ein paar Zentimeter, und sie holt ihren Gefährten in die Welt der Lebenden zurück. Noch halb im Schlaf schiebt er sich zwischen die Schenkel der jungen Frau, die aufstöhnt und sich seiner zärtlichen Berührung öffnet. Die Begierde, die ihren Körper wie eine Welle überspült, läßt sie erzittern. Sie gibt sich ihrer Lust hin. Ihr Körper bäumt sich auf.
Draußen zucken kurze Blitze über den Horizont.
3
Dicke Gewitterwolken ballen sich am grauen Himmel. Aus der Ferne ertönt seit Stunden ein Donnergrollen; der Wind fegt durch das Tal und über die Hänge des »Bergs«, peitscht über die Wacholderhecken längs der schmalen Straße, die sich in engen Serpentinen zum Haus hochschlängelt. Durch das Küchenfenster betrachtet Marion die Kiefern; sie stemmen sich dem nahenden Sturm entgegen wie ein zerbrechlicher Wall, der den Gemüsefeldern und einer Handvoll Schafen und Kühen so gut es geht Schutz gewährt. Entspannt genießt sie die Gewitterstimmung, und ihr Alltag, die Kripo, die laufenden Fälle könnten ferner nicht sein.
Kommissarin Edwige Marion, von allen kurz Marion genannt, ist all das, was außerhalb ihrer kleinen, privaten Welt geschieht, in diesem Moment herzlich egal.
Nichtsdestotrotz streckt sie automatisch die Hand aus und drückt auf den grünen Knopf ihres Radios, das auf France Info eingestellt ist. Im Wetterbericht ist von einem Tief die Rede, das von Westen her näher kommt und eine weitere Verschlechterung des Wetters mit sich bringt, aber Marion, deren Blick über die Landschaft schweift, hört kaum hin. Weiter unten, auf der Höhe der ersten Straßenbiegung, erweckt ein weißer Strich, der sich vorwärts bewegt, ihre Aufmerksamkeit. Er verschwindet, als der Wind für einen Moment abflaut und die Büsche sich wieder aufrichten. Marion, der plötzlich einfällt, daß sie in die Küche gekommen ist, um Frühstück zu machen, füllt den Wasserkocher. Sie legt ein Tablett auf die Arbeitsplatte, stellt drei Tassen, Toastbrot, Brombeergelee und gesalzene Butter darauf. Dann nimmt sie die Küchenpapierrolle, reißt drei Stücke ab, faltet sie und klemmt sie unter die Tassen, gibt zwei Löffel Kakao in Ninas Becher und etwas Ceylon-Tee in eine Fayencekanne, deren tiefblaue Farbe sie liebt.
Ein kurzer Blick aus dem Fenster, und sie sieht, wie der weiße Strich hinter der dritten Kurve wieder auftaucht, ehe sie dank eines Lochs in der Hecke erkennt, daß es sich um einen kleinen Lieferwagen handelt, auf dessen Tür der Name eines Umzugsunternehmens prangt.
So ein Sonntag ist ideal zum Umziehen, sagt sich Marion, während im Radio die Acht-Uhr-Nachrichten beginnen. Der Sprecher verkündet die neusten Meldungen: ein Lebensmittelskandal, ein Busunfall in Spanien, eine in der Ferienlethargie versackte Finanzaffäre, die nun wohl doch wieder aktuell wird. Eine leichte Berührung von hinten, gefolgt von einem zärtlichen Kuß in den Nacken, schneidet dem Katastrophenverkünder das Wort ab. Gilles Arme umfangen sie. Mit geschlossen Augen sinkt sie glückselig zurück.
»Schießerei in einer Bar in Lyon«, leiert der Ansager mit tonloser Stimme herunter. »Zwei Verletzte …«
Marion erstarrt.
Klack. Gilles Finger auf dem roten Knopf. Stille.
»He!« protestiert Marion. »Was fällt dir ein? Laß mich gefälligst die Nachrichten hören!«
»Kommt nicht in Frage!« erwidert Gilles und hält ihre Arme fest, damit sie das Gerät nicht wieder einschalten kann. »Vergiß dieses blöde Ding mit seinen Horrormeldungen! Du bist im Urlaub.«
Er lacht wie ein großer Junge, der zu Streichen aufgelegt ist. Groß und kräftig ist er, aber richtig gut sieht er eigentlich nicht aus. Marion versucht sich mit diversen Tricks aus seinem Griff zu befreien, was ihr schließlich gelingt.
Klack. Der grüne Knopf. Zu spät, der Sprecher hat schon das Thema gewechselt.
»Mist«, schimpft sie vor sich hin. »Ich hätte wirklich gern gewußt, wo das war …«
»Du wirst es schon früh genug erfahren«, sagt Gilles und gibt ihr einen Kuß. »Was ist jetzt mit dem Frühstück? Ich sterbe vor Hunger.«
Marion erwidert seinen Kuß, während ihr wieder einmal auffällt, daß dieser Mann ständig Appetit hat, ein Umstand, der seine nicht gerade asketische Figur erklärt. Aber sie muß zugeben, daß er mit den Nachrichten recht hat. Heute ist ihr erster Urlaubstag, und es ist wichtig für sie beide, daß es ihr gelingt, die Arbeit und alle Tagesereignisse völlig aus ihren Gedanken zu verbannen. Trotzdem kann sie nicht verhindern, daß Gilles autoritäres Gebaren sie leicht verärgert. Zärtlich, aufmerksam und vernünftig, aber eben trotzdem autoritär. Sie bemüht sich, ihren Unmut nicht zu zeigen; ihr Liebster merkt sofort, was los ist, zieht sie an sich, und entschuldigt sich dafür, daß er sich in Dinge eingemischt hat, die ihn nichts angehen. Um einen Schlußstrich zu ziehen, schickt sie ihn los, Nina aufzuwecken. Am nächsten Morgen wollen sie Richtung Süden fahren, ein paar Tage faulenzen, und bis dahin ist noch viel zu tun.
Als Gilles wieder fort ist, stützt sie sich mit den Ellbogen auf den Rand des Spülbeckens, aber das Radio wieder anzuschalten wagt sie nicht. Sie schaut durch das geschlossene Fenster.
Der weiße Lieferwagen hat den Hang erklommen und die letzte Kurve erreicht. Er fährt jetzt langsamer, als bräuchte er etwas Zeit zum Verschnaufen. Marion wird stutzig und schaut genauer hin: Sie erkennt die Silhouette des Fahrers, der sich über den Beifahrersitz beugt. Bestimmt studiert er eine Karte, weil er sich verfahren hat. Schließlich kommt das Fahrzeug ganz zum Stehen. Trotz tosenden Windes und einer Folge von Donnerschlägen, die immer näher kommen, hört Marion, wie die Handbremse gezogen wird. Die Tür geht auf, ein junger Mann mit Rasta-Mütze springt auf die Straße und geht mit wippendem Gang auf das Eingangstor zu. Er beugt sich über den Briefkasten, auf dem ihre drei Namen stehen, und sieht zum Fenster hoch. Marion tritt rasch zur Seite, weil sie nicht nackt gesehen werden will, doch dann fällt ihr ein, daß sie ein T-Shirt von Gilles übergestreift hat, ehe sie in die Küche kam, und sie stößt einen Fensterflügel auf.
Der Mann macht aus seiner Ungeduld keinen Hehl, so als sei Marion persönlich daran schuld, daß er die Orientierung verloren hat.
»Haben Sie sich verfahren?« schreit sie, um das immer lautere Donnergrollen zu übertönen. »Die Straße hier führt nur zu unserem Haus.«
»Ich weiß«, erwidert der Fahrer mit wütendem Blick. »Seit zwei Stunden kurve ich schon durch die Gegend. Aber gut, jetzt hab ich Sie ja gefunden …«
Auch er muß schreien. Ein paar dicke Tropfen landen auf seiner Mütze, und er blickt hoch, um zu sehen, wann sich der Zorn des Himmels über ihm entladen wird.
»Wie bitte?« brüllt Marion. »Was haben Sie gesagt?«
Er streckt ein Blatt Papier in die Höhe, immer noch bemüht, die Ruhe zu bewahren, während weitere Tropfen vom pechschwarzen Himmel herabfallen.
»Sie sind doch Madame Marion? Edwige Marion?«
»Ja, aber …«
»Ich habe eine Lieferung für Sie!« schreit er und duckt sich. »Kann ich reinkommen? Ich hab heute schon geduscht.«
»Warten Sie«, protestiert Marion. »Das verstehe ich nicht. Was für eine Lieferung? Ich habe nichts bestellt!«
Der Gedanke, daß Gilles dahinterstecken könnte, bringt ihr Blut in Wallungen. Sie ruft sich die Situation des Vortags in Erinnerung, als er beim Nachtisch um ihre Hand angehalten hat.
»Heirate mich!« Es klang wie ein Befehl. Als er dann Marions finsteren Blick bemerkte, hatte er sich rasch korrigiert: »Ich möchte dich in aller Form und mit allem gebotenem Ernst bitten, mich zu heiraten, meine Liebste …«
Ein Blick zum Lieferwagen, auf den inzwischen der Wolkenbruch niederprasselt, treibt ihr die Zornesröte ins Gesicht. Gilles wird doch wohl ihre Antwort nicht vorweggenommen haben? Er wird doch wohl nicht auf die Idee gekommen sein, ihr an einem Sonntagmorgen, nach dem Liebesspiel und einer heißen Nacht, seine Möbel liefern zu lassen?
»Hören Sie«, empört sich der Fahrer. »Ich habe nicht vor, meinen Sonntag vor Ihrer Haustür zu verbringen. Nachdem ich sowieso schon zuerst bei Ihrer alten Adresse war. Zum Glück hat mir ein netter Nachbar gesagt, daß Sie umgezogen sind … Nehmen Sie die Ladung jetzt an, oder soll ich Ihnen alles in den Garten kippen?«
Die Ladung? Hat er wirklich »die Ladung« gesagt? O Gott, dann hat sie also den richtigen Riecher gehabt. Gilles zieht ein!
»Was ist denn los?« hört sie hinter sich die Stimme ihres Geliebten. »Was schreist du so?«
Marion dreht sich um.
»Sag mal, Gilles Andrieux«, erwidert sie und mustert ihn scharf, »du bist nicht zufällig im Begriff, hier einzuziehen?«
Sie deutet auf den Lieferwagen und den Fahrer, der sich unter einen Trompetenbaum geflüchtet hat. Gilles Verblüffung kann nicht gespielt sein.
»So etwas würdest du doch nicht tun, oder?« fragt sie wieder und weiß nicht mehr, ob sie sich ärgern oder über die beleidigte Miene ihres Lebensgefährten lachen soll.
»Ich hoffe, das ist nicht dein Ernst«, sagt er, als er endlich zu begreifen scheint, was überhaupt los ist. »Und laß doch den armen Typen da nicht mitten im Gewitter unter einem Baum stehen, das ist gefährlich!«
»Was macht ihr hier eigentlich? Bei dem Krach kann ja kein Mensch schlafen!«
In der Küchentür steht Nina, zerzaust und im Pyjama, die Augen noch vom Schlaf verklebt, und blinzelt ins Morgenlicht. Ein wandelnder Vorwurf.
»Es ist wegen dem Lieferwagen«, stammelt Marion.
»Welchem Lieferwagen?«
Nina reißt die Augen auf. Ihre Mutter erscheint wie vor den Kopf geschlagen und gibt eine verworrene Erklärung ab. Das liegt an ihm, denkt die Kleine voller Groll, während sie auf Gilles nackte Füße starrt, deren Zehen sich auf dem Fliesenboden krümmen.
»Jetzt hört mal zu«, sagt Marion schließlich entnervt und geht zur Haustür. »Ich weiß nicht, was das Ganze soll, aber ich habe den Eindruck, daß mir hier irgend jemand einen bösen Streich spielt.«
Sie schiebt den Riegel zurück und öffnet die Tür, worauf der Fahrer völlig durchnäßt hereinstürzt; die bunte Mütze klebt ihm am Kopf, während der Regen immer heftiger auf die Karosserie seines Autos trommelt.
»Tut mir leid«, murmelt Marion. »Ich mache Ihnen einen Kaffee.«
Der Mann, der sich schon wieder beruhigt hat, nimmt die Einladung mit einem Nicken an und reicht ihr den aufgeweichten Zettel.
»Unterschreiben Sie hier. Wo soll ich das Ganze hinstellen?«
Marion wird plötzlich schwindelig; sie lehnt sich an die leuchtend gelbe Küchenwand und hält sich an einer Stuhllehne fest.
»Ich unterschreibe gar nichts! Ich weiß überhaupt nicht, was Sie mir da bringen. Ich nehme keine Lieferung an, solange ich nicht weiß, worum es sich handelt und wer der Absender ist.«
Der Fahrer hält ihr nochmals den Zettel unter die Nase, worauf sie ihn schließlich entgegennimmt. Auch Gilles und Nina sind inzwischen nähergekommen. Das Mädchen mustert den Rasta-Mann, als ginge eine große Gefahr von ihm aus, und auch Gilles, der angespannt wirkt, sieht so aus, als wolle er ihm jede Sekunde an die Gurgel gehen.
»Hier steht’s. Fünfzehn Kartons auf Ihren Namen, der Absender ist Monsieur Tarquin, Notar, Cours Lafayette 12 in Lyon. Reicht Ihnen das?«
Der Mann sieht aus wie ein waschechter Jamaikaner, aber sein makelloser Lyoneser Akzent deutet auf eine weniger exotische Herkunft hin.
»Fünfzehn Kartons! Ich glaub, ich träume, du hast wohl die ganze Heilsarmee geplündert«, lästert Nina, die Marions Vorliebe für Trödelkram kennt.
»Ich versteh das nicht«, murmelt Marion mißmutig. »Das muß ein Irrtum sein, ich rufe diesen Notar an.«
»Heute ist Sonntag«, erwidert der Mann mit einem mitleidigen Achselzucken. »Ich hab den Job aus reiner Nettigkeit angenommen, und außerdem hab ich dann morgen weniger zu tun. Aber den ganzen Tag schlag ich mir nicht damit um die Ohren. Ich soll liefern, also liefere ich. Jetzt sagen Sie, was Sie wollen, sonst stell ich Ihnen den ganzen Kram in den Hof!«
Gilles setzt gerade an, den jungen Mann zu mehr Höflichkeit zu ermahnen, da unterbricht ihn Marion mit einer Handbewegung.
»Sie haben recht, wir haben schließlich alle zu tun«, sagt sie und hält nach einer Regenjacke oder einem Schirm Ausschau, um sich in den sintflutartigen Regen, der inzwischen noch heftiger geworden ist, hinauszuwagen.
Sie läuft zum Lieferwagen, dicht gefolgt von dem jungen Rasta-Mann, der durch die Pfützen patscht wie ein tapsiger kleiner Hund. Er öffnet eine Tür, und Marion gibt ihm zu verstehen, daß sie in den Wagen steigen will. Er reicht ihr die Hand, aber sie ignoriert seine Geste und ist mit einem Satz im Laderaum verschwunden. Eine Serie von Blitzen, denen fast im gleichen Moment die Donnerschläge folgen, deutet darauf hin, daß sich das Gewitter direkt über ihnen befindet. Nina, die in der Eingangstür steht, behauptet sogar, gesehen zu haben, wie eine Feuerkugel vom Himmel fiel, worauf Gilles sie ins Haus zieht. Wieder am Küchenfenster, warten die beiden gespannt, was Marion sich wohl einfallen lassen wird, um den Fahrer und seine Kartons zum Teufel zu schicken. Seit fünf Minuten ist sie jetzt schon in diesem blöden Lieferwagen, und Nina beginnt ungeduldig zu werden.
Als Marion schließlich wieder zum Vorschein kommt, fällt ihnen als erstes ihr bleiches Gesicht auf und der verstörte Blick, mit dem sie zu ihnen herübersieht, fast so, als hätte sie vergessen, daß es die beiden gibt.
Der Regen hat noch nicht aufgehört, doch er wird von Minute zu Minute schwächer, und auch der Wind flaut ab. Unter ihrem Regenschirm, der den Cognac Martell anpreist, winkt Marion ihnen zu. Beide beugen sich aus dem Fenster.
»Macht mal die Garage auf und räumt eine Ecke frei!« ruft sie. »Wir müssen fünfzehn Kartons unterbringen.«
Nina sieht Gilles an, der seinen Blick auf Marion geheftet hat, die wiederum den Lieferwagen fixiert. Keiner rührt sich. Erst das Telefon holt alle in die Realität zurück. Nina läuft los.
Als sie zurückkommt, ist die Sommerbräune aus ihrem Gesicht gewichen. Unsicher setzt sie einen Fuß vor den anderen und ergreift instinktiv Gilles Hand, während sie ihre Mutter voller Verzweiflung anstarrt.
»Wer war das?« will Marion wissen.
»Das war für dich«, flüstert Nina mit zitternder Stimme. »Das Krankenhaus.«
4
Von ihren Männern hat Marion schon einige sterben sehen. Die Vorstellung, daß sie noch einen verlieren könnte, ist unerträglich. Ausgerechnet ihn.
Talon atmet noch, aber durch den Kopfverband und die rote Jodtinktur, die man hastig auf seinen nackten Oberkörper aufgetragen hat, ist er kaum zu erkennen. Die erste Kugel hat seine Kopfhaut gestreift, sie war harmlos. Die Kugel, die ihn womöglich ins Jenseits befördern wird, ist in seinen Bauch eingedrungen, wo sie sich noch immer befindet. Kaliber 38, hohe Mündungsgeschwindigkeit. Der diensthabende Beamte, den Nina am anderen Ende der Leitung hatte, bat ohne Umschweife darum, man möge so schnell wie möglich Kommissarin Marion benachrichtigen: Lieutenant Talon liege im Sterben und habe nach seiner Chefin verlangt, so wie andere sich den Beistand eines Priesters wünschen. Die Nachricht ist wie ein Gewitter über Nina hereingebrochen, die Talon wie einen großen Bruder liebt. Sie wäre beinahe ohnmächtig geworden.
Talon war nicht bei Bewußtsein, als Marion ungekämmt und mit irgendwelchen rasch zusammengeklaubten Kleidern am Leib im Krankenhaus eingetroffen ist. Er wird noch immer künstlich beatmet und ist an ein Gerät zur Kontrolle der Herzfunktion angeschlossen, und obwohl Marion schon seit einer halben Stunde sein blutleeres Gesicht fixiert, ohne auch nur das leiseste Lebenszeichen wahrzunehmen, kann sie sich nicht dazu durchringen zu gehen; sie ist sich sicher, daß ihre Anwesenheit der einzige Grund dafür ist, daß man die Geräte noch nicht ausgeschaltet hat.
Irgendwo schlägt eine Tür, und sie hört durch Kreppsohlen gedämpfte Schritte, die näherkommen. Der Assistenzarzt, der Marion empfangen hat, um ihr Talons Fall zu erklären, geht um Bett Nummer 2 der Intensivstation herum und stellt sich vor sie hin, die Hände in den Taschen seines aufgeknöpften Kittels. In seinen Augen sucht sie nach einem Grund, doch noch zu hoffen, aber er weicht ihrem Blick aus.
»Der Mann, der zusammen mit ihm eingeliefert wurde, ist soeben verstorben. Um neun Uhr achtundzwanzig«, sagt er mit ausdrucksloser Stimme.
Er muß um die dreißig sein, obwohl er irgendwie alt wirkt mit seinem bleichen Gesicht und dem schütteren Haar, die Haut voller Aknenarben, von denen einige angeschwollen sind und so frisch, als stecke er mitten in der Pubertät.
»O mein Gott«, murmelt Marion, während ihr Blick wieder zu Talon wandert. »Mach, daß alles ein Alptraum ist …«
»Es tut mir leid«, sagt der Arzt mit Grabesstimme. »Aber Sie sollten wissen, daß er kaum Chancen hat, es lebend zu überstehen.«
»Aber er war doch wieder bei Bewußtsein!«
»Nicht daß ich wüßte …«
»Er hat mich zu sich gebeten. Ich dachte … Dann haben Sie das veranlaßt?«
»Auf seinem Organspender-Ausweis steht Ihr Name, neben seiner Blutgruppe. Sie sind die Person, die wir im Todesfall verständigen sollten.«
»Im Todesfall!« empört sich Marion. »Das ist doch verrückt … Er ist noch am Leben, und Sie haben schon alles verplant, sein Herz, seine Lunge, seine …«
»Wir haben ihn letzte Nacht operiert«, fällt ihr der Arzt ungeduldig ins Wort. »Aber die Kugel steckt in einem Wirbel in unmittelbarer Nähe zum Rückenmark. So nah, daß wir ein zu großes Risiko eingehen, wenn wir sie entfernen. Sollte er überleben, bräuchte er nur einmal zu stolpern, das Stückchen Blei würde sich verschieben, und dann …«
Was ist besser, tot zu sein oder ein Lebender auf Abruf, fragt sich Marion.
»Wann haben wir Gewißheit?«
Der Assistenzarzt verzieht den Mund.
»Für mich ist er tot. Allerdings ist noch eine gewisse Hirntätigkeit zu verzeichnen, weshalb der Chef noch ein bißchen warten will. Gibt es Familienangehörige, die benachrichtigt werden sollten?«
Marion schüttelt den Kopf, während sie fassungslos auf das aschgraue Gesicht ihres Kollegen starrt, seinen schütteren Bart und die geschlossenen Augen. Auf einmal sieht sie ihn vor sich, wie er ein großes, kariertes Taschentuch zückt, um seine Brille zu putzen, wie er mit von Druckertinte schwarz verschmierten Fingern über seine weichen Wangen streicht, und die Empörung schnürt ihr die Kehle zu.
»Das kannst du mir nicht antun, Jérôme Talon!« sagt sie mit zusammengebissenen Zähnen, während sich hinter ihr der Assistenzarzt Richtung Tür davonmacht. »Hörst du mich? Das ist unmöglich, nicht du.«
Das regelmäßige Piepen des Monitors, der Talons Herztätigkeit abbildet, ist die einzige Reaktion auf den Befehl, den sie ihrem Lieutenant mit heiserer Stimme zugeflüstert hat. Ihre Verzweiflung ist so groß, daß sie gegen das ungeschriebene Kripo-Gesetz verstoßen hat, demzufolge Chef und Untergebene sich zu siezen haben.
»Und Nina? Was soll ich Nina sagen? Findest du nicht, daß sie schon genug mitgemacht hat? Ihr Vater, Léo … und jetzt du … Was ist eigentlich mit euch Kerlen los, daß ihr ständig das Weite sucht? Was soll das?«
In der Stille des Krankenhauses wartet sie auf eine Antwort. Es kommt ihr so vor, als hätte Talon den linken Zeigefinger bewegt, und wie gebannt starrt sie darauf, beschwört ihn, sich noch einmal zu rühren. Aber sie hat es sich eingebildet, nichts ist passiert, Talon wird sich nicht rühren.
»Verdammt noch mal«, flucht Marion. »Was hab ich dem lieben Gott eigentlich getan? Warum war ich gestern Nacht nicht bei dir, Jérôme? Statt dessen …«
Sie beugt sich zu ihm vor, und unter ihren Lidern brennen die Tränen, die sie unterdrückt, weil man ihr gesagt hat, daß man »positiv« sein muß, wenn man einem Menschen dabei helfen will, aus dem Koma zu erwachen. Sie flüstert:
»Statt dessen habe ich gegessen, geschlafen und gevögelt, mein lieber Jérôme, während sie dich abgeknallt haben. Ich mache mir Vorwürfe, schreckliche Vorwürfe. Jérôme, du mußt mich hören!«
So sehr sie es auch zu verhindern sucht, stiehlt sich doch eine Träne aus ihrem Auge und kullert an ihrer Nase hinunter. Sie wischt sie mit dem Handrücken ab. Mit gebrochener Stimme fährt sie fort:
»Ich verbiete dir zu sterben, hast du verstanden? Du hast nicht das Recht, mich allein zu lassen. Wir beide haben uns doch noch nie im Stich gelassen, Talon, oder? Was soll ich jetzt bloß machen? Lavot ist schon nach Lateinamerika abgehauen. Er sagt, es wär nur für ein Jahr, aber ich weiß, daß er nicht mehr zurückkommt. Er hat sich für Mathilde und die Jungs entschieden, ist ja auch normal. Und Quercy, der strebt nach Höherem … Der verzieht sich nach Paris, ins Ministerium. Und jetzt bist du auch noch dabei, den Löffel abzugeben …«
Ein unterdrücktes Schluchzen schnürt ihr die Kehle zu.
»Was soll in dem ganzen Schlamassel bloß aus mir werden? Ist dir eigentlich klar, daß ich diesen Job ohne dich nicht mehr machen kann? Bitte, Talon … Jérôme … sag was. Nur ein Wort, damit ich weiß, was du denkst. Ich hab dich doch lieb, du blöder Idiot …«
Sie beugt sich noch weiter zu ihm vor, legt vorsichtig ihre Stirn auf Talons leblose, wenn auch warme Hand und läßt ihren Tränen freien Lauf, ohne jede Scham, wie eine große Schwester, die ihren kleinen Bruder sterben sieht und ihm etwas von ihrem Leben abgeben will.
5
»Das Schlimmste ist die Ohnmacht. Du stehst da und würdest alles geben, dein Blut, dein Leben … alles. Aber das kannst du nicht, du kannst nichts tun. Nichts. Der Tod nimmt dir die Entscheidung aus der Hand, er nimmt dir alles. Deine Freunde, deine Brüder.«
Marion streift durch das Wohnzimmer wie ein Raubtier im Käfig. Wegen der Feuchtigkeit und weil es mit Einbruch der Nacht plötzlich kühler geworden ist, hat Gilles im Kamin ein knisterndes Feuer entzündet; über der Glut hat er ein paar in Ingwersauce eingelegte Hühnerbrüstchen gegrillt, dazu eine Handvoll Pfifferlinge, die er Gott weiß wie herbeigezaubert hat. Er hat sich die größte Mühe gegeben, um Marion und Nina aufzuheitern, aber beide haben das Essen verschmäht, und die Kleine hat nicht ein einziges Mal den Mund aufgetan. Der weiße Rand um ihre Lippen verriet, wie schwer es ihr fiel, nicht aufzuschluchzen und ihren Kummer zu verbergen. Schließlich ist sie schlafen gegangen, und als Marion eine Viertelstunde später nach ihr gesehen hat, lag sie zusammengerollt, von Kummer und Müdigkeit übermannt, auf dem Bett. Das alte Kuscheltier, das sie in besonders verzweifelten Momenten aus den Tiefen des Wandschranks hervorholt, hielt sie fest an sich gedrückt.
»Er ist noch nicht tot«, stellt Gilles behutsam richtig. »Du mußt daran glauben, Marion … Wo noch ….«
»Wo noch Leben ist, ist auch Hoffnung«, unterbricht ihn Marion in bitterem Ton. »Die alte Leier kenn ich schon, danke.«
Gilles’ Miene verfinstert sich. Es ist nicht zu übersehen, daß seine Beschwichtigungsversuche vergeblich sind. Nicht nur das, Marion nimmt sie ihm sogar übel.
»Das wollte ich nicht sagen«, erwidert er geduldig. »Solange er noch Vitalfunktionen aufweist, darf man in der Tat hoffen, daß er es schafft. Ich denke, du hast gut daran getan, den ganzen Tag bei ihm zu bleiben.«
Marion bleibt stehen und mustert Gilles. Schwang in seiner letzten Bemerkung nicht ein unterschwelliger Vorwurf mit? Die ohnehin schlechte Stimmung wird noch angespannter. In ihrem Zustand bringt sie es fertig, jeden noch so harmlosen Satz in einen Angriff gegen ihre Person umzudeuten. Gilles fügt eilig hinzu:
»Du kannst nichts dafür, Marion … Solche Dinge passieren einfach … Es ist nicht deine Schuld.«
»Doch, es ist meine Schuld«, sagt sie und starrt wieder in das Kaminfeuer. »Ich hätte dort sein sollen, bei ihm, mich den Kugeln stellen wie die anderen …«
»Also wirklich! Red doch keinen Unsinn … Du kannst und brauchst nicht ständig bei ihnen zu sein, es sei denn, du bist keine gute Chefin. Die Jungs sind erwachsen, volljährig, selbständig.«
»Eben nicht, das haben wir ja gesehen! Die Sache wäre anders gelaufen, wenn ich dabeigewesen wäre. Wenn geschossen wird, vergißt man, wer man ist und wo man ist, dann ist man nur noch ein kleines Kind, das die Hosen voll hat. Du kannst gar nicht wissen, wie das ist, woher auch.«
Zuerst will Gilles protestieren, aber dann wird ihm klar, daß es sinnlos ist, in einen Streit einzusteigen, den seine Partnerin wahrscheinlich nur sucht, um sich abzureagieren und ihre Schuldgefühle zu vergessen. Selbstbeherrschung ist eine der größten Stärken dieses Mannes, der so anders ist als alle Männer, die Marion bis dahin kennengelernt hat. Er streckt ihr die Hand entgegen, damit sie sich zu ihm auf die Bank setzt, aber sie tut so, als bemerke sie es nicht.
»Ich baue Brücken und Straßen«, erwidert er trotzdem. »Ich weiß nicht viel über deinen Beruf, sicher, aber du vergißt, wie wir uns kennengelernt haben … Im Club Med war das nicht, wenn ich mich recht erinnere …«
Marion entspannt sich ein wenig und läßt sich sogar zu einem kurzen Lächeln hinreißen. Dabei ist die Erinnerung an ihre erste Begegnung alles andere als komisch. Beim bloßen Gedanken daran läuft es Gilles kalt den Rücken herunter. Marion dreht sich zu ihm um. Sie sieht mitgenommen aus, und ihr Blick wirkt plötzlich hilflos.
»Ich will nicht, daß Talon stirbt«, bricht es aus ihr hervor, während sie sich in seine Arme flüchtet. »Es ist so ungerecht, ich will das nicht. Ich hätte dasein sollen, ich hätte verhindert, daß auf ihn geschossen wird …«
Gilles hält sie lange umschlungen, läßt ihr Zeit, all diese nutzlosen Worte zu sagen und ihre Wut und Verzweiflung herauszuschreien, an der sie zu ersticken droht, seit sie aus dem Krankenhaus zurückgekehrt ist und krank vor Angst darauf wartet, daß das Telefon klingelt. Er sagt ihr, daß er sie liebt und daß er den Schmerz mit ihr teilen wird. Und langsam, ganz allmählich, kommt Marion zur Ruhe. Schließlich schweigen beide, wie in stiller Andacht. Sie ergreift als erste wieder das Wort.
»Ich werde morgen nicht mitfahren«, sagt sie und schnieft. »Ich muß mich um Talon kümmern und um diese Schießerei. Das bin ich ihm schuldig.«
Gilles nickt schweigend. Er hat damit gerechnet, und trotz seiner Enttäuschung ist er irgendwie auch stolz. Stolz auf diese aufrechte, starke Frau, die eingewilligt hat, ihn zu heiraten. Im Oktober, weil das die Zeit der Weinlese ist und sie mütterlicherseits aus dem Burgund stammt.
»Und überhaupt muß ich auch mit diesem Notar reden«, fügt sie hinzu. »Du hast mich noch gar nicht gefragt, warum ich diese Kartons heute morgen angenommen habe …«
Gilles kommt es so vor, als lägen Lichtjahre zwischen dieser morgendlichen Episode und jetzt, obwohl ihn die Sache durchaus nicht kaltgelassen hat; schließlich war er derjenige, der sich die ganze Arbeit aufgehalst und die fünfzehn bleischweren, von Staub und Spinnweben bedeckten Kartons in die Garage geschleppt hat.
»Also gut«, seufzt er. »Warum?«
»Eigentlich weiß ich das selbst nicht genau. Na ja, ich habe einen Karton aufgemacht und darin den Namen des Absenders gefunden.«
Sie schweigt wieder und schließt die Augen, den Kopf an Gilles Schulter gelehnt, als hätte sie damit alles zu dem Thema gesagt.
»Und wer ist es?«
»Gustave Léman.«
»Was du nicht sagst ….« erwidert Gilles ironisch. »Und wer ist dieser Gustave Léman?«
»Er war der beste Freund meines Vaters. Das ist lange her … Habe ich dir von meinem Vater erzählt?«
»Du hast mir nur gesagt, daß er Polizist war und im Dienst getötet wurde, als du noch ein kleines Mädchen warst.«
»Ja, genau. Gus und er waren wie Brüder. Ich erinnere mich noch ziemlich gut an Gus, aber zeitlich einordnen könnte ich meine Erinnerungen nicht. Ich glaube, daß ich ihn seit mindestens dreißig Jahren nicht mehr gesehen habe. In der ganzen Zeit habe ich eigentlich auch nichts von ihm gehört. Nichts, nicht einmal das kleinste Lebenszeichen.«
»Warum soll er dir dann die Kartons geschickt haben? Wenn ein Notar eingeschaltet war, bedeutet das wohl …«
»Daß Gus gestorben ist.«
Gilles sieht sie an. Er ist versucht, ihr etwas zu entgegnen, aber er tut es nicht. Für heute hat er genug geredet.
6
Der Notargehilfe der Kanzlei Charles Tarquin und Söhne öffnet die Tür des Büros von Charles Tarquin junior und kündigt die Besucherin an.
»Gestatten Sie, Maître Tarquin: Madame Edwige Marion!«
Seine manierierte Unterwürfigkeit ist Marion ein Rätsel. Man kann sich durchaus respektvoll gegenüber seinem Vorgesetzten verhalten, ohne es gleich so zu übertreiben.
Die junge Frau überquert einen dicken Wollteppich in Rot- und Grüntönen und geht auf zwei antike, edle Ledersessel zu, auf die der Notargehilfe mit theatralischer Geste gedeutet hat.
Im ersten Moment glaubt Marion, daß ein Irrtum vorliegt und das Büro leer ist. Doch dann hört sie hinter dem riesigen Empire-Schreibtisch ein schabendes Geräusch und fährt aus ihrem Sessel hoch, was dieser mit einem langgezogenen Ächzen quittiert. Vor Verlegenheit verschlägt es ihr erst einmal die Sprache, als sie einen kleinen, schmächtigen Mann erblickt, der sich in Kauerstellung seine Schuhe, vermutlich Größe 32, zubindet und dabei ihren neugierigen Blick erwidert. Er hat die Glupschaugen eines Chamäleons, einen Spitzbart, wie er zur Zeit der ägyptischen Pharaonen modern war, und trägt eine merkwürdig zusammengewürfelte Kluft, deren Farben auf Teppich und Tapeten abgestimmt sind.
»Guten Tag«, stammelt Marion.
»Diese verflixten Schnürschuhe«, schimpft Maître Charles Tarquin junior vor sich hin. »Bei meinen Füßen! Warum habe ich eigentlich auf diese dusselige Kuh gehört? Mokassins! Es geht doch nichts über Mokassins!«
Der Notar richtet sich wieder auf und macht sich daran, seinen Stuhl zu erklimmen. Wenn er steht, kann er so eben über die Schreibtischplatte aus Mahagoni hinwegsehen, was nach Marions Schätzung auf eine Größe von ein Meter fünfzehn, höchstens ein Meter zwanzig schließen läßt.
»Guten Tag, Kommissarin Marion!« sagt er mit lauter, hoher Stimme, nachdem er erstaunlich behende wieder Platz genommen hat. »Was kann ich für Sie tun?«
Er stützt seine kurzen Unterarme auf die Schreibtischkante und faltet die Hände, deren Finger so dick sind wie die eines erwachsenen Mannes, aber nur streichholzlang. Marions fassungsloses Gesicht veranlaßt ihn zu einem breiten Grinsen, und er hilft ihr rasch über ihre Verlegenheit hinweg:
»Manche Leute würden sagen, daß ich ein kleiner Mann bin oder ein bißchen zu kurz geraten. Alles dummes Geschwätz. Ich bin ein Zwerg. Das kann jeder sehen, also brauchen wir nicht länger darüber zu reden. Sie sind eine sehr schöne Frau, Kommissarin Marion.«
Marion weiß nicht, ob sie die Flucht ergreifen oder losprusten soll, aber Maître Tarquin hat seine vorstehenden Augen schon auf das Aktenblatt geheftet, das der ehrerbietige Gehilfe für ihn vorbereitet hat. Als er aufsieht, ist seine Miene so ernst und professionell, daß Marion sich wieder auf den Grund ihres Kommens besinnt.
»Ich kann Ihnen nicht viel dazu sagen«, verkündet er mit seiner merkwürdigen Stimme, als die junge Frau ihm ihr Problem vorgetragen hat. »Ich bin nicht der Testamentsvollstrecker von Monsieur Gustave Léman. Ich habe die Sache von meinem Kollegen Renoir in Dijon übertragen bekommen … Monsieur Léman ist gestorben in … warten Sie …«
Er blickt wieder auf das Blatt Papier, wobei er seinen kurzen Spitzbart streichelt.
» … Charmes. Das liegt auch im Departement Côte d’Or. Kennen Sie den Ort?«
»Nie davon gehört. Meine Mutter ist in Dijon geboren, aber sie hat nur die ersten zwanzig Jahre ihres Lebens dort verbracht, wenn ich mich recht erinnere. Sie ist vor achtzehn Jahren gestorben. Das ist das einzige, was mir zu dieser Gegend einfällt.«
»Und dieser Gustave Léman?«
»Er war ein Freund meines verstorbenen Vaters.«
»Tja, vor drei Tagen ist Monsieur Léman gestorben und hat Sie zu seiner Alleinerbin benannt.«
Marion muß an ihre Garage denken, in der sich fünfzehn Kartons stapeln. Ein komisches Erbe. Die Erinnerung an Gilles, ächzend unter dem Gewicht dieses merkwürdigen Nachlasses, entlockt ihr ein Lächeln.
»Warum mich? Ich finde, das ist eine sonderbare Vorgehensweise«, erwidert Marion, während Maître Tarquin junior sie erstaunt ansieht. »Ich meine, niemand hat mich davon in Kenntnis gesetzt … Ich habe diese Kartons aus Mitleid mit dem Fahrer des Lieferwagens angenommen, aber … ich habe darüber nachgedacht und … könnte ich dieses Erbe … ausschlagen?«
»Selbstverständlich. Allerdings ist der Fall meinen Informationen zufolge alles andere als einfach.«
»Das heißt?«
»Kannten Sie Monsieur Léman gut?«
»Aber das habe ich Ihnen doch gerade erklärt, Maître Tarquin!« ruft Marion aus. »Er war so alt wie mein Vater, und ich habe ihn im Lauf meines Lebens vielleicht drei- oder viermal gesehen, in der Zeit zwischen meiner Geburt und meinem fünften oder sechsten Lebensjahr.«
Maître Tarquin neigt erneut den Kopf und verzieht seine dicken Lippen, was ihn nicht unbedingt anziehender macht.
»Ich wollte sagen, haben Sie ihn von Berufs wegen gekannt?«
»Warum? Sollte ich?«
Marion versteht überhaupt nichts mehr, und dieses Ratespiel mit einem zwergwüchsigen Notar geht ihr langsam auf die Nerven.
»Hören Sie, Maître Tarquin«, sagt sie in bestimmtem Ton, »ich bitte Sie um eine Erklärung, wenn das nicht zuviel verlangt ist.«
»Ich denke, Sie werden nicht umhinkönnen, meinem Kollegen Renoir im Burgund einen Besuch abzustatten.«
»Soll das ein Witz sein? Das kommt überhaupt nicht in Frage.«
Der kleine Mann richtet sich auf.
»So lautet Monsieur Lémans Letzter Wille. Außerdem obliegt es Ihnen, die Beerdigung zu organisieren, so steht es in meiner Akte.«
Das ist ja wohl die Höhe, denkt Marion verdutzt. Jetzt soll ich auch noch bezahlen!
Die Zwergenhände klatschen auf den Schreibtisch, und der Notar springt mit einem Satz von seinem Stuhl. Er stellt sich vor Marion auf. Da sie noch sitzt, sind ihre Gesichter fast auf gleicher Höhe.
»Ich habe so das Gefühl«, sagt er und beugt sich mit einem vieldeutigen Lächeln zu ihr hin, »daß Sie diese Reise unternehmen werden. Als Polizistin werden Sie sich das nicht entgehen lassen.«
Marion weicht unmerklich zurück. Dieser Mann weckt eine instinktive Abneigung in ihr und geht ihr außerordentlich auf die Nerven. Sie denkt an Talon, der im Sterben liegt, an die Ermittlungen zu der Schießerei, die noch im üblichen Anfangschaos stecken, an Gilles Enttäuschung, an Ninas Kummer … Mit einem Ruck steht sie auf, streicht ihre beigefarbene Leinenhose glatt, nimmt die dazu passende Jacke, die sie über die Armlehne des Sessels gelegt hat, und macht einen großen Schritt zur Seite, um den Abstand zwischen sich und dem Notar zu vergrößern.
»Glauben Sie?« fragt sie und blickt fest in die Augen des kleinen Mannes, dessen Spitzbart jetzt allenfalls noch ihre Taille streifen könnte.
»Ich bin mir sogar sicher. Denn wissen Sie, Kommissarin Marion, Monsieur Gustave Léman ist in der Tat gestorben, aber er starb keines natürlichen Todes, wie man so schön sagt … Er wurde ermordet.«
7
»Was habe ich mit diesem alten Kerl zu schaffen, den ich noch nicht mal gekannt habe …«, murmelt Marion, während sie mit Blaulicht und heulendem Martinshorn durch die Straßen der Stadt rast. Ihre Gedanken kreisen immer wieder um Charles Tarquin junior und das tragische Ende von Gustave Léman, denn sonst müßte sie an das denken, was sie am Ende der Straße erwartet, in die sie gerade mit Tempo hundert eingebogen ist. Ein plötzlicher Anruf aus dem Krankenhaus hat sie aus den Fängen dieses merkwürdigen Notars befreit.
Auf den Straßen herrscht kaum Verkehr. Im August ist die Stadt menschenleer, sogar die Polizisten gehen am Strand auf »Verbrecherjagd«.
In der Ferne sieht sie die schmutziggelben dicken Mauern des Édouard-Herriot-Krankenhauses.
Talon liegt noch in derselben Abteilung wie am Vortag, und als sie die Intensivstation betritt, sieht sie vor dem Bett jemanden in einem weißen Kittel stehen, dessen schlaff herabhängende Schöße schon von weitem verraten, daß es wieder der Assistenzarzt ist. Als der pickelige Mediziner sich zu ihr umdreht, erblickt Marion hinter ihm das aschgraue Gesicht von Talon. Er ist noch immer nicht bei Bewußtsein.
»Was ist los?« fragt Marion mit belegter Stimme.
»Sie müssen ein Formular unterschreiben, mit dem Sie uns zur Organentnahme ermächtigen. Gestern waren Sie so schnell wieder weg, daß ich …«
»Gestern haben Sie mir gesagt, daß er noch eine kleine Überlebenschance hat. Daß Ihr Chef noch Hoffnung hegt und daß …«
»Aber ja doch, sicher. Die Unterschrift brauchen wir nur für den Fall, daß wir schnell handeln müssen und Sie nicht da sind.«
»Wo soll ich denn bitteschön sein?« zischt ihn Marion an.
Der Arzt zuckt mürrisch die Achseln.
»Das ist eine reine Formsache.«
Dann ist Talon, sein Lachen, seine Freuden, seine Sorgen, sein ganzes Leben jetzt also nur noch eine reine Formsache …
Sie ist schon drauf und dran, diesem fischblütigen Arzt eine schneidende Antwort zu geben, als eine Bewegung an der Tür sie innehalten läßt. Eine mittelgroße junge Frau in Jeans und einem blauen, kurzärmeligen Hemd steht zögernd auf der Schwelle. Sie ist sehr hübsch, mit dunklem Teint, schwarzem, vollem Haar und strahlend weißen Zähnen. Ihr abgespanntes Gesicht läßt auf eine durchwachte Nacht schließen.
»Hallo Meceri«, sagt Marion mit neutraler Stimme. »Es gibt keine besonders guten Neuigkeiten …«
»Ich weiß«, murmelt das junge Mädchen. »Ich war diese Nacht hier …«
Marion dreht sich zum Assistenzarzt um und sieht ihn eindringlich an.
»Schalten Sie das Gerät noch nicht ab, bitte. Er ist jung, er ist stark, und er ist gesund. Wir bleiben bei ihm, wir reden mit ihm. Er wird zu uns zurückkommen, da bin ich mir sicher …«
Der Arzt verschränkt wortlos die mageren Arme über seinem Stethoskop, dessen Bügel klappernd gegeneinanderschlagen, und dreht sich zur Tür um. Lange verweilt sein Blick auf den harmonischen Gesichtszügen von Naïma Meceri, dann sieht er Marion an und seufzt.
»Aber den Zettel müssen Sie trotzdem unterschreiben.«
Es herrscht Schweigen zwischen Kommissarin Marion und ihrer jüngsten Kollegin, die ihre schwarzen Augen verzweifelt auf Talons Gesicht geheftet hat.
»Er wird doch nicht sterben, oder?« sagt sie mit einer Stimme, in der sich Wut und Trauer überlagern.
Meceri ist erst seit knapp zwei Monaten im Polizeidienst und zum ersten Mal mit einer so ernsten Sache konfrontiert. Dem Tod.
»Nein«, lügt Marion, »aber wir sollten uns lieber innerlich darauf vorbereiten. Sie haben gehört, was der Arzt gesagt hat.«
Die junge Frau zupft nervös an ihren Locken.
»Was wird passieren?« fragt sie hilflos. »Bekomme ich Schwierigkeiten?«
»Sie werden Erklärungen liefern müssen, und das ohne Ende. Es wird zu Gegenüberstellungen kommen. Und mit großer Wahrscheinlichkeit auch zu einem Prozeß, in dem es um Fahrlässigkeit gehen wird und um Wiedergutmachung. Letztlich wird sich alles ums Geld drehen.«
»Wird man mich vom Dienst suspendieren?«
»Ach was … Außer Sie haben einen groben Fehler begangen. Im übrigen sind Sie noch Beamtin auf Probe, im schlimmsten Fall könnte man Ihnen deshalb die Übernahme ins Beamtenverhältnis verweigern. Erzählen Sie mir genau, was passiert ist.«
8
Alle sind im Flur, wo eine spontane Betriebsversammlung in Anwesenheit des Gewerkschaftsvertreters stattfindet. In kleinen Gruppen stehen sie um die Kaffeemaschine herum, und Marion hält kurz an, um ihnen zuzuhören.
Was sie aufschnappt, sind allerlei Kommentare über den chronischen Personalmangel, über Kollegen, die aus dem Dienst scheiden und deren Stellen vakant bleiben, über die Inkompetenz der Vorgesetzten, die es sich aus schnöden Karrieregründen verkneifen, »im Ministerium mal ordentlich auf den Tisch zu hauen«, um die nötigen Mittel locker zu machen, über die wachsende Zahl von Polizistinnen, die bei Einsätzen eine Bürde sind. Sie hört, daß die jüngste Polizistin, die als letzte in Marions Abteilung gekommen ist, direkt für den Ausgang der Schießerei am vergangenen Samstag abend verantwortlich gemacht wird, und beschließt, daß es an der Zeit ist, sich einzumischen.
Die erste Person, deren Blick sie begegnet, ist ausgerechnet Naïma Meceri. Mit verschränkten Armen steht sie da, still und bleich an die Wand gelehnt, und offensichtlich erleichtert, als sie Marion kommen sieht. Marion hat sich nach ihrem Gespräch mit Naïma dazu entschlossen, ihren Einfluß geltend zu machen, denn sie ist überzeugt, daß die junge Frau ihre Hilfe brauchen wird, mehr noch als Talon, der im Moment durch seinen Gesundheitszustand unantastbar ist.
Naïma Meceri ist erst vor kurzem zur Lyoneser Kripo gestoßen, wo es neben Marion noch zwei weitere weibliche Mitarbeiter gibt. Erschwerender Begleitumstand: die Neue ist ein »Mischling« – französische Mutter, algerischer Vater –, was zu den üblichen Vorbehalten gegenüber Frauen erschwerend hinzukommt. Dabei ist Meceris Biographie dazu angetan, alle Klischees Lügen zu strafen: Mit ihren zwei älteren Brüdern stammt sie aus einer vernünftig proportionierten Familie, die obendrein intakt ist. Sie kommt nicht aus einem der Vorstadtghettos in La Courneuve, sondern aus Cognac, wo ihr Vater Angestellter in einer Branntweinbrennerei ist. Sie wurde nicht im Alter von zwölf Jahren von ihren Brüdern vergewaltigt und hatte eine glückliche Kindheit. Sie hat mit niemandem eine Rechnung zu begleichen, außer vielleicht mit sich selbst, so wie die meisten jungen Frauen ihres Alters. Ihr größter Schwachpunkt ist nach Marions Ansicht ihre Überstürztheit. Ihrer Begeisterungsfähigkeit und Impulsivität – oder auch Unüberlegtheit – verdankt sie, je nach Tagesform, die Beinamen Intercity oder Attila. Sie wird sich mit der Zeit bessern, und im übrigen findet Marion es absolut nicht normal, daß sie sich ihre ersten Sporen nicht in einer etwas harmloseren Abteilung verdienen darf. Das zu ihrer Verteidigung.
Die Gespräche verstummen auf einen Schlag, als man Marion bemerkt. Eigentlich sollte sie in der Sonne braten, und niemand hat mit ihrem Besuch gerechnet. Sogar Capitaine Yves Capdevil wirkt überrascht. Marion ist dafür um so glücklicher, ihn zu sehen.
Vor einem knappen Monat ist er ins Kriminalkommissariat der Lyoneser Polizei zurückgekehrt, und sie hat die Neuigkeit mit Freude zur Kenntnis genommen. Dabei bedeutet diese Rückkehr für den Beamten ein doppeltes Scheitern: zum einen das Scheitern seiner Beziehung mit einer temperamentvollen, exzentrischen Pariserin, die ihm während ihres gesamten Zusammenseins hart zugesetzt hat; zum anderen das Scheitern seiner Karriere im »Amt für den Schutz von Kulturgütern«, denn für diese, insbesondere die Werke der Malerei, hegt er eine im Grunde noch größere Leidenschaft als die, die er seiner ausgeflippten Geliebten entgegenbrachte. Beides unter einen Hut zu bringen war eine einzige Folter für ihn, und so hat Capdevil, wie zwei Jahre zuvor in entgegengesetzter Richtung, einen Schlußstrich gezogen und erneut alles hinter sich gelassen, um nach Lyon zurückzukehren, wo er noch einige Kontakte hatte. Marion ist die letzte, die sich darüber beklagen würde: Capitaine Capdevil ist ein ausgesprochener Ästhet. Er mag weder Pistolen noch Leichen, was ihn deutlich von Talon unterscheidet, mit dem er bislang ein ungleiches, aber hervorragend funktionierendes Team gebildet hat. »Wie gewonnen, so zerronnen«, denkt Marion bedrückt.
»Setzen Sie sich und hören Sie mir zu!« befiehlt sie ihren Beamten und Beamtinnen, nachdem sie alle in den engen, düsteren Besprechungsraum beordert hat.
Als erstes schildert sie Talons Zustand, was stumm zur Kenntnis genommen wird. Die Kollegen sind erschüttert und gereizt, ihre Gesichter verkrampft.
Dann fährt sie fort:
»In einer knappen Stunde werden die Ermittler der Dienstaufsichtsbehörde mit den Zeugenvernehmungen beginnen. Wie Sie wissen, gibt es Vorschriften, die immer dann gelten, wenn Polizeibeamte direkt in eine Straftat verwickelt sind, und so hat die Staatsanwaltschaft veranlaßt, daß Untersuchungen zu der Schießerei im Chien qui fume, einem Spielklub im Stadtzentrum, durchgeführt werden. Die Umstände dieser bewaffneten Auseinandersetzung zwischen Gästen und Kripobeamten scheinen noch völlig unklar zu sein.«
Marion hat sich von Meceri schildern lassen, wie es dazu kommen konnte, daß ein gewöhnlicher Polizeieinsatz innerhalb von wenigen Augenblicken außer Kontrolle geriet. Natürlich hat sie Talons Version nicht gehört, aber sie kann sich denken, was er als wichtigstes Argument angeführt hätte: den Sommermonat August, in dem die Hälfte der Kollegen in Urlaub sind. Sie selbst ebenfalls nicht da. Dafür der Chien qui fume jeden Abend zum Bersten voll, hauptsächlich Ausländer. Da das Lokal als Schlupfwinkel für gewisse Mafiakreise der Region gilt, die dort ihre Geldwäsche betreiben, wird es seit sechs Monaten intensiv überwacht; man hat sogar einen verdeckten Ermittler eingeschleust. Nachdem der Mann wochenlang nichts von sich hören ließ, hat er sich ausgerechnet besagten Samstag ausgesucht, um sich bei Talon zu melden, der Wachdienst hatte und nehmen mußte, was da war, um überhaupt ein Team aufstellen zu können.
»Einen Frischling und einen Säufer«, bringt es ein Beamter links von Marion in bitterem Ton auf den Punkt.
Der Frischling ist Naïma Meceri. Der Säufer – und der Vollständigkeit halber hätte man vielleicht Kiffer und Kokser hinzufügen müssen – ist Capitaine Prunier, der es für ratsam gehalten hat, sich erst einmal krank schreiben zu lassen und in Deckung zu gehen.
Auf dem Flip-Chart zeichnet Marion die Positionen der verschiedenen Beteiligten auf dem Höhepunkt des Geschehens ein. Talon und Naïma bildeten die Vorhut. Nachdem sie das Lokal als Paar in Zivil betreten hatten, sollten sie sich der Zielperson so weit wie möglich nähern, während an den Ein- und Ausgängen verteilt sechs Beamte auf Talons Zeichen warteten. Einer von ihnen war Prunier, der die Tür zu den Toiletten überwachen sollte. Der Zustand des Beamten in dieser schwierigen Situation war niemandem entgangen, und sicher war das auch der Grund, warum Talon ihn dorthin plaziert hatte. Marion weiß, daß er Prunier hätte heimschicken müssen und daß ihn diese Fehleinschätzung womöglich teuer zu stehen kommen wird, sofern er überlebt.
»Hier nimmt die Katastrophe ihren Anfang«, urteilt Marion, um rasch hinzuzufügen, daß es hinterher immer leicht ist, Kritik zu üben, vor allem, wenn man nicht dabei war.
Der erste Teil des Einsatzes scheint normal abgelaufen zu sein. Aber in dem Moment, als Talon und Naïma Meceri den gesuchten Mann ansprechen, um seine Personalien zu überprüfen, glaubt Prunier zu sehen, wie einer der Spieler in die Innentasche seiner Jacke greift und einen Gegenstand hervorzieht, den er für eine Waffe hält. Da er hinter dem Mann steht, hat er Talon in der Schußlinie. Sein Aufschrei läßt Panik ausbrechen. Beim ersten Schuß sieht Meceri Blut von der Stirn ihres Kollegen spritzen, ohne zu begreifen, was eigentlich vor sich geht. Talon zieht seine Waffe, ohne genau zu erkennen, wer ihn bedroht. Als ihm die zweite Kugel die Eingeweide zerreißt, zielt er in Richtung des Schützen, den er im dichten Rauch nur erahnen kann. Der Dicke vor ihm, der in der einen Hand seine Brieftasche, in der anderen wohl eine Colaflasche hält, wirft sich in panischer Angst genau in die Flugbahn seiner Kugel.
»Interessant …« durchbricht eine Stimme hinter Marion die bleierne Stille, die ihre Ausführungen begleitet hat. »Interessant, aber aus der Luft gegriffen.«
Sie fährt herum. Paul Quercy starrt sie an, die Arme über dem marineblauen Anzug verschränkt. Mit seinem korrekten Haarschnitt, der Hornbrille und dem Ordensband der Ehrenlegion im Knopfloch ähnelt der Leiter der Kripo eher einem Ministerialbeamten als einem Polizeichef. Lange messen sich die beiden mit Blicken, und Marion liest in Quercys Augen, wie sehr ihm dieser Fall gegen den Strich geht. Die Beamten rühren sich nicht, sondern warten gespannt, ob es wieder einmal zu einem Schlagabtausch zwischen dem Kripochef und der Kommissarin kommen wird.
Quercy wendet sich an die Gruppe:
»Was Sie gehört haben, ist die Version Ihrer Chefin, die auf einem Ohr taub ist«, sagt er trocken und sieht Marion dabei von der Seite an. »Ich bin der festen Überzeugung, daß der Anwalt wirklich bewaffnet war und daß in dem ganzen Chaos jemand seine Waffe hat verschwinden lassen. Um uns in die Scheiße zu reiten. Ich kenne einige Journalisten oder auch andere Leute, die den Bullen immer gern eins auswischen, nach dem Motto: ›Polizei schießt auf redlichen Anwalt … Ein Versehen, mangelnde Koordination?‹ Damit aus diesem schlimmen Vorfall, den ich mehr als bedauere, ein Riesenskandal wird. Dann könnten sie uns endlich mal nach Lust und Laune an den Pranger stellen. Das will ich verhindern. Die Dienstaufsichtsbehörde hat gerade mit den Zeugenvernehmungen begonnen. In einer Stunde gebe ich eine Pressekonferenz, und ich verbiete allen hier Anwesenden, sich außerhalb der offiziellen Befragungen zu dem Fall zu äußern. Ich will, daß wir es bis auf weiteres bei der anfänglichen Darstellung der Ereignisse bewenden lassen: Der Anwalt hat eine Waffe gezogen, Capitaine Prunier wollte seinen bedrohten Kollegen schützen und hat ebenfalls zur Waffe gegriffen. Daraufhin sind Schüsse gefallen, über deren Herkunft noch nichts bekannt ist, und in dem ganzen Tumult wurde Talon von mehreren Kugeln getroffen. Er hat zurückgeschossen und den Anwalt tödlich verletzt. Nicht wahr, Mademoiselle Meceri?«
Naïma Meceri reißt die Augen auf, und alle Köpfe drehen sich zu ihr hin. Hilfesuchend sieht sie Marion an, die ihr zu verstehen gibt, daß sie nichts für sie tun kann.
»Ich habe nicht alles gesehen«, sagt die junge Frau mit heiserer Stimme. »Ich war ja dabei, die Papiere von dem Mann zu überprüfen, ich weiß nicht …«
»Sehr gut«, fällt ihr Quercy ins Wort. »Halten Sie sich an das, was Sie wirklich gesehen und getan haben, und versuchen Sie nicht, irgendwelche Schlüsse zu ziehen oder sich zusammenzureimen, wer wohl was getan hat.«
Er dreht sich zu Marion um, die ihn herausfordernd ansieht, die Hände in die Hüften gestemmt. Quercy fährt unbeirrt fort:
»Diese Anweisungen gelten für alle, Kommissarin Marion … Also los jetzt, Leute! Die Kundgebung ist vorbei, macht euch wieder an die Arbeit – wenn ihr es irgend jemandem heimzahlen wollt, ist das immer noch der beste Weg.«
Unter leisem Protest stehen die Beamten auf und verlassen den Raum, ohne Quercy im Vorbeigehen zu grüßen; nur der Gewerkschaftsvertreter bedenkt ihn aus unerklärlichen Gründen mit einem leisen »Danke, Monsieur Quercy«. Marion sieht den verschlossenen Gesichtern an, wie aufgebracht alle sind, obwohl man sich ihr gegenüber freundlich oder neutral verhält. Das Problem hat nichts mit Marions Verhältnis zu ihren Mitarbeitern zu tun, es liegt viel tiefer. Was sich hier zeigt, ist eine allgemeine Unzufriedenheit, die eines Tages auch vor den besten Polizisten nicht mehr haltmachen wird.
»Warum sind Sie hier?« fragt Quercy, als alle gegangen sind.
Marion fährt zusammen. Jetzt redet er noch immer in diesem Chefton mit ihr, dabei sind sie doch allein! Sie dreht sich um, als stünde jemand hinter ihr.
»Haben Sie mit mir gesprochen, Chef?«
»Nein, mit dem Papst! Ich dachte, Sie wären im Urlaub.«
»Ich bleibe hier.«
»Das ist doch lächerlich. Sie brauchen Ihren Urlaub, genau wie jeder andere auch. Für wen halten Sie sich? Glauben Sie, daß wir ohne Sie nicht überleben können?«
Er vergräbt die Hände tief in seinen Hosentaschen und klimpert mit ein paar Geldstücken.
»Das ist ein Fall, wie er schlimmer nicht sein könnte«, sagt sie. »Talon ist einer meiner engsten …«
»Eben. Sie haben weder den nötigen Abstand noch die nötige Objektivität. Nehmen Sie sich Ihre freien Tage, wir halten Sie auf dem laufenden.«
Marion sieht ihn aufmerksam an. Sie kennt ihn in- und auswendig, diesen bärbeißigen, aufrichtigen Mann, und deshalb weiß sie, daß er ihr nicht alles gesagt hat.
»Was wollen Sie eigentlich beweisen mit ihrer vorgekauten Geschichte, die wir alle der Dienstaufsichtsbehörde auftischen sollen? Die wird sowieso im Handumdrehen widerlegt sein. Sie wissen genausogut wie ich, daß Prunier auf Talon geschossen hat, weil er zwei oder drei Promille im Blut hatte oder mit Koks zugeknallt war. Da mache ich nicht mit. Prunier ist rauschgiftsüchtig und damit eine Gefahr für die Allgemeinheit, er muß gefeuert werden.«
»Ich werde ihn feuern, sobald ich Beweise für Ihre Behauptung habe. Zum Beispiel dann, wenn das ballistische Gutachten vorliegt.«
»Das kann ja wohl nicht wahr sein! Sie geben diesem Typen Rückendeckung und lassen Talon im Regen stehen!«
»Talon hat einen exzellenten Lebenslauf und hervorragende Zeugnisse, die ihn vor größeren Schwierigkeiten bewahren werden. Und in seinem augenblicklichen Zustand riskiert er sowieso nichts. Nun ja, Sie wissen schon, wie das gemeint war …«
»Ich bitte Sie, Monsieur Quercy, werden Sie nicht zynisch. Und Prunier, womit hat er soviel Fürsorge verdient?«
»Vier Kinder, eine Verletzung im Dienst.«
»Und was noch? Ist er in Ihrer Partei? Ist er Freimaurer? Gewerkschaftler wahrscheinlich, muß ja, wenn man so einen Rattenschwanz von Problemen hinter sich herzieht wie der …«
Marion ist außer sich. Quercy weist sie in schneidendem Ton zurecht:
»Ich verlange von Ihnen, daß Sie die Finger von diesem Fall lassen, Kommissarin Marion. Sie werden die Sache mir, Ihrem Vorgesetzten, überlassen. Ich kümmere mich darum, und zwar anhand der Informationen, über die ich verfüge. Und damit basta.«
Marion hat schon den Mund geöffnet, um zurückzuschießen, doch Quercys eisiger Blick läßt sie innehalten. Sie wählt eine neue Taktik.
»Kann es sein, daß Sie mich loswerden wollen?« fragt sie in möglichst gelassenem Ton.
Er verdreht die Augen.
»Sie leiden unter Wahnvorstellungen … Obwohl Sie schon recht haben«, fügt er hinzu, als hätte er plötzlich keine Zeit mehr für Feinheiten. »Ich will Sie nicht zwischen den Füßen haben. Wegen dieses Falls habe ich einen Anschiß vom Minister bekommen …«
»Ich dachte, Sie wären dicke Freunde.«