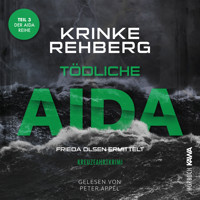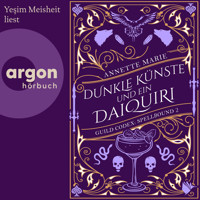5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Sir Gabriel Ward ermittelt
- Sprache: Deutsch
»Ein wahres Lesevergnügen von der ersten bis zur letzten Seite.« Sunday Times
London 1901: Der Temple-Bezirk mit seinen alten Gebäuden und verwinkelten Straßen liegt im Herzen Londons und bildet das Zentrum der englischen Rechtswelt. Ein Ort, an dem Traditionen alles bedeuten und Mord seit Jahrhunderten nur in Fallbüchern vorkommt – bis jetzt … Als der Anwalt Gabriel Ward an einem sonnigen Morgen im Mai aus seinen Räumen tritt, stolpert er buchstäblich über die Leiche des obersten Richters. Da die Polizei im Temple-Bezirk keine Befugnisse hat, wird Gabriel mit der Aufklärung betraut. In gewohnter Manier stürzt er sich mit Logik und Akribie auf die Fakten, doch er muss bald feststellen, dass ein Mord ganz eigenen Gesetzen folgt. Und dass sich hinter den schweren Eichentüren des Temple-Bezirks mehr dunkle Geheimnisse verstecken, als er je geahnt hätte …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 422
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Buch
London 1901: Der Temple-Bezirk mit seinen alten Gebäuden und verwinkelten Straßen liegt im Herzen Londons und bildet das Zentrum der englischen Rechtswelt. Ein Ort, an dem Traditionen alles bedeuten und Mord seit Jahrhunderten nur in Fallbüchern vorkommt – bis jetzt …
Als der Anwalt Gabriel Ward an einem sonnigen Morgen im Mai aus seinen Räumen tritt, stolpert er buchstäblich über die Leiche des obersten Richters. Da die Polizei im Temple-Bezirk keine Befugnisse hat, wird Gabriel mit der Aufklärung betraut. In gewohnter Manier stürzt er sich mit Logik und Akribie auf die Fakten, doch er muss bald feststellen, dass ein Mord ganz eigenen Gesetzen folgt. Und dass sich hinter den schweren Eichentüren des Tempel-Bezirks mehr dunkle Geheimnisse verstecken, als er je geahnt hätte …
Autorin
Sally Smith ist Anwältin und King’s Counsel, die ihr gesamtes Berufsleben im Temple-Bezirk verbracht hat. Die historische Umgebung, in der sie lebt und arbeitet, und die jahrhundertelange Geschichte des Ortes inspirierten sie zu ihrem ersten Roman.
Sally Smith
Der Tote in der Crown Row
Ein Fall für Sir Gabriel Ward
Aus dem Englischen von Sibylle Schmidt
Die Originalausgabe erschien 2024 unter dem Titel »A Case of Mice and Murder« bei Raven Books, ein Imprint von Bloomsbury UK, London.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Deutsche Erstveröffentlichung April 2025
Copyright © by Sally Smith 2024
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2025
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestaltung: UNO Werbeagentur, München
Covermotiv: FinePic®, München
Karte: Gestaltung von Sabine Timmann
Redaktion: Johanna Schwering
ES · Herstellung: ik
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-31455-2V002
www.goldmann-verlag.de
Für Roger
Karte
1
Wohl niemand konnte ermessen, was dem Lordoberrichter von England in jenen schrecklichen Sekunden durch den Kopf ging, als er verstand, dass der Tod ihn ereilen würde. Zog sein Leben – erfolgreich und konventionell – vor Lord Norman Dunnings innerem Auge vorüber, wie immer behauptet wurde? Und falls dem so war, blieb ihm noch genügend Zeit, um die ausgesprochen absonderlichen Umstände seines eigenen Ablebens zu registrieren?
Gelegentlich hatte man im Laufe der Jahrhunderte schockiert vernommen, dass weniger gut beleumundete Richter aus niedrigeren Rängen in fremden Betten zu Tode gekommen waren, in Gesellschaft von Personen, die nicht ihre Ehefrauen oder, schlimmer noch, nicht einmal Frauen waren. Auch von Kaschemmen und Spielsalons war zu hören, einmal sogar von einer Opiumhöhle. Lord Dunning jedoch, höchster Richter des Landes, entsprach in jeder Hinsicht den Erwartungen der Gesellschaft. Er hatte an die zwanzig Jahre ebenso ereignis- wie fantasielos Recht gesprochen, und man hätte erwartet, dass er bei seiner Vorliebe für reichhaltige Mahlzeiten eines Nachts aufgrund von Bluthochdruck entschlafen würde.
Gewiss wäre niemand auf die Idee verfallen, dass Lord Dunning Opfer eines Mordes werden könnte.
Seine Leiche wurde am 21. Mai frühmorgens von Kronanwalt Sir Gabriel Ward entdeckt, der buchstäblich über sie stolperte. Man konnte nicht behaupten, dass Sir Gabriel seine Laufbahn als Barrister mit der Suche nach Wahrheit oder Gerechtigkeit verbrachte, denn beides interessierte ihn nicht sonderlich. Er hatte allerdings höchste Achtung vor dem Gesetz und legte größten Wert auf dessen präzise und erfolgreiche Anwendung.
Für die Rolle eines Amateurdetektivs hätte es keinen erstaunlicheren Kandidaten geben können als Sir Gabriel.
Er lebte allein in seiner Wohnung im Temple, diesem exklusiven und abgeschirmten sieben Hektar umfassenden Bezirk Londons mit Gärten, Plätzen und Gassen rund um die Temple Church, der seit dem vierzehnten Jahrhundert den Männern des Rechts vorbehalten war. Jeden Morgen um zwei Minuten vor sieben, wenn der Arbeitstag im Temple noch kaum begonnen hatte, trat Gabriel aus seiner kleinen Wohnung am King’s Bench Walk, schloss die Tür ab und drückte zur Sicherheit noch drei Mal dagegen, obwohl er wusste, dass sie bereits fest verriegelt war.
Dann trat er den täglichen Weg zu seiner Kanzlei an, in der er sich der Rechtsfindung widmete. Die Welt außerhalb der Mauern des Temple war nah und fern zugleich. Südlich befand sich die Themse, Segelbootmasten und Dampferschornsteine waren dort zu erkennen, das Kreischen der Möwen zu vernehmen. Nördlich lag die pulsierende Fleet Street mit dem hektischen Treiben in ihren Zeitungsredaktionen und Druckereien, während der Verkauf der Morgenausgaben begann. Doch Gabriel stand alldem gleichgültig gegenüber, denn er trat nur ebenso selten wie widerwillig durch die Tore in die Außenwelt. Im geschützten Bereich des Temple hatte er alles, was er begehrte. Wenn er vom gewaltigen Gebäude der Bibliothek zu der ausladenden Rasenfläche an der Terrasse blickte, murmelte er nicht selten die Worte des überragenden römischen Advokaten Cicero vor sich hin: »Hast du einen Garten und eine Bibliothek, dann hast du alles, was du brauchst.«
Manchmal, wenn Norman Dunning bereits frühmorgens unterwegs gewesen war, weil vor der Verhandlung noch ein Urteil geschrieben werden musste, hatten sich ihre Wege gekreuzt. Gabriel empfand den Lordoberrichter menschlich als uninteressant und intellektuell als unerträglich. Die beiden kannten sich, seit Gabriel sieben und Dunning acht Jahre alt gewesen war. Nach der Schule waren sie gemeinsam am Eton College gewesen, hatten anschließend beide in Oxford studiert und im Inner Temple ihr Anwaltspraktikum absolviert. Beide blickten auf eine lange Laufbahn zurück, die bei Dunning zu seiner Position als oberster Richter des Landes geführt hatte, und bei Gabriel zu dem Renommee, auch noch die vertracktesten juristischen Probleme lösen zu können, an denen seine Kollegen zu verzweifeln pflegten.
Die Allgemeinheit hielt Lord Dunning für gediegen und ehrenwert. Gabriel hielt ihn für dumm. Er hatte schon häufig in trockenem Tonfall und mit seinem charakteristischen Schnauben bemerkt, dass Dummheit offenbar kein Hinderungsgrund war, die Position des hochrangigsten Richters zu erlangen. Ferner war er der Ansicht, dass für diese verantwortungsvolle Stellung mehr vonnöten war als nur Gediegenheit (was ihn eher an Möbel erinnerte). Dennoch hatte Gabriel höchste Achtung vor Dunnings Position und hätte sich niemals Vertraulichkeiten oder Unhöflichkeit erlaubt gegenüber dem Amtsinhaber der höchsten Richterposition des Landes, der direkt dem Justizminister unterstand.
Wenn sich ihre Wege kreuzten, lüpfte Gabriel deshalb stets seinen Zylinder, sagte »Guten Morgen« und fügte mit einer leichten Verzögerung »Lordoberrichter Dunning« hinzu. Die kurze Sprechpause sollte auf subtile Weise zugleich Respekt gegenüber dem Amt und Verachtung für den Amtierenden zum Ausdruck bringen. Gabriel wäre allerdings empört gewesen, hätte er geahnt, dass Dunning nicht nur diese Verzögerung, sondern auch seinen Kollegen selbst kaum wahrnahm. Der Lordoberrichter dachte lediglich, dass der alte Knabe sich seit seiner Kindheit kaum verändert hatte. Ward war noch immer ein ebenso schüchterner, verschlossener, zaghafter (daher wohl die Sprechpause) Brillenträger wie mit sieben Jahren.
Dann und wann hob Dunning ebenfalls seinen Zylinder an und rief munter »Morgen, Ward«. Dabei musste er aus Gründen, die er niemals hinterfragt hatte, stets an den luxuriösen Frühstücksraum in seinem Haus an der Stafford Terrace in Kensington denken. Er sah seine große Familie vor sich, wie sie inmitten der erdrückenden Pracht aus Mahagoni, Silber, Brokat, Spiegeln und Mezzotinto-Drucken an dem mächtigen mit Speisen überladenen Tisch saß. Und falls der Lordoberrichter bei den Begegnungen mit seinem Kollegen in seinem tiefsten Inneren einen unerklärlichen Anflug von Neid empfand, wurde auch dieser nicht hinterfragt. Grundgütiger, ganz gewiss wünschte Dunning sich nicht das einsame Leben des bedauernswerten Ward.
Der denkwürdige Morgen des 21. Mai 1901 begann wie jeder andere. Da Gabriel nie von seinen Gewohnheiten abwich, eilte er in Gedanken stets voraus. Wenn er die Terrasse überquerte und auf seine Kanzlei in der Crown Office Row zusteuerte, spürte er bereits den schwarzen Türknauf mit seinen jahrhundertealten Lackschichten in der Hand. Und wenn diese schließlich den Türknauf umschloss, ließ Gabriel sich in seiner Vorstellung bereits an dem ausladenden Mahagonischreibtisch mit der ausgeblichenen grünen Lederschreibunterlage nieder, auf der säuberlich angeordnete, mit rosa Kordeln umwickelte Papierstapel lagen.
Als Gabriel die Kanzlei an diesem Morgen betreten wollte, entging ihm deshalb zunächst, dass etwas vor der Türschwelle lag. Erst als seine Fußspitze gegen ein merkwürdig weiches Hindernis stieß, registrierte Gabriel, der in Gedanken bereits an seinem Schreibtisch saß, dass der Zutritt nicht möglich war. Dann stellte er fest, dass sich vor seiner Tür zweifellos ein Toter befand, das Gesicht zur Wand gedreht, der Torso von einem schwarzen Mantel bedeckt, der Kopf von einem Zylinder. Die Füße des Mannes jedoch waren erstaunlicherweise nackt, gepflegt, wenn auch etwas schmutzig an den Sohlen. Es stellte keinerlei Schwierigkeit dar, über die Beine in den tadellosen Hosen hinwegzusteigen, zu denen die nackten rosa Extremitäten in absurdem Widerspruch standen. Dies tat Gabriel instinktiv, um in den Flur zu gelangen, wo er ebenso instinktiv die Tür hinter sich zuschlug, um den grauenhaften Anblick auszublenden, wofür er sich später ein wenig schämte.
2
Wie gelähmt ob dieser Störung seiner gewohnten Abläufe, stand Gabriel stocksteif in dem vertrauten Flur. Was nun zu tun war, stand außer Frage: Die Polizei musste geholt werden. Dass die Fernsprechanlage, die jüngst im Büro installiert worden war, für Gabriel noch ein Rätsel war, konnte nicht als Ausrede gelten; wie Chapman, sein Anwaltsgehilfe, unermüdlich betonte, konnte man sich zumindest bemühen, sie zu bedienen. Und sollte dieser Versuch scheitern, würde sich in der Fleet Street ein Botenjunge finden lassen, der im Nu eine handgeschriebene Nachricht ins Polizeirevier befördern konnte.
Während Gabriel sich für eine dieser beiden Handlungen zu entscheiden versuchte, geschah zweierlei gleichzeitig. Aus dem Büro war Chapman zu vernehmen, der mit erhobener Stimme und im Befehlston in das Fernsprechgerät sprach, während von draußen schrille Schreie die friedliche Stille des frühen Morgens störten. Unablässig kreischte jemand: »O nein, o nein, o nein«, bis schließlich die Worte nicht mehr zu identifizieren waren und nur noch eine Art »Oneinoneinonein«-Mantra daraus wurde.
Unwillkürlich riss Gabriel die Tür wieder auf und fand sich der Reinmachefrau gegenüber, die mit Schreckensmiene die schwieligen Hände zu einer Art absurder Bittgeste erhoben hatte.
»O nein«, fuhr sie fort zu kreischen. »O nein, o nein!«
Gabriel, erpicht darauf, den unerträglichen Lärm zu beenden, beugte sich vor, ergriff die Oberarme der Frau, zog und hob sie über die Beine des Toten hinweg und geleitete sie anschließend zu dem Stuhl, auf dem die Kollegen zu sitzen pflegten, die ihm in ihrer Funktion als Solicitors die notwendigen Informationen für einen Fall unterbreiteten.
Der stattliche Chapman, der für seine Verhältnisse außergewöhnlich aufgeregt wirkte, kam nun aus dem Büro.
»Ich habe die Polizei angerufen, Sir«, erklärte er. »Bald wird jemand hier sein.«
»Aber was ist geschehen, Chapman?«
»Ich habe nicht die geringste Ahnung, Sir.« Sonst stets ein Ausbund an Höflichkeit, klang Chapman jetzt erstaunlich brüsk. »Ich bin erst vor fünf Minuten eingetroffen, da war er schon hier.«
Beide Männer mussten mit erhobener Stimme sprechen, um das ohrenbetäubende Geschrei zu übertönen, das unvermindert anhielt.
Gabriel blickte missfällig auf die Tränenbäche und die triefende Nase der Reinmachefrau und durchforstete sein Gehirn nach einer angemessenen Reaktion. Dabei entdeckte er in einem der hintersten Winkel Worte seines Kindermädchens, die er anwandte, obgleich er sie seinerzeit weder verstanden noch als hilfreich empfunden hatte.
»Kommen Sie«, sagte er. (Und was soll das bitte schön heißen?, wollte prompt sein innerer Anwalt wissen. Wohin sollte die Frau denn kommen? Er wollte schließlich nicht, dass sie irgendwohin kam, sondern dass sie verstummte.) »Das ziemt sich nicht.«
Und als sei ein Wunder geschehen, schluchzte die Frau ein letztes Mal auf und blieb dann still. Ermutigt durch diesen enormen Erfolg, versuchte Gabriel sich zu erinnern, was sein Kindermädchen als Nächstes getan hatte, aber dieses Mal verweigerte sich sein Gedächtnis. Stattdessen kam ihm in den Sinn, wie die Richter mit in Tränen aufgelösten Zeugen umzugehen pflegten (was nicht selten vorkam, da Gabriels Kreuzverhöre legendär gnadenlos waren), und er fragte die Reinmachefrau, ob sie ein Glas Wasser wünsche. Auch das erwies sich als trefflicher Einfall, da sie flüsternd bejahte.
Und dann stellte glücklicherweise Chapman die Ordnung wieder her.
»Annie, bitte begeben Sie sich ins Büro«, sagte er entschieden. »Dort können Sie gern ein Glas Wasser bekommen. Sie werden Sir Gabriel nicht länger mit Ihrer Hyst… mit Ihrem Entsetzen belästigen. Wir sind alle erschüttert.«
Unruhig verharrte Gabriel an Ort und Stelle. Doch Chapman war nun wieder ganz in seiner vertrauten Rolle als einer jener unverzichtbaren Diener des Rechtswesens, der die Diskretion und Treue eines guten Butlers mit dem Geschäftssinn und der Leutseligkeit eines Theateragenten vereinte. Gabriels Seelenfrieden war Chapmans Seelenfrieden; Gabriels Erfolge waren Chapmans Erfolge; jede Guinee, die Gabriel verdiente, war ein Shilling in Chapmans Tasche. Mit Leichen auf Türschwellen, so erschreckend sie auch sein mochten, musste man umgehen, und der Alltag in der Kanzlei musste weitergehen. Unter keinen Umständen durfte Sir Gabriels eminent wichtige Arbeit beeinträchtigt werden.
»Ihren Mantel und Hut, bitte, Sir«, sagte Chapman. »Ich werde Sie benachrichtigen, sobald die Polizei eintrifft. Die Papiere zum Fall Cadamy gegen Moore befinden sich auf Ihrem Schreibtisch. Sie können hier vorerst nichts mehr tun, Sir. Ich kümmere mich um Annie, seien Sie unbesorgt.«
Wortlos überreichte Gabriel Mantel und Zylinder, ging in sein Zimmer und ließ sich am Schreibtisch nieder. Für gewöhnlich war diese Zeit des Morgens besonderer Stille vorbehalten. Doch nun ließ der Tote auf der Schwelle die Ruhe unheilvoll erscheinen, die überdies wohl nur von kurzer Dauer sein würde.
Sekunden vergingen, untermalt vom Ticken der Wanduhr und dem Tropfen des Wasserhahns in dem Eckschrank, in dem sich ein Waschbecken befand. Während die Sekunden zu Minuten wurden, beruhigte sich Gabriels Herzschlag, passte sich an das Ticken und das Tropfen an, und es hatte den Anschein, als sei die Normalität wiederhergestellt. Gabriel beäugte seinen Schreibtisch. Hatte er das Tintenglas so ausgerichtet, dass die Scharniere des Silberdeckels exakt parallel zum Rand des ewigen Tischkalenders daneben verliefen? Lag sein goldener Bleistift in dem flachen Schildpattkästchen mit der Spitze zum Fenster?
Alles war, wie es sein sollte. Nachdem das festgestellt war, erschien es auch möglich, sich den neuen Unterlagen in dem hochkomplizierten Fall Cadamy gegen Moore zuzuwenden und den Knoten der rosa Kordel an dem Aktenbündel zu lösen. Und Gabriel empfand sogar wie immer die freudige Spannung, die sich verlässlich einstellte, wenn ein besonders verzwicktes juristisches Problem, an dem weniger begabte Barrister wohl verzweifeln würden, sich vor ihm in verlockender Rätselhaftigkeit entfaltete wie eine Rosenblüte im warmen Sonnenschein.
Es kam selten vor, dass eine juristische Herausforderung Gabriel lange beanspruchte. Aber die außerordentlichen Umstände der Klage von Miss Cadamy gegen Gabriels Mandanten Mr Herbert Moore, den Verleger, bei der es um gigantische Geldsummen und potenzielle Rufschädigung ging, hatten ihn bereits etliche Stunden beschäftigt. Gabriel freute sich auf die nächsten Etappen, während er sich zufrieden schnaubend mit uralten Präzedenzfällen befasste, die vielleicht erhellend sein konnten, und noch die verborgensten Winkel seines Gehirns nach gedeihlichen Einfällen durchforstete.
Dabei umhüllte ein tiefer Frieden Gabriel und seinen Arbeitsraum.
Doch mit diesem Frieden war es rasch vorbei. Keine zwanzig Minuten später war Gabriel gezwungen, sich von seinen Notizen loszureißen, um eine ganz andere Frage zu beantworten, die ihm von einem Constable der Londoner Polizei gestellt wurde.
»Haben Sie den Toten erkannt, Sir?«
»Nein«, antwortete Gabriel. »Sein Gesicht war zur Wand gekehrt und sein Kopf von dem Zylinder bedeckt.«
»Würden Sie den Toten bitte jetzt betrachten, Sir? Ich habe ihn umgedreht und ihm den Zylinder abgenommen.«
So langsam wie eine Schildkröte, ein Tier, mit dem Gabriel ohnehin eine gewisse Ähnlichkeit aufwies, folgte er dem Polizisten zur Eingangstür und blinzelte bedächtig, während er den Blick auf die Leiche richtete, die jetzt auf dem Rücken lag. Unter dem Mantel war die große Abendgarderobe mit weißer Fliege zum Vorschein gekommen. Der Zylinder lag neben dem Toten, beinahe ehrerbietig. Auf dem blütenweißen Frackhemd zeichnete sich ein kreisrunder scharlachroter Fleck ab, aus dem ein großes Tranchiermesser herausragte. Es war beinahe bis zum Heft versenkt, auf dem ein Pferd mit silbernen Flügeln eingraviert war. Gabriel blieb stumm.
»Und, Sir?«
Auf diese Frage hin äußerte Gabriel eine Tatsache, die so verblüffend war, dass er wie manchmal vor Gericht seine eigene Stimme besonders deutlich wahrnahm. Sie klang ebenso klar und präzise wie ausdruckslos.
»Das ist Lord Dunning.«
»Lord Dunning, Sir? Aber doch gewiss nicht der Lordoberrichter, Sir?« Der Polizist schien zu glauben, er habe es mit einem Wahnsinnigen zu tun.
»Doch«, antwortete Gabriel fest. »Das ist der Lordoberrichter.«
3
»Aber er hat nackte Füße.«
»Sogar ein Lordoberrichter hat Füße, Officer«, erwiderte Gabriel und ergänzte mit dem typischen kleinen Schnauben, das bei ihm oft einer geistreichen Pointe vorausging: »In diesem Fall stand er wohl auf tönernen Füßen.«
»Tönern?«, wiederholte der Polizist verständnislos.
Worauf Gabriel trotz der Befriedigung über die gewitzte Anspielung Scham empfand, denn die Bemerkung war freilich geschmacklos. Dunning war alles in allem gewiss ein anständiger Mensch gewesen. Gabriel sah vor seinem inneren Auge den eifrigen Jungen, der in Cricket gut, aber in allen anderen Fächern nur mittelmäßig war, ständig aufgeschürfte Knie hatte und stets großzügig den Inhalt seiner Brotdose mit anderen teilte.
Gabriels eigene Knie fühlten sich jetzt recht weich an, und da dem Polizisten nicht entging, dass sich eine erwartungsgemäße Reaktion auf das Geschehen einstellte, fasste er Gabriel fürsorglich am Ellbogen und steuerte ihn in sein Arbeitszimmer, gefolgt von Chapman, der mit Argusaugen über seinen Dienstherrn wachte.
Als Gabriel wieder hinter seinem Schreibtisch saß, fühlte er sich gleich sicherer. Constable Maurice Wright jedoch, der erst zwei Jahre bei der Londoner Polizei tätig war, wünschte sich sehnlichst zurück zum Streifendienst in der Fleet Street, von dem man ihn eilends abgezogen hatte. Angesichts dieser bestürzenden Information, die ihn in eine hochnotpeinliche Lage bringen würde, falls sie falsch war, und die in jedem Fall einen enormen Aufruhr erzeugen würde, fühlte sich der junge Mann reichlich überfordert. Er setzte seinen Helm ab und wischte sich den Schweiß von der Stirn, bevor er fragte:
»Sind Sie ganz sicher, dass es sich bei dem Toten um Lord Dunning handelt, Sir?«
»Ja, das bin ich«, antwortete Gabriel, und um seine Aussage zu untermauern, fügte er hinzu: »Ich bin erst gestern vor ihm aufgetreten.«
»Aufgetreten, Sir?«
»Ich will damit sagen, dass ich als Anwalt in seinem Gericht aufgetreten bin«, erklärte Gabriel. »Und ich habe verloren.«
Sofort fragte er sich, weshalb er dem jungen Polizisten diese unangenehme Erfahrung offenbarte. Das wunderbar strukturierte Plädoyer, Dunnings schnöde pragmatische Abweisung desselben, die hohe Geldsumme, die dem Kläger zugesprochen wurde – das Urteil war ganz und gar abscheulich und widersinnig gewesen, so bar jeder Präzision und Klarheit und all dessen, was die Schönheit des Rechtswesens ausmachte.
Für Constable Wright brachte diese Bemerkung allerdings zumindest etwas Licht ins Dunkel der verworrenen Bemerkungen seines wunderlichen Gegenübers.
»Haben Sie sich geärgert, als Sie den Prozess verloren haben, Sir?«
»Nicht genug, um deshalb den Lordoberrichter zu töten, falls Sie darauf anspielen. Wir hätten einen bedenklichen Mangel an Richtern, wenn wir uns gegenseitig umbringen würden, sobald wir eine Niederlage verkraften müssen.«
»Erkennen Sie das Messer, Sir?«
»Im Heft ist das silberne Pegasusmotiv eingearbeitet«, antwortete Gabriel bedauernd. »Das trifft auf das gesamte Besteck des Inner Temple zu, dessen Symbol Pegasus ist. Das geflügelte Pferd der göttlichen Eingebung, das himmelwärts fliegt, ist unser Zeichen: Volat ad aethera virtus.«
Constable Wright, der erneut im Dunkeln tappte, vernahm jetzt mit großer Erleichterung, wie sich die schweren Stiefelschritte seines Vorgesetzten näherten. Sergeant Rayners laute Selbstsicherheit und seine Ablehnung gehobener Ermittlungsarbeit, die er verächtlich als »Wissenschaftshumbug« abzutun pflegte, machten Constable Wright häufig zu schaffen. Jetzt jedoch war er ausnahmsweise dankbar für die Anwesenheit des Sergeants. Wright eilte zur Tür, wo zwei Kollegen mit einer Trage warteten. Rayner war über den Toten gebeugt und näherte gerade seine große Pranke, die in einem Lederhandschuh steckte, dem Messer.
»Vielleicht sollten wir das Heft nicht berühren«, gab Wright besorgt zu bedenken, als er hinter seinen Vorgesetzten trat.
»Das Heft nicht berühren? Was zum Teufel soll das heißen? Glauben Sie, wir könnten ihm noch wehtun? Der Mann ist mausetot«, erwiderte Rayner unwirsch.
»Der Mörder hat vielleicht Fingerabdrücke darauf hinterlassen, Sergeant.« Der ehrgeizige junge Constable, der einen Aufstieg zum Detective anstrebte, hatte nicht umsonst das neue Handbuch der Kriminalistik gründlich studiert.
»Ja, in der Tat«, bestätigte Gabriel, der jetzt in der Tür erschien. »Daktyloskopie.«
»Wie bitte, Sir Gabriel?«
»Daktyloskopie«, erklärte Gabriel, hocherfreut über die Gelegenheit für diesen Exkurs in die Wissenschaften. »Man untersucht dabei Fingerabdrücke, um Personen zu identifizieren – ein höchst faszinierendes und sehr altes Verfahren. Die Babylonier wandten es bereits zweihundert vor Christus an, wissen Sie, und der große römische Anwalt Quintilian sorgte mit einer Analyse blutiger Handabdrücke am Tatort im ersten Jahrhundert nach Christus für den Freispruch seines Mandanten …«
»Ja, genau«, schaltete sich Constable Wright begeistert ein, »und es heißt, der Stellvertretende Polizeipräsident der Metropolitan Police will in Kürze bei Scotland Yard eine Abteilung für Fingerabdrücke einrichten. Wie in Kalkutta, Sir.«
»Was für ein Unfug!«, versetzte der Sergeant scharf. Er war durch und durch ein Mann der City of London Police, und jede Erwähnung der polizeilichen Konkurrenz brachte ihn sofort auf die Palme. »Kalkutta! Der Stellvertretende Polizeipräsident von Scotland Yard hat jede Menge Flausen im Kopf! Ich mag altmodisch sein, aber ich sage, die althergebrachten Methoden sind immer noch die besten. Fingerabdrücke sind Kokolores, mein Junge.« Und damit packte Rayner das Heft, zog das spitze stilettähnliche Messer vorsichtig aus der Leiche und verstaute es in seiner Tasche.
Dann hob er die Schultern des Toten an und befahl Wright: »Fassen Sie ihn an den Knöcheln, und helfen Sie mir, ihn auf die Trage zu verfrachten.«
»Ich habe ihn zwecks Identifizierung umgedreht, Sergeant«, gestand Wright beklommen, »aber vielleicht sollten wir die Leiche vorerst liegen lassen, damit sie vom Gerichtsmediziner untersucht werden kann.«
»Liegen lassen?«, bellte Rayner. »Quer vor einer Tür?«
»Jawohl, ganz recht«, meldete sich Gabriel erneut zu Wort. »Bewahrung des locus in quo. Edmond Locard, ein beeindruckender französischer Kriminologe, hat nachgewiesen, dass jede Berührung an Toten eine Spur hinterlässt. Sein Werk gewinnt immer mehr an Einfluss, wissen Sie.«
Sergeant Rayners Gesicht, bereits gerötet von der Anstrengung, nahm nun vor Wut einen krebsroten Farbton an.
»Was scheren mich die Lateiner und Inder und Franzosen?«, sagte er in vernichtendem Tonfall. »Gute englische Polizisten und anständige Ermittlungsarbeit reichen vollkommen aus. Ich brauche keinen Arzt, um zu erfahren, dass der Mann hier seit Stunden tot ist. Der Mediziner kann ihn in der Leichenhalle in Augenschein nehmen.«
Während er den Toten auf die Trage hievte, war das Klirren von Glas zu vernehmen.
»Warten Sie, Sir!«, rief Constable Wright aus.
Er steckte die Hand in die Innentasche des Fracks der Leiche und brachte eine Taschenuhr zum Vorschein. Das Glas war beim Sturz zerbrochen, und die Zeiger waren zum Zeitpunkt des Todes stehen geblieben. Lord Dunnings Leben war mutmaßlich um fünfundzwanzig Minuten nach elf am Abend des 20. Mai 1901 zu Ende gegangen.
4
Eine Stunde nach Entdeckung der Taschenuhr Lord Dunnings wurde ein Polizeitransporter langsam die Middle Temple Lane entlanggezogen, jene schmale Straße zwischen Inner Temple und Middle Temple, wo die beiden altehrwürdigen Gruppen von Rechtsgelehrten residierten.
Das Klappern der Pferdehufe auf dem Kopfsteinpflaster weckte noch die letzten Anwohner, die nicht bereits neugierig aus den Fenstern spähten. Die Pförtner, Hüter des großen Tors zur Fleet Street, öffneten es, um den Wagen hinauszulassen. Und so trat Lord Dunning, Lordoberrichter von England, seine letzte Reise an, die ihn an den Royal Courts of Justice vorbeiführte, in denen er jahrelang Recht gesprochen hatte.
Dort herrschte indessen helle Aufregung. Die Folgen der Nachricht vom Ableben des Lordoberrichters ließen sich kaum überblicken, die Liste seiner geplanten Verhandlungen war endlos. Prozessparteien warteten auf das Urteil in ihren Rechtsstreitigkeiten. Zwei Kronanwälte mit Robe und Perücke standen vor Lord Dunnings Gerichtssaal in Begleitung ihrer Mandanten, die Unsummen berappt hatten, um ihren juristischen Kampf vor dem Lordoberrichter persönlich ausfechten zu lassen. Der nun ranghöchste Richter, hastig zurate gezogen, ließ das Gerichtsgebäude kurzerhand für den Rest des Tages schließen.
Bestürzte Richter, abrupt ihrer Aufgaben enthoben, eilten aus ihren Räumen und trafen sich im Korridor, und so machte die grauenvolle Nachricht weiter die Runde. Dunning, seit vielen Jahren im Amt, war ein angesehener Mann gewesen, hatte aber wie viele Männer in hohen Positionen keine engen Freundschaften gepflegt. Deshalb war weniger Trauer als vielmehr Fassungslosigkeit ob dieses unsäglichen Verbrechens zu bemerken. Nachdem sämtliche Richter im Gang versammelt waren, schritten sie, wie angetrieben von einem gemeinsamen Instinkt, durch die gewaltige Eingangshalle und verließen das Gebäude.
Draußen stellten sie sich so dicht nebeneinander auf die Treppe, wie ihre Würde und ihre ausladenden Roben es zuließen, einer Art Bollwerk gegen Gesetzlosigkeit gleich, und zwar unwillkürlich in der Position ihrer Rangordnung. Ganz vorne postierten sich die fünf Richter des Berufungsgerichts, dahinter die einundzwanzig Richter der King’s Bench, des Kanzleigerichts und des Nachlassgerichts. Alle waren für die geplanten Prozesse des Vormittags angetan mit prachtvollen Gewandungen in Schwarz, Gold, Scharlachrot, Violett und jeweils mit dem obligatorischen Hermelinkragen. Als die sterblichen Überreste des Lordoberrichters langsam durch das große Tor des Temple und die Fleet Street entlang befördert wurden, nahmen sämtliche Richter in einer Geste der Achtung ihre Perücken ab und hielten sie in den Händen.
Bei der erhabenen Gruppe der Berufungsrichter standen die Lordrichter Wilson und Brown, Schulter an Schulter, den Kopf zum Gebet gesenkt. In den mit Hermelinpelz und farbigen Bändern verzierten Roben glichen die Männer einander und wirkten auf den ersten Blick beinahe identisch, als seien sie lediglich Verkörperungen richterlicher Autorität. Doch obwohl beide über einen scharfen Verstand und ausgeprägten Ehrgeiz verfügten, konnten sie kaum unterschiedlicher sein. Lordrichter Brown war groß, schmallippig, zurückhaltend und vornehm. Lordrichter Wilson dagegen war ein kleiner, korpulenter Mann mit rotem Gesicht, der zur Großspurigkeit neigte.
Nach außen hin erschienen beide in dieser Situation zutiefst betroffen von dem ungeheuerlichen Ereignis; in ihrem Herzen jedoch herrschte bei beiden Jubel. Denn jeder von ihnen wusste mit berauschender, erhebender Gewissheit, dass er der nächste Lordoberrichter von England sein würde.
Sämtliche Richter Seiner Majestät fanden sich durch dieses erschütternde Drama unversehens freigestellt von den inszenierten Dramen der Prozesse und verspürten außerdem ein ungewohntes Gefühl von Verletzbarkeit. Entsprechend ihrem Charakter nutzten sie die verwirrende, tragisch gewonnene Freizeit auf unterschiedliche Weise. Die Gewissenhaften begaben sich in die Bibliothek, die Geselligen in ihre Clubs und die Treuliebenden nach Hause. An diesen Zufluchtsorten fand ein jeder von ihnen den benötigten Trost.
Lordrichter Brown verspürte sofort das Verlangen, mit seiner Gattin zu sprechen. Doch dann fiel ihm ein, dass sie dienstags immer im Waisenhaus war. Deshalb ging er zunächst in die Bibliothek und brütete dort eine Stunde lang beharrlich über dem neuen Gesetz zur Verhinderung von Unfällen im Eisenbahnverkehr, dessen Einzelheiten ihn voraussichtlich in seinem nächsten Fall beschäftigen würden.
Als er später nach Hause kam, war Lady Brown noch immer nicht von ihrem Morgenbesuch zurückgekehrt. Sie selbst hatte keine Kinder bekommen und widmete sich umso eifriger den Waisen im Heim St Saviour’s, wo die kleinen Wesen in ihren steifen Uniformen all die angestaute Liebe ihrer Wohltäterin dankbar in sich aufsogen wie Schwämmchen. Seit Jahren schon stattete Lady Brown der tristen Institution in Shepherd’s Bush allwöchentlich einen Besuch ab. Mit ihren schmeichelnden Pelzen und Seidenkleidern, liebevollen Umarmungen und Worten sowie süßen Sahnebonbons, Spielen und Geschichten bereicherte sie das Leben der elternlosen Kinder. Und wenn sie dann nachmittags nach Hause zurückkehrte, gab sie sich stets besonders fröhlich und munter, um sich den Schmerz ihrer unerfüllten Sehnsucht nicht anmerken zu lassen.
Ihr Gatte jedoch wusste ohnehin Bescheid. Während der langen Gerichtsferien hatte er sie einmal begleitet und zugesehen, wie sie in dem einzig anheimelnden Element der Institution saß, dem sogenannten Garten, der aus einer kümmerlichen Rasenfläche mit einem mächtigen Kastanienbaum bestand. Umgeben von verzückt lauschenden Kindern, hatte Lady Brown unter seinen schützenden Ästen eine ihrer selbst ausgedachten Geschichten erzählt, die von einem ganz anderen Garten handelte, in dem es blühende Blumen, Häschen und Elfen gab. Und Lordrichter Brown hatte seine Gemahlin ebenso verwandelt erlebt wie die Waisenkinder.
»Es tut mir leid, meine Liebe«, hatte er auf dem Rückweg zur Kutsche recht steif gesagt und sich danach nie wieder zu dem Thema geäußert.
Jetzt tigerte der Richter unruhig durch den Salon, bis er gleichzeitig mit dem Essensgong hörte, wie seine Gattin heimkehrte. Ihre Reaktion auf die Neuigkeiten war ganz, wie er es erwartet hatte: Sie zeigte sich so erschüttert, als sei er selbst mit dem Tranchiermesser bedroht worden; schauderte bei der Vorstellung, in welcher Gefahr er womöglich am Abend des Diners mit dem Lordoberrichter geschwebt hatte, und äußerte warmherziges Mitgefühl für Lord Dunnings Familie.
»Das ist wahrhaft unfassbar«, sagte Lady Brown schließlich. »Und dabei habe ich Amelia Murray heute Morgen noch im Waisenhaus getroffen. Da kann sie noch nichts von dieser Tragödie gewusst haben.«
»Wer ist Amelia Murray?«
»Ach, ich dachte, du wüsstest das. Sie war vor einigen Jahren selbst noch eine Waise. Ein kluges, energisches und fleißiges Mädchen. Doch inzwischen ist sie die Gouvernante der Dunning-Kinder.«
»Um welche Uhrzeit hast du sie dort getroffen?«, fragte der Lordrichter erstaunt. »Die Familie muss doch vollkommen erschüttert sein. Was um alles in der Welt machte die Gouvernante dann in St Saviour’s?«
»Es war noch früh am Morgen. Ich traf bereits um acht dort ein, weil ich die Kleinen immer so gern beim Frühstück sehe. Amelia kann noch nichts von dem schrecklichen Ereignis gewusst haben. Sie hat es gewiss bei ihrer Rückkehr erfahren. Ich darf gar nicht daran denken. Die armen Kinder.«
»Aber wieso hat die junge Frau sich dort aufgehalten?«
Seine Gattin schüttelte den Kopf. »Das weiß ich wirklich nicht, mein Lieber. Sie sagte nur, sie wolle sich nützlich machen bei den Kleinsten. Mir kam der Gedanke … ich habe mich gefragt, ob sie vielleicht unglücklich ist in der Familie. Aber das ist gewiss dumm von mir. Sie hat sich so gut gemacht, und wir sind alle sehr stolz auf sie. Nun, jedenfalls half sie beim Frühstück. Danach lauschte sie im Garten meiner ersten Geschichte und verschwand irgendwann.«
Lady Brown warf ihrem Mann einen wehmütigen Blick zu. »Weißt du, ich denke immer an all die Kinderchen und hoffe, dass sie später ein gutes Leben haben. Es wäre so traurig, wenn unsere Waisen draußen in der Welt nicht zurechtkämen, sie hatten ja schon so einen schlimmen Start. Manchmal wünschte ich, wir könnten einem dieser Kinder ein Zuhause bieten.«
Etwas verwundert betrachtete der Lordrichter seine Frau. »Meine liebe Maria, du weißt doch, dass du die alleinige Entscheidung über unser Personal hast. Wenn eine Stelle frei wird, kannst du sie selbstverständlich einem dieser jungen Menschen anbieten.«
»Ach so«, erwiderte Lady Brown. »So hatte ich das nicht gemeint. Ich dachte eher, hier im Haus … mit uns …«
»Mit uns? Was soll das bedeuten? Du meinst, als Mündel? Das kommt nicht infrage!«
Seine Gattin starrte auf ihren Teller.
Lordrichter Brown war seiner Gemahlin sehr zugetan. Ruhiger sagte er: »Maria, meine Liebe … du weißt doch gar nichts über die Herkunft dieser Kinder. Sie könnten alles Erdenkliche geerbt haben – einen Hang zum Verbrechen, Trunksucht, Wahnsinn … Großer Gott, du müsstest doch am allerbesten wissen, dass dergleichen in keiner Weise mit uns in Verbindung gebracht werden darf.«
Lady Brown war durchaus im Bilde über die nur dezent geäußerten, aber zuversichtlichen Pläne für den beruflichen Aufstieg ihres Gatten. Zunächst war es ihr geschmacklos erschienen, die Folgen von Lord Dunnings Tod anzusprechen, doch jetzt wagte sie es mit gezieltem Feingefühl.
»Ich nehme an, mein Lieber«, sagte sie, »dass du in Bälde womöglich sehr beschäftigt sein wirst?«
Aber sogar diese Andeutung schien noch zu deutlich für das außerordentlich heikle Thema, und der Lordrichter wich davor zurück wie ein scheuendes Pferd.
»Gewiss wird es in den nächsten Tagen viele Fragen zu beantworten geben«, antwortete er ausweichend. »Ich war einer der wenigen, die den armen Dunning noch lebend gesehen haben beim Diner des Schatzmeisters. Ich hoffe, daraus entstehen mir keine Schwierigkeiten.«
»Ganz bestimmt nicht«, erwiderte seine Gattin beruhigend. »Der gute Lord Dunning, dein Freund und Kollege. Jeder wird doch verstehen, wie schlimm dieser Verlust für dich ist.«
Angesichts dieser liebenswürdigen, vertrauensvollen Augen, die nur das Gute in den Menschen sahen, war Lordrichter Brown etwas unbehaglich zumute, da er sich plötzlich wie ein Betrüger vorkam.
»Maria, meine Liebe«, sagte er zögernd, »du musst wissen, dass Mordermittlungen sehr gründlich durchgeführt werden. Die Polizei wird überall herumschnüffeln. Angesichts meiner bevorstehenden Beförderung … müssen wir äußerst vorsichtig sein mit unseren Aussagen.«
»Du meinst doch nicht … meinst du … aber dein neues Amt hat doch gewiss nichts mit dem Tod von Lord Dunning zu tun?«
»Nein, nein«, antwortete Brown hastig. »Er hat allerdings während des Diners etwas gesagt, das …«
Lady Brown sah ihn mit schreckgeweiteten Augen an.
»Ach, nicht der Rede wert. Es war wirklich nichts.«
Die besondere Betonung schien die Ängstlichkeit seiner Gattin jedoch nur zu verstärken, und den Rest der Mahlzeit verbrachten sie schweigend.
Lordrichter Wilson hatte sich indessen auf direktem Wege nach Hause begeben, angetrieben von einem Verlangen, das nichts mit seiner herrschsüchtigen Gattin zu tun hatte. Mittlerweile war es heiß geworden, und während der beleibte Lordrichter die Stufen zur Tür seines Hauses in Hampstead hinaufstapfte, wurde er beflügelt von einer Art klangvollem innerem Gesang: »Leda, Charles de Mills, Rosa Alba, Old Blush, Nuits de Young, Cécile Brünner, Reine des Violettes …« Und dann erreichte er sein Zuhause und damit die berauschend üppige Pracht seiner blühenden Rosen.
Um zu ihnen zu gelangen, musste er jedoch den Wintergarten durchqueren, wo er unweigerlich auf seine Gattin traf, ebenfalls eine leidenschaftliche Gärtnerin, die gerade zwischen ihren sorgfältig gepflegten Palmen und Jasminsträuchern die Einladungen für ihr nächstes Damentreffen schrieb. Sie zog fragend die Augenbrauen hoch, weil ihr Mann unerwartet an einem Dienstagvormittag nach Hause kam, verarbeitete jedoch die Nachricht erstaunlich schnell. Die darauffolgende Bemerkung hatte ihr Gatte zwar vorausgesehen, fand sie aber dennoch wenig erbaulich.
»Haben sie dich wegen der Nachfolge gefragt?«, wollte Lady Wilson prompt wissen, und in ihrer Stimme schwang ein peinlich triumphierender Unterton mit.
Auch Lordrichter Wilson hatte seine geheimen Hoffnungen seiner Frau offenbart. Er war kein empfindsamer Mann, doch sogar er zuckte innerlich zusammen angesichts der Taktlosigkeit dieser Äußerung.
»Meine liebe Louisa, selbstverständlich nicht. Großer Gott, alles war in Aufruhr! Ich glaube kaum, dass davon so schnell die Rede sein wird. Es ist eine erschütternde Tragödie.«
»Aber das Leben geht weiter«, versetzte seine Gattin so bedeutungsvoll, als hätte sie diese Plattitüde gerade selbst erfunden. »Und ich denke, wir sollten keine Chance ungenutzt lassen, deinen Aufstieg voranzutreiben.«
Während des Mittagsmahls setzte sie ihre Rede fort: »Ich könnte mich ja bei der Gemahlin des Lordkanzlers erkundigen, wann ihr Mann gedenkt, die Ernennung zu verkünden.«
Wilson war entsetzt. »Um Himmels willen, Louisa! Das kommt überhaupt nicht infrage, bitte tu das nicht!«
»Aber warum denn nicht? Sie ist eine liebenswürdige Person, wir sind uns häufig bei Empfängen begegnet. Ich halte das für eine hervorragende Idee. Manchmal kommt es mir geradezu vor, als sei ich ehrgeiziger für dich als du selbst.«
Der Lordrichter plusterte sich so auf, dass sogar die Rose in seinem Knopfloch erbebte. »Meine hochverehrte Louisa, dies ist keine Angelegenheit für die Damenwelt. Ich muss dich dringend bitten, dich dabei nicht einzumischen. Meine Ernennung zum höheren Amt überlässt du bitte dem Lordkanzler und mir.«
Mit pikierter Miene klingelte Lady Wilson dem Butler. »Wie du wünschst. Ich habe bereits mein Bestes getan. Dann werde ich von jetzt an nichts mehr unternehmen, außer auf die Verkündigung zu warten. Aber die sollte wirklich zügig erfolgen.«
Ihr Gatte fragte sich beunruhigt, weshalb sich auf dem Gesicht seiner Frau kurz ein Ausdruck abgezeichnet hatte, der ihm ziemlich dubios erschienen war. Und was in aller Welt meinte sie mit der Bemerkung, sie habe bereits ihr Bestes getan?
»Mich beschäftigt gegenwärtig eher«, sagte er, »dass ich eine der letzten Personen war, die Dunning lebend gesehen haben.« Und dann äußerte der Lordrichter ähnliche Gedanken wie sein Kollege, den er als Konkurrent gar nicht in Erwägung zog: »Ich hoffe, dass mir daraus keine … Schwierigkeiten entstehen.«
»Wieso das denn?«, erwiderte seine Frau. »Du glaubst doch wohl nicht, dass jemand dich des Mordes am Lordoberrichter verdächtigt?«
»Meine liebe Louisa! Ich meinte damit nur, dass es besser wäre, wenn ich nicht in irgendeinem Zusammenhang gesehen würde mit einem Geschehen, das für jede Menge Unruhe im Temple sorgen wird. Ich muss damit rechnen, dass ich von der Polizei zu den Ereignissen letzte Nacht befragt werde.«
»Dann trifft es sich doch gut«, erwiderte Lady Wilson ungerührt, »dass ich dich nach dem Diner im Temple abgeholt habe und wir gemeinsam nach Hause zurückgekehrt sind, nicht wahr?«
»Ja gewiss«, antwortete der Lordrichter, den jedoch ein gewisses Unbehagen beschlich. Er erinnerte sich unversehens daran, wie er Louisa vor etwa zehn Jahren ins Lyceum Theatre ausgeführt hatte, um dort den großen Shakespeare-Darsteller Henry Irving als Macbeth zu erleben. Rasch bemühte sich der Lordrichter, die unerwünschte Erinnerung an dessen machthungrige Gemahlin zu verdrängen. Er wollte nicht darüber nachdenken, weshalb sie ihm ausgerechnet jetzt in den Sinn kam.
5
»Barfuß?«, fragte Sir William Waring ebenso vernichtend wie verächtlich. »Wieso um alles in der Welt waren seine Füße nackt? Und wo zum Teufel sind die Schuhe und Strümpfe des Mannes?«
Gabriel schüttelte stumm den Kopf und verlagerte sein Gewicht auf dem harten Stuhl mit der starren Lehne. Der Stuhl stand vorsätzlich gegenüber dem hohen Schiebefenster in Warings elegantem Büro, damit sich Besucher möglichst unwohl fühlten. Gabriel wurde von der Sonne geblendet und musste angestrengt blinzeln, wohingegen Sir William, Oberster Schatzmeister und Präsident des Inner Temple, mit dem Rücken zum Licht hinter seinem Schreibtisch thronte. Der blühende Goldregen auf der Terrasse wirkte als Hintergrund für den markanten Kopf des Schatzmeisters wie ein Heiligenschein auf einem Andachtsbild.
Sir William fand Gabriel vollkommen rätselhaft. Jeder im Temple war im Bilde über die Gewohnheiten des Kronanwalts, und es wurde gewitzelt, dass man die Uhr nach dem Lampenlicht in Gabriel Wards Fenster am King’s Bench Walk Nummer vier stellen könne: Morgens war es exakt bis sechs Uhr achtundfünfzig erleuchtet, abends von sechs bis null Uhr dreißig. Dieses Gebaren des wissbegierigen Rechtsgelehrten brachte den eitlen, leichtfertigen Lebemann Waring auf die Palme.
»Was zum Teufel macht der Bursche denn immer?«, pflegte er seine Begleiter bei geselligen Abenden im altehrwürdigen Garrick Club zu fragen. »Arbeiten«, lautete wiederholt die Antwort, worauf Sir William verständnislos, jedoch auch mitfühlend den Kopf schüttelte.
»Ich brauche Ihnen wohl nicht zu erklären, Ward«, sagte er jetzt mit finsterem Stirnrunzeln, »dass dieser Vorfall ausgesprochen schädlich ist für den Ruf des Inner Temple. Der Zeitpunkt könnte kaum ungünstiger sein.«
Gabriels leicht befremdete Miene entging dem Schatzmeister nicht, weshalb er hastig eine angemessenere Bemerkung hinzufügte: »Das ist natürlich alles entsetzlich, und ich bin selbstverständlich sehr um die Sicherheit unserer Mitglieder und Bediensteten bemüht. Mir ist nicht verborgen geblieben, dass die Angst umgeht, und ich habe den Pförtnern eingeschärft, besonders wachsam zu sein, und dem Laternenanzünder aufgetragen, nachts sämtliche Lampen anzuzünden, nicht nur die in den belebteren Straßen.« Dann kam sein eigentliches Anliegen wieder zum Vorschein: »Wir können uns einen solchen Skandal gegenwärtig nicht erlauben, in dieser geschäftigen Periode. Der Middle Temple ist natürlich bereits schadenfroh.«
Es war die Mittagszeit des Tages, an dem Lord Dunnings Leiche entdeckt worden war, und Gabriel, intensiv befasst mit dem komplizierten Fall Cadamy gegen Moore, zu dem er nachmittags einen Beratungstermin hatte, war Warings mysteriöser Aufforderung zum Gespräch nur höchst widerwillig gefolgt. Jetzt gab der Barrister ein uneindeutiges Geräusch von sich und überlegte, ob er wohl heimlich auf seine Uhr schauen könnte.
Sir William starrte ihn aufgebracht an. »Um unser Ansehen in der Welt zu bewahren, müssen wir alle an einem Strang ziehen, da werden Sie mir doch gewiss beipflichten.«
Prompt meldete sich der innere Anwalt zu Wort. Schrecklich abgedroschene Formulierung.Überdies unpräzise. Gabriel schüttelte erneut den Kopf, diesmal wegen der geistlosen Phrase, nickte dann aber hastig als Antwort auf die Frage.
»Ich werde nicht zulassen, dass Polizisten durch den Inner Temple schleichen und im Leben der hier wohnenden und arbeitenden Menschen herumschnüffeln«, verkündete Sir William kategorisch. »Die Leute haben schon genug Angst. Die Bediensteten wollen nicht allein nach Hause gehen, Barrister schließen zum ersten Mal seit Jahrhunderten ihre Kanzlei ab, und im Gerichtsgebäude herrscht nahezu Panik.«
Waring spielte mit seinem Briefbeschwerer und wirkte dabei, als habe er etwas zu verbergen. Gabriel wartete mit einer gewissen Neugierde ab; Sir William zögerte nämlich nie und trat stets mit überragender Selbstsicherheit auf. Früher war er Richter am Obergericht gewesen, hatte den Posten jedoch vorzeitig aufgegeben, weil er lieber Schatzmeister sein wollte. Man konnte nicht behaupten, dass er dafür hart gearbeitet hatte, da er bereits von Natur aus die Eigenschaften mitbrachte, die für dieses Amt erforderlich waren. Waring war ein höflicher Machtmensch, dem sein eigenes Renommee sicher mehr bedeutete als der gute Ruf des Inner Temple. Solange er seinen Willen bekam, konnte er diplomatisch und sogar nachsichtig sein, andernfalls skrupellos.
In seiner Amtszeit war der Inner Temple aufgeblüht: Die Gebäude wurden hervorragend gepflegt, historische Gemälde und Silber restauriert, die Diners waren opulenter geworden, die Weinkeller besser gefüllt, die Gärten üppiger, die Einladungen zu allerlei Geselligkeiten heiß begehrt. Wer wehmütig an ruhigere Zeiten zurückdachte (und zu jenen zählte Gabriel), als die Gärten wunderschön, aber wilder waren, und man in den etwas heruntergekommenen Gebäuden noch Geschichte spüren konnte, der war in der Minderheit. Allgemein herrschte die Meinung vor, dass Sir William seine Sache gut machte. Gestärkt durch diese Anerkennung, hatte er die feste Absicht, sein Ansehen weiter auszubauen.
Jetzt fragte er: »Sie sind doch über das besondere Verhältnis von Inner und Middle Temple im Bilde, oder, Ward?«
»Gewiss, Sir William, ich habe mich eingehend damit befasst. Der Temple-Bezirk mit Inner und Middle Temple wurde im zwölften Jahrhundert von den Tempelrittern errichtet und später von den Rechtsgelehrten übernommen.« Gabriel, ganz in seinem Element, merkte gar nicht, dass er seinem Gegenüber Fakten referierte, die diesem so bekannt waren wie ihm selbst. »Er liegt innerhalb der City of London, ist jedoch eine unabhängige Enklave, etwa wie der Vatikan in Rom. Beide Areale sind sogenannte ›Liberties‹, also unabhängig von der städtischen Jurisdiktion von London. Inner und Middle Temple unterliegen weder ziviler noch kirchlicher Jurisdiktion und werden von eigenen Parlamenten regiert. Das ist unsere ganz eigene kleine Welt. Ausgesprochen romantisch, nicht wahr?«
Sir William besaß nicht den geringsten Sinn für Romantik.
»Ja, ja«, sagte er gereizt. »Und mit diesem besonderen Status einher geht bekanntermaßen die Tatsache, dass die Polizei der City of London nur mit unserer Einwilligung Zutritt zum Temple hat. Ich bin der Ansicht, dass in diesem abscheulichen Verbrechen zumindest vorerst von einem erfahrenen Mitglied unserer Gemeinschaft ermittelt werden sollte. Dabei muss natürlich mit großem Feingefühl vorgegangen werden. Wir dürfen nicht den Eindruck erwecken, als hielten wir uns für der Polizei überlegen. Ferner möchte ich auch nicht, dass der Inner Temple in dieser modernen Zeit als rückschrittlich betrachtet wird. Fortschritt ist das Wort, das unsere Leitlinie sein soll. Fortschritt und Prestige!«
Gabriel hüllte sich in Schweigen, während Sir William sich in eine seiner Tiraden hineinsteigerte, für die er in der Anwaltskammer berüchtigt war und aus denen es kein Entkommen gab.
»Wir wissen doch, nicht wahr, dass kein Mitglied des Inner Temple, und ganz gewiss keiner der würdigen Rechtsgelehrten, mit denen der Lordoberrichter dinierte, diese ungeheuerliche Tat begangen haben kann. Jemand muss von außen eingedrungen sein. Es ist jedoch einzuräumen, dass die Mordwaffe aus den Beständen des Inner Temple stammte und dass die Leiche hier gefunden wurde. Deshalb müssen innerhalb unserer Gemeinschaft sämtliche Möglichkeiten in Erwägung gezogen und Zeiten und Gelegenheiten überprüft werden. Ich habe diese Meinung gegenüber dem Polizeipräsidenten zum Ausdruck gebracht, mit dem ich von Diners in der Stadt bekannt bin. Erfreulicherweise kann ich berichten, dass er meinem Vorschlag, zunächst interne Befragungen bei der Familie des Lordoberrichters und bei unseren Mitgliedern durchzuführen, zugestimmt hat. Er stellt uns dafür sogar einen Constable zur Seite. Sämtliche weiterführenden Ergebnisse von uns werden der Polizei mitgeteilt, die dann extern ermittelt, was zweifellos rasch zur Verhaftung des Eindringlings führen wird. Unterdessen müssen wir uns für einige Tage die Presse vom Hals halten. Ich werde einen Aushang dazu machen.« Waring hielt inne, um Luft zu holen, und fuhr dann ohne Umschweife fort: »Wir sind der Ansicht, dass der für diese ersten Untersuchungen geeignete Barrister ein Alibi haben muss, damit er über jeglichen Verdacht erhaben ist. Ich habe mich für Sie entschieden.«
»Für mich?« Gabriels Stimme klang schrill vor Entsetzen.
»Ja, Ward, für Sie.«
»Aber das kann ich nicht übernehmen.«
»Sie sind ein Barrister mit exzellentem analytischem Verstand und gelten als außergewöhnlich scharfsinniger und sachlicher Jurist. Überdies wurde mir zugetragen, dass Sie am Ort des grauenhaften Mordes beträchtliche Kenntnisse in der Verbrechensaufklärung an den Tag gelegt haben. Wiewohl mir das unerklärlich ist«, bemerkte Sir William säuerlich, »da Sie schließlich auf die obskursten Gebiete der Rechtswissenschaften spezialisiert sind.«
»Ich habe nur Bücher darüber gelesen«, sagte Gabriel bescheiden. »Ich lese über fast alles Bücher.«
Der Schatzmeister gab eine Art Grunzen von sich.
»Aber ich habe kein Alibi«, ergänzte Gabriel hoffnungsvoll.
Sir William grinste grimmig. »Doch, Ward, Sie haben ein Alibi, und zwar eines, das die Polizei gewiss als felsenfest bezeichnen würde. Ihre Gewohnheiten sind den Kollegen bekannt, und jeder hier ist mit dem Anblick vertraut, Sie am Abend durch Ihr Fenster an Ihrem Schreibtisch sitzen zu sehen. Ein Bewohner der Paper Buildings, ein sehr zuverlässiges Mitglied der Anwaltskammer, dessen Wohnung sich auf Höhe der Ihren befindet, hat mir mitgeteilt, dass er Sie gestern Abend wie üblich zwischen sechs und halb eins am Tisch hat sitzen sehen. Nachdem Sie sich dort erhoben hatten, ging in Ihrem Schlafzimmer Licht an, und Sie wurden dabei beobachtet, wie Sie in Ihrem Nachtgewand am Fenster standen«, endete Waring triumphierend.
»Sir William, ich bin wirklich kein Detektiv, aber wurde denn der Todeszeitpunkt von Lord Dunning bereits festgestellt?«
»Ah!« Der Schatzmeister genoss es immer, Antworten präsentieren zu können. »Es trifft sich gut, dass derselbe Gentleman, der beobachtet hat, wie Sie um halb eins zu Bett gingen, zur selben Zeit ein langes dunkles Objekt bemerkt hat, das vor Crown Office Row Nummer eins am Boden lag. Der Kollege ist ziemlich sicher, dass es sich noch nicht dort befand, als er um elf Uhr aus dem Fenster schaute. Zu diesem Zeitpunkt sah er einige Herren aus ihren Kanzleien in Crown Office Row Nummer zwei kommen, und die Pförtner am Tor waren auch noch da. Ich fürchte, der Kollege hielt Lord Dunnings Leiche für einen aufgerollten Teppich und dachte sich nichts dabei, bis er die tragische Nachricht erfuhr, worauf er zu mir kam und die ganze Geschichte erzählte. Sie sind somit entlastet und ideal geeignet für die Rolle des Detektivs.«
Gabriel öffnete den Mund, um zu fragen, woher Sir William wissen wollte, dass das dunkle Objekt nicht tatsächlich ein aufgerollter Teppich gewesen war. Um aber nicht zu demonstrieren, dass er kriminalistisch denken konnte, sagte er nur: »Detektiv? Wie Sherlock Holmes, meinen Sie?«
»Wer ist Sherlock Holmes?«, fragte Sir William, der nie etwas anderes als Prozessberichte las.
»Die Hauptfigur der Romane und Kurzgeschichten von Mr Conan Doyle. Die übrigens äußerst gelungen sind, ich kann sie sehr empfehlen.«
Sir William machte eine wegwerfende Handbewegung. »Niemand verlangt von Ihnen, dass Sie sich eine erfundene Figur ausdenken. Wir bitten Sie lediglich, innerhalb der Gemeinschaft des Inner Temple einige Befragungen durchzuführen und die Ergebnisse mir und der Polizei zu übermitteln. Wir wissen, dass Lord Dunning gestern Abend im Inner Temple diniert hat und dass seine Leiche heute früh nur wenige Schritte vom Eingang zum Bankettsaal gefunden wurde. Er hatte nämlich mit mir diniert, ich gab eines meiner Kleinen Diners, wissen Sie.«
Gabriel wusste in der Tat Bescheid. Die Kleinen Diners des Schatzmeisters waren im Temple allgemein bekannt. Es handelte sich um außerordentlich formelle Angelegenheiten, die von den respektloseren Kollegen als lächerlich pompös verspottet wurden. Die Gäste, höchstens sechs an der Zahl, saßen für diesen exklusiven Anlass im Bankettsaal, der beinahe dreißig Meter lang war. Große Abendgarderobe war verlangt, und man dinierte an dem Tisch, an dem vierzig Gäste Platz gehabt hätten. Die Speisen waren vorzüglich, die Weine erlesen; vor allem der Portwein genoss einen legendären Ruf. Doch diese Genüsse gab es nicht umsonst. Sir William legte nämlich stets seine Strategien für mehr Machtgewinn im Temple dar, deren Durchführung anschließend den anwesenden Gästen oblag.
»Die übrigen Gäste«, fuhr Waring fort, »waren der Reverend Master der Temple Church, Reverend Vernon-Osbert, Lordrichter Wilson, Lordrichter Brown und Kronanwalt Sir Vivian Barton. Der Lordoberrichter war unser Ehrengast. Wir hatten eine delikate Angelegenheit zu besprechen, die in keinerlei Zusammenhang mit dem späteren tragischen Vorfall steht und mit der Sie sich nicht belasten müssen. Ich möchte Ihnen jedoch nahelegen, Informationen über den weiteren Verlauf des Abends zunächst von den anderen und erst später von mir einzuholen. Für Recht und Gerechtigkeit benötigt man Distanz und Gedankenfreiheit, nicht wahr?«
Gabriel neigte wortlos den Kopf. Die Bemerkung war zwar banal, fand aber seine Zustimmung.
»Das werden Sie sicher bestätigt finden, aber ich kann Ihnen jedenfalls mitteilen, dass Lord Dunning mein Kleines Diner um Viertel vor elf verließ. Von da an wäre der Zeitraum bis halb ein Uhr nachts abzuklären. Sie haben eine Woche Zeit und werden mir am nächsten Dienstag Bericht erstatten.«
Er legte eine Pause ein, um Gabriel Gelegenheit für Äußerungen zu geben, doch der war sprachlos. Während der gesamten Unterredung hatte Sir William mit keinem Wort sein Bedauern über den Tod von Lord Dunning zum Ausdruck gebracht, den er seit vielen Jahren gekannt hatte.
»Ich schlage vor, dass Sie als Erstes mit der Köchin der Inner-Temple-Küche über den Zeitpunkt des Diners und die Herkunft des Messers sprechen«, fuhr Sir William fort. »Anschließend können Sie Lady Dunning und die exzentrische Schwester des Lordoberrichters aufsuchen, um in Erfahrung zu bringen, wann er zu Hause erwartet wurde, und ob man dort die Abwesenheit seiner Fußbekleidung erklären kann. Die Familie wohnt in Kensington, Stafford Terrace.«
»In Kensington!«, rief Gabriel entgeistert aus. Abgesehen von seinen berufsbedingten Aufenthalten im nahe gelegenen Gerichtsgebäude hatte er den Temple-Bezirk seit mehreren Jahren nicht verlassen.
»Ja«, bestätigte Sir William erbarmungslos. »In Kensington.«
»Und auch noch zwei Frauen!«, äußerte Gabriel noch bestürzter. Frauen waren für ihn gänzlich unverständliche Wesen, denn sein Verhältnis zum anderen Geschlecht war geprägt vom Desinteresse seiner Mutter an seiner Person und der erdrückenden Liebe seines Kindermädchens.
Als der Schatzmeister (der zwei Töchter, eine Ehefrau und eine Geliebte hatte, von diversen Gespielinnen ganz abgesehen) später seinen Trinkfreunden von dieser Unterredung berichtete, sagte er abfällig: »Der Mann hätte nicht angewiderter klingen können, wenn ich ihm aufgetragen hätte, sich in einem Pariser Bordell umzuhören.«
In seinem Grauen wurde Gabriel resolut. »Es tut mir leid, Sir William, aber ich kann diese Aufgabe nicht übernehmen. Ich habe derzeit außerordentlich viel zu tun und jede Menge Vorbereitungen für meine Fälle zu erledigen. Gleich heute Nachmittag habe ich einen Beratungstermin. Bei aller Achtung muss ich es ablehnen, diese Ermittlungen durchzuführen. Es ist absolut ausgeschlossen.« Und nun blickte er demonstrativ auf seine Taschenuhr.
In der jetzt eintretenden Stille neigte der Schatzmeister zuerst langsam den Kopf, als wolle er zustimmen, und drehte sich dann mit seinem Stuhl so zum Fenster, dass er über die Terrasse blicken konnte.
»Was für ein herrlicher Tag«, bemerkte Waring sinnend, »und wie schön die roten Backsteinhäuser des King’s Bench Walk in der Sonne leuchten. Dieses Haus wurde vom großen Baumeister Christopher Wren entworfen, nicht wahr?«
»In der Tat«, antwortete Gabriel, erleichtert, sich wieder auf sicherem Terrain zu befinden. »Von den meisten Gebäuden im King’s Bench Walk sind die Architekten nicht bekannt. Aber Haus Nummer vier, wo ich das Glück habe, wohnen zu dürfen, wurde mit höchster Wahrscheinlichkeit von Sir Wren gestaltet, richtig.«