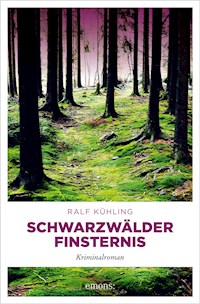Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Carl Christopher Modersk
- Sprache: Deutsch
Ein rasanter Action-Krimi um einen unkonventionellen Ermittler mit Kultpotenzial. Hauptkommissar Carl Christopher Moderski ist nach einem gefährlichen Undercovereinsatz am Ende seiner Kräfte. Um kürzerzutreten, wechselt er zu einer kleinen Dienststelle im Nordschwarzwald. Doch schon an seinem ersten Tag wird ein erfrorener Landstreicher im Wald gefunden. Seine Kollegen wollen den scheinbar klaren Fall schnell abschließen, aber für Moderski ist es Mord. Er verfolgt die Spur und stößt auf ein viel größeres Verbrechen – denn seine neue Heimat ist nicht so ruhig, wie er dachte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 237
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ralf Kühling, Jahrgang 1958, wuchs im Ruhrgebiet auf. Er ist Goldschmiedemeister und seit 1990 in Calw im Nordschwarzwald selbstständig. Für seine vier Kinder erzählte er jahrelang Gutenachtgeschichten, bevor er zum Schreiben kam.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
Lust auf mehr? Laden Sie sich die »LChoice«-App runter, scannen Sie den QR-Code und bestellen Sie weitere Bücher direkt in Ihrer Buchhandlung.
© 2019 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: designritter/photocase.de
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Christine Derrer
eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-540-4
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Auf der Straße herrscht das Gesetz des Stärkeren, eigentlich funktioniert die ganze Welt so. Der Stärkere unterdrückt und beutet aus. Ich finde, es sollte anders sein, die Starken sollten den Schwachen helfen. Nur wer helfen kann, ist wirklich stark …
Carl Christopher Moderski
EINS
Ich sah mich in dem verkalkten Hotelspiegel an. Gerade aufgestanden, schlecht geschlafen, zu viel Alkohol. Hinter mir konnte ich die leere Flasche erkennen, die halb unter das Bett gerollt war.
Vielleicht hätte ich den Wein nicht an der Tankstelle kaufen sollen.
Ich war gestern Abend angekommen, brauchte ein Zimmer, das ich mir auch länger leisten konnte. So war ich hier gelandet, günstig, oder besser billig. Die dilettantisch über der Tapete verlegten Leitungen bestätigten die alte Weisheit, dass Provisorien mitunter lange halten. Was man vom Teppichboden nicht sagen konnte. Die Möbel waren aus Pressholz mit Kunststofffurnier, Marke geschmacklos. Immerhin, die Matratze hatte mir keine Rückenschmerzen beschert.
Ich duschte und rasierte mich, dazu ein frisches Hemd. Schon besser.
Das Frühstücksbuffet bestand aus Cornflakes, eingeschweißter Wurst, zu süßer Marmelade und aufgebackenen Brötchen. Wenigstens der Kaffee war in Ordnung.
Ich ging zu Fuß, vom Hotel zum Kommissariat war es nicht weit. In dieser Stadt war eigentlich nichts weit. Friederichsburg im Nordschwarzwald, irgendwo zwischen Karlsruhe und Stuttgart, war gerade groß genug, um kein Schlaf-Kaff zu sein. Es gab ein Parkhaus. Bei einem Bäcker, der schon geöffnet hatte, kam ich vorbei, alles andere war noch geschlossen, dunkel, mit Rollläden verbarrikadiert. Die trüben Wolken, die dicht über den Häuserdächern zu hängen schienen, verstärkten den faden Eindruck. Als ich das Haushaltswarengeschäft hinter mir gelassen hatte, fiel mir ein, dass ich ein belegtes Brötchen hätte kaufen sollen. Egal, dafür würde ich nicht zurückgehen. Zwei drei Modefilialen, dann »Rademacher – Mode für Sie und Ihn«, Vodafone, FahrRat – »Wir ziehen um – ab 1. November finden Sie uns …« –, Tchibo mit Stehcafé, leider noch zu. Ein kleiner Lichtblick: Beim Juwelier leuchtete und glitzerte es im Schaufenster, der Goldschmied saß schon bei der Arbeit. Auf einem Schild las ich: »KÜHLING – wir machen Schmuck« und »Schmuck ist Liebe«. Klar, wenn man es so betrachtete. Wer kauft schon Schmuck aus Ärger? Glück gehabt, der gute Mann, dachte ich, braucht sich nicht ständig mit den dunklen Seiten der Menschheit herumzuschlagen.
Noch ein Dutzend weitere Geschäfte folgten. Anwaltskanzleien, Physiopraxen, Zahnärzte und was auch immer in den Obergeschossen angeboten wurde. Je näher das Ende der Fußgängerzone rückte, desto mehr nahmen die Leerstände zu.
Das Gebäude der Kriminalpolizei war ein lang gestreckter, weißer, zweigeschossiger Flachdachkasten. Auf dem Parkstreifen vor dem Gebäude standen nur wenige Autos, kein Streifenwagen war zu sehen.
Das weiße Plastik der Sprechanlage war vergilbt und die Rippen über dem Lautsprecher an zwei Stellen herausgebrochen.
Soweit ich bisher feststellen konnte, strahlten alle Polizeipräsidien der Welt diesen unverkennbaren Verwaltungsmief aus. Ich musste an den Goldschmied denken, hier glitzerte nichts. Selbst der Geist der Gerechtigkeit hatte Mühe, unter der Patina aus ärmlicher Vernachlässigung hervorzuschimmern. Das hier ist der Arsch der Welt, dachte ich, zumindest was Verbrechen angeht. Wird ein ruhiger Job. Genau das, was ich nach all dem Mist der letzten Jahre brauchte.
Ich drückte die Klingel.
»Ja?«
»Moderski. Ich bin der Neue.«
»Ich hol Sie ab.«
Der Türsummer schnarrte. Ich stand in der Schleuse, der Empfang war nicht besetzt. Bildschirm aus, abgestellte Kartons, Staub.
Der Mann kam, graubeiger Bürotyp, Bauch, schütteres Haar. Wir gingen in den zweiten Stock, er redete unablässig. Er stoppte vor einer Tür: »Zimmer 212 – Müller, Christine«, und kündigte mich an. »Der neue Kommissar, Herr Moderski, ist da.«
Christine Müller war mal hübsch gewesen, hatte aber offensichtlich vor ein paar Jahren aufgehört, Modezeitschriften zu lesen. Sie lächelte freundlich. Ich musste kurz warten.
»Ah, Hauptkommissar Moderski, kommen Sie herein«, sagte Winfried Großhans, der Leiter des Präsidiums. Er war Ende fünfzig, grauer Anzug, hellblaues Hemd, rahmenlose Brille, hängende Backen. Er saß zu viel am Schreibtisch, sein Rücken schien rund zu sein, das sah aus, als würde er sich seinem Gegenüber entgegenneigen, dabei machte er einen väterlich-freundlichen Eindruck. Vor ihm lag eine Personalakte.
Er hob den Deckel an einer Ecke an, machte ihn dann aber wieder zu. »Hauptkommissar Moderski, wir freuen uns, dass Sie da sind. Sie haben schon in größeren Revieren gearbeitet, und ich hoffe, Ihre Erfahrungen und Kontakte werden uns allen zugutekommen …«
So ging es noch eine Weile weiter, Erwartungen, dezente Hinweise auf Verhaltensregeln und Hierarchie, Aufgabenbeschreibung.
»… Ihre Kollegen werden Sie dann heute Mittag bei der Dienstbesprechung kennenlernen. Am besten richten Sie sich erst einmal Ihren Arbeitsplatz ein. Mayer bringt Sie hin.«
Der graubeige Typ brachte mich zu einem Büro an der äußersten Ecke des Gebäudes. Die Seite zum Flur hin bestand komplett aus Aktenschränken, gegenüber war eine lange Fensterfront mit Ausblick über einen Parkplatz, über eine Wiese mit Grillstelle, durch Bäume und Büsche zum Fluss, dahinter Industrie, die Bundesstraße, ein Berg, der Rest der Welt. Vor den Fenstern standen vier Schreibtische, die zwei in der Mitte zusammengestellten sahen nach viel Arbeit aus: Aktenstapel, lose Papiere, leere Kaffeetasse, ein Wackel-Elvis, Fotorahmen. Ein weiterer Schreibtisch war rechts an die Wand gerückt, darüber hingen ein Terminplaner, ein paar Fotos und Ansichtskarten. Der vierte Schreibtisch stand links an der Außenwand, er war leer bis auf einen Röhrenmonitor, IT-Steinzeit.
Wohin hat es mich hier nur verschlagen? Das war also mein Arbeitsplatz, mit Blick auf die Wand.
Mayer wies darauf. »Hier sitzen Sie, in Ihrem Rücken ist der Platz von Kommissar Oppermann, gegenüber Hauptkommissar Gerl und da Hauptkommissarin Hammerschmitt.«
»Wo sind die alle?«
»Heute Morgen wurde ein Leichenfund gemeldet, Gerl und Oppermann sind vor Ort, Hammerschmitts Sohn ist krank, sie kommt später.«
Erster Tag – erster Toter. Und das sollte ein ruhiges Revier sein? »Hier ist ja richtig was los.«
Mayer sah mich fragend an.
»Na, mein erster Tag und gleich eine Leiche.«
»Das ist, glaube ich, nur Zufall«, sagte Mayer. »Im letzten Jahr hatten wir nur fünf Tötungsdelikte.«
»Okay, dann sollte ich mir das nicht entgehen lassen. Können Sie mich hinbringen?«
»Wollen Sie sich nicht erst einrichten?«
Ich stöpselte den Monitor aus und drückte ihn Mayer in die Arme. »Sagen Sie der IT-Abteilung, den Rest können sie auch abholen. Ich brauche einen Druckerscanner und einen Zugang zum Intranet. Wir treffen uns in fünf Minuten am Eingang.«
Mayer starrte mich ungläubig an und ging erst, nachdem ich mehrmals genickt hatte.
Ich packte meinen Laptop aus und klappte ihn auf, von Oppermanns Tisch schnappte ich ein Blatt Papier und legte einen Kugelschreiber dazu. Fertig, mein Platz war eingerichtet.
Wir verließen die Stadt Richtung Saulau. Ein bis zwei Kilometer nach der letzten Bebauung von Friederichsburg bogen wir von der Bundesstraße ab. Mayer fuhr einen Forstweg entlang und hielt an einem Abzweig, bei dem schon einige Wagen geparkt waren. »Da rein, circa zweihundert Meter. Sie können die Kollegen gar nicht verfehlen, sind ja genug da.«
Ich stapfte zur Fundstelle. Hier lag noch Schnee, in der Stadt war schon alles weggeschmolzen. An der Absperrung hielt mich ein Polizist an. Ich zeigte ihm meinen Ausweis. »Hauptkommissar Moderski, ich bin neu hier, seit heute. Wer leitet die Ermittlung?«
»Ich«, meldete sich einer. »Hauptkommissar Gerl.« Der Mann strahlte mit seinen nach innen gerichteten Schneidezähnen die Bedrohlichkeit eines Frettchens aus. »Wer sind Sie?«, fragte er barsch.
»Moderski.«
»Ah, und was machen Sie hier?«
»Ich wollte mir das nicht entgehen lassen. Darf ich?« Ich schlüpfte unter dem Absperrband durch und an Gerl vorbei.
»Da gibt es nicht viel zu sehen. Ein Obdachloser, er hat sich einen Unterschlupf im Wald gebaut, ist vermutlich erfroren. War ja ganz schön kalt in den letzten Tagen.«
Ein Mann in weißem Schutzanzug streckte mir seine Hand entgegen. »Norbert Oppermann. Sie hätten sich auch erst mal in Ruhe eingewöhnen können. Das hier ist keine große Sache.«
»Ich war schon fertig mit Eingewöhnen und wollte mich nicht langweilen. Ich gucke erst mal nur von Weitem zu.« Zu Gerl gewandt sagte ich: »Lassen Sie sich nicht stören.«
Gerl ging an mir vorbei und brummte: »Sie stören doch nicht.«
Der Fundort der Leiche lag mitten im Wald, etwa dreihundert Meter von der Straße entfernt, zweieinhalb Kilometer bis zur Stadt. Der Wald war hier ein Mischwald, hauptsächlich Buchen, aber auch Tannen, Fichten, Kastanien und Eichen, es gab wenig Unterholz, nur hier und da Büsche und junge Bäume, die im Schatten der großen um ihr Leben kämpften. Der Tote lag zusammengekauert unter alten Lumpen in einem provisorischen Unterschlupf aus kleinen Stämmen und Ästen, ein Stück von einer Lkw-Plane und ein paar Bretter dienten als Dach.
Ich reckte mich, um mehr zu sehen, aber Gerl stand absichtlich im Weg. »Keine Fremdeinwirkung?«
»Nein!«
Einer von der Spurensicherung sagte: »Nicht offensichtlich.«
Ich erblickte Schnapsflaschen und Konservendosen. »Was sind das da für Dosen?«
Wieder war es der Mann von der Spurensicherung, der antwortete: »Hundefutter.«
»Steht alles später im Bericht, Herr Moderski«, knurrte Gerl von der Seite.
Aha, so gern hatte er mich also hier. Ich nahm ihm doch nichts weg, oder hatte er was zu verbergen?
Ich ging zum Wagen der Kriminaltechniker. »Habt ihr Scheißhaufen gefunden?«
»Was?«
»Na, wenn der hier gewohnt hat, wird er auch hingemacht haben. Nicht gleich in der Nähe, aber irgendwo hier.«
Nein, hatten sie nicht. Gestern hatte es geschneit, vermutlich lag der Tote schon länger hier, alle Spuren waren verdeckt. Ich dachte: Vielleicht sollten sie Hunde holen, sagte aber nichts.
Hier war nichts zu tun für mich. Ich ging ein Stück zur Straße zurück und dann in einem großen Bogen um die Fundstelle herum. Der Schnee war nicht tief, ich kam auch querfeldein gut voran, bergauf war es anstrengend, aber die Luft war angenehm.
Sollte ich öfter machen, Bewegung im Freien.
Einige Tiere hatten frische Spuren im Schnee hinterlassen, Hasen, Rehe, Fuchs, mehrere Hunde. Ich kreuzte den Waldweg. Erstaunlich, wie viele Autos hier schon langgefahren waren. Vierhundert Meter oberhalb des Weges traf ich auf einen Zaun. Er war alt, mit Übersteigschutz aus NATO-Draht. Außen erkannte ich Spuren von Turnschuhen. Jogger. Innen waren Abdrücke von groben Stiefeln und Hundepfoten im Schnee. Wachen. Ein Stück weiter war ein Tor, verriegelt mit einem Sicherheitsschloss und zusätzlich mit einer Kette. Der Jogger hatte das Gelände hier verlassen, war einmal außen herumgelaufen und auch an dieser Stelle wieder hineingegangen. Ich legte meine Uhr neben einen besonders deutlichen Fußabdruck und machte ein Foto mit meinem Handy, inklusive GPS-Daten. Keine der Spuren führte zum Fundort.
Von einem Kollegen ließ ich mich zum Revier zurückbringen.
Nadija Hammerschmitt saß an ihrem Schreibtisch. Als ich eintrat, fuhr sie mit ihrem Stuhl nach hinten und lehnte sich entspannt zurück. »Ja?«
Ein paar Sekunden musterten wir uns. Sie, knapp eins achtzig, Ende dreißig, glänzende braune Haare, Pferdeschwanz, große aufmerksame Augen, ebenfalls braun, schlank, aber kräftig, verwaschene Jeans, weiße Hemdbluse, leuchtend grüne kurze Steppjacke. Sie gefiel mir, trotz ihres müden, etwas bitteren Zugs um Mund und Augen.
Was sieht sie wohl bei mir?
Ich dachte an mein Bild im Spiegel heute Morgen.
Aber ihr professionell beobachtender Blick wurde freundlicher, das Bittere machte einem koketten Lächeln Platz.
War wohl nicht mehr so schlimm.
»Nadija Hammerschmitt.« Sie kam mir entgegen, wir reichten uns die Hände. Fester, trockener Händedruck. »Sie müssen Hauptkommissar Moderski sein. Ich habe gesehen, dass Sie schon da waren.« Sie deutete auf meinen Schreibtisch in der Ecke.
»Ja, Moderski. Angenehm.«
Bisschen steif.
»Sie können Nadija sagen, wir sind ja jetzt Kollegen.«
Sie wirkte etwas zu ungestüm fröhlich für ihr Alter, ein bisschen aufgedreht, aber nett.
»Ja, gern. Ich heiße Carl.« Ich reichte ihr noch mal die Hand, sie hielt sie eine Sekunde zu lange.
Sie sucht einen Freund, vielleicht einen Verbündeten.
Merkte ich mir.
»Du warst an der Fundstelle?«
Das Du klang noch ungewohnt. Ich berichtete ihr, was ich mitgekriegt hatte.
»Ja, Gerl macht gern auf wichtig«, sagte sie.
»Warum warst du nicht da?«
»Nicht mein Ding. Ich mach hier Innendienst. Ich kann ja die Berichte lesen.« Da war wieder der müde Ausdruck, aber nur kurz, dann lächelte sie wieder. »Um zwölf ist Dienstbesprechung, wollen wir danach zusammen was essen?«
»Okay, ich will noch etwas recherchieren.« Ich blickte zu meinem Laptop.
»Klar.«
»Was machst du gerade?«
»Ich tippe einen Bericht, häusliche Gewalt, wir haben die Frau in ein Frauenhaus gebracht.«
»Wieso machst du das? Du bist doch Hauptkommissarin?«
»Wir haben keine Sekretärin.« Sie wandte sich zu ihrem Platz. »Und einer muss es ja machen.«
Ach, so ist das.
Ich startete meinen Laptop und rief eine Karte der Gegend auf. Der umzäunte Bereich war als »Staufenbergkaserne« ausgewiesen.
Ich fand mehr heraus: Staufenbergkaserne Friederichsburg. In den 1950er Jahren gegründet, Infanterieausbildung, seit den Sechzigern Fallschirmjäger, in den Neunzigern Eliteausbildungszentrum, aufgegeben, Planungen zur Industrieansiedlung, seit 2006 verpachtet an »PMC security, logistic and trainee«.
PMC gleich »Private Military Contractors«? Söldner?
»Carl, kommst du mit? Die Dienstbesprechung fängt gleich an.«
»Sekunde, bin sofort da.« Laptop – aus.
Bei der Dienstbesprechung waren fünfzehn Leute anwesend: der Dienststellenleiter Winfried Großhans, vom K11 Gerl, Oppermann, Nadija und ich, Kriminaltechnik, Drogen, Sitte, Wirtschaft, Verwaltung, je ein bis zwei Vertreter. Es gab nicht viel zu berichten, alles Routine. Gerl nahm viel Zeit in Anspruch für wenig Neues. Er gehe davon aus, dass es sich um einen Obdachlosen handelte, der im Suff erfroren war, er warte auf die Bestätigung aus der Gerichtsmedizin und die Berichte von Erkennungsdienst und Spurensicherung. Ich hielt den Mund, war ja mein erster Tag. Großhans bat mich, mich selbst vorzustellen.
»Mein Name ist Carl Christopher Moderski, Jahrgang ’72, Hauptkommissar. Ich war eine Zeit lang außer Gefecht und freue mich jetzt auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Danke.«
»Das war knackig.«
Zwischen Nadija und mir standen zwei Portionen Bandnudeln mit Schinkensoße und Salat.
»Der Salat?«
»Deine Vorstellung.«
»Es war alles Wichtige. Wer mehr wissen will, kann ja fragen.«
Sie schwieg und aß.
Oh, war ich zu schroff?
Aber sie war nicht feige. »Da gibt es schon ein paar Fragen.«
Ich ließ die Gabel sinken und sah sie an.
»Was hast du vorher gemacht? Warum warst du außer Gefecht? Bist du allein hier? Hast du Kinder? Gehst du gern einen trinken? Welchen Sport machst du? Tausend Fragen.«
Ich sah ihr tief in die Augen. Ihr Blick flackerte leicht, aber sie hielt stand. War sie es wert, konnte ich ihr trauen, oder war sie nur neugierig?
Die Stille breitete sich aus, sie würde das Vertrauen zerfressen, wenn ich zu lange wartete.
Ihr Händedruck, sie sucht einen Freund. Du verlierst doch nichts.
»Ich war bei einer Sonderkommission vom LKA Nordrhein-Westfalen. Also eigentlich habe ich mal beim mittleren Dienst angefangen, aber ich habe mich hochgearbeitet, ist ’ne lange Geschichte. Es ging um organisiertes Verbrechen, Drogen, Mord, Menschenhandel.« Ob sie merkte, wie brüchig meine Stimme war? Ich schob mir ein paar Nudeln rein und sprach mit vollem Mund weiter: »Alles, was du dir vorstellen kannst. Erst hatte es ganz banal angefangen. ›Nur ein Kontakt‹, hatten sie gesagt. Aber dann war ich drin und kam immer tiefer rein. Da gab es kein Zurück mehr. Das hat fast drei Jahre gedauert. Harte Zeit. Und dann ging irgendwas schief. Verrat, Unvorsichtigkeit, Pech? Ich weiß nicht. Sie haben mich enttarnt und gejagt. Sie hatten meine Kinder. Ich habe gekämpft, ich habe wirklich gekämpft, aber ich wäre beinahe draufgegangen und meine Kinder auch.«
Für einen Moment aßen wir beide schweigend weiter.
»Ich trinke ganz gern mal einen, nur nicht unbedingt mit den Kollegen.«
»Entschuldige, ich bin immer so ein Kamel …«
Ich sah sie fragend an.
»… das das Gras runterfrisst.«
Ich versuchte ein Lächeln. »Nicht so schlimm. Aber erzähl es nicht rum.«
»Okay.«
Als wir die Tabletts wegräumten, sagte ich: »Wir können ja mal zusammen einen trinken gehen.«
»Obwohl ich eine Kollegin bin?«
»Ich mach eine Ausnahme.«
Sie lächelte und zuckte mit den Schultern.
Das war immerhin kein Nein.
Nach drei Tagen stapelten sich die Weinflaschen in meinem Hotelzimmer. Pünktlich Feierabend zu machen bringt nichts in so einer Unterkunft, weil das Leben keinen Spaß macht in so ’nem Loch. Fernsehen – kannste vergessen. Im Kino zwei Filme – schon gesehen. Die Kneipen in der Nähe – da machte das Unter-Leuten-Sein richtig einsam. Ein Buch – nach fünf Seiten wurde ich von der Ruhe ruhelos. Blieb nur noch die gute Flasche Roter von der Tanke.
Nichts war, wie es sein sollte.
Mein Leben war ein Müllhaufen, und nur ich konnte das ändern.
Im Job waren die Berichte zu dem Fall des Toten im Wald wenig aufschlussreich. Der Erkennungsdienst konnte den Toten keinem Vermissten zuordnen, denn Daten zu ihm waren nicht gespeichert. Durch den Schnee fand die Kriminaltechnik keine verwertbaren Spuren am Fundort. Auf den Flaschen und Dosen befanden sich lediglich Fingerabdrücke des Toten, Kleidung, persönliche Gegenstände ebenfalls ohne Auffälligkeiten. Die Gerichtsmedizin urteilte: Tod durch Erfrieren, zwei Komma acht Promille Alkohol, letzte Mahlzeit Hundefutter.
Gerl wollte den Fall möglichst schnell abschließen und wartete nur noch auf den Gebissabgleich des Erkennungsdienstes.
Die Aktenlage war sauber – zu sauber. Ich hatte das Gefühl, dass es nicht war, wie es sein sollte, und wir machen nichts anderes als warten.
Wenn man etwas ändern möchte, ist es am besten, gleich damit anzufangen. Es war kurz nach neunzehn Uhr. Die Flasche Rotwein stand geöffnet auf dem Nachttisch. Ich nahm einen kleinen Schluck zum Probieren. Er war okay, ein trockener Spanier, Tempranillo, der herbe, tanninhaltige Geschmack rann über meine Zunge, die Kehle hinunter, und erfrischte und beschwerte zugleich. Ich drückte den Korken in die Flasche. Das war mein letzter Schluck für heute.
Es war dunkel draußen, ein bis zwei Grad plus, Schneeregen, den der Wind mir ins Gesicht blies, ein Scheißwetter! Um die Zeit hatten nur noch die Supermärkte geöffnet. Zu dem einen war es eine Viertelstunde zu Fuß. Bei dem Wetter war kein Mensch auf der Straße. Nur das Licht der Laternen fiel gequält trübe auf das nasse Pflaster und durchbrach die Dunkelheit ein wenig.
Der Supermarkt leuchtete schon von Weitem, als sei er ein gelandetes Ufo.
In den von Neonlicht erbarmungslos ausgeleuchteten Gängen schlichen die letzten Verdammten, wie die Schatten einer vergangenen Zivilisation, Zielen entgegen, die ihrer galaktischen Irrfahrt einen Sinn geben könnten. Diese manifestierten sich dann in Form einer Dose Bohnen, einer Folie mit Fleisch von glücklichen Schweinen und einer Flasche Wodka.
Ich suchte mir Turnschuhe, Trainingshose, Sweatshirt und eine leichte Regenjacke aus, probierte alles und behielt die Sachen gleich an. Jeans, Hemd, Pullover und Winterjacke stopfte ich in einen Rucksack, die Schuhe dazu. An der Kasse legte ich nur die Etiketten auf das Band.
Dann lief ich los.
Der Rhythmus meiner Schritte und meines Atems gaben mir Sicherheit. Die kalte Luft schmerzte in der Lunge, der Schneeregen brannte auf der Haut. Es war scheußlich und wunderbar zugleich.
Ohne auf meinen Weg zu achten, war ich durch die Nacht gelaufen, möglichst durch beleuchtete Straßen, weil noch immer Schnee- und Eisreste die Wege rutschig machten. Eine Dreiviertelstunde später wusste ich nicht mehr, wo ich war. Ich musste am Ende der Stadt sein, hier erhellte kein Licht die Häuser, die Laternen funzelten trüb und spärlich. Hundert Meter weiter war ein Hauseingang beleuchtet, und aus einer breiten Fensterfront schien aus dem ersten Stock Licht auf die Straße.
Bis dahin, dort kehre ich um.
Mein Atem ging schwer. Ich wartete, bis er sich etwas beruhigte. Aus den hellen Fenstern drangen vertraute Geräusche herunter, Kampfsporttraining. Kommando und Folgen. »Dynamic Self-Defense Friederichsburg e.V.« stand auf einem Schild neben der Tür.
Der Bau musste aus den Anfängen der Turnbewegung stammen. Das Untergeschoss war aus Sandstein und mit der Rückseite direkt an den Berg gebaut. Ich drückte die schwere Holztür auf, bei der die Farbe abblätterte. Rechts und links des Flurs waren Umkleiden und Waschräume, weiter hinten führte eine Holzstiege in das erste Obergeschoss. Trübes Licht und der unverkennbare Geruch aller Kampfstätten der Welt begleitete mich: Schweiß, Schmutz, Reinigungsmittel, muffiges Gemäuer, Leder, Holz und etwas, das an Blut erinnerte.
Sofort war wieder alles da, das Training jeden Tag nach den Hausaufgaben. Mein erster Kampf, Junioren U20, »Vale Tudo«, Faustkampf, fast ohne Regeln. Ich war noch ein Junge, kurz vor dem Abitur, mein Gegner sah fünf Jahre älter aus und hatte ein Mördergesicht, er war ein portugiesischer Straßenschläger.
Schon nach drei Treffern blutete meine Nase. Nach einer Minute war mein linkes Auge halb zugeschwollen, und ich sah seine Rechte nicht mehr kommen. Ich hatte die bessere Technik, tausendmal trainiert, meine Aktionen kamen automatisch: Angriff, Abwehr, Schmerz, Gegenangriff. Mein Gegner war erfahrener, brutaler und wilder. Als ich die Bretter auf mich zukommen sah, war ich froh, dass es vorbei war. Verlieren kann süß sein.
Das Obergeschoss war ein mit roten Ziegeln vermauertes Fachwerk. Im Übungsraum waren die Wände verkleidet, Fangnetze waren vor den Fenstern angebracht worden. Etwa zwanzig junge Frauen trainierten in weißen Judoanzügen. Nadija Hammerschmitt stand mit dem Rücken zu mir, sie trug einen schwarzen Gürtel und gab die Kommandos. Nach kurzer Zeit hatte sie mich bemerkt. Sie deutete auf eine kleine Tribüne aus drei Bänken. »Wartest du? Ich bin gleich fertig.«
Da saßen zwei etwa vierzehnjährige Mädchen und daddelten an ihren Handys. In der obersten Reihe ganz hinten in der Ecke spielte ein Junge mit Autos. Ich beobachtete Nadija. Wenn sie eine Übung vormachte, flossen ihre Bewegungen in vollkommener Harmonie. Ich spürte bei ihr eine Kraft, die außergewöhnlich war.
Das Training war beendet, Nadija kam herüber. »Was machst du hier?«
»Ist Zufall, ich hab mich verlaufen.«
Sie beäugte meinen Joggingaufzug. »Du bist ja ganz nass.«
»Nur die Hose, die Schuhe und die Jacke sind dicht.«
»Ich kann dich nach Hause bringen.«
In dem Moment zog der Junge, der mit den Autos gespielt hatte, an ihrem Anzug. »Mama, ich will heim.«
»Klar, Schatz, wir gehen sofort, ich hole nur eben meine Sachen.« Zu mir sagte sie: »Das ist David, mein Sohn.«
David war etwa zehn Jahre alt, sein Körper wirkte ziemlich zart, sein Kopf dafür relativ groß. Er starrte auf seine Autos, die er in einem kleinen Korb trug.
»Hallo David, du hast ja einen Jaguar. Ist das ein F-Type?« Ich wollte nach dem Auto greifen, aber David riss den Korb weg.
»Man braucht ein bisschen Geduld mit ihm«, sagte Nadija entschuldigend.
Wo waren die Kraft und die innere Harmonie geblieben, die sie gerade noch ausgestrahlt hatte?
Nadija fuhr einen Golf Kombi. Der Kofferraum war voll mit Sportzeug, Spielsachen und einem leeren Kasten Mineralwasser.
Im Wagen fragte sie, ob sie David erst nach Hause bringen könne. Und kurz darauf saß ich in ihrer Küche, trank Kräutertee und beobachtete die beiden bei ihrem Abendritual. David schaute immer wieder verstohlen zu mir, bis er endlich fragte: »Welches Auto hast du?«
Ich sagte ihm, ich hätte zurzeit kein Auto. Das schien ihn zu verwirren.
»Warum nicht?«
»Ich kann mich nicht entscheiden, welches ich mir kaufen soll, und wenn es nötig ist, kriege ich ja einen Dienstwagen.«
»Hattest du schon mal ein Auto?«
Nadija wehrte ab. »David, lass doch, du immer mit deinen Autos.«
»Nein, ist schon gut. Ich mag Autos auch. Mein erster Wagen war ein VW-Bus, ein T2.«
David staunte. »Ein Oldtimer!«
»Als ich ihn hatte, war er nur alt, aber noch kein Oldtimer.«
Daran hatte er erst einmal zu knacken, was Nadija amüsierte. Sie war hübsch. Wenn sie lächelte, hatte sie süße Grübchen auf den Wangen und sah Jahre jünger aus.
»Bist du schon so alt?«
Er hatte es kapiert. Ich nickte und zwinkerte ihm zu.
»Wie viele Autos hattest du schon?«
»Zähl mal mit, einen T2, einen Golf …«
»Was für einen?«
»Einen Golf 1 GTI mit hundertzehn PS.«
»Der neue Golf 7 hat zweizehntausend.«
Nadijas Lächeln verschwand. Davids Begeisterung verebbte in Schweigen.
Ich tat so, als sei alles ganz normal. »Mein drittes Auto war ein Triumph Spitfire, schönes Auto, ist aber immer kaputtgegangen. Das war schlimm, weil ich nicht genug Geld hatte, um ihn reparieren zu lassen. Und dann hatte ich noch einen Passat Kombi, eine Mercedes S-Klasse, eine G-Klasse, einen SLK und einen GLK.«
»Ich mag Porsche lieber«, tönte David.
»Und was meinst du, was soll ich mir für ein Auto kaufen?«
»Lamborghini Gallardo.«
»He, ich bin Polizist, weißt du, was der kostet?«
Ich Idiot.
David fiel in sich zusammen und schüttelte nur den Kopf.
»Es ist spät«, sagte Nadija. »Komm, ich bring dich ins Bett.«
Er rutschte wortlos von seinem Stuhl.
»David, der hat einen zu kleinen Kofferraum. Denk dir einen neuen aus, mit mehr Kofferraum, aber schnell muss er sein.«
Ich hörte sie im Bad – Zähne putzen – und dann in seinem Zimmer. Plötzlich kam David noch mal in die Küche gelaufen. Er legte ein Spielzeugauto vor mir auf den Tisch und verschwand wieder.
Es war der Jaguar F-Type Coupé aus seinem Körbchen.
Es war still in der Wohnung. Irgendwo tickte eine Uhr. Aus der Nachbarwohnung murmelte ein Fernseher. Ich hörte Nadija leise sprechen, eine Gutenachtgeschichte. Dann stand sie in der Küchentür. Sie hatte sich etwas frisch gemacht und trug jetzt eine Jeans und ein altes Sweatshirt. Es sah umwerfend lässig aus, als sei es ihr völlig egal, wie sie auf mich wirkte.
»Schläft er?«
»Noch nicht.«
Ich ging auf sie zu.
»Es ist nicht leicht mit ihm.«
»Warum, er ist doch nett.«
»Er mag dich.« Sie deutete auf den Jaguar. »Ist gerade sein Liebstes.«
»Was ist mit ihm?«
Nadija zuckte mit den Schultern. »Er ist nicht dumm, er ist irgendwie verzögert, alles ist langsamer bei ihm, und manche Sachen kriegt er einfach nicht hin. Das mit den Zahlen zum Beispiel. Er ist elf und in der zweiten Klasse der Förderschule, die anderen in seinem Alter sind in der fünften oder sechsten.«
Sie schwieg. Ich sah, wie sie mit sich kämpfte, wie sie litt. Dann sagte sie ganz leise: »Nimmst du mich einen Moment in den Arm?«
Ich stand ganz dicht vor ihr. »Nadija, ich bin nicht der, den du suchst. Aber ich hätte auch gern jemanden, der mich hält.«
Sie lächelte ein schüchternes, bittersüßes Lächeln. »So was tut immer weh.«
»Liebe und Schmerz sind Geschwister.«
»Du kannst zum Frühstück bleiben?«
Ich nahm sie in den Arm und antwortete mit einem Kuss. Ihre Bedenken schmolzen wie Schokolade in der Sonne. »Wenn du Nutella hast.«
Nadija lachte. Ihre Verlegenheit war fort. Sie boxte mich an die Schulter. »Mann – du Blöder!«
David war um Viertel nach sieben vom Schulbus abgeholt worden. Nadija brachte zwei Becher Kaffee mit, als sie mich weckte. Natürlich wollte sie mehr von mir wissen. Welche Frau will das nicht von dem Mann, der zum Frühstück bleibt?
So erfuhr sie von meiner elfjährigen Tochter Kai Christin und meinem zwei Jahre jüngeren Sohn Carl Julian. Dass meine Frau Julia aus Stuttgart stammte und nach unserer Trennung wieder zu ihren Eltern gezogen war, was auch ein Grund für die Versetzung gewesen war, da ich so die Kinder öfter sehen konnte. Sie wollte wissen, wo ich Julia kennengelernt hatte. Julia hatte in Dortmund studiert und ihre Diplomarbeit über »Interkulturelle Spannungen und Eingliederung« geschrieben. Ich hatte ihr Projekt aus polizeilicher Sicht betreut. Wir gründeten Hals über Kopf eine Familie, unsere ersten Jahre waren entbehrungsreich, ungestüm und wild, aber wir genossen die Zeit mit unseren Kindern, und wir glaubten, unser Glück sei unverwundbar.
Nadija drückte meinen Arm und unterbrach mich mit einem zärtlichen Kuss auf die Wange. »Du liebst sie noch immer.«
Ich nickte.
»Deshalb sagst du: ›Liebe und Schmerz sind Geschwister.‹«
»Ja.« Meine Stimme klang belegt. »Das Leben ist nicht immer so, wie man es gern hätte.«
»Das musst du mir nicht sagen. Wenigstens weiß ich jetzt, dass es nicht an mir liegt.« Sie klang traurig.
»Oder an David?«, vermutete ich.
»Ja.«
»Wo ist eigentlich sein Vater?«
»Der hat sich aus dem Staub gemacht, als sich herausstellte, dass es mit David schwierig wird. So ein Leben wollte er nicht, mit ›immer so einem Scheißer am Bein‹.«
»Kein feiner Zug.«
»Der Typ war von Anfang an ein Fehler, einer von vielen. Die meisten Männer sind sowieso verheiratet. Oder bei ihnen ist Schluss, wenn sie David sehen.«
Wir hingen einen Moment unseren Gedanken nach, jeder für sich.
»Weißt du«, brach sie das Schweigen, »es ist nicht schön, nur die Trösterin zu sein, die doch nie eine Chance hat.«
»Hey, was war – war; was ist – ist; und was sein wird – weiß niemand. Dir gehört die Gegenwart!«