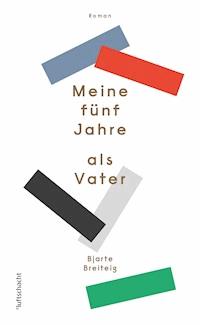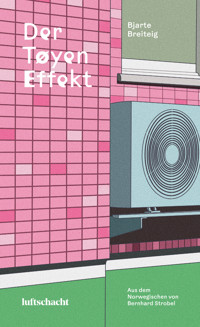
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Luftschacht Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Tøyen-Effekt handelt von einem Osloer Stadtteil, und von einer Familie: von Mona, Jostein und ihrem Sohn Kalle. Sie betreiben seit mehreren Jahren ein Café in einem Bezirk, der lange als der berüchtigtste im ganzen Land galt. Rund um das Café existiert ein Netzwerk aus Menschen vieler verschiedener Kulturen, die einander helfen und sich in ihrer Nachbarschaft engagieren. Aber ist Tøyen ein solcher Ort geworden, wie sie ihn sich einst vorgestellt haben? Was ist passiert mit der weltoffenen, umsichtigen Nachbarschaft, in der einmal Platz war für alle? Jostein hat seinen Feuereifer verloren. Seine Fähigkeiten zur Zusammenfindung und sein brennendes Engagement verwittern, und Mona kämpft mit einer heimlichen Sehnsucht, Tøyen und ihn zu verlassen. Als Jostein nicht wie geplant von einer Reise zurückkehrt, spitzt sich die Situation zu, und im Lichte von Josteins Abwesenheit folgt der Roman Mona durch eine intensive Zeit im Verlauf eines Tages und einer Nacht, in einem Spannungsfeld zwischen Aufruhr und Selbstbefragung. Der Tøyen-Effekt ist ein hochaktueller, tiefschürfender Gegenwartsroman über eine Einwohnerinitiative, über die Suche nach einem Halt für die Liebe außerhalb der geschlossenen Familiensphäre und über den Glauben und den Zweifel an der Kraft der Gemeinschaft. »Der Tøyen-Effekt ist ein Roman, der sich leicht empfehlen lässt, der von Lokalkolorit, kultureller Toleranz und einem beeindruckenden politisch-menschlichen Engagement getragen wird.« STAVANGER AFTENBLAD
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 437
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Tøyen-Effekt handelt von einem Osloer Stadtteil, und von einer Familie: von Mona, Jostein und ihrem Sohn Kalle. Sie betreiben seit mehreren Jahren ein Café in einem Bezirk, der lange als der berüchtigtste im ganzen Land galt. Rund um das Café existiert ein Netzwerk aus Menschen vieler verschiedener Kulturen, die einander helfen und sich in ihrer Nachbarschaft engagieren.
Aber ist Tøyen ein solcher Ort geworden, wie sie ihn sich einst vorgestellt haben? Was ist passiert mit der weltoffenen, umsichtigen Nachbarschaft, in der einmal Platz war für alle? Jostein hat seinen Feuereifer verloren.
Seine Fähigkeiten zur Gemeinschaftsbildung und sein brennendes Engagement verwittern, und Mona kämpft mit der heimlichen Sehnsucht, Tøyen und ihn zu verlassen. Als Jostein nicht wie geplant von einer Reise zurückkehrt, spitzt sich die Situation zu, und im Lichte von Josteins Abwesenheit folgt der Roman Mona durch eine intensive Zeit im Verlauf eines Tages und einer Nacht, in einem Spannungsfeld zwischen Aufruhr und Selbstbefragung.
Der Tøyen-Effekt ist ein hochaktueller, tiefschürfender Gegenwartsroman über eine Einwohnerinitiative, über die Suche nach einem Halt für die Liebe außerhalb der geschlossenen Familiensphäre und über den Glauben und den Zweifel an der Kraft der Gemeinschaft.
BJARTE BREITEIG, *1974 in Kristiansand/ Norwegen. Er studierte nach einem abgebrochenen Physikstudium Literatur in Trondheim, an der Skrivekunstakademiet und an der Universität von Bergen. Für seine Erzählungen wurden ihm zahlreiche nationale Preise verliehen. Der Tøyen-Effekt ist – neben seinen drei hochgelobten Erzählbänden und seinem ersten Roman Meine fünf Jahre als Vater (2016) – sein zweiter Roman im Luftschacht Verlag.
Bjarte Breiteig lebt in Oslo.
BERNHARD STROBEL, * 1982 in Wien, Studium der Germanistik und Skandinavistik. Lebt als Autor und Übersetzer aus dem Norwegischen in Neusiedl am See. Österreichischer Staatspreis für literarische Übersetzung 2021. Zuletzt erschienen: Der gute Mann Leidegger (Roman, Droschl 2023).
Bei Luftschacht erschienen (in Übersetzung von Bernhard Strobel):
Der Tøyen-Effekt (Roman, 2025)
Die kennen keine Trauer (Erzählungen, 2019)
Meine fünf Jahre als Vater (Roman, 2016)
Phantomschmerzen (Erzählungen, 2013)
Von nun an (Erzählungen, 2010)
Bjarte Breiteig
Der Tøyen-Effekt
Roman
Aus dem Norwegischen von Bernhard Strobel
Luftschacht Verlag
Titel der norwegischen Originalausgabe: Tøyeneffekten
Copyright: © Bjarte Breiteig
ISBN: 978-82-459-2395-5
First published by Forlaget Oktober AS, 2021
Published in agreement with Oslo Literary Agency.
This translation has been published with the financial support of NORLA.
© Luftschacht Verlag – Wien
luftschacht.com
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten.
1. Auflage März 2025
Umschlaggestaltung: Bruch—Idee&Form – studiobruch.com
Übersetzung: Bernhard Strobel
Lektorat: Teresa Profanter
Satz: Luftschacht
Gesetzt aus der Metric und der Noe.
Druck und Herstellung: Finidr s.r.o.
Papier: Holmen book cream 80 g/m2, Geltex glatt 115 g/m2, Surbalin glatt 115 g/m2
ISBN: 978-3-903422-52-0
ISBN E-Book: 978-3-903422-53-7
Anmerkungen zur Produktsicherheit (GPSR):
Luftschacht e.U., Jürgen Lagger, Malzgasse 12/2, 1020 Wien
Ein Ort gehört für immer dem, der ihn sich am stärksten angeeignet hat, sich am leidenschaftlichsten daran erinnert, ihn sich selbst entreißt, ihn formt, darstellt, ihn so radikal liebt, dass er ihn in seinem eigenen Bild neu erschafft.
– Joan Didion –
(aus: Das weiße Album, Ullstein 2022, Übersetzung: Antje Rávik Strubel)
INHALT
TØYEN (2018)
SECHS TAGE IN LISTA (2003)
BISLETT (2005–2007)
TØYEN (2009–2015)
SØRENGA (2018)
TØYEN (2018)
„woistpapa?“
Das war das Erste, was Kalle fragte, als ich nach Hause kam. Ich stellte die Einkaufstasche ab und warf einen Blick ins Wohnzimmer. Kalle lag auf dem Sofa, von der Playstation kam ein leises Rauschen, und ich sah, wie er Controller und Fernbedienung zwischen sich und der Sofalehne zu verstecken versuchte. Ich ließ mir Zeit mit dem Aufhängen des Mantels, bevor ich etwas sagte. Ich setzte mich auf den Hocker, die Stiefel lösten sich mit einem lauten Plopp, dann ging ich zu ihm hinein.
„Papa ist in Kopenhagen.“
„Wie lange kommt er noch bis nach Hause?“
„Wie lange dauert es noch, bis er nach Hause kommt.“
„Ja“, sagte er. „Wie lange dauert es noch?“
„Ein paar Stunden, denke ich.“
Hier drinnen wirkte es so viel dunkler, als es draußen gewirkt hatte. Es war Abend und doch nicht Abend, noch immer einige Stunden bis zur Schlafenszeit, die mit Inhalt gefüllt werden mussten. Und dann das Abendessen. Ich dachte an das dicke Stück Wurst und das Fertigpüree, das ich gekauft hatte. Nichts Grünes, aber immerhin war Jostein ja nicht da und konnte deshalb auch keinen Kommentar dazu abgeben. Kalle wand sich auf dem Sofa, eine Rastlosigkeit, die an Entzugserscheinungen erinnerte: Das war die Spannung des Spiels, die noch in ihm steckte, die fiktive Welt, die ihn rief. „Warum gehst du nicht ein bisschen raus?“
„Wohin?“
„Weiß nicht. Zu Abdi oder Jeton, so wie früher.“
„Nein, Mama.“
„Oder zu dem Mädchen, das bei uns war, wie hieß sie noch gleich, Zainab?“
„Zainab!“
Das sagte er, als wäre es eine Beleidigung, etwas völlig Undenkbares, dabei war es erst ein paar Wochen her, dass dieses reizende, uns unbekannte Mädchen an der Gegensprechanlage geklingelt hatte und zu uns heraufgekommen war. Sie hatten Der Stern von Afrika in seinem Zimmer gespielt, ohne zu streiten, nur ihre ruhigen Stimmen waren von drinnen zu hören gewesen, er hatte ihr die Regeln erklärt, und sie hatte gewürfelt und irgendwie überrascht „Ich hab eine Vier? Ich hab eine Zwei?“ gerufen.
Kalle hatte den Controller und die Fernbedienung bereits vergessen, die jetzt offen herumlagen. Er drückte sich seitlich mit dem Gesicht gegen das Sofapolster, klappte den Mund auf wie ein Fisch und hob einen Arm an. Mit einem lauten Seufzen vermittelte er mir das Gefühl, ich sei schuld an seiner grenzenlosen Langeweile. So war es immer: Ich empfand es als meine Verantwortung, ihn ständig zu beschäftigen, und das ärgerte mich.
„Ich weiß, dass du gezockt hast“, sagte ich.
Er wurde ganz steif, und sein Arm sackte neben seinem Körper herab.
„Entschuldigung.“
„Du sollst nicht jeden Tag spielen“, sagte ich. „Dass wir Grenzen setzen, tun wir nur dir zuliebe. Du brauchst den Kontakt zu anderen in der Nachbarschaft.“
„Ich weiß“, sagte er. „Entschuldigung.“
Es war unangenehm, ihn so gefügig zu erleben. Ich wartete auf das Argument, er sei ja den ganzen Tag in der Schule ge wesen, er sei draußen gewesen und habe mit anderen gespielt, und obwohl er nichts sagte, wirkte das Argument, und ich wuschelte ihm durch die Haare.
„Immerhin warst du ja den ganzen Tag in der Schule und bist dort viel draußen gewesen“, sagte ich. „Du darfst noch ein bisschen spielen.“
„Muss nicht sein“, sagte er.
„Bestraf dich nicht selber. Du darfst spielen.“
„Ich will aber nicht.“
„Na schön.“
Ich erhob mich mit einem kurzen Seufzen, das ich ihn bewusst hören ließ.
„Brav und fügsam.“ Das waren die Worte, die Vegard, der neue Lehrer, bei dem Elterngespräch neulich benutzt hatte. Er hielt das gewiss für etwas Positives, zumindest hatte er gelächelt, als er mit seinem pfaffenhaften Angesicht über seine Notizen gebeugt dagesessen war, diese Art Lächeln, das nur so lange andauert, solange es erwidert wird, und ich hatte gedacht, du kapierst einen Scheiß. Für meine Begriffe hätte er ebenso gut „untertänig“ oder „unterdrückt“ sagen können, denn wenn es eine Eigenschaft gab, die Kalle an einem Ort wie diesem nicht gebrauchen konnte, dann war das Gefügigkeit. Was er brauchte, war Eigenantrieb, Willenskraft. Auch Empathie natürlich und eine Fähigkeit zum Miteinander, aber ohne eine große Portion Selbstständigkeit konnte es schnell übel für ihn enden. Sein voriger Lehrer, Jeevat, hatte das erkannt. Jeevat hatte gemeint, wir sollten nicht zu streng sein, wenn Kalle mitunter etwas aufsässig sei, sondern ihn im Gegenteil dazu ermuntern. „Nicht immer ist richtig, Regeln von die andere zu befolgen.“ Aber Vegard hatte recht: Kalle war gefügig. Er schien nicht der Typ zu werden, der sich problemlos auf eigene Faust durchzuschlagen wusste, sondern war dabei, ein vorsichtiger, zurückgezogener Junge zu werden, der eher den eigenen Willen unterdrückt, als eine unschöne Atmosphäre um sich herum zu erzeugen.
Ich begann das Essen herzurichten. Mit einer Mischung aus Hunger und Ekel vor dem Geruch des rohen Fleisches schnitt ich die steife Wursthülle auf. Jostein und ich hatten vergangenen Abend zu viel getrunken, und ich hatte schlecht geschlafen nach dem unangenehmen Gespräch, das wir geführt hatten. Tagsüber in der Arbeit war es mir irgendwie gelungen, die Übelkeit und das Unbehagen zu verdrängen, indem ich mich auf die eingehenden E-Mails konzentrierte, die beantwortet werden mussten, und beim Mittagessen mit Stella Høek musste ich mir meinen ganzen Enthusiasmus abringen, um gemeinsam mit ihr die Werbestrategie für ihr Weinbuch fertig auszuarbeiten. Doch die ganze Zeit hatte ich das Gefühl, mich am Rande eines Abgrunds zu bewegen in dem Bewusstsein, was ich am Abend davor zu Jostein gesagt hatte. Jedes Mal ein kurzer Schock, wenn ich meine eigenen Worte im Ohr hatte: „Vielleicht wäre es am besten, wir würden getrennt wohnen.“ Das hatte ich gesagt, klar und kalt, während ich ihm direkt in die Augen sah. Ich hatte „vielleicht“ gesagt, weil es nicht als etwas Endgültiges gemeint war, nicht einmal als ein Vorschlag, es war bloß ein Gedanke, den ich laut ausgesprochen hatte, damit er den Ernst der Lage erkannte. Doch sowie es gesagt war, fühlte es sich so real an, kalte, klare Worte, als wäre es bereits entschieden: Wir würden getrennt wohnen, das Nachbarschaftscafé aufgeben, Tøyen hinter uns lassen. Jostein hatte sich auf dem Sofa nach vorn gebeugt und den Kopf in die Hände gelegt. Vor ihm auf dem Tisch standen sein Whiskyglas und die vielen leeren Bierflaschen. Er zeigte fast keinen Widerstand, stimmte quasi allem zu, was ich sagte. „Ja“, murmelte er. „Du hast recht. Ich verstehe. Es geht nicht mehr.“ Es war, als hätte er gewusst, was kommen würde, als hätte er es erwartet und wäre fast ein wenig erleichtert. Er nickte schweigend, als ich sagte: „Du kannst nicht schon wieder in eine Depression rutschen, Jostein.“ Ich war absichtlich streng zu ihm, hart. „Fast scheint es ja, als ob du das wolltest. Willst du depressiv werden?“ Er antwortete nicht. Ich glaubte, er würde im nächsten Moment aufstehen, doch stattdessen ließ er sich wie ein riesiger, schwerer Sack vom Sofa fallen und schlug dumpf mit der Stirn neben dem Tisch auf den Dielen auf. So blieb er liegen, bäuchlings, mit schlaffen Armen und dem Gesicht auf dem Boden. Still lag er da und atmete schwer. Vermutlich wollte er mir damit etwas demonstrieren, mir zeigen, wie schwer ihm alles geworden war, aber das Einzige, was er damit demonstrierte, war ja genau das, was ich ihm gerade vorgeworfen hatte: Er wollte depressiv sein. Ich sah die Ziehharmonikafalten auf seinem Hemdrücken, sah seinen Hosenboden, der ihm wie eine lose Hülle am Hintern hing, und wurde wütend: „Auf mit dir!“, fauchte ich ihn an. „Reiß dich zusammen! Lieg da nicht herum wie eine Made!“ Und schließlich rappelte er sich doch auf, setzte sich mühsam wieder zurück aufs Sofa und würgte einen großen Schluck Whisky hinunter, und ich spürte die Wut in mir aufsteigen, kalt und hart. Sein Kopf war jetzt noch tiefer herabgesunken, als müsse er gegen unmenschliche Schwerkräfte ankämpfen, und ich sagte: „Es liegt jetzt an dir. Wenn du dich dagegen entscheidest, dann muss es nicht wieder zu einer Depression kommen. Aber wenn du jetzt nicht aufstehst, wenn du einfach alles fallen lässt, das ertrage ich nicht länger. Dann bleibst du allein.“
Ich nahm den Topf mit dem kochenden Wasser von der Platte und leerte den Inhalt aus der Kartoffelpüreepackung hinein. Die kleinen Flocken sahen aus wie trockener Schnee oder Schuppen, und ich rührte einen Klecks Butter hinein und legte den Deckel auf den Topf. Ich nahm eines der halb durchgebratenen Wurststücke aus der Pfanne, und während ich darauf herumkaute, sah ich wie so oft hinüber zu den Wohnungen auf der gegenüberliegenden Hofseite – Räume, die aus der Dunkelheit herausleuchteten. Ich sah die Kinder der neu eingezogenen syrischen Familie in ein Handy vertieft am Küchentisch sitzen. Obwohl, syrisch: Ich nahm an, dass sie aus Syrien stammten, zumindest hatten sie eine hellere Hautfarbe und waren nicht so streng in Sachen Hidschab – die Töchter gingen ohne –, und auch Vorhänge hatten sie noch keine montiert. Inzwischen war das ein überteuertes Mietshaus mit hoher Fluktuation, in dem vorwiegend berufstätige Eltern mit Kleinkindern wohnten, die sich eine Zeit lang dort über Wasser hielten, während sie sich nach etwas Billigerem umsahen. Ich hatte beobachtet, wie sie frühmorgens zu den Betriebskantinen oder ihren Taxis aufbrachen oder wohin auch immer sie von den Leiharbeiterfirmen vermittelt worden waren. Ein hartes Leben musste das sein – und trotzdem waren sie finanziell weit bessergestellt als die Familien aus den Sozialwohnungen. Eines der syrischen Mädchen hatte mich entdeckt und winkte. War das Zainab, wohnte sie dort? Ja, bestimmt war sie das. Ein Lächeln blitzte in ihrem Gesicht auf, als ich zurückwinkte. Auf einmal interessierten sich auch alle anderen Kinder für mich, zeigten herüber und winkten, und ich stieß ein kurzes lachendes „Hei“ hervor. In der Tür hinter ihnen erschien ihre Mutter, wie um nachzusehen, was da los sei. Auch sie winkte, wenn auch eher verhalten. Wir wohnten nur zwanzig Meter voneinander entfernt, kannten einander aber nicht. Wäre alles wie früher gewesen, hätte Jostein längst dafür gesorgt, dass wir uns einander vorstellten. „Zufällig“ wäre er ihnen im Innenhof über den Weg gelaufen und hätte sich über die Mülltonnen hinweg, durch den Maschendrahtzaun, der unseren Außenbereich von ihrem trennte, mit ihnen unterhalten. Er hätte sie in der Nachbarschaft willkommen geheißen und ihnen vom Café erzählt. „Alle sind willkommen“, hätte er gesagt, „ihr müsst kommen, ich hoffe, wir sehen uns dort.“ Das war seine übliche Strategie.
Es fühlte sich unglaublich an, dass ich das alles gesagt hatte. Dass ich nicht nur unsere Beziehung und die kleine Familie, zu der wir geworden waren, so leicht aufs Spiel zu setzen bereit war, sondern unser ganzes Tøyen-Dasein. Ich hatte es gesagt, als ob ich das einfach hinter mir lassen könnte, als ob das Café und die Schule und das Miteinander, das wir zehn Jahre lang aufgebaut hatten, mich nichts angingen. Und nach allem, was ich wusste, schmerzte Jostein genau das am meisten: dass ich offenbar einfach so aussteigen konnte. Ja, vielleicht war es das, mehr als irgendetwas sonst, was in letzter Zeit so schwer auf ihm lastete: der alte Verdacht, dass mir „die Community“ eigentlich gar nicht so wichtig sei. Aber das ist sie, sie ist mir wichtig, verspürte ich jetzt den Drang zu sagen. Und dass ich es deshalb nicht ertragen könne, wenn er jetzt aufgebe. Denn wer wäre er dann noch?, dachte ich. Was bliebe ihm noch? Oh, das durfte ich nicht sagen. Wer wäre er noch, wenn er das aufgäbe, so, wie er alles andere davor aufgegeben hatte? Und ich dachte: Niemand, er wäre ein Niemand. Aber diesen Gedanken musste ich für mich behalten.
Heute Abend, sobald er zu Hause war und Kalle im Bett lag, würde ich mit ihm darüber reden. Ich würde darauf bestehen, heute nichts zu trinken, sondern ein ruhiges, kontrolliertes Gespräch zu führen. Oder doch, ein kleines, eiskaltes Bier könnten wir uns vielleicht genehmigen, aber mehr nicht, und dann würde ich ihm klarmachen, wie viel auch mir die Gemeinschaft bedeutete. Sein Familienleben so zu führen, dass es gleichzeitig einer größeren Sache dient, sei nicht selbstverständlich. Die meisten Menschen, würde ich sagen, lebten und arbeiteten nur für ihr eigenes Familienglück oder um Geld anzuhäufen, das sie später ihren Kindern vermachten, aber sie vermissten ein Mehr in ihrem Leben, und dieses Gefühl, dass ihnen etwas fehlte, würden sie bis ins hohe Alter mit sich herumtragen. Wir aber hätten dieses Mehr gefunden. Für uns bestehe es darin, ein Fest zum Nationalfeiertag im Schulhof zu organisieren, die Fußballmannschaft zu trainieren, andere Kinder zu uns nach Hause einzuladen, was wir nicht nur aus einem Pflichtgefühl heraus täten, aber es bedeutete eben auch, dass wir uns politisch engagierten. Der Entschluss, Kalle hier zur Schule zu schicken, anstatt, wie wir es hätten tun können – und wie es auch viele von uns erwartet hätten –, unsere finanziellen Mittel dazu zu verwenden, ihn in eine Bildungseinrichtung mit besseren Erfolgsaussichten zu geben, ja, allein der Umstand, hier zu wohnen, auch jetzt noch, da die Kleinkindzeit vorbei sei – das seien Entscheidungen, die sich konkret auf einen der brennendsten Gesellschaftskonflikte unserer Zeit auswirkten: die Migration. Wir machten einen Unterschied aus. Mit dem Alltag, so wie wir ihn lebten, beteiligten wir uns aktiv am Gesellschaftsumbruch.
Und hier, im Osloer Bezirk Tøyen, einer der damals berüchtigtsten Gegenden des Landes, war in den frühen 2010er-Jahren ein Nachbarschaftscafé eröffnet worden, betrieben von sogenannten Gutmenschen in einem wenig einladenden Geschäftslokal des ehemaligen Einkaufszentrums Tøyensenteret, dessen Läden größtenteils leer standen. Und rund um dieses Café war eine Community entstanden, die immer weitergewachsen war und sich bis in die umliegenden Straßen ausgebreitet hatte. Menschen jeden Alters und aus den unterschiedlichsten Kulturkreisen hatten begonnen, einander zu grüßen, miteinander zu reden, sich umeinander zu kümmern. Die Gemeinschaft hatte sich bis in die Hinterhöfe ausgebreitet, bis hinauf in die Wohnungen, in die hohen Blocks. Sie wuchs und wurde durch die Schule und die Kindergärten des Viertels gestärkt. Man spürte sie in den Gemüseläden, den Importshops, den Frisörsalons, den Kebab-Buden. Es gab eine Nachbarschaftswache. Ein Sportverein wurde gegründet. Ein Kinderchor. Pop-up-Fahrradwerkstätten im Freien wurden organisiert. Wo man einander zuvor fremd gewesen war an einem fremden Ort, hatte sich nun ein Netzwerk aus Nachbarinnen und Nachbarn gebildet, die sich gegenseitig unterstützten und sich in ihrer unmittelbaren Umgebung engagierten. Die Tøyen-Zugehörigkeit hatte einen völlig neuen Stolz entstehen lassen, und als die Gegend in den Jahren 2013 bis 2018 eine öffentliche Gebietsaufwertung erfuhr, stützte man sich dabei stark auf die bereits bestehende Community. So stark, würden manche sagen, dass es in allen Fugen krachte.
Die Gemeinschaft in Tøyen hatte landesweit für Aufmerksamkeit gesorgt, und daran hatte auch ich meinen Anteil. Noch mehr als Jostein hatte ich mich dafür eingesetzt, unsere Community und unser Leben hier möglichst sichtbar zu machen. Ich war es gewesen, mehr als irgendjemand sonst, die darin eine Möglichkeit gesehen hatte, wie wir uns bemerkbar machen konnten. Und warum hätten wir das nicht tun sollen? War die politische Wirkung nicht umso größer, je deutlicher wir von anderen gesehen wurden? Ich war es gewesen, die öffentlich in Erscheinung trat und sich – mit oder ohne Jostein, mit oder ohne die anderen aus der Gemeinschaft – für Zeitungsreportagen, Radiosendungen, Fernsehbeiträge zur Verfügung gestellt hatte. Ich hatte Kolumnen geschrieben: eine über die generellen sozialen Missstände in Oslo; eine über die Armutsfalle, verursacht durch die städtische Wohnungspolitik, die die hier Lebenden zum Ausziehen zwang, sobald sie über ein eigenes Einkommen verfügten; eine über die weißen Kinder in Tøyen, die jeden Morgen feierlich zur U-Bahn marschierten, und inwiefern die freie Schulwahl die schon bestehenden sozialen Unterschiede noch vergrößerte. Diese Kommunikationsarbeit hatte ich teils abends geleistet, teils während der Arbeit, wenn gerade niemand zusah, ich betrachtete sie als mein Geschenk an Tøyen. Ich befeuerte die sozialen Medien mit Bildern und kleinen „Herzensgeschichten“, Ausschnitten aus der Nachbarschaftsarbeit für das Café, vom Fußballtraining, von unserem Alltag in Tøyen, und einige dieser Postings hatten eine enorme Reichweite. Die Menschen dort draußen gierten nach Fotos von Frauen im Hidschab, die eine Kreissäge bedienten, oder von afrikanischen Burschen mit Schürze beim Tortenbacken. Beliebt waren auch eher private Fotos, wie etwa das von Kalle beim Blaubeerensuchen mit seinen norwegisch-somalischen Freunden, ein Alf-Prøysen-Motiv in neuem Kolorit. Ich postete es, wohl wissend, dass solche Dinge in einem bestimmten Teil der Gesellschaft definitiv nicht beliebt waren. Die schlichte Behauptung hinter all diesen Postings lautete: Integration muss kein Problem sein, sofern es nur mehr Leute wie uns hier in Tøyen gibt. Zuwanderung ist etwas, an dem wir wachsen können, wenn wir das wollen.
Natürlich fühlten sich davon auch viele provoziert. Es rief Widerstand hervor, Wut, Spott. Es gab Leute dort draußen, die sich zu akzeptieren weigerten, dass ein harmonisches multikulturelles Leben möglich war, obwohl sie es mit eigenen Augen sahen. Nachdem unsere Schulwahl in den Medien für eine gewisse Aufmerksamkeit gesorgt hatte – Kalle war der Einzige in seiner Schulstufe mit norwegischen Eltern –, bekamen wir zu hören, wir würden ihn einem sozialen Experiment aussetzen. Die Islamgegner sahen in Tøyen ein abschreckendes Beispiel für einen Ort, an dem das „Gift“ der Religion tief in die norwegische Gesellschaft eingedrungen sei. Wörter wie „Infiltration“ und „Gehirnwäsche“ wurden genannt – womit sie sich auf uns bezogen, auf Jostein und mich. Besonders schlimm waren die sogenannten „Realisten“, eine Gruppe rechter Journalistinnen und Journalisten, die von sich selbst behaupteten, die „harten Fakten“ zu vertreten, und von ihren Einfamilienhäusern im Westen der Stadt aus bissige Kommentare zum „Einwanderungsproblem“ schrieben. Ihnen zufolge machten wir die Sache nur schlimmer, denn je mehr solcher Menschen in unserem Land heimisch würden, desto mehr wüchse auch bei anderen das Bedürfnis hierherzukommen. Was wir taten, sei naiv, hoffnungslos romantisch und nicht zuletzt eine Verschwendung öffentlicher Mittel – denn natürlich war ihnen zu Ohren gekommen, wie hoch die Fördersumme war, die Jostein für das Café hatte auftreiben können. Und obwohl dieser Widerstand mitunter verletzend sein konnte, nicht nur für mich, die meist im Vordergrund agierte, sondern auch für Jostein (denn die Kommentare waren oftmals überraschend gemein), ließ uns das nur noch verbissener werden, lange Zeit jedenfalls. Alles in allem jedoch überwog die positive Aufmerksamkeit. Wir erhoben Tøyen zu einem Leitbild für das neue Norwegen, wie wir es gerne nannten, ein Norwegen, das sich aus vielen Kulturen zusammensetzte, aber trotzdem von Solidarität und Toleranz geprägt war. Und dieses sinnstiftende Gefühl – ja, eine Lebensfülle, eine Spannung, weil wir ein Teil davon waren – musste ich heute Abend Jostein gegenüber hervorheben, in genau diesen Worten, für die er gewiss empfänglich wäre. Und dann würde ich sagen, ihm allein hätten wir das alles zu verdanken. Das war eine Übertreibung, aber keine, die nicht einen wahren Kern enthielt. Er sei derjenige gewesen, der uns diesen Weg gezeigt habe, würde ich sagen. Er habe das Ganze erst ins Rollen gebracht. Ohne dich, würde ich sagen und sagte es mir auch jetzt leise vor, während ich die fertiggebratenen Wurststücke in der Pfanne herumschaufelte, ohne dich gäbe es kein Café und damit auch keine Gemeinschaft. Kalle wäre auf eine andere Schule gegangen. Tøyen wäre ein anderes Tøyen geworden.
Trotzdem ist alles anders gekommen, als wir es uns vorgestellt hatten. Tøyen ist nicht zu diesem Ort geworden, der allen Platz bot und an dem alle weltoffen und großherzig ihren Beitrag leisteten. Zumindest nicht nur zu so einem Ort. Heute ist Tøyen vor allem als „Trendviertel“ mit beliebten Bars, fotogenen Wohnungen (nackte Wände, rustikaler Touch) und teils teuren Restaurants bekannt (auch dort nackte Wände und rustikaler Touch). Obwohl das verarmte Tøyen nach wie vor existierte, und zwar in allerhöchstem Maß – denn das ließ sich nicht durch teure Restaurantfassaden aus der Welt schaffen –, schossen an jeder freien Stelle Neubauten in die Höhe, deren Wohnungen zu horrenden Preisen verkauft wurden. War „Tøyen“ in den Immobilienanzeigen früher konsequent ausgespart worden, wurde es nunmehr extra hervorgehoben: „Im Herzen von Tøyen.“ „Investitionsobjekt in Tøyen.“ „Einzigartige Gelegenheit im trendigen Tøyen.“ Aufgrund der steigenden Immobilienpreise waren im Laufe der Jahre viele derjenigen, die sich aktiv an der Café-Community beteiligt hatten, Menschen, die wir „unsere Leute“ nannten, gezwungen gewesen, mit ihren Familien wegzuziehen, weg aus jener nachbarschaftlichen Gemeinschaft, die durch ihre Mithilfe überhaupt erst entstanden war.
Aber war es nicht trotz alledem ein besseres Tøyen, als es das ohne uns gewesen wäre? Darauf musste ich mich fokussieren. Das musste ich Jostein begreiflich machen. Man brauchte nur an die frühen 2010er-Jahre zurückdenken, als der Name Tøyen noch einen düsteren, gefährlichen, anrüchigen Beiklang hatte: „der Einwandererbezirk“, „der vernachlässigte Bezirk“, „der Gangsterbezirk“, berüchtigt für seine vielen Kriminellen, seine Drogenabhängigen, seine Armut. In den Zeitungsreportagen und Fernsehberichten wurden dunkle Fußgängerunterführungen und Einsatzfahrzeuge gezeigt, Frauen mit Burka vor Moscheefassaden, Gestalten in Kapuzenpullis vor vollgesprayten Wänden und die ewigen Backsteinwohnblocks, die in einen düsteren Himmel emporragten. Und in dieses verdreckte, unsichere, mit Argwohn beäugte Tøyen waren wir gekommen, um unser Kind großzuziehen. Von einem Tag auf den anderen spielte sich unser tägliches Leben in Straßen ab, in denen sich Jugendgangs herumtrieben, in denen die Leute mehr mit sich selbst redeten als mit anderen und nicht selten Spritzen unter unseren Schuhsohlen knirschten, wenn wir vom Gehweg hinunterstiegen. Kehrten wir von einer Kinderwagenausfahrt in die idyllische Holzhaussiedlung in Kampen – die wir mit der Zeit leicht abschätzig „Kardemomme“ nannten, nach der Stadt in dem Kinderbuch – nach Hause zurück, spürten wir, wie wir mit dem Überqueren der Kjølberggata zugleich die Grenze in eine andere Wirklichkeit überschritten, so wie in Horrorfilmen, wenn man sich plötzlich in der Schattenwelt befindet. Plastiktüten wehten über die Straße, eine Frau mit Halbglatze stand schreiend an einer Mauer, ein Schäferhund versuchte, seinen Besitzer wachzulecken, der mit herunterhängender Hose und einer aus dem Leistenbereich ragenden Spritze auf dem Boden lag.
Und es gefiel uns. Nicht die soziale Not an sich, sondern die Tatsache, dass wir uns, da es sie nun einmal gab, nicht vor ihr abschirmten. Abends saßen wir mit einem Bier, einem Glas Wein oder einem Whisky in der heruntergekommenen Wohnung, die jetzt unsere war, und lauschten nicht ohne eine gewisse Faszination den Schlägereien, den Sirenen, den einsamen Rufen einer psychotischen Seele. Wir hatten uns aus dem sicheren Dasein losgerissen, uns vom Materialismus befreit, wir beteiligten uns nicht mehr am Rat Race und konnten uns jetzt berechtigterweise abschätzig darüber äußern. Wir waren so sehr wir selbst. Unsere kleine, kostbare Einheit, wir drei, im Fremdgebiet. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite, im Außenbereich des Kindergartens, in dem Kalle, nachdem wir unseren Umzug bekanntgegeben hatten, auf Anhieb einen Platz bekommen hatte, ließ eine Bande Jugendlicher im Abenddunkel ihre Waffen aufblitzen. Wir registrierten es, ohne eine große Sache daraus zu machen. Vielleicht riefen wir die Polizei, vielleicht auch nicht, aber falls wir es taten, dann ohne jede Aufregung in der Stimme, eher mit einer Art Nachsicht, „Sie sind wieder da, ja, und sie haben Waffen dabei“, woraufhin wir die Waffen beschrieben, die wir gesehen hatten: Machete, so und so lang, Baseballschläger, Pistole, Fahrradkette. Mehrmals gab es Schießereien in den angrenzenden Straßen, einmal sogar mit einer automatischen Waffe direkt vor unserer Wohnung, und das riss uns heraus aus unserer aufgesetzten Unempfindlichkeit. Wir warfen uns auf den Boden, zwischen uns Kalle, den wir gerade ins Bett bringen wollten, meine zitternde Hand auf seinem Windelpopo. Die Schüsse waren in der Mauer auf der anderen Seite eingeschlagen, keine Verletzten, wie wir von dem Polizisten erfuhren, der anschließend von Tür zu Tür ging, um Zeugenaussagen aufzunehmen.
*
Kalle kam in die Küche herein.
„Kann ich dir bei irgendwas helfen, Mama?“
„Wie lieb, dass du fragst. Du könntest den Tisch decken“, schlug ich vor.
„Oh“, sagte er. „Nur das nicht.“
„Sonst ist nichts mehr zu tun. Das Essen ist fertig.“
„Aber ich könnte zum Beispiel Käse schrubben.“
„Es gibt Wurst mit Kartoffelpüree“, sagte ich. „Wir brauchen keinen Käse.“
„Aber ich will Käse schrubben.“
Ich stellte es mir vor: weiche Streifen von geriebenem Käse auf den Wurststücken, in das Kartoffelpüree eingerührt und geschmolzen. Ich hatte einen großen Block Fyldig Norvegia gekauft, ganz frisch, und ich spürte ein plötzliches Hungergefühl. Ich holte den Käse aus dem Kühlschrank, legte ihn vor Kalle ab, und während ich die Reibe suchte, die Jostein aus irgendeinem Grund immer ganz hinten in dem Schrank für die Töpfe verstaute, hatte Kalle das größte Messer von der Magnethalterung genommen und fuchtelte damit herum, während er sich auf die Bank setzte, und ich hatte Josteins Stimme im Ohr: „Ui, vorsichtig!“ Kalle fummelte mit der Spitze an den Plastiknähten der Käsepackung herum, ohne zu wissen, wo er sie auftrennen musste, aber ich sagte nichts, weil ich fand, es würde ihm guttun, solche Dinge selbst herauszufinden. Er stach mit der Spitze seitlich in die Verpackung und fing an, kleine Plastikstückchen abzuzupfen. Da hätte Jostein sich schon zu ihm gewandt, was eigentlich eine Kritik an mir gewesen wäre: „Sieh mal, du brauchst kein Messer“, und ihm gezeigt, wie leicht sich die Verpackung an der markierten Ecke öffnen ließ.
Während Kalle den Käse rieb, nahm ich mir einen Moment Zeit und ging mit dem Handy hinaus auf den Balkon. Eine Nachricht von Stella war gekommen: „Gespannt und nervös wegen morgen. Können wir uns heute Abend treffen?“ Ich seufzte. Es fühlte sich an, als hätten wir uns gerade erst verabschiedet. Aber solche Dinge hatten nun einmal Vorrang, also antwortete ich sofort: „Klar! Aber ich bin momentan noch mit Kalle allein, kannst du herkommen?“ Das schrieb ich, ohne mir Gedanken darüber zu machen, wie es hier aussah, was sie von unserem abgenudelten Lebensstil halten würde, wie altmodisch es bei uns war – bislang war immer nur ich bei ihr zu Hause gewesen, nie sie bei mir. Sie antwortete sofort. „Du bist die beste Lektorin der Welt (Herzchen)! Ich komme so um sieben mit einer Flasche, aber versprich mir, dass du mich nicht mehr als ein Glas trinken lässt (Smiley, Champagnerflasche), muss morgen fit sein!“ Ich spürte, wie schnell mein Vorsatz, den heutigen Abend für Jostein zu reservieren, von diesem Lob verdrängt wurde: Ich war die beste Lektorin der Welt – klar würde ich alles stehen und liegen lassen, wenn meine Autorin mich brauchte. Und die arme Stella, sie war so durch den Wind, jetzt, da der Erscheinungstermin endlich näher rückte. Wir hatten ihr einen Auftritt in der morgigen Ausgabe von Guten Morgen, Norwegen verschafft, und ich hatte ihr versprochen, sie zur Sendung zu begleiten. Stella brauchte viel Aufmerksamkeit, gab von ihrer Energie aber auch etwas zurück, und obwohl ich mir während des Studiums nicht ausgemalt hatte, einmal beruflich mit dieser Art Bücher zu tun zu haben – ich hatte meine Masterarbeit über Cora Sandel geschrieben –, arbeitete ich gern mit ihr zusammen und war stolz, dass ich es war, die sie entdeckt hatte, als sie noch mit einem von Josteins alten Freunden verheiratet gewesen war. Ja, es war ein langwieriger Prozess gewesen, aber jetzt, da wir endlich am Ziel waren, hatte auch ich das Gefühl, etwas geschaffen zu haben. Denn es war weitestgehend mein Verdienst, dass aus dem Buch das geworden ist, was es jetzt war, nämlich nicht bloß ein x-beliebiges Weinbuch, sondern ein persönlicher Bericht über Stellas Werdegang zur Weinexpertin. Neugierig, aber ziemlich blauäugig, hatte sie sich Schritt für Schritt ein tiefes Verständnis über das Thema Wein angeeignet und vermittelte diesen Lernprozess mit viel Verve und Humor. Intern nannten wir es ein Drei-in-eins-Buch, weil es neben der Einführung in die Thematik auch eine mitreißende und stellenweise ergreifende Erzählung über die Trennung enthielt, die sie neben dem Selbststudium durchlebt hatte, und zu guter Letzt war es auch noch ein Reisebericht: Ich hatte den Verlag dazu überreden können, die Kosten für eine Exkursion zu übernehmen, zuerst in die klassischen französischen und italienischen Weingegenden, wo sie einige ihrer Lieblingsproduzenten besuchte, und von dort weiter in die „Wein-Avantgarde“, wie sie es im letzten Teil des Buches nannte: alternative, idealistische Winzer in Nordfrankreich, Belgien und den Niederlanden, die einen Wein erzeugten, der, so nannte es Stella – und aus ihrem Mund war das eine Ehrenbezeichnung –, „total gaga“ war. Und genau auf diese Art schrieb sie auch: so ungezwungen und lebendig, dass selbst jemand wie ich, die eigentlich ein kaltes Bier bevorzugte, nicht dagegen ankam, sich für dieses Thema zu interessieren. Eine so kostenintensive Produktion hatten wir nur deshalb gewagt, weil wir wussten, dass wir mit Stella ein großes Talent im Stall hatten, und im Verlag pushten wir uns schon gegenseitig mit Ideen für zukünftige Høek-Projekte.
Ich schob das Handy in die Gesäßtasche und schaute hinaus in die Dunkelheit zwischen den Gebäuden, die mir so vertraut waren. Es überraschte mich jedes Jahr, wie offen hier alles wurde, wenn das Laub abgefallen war, und der Wind hatte in dieser Nacht fast alle Blätter heruntergeweht. Es war, als rückten die Wohnungen dann näher zusammen. Mehrere Kinder waren unten im Hof und spielten mit Taschenlampen. Ich sah sie als graue Gestalten, sah die über den Boden und an den Ziegelsteinwänden hinaufschwirrenden Lichtflecken, durch die ab und zu die nackten Äste der Bäume hindurchhuschten. Ihr aufgeregtes Rufen ließ mich an die Vorfreude denken, die ich als Kind immer verspürt hatte, wenn ich an den langen Herbstabenden die anderen draußen spielen hörte und mir die Schuhe gar nicht schnell genug anziehen konnte. Das war eine Zeit ohne Handys und Bildschirme, als das Leben der Kinder sich noch hauptsächlich draußen abgespielt hatte, und ich weiß noch, wie frei ich mich unter den anderen Mädchen und Jungen beim Herumlaufen zwischen den Kiefernstämmen und Felsen gefühlt hatte, die kalte Luft, alles so offen. Das waren die Achtziger in Vennesla, eine ganz andere Welt als hier. Empfanden die Kinder dort unten noch etwas Ähnliches? Ich warf einen Blick zu Kalle hinein und sagte gedämpft, aber doch irgendwie aufgeregt:
„Komm mal kurz raus!“
Er gehorchte und trat auf Socken heraus auf die kalten Terrassendielen. Zuerst sagte ich nichts, sondern legte nur den Finger an die Lippen, damit er die Kinder spielen hörte und unabhängig von mir eine Abenteuerlust entwickelte. Aber er starrte nur steif in den Hof hinunter.
„Soll ich die Taschenlampe holen?“, schlug ich kurz darauf vor.
„Aber Mama, ich kenn die ja nicht.“
„Das sind doch unsere Nachbarn. Ihr werdet euch schnell kennenlernen.“
Er nickte und blieb stehen, als müsse er es sich noch überlegen, aber ich wusste genau, dass das nur Theater war, er hatte seine Entscheidung bereits getroffen. Und vielleicht wusste er ja auch, dass ich ihn durchschaute, denn als er wieder hineinschlurfte, fand er es nicht einmal der Mühe wert, mir irgendeine Ausrede aufzutischen. Durch das Fenster sah ich, wie er seinen Platz hinter der Reibe wieder einnahm und weiterschrubbte, sah die blasse Haut in seinem Nacken, der freilag, wenn er sich nach vorn beugte, er kam nur langsam voran, der Käse war zu groß in seiner Hand, er hatte erst einen kleinen Haufen geschafft. Er hatte etwas zutiefst Einsames an sich, das war mir schon das ganze vergangene Jahr über aufgefallen, aber jetzt sah ich es ganz deutlich, er zeigte einen immer stärkeren Hang zur Isolation und Gleichgültigkeit. Wohin war die Begeisterung der ersten Schuljahre verschwunden? Wo war die Neugier auf die anderen Kinder, wo das Vertrauen, das er ihnen entgegengebracht hatte? Sehnsüchtig dachte ich manchmal an die Zeit zurück, als er mit Ausdrücken wie „Wallah“ oder „Wazzup“ nach Hause gekommen war. Ja, sogar „Fick deine Mutter“ vermisste ich hin und wieder. Und wie verständig er über Dinge reden konnte, die er absolut nicht von uns hatte: Kebab und halal, Bohnensuppe und Dubai. Er konnte von den somalischen Clans berichten, zwischen denen lange Zeit Krieg geherrscht hatte, die jetzt aber, in Norwegen, Freunde sein mussten. Lange hatte es den Anschein gehabt, als ob die Tatsache, dass er hier aufwuchs, genau diesen aufgeschlossenen, erweiterten Blickwinkel bei ihm zur Folge hätte, an den wir glaubten, und er hier „etwas lernen würde, was viele andere Kinder nicht lernten“. Doch jetzt hatte ihn die Einsamkeit wie eine Krankheit befallen. Gut möglich, dass sie ihn sein ganzes restliches Leben prägen würde. Aber war das die Einsamkeit von jemandem, der ausgeschlossen wurde, oder blieb er selbst auf Distanz zu anderen? Ich war mir ziemlich sicher, dass es von ihm ausging. Aber warum? War das eine Folge unseres Lebens hier? Oder war es, wie Jostein meinte, eine innere Distanz, die er sowieso entwickelt hätte und mit der wir in einem homogeneren Umfeld noch schwerer hätten leben können? Bei Jostein selbst war es so, wie mir nach und nach klar wurde. Auch in ihm existierte ein innerer Abstand zu anderen, mit dem er hier leichter umgehen konnte als in der Welt außerhalb Tøyens. Kalle lernte von uns. Und vielleicht hatte er in der Art und Weise, wie wir uns in der Nachbarschaft verhielten, eine Veränderung bemerkt, weil auch wir nicht mehr dieselbe neugierige Begeisterung an den Tag legten. Fest stand, dass sich in letzter Zeit etwas in ihm verändert hatte. Er hatte sein Anderssein bemerkt. Er war sich dieser Grenze zwischen uns und ihnen bewusst geworden, die wir so gerne niedergerissen hätten, und nach unserer Auffassung hatten wir alles dafür getan, um das zu erreichen. „Die Unterschiede sehen nur wir, nicht die Kinder“, pflegte Jostein zu sagen, und nach dieser These hatten wir noch bis vor Kurzem gelebt und es bewusst vermieden, die eindeutig sichtbaren Unterschiede, allem voran die Hautfarbe, vor Kalle zu benennen, um im Gespräch die einzelnen Personen aus der Nachbarschaft auseinanderzuhalten. Und wenn Kalle, um uns zu verdeutlichen, wen er meinte, sie als „braun“ oder „hellbraun“ bezeichnete, taten wir, als wäre uns dieser unwesentliche Unterschied erst jetzt aufgefallen.
Vor einem Jahr aber, nachdem eine Somalierin, Samira, vor einer Kiwi-Filiale direkt auf der anderen Straßenseite überfallen worden war, mussten wir unsere Strategie ändern. Eine unbekannte Frau war aus einem Auto gestiegen und auf Samira zugestürmt, hatte „Negerfotze“ geschrien und wollte ihr den Hidschab herunterreißen. In dem Tumult, der daraufhin entstanden war, hatte sie Samira den Arm ausgerenkt; das alles, während die Kinder der Frau zusahen. Wir waren nicht da gewesen, als es passierte, sondern hatten erst später am Abend davon gehört, und Kalle erfuhr es am nächsten Tag in der Schule. Auch davor hatte er schon mehrmals von schweren Gewalttaten gehört, auch von Mord, und wusste, dass solche Dinge in unserer Nachbarschaft vorkamen, darum hatte er sich zunächst nicht mehr darüber gewundert als über andere Vorfälle. Der große Unterschied war, dass diesmal eine Antirassismus-Demonstration organisiert wurde. Prinzipiell war es eine schöne Veranstaltung, wie wir fanden, ein spontaner Ausdruck dessen, was wir alle empfanden. Gefühlt ganz Tøyen hatte sich auf dem Platz versammelt, und auch viele von außerhalb. Die Backsteinwohnblöcke gleißten über uns in der Herbstsonne, es gab Ansprachen und Lieder, die Menschen grüßten einander, umarmten einander, hielten einander an den Händen. Eine ganze Nachbarschaft hatte sich versammelt, um Samira zu verkünden, sich selbst zu verkünden, ganz Norwegen zu verkünden, dass so etwas nicht geduldet werde. Ich hatte mir ein paar Stunden freigenommen, um dabei sein zu können, und stand Arm in Arm mit Jostein draußen vor dem Café, während Kalle bei seiner Klasse war, denn auch die Schule war gekommen, alle Lehrkräfte und Schulkinder, um den alljährlichen Mitmach-Tanz aufzuführen. Alle „Unsrigen“ aus der Café-Community waren gekommen, auch einige von denen, die schon eine Weile keine Schicht mehr übernommen hatten, ich sah Leute aus dem Tøyen Sportsklubb und viele andere engagierte Seelen, von denen es inzwischen so viele gab. „Das Wort Rassismus gibt es in Tøyen nicht“, sagte der Schuldirektor von der improvisierten Bühne herab, was mit einstimmigen Jubelrufen beantwortet wurde. Der nächste Redner vom Antirassismus-Zentrum teilte diese Ansicht jedoch nicht. Leider, sagte er, gestalte sich das in der Realität nicht so einfach. Rassismus existiere sehr wohl und werde auch aktiv praktiziert. Und als sei der Überfall auf Samira nicht Beweis genug dafür, begann er, eine Auswahl an Hasspostings vorzulesen, die allein in den vergangenen Monaten bei ihnen gemeldet worden waren. „Schnauze, Negerhure“, las er. „Die Moslems sollen in Schweinfett braten“, las er. „Du hast kein Recht, hier zu wohnen, geh wieder dorthin zurück, wo du hergekommen bist“, las er. Ich sah, wie sich einige Schulkinder verwirrt umdrehten, norwegische Kinder mit irakischem, somalischem, pakistanischem Background, die bis dahin kaum etwas von diesem Hass mitbekommen hatten, und hörte Anahita aus Kalles Klasse sagen: „Ich bin Muslimin, wieso sagen die das über Muslime?“ Und obwohl in der Schule in den Wochen danach Themen wie Toleranz und Menschenwürde im Unterricht nachbesprochen wurden, hatte sich in der Nachbarschaft etwas verändert. „Rassismus ist genau wie Schach“, sagte Kalle eines Abends. „Schwarz kämpft gegen Weiß, und man soll sich gegenseitig umbringen.“ Wir konnten nicht länger so tun, als gäbe es diese Unterschiede nicht, und jetzt kamen die Fragen am laufenden Band: „Warum wohnen die Dunkelhäutigen alle in Hochhäusern?“ „Warum haben die so viele Geschwister?“ „Wieso kriegen die Weißbrot und Pizza als Pausenbrot und ich nicht?“ Von da an bemühten wir uns, ihm stattdessen das größtmögliche Verständnis für die Unterschiede zu vermitteln, die er sah. Wir sprachen über die unterschiedlichen Verhältnisse, in denen wir lebten, auch hier in Tøyen, darüber, was es bedeutete, eine eigene Wohnung zu besitzen oder nur zur Miete zu wohnen, über die Arbeitslosigkeit, über die Folgen fehlender Sprachkenntnisse, über die Traditionen in anderen Ländern, die umso stärker in den Menschen wiederauflebten, je weniger sie sich in Norwegen heimisch fühlten. Wir klärten ihn über die Herkunft der Menschen in unserer Nachbarschaft auf, von denen viele aus Kriegsgebieten stammten, und inwiefern die Wurzeln dieser Kriege in eine Zeit zurückreichten, in der unsere Vorfahren ihre Heimatländer brutal ausgenutzt hatten, weshalb wir hier in Europa nicht unschuldig seien an den Strukturen und der wirtschaftlichen Schieflage, die wir um uns herum beobachteten. Doch je mehr wir ihm erklärten, desto sichtbarer wurde die Trennlinie: Es gab ein Wir, und es gab ein Sie.
Und dann war aus Jostein allmählich wirklich jede Energie entwichen. Er, der uns zehn Jahre lang immer tiefer in Verpflichtungen verstrickt hatte, verlor seine Tatkraft. Die Szene rund um das Café stagnierte. Die Freiwilligen bekamen nicht länger seine energischen Aufmunterungen, fühlten sich nicht mehr gesehen, und viele kamen gar nicht mehr. In den vergangenen Monaten hatte er Mühe gehabt, überhaupt den Dienstplan besetzen zu können, was darauf hinausgelaufen war, dass er viel zu viele Schichten selbst übernommen hatte. Der vergangene Abend war nur einer von vielen, an denen er mit seiner Verzweiflung zu mir kam. „Es ist, als würde ich jeden Tag durch einen Sumpf waten.“ Und meine Reaktion darauf war nun also die Drohung, ihn zu verlassen. Aber wie oft hatte ich ihm schon zugehört! So oft, dass mein Mitgefühl aufgebraucht war. Manchmal wiederholte er fast wortgetreu, was er tags zuvor bereits gesagt hatte, etwa wenn er mir die Abneigung beschrieb, mit der er morgens das Lokal aufsperrte, um sich ans Aufräumen und Abwaschen zu machen. „Früher hat mich das so glücklich gemacht, aber jetzt ist es nur noch anstrengend. Einkaufen, Waffelteig machen, Sandwiches streichen, die Brettspiele einräumen …“ Er erzählte, wie sehr er die Freiwilligen mitunter satthatte. „Ich habe keine Lust mehr, mit ihnen zu reden, aber wenn ich nicht rede, redet auch sonst keiner. Oh, Mona, ich fühle mich so allein!“ Darauf lief es am Ende immer hinaus, wie alleingelassen er sich fühlte, was natürlich eine Kritik an mir war, weil ich aufgrund meines Jobs nicht mehr so viel Engagement zeigte und keine Cafédienste mehr übernahm. Auch meine Arbeit war nicht immer so einfach, doch das hatte in unseren Gesprächen keinen Platz. Die angespannte Wirtschaftslage, die drohenden Kürzungen, mein Posten, der keineswegs sicher war, die ständig geforderten Umsatzsteigerungen. Das wollte Jostein nicht hören, dafür war er immer zu müde, oder aber er hielt das, was wir im Verlag so trieben, für unwesentlich, obwohl mein Gehalt es ihm überhaupt erst ermöglichte, seine gesamte Zeit einer freiwilligen Tätigkeit zu widmen. „Das ist dein Projekt!“, rief es manchmal in mir. „Du warst es, der das angefangen hat!“
In letzter Zeit hatte ich mir immer öfter ein Leben allein mit Kalle vorgestellt. Eine verbotene Fantasie, die sich mit der Kraft des Verbotenen entfaltete: Ein Alltagsleben in einem völlig anonymen Stadtviertel, wo wir niemanden kannten. Keine stockenden Gespräche auf der Straße, wenn ich spät dran war und auf dem Weg zur Arbeit noch von gebrochenem Norwegisch aufgehalten wurde. Keine verweigerten Aufenthaltsgenehmigungen, Wohnungskündigungen oder Schriftstücke vom Arbeitsamt, bei denen unsere Hilfe benötigt wurde. Ein Bett für mich allein. Niemand, der mit einer Whiskyfahne und seinen ganzen Sorgen und Begierden zu mir unter die Decke kroch, wenn ich erschöpft war. Nur Kalle und ich. Eine saubere, moderne, funktionelle Wohnung. Frühstück auf Barhockern an der Küchentheke, ein sanft surrender Kühlschrank, Fenster vom Boden bis zur Decke, Aussicht auf die Bäume eines Parks. Ich hatte es mir gestattet, mir diese Bilder auszumalen, sie in mir wachsen zu lassen. Sogar vom Aufzug hatte ich eine klare Vorstellung, immer frisch gereinigt und nach Putzmittel duftend, der sanfte Glockenschlag, wenn die Türen still aufglitten und uns in einen gefliesten Eingangsbereich entließen. Ein beauftragter Hausmeisterservice sorgte dafür, dass es immer sauber war, die Briefkästen immer geleert waren; nirgends abgestellte Gegenstände oder herumliegendes Werbematerial. Und morgens würde ich mich nicht vor den alten, dicken Backsteinmauern der Tøyen-Schule von Kalle verabschieden, sondern vor einem modernen Schulgebäude mit großen Glasflächen. Die anderen Schulkinder wären wohlerzogen und würden Norwegisch sprechen, als wäre es die natürlichste Sache auf der Welt, hätten Regenzeug an, wenn es regnete, Fäustlinge, wenn es kalt war, und ich müsste nicht nach Hause laufen, um einen zusätzlichen Schlitten für irgendjemanden zu holen, wenn sie rodeln gingen. Es brauchte nicht einmal in der Stadt zu sein. Es würde mich nicht stören, vor und nach der Arbeit eine Zeit lang allein im Zug zu verbringen, zwischen Anonymen zu sitzen und selbst anonym zu sein. Abends hätte ich Zeit, all die Bücher zu lesen, die ich schon seit dem Studium lesen wollte, oder endlich den Artikel über die Alberte-Bücher zu schreiben, über dem ich schon so lange brütete … Doch irgendwann erreichte ich dann immer den Punkt, an dem die Sehnsucht nach so einem Leben sich zu einem Schlund öffnete: Josteins Abwesenheit wirkte plötzlich wie ein Schock, und ich musste die Hände vors Gesicht schlagen und flüstern: „Nein, nein!“ Denn ohne Jostein konnte ich nicht existieren. Aber wie stand es mit ihm? Er würde alles von sich abfallen lassen. Würde wieder Tabletten schlucken, so wie damals, als er seine Masterarbeit hingeschmissen hatte, er würde nicht mehr aufstehen, nicht mehr telefonieren, nicht mehr reagieren, wenn er angesprochen wurde. Das Café würde dichtmachen, und alles, was noch an Gemeinschaft übrig war, würde sich auflösen, und das könnte ich nicht mitansehen.
Ich ließ ihm einen versöhnlichen Gedanken zukommen, da er trotz allem heute Nacht aufgestanden war, um nach Kopenhagen zu fahren. Er war nicht liegen geblieben, obwohl wir so viel getrunken hatten und es ihm so sehr vor diesem Auftrag gegraut hatte, einem Vortrag, The Café that transformed the Quarter, den er auf einer Konferenz für Active Citizenship halten sollte. Er hatte das Angebot vor über einem Jahr bekommen, als er energiemäßig noch voll auf der Höhe gewesen war. Damals war es mir nicht schwergefallen, ihn zur Teilnahme zu überreden. „Jetzt wird das Café mehr sein als nur ein Café“, sagte ich. „Es wird ein Symbol, ein Beweis dafür sein, dass eine multikulturelle Gemeinschaft möglich ist.“ Und als er mir von seiner Zusage berichtet hatte, hatte ich mit einem triumphierenden „Super, Jostein!“ reagiert, und danach mit einem „Super, super, super!“, und wir hatten miteinander geschlafen an diesem Abend, er war so stolz und selbstbewusst gewesen. Aber es lastete noch eine zusätzliche Verantwortung auf ihm, da er auf mein Anraten hin darum gebeten hatte, Abdi Farah mitnehmen zu dürfen. Der Gedanke dahinter war, dass damit die Gemeinschaft nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis veranschaulicht werde. Der dänische Veranstalter war mit dem Vorschlag einverstanden und versprach, selbstverständlich werde Abdi Farah dasselbe Honorar erhalten wie er. Doch war es Jostein vor einem Jahr noch inspirierend erschienen, gemeinsam mit seinem somalischen Freund zu verreisen, hatte sich das nun als eine zusätzliche Belastung herausgestellt. Er glaube selbst nicht mehr an diese Geschichte, sagte er. Er sei kein Schauspieler und wolle Abdi Farah nicht zum Narren halten. „Soll ich dort unten herumrennen und ihn wie eine Trophäe herzeigen?“ Ich entgegnete, sie beide würden als Freunde dorthin fahren, nicht mehr und nicht weniger, und ob das allein nicht Beweis genug dafür sei, dass die Geschichte über das Café wahr sei?
Als wenig hilfreich erwies sich natürlich zudem, dass Anfang Herbst ein langer, sehr negativer Artikel über die Gentrifizierung Tøyens erschienen war, in dem das Café als Teil der Ursache angeprangert wurde. Kritik und Spott von der politischen Rechten waren wir längst gewöhnt, diesmal jedoch kamen sie von links, von einem dieser radikalen Onlinemagazine, an das arbeitslose Journalistinnen und Journalisten sich klammerten, nachdem die Zeitungen, für die sie früher gearbeitet hatten, den Mitarbeiterstab ausgesiebt hatten oder eingegangen waren. Jetzt schrieben sie frei, aber meiner Meinung nach auch viel zu lang und viel zu kritisch. Für Jostein allerdings war nicht so eindeutig ersichtlich, dass diese Kritik mit der fehlenden redaktionellen Führung zusammenhing, sondern er war davon tief getroffen. Als Bildmaterial hatten sie eines der fünf Jahre alten Fotos von der Café-Eröffnung verwendet, das ich selbst in den sozialen Medien geteilt hatte: Jostein und ich und dazwischen ein lächelnder Abdi Farah. Die Journalistin hatte die Formulierungen „Lokale Klassentrennung“ und „Gratisarbeitskraft“ verwendet, womit sie im weitesten Sinne angedeutet hatte, der eigentliche Zweck unserer Nachbarschaftskampagne bestehe darin, die Immobilienpreise in die Höhe zu treiben, wodurch wir selbst Gewinne erzielten. Unter dem Foto stand: „Zusammenarbeit?“
Das machte Jostein schwer zu schaffen, während er Abend für Abend mit Abdi Farah im Arbeitszimmer saß, um ihre Präsentation vorzubereiten. Ich hörte sie bis ins Wohnzimmer über Inhalt und Bilder diskutieren, und später Abdi Farah, wie er seinen Text einstudierte, ihn sich Wort für Wort einhämmerte, und wie geduldig Jostein ihm dabei half. „Nicht escapability, Abdi, capability.“ An einem der letzten Abende starteten sie in meiner Anwesenheit einen Probedurchlauf ihres Vortrags. Jostein schloss den Computer an den Fernsehbildschirm im Wohnzimmer an und ließ die Präsentation laufen, während sie danebenstanden und so taten, als befänden sie sich auf der Bühne. Sie starteten mit Bildern des Cafés und des Tøyensenteret, wie es früher ausgesehen hatte. Schmutzige, verdunkelte Fenster. Die Betonwucht einer urbanen Wüste. Eine Auswahl von Schlagzeilen aus den Jahren 2011 und 2012, die Jostein nach bestem Wissen und Gewissen ins Englische übersetzt hatte: What is it about Tøyen? The quarter that Norway forgot. The shadowside of the wellfare state. Danach folgten Bilder, viele davon von mir aufgenommen, von den ersten Arbeiten, von der kleinen Gruppe Freiwilliger, der sich immer mehr Leute angeschlossen hatte und die immer mehr Freude und Selbstsicherheit ausstrahlte, je konkreter das Café Gestalt annahm, mit Möbeln, einem schicken Apothekentresen, den sie irgendwo aufgetrieben hatten, gestrichenen Wänden und Fensterrahmen, alten Lampen und Wandleuchten. Ich konnte deutlich vor mir sehen, wie Jostein die Fotos nach dem Prinzip möglichst gemischter Hautfarben ausgewählt hatte. Es vermittelte den Eindruck, Menschen aus allen Teilen der Welt hätten sich in einem Cafélokal im Osloer Bezirk Tøyen versammelt, Männer, Frauen und Kinder jeglichen Alters, die gemeinsam die Pinsel schwangen, hämmerten und bohrten, daneben aber auch Zeit fanden, gemeinsam ein schlichtes Essen zuzubereiten, über Popcorn in den Haaren zu lächeln, durch Waffelgesichtsmasken zu grinsen und draußen auf dem trostlosen Platz Fußball zu spielen. Danach folgten Fotos von der Eröffnung, mit Blumen und Luftballons und bekannten Personen aus der Politik, anschließend von den verschiedenen Veranstaltungen, die ich schon fast vergessen hatte: Kleiderreparaturwerkstatt, Tauschbörse, Trommelkurs, arabischer Poesieabend. Reihenweise Aussagen von freiwilligen Hilfskräften und Gästen über das Café und was es ihnen bedeutet. „I knew nobody here, now I know everyone.“ „Café Ansiktet gave me back my social life.“ Was meinem Empfinden nach jedoch den tiefsten Eindruck beim Publikum hinterlassen würde, war Abdis persönlicher Erfahrungsbericht im Anschluss. Durch das Café habe er das nötige Arbeits- und Sprachtraining bekommen sowie eine Einführung in „the Norwegian way of being“, wie er sagte, und er fügte hinzu: „Not the easiest thing to understand!“ Abschließend bedankte er sich bei Jostein für das Arbeitszeugnis, das er ihm ausgestellt hatte und das für ihn ein wichtiger Schritt gewesen sei auf dem Weg zu seiner Anstellung bei der Stadtverwaltung. Und Jostein: „No, no, I thank you, my friend.“ Ich spendete ihnen einsamen Beifall. Sehr überzeugend! Eine sehr ergreifende Geschichte! Das sagte ich mit so viel Inbrunst, wie ich zustande brachte, und ich sagte es noch einmal, nachdem Abdi gegangen war und Jostein mit dem Gesicht auf der Rückenlehne des Sofas lag und so leise weinte, wie er nur konnte, damit Kalle es nicht hörte. „Du hast etwas Großes auf die Beine gestellt“, sagte ich, denn in dem Moment konnte ich mich nicht dazu durchringen, „wir“ zu sagen. „Du hast Menschleben verändert“, sagte ich. „Vergiss das nicht.“