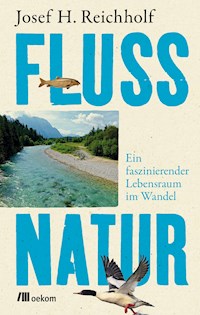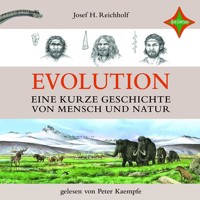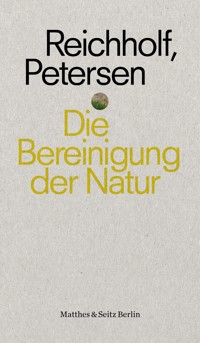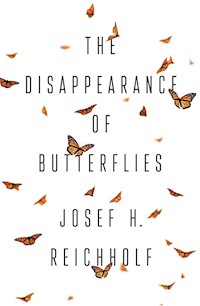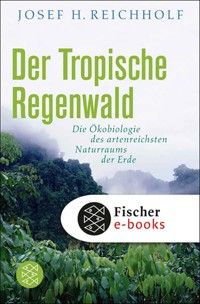
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine biologische Reise durch das grüne Paradies Der Tropische Regenwald ist der artenreichste Naturraum der Erde, ein einzigartiges Ökosystem, das entscheidend zum gesamten Erdklima beiträgt. Der renommierte Biologe und Bestsellerautor Josef H. Reichholf nimmt uns mit auf eine spannende Reise durch dieses Paradies. Neben einer Fülle von faszinierenden Details vermittelt er genaue Einblicke in die ökologischen Zusammenhänge. Und erst wer diese versteht, kann begreifen, wie folgenschwer die Störung dieses sehr empfindlichen Gleichgewichts ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 267
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Josef H. Reichholf
Der Tropische Regenwald
Die Ökobiologie des artenreichsten Naturraums der Erde
Über dieses Buch
Der Tropische Regenwald ist der vielfältigste und artenreichste Naturraum der Erde; ein einzigartiges System naturgewachsenen Lebens, das außerdem entscheidend zum gesamten Erdklima beiträgt. Josef H. Reichholf beschreibt in diesem Buch das phantastische Ökosystem des Tropischen Regenwaldes, der auf den ersten Blick nur eine gigantische, von Ameisen bevölkerte grüne Masse zu sein scheint. Die biologische Reise des Autors durch dieses Paradies vermittelt neben der Fülle von faszinierenden Details genaue Einblicke in die ökologischen Zusammenhänge: in das höchst differenzierte Zusammenspiel der Tier- und Pflanzenwelt, des Nährstoff- und Wasserkreislaufes. Erst wenn man diese Zusammenhänge erkennt, kann man begreifen, wie folgenschwer die Störung dieses sehr empfindlichen Gleichgewichts ist.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Covergestaltung: hißmann, heilmann, hamburg
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2010
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-400896-7
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Einführung zur Neuausgabe
1 Rahmenbedingungen
2 Zentrum des Artenreichtums
3 Vögel
4 Insekten
5 Insektenstaaten
6 Farbenpracht und Gigantismus
7 Merkwürdige Frösche
8 Panzerechsen und Riesenschlangen
9 Singende Fische
10 Enten und andere Wasservögel
11 Geheimnisse des Vogelzugs
12 Kolibris
13 Säugetiere
14 Primaten
15 Ökosystem Regenwald
16 Drei Grundvoraussetzungen
17 Tropische Diversität
18 Von der Nutzlosigkeit der Nutzung
19 Der wahre Wert der Tropischen Regenwälder
Literatur
Einführung zur Neuausgabe
Von der Lebensfülle im Tropischen Regenwald, ihrer Gefährdung und Vernichtung handelt dieses Buch. Als die Erstfassung im Jahre 1990 erschien, war die Bedrohung der Regenwälder in den Tropen ein großes Thema. Die Medien trugen die Regenwaldvernichtung in die Öffentlichkeit. Die großen Naturschutzorganisationen setzten sich für verbesserten Schutz ein. In Deutschland und in den meisten anderen Industrieländern gab es eine Fülle von Veranstaltungen und eindringliche Resolutionen. Beim »Erdgipfel von Rio« 1992 wurde der Höhepunkt erreicht. Darauf folgte ein jäher Absturz des Interesses. Auch das »Waldsterben« fing an, seine Öffentlichkeitswirkung einzubüßen. Es war unglaubwürdig geworden. Der deutsche Wald starb nicht und schon gar nicht starb er bis zur Jahrtausendwende aus, wie es vorhergesagt worden war. Er entwickelte sich sogar viel besser, als selbst Optimisten erwartet hatten. Die Medien wandten sich anderen Themen zu. Sie ließen das Waldsterben einen stillen Tod sterben. Auch das Interesse am Tropischen Regenwald erlosch. Nur wenige versuchten weiterzukämpfen. Von der Politik fühlten sie sich verlassen. Denn nachdem der damalige deutsche Umweltminister Klaus Töpfer, der sich im Vorfeld des von ihm maßgeblich gestalteten »Erdgipfels von Rio« so sehr für den Regenwaldschutz und die Erhaltung der Biodiversität eingesetzt hatte, Chef des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) geworden und nach Nairobi gegangen war, blieb die erhoffte Hilfe für die Erhaltung des Regenwaldes aus. Nicht einmal das angestrebte deutsche Forschungsinstitut für Tropenökologie kam zustande. Ein solches hätte ähnlich wie die so erfolgreiche deutsche Polarforschung die wissenschaftlichen Aktivitäten in den Tropen bündeln sollen. Die Forschungen sollten auf die Kernfragen konzentriert werden, die mit der Erhaltung und der nachhaltigen Nutzung der Tropenwälder verbunden sind. Ein solches Tropenforschungsinstitut blieb ein Wunschbild, das mit der Zeit verblasste und in Vergessenheit geriet. Die neue, noch größere Welle namens Klimaerwärmung baute sich auf und überflutete alles.
Doch gerade in dieser Zeit gerieten die Tropenwälder insbesondere in Südamerika noch stärker in Gefahr. Es wurde gerodet wie nie zuvor. Die »BSE-Krise« hatte Ende des 20. Jahrhunderts einen plötzlichen Mangel an Futtermitteln verursacht, weil keine tierischen Abfälle mehr der Nahrung für das Stallvieh beigefügt werden durften. Die Folge davon war, dass die Rate der Tropenwaldvernichtung allein in Brasilien von vorher eineinhalb Millionen auf über drei Millionen Hektar pro Jahr anstieg. Soja auf den gerodeten Flächen anzubauen, wurde zum großen Geschäft. Der Sojabedarf stieg und stieg. Zum bisherigen Hauptabnehmer Europa war China als neuer Großeinkäufer hinzugekommen. Die Vernichtung von Tropenwäldern erreichte noch nie da gewesene Größenordnungen. Sie stieg auf insgesamt 10 bis 13 Millionen Hektar pro Jahr. In den zwanzig Jahren seit dem ersten Erscheinen dieses Buches im Mai 1990 wurde eine Fläche von der Größe Deutschlands, Frankreichs, Polens, Italiens und Österreichs zusammen entwaldet. Bei 13 Millionen Hektar Tropenwaldvernichtung pro Jahr dauert es gegenwärtig nur drei Jahre, bis eine Fläche so groß wie ganz Deutschland abgeholzt ist. Hinzu kommt, wie das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) bereits in den 1990er Jahren bekanntgegeben hatte, dass alljährlich in den Tropen und Subtropen eine Fläche so groß wie ganz Australien abgebrannt wird. Dieses Flämmen soll den Graswuchs anregen und das dort fast überall recht dürftige Weideland für Vieh kurzzeitig ein wenig verbessern. Die Energie, die durch diese Brände gänzlich ungenutzt frei wird und in Form von Wärme und Rauch in die Atmosphäre gelangt, überstieg nach diesen UNEP-Berechnungen mit 500 Millionen Tonnen Steinkohle-Einheiten den gesamten Energieumsatz Deutschlands um 80 Millionen Tonnen. Das seit Jahren auch von der deutschen Bundesregierung favorisierte Ziel der Verminderung des CO2 freisetzenden Energieverbrauchs um 20 Prozent bleibt im Vergleich zu diesem Geschehen in den Tropen und Subtropen Makulatur. Bei den herrschenden Verhältnissen würde nicht einmal ein völliges Verschwinden Deutschlands im Weltklima bemerkt werden.
Die Tropenwaldvernichtung geschieht aber nicht nur, um Futtermittel für die Stallviehhaltung zu erzeugen. Ein Großteil der gerodeten Tropenwälder wird in ertragsarme Weideflächen für Vieh, insbesondere für Rinder, umgewandelt. Brasilien baute in den letzten Jahrzehnten einen Rinderbestand auf, der jenem der Heiligen Kühe Indiens gleichkommt. Ihr Lebendgewicht übertrifft das aller Menschen in Brasilien beträchtlich. Gerade unter tropischen und subtropischen Lebensbedingungen scheiden die Rinder als Wiederkäuer aber besonders große Mengen an Methan aus. Es entsteht bei ihrer besonderen Art der Verdauung. Da die Rinderweiden in den Tropen und Subtropen die Entwicklung von Großtermiten begünstigen, die gleichfalls zu den ganz großen Erzeugern von Methan zählen, verdoppelt sich die Wirkung der Rinder. Methan nimmt als Treibhausgas in der Atmosphäre den 3. Platz nach dem Wasserdampf und dem CO2 ein. Allein die von Rindern stammenden Mengen übertreffen an atmosphärischer Wirksamkeit den CO2-Ausstoß der Industrienationen Japan und Deutschland zusammen bei weitem. Die eineinhalb Milliarden Rinder, die es global gibt, gehören somit, wie auch die mehr als eine Milliarde Schweine und die vielen Milliarden Hühner, zu den Hauptgrößen in der Belastungsbilanz der Umwelt unserer Erde. Ihr Futter wird zu einem Großteil in den Tropen und Subtropen erzeugt und von dort nach Europa, Nordamerika und Ostasien exportiert. Die Nutztiere übertreffen an Lebendgewicht die gesamte Menschheit um mehr als das Fünffache; in ihrem Nahrungsverbrauch um mindestens das Zehnfache. Damit sind sie in doppelter Weise die größte Konkurrenz der Millionen hungernden Menschen. Sie verbrauchen Nahrung wie Soja, die auch die Hungernden essen könnten, und beanspruchen Land, das den Menschen als Lebensraum fehlt.
Doch wie immer muss man bei Pauschalierungen berücksichtigen, dass die Unterschiede regional sehr groß sein können. So leben in den südostasiatischen Tropen weit mehr Menschen als in den afrikanischen oder den südamerikanischen. In Brasilien kommen nur etwa 20 Menschen auf jeden Quadratkilometer des fünftgrößten Landes der Erde vor; in Indonesien aber zehnmal mehr und in Bangladesh drängen sich schon über 1000 Menschen pro Quadratkilometer zusammen. Daher ist bei der Tropenwaldvernichtung zu beachten, ob es sich dabei in erster Linie um den Landbedarf der stark wachsenden Bevölkerung dreht oder um die Umwandlung von Wäldern in Viehweiden und Soja-Großplantagen für den Export nach Europa und Ostasien. Tatsächlich stehen die Exporte mit weitem Abstand an erster Stelle unter den Hauptverursachern der Tropenwaldvernichtung. Die arme und hungernde Bevölkerung bekommt davon nur sehr wenig ab. Dass unser Stallvieh in Deutschland aufgrund der importierten Futtermittel Tropenwälder in Südamerika auffrisst, hat somit eine ganz andere politische und soziale Dimension als die Rodung von Wäldern durch und für die einheimische Bevölkerung in Zentralafrika oder in Teilen Süd- und Ostasiens.
Die Problematik vergrößerte sich im letzten Jahrzehnt noch weiter durch den Anbau und die Verwertung von »Biomasse-Pflanzen« zur Erzeugung von Biodiesel und Alkohol. Die im Hinblick auf den Klimaschutz begünstigte Nutzung von erneuerbaren Energiequellen verursachte Engpässe in der Verfügbarkeit von Getreide auf dem Weltmarkt und entsprechend steigende Preise. Die Teuerung traf die Ärmsten der Armen. Auch in Deutschland wurde Weizen zur Energieerzeugung verbrannt, weil das den Bauern mehr Geld einbrachte als der Verkauf als Brotgetreide. Der Anbau »nachwachsender Rohstoffe« konkurriert nicht allein bei uns mit der Getreideerzeugung, sondern als globaler Trend trifft er die Tropenwälder ganz besonders stark. Immer größere Teile der dortigen landwirtschaftlichen Nutzflächen werden dem Anbau von Biomassepflanzen gewidmet. Also frisst nicht allein das Stallvieh diese Wälder auf, sondern auch der Klimaschutz zehrt verstärkt davon. Für eine ehrliche Bilanz ihrer globalen Auswirkungen müssten Deutschland und die anderen großen Importeure von Ressourcen aus den Tropen und Subtropen national all das mit einrechnen, was der Entzug von Ressourcen in deren Herkunftsländern anrichtet. Umgekehrt müssen die Emissionen von Methan und die Masseverluste der Wälder, die verbrannt wurden, ebenfalls in die nationalen Bilanzen der Tropenländer eingerechnet werden. Die Pro-Kopf-Werte der globalen Umweltwirkung lägen dann für Indien oder Brasilien weitaus höher als bei alleiniger Berücksichtigung der Freisetzung von Kohlendioxid.
Aus alldem geht hervor, dass die Tropenwälder nach wie vor eine Schlüsselposition im globalen Wandel einnehmen. Ihre Bedeutung hat seit der Erstveröffentlichung meines Buches sogar noch erheblich zugenommen. Die letzten zwanzig Jahre brachten keine erkennbaren Veränderungen in den globalen Trends. Die große Waldvernichtung findet in den Tropen und Subtropen statt. Außertropischen Wäldern geht es im Vergleich dazu ganz gut. In Deutschland hat die Waldfläche sogar, wie auch in einigen anderen Ländern der Europäischen Union, im 20. Jahrhundert etwas zugenommen. Aber dieser Zugewinn bedeutet nichts verglichen mit dem weltweiten Geschehen. In den letzten 100 Jahren wurde die Waldfläche global um die Hälfte vermindert, während das Ackerland nur um wenige Prozent zugenommen hat – viel weniger, als es dem Anwachsen der Weltbevölkerung entsprechen würde. Letztere hat sich im gleichen Zeitraum verdreifacht. Die Abhängigkeit der Menschheit von ergiebiger pflanzlicher Nahrung wird durch das Bevölkerungswachstum immer größer. Doch hinzubekommen haben nicht die Menschen, sondern das Vieh die Hauptanteile der neuen Lebensräume. Viehweiden, Schweine- und Hähnchenmast sind uns mehr wert, als uns der Hunger von Millionen von Menschen bedeutet. Der extrem hohe, immer noch steigende Fleischkonsum in all den Ländern, in denen es keinen Hunger (mehr) gibt, stellt daher die Hauptbedrohung sowohl für die Ernährung von mehr als der Hälfte der Menschheit als auch für den Fortbestand der Tropenwälder dar.
Europa, Nordamerika und Ostasien beuten, ähnlich wie das in der Kolonialzeit geschehen ist, die Tropen- und Subtropenwelt aus. Die Zukunft der Regenwälder liegt nicht in den Händen der dort lebenden Menschen, sondern sie hängt davon ab, wie lange wir uns noch an den Ressourcen aus diesen Regionen bedienen. Wir produzieren hier, was in den Herkunftsgebieten der Futtermittel mit weit weniger Aufwand und in fairerer Weise erzeugt werden könnte. Tatsächlich entfernen wir uns immer weiter von einer angemessenen Selbstversorgung und begeben uns immer stärker in die Abhängigkeit der globalen Materialflüsse und Energieversorgung. Unsere Landwirtschaft muss für ihre Erzeugnisse viel zu viel Energie einsetzen. Sie ist zu einer äußerst energie-intensiven Unternehmung geworden. De facto nutzt sie eine Fläche doppelt so groß wie die bei uns vorhandene landwirtschaftliche Flur – das meiste davon liegt in den Tropen und Subtropen in Gebieten, in denen noch vor wenigen Jahrzehnten lebensvolle Wälder wuchsen. Mit deren Verschwinden verliert die Erde Biodiversität in ungleich größerem Ausmaß, als das bei uns in Mitteleuropa geschieht. 2010 ist das ›Jahr der Biodiversität‹. Es sollte uns zu denken geben, dass aus »Rio«, dem so hoch gelobten »Erdgipfel«, nichts geworden ist. In der seither verstrichenen Zeit ging artenreiche Tropennatur in noch größerem Umfang als vorher verloren, und die Rate der Waldvernichtung wurde nicht wie vorgesehen abgebremst. Den Tropenländern ist das nicht anzulasten. Die Hauptverursacher des Niedergangs ihrer Wälder sind nicht sie, sondern wir. Dass zu diesem »Wir« in den letzten beiden Jahrzehnten China hinzugekommen ist, verschlechtert die Aussichten, die Biodiversität der Tropenwelt zu erhalten, ganz erheblich. Denn anders als in der Europäischen Union und in Nordamerika gibt es in China tatsächlich einen riesengroßen Nachholbedarf, der erst zu decken und zu konsolidieren ist, bevor sich das volkreichste Land der Erde das leisten können wird, was sich »der Westen« seit »Rio« hätte leisten sollen. Er hat es nicht getan. Wir sind nicht mit gutem Vorbild vorangegangen; ganz im Gegenteil: Im eigenen Land steht es schlecht um die Erhaltung der Biodiversität. Die großen Ziele des Naturschutzes fielen dem Aktionismus zum Klimawandel zum Opfer. Die überfällige Reform der EU-Landwirtschaft ist ausgeblieben. Sie liegt ferner denn je. Unmittelbar nach der Wiedervereinigung Deutschlands hatte es noch Hoffnung gegeben. Sie schwand vollends, als es auch mit dem Beitritt der großen Agrarländer Mittelosteuropas zur EU zu keiner grundlegenden Änderung kam. So wird die Ausbeutung der Tropen weitergehen und eher noch zunehmen als zurückgehen. Der Kolonialismus ist noch längst nicht zu Ende.
Wozu ist dann die Forschung, die ökologische Freilandforschung an und in der Natur der Tropen eigentlich gut, wenn die Ergebnisse nicht zur Kenntnis genommen werden? Befriedigen wir damit mehr unsere Forscherneugier, als wir Notwendigkeiten erfüllen? Solche und ähnliche Fragen tauchen stets im Vorfeld von Resignation auf. So verständlich es ist, pessimistisch zu reagieren, so falsch wäre es dennoch, nur schwarzzusehen. Vieles braucht seine Zeit, auch in der Wissenschaft. Manches muss reifen, um gut zu werden. Befunde werden in der Versenkung verschwinden, weil sich Bedarf und Ziele verändert haben. Wer den eigenen Beitrag zu hoch einschätzt, wird Enttäuschungen hinnehmen müssen. Eine realistische Haltung gebietet hingegen die Abwägung zwischen dem Wünschenswerten und dem Unmöglichen. Vieles von dem, was die Tropenforscher und Tropenwaldschützer in den 1980er Jahren angestrebt hatten, war, wie wir jetzt wissen, unmöglich zu erreichen. Manches ist dennoch gelungen, auch wenn es bei (zu) hoch angesetzten Erwartungen als zu wenig erscheinen mag. So wuchs in Brasilien inzwischen eine neue Generation von Forschern und Naturschützern heran. Sie leisten Hervorragendes. Große Schutzgebiete für Regenwälder in Amazonien sind nun ausgewiesen. Die Chancen für ihre Erhaltung stehen nicht schlecht. Sie sind erheblich besser geworden, seit eigene Spezialisten im Land vorhanden sind. Brasilien hat den Wald auf eine neue Art zur Kenntnis genommen und sich vom alten »matar o mato«, von der Vernichtung des Waldes, verabschiedet. Es wird aus eigener Kraft sicher mehr schaffen, als vorher von außen erwartet werden konnte.
Längst ist auch der touristische Wert der Tropennatur in allen Tropenregionen erkannt worden. Der Öko-Tourismus bringt Geld. Auch wenn kein Tourismus ohne Nebenwirkungen bleibt, so sind doch seine Folgen auf jeden Fall ungleich weniger gravierend als die Vernichtung des Waldes um eines kurzfristigen, schnellen Gewinns willen. Überraschend und erfreulich sind auch die neuen Befunde zum Artenreichtum in den Sekundärwäldern. Wo immer Buschwerk und Wald aufwachsen, weil genutzte Flächen aufgegeben worden sind, stellt sich eine durchaus tropische Vielfalt an Pflanzen und Tieren ein. Vielleicht haben wir die Fähigkeit zur Regeneration der Tropenwälder bislang unterschätzt. Möglicherweise sind sie doch in der Lage, beträchtliche Teile ihrer früheren Biodiversität mit der Zeit wieder aufzubauen. Sollte ich mich in meiner früheren Einschätzung, die im Buch noch zu finden ist, geirrt haben, wäre mir das, wie wohl auch den meisten anderen Tropenforschern, die sich für die Erhaltung der tropischen Lebensvielfalt einsetzen, ein höchst willkommener Irrtum. Langzeitstudien bringen allemal bessere Ergebnisse als noch so gute Kurzzeitforschungen, zu denen unser Förderungssystem die Forschung zwingt. Viel Neues ist infolgedessen in den vergangenen beiden Jahrzehnten hinzugekommen. So sehr davon die Kenntnisse ausgeweitet und vertieft worden sind, so wenig haben die neuen Befunde aber an den Grundlinien geändert. Deshalb habe ich den Inhalt des Buches auch nicht überarbeitet. Es hätte ganz neu geschrieben werden müssen, ohne aber wirklich neu geworden zu sein. Sollte sein Ausklang zu wenig Zuversicht zum Ausdruck bringen, so möchte ich das an dieser Stelle etwas zurechtrücken. Ich glaube nicht, dass in absehbarer Zeit ein Großteil der Tropenwälder vernichtet sein wird. Allen Befürchtungen zum Trotz bin und bleibe ich zuversichtlich. Bernhard Grzimeks Serengeti in Ostafrika ist nicht gestorben. Auch die Regenwälder an Amazonas, Kongo und in Südostasien werden überleben. Diese Hoffnung gebietet die Fülle des Lebens in der Tropenwelt.
Josef H. Reichholf,
März 2010
1Rahmenbedingungen
Das Klima setzt den Rahmen: In der Tropenzone zwischen den Wendekreisen können sich Tropische Regenwälder entwickeln, wenn die jährliche Niederschlagsmenge wenigstens 2000 Millimeter erreicht und keine Trockenzeit von mehreren Monaten auftritt. Unter solchen klimatischen Bedingungen übersteigt die Regenmenge die Verdunstungsrate. Es stellen sich dauerfeuchte Verhältnisse ein. Die Lufttemperatur bleibt wegen des hohen Feuchtigkeitsgehaltes der Luft erheblich unter den Werten der Hitzegebiete der trockenen Tropen. Selten übersteigt sie 33 °C; zumeist bewegt sie sich zwischen 22 oder 23 °C in der Nacht und 28 bis 30 °C am Mittag, wenn die Sonne den Höchststand erreicht. Die Luftfeuchtigkeit fällt selten unter 95 Prozent und überschreitet häufig den Taupunkt, also 100 Prozent. Feuchte Schwüle kennzeichnet das Klima der feuchten Tropen. Das ist die Umwelt des Tropischen Regenwaldes; eine Umwelt, die, wie zu zeigen sein wird, ursächlich mit seiner Struktur zusammenhängt.
Tropische Regenwälder erreichen ihre größten Ausdehnungen in den Niederungsgebieten der äquatorialen Kontinente. In Amazonien, im Kongobecken, auf den großen, zum asiatischen Festlandssockel gehörenden Inseln Borneo und Sumatra sowie in den Niederungen Südostasiens liegen die größten zusammenhängenden Tropenwaldgebiete. An den Berghängen ziehen sie sich bis in Höhen von 1000 oder 1200 Metern hoch. Schon ab etwa 600 Metern Meereshöhe beginnt sich der Regenwald zu verändern. Er geht allmählich, zumeist nahezu unmerklich in einen Bergregenwald über, den ein kühleres, noch feuchteres Klima kennzeichnet. In diesen Höhen schließen sich Feuchtwälder mit krüppelwüchsigen Bäumen und außerordentlich reicher Entwicklung von Moosen und Farnen an. An manchen tropischen Hochgebirgen bilden sie eine eigene Höhenstufe. Sie wird als »Elfenwald«, auch im fachlichen Sprachgebrauch, charakterisiert, weil Kleines zu groß geraten und Großes klein geworden erscheint. Heidekrautgewächse bilden übermannshohe Gewächse, Moosbärte hängen meterlang von den Ästen, und der Besucher versinkt wadentief im schwammigen, von Pflanzenpolstern gebildeten Untergrund.
Baumfarne. Sie wachsen vorwiegend in den sehr feuchten Berg- und Schluchtwäldern der inneren Tropenzone. Im Tropischen Regenwald des Tieflandes können sie sich nicht gegen die Konkurrenz der »modernen« Bäume behaupten. Die Baumfarne gehören zu den stammesgeschichtlich sehr alten Baumformen, die ihre Blütezeit im frühen Erdmittelalter hatten. Sie gelten daher als »lebende Fossilien« unter den Bäumen des Tropischen Regenwaldes.
Die Höhenzonen sind gewöhnlich deutlicher abgegrenzt als die verschiedenen Typen von Regenwäldern, die sich im Tiefland ausbilden. Auf Böden ohne Staunässe wächst Hochwald, der eindrucksvolle Wuchshöhen erreichen kann. Das Kronendach befindet sich in 30 bis 40 Metern Höhe, überragt von »Urwaldriesen«, die bis zu 70 Meter erreichen können. Sie sind aber keineswegs die größten Bäume. Die Mammutbäume im westlichen Nordamerika und manche Eukalyptus-Arten werden viel höher und mächtiger. 120, ja 150 Meter Höhe sind von den Größten von ihnen erreicht worden.
In flachen Senken, aus denen die Wassermassen der Niederschläge nicht schnell genug ablaufen können, bilden sich Sumpfwälder. Oft sind sie durch fast artreine Bestände bestimmter Palmenarten gekennzeichnet. Ein anderer, weit verbreiteter und wichtiger Waldtyp findet sich entlang der Flüsse im Überschwemmungsbereich. (Wie die chemische Zusammensetzung der Böden Einfluss nimmt auf die Zusammensetzung und die Wüchsigkeit der Regenwälder, darauf wird noch ausführlicher eingegangen.) Schließlich gehen die Tropischen Regenwälder an flachen Küsten in den Mangrovendschungel über, in dem Ebbe und Flut das Geschehen bestimmen.
Die Niederschlagsmengen setzen den klimatischen Rahmen – und nicht die geographische Begrenzung der Tropenzone an den Wendekreisen! Wo die jährliche Niederschlagsmenge unter 2000 Millimeter absinkt, können sich in der Regel im Tropengürtel keine dauerfeuchten Regenwälder halten, weil die von der hochstehenden Sonne verursachte Verdunstung dann über längere Zeit den Nachschub an Feuchtigkeit übersteigt. Dauert dies drei oder mehr Monate lang, entstehen Saison-Regenwälder. Am weitesten verbreitet und am markantesten ausgebildet sind sie im südasiatischen Monsunklima zu finden. Solche Wälder werfen ihr Laub ab, wenn die Trockenzeiten regelmäßig auftreten und mehr als drei Monate dauern. Während und kurz nach der Regenzeit können sie wie richtige Tropische Regenwälder aussehen, aber bald macht sich die aufkommende Trockenzeit bemerkbar.
Umgekehrt liegt der Fall, wenn unter bestimmten geographischen Voraussetzungen, wie beispielsweise in Südostbrasilien und Ostparaguay, im randtropischen und subtropischen Bereich Wälder zu finden sind, die große Niederschläge in weitgehend ausgeglichenen Mengen übers Jahr erhalten. Sie ähneln dann dem Tropischen Regenwald recht stark, sind aber sinkenden Temperaturen gegenüber relativ unempfindlich. Die Grenzwerte von 20 °C werden in diesen außertropischen Wäldern im Winterhalbjahr häufig unterschritten, wenn Kaltluft aus dem Süden bis über den Wendekreis äquatorwärts vordringt. Auch wenn damit noch kein Frost verbunden ist, bedeutet der starke Temperaturabfall dennoch eine erhebliche Einschränkung der Lebensmöglichkeiten für tropische Arten. Sind innerhalb der Tropen die Niederschlagsmengen die entscheidende Voraussetzung für die Entwicklung von Tropischem Regenwald, so ist die Vegetation außerhalb der Tropen von den großen Schwankungen der Temperatur bestimmt.
Nicht nur nach unten zu wirkt die Temperatur begrenzend; auch die große Hitze der Rand- und Subtropen während des Sonnenhöchststandes schränkt die Waldentwicklung ein. Die Regenwälder gehen in Saisonwälder mit Trockenzeiten über, in denen sich die Bäume auf die Hitze einstellen, und bei weiterem Abfall der Niederschlagsmengen und steigender Sommerhitze bilden sich Savannen. In diesen kann sich der Baumwuchs nur entlang von Flussläufen einigermaßen entfalten, da dort beständig gute Wasserversorgung gewährleistet ist. Der Wald greift dann die Flüsse aufwärts wie mit dünnen Fingern in die Savannenlandschaft.
Im Bereich der Wendekreise wird die Sommerhitze jedoch durch absinkende Luftmassen aus den inneren Tropen so verstärkt, dass sich auch die Savannenvegetation nicht mehr halten kann. Die anhaltenden Hochdruckwetterlagen mit ungebremster, durch keine hohe Luftfeuchtigkeit abgeschirmter Einstrahlung verschiebt das Verhältnis von Niederschlag und Verdunstung so sehr zugunsten der Verdunstung, dass sich Halbwüsten oder Wüsten ausbilden. Die Evapotranspiration, also der Wasserverlust durch Verdunstung, und die Möglichkeiten, Ersatz dafür aus dem Grundwasser oder aus den Niederschlägen zu entnehmen, wird zur zentralen Größe für das Pflanzenwachstum. Immer mehr Arten fallen aus, je ungünstiger die Verhältnisse werden. Das Klima ist weltweit in der Tropenzone verhältnismäßig einheitlich und maßgeblich bestimmt vom Austausch der Luftmassen zwischen Äquator und Wendekreisen.
Im äquatorialen Bereich verursacht die starke Einstrahlung der senkrecht stehenden Sonne die Erwärmung der feuchten Luftmassen. Sie steigen auf, kühlen sich dabei ab und geben die übermäßige Feuchtigkeit in Form von heftigen Niederschlägen ab. Die abgekühlte Luft fließt in der Höhe beiderseits des jeweiligen Sonnenhöchststandes in Richtung Wendekreise, wo sie in großem Umfang absinkt. Hatten die aufsteigenden Luftmassen das äquatoriale Tiefdrucksystem erzeugt, so verursachen die zurückfließenden nun beim Absinken die beständigen Hochdruckgebiete im Bereich der Wendekreise. So entstanden die Wüstengürtel der Erde. Im bodennahen Bereich der Wendekreise werden die Luftmassen nun vom Windsystem der Passate erfasst, die schräg zum Sonnenhöchststand hinwehen und damit die aufsteigenden Luftmassen wieder ersetzen. Wenn sie über den Ozean strömen, beladen sie sich mit Feuchtigkeit und bringen Regen in die Tropenzone der Kontinente.
Wie zwei gewaltige Walzenringe rollen auf diese Weise, im Jahreslauf mit dem Sonnenstand pendelnd, die Luftmassen im bodennahen Bereich zu den inneren Tropen, wo sie aufsteigen, sich abregnen und abkühlen, um daraufhin im oberen Walzenteil in Richtung auf die Wendekreise transportiert zu werden, wo sie absinken und wieder in das Passatsystem einbezogen werden. Da sich die Erde gleichsam unter ihrer Lufthülle wegdreht, strömen die Luftmassen nicht direkt senkrecht äquatorwärts, sondern schräg westwärts.
Dieses globale, Meer und Land miteinander verbindende Austauschsystem der tropischen Luftmassen ist für die Tropischen Regenwälder von größter Bedeutung. Es macht einen eminent wichtigen Zusammenhang zwischen Afrika und Südamerika sichtbar. Denn dieses System der Umwälzung von Luftmassen kann in der geschilderten Weise nur dort funktionieren, wo die Landmassenverteilung beiderseits des Äquators einigermaßen ausgeglichen ist. Dies trifft zu für Südamerika, für Afrika und für die südostasiatische Inselwelt mit den angrenzenden Kontinentalblöcken von Asien und Australien (Nordostteil), nicht aber für das tropische Südasien. Dort fehlt ein Gegenstück im Indischen Ozean.
Das hat zur Folge, dass die asiatischen Tropen im kontinentalen Bereich nicht durch das Passatsystem, sondern durch den Monsun mit Niederschlägen versorgt werden. Die große Landmasse Asiens heizt sich im Sommer so stark auf, dass sie feuchtigkeitsbeladene Luftmassen aus dem Raum über dem Indischen Ozean nicht äquatorwärts fließen lässt, sondern zum Festland hinlenkt. Diese verursachen dort die Monsunregen, die an Menge und Heftigkeit die Niederschläge in den südamerikanischen oder westafrikanischen Tropen erheblich übertreffen können. Im Stau des Himalaya gibt es Orte mit mehr als 10 Metern Niederschlagshöhen pro Jahr. Auf sintflutartige Regenfälle während der Monsunzeit folgt dann im Winterhalbjahr anhaltende Trockenheit, die Nordindien zu einer Halbwüste werden lässt, wo nach der Monsunzeit noch blühendes Land zu finden war. Unter derartig stark schwankenden Niederschlagsverhältnissen können sich keine Tropischen Regenwälder entfalten. Das Monsunklima begünstigt den »Dschungel«, der ganz anders aussieht und völlig unterschiedlich funktioniert.
Auch die Lage und die Richtung von Gebirgsketten nehmen Einfluss auf die Niederschlagsverhältnisse und damit auf die Ausbildung von Tropischem Regenwald. Stauen sich Luftmassen, fördert dies die Niederschlagstätigkeit, während fallende Luftmassen hinter Bergrücken Feuchtigkeit aufnehmen können und damit vorhandene Trockenphasen verstärken oder solche auslösen. Dieser Föhn-Effekt spielt auf der Lee-Seite der Gebirge eine bedeutende Rolle für die Ausbildung des Klimas. Allein diesem Umstand ist es zuzuschreiben, dass das Kongobecken ungleich weniger Niederschläge abbekommt als Amazonien. Der mächtige Riegel des Ostafrikanischen Hochlandes hindert feuchte Luftmassen vom Indischen Ozean, von Osten her einzudringen. Amazonien ist dagegen – genau in der günstigsten Richtung des Passat-Systems – zum Atlantik offen. Die Luftmassen stauen sich erst vor den Anden, 4000 Kilometer tief landeinwärts, wo sich denn auch die Zentren der Niederschlagstätigkeit in Amazonien befinden.
Die schon vom Ursprung her erheblich geringeren Feuchtigkeitsmengen, welche vom tropischen Südwestpazifik nach Nordostaustralien fließen und in Queensland einen schmalen Streifen Tropischen Regenwaldes entlang der Küste mit Niederschlägen versorgen, reichen bei weitem nicht aus, um nach Überwindung der gar nicht hohen Gebirgsbarriere dahinter gleichfalls noch ausreichende Niederschläge zu verursachen. Sie genügen nur für eine Trockenbusch- und Savannenvegetation.
Geographische Gegebenheiten modifizieren somit in starkem Maße die Verhältnisse in den inneren Tropen. Ihnen ist es zuzuschreiben, dass die Tropischen Regenwälder auf den Kontinenten in so ungleicher Verteilung vorhanden sind. Dennoch bilden sie zusammen einen weltumspannenden Großlebensraum, ein Biom; nämlich das Biom »Tropischer Regenwald«.
Tiefes Grün kennzeichnet diesen äquatorialen Gürtel aus Tropischem Regenwald. Aus dem Weltraum betrachtet, würde er sich ganz deutlich vom Braun der Savannen und vom hellen Ocker der Wüsten abheben. Das Gegenstück zu diesem dunklen Grün bildet das tiefe Blau der tropischen Ozeane.
Blau ist die »Wüstenfarbe des Meeres«, das Kennzeichen für sehr geringe Pflanzenproduktion im tropischen Ozean. Grün dagegen sind ganz andere Meeresgebiete: die kalten Meere in den Polarregionen und die Auftriebszonen von Tiefenwasser im Tropenbereich an der Westseite der Kontinentalblöcke. Besteht ein Zusammenhang zwischen diesen grünen Meeren und dem dumpfen Grün der feuchtwarmen Regenwälder, hat das jeweilige Grün etwas miteinander zu tun?
Dieser Vergleich liegt nahe – in beiden Fällen wird die grüne Farbe von Pflanzen hervorgerufen. Im grünen Wasser kalter Meere sind es winzig kleine Algen, welche die Färbung verursachen; in den Regenwäldern der Tropen sind es die immergrünen Kronen der Bäume, deren Blattwerk Myriaden winzig kleiner Gebilde enthält, in denen das Blattgrün steckt. Die Übereinstimmung geht tiefer, als man auf den ersten Blick annehmen würde. Denn die »winzig kleinen Gebilde«, die das Blattgrün in den Zellen der Blätter eingeschlossen haben, stammen von Algen ab, die vor mehr als einer halben Milliarde Jahren noch als freilebende Algenzellen existierten, bevor sie die Gemeinschaft mit anderen Pflanzen eingegangen sind. Die Fachsprache bezeichnet sie als »Chloroplasten«.
Sie stellen höchstwahrscheinlich symbiontische Blaualgen dar, die sich sogar unabhängig von den Zellen, in denen sie leben, durch Teilung vermehren. Wenn ihre entfernten Verwandten, die Meeresalgen, ihre größte Häufigkeit in den kalten Gewässern der Ozeane erreichen, dann sollte es dafür Gründe geben, aber mit dem Tropischen Regenwald ist kein offensichtlicher Zusammenhang erkennbar. Im Gegenteil: Kalte Meeresgebiete mit Wassertemperaturen um 4 °C und innertropische Klimaverhältnisse mit beständig hohen Temperaturen bilden einen so augenfälligen Gegensatz, dass man einen Zusammenhang auszuschließen geneigt ist, wenn es um die Beschaffenheit des Tropischen Regenwaldes als Großlebensraum geht.
Aber merkwürdig ist es dennoch, dass das Meer dort blau und nicht auch am grünsten ist, wo das Grün an Land seinen Höhepunkt erreicht, zumal beide, Meeresalgen und Landpflanzen, mit dem gleichen Farbstoff, dem Chlorophyll, in den gleichen Zelleneinheiten arbeiten. Dass das Blattgrün bei den Landpflanzen in eigenständigen Zellkörperchen, in Organellen, eingeschlossen ist, die wie Körperorgane in den Blattzellen tätig sind, macht den wesentlichen Unterschied gewiss nicht aus. Im Grunde genommen kommt es nur auf das Blattgrün selbst an. Die weltweite Verteilung der Chlorophyll-Häufigkeit spiegelt die Produktionsverhältnisse; genauer: die Primärproduktion. Von ihr hängen fast alle übrigen Lebensvorgänge einschließlich unserer eigenen ab. Sie lässt sich anhand des »Chlorophyll-Index« als vorhandene oder »stehende Ernte« (Biomasse) angeben. Die Chlorophyll-Dichte pro Flächeneinheit ist ein sehr zuverlässiges Maß für »stehende Ernte« und ihre globale Verteilung. Im Tropischen Regenwald erreicht sie die höchsten Werte. Der Chlorophyll-Gehalt kann auf mehr als 5 Gramm pro Quadratmeter ansteigen, und damit übertrifft er die übrigen Landlebensräume um das Fünf- bis Zehnfache.
Aber die algenreichen, kalten Meeresgebiete bringen es auf immerhin auch mehr als 1 Gramm pro Quadratmeter. Dieser Wert entspricht dem Mehrhundertfachen der Chlorophyll-Dichte in blauen, tropischen Ozeanen. Sieht man von den regionalen Auftriebsgebieten an den Westküsten von Südamerika (Humboldt-Strom) und Südafrika (Benguela-Strom) sowie einigen weiteren, weniger bedeutenden Auftriebsgebieten in temperierten oder warmen Meeren ab, so ergibt sich ein klarer, globaler Trend. Die Chlorophyll-Dichte in den Meeren nimmt von den polaren Zonen kontinuierlich zur Tropenzone hin ab. Die größte Chlorophyll-Dichte erreicht das Weltmeer im Gürtel um die Antarktis und in den Gebieten zwischen Neufundland und Island sowie im Nordpazifik vor dem Übergang zum Eismeer.
An Land verläuft die Kurve der Chlorophyll-Dichte pro Flächeneinheit deutlich anders. Sie liegt sehr niedrig auf den polaren Randzonen mit Tundrabewuchs. Zu den gemäßigten Breiten hin steigt sie kräftig an und erreicht in den großen Gürteln landwirtschaftlicher Nutzflächen ein vorläufiges Maximum. Daraufhin fällt die Kurve wieder deutlich ab und durchläuft ein Minimum in der Wüstenzone. Danach setzt erneut ein starker Anstieg ein, der zum Höhepunkt im Tropischen Regenwald führt.
Dieser weltweite Verlauf verwundert nicht, aber gleichzeitig verschleiert er einen wichtigen, ja grundlegenden Unterschied zwischen Land und Meer: Von der vorhandenen Menge Blattgrün kann man nicht darauf schließen, dass sie auch eine ihrer Menge entsprechende Leistung entfaltet.
Das wäre nur dann der Fall, wenn die Produktionsbedingungen überall weitgehend die Gleichen wären, also wenn sich die Großlebensräume der Erde nicht in Temperatur, Einstrahlungsstärke der Sonne und Verfügbarkeit von Nährstoffen unterscheiden würden. Allein schon die Temperatur sollte einen starken Einfluss auf die Leistung der Pflanzen entfalten. Die chemischen Reaktionen laufen temperaturabhängig ab. So steigt die Reaktionsgeschwindigkeit nach der vant’Hoff’schen Regel bei einem Temperaturanstieg um 10 °C auf das Zwei- bis Dreifache an – und umgekehrt. Das gilt in etwas abgeschwächter Weise auch für die biochemischen Reaktionen in den Zellen der Pflanzen und der Tiere. Eine Temperaturerhöhung um 10 °C bewirkt ungefähr eine Verdopplung der Reaktionsgeschwindigkeiten. Wenn zwischen den kalten Ozeanen und dem Kronendach des Tropischen Regenwaldes drei solcher Zehnerschritte im Temperaturunterschied gegeben sind, müssten die Geschwindigkeiten der biochemischen Abläufe infolgedessen den etwa sechsfachen Wert ausmachen. Nimmt man den Unterschied in der Chlorophyllmenge, nämlich das Fünffache des Wertes kalter, »grüner« Meeresgebiete, in die Kalkulation mit hinein, so steigt der Gesamtunterschied auf das Dreißigfache. Der Tropische Regenwald müsste also pro Flächeneinheit dreißigmal mehr leisten als die besten, die produktivsten Meeresgebiete.
Die Messungen haben ergeben, dass dies nicht der Fall ist. Aber was ist überhaupt die Leistung des Chlorophylls? Es katalysiert die Fotosynthese, und seine Leistung ist recht einfach an der Menge des freigesetzten Sauerstoffs zu messen. Die Grundlage dafür bietet die Fotosynthese-Gleichung:
Hierbei ist das Chlorophyll maßgeblich beteiligt. Es fängt die Energie des Sonnenlichtes mit seinem antennenartig gebauten Molekül ein und überträgt sie in feinen Abstufungen auf jenen chemischen Grundprozess, der aus 6 Molekülen Kohlendioxid und 6 Molekülen Wasser ein Zuckermolekül, also eine organische Verbindung, aufbaut und dabei 6 Moleküle Sauerstoff abgibt. Die Menge des freigesetzten, leicht nachweis- und messbaren Sauerstoffes dient daher als Bemessungsgrundlage für die Leistung der Fotosynthese.