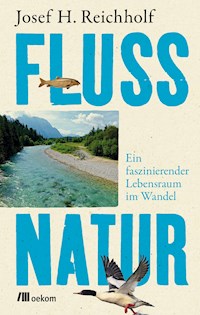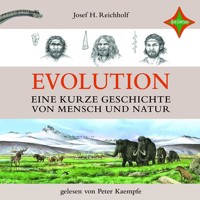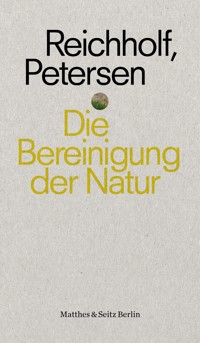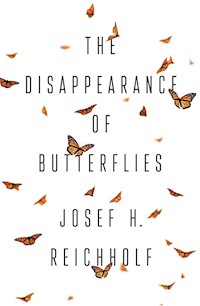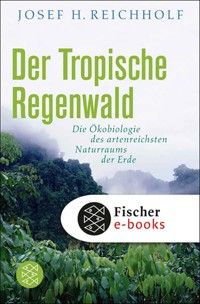Einführung
Spaziergänge an Flüssen
Sommerabend am Wildfluss
Flammendes Goldrot des Sonnenuntergangs schimmert, gespiegelt von Wolken, auf dem Wasser der Isar. Murmelnd schießt es im flachen Bogen vorbei an einer mächtigen Kiesbank. Das starke Hochwasser von 2002 hatte diese aufgeschüttet. Eine fast fünf Meter hohe Steilwand war dabei aus dem Ufer gegenüber herausgebrochen. Dort sitzen wir und genießen die Abendstimmung. Mit der Strömung zieht etwas kühlere Luft durchs Tal. Der Tag war sommerlich warm, nahezu mediterran, und sehr lang. Denn es ist die Zeit der Sommersonnenwende. Einige Schwalben eilen mit zackigem Flug flussaufwärts. Von den Fichtengipfeln am jenseitigen Ufer kommt der Gesang einer Amsel. Ziemlich lustlos hört er sich an. Die Intensität der Vogelgesänge nimmt ab, wenn der Sonnenbogen seinen Höhepunkt überschritten hat. Nur die Lieder der Rotkehlchen klingen genauso perlend ruhig wie seit Anfang März, als sie zu singen angefangen hatten. Von Zeit zu Zeit löst sich ein Stein aus dem eiszeitlichen Schotter, an dem tief unter unseren Füßen die Isar auch mit kleinen Wellen weiter nagt. Jeder Laut, nicht nur das Klicken der Steine, fällt auf in dieser Abendstille. Kaum zu glauben, dass man hier noch fast an der Peripherie der Millionenstadt ist. Erreichbar bei einer Abendtour mit dem Fahrrad.
Jetzt fahren keine Schlauchboote oder Kajaks mehr die Isar hinunter. Bei schwindender Sicht wird es auf der Wildflussstrecke riskant. Ein Stockentenpaar lässt sich von der Strömung flussabwärts tragen. Das Weibchen quäkt laut, als es uns sieht. Das Männchen sagt nichts. Die Enten sind Menschen gewohnt. Wie auch die Gänsesäger, von denen wir heute mehrere Weibchen mit Jungen gesehen hatten. Sie wissen, dass sie von den Sonnenanbetern am Ufer nichts zu befürchten haben.
Auch nicht von den vielen Booten, die bei schönem Wetter ab dem späten Vormittag den Fluss herabkommen. Mitunter verbreiten sie viel Lärm, wenn die Insassen schon trunken sind, allerdings nicht von der großartigen Szenerie des Flusses. Menschen, die Ruhe und Erholung am Wildfluss suchen, empfinden das Gegröle ungleich störender als die Enten und viele andere Wasservögel. Ihre Feinde nähern sich möglichst unhörbar. Gefährlich wird es, wenn sie ganz plötzlich erscheinen. Darüber hatten wir uns noch unterhalten, als am späten Nachmittag die letzten Schlauchboote mit ziemlich angeheiterten Insassen vorbeifuhren.
»Flussidylle« in der Großstadt: Unweit des Zentrums ist die Isar naturnah geworden und hat sich zum beliebten Naherholungsgebiet entwickelt.
Welche zeitlichen Beschränkungen wären nötig zum Schutz der seltenen Vögel hier im Naturschutzgebiet? Wie stark wird der Erholungsbetrieb noch weiter zunehmen? Wird die Renaturierung der Isar bis nach München hinein bloß mehr Kulisse schaffen, weil der Flussnatur der Druck der Menschenmassen zu groß wird? Wann hört Naturgenuss auf, Genuss zu sein, wenn zu viele Menschen anwesend sind? Deckt sich das, was wir als störend empfinden, objektiv genug mit Befunden zur Beeinträchtigung der Natur? Verstehen wir die Flussnatur gut genug, um brauchbare Konzepte für den Umgang mit ihr entwickeln zu können? Gut Gemeintes wird nicht immer auch gut. Das lehrt die Erfahrung, die man so nach und nach sammelt. Manches fachlich überzeugend wirkende Konzept muss man dann relativieren. Oder aufgeben.
Darüber wollten wir uns an diesem selten schönen Frühsommerabend aber nicht mehr den Kopf zerbrechen. Die Minuten der Stille zu genießen, die sich über das stete Rauschen des Wassers gelegt hatte, war wichtiger. Gerade wollten wir uns auf den Heimweg machen, als Insekten am Ufer mit aufglitzernden Flügeln hochstiegen und langsam, wie zu schwach dafür, emporstrebten, bis sie mehrere Meter über dem Wasser waren, in unserer Sitzhöhe oder noch etwas höher. Eintagsfliegen fingen zu schwärmen an. Nichts Besonderes zu dieser Zeit. Sind es die größeren oder die großen Arten, sind sie nicht zu übersehen. Weil sie so markante Tänze vollführen: Einen halben oder einen Meter schwingen sie sich in die Höhe und schweben dann in sanftem Bogen die gleiche Strecke nieder. Und wieder hoch. Und nieder … Dutzende, Hunderte mitunter, vollführen in lockerem Schwarm diese Tanzflüge. Doch an diesem Abend bahnte sich offenbar mehr an. Die aufsteigenden Eintagsfliegen sammelten sich nicht zu Tanzgruppen. Sie begannen flussaufwärts zu fliegen. Höher als sonst, mindestens in Höhe der Weidenbüsche, die am Ufer wachsen, dann noch höher, vielleicht zehn Meter über dem Fluss. Minuten nach Beginn dieses Fluges erfüllen Tausende, Zehntausende, vielleicht Millionen Eintagsfliegen den Luftraum über der Isar. Wie ein Fluss, der über dem Fluss aufwärtsströmt, streben sie in immer dichter werdenden Massen dahin, silbrig glänzend im Abendlicht. Das Schauspiel wurde atemberaubend. Wir konnten kaum fassen, was sich unseren Augen darbot. Wir schauten und schauten, bis uns die beginnende Dunkelheit dazu zwang, das Isarufer zu verlassen und den Heimweg zu beginnen. Morgen würden wir wiederkommen, um den Fluss der glänzenden Wasserfliegen nochmals zu erleben. Hofften wir.
Anderntags wussten wir, dass es ein einmaliges Schauspiel war. Nichts deutete 24 Stunden später darauf hin, was am Vorabend geschehen war. Der große Schwärmflug war vorbei. Vielleicht werden wir nie wieder das Glück haben, zum einzig richtigen Zeitpunkt an der passenden Stelle zu sein. Starke Flüge von Eintagsfliegen wird es immer wieder mal geben. Aber dass sie diese mit der Wanderung flussaufwärts verbinden und dabei zum lebendigen Fluss über dem Wasser werden, bleibt die große Ausnahme. Nötig ist sie, denn mit der Zeit würde die Strömung unweigerlich die Larven flussabwärts verlagern, bis es irgendwann nach Jahren keine mehr oben im Fluss gäbe. Die Wanderung flussaufwärts muss stattfinden. Aber sie entzieht sich einer Vorhersage. Wie so viel in der Dynamik der Flussnatur unvorhersehbar ist. Nur ein weiteres Mal in zwanzig Jahren waren wir zur Stelle, als Eintagsfliegen an einem Sommerabend in großen Mengen schwärmten. Doch da wanderten sie nicht, sondern tanzten nur.
An der Isar in München
Auf die Frage, was München charakterisiert, gibt es recht unterschiedliche Antworten, je nachdem, was die Gefragten selbst für attraktiv und wichtig halten. Die Isar wird oft mit dabei sein. Denn sie ist nicht austauschbar, wie das Bauwerke, Museen, Biergärten oder andere menschengemachte Besonderheiten sind. Als Fluss teilt die Isar die Stadt nicht wirklich. Dazu ist sie zu klein. An vielen Stellen kann man sie durchwaten, wenn man möchte. Und wenn sie nicht gerade Hochwasser führt, sieht die Isar eher lieblich aus, obgleich sie als Wildfluss, der sie seit Jahren wieder sein darf, »wild« wirken sollte. Die Münchner und viele Gäste nutzen die Isar vom Frühjahr bis weit in den Herbst hinein als Erholungsgebiet. Wovon man sich erholen muss oder möchte, steht nicht zur Debatte. Ein Isarnachmittag oder -abend gehört zur Lebensqualität. Vor allem seit der Renaturierung, die so viele neue attraktive Plätze am Fluss geschaffen hat. Kein Vergleich mehr mit dem früheren begradigten, weitgehend kanalisierten Zustand.
Doch selbst diesen fanden die Münchner gar nicht so übel, die Menschen wie auch die tierischen Mitbewohner der Stadt. Es ließ sich viel erleben an den Ufern, bei jedem Spaziergang, auch nachts, wenn die Beleuchtung der Brücken und der Uferstraßen das Geschehen sichtbar machte. Da schwammen Biber kreuz und quer, stiegen ans Ufer, schüttelten sich das Wasser aus dem Fell und fingen an, Weidentriebe abzunagen. Mit mehreren solchen zwischen den Zähnen schwammen sie gelegentlich zu einer anderen Stelle, beispielsweise an der Insel, auf der das Deutsche Museum steht, und fügten die Zweige zu ihrer Burg, einen mehrere Meter breiten und bis eineinhalb Meter hohen Bau, oder nagten einfach vor dieser die Rinde ab. Oft schauten sie am Abend zuerst an einer bestimmten Uferstelle nach, ob von dort wieder so Leckeres kommt wie Karotten oder reife Äpfel. Denn die Münchner Biber haben Fans, die kommen und auf die großen Nager warten. Sie bringen ihnen solche Leckerbissen mit.
Von 2000 bis 2011 wurde die Isar im Münchner Stadtgebiet unter dem Motto »Neues Leben für die Isar« naturnah gestaltet. Totholz und »Störsteine« sorgen für vielfältige Flussstrukturen.
Hier, mitten in der Großstadt, bedroht lediglich die Wucht eines Hochwassers die Biber. Zwangsläufig schießt es am Deutschen Museum wie durch eine Düse, weil die Bebauung zu nahe an den Fluss gerückt ist. Auch die Renaturierung konnte dies nicht mehr rückgängig machen. Starke Hochwasser, wie sie alle zehn bis zwanzig Jahre kommen, zerstörten immer wieder die Biberburgen. Die Biber gaben deswegen nicht auf. Auch an naturbelassenen Flüssen sind sie den Gefahren von Fluten ausgesetzt. Die vielen Jahre günstiger Wasserführung gleichen hochwasserbedingte Verluste im Biberbestand aus. In der Großstadt zu leben war und ist für Spezialisten, wie es die Biber sind, kein wirkliches Problem. Entscheidend ist vielmehr, dass sie dort leben dürfen. Die Stadtbevölkerung ist ihnen zugetan. Am Land draußen ist dies keineswegs immer der Fall. Wie auch bei vielen anderen Tieren.
An der Isar in München ließen sich schon vor mehr als einem halben Jahrhundert die seltenen Kolbenenten beobachten, deren Erpel im Prachtkleid einen fuchsroten Kopf mit semmelgelbem Scheitel entwickeln. Der rote Schnabel sticht davon ab wie frisch lackiert. Niemand verfolgte die Kolbenenten auf den Stadtgewässern. Sie konnten die Scheu vor den Menschen vermindern, wie auch zahlreiche andere Arten von Wasservögeln. Zu ihrer Beobachtung muss man nicht mit Fernrohr an die Isar. Das bloße Auge tut es häufig schon, wenngleich ein Fernglas hilfreich ist und mehr Details zeigt. Futterzahm brauchen die Enten nicht zu sein. Den Gänsesägern auf der Isar, deren Erpel aussehen wie ein Designerentwurf, wenn sie im Winter und Frühling das Prachtkleid tragen, bringt niemand lebendige Kleinfische oder Sardinen mit, um sie zu füttern. Die Säger suchen sich ihre Nahrung selbst, auch ihre Jungen schon, die im Stadtgebiet unbehelligt von Verfolgungen heranwachsen. Die Erfolge Junge führender Gänsesägerweibchen sagen den Kundigen, ob es im betreffenden Jahr viele Kleinfische gibt oder ob es wenige sind, weil ein Hochwasser die Isar zu stark ausgeräumt hat. Der Fischbestand wird dennoch nicht dezimiert, wie die Angler meinen, die die Gänsesäger in der freien Natur nicht dulden wollen.
Auch Eisvögel und Wasseramseln schädigen die Kleinfischbestände nicht. Den amselartig kugeligen Spezialisten kann man von den Brücken oder vom Ufer dabei zusehen, wie sie sich ins Wasser stürzen, untertauchen und am Boden umherlaufen. Sie suchen nach den Larven von Eintagsfliegen, Köcherfliegen, Kleinkrebsen oder nach Kleinfischen. Häufiger als die Wasseramseln sind die gelbbäuchigen Stelzen, die immer mit ihrem langen Schwanz wippen, am Ufer direkt an der Wasserkante entlangtrippeln und Ausschau halten, was an Insekten und anderem Kleingetier angeschwemmt wird. Beide Arten, die schwarzweiße Bachstelze und die gelbbäuchige Gebirgstelze, leben an der Isar in München – wie auch in anderen Städten, ob groß oder klein, die an Flüssen liegen.
Im Herbst kommen Möwen in die Stadt und bleiben zum Überwintern. In München sind dies nahezu ausnahmslos Lachmöwen. Die erheblich größeren Mittelmeermöwen, die sich von den sehr ähnlichen Silbermöwen der Städte an der Nordseeküste an den gelben Beinen unterscheiden lassen, sind als Wintergäste immer noch recht selten. Die Lachmöwen machen Schlafplatzflüge. Sie kommen frühmorgens in die Stadt, wie die Pendler zur Arbeit, und verlassen sie am späten Abend wieder. Früher, vor allem in den 1960er- und 1970er-Jahren, waren es Hunderte, manchmal mehr als tausend Lachmöwen, die München zum Überwintern aufgesucht hatten. Mit dem Schwinden der Brutbestände der Lachmöwen in weiten Teilen Europas haben die »Wintermöwen« abgenommen. Manche Herkunft war ermittelt worden, weil die Möwen beringt waren und die Ringnummer dank der Nähe abgelesen werden konnte. Vögel halten sich eigentlich immer an der Isar in München auf. Zu jeder Jahreszeit. München ist keine Ausnahme. Bird watching lohnt an Stadtgewässern.
Wasservögel am unteren Inn
Grüne Köpfe wurden hochgerissen und auf den Rücken geschleudert, weiße Bäuche blitzten auf. Überall auf der weiten Wasserfläche. Die Schellenten balzten. Zu Hunderten. Über viertausend. Die Weibchen fielen mit ihren kleineren braunen Köpfen weniger auf. Aber die Zählung ergab, dass die Erpel tatsächlich klar überwogen. Damals, im März, wimmelte es nur so vor Enten. Denn auch Reiherenten, die Erpel schwarz mit weißem Bauch und kleinem Federschopf am Hinterkopf, Tafelenten, deren Erpel ein braunes Kopfgefieder tragen, und die überall häufigen Stockenten waren zu Tausenden da. Kleine Krickenten flogen in Gruppen um die Insel und gaben die hellen »krrick, krrick«-Rufe von sich, die ihnen ihren Namen eingetragen haben.
Der Inn (links) mit dem Mündungsdelta der Salzach im bayerisch-österreichischen Vogelschutzgebiet »Europareservat Unterer Inn«.
Am Spätnachmittag kamen Schwärme von Lachmöwen an. Als es zu dämmern begann, bildeten sie weiße Flächen auf dem Wasser, so dicht an dicht schwammen sie. Die flachen, wenig durchströmten Stellen wählten sie als Schlafplatz. Den Tag hatten sie draußen auf den schneefrei gewordenen Fluren verbracht und nach Würmern gesucht. Mit rauen Schreien und schwerem Flügelschlag wuchteten einige Graureiher vorüber. Die großen Vögel lösten keine Panik unter den Enten aus. Diese kannten die Harmlosigkeit der Reiher. Flötende Rufe kündeten das Eintreffen von Brachvögeln an. Auch sie hatten tagsüber auf den Fluren, vor allem auf den Wiesen, nach Nahrung gesucht und fielen nun auf Schlickflächen am Rand einer großen Insel zum Übernachten ein. Dort trippelten bereits einige Kampfläufer; langbeinige Watvögel (Limikolen), die vornehmlich an der Grenze von Land und Wasser nach Nahrung suchen. In wenigen Wochen, ab Ende April, fechten sie ihre Kämpfe auf speziellen Balzplätzen aus. Wie einst bei Ritterspielen. Hier am unteren Inn taten sie dies nur andeutungsweise. Ihre Brutgebiete liegen viel weiter im Norden und Nordosten. Der untere Inn ist für sie wie für viele andere Wasservögel eine Raststation auf dem Frühjahrszug. Hier können sie weitgehend ungestört verweilen, Nahrung suchen und gleichsam auftanken für die noch zu bewältigende Strecke, bis sie am Ziel sind. Irgendwo in Nord- und Nordosteuropa liegt es, bei manchen Arten jenseits des Polarkreises.
Während Lachmöwen, Schwarm auf Schwarm, schier unablässig dicht über dem Wasser ihrem nun in seiner weißen Masse von Vogelkörpern weithin sichtbaren Schlafplatz zuflogen, brausten Schwärme von Staren heran. Sie hielten sich über der Höhe der Uferbäume, drehten einige Runden über der Insel, die offensichtlich ihr Ziel war, und ließen sich mit Aufrauschen plötzlich auf das Weidengebüsch fallen, das diese bedeckt. Es war bereits schwarz vor Staren, und es kam immer mehr. Wir hatten Mühe, die Größe der Schwärme zu schätzen. An ein Zählen war nicht mehr zu denken. Vögel waren überall in der Luft. Wichtig war es, sich bei den Registrierungen nicht ablenken zu lassen von anderen ins Blickfeld geratenen Schwärmen oder von Rufen seltenerer Arten. Dutzende verschiedener Wasservogelarten waren hier. Der Frühjahrszug gehört zu den interessantesten Zeiten am Fluss. Da ist die Vielfalt groß. Die Vögel, zumal die Enten, tragen mit ihrem Brutkleid das Prachtgefieder, das sie auszeichnet und eindeutig charakterisiert.
Von all dem Geschehen in der Luft unberührt, schwamm eine Bisamratte vom Ufer zur Insel hinüber. Mit ihrem dünnen Schwanz seitwärts schlängelnd, strebte sie dahin und zog einen im Abendlicht aufschimmernden Wellenkeil durchs gemächlich dahinströmende Wasser. Ein kurzer Blick durchs Fernglas bestätigte, dass es kein junger Biber war und auch kein Fischotter. Vielleicht tauchte sie draußen an der Insel nach Muscheln, um diese am Ufer zu verzehren. Ihre Fressplätze sind an den vielen Muschelschalen leicht zu erkennen. Zahnmarken an den Schalenrändern beweisen, dass die Bisamratten die Muscheln erbeutet hatten.
Noch immer kamen Lachmöwenschwärme an. Weit über Zehntausend waren nun am Schlafplatz versammelt. Es könnten noch mehr werden. Aber nun ließen sie sich nicht mehr zählen; nicht einmal mehr schätzen. Am nächsten Morgen noch vor Tagesbeginn musste man wieder hier sein, um den Abflug zu erfassen. Aber das geht sehr schnell und wird entsprechend ungenau. Bis tief in die Nacht, vielleicht die ganze, war das Möwengeschrei kilometerweit zu hören. Als ich die Abendzählung beendet hatte, übertönte das markante Klingeln Hunderter und Aberhunderter Schellentenflügel kurz den Möwenlärm.
Die Schellenten flogen einige Kilometer flussaufwärts, wo sie zum Grund des Flusses hinabtauchten, um dort nach Larven großer Wasserinsekten zu suchen. Zum Tauchen nutzen sie die Strömung und fliegen dazu lieber ein gutes Stück flussaufwärts, als unter Wasser dagegen anzukämpfen. Der Flug kostet sie weniger Energie. Und das Tauchen lohnt nur, wenn die Bestände der Kleintiere im Bodenschlamm oder an den Steinen im Flussgrund groß genug sind. Deshalb verhalten sich die Stockenten ganz anders als die Schellenten. Sie können nicht tauchen, nur gründeln, das heißt den Kopf ins Wasser strecken und versuchen, in der für sie erreichbaren Tiefe zu nutzen, was zu finden ist. Doch wenn in den Bergen, in tieferen Lagen, die Schneeschmelze einsetzt, nimmt die Wasserführung des Inns zu. Uferzonen, die während der winterlichen Niedrigwasserzeit trockengefallen waren, werden wieder überflutet. Für die Stockenten bieten sie zu wenig Nahrung. Also fliegen diese abends hinaus zu Altwässern in den Auen und Schmelzwassertümpeln in den Niederungen, um dort im Schutz der Dunkelheit nach Nahrung zu suchen. Nahrungsgründe, Ruheplätze und Rückzugsmöglichkeit bei Gefahr am Tag überlagern sich während der Zugzeiten der Vögel am Fluss.
Manche, wie die Stare, kommen nur, weil die Inseln sichere Schlafplätze bieten. Andere, wie die Schellenten, nutzen die Zwischenraststation auf dem Zug zu ihren nordischen Brutplätzen richtiggehend zum Auftanken. Am Tag fliegen Krähen und Dohlen herbei, um im Flachwasser der Inselränder zu baden. Jede der zahlreichen Vogelarten nutzt den Fluss auf spezielle Weise. Wie auch die Bisamratten und andere Säugetiere. Und wie so oft war ich fast berauscht von der Fülle und der Intensität des Geschehens, das sich mir hier bot.
Dies alles musste in der Vergangenheitsform geschrieben werden. Denn das Geschilderte charakterisiert die Verhältnisse in den 1970er-Jahren. Seither hat sich sehr viel geändert. Die Mengen der Wasservögel gingen stark zurück. Die Zusammensetzung des Artenspektrums verschob sich in bezeichnender Weise. Gegenwärtig ist damit zu rechnen, dass ein patrouillierender Seeadler Panik unter den Wasservögeln auslöst. Auch sind weit mehr von Fischen lebende Arten vorhanden als vor einem halben Jahrhundert, aber in viel geringerer Häufigkeit. In der Abenddämmerung sind nun Biber weit eher zu sehen als Bisamratten. Möwengeschrei dringt im März nicht mehr bis zu den Dörfern hinaus ins Inntal. Wenn ich die Befunde von früher vornehme, wirken sie, als stammten sie aus einer ganz anderen Gegend. Der Untere Inn steht unter Naturschutz. Der fast überall an den Gewässern ausufernde Erholungsbetrieb wirkt hier nicht so stark, speziell zu den Zugzeiten der Wasservögel. Hätte ich die Veränderung, die ganze Entwicklung, nicht selbst miterlebt und mitverfolgt, würde ich kaum glauben können, dass »Früher« und »Heute« einen festen, gut nachvollziehbaren Zusammenhang haben.
Mühlenbäche als Kulturschöpfungen
Szenenwechsel nach Nordhessen, hinein in den Bereich der Mittelgebirge mit ihren Bachtälern. Anfang Mai sind sie am schönsten. Zahlreich gibt es sie noch, die kleinen Bäche, die sich durch die Täler schlängeln. An den Ufern stehen Gruppen von Erlen oder Traubenkirschen, mitunter auch ziemlich geschlossene Reihen von Bäumen, begleitet von niedrigem Buschwerk. Wiesen grenzen an. Sie füllen das Tal und verleihen ihm ein unvergleichlich zartes Frühjahrsgrün. Schlüsselblumen blühen in Gruppen. Stellenweise bilden sie gelbe Säume vor den Bäumen am Bach, auch an den Hängen, wo Wasser austritt und Seggen dies andeuten. Veilchen finden wir erst bei näherer Betrachtung, Lerchensporn fällt schon aus Dutzenden Meter Distanz auf. An den als Büsche oder Bäume aufgewachsenen Traubenkirschen wiegen sich schaumweiße Blütentrauben im sanften Talwind.
Der Bach führt wenig Wasser. Die Schneeschmelze, die ihn hatte anschwellen lassen, ist längst vorüber. Nun hängt es von den Regenfällen ab, wie sich die Wasserführung entwickelt. Die Talwiesen können überflutet werden. Sie wurden das auch in früheren Zeiten und blieben deshalb Wiesen. Ansonsten hätte man sie längst umgewandelt in ertragreichere Äcker. Mit schrillem Pfiff und kurz blau aufblitzend, schießt ein Eisvogel vorüber. Er hält sich nicht an den kurvigen Verlauf des Baches, sondern nutzt Abkürzungen für eine ziemlich geradlinige Flugstrecke. Irgendwo weiter bachauf- oder bachabwärts wird seine Bruthöhle in der Uferwand sein. Solche Stellen sind selbst an naturbelassenen Bächen selten. Und stets hochwassergefährdet, weil sie nicht hoch genug über dem Wasser liegen. Die schnell ankommenden Fluten können auch die Nester der Wasseramseln und der Gebirgstelzen vernichten, wenn diese nicht hoch genug angelegt werden können.
»Hoch genug«, das gibt es an den Mühlen. Und Mühlen gibt es (oder gab es) fast überall an den Mittelgebirgsbächen. Die Wehre, das Mühlengebäude selbst oder die Häuser in unmittelbarer Nähe bieten günstige Nistmöglichkeiten für diese Ufervögel. Sie sind die charakteristischen Vögel der Bäche; mehr als der Eisvogel, für den zu selten größere Steilwände vorhanden waren. Und oft ist das Bachwasser auch zu wirbelig für seine Jagdmethode. Der Mühlenteich bot und bietet günstigere Bedingungen, wo es ihn noch gibt. Dort steht das Wasser, dort ist es klar, und die Sicht reicht tief genug hinein für einen erfolgreichen Tauchstoß nach den Fischchen.
Eisvogel und Wasseramsel
Zwei Vogelarten charakterisieren Bäche und kleinere Flüsse in besonderer Weise, der Eisvogel Alcedo atthis und die Wasseramsel Cinclus cinclus. Beide sind Besonderheiten. Der Eisvogel ist so schön, dass er »fliegender Edelstein« genannt wird. Türkisgrün mit Blau glänzt sein Gefieder auf der Rückenseite, rostbraun der Bauch. Der Schnabel ist lang, so lang wie der Kopf. Der Eisvogel fliegt pfeilschnell und gibt dabei häufig einen schrillen Pfiff von sich. Von einem Ästchen über dem Bach oder aus kurzem Rüttelflug heraus stürzt er sich ins Wasser. Und kommt mit einem silbrig blinkenden Fischlein im Schnabel empor. Nicht immer, nur in der Hälfte der Fangversuche, auch wenn es genug Kleinfische gibt. Sein Erfolg wird damit zum Maß für die Qualität des Baches oder Flusses für Aufkommen und Heranwachsen von Fischbrut. Die Zeiten, in denen sogar die kleinen Eisvögel als Fischräuber verfolgt und vernichtet wurden, sind zumindest in Mitteleuropa weitgehend vorüber. Seit Langem stehen sie unter Naturschutz, was jedoch nicht viel besagt. Die Grundeinstellung der Fischerei zu Tieren, die ihrer Natur gemäß von Fischen leben, muss sich ändern. Beim Eisvogel ist dies im Gang. Eine Teichwirtschaft, die für sich werben möchte, tut dies am besten mit dem fliegenden Edelstein.
Dass Eisvögel trotzdem Raritäten (geblieben) sind, liegt daran, dass sie kaum irgendwo Möglichkeiten zum Nisten finden. Sie graben meterlange Röhren in steile Uferabbrüche und bauen das Nest in einer Kammer am Ende unter den dort wohltemperierten und vor Nestfeinden geschützten Verhältnissen. Theoretisch. In der Praxis hat ihnen der Wasserbau diese Möglichkeiten genommen. Bäche und Flüsse dürfen nicht einfach ihrem natürlichen Lauf folgen und dabei Ufer anschneiden. Selbst wenn sie wieder rückgebaut werden, wird darauf Wert gelegt, dass die Ufer »fest« bleiben. Dann sieht dies nach außen zwar schön »natürlich« aus, ist es aber nicht wirklich. Sogar wenn der Uferbereich kommunaler Grund ist, werden Bachschlingen und Flussmäander befestigt. Und oft auch abgeschrägt, damit niemand ins Wasser fällt, der sich unvorsichtigerweise an die Uferkante hinbegeben hat. Es reicht, wenn dies in Jahrhunderten einmal passieren könnte, um die behördliche Akzeptanz eines steilen Naturufers zu verhindern. Leider gilt dies auch für aufgelassene Kiesgruben. In diesen gäbe es oft beste Möglichkeiten für den Eisvogel und für zwei andere, ursprünglich an Gewässer gebundene Vogelarten, die Uferschwalbe Riparia riparia und den tropisch bunten Bienenfresser Merops apiaster. Am ehesten haben sie Chancen, an den Steilwänden von Kies- und Sandgruben zu brüten, wenn in diesen noch abgebaut wird. Da sind die Gruben gesperrt für die allgemeine Zugänglichkeit.
Einer ähnlichen Problematik ausgesetzt ist die Wasseramsel Cinclus cinclus. Dieser rundliche Singvogel, bräunlich gefiedert und etwas kleiner als eine Amsel, trägt einen großen weißen Latz an der Vorderbrust. Wasseramseln leben an Bächen und kleinen Flüssen. Sie können ins Wasser eintauchen und am Boden unter Ausnutzung des Strömungsdruckes, der auf dem schräg gestellten Rücken lastet, nach Larven von Wasserinsekten suchen oder kleine Fische fangen. Ganz ohne Schwimmhäute an den Zehen, wie sie für Schwimmvögel typisch sind, schwimmt die Wasseramsel dazu mithilfe der Flügel.
Wasseramsel Cinclus cinclus
Bei aller Unterschiedlichkeit zum Eisvogel hat sie ein sehr ähnliches Problem: Nistplätze am Wasser sind rar. Die Wasseramsel baut zwar selbst Nester, große, kugelige Gebilde aus Moos und Halmen, aber dafür benötigt sie Nischen und Winkel, die so hoch liegen, dass sie außer bei starkem Hochwasser nicht überflutet werden. Begradigte, abflussertüchtigte Bäche eignen sich nicht mehr. Renaturierte auch nur, wenn höhere Uferabbruchkanten zugelassen oder wiederhergestellt werden. Dies funktioniert mehr schlecht als recht.
Vogelschützer fanden einen Ausweg mit der Anbringung von Nistkästen unter Brücken, die dort gut geschützt sind. Dafür sind jedoch Genehmigungen nötig, so sehr achten die Wasserwirtschaftsämter nach wie vor auf die rasche Ableitung des Wassers aus der Landschaft. »Rückstau« durch einen Wasseramsel-Nistkasten darf nicht passieren. Wie beim Eisvogel beleuchtet dies, wie wenig die formale Unterschutzstellung »wert« ist, wenn sie schon durch Lächerlichkeiten außer Kraft gesetzt werden kann. Dabei wäre die kleine Wasseramsel mit ihren Vorkommen und ihrer Siedlungsdichte pro Kilometer Bach- oder Flusslauf der ideale biologische Indikator für die Qualität der Lebensverhältnisse im Wasser. Denn ihre Nahrung setzt sich aus einer Vielzahl von Wasserinsekten und anderen Kleintieren zusammen, die all das »zusammenfassen«, was auf die kleinen Fließgewässer einwirkt. Weit besser als (eingesetzte) Fische drücken Wasseramseln den Gewässerzustand aus.
Im Mühlenteich wimmelt(e) es vor Kleinfischen. Gab es eine günstige Brutwand zum Graben einer Röhre, die meterweit ins Ufer reicht, stellte sich mit Sicherheit ein Eisvogelpaar ein. Auch weil der Mühlenteich schon auf Dutzenden Meter Strecke ungleich mehr Nahrung bietet als der Bach auf Kilometer Länge. Im Mühlenteich tummeln sich Tausende schwarzer Kaulquappen. Erdkröten hatten hier im März ihre Eischnüre abgesetzt. Anders als so mancher natürliche Tümpel trocknen Mühlenteiche höchst selten einmal aus, wenn es im Frühjahr zu wenig geregnet hat. Das Wehr reguliert den Wasserabfluss. Was eines allein nur unzureichend schaffen würde, gelingt über die Abfolge mehrerer Mühlen. Sie halten Wasser in der Landschaft und die Bäche dennoch in Fluss. Im Prinzip genauso wie die Biber mit ihren Dämmen.
Am Rande des Nationalparks Kellerwald liegt die Bärenmühle. Mit dem zugehörigen Mühlteich entstand ein ästhetisches und vielfältiges Ensemble – auch wenn es menschengemacht ist.
Die Bachtäler sind Kulturschöpfungen. Ließe man der Natur ihren Lauf, wären sie in wenigen Jahrzehnten zugewachsen. Der Wald hätte sie zurückerobert, aus dem sie vor Jahrhunderten herausgerodet worden waren. Die Mühlenteiche wären versandet. Bei einem starken Hochwasser hätte sich der Bach einen neuen Lauf ums Wehr herum gegraben und wie eh und je seinen Weg durchs Tal genommen, durch Baumbestände und durch sumpfiges Gelände, mit kleinen Wasserfällen, wo festes Gestein ansteht, und mit wechselnden Breiten, je nachdem, wie Gefälle und Wassermenge diese einstellen. Die Bachtäler würden von Natur aus ganz anders aussehen. Schön sind sie trotzdem. Sie sind keine Kunstlandschaft wie vielerorts in flacherem Gelände, wo die Bäche begradigt und »abflussertüchtigt« worden sind, um landwirtschaftliche Nutzung bis an ihren Rand zu ermöglichen. Wiesen waren einst von Natur aus rar. Die gerade jetzt zur Maienzeit bei schönem Wetter so lieblichen Wiesen am Bach sind Kultur, gut gestalteten Gärten vergleichbar. Und artenreich wie diese. Wo begradigte, kanalisierte Bäche »zurückgebaut« werden, soll sich die Maßnahme am Mühlenwiesenbach orientieren. Oder sollte das renaturierte Bachtal mit der Zeit zuwachsen und ein Waldbach entstehen dürfen? Ist Renaturierung mehr Landschaftsgestaltung als Rückführung auf einen Naturzustand, der zustande käme, wenn es so gut wie keine Eingriffe seitens der Menschen mehr gäbe? Auch kein Angeln am Bach und keine Spaziergänger auf Uferwegen. Um es noch allgemeiner auszudrücken: Was ist Flussnatur? Wie sollte sie sein?
An der mittleren Elbe in Zeiten der DDR
Anfang der 1970er-Jahre bürgerte der Bund Naturschutz in Bayern e. V. den Biber in Bayern wieder ein. Der damalige Vorsitzende Hubert Weinzierl hatte es geschafft, die Genehmigungen für die Wiedereinbürgerung zu erhalten und auch Biber aus Schweden dafür zu bekommen. Etwa 50 kamen per Flugzeug nach München. Sie wurden umgehend an den unteren Inn und an einige andere für geeignet gehaltene Stellen an südbayerischen Flüssen gebracht. Doch es regte sich Kritik. Die Flüsse seien viel zu stark reguliert, ja denaturiert, um den Bibern artgerechtes Leben zu ermöglichen. Es sei nicht zu verantworten, dass so wertvolle Tiere, die europaweit als vom Aussterben bedroht, zumindest als gefährdet eingestuft waren, von Schweden nach Mitteleuropa verfrachtet werden. Auch wenn sie hier ein paar Jahre leben, würden sie doch nicht überleben und einen neuen Biberbestand wiederbegründen, der sich selbst erhalten kann.
Dass es nicht gut stand um die Flüsse, nicht nur in Bayern, das ließ sich nicht bestreiten. Aber Gebiete wie der untere Inn mit seinen vielen Inseln, auf denen Silberweiden und andere Weichhölzer wachsen (dürfen), sollten sich schon für die großen Nager eignen. Zumindest ging es den Bibern in den ersten Jahren nach der Wiedereinbürgerung dort sichtlich gut. Gewiss waren schwedische Bibergewässer naturnäher. Das brauchte nicht überprüft zu werden. Sie lieferten ja den Überschuss an Bibern, die man dort wegfangen musste und andernorts wieder anzusiedeln trachtete. In Skandinavien weiter hinauf in den Norden – und nach Süden, nach Bayern. Aber viel näher zu Bayern gab es einen anderen Biberbestand, der die besonders ungünstige Zeit der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts überlebt hatte, die Elbe-Biber. Etwa 100 bis 150 dieser Biber existierten Mitte der 1970er-Jahre, so die vagen Informationen, die wir von dortigen Biberschützern erhielten. Sogar leichte Ausbreitungstendenzen aus dem Kerngebiet an der Elbe zwischen Dessau und Magdeburg und der Mulde nahe ihrer Mündung in die Elbe wurden festgestellt. Die Lebensbedingungen der Elbe-Biber näher kennenzulernen wäre sicherlich hilfreich für die Beurteilung der Sinnhaftigkeit der bayerischen Wiedereinbürgerung gewesen. Damals existierte aber noch die DDR, und es war sehr schwierig, aus dem Westen hinüberzukommen Nach einigem Hin und Her klappte die Fahrt nach Dessau, trotz des Argwohns, den die Besichtigung des Auwaldes nahe der Muldemündung bei den Sicherheitsorganen erregte.
Der Eindruck war überwältigend, der Befund eindeutig. Der Auwald sah großartig aus. Alte Eichen von eindrucksvoller Größe; Wildnis, wie man sich eine Hartholzaue in Mitteleuropa nicht schöner hätte vorstellen können. Rotmilane kreisten darüber, kaum Menschen waren draußen, die Biber hatten Rettungshügel gebaut bekommen, falls ein zu starkes und zu lange anhaltendes Elbhochwasser den Auwald mit ihren Vorkommen überfluten sollte. So einen Auwald konnte Bayern den Bibern nicht bieten, nicht einmal ansatzweise. Allerdings enthielt die Elbaue bei Weitem nicht so viele Weichhölzer, Weiden und Pappeln, wie die Innauen. Biber brauchen aber diese, nicht die Eichen. Auf die Verfügbarkeit von Nahrung bezogen, bot ihnen der untere Inn günstigere Verhältnisse, trotz weniger schöner Auwaldlandschaft. Aber diese Kulisse sahen wir wahrscheinlich anders als die Biber selbst, die hauptsächlich nachts aktiv sind und sich nicht gerade eines Panoramablicks erfreuen. Viel wichtiger sollte für sie das Wasser sein. Und mit Bezug darauf wurde der DDR-Befund glasklar: Für unsere westdeutschen Begriffe waren Elbe und Mulde katastrophal mit Chemieabwässern verschmutzt. Da die Biber mit diesem Zustand überlebten, mussten sie überall an bayerischen Gewässern leben können. Das war die Schlussfolgerung.
Eine so klare Aussage lässt sich selten einmal für Verhältnisse in der Natur machen. Die Biber bestätigten diese umgehend. Es dauerte kein Jahrzehnt, dann gab es an bayerischen Flüssen mehr Biber als in der (damals noch existierenden) DDR. Inzwischen ist der Bestand mit nur noch grob abschätzbaren 20.000 Bibern sicherlich höher, als er jemals im letzten halben Jahrtausend gewesen war. Die Lektion des Besuchs an der Elbe spiegelte sich an dieser selbst mit Parallelen zu den Entwicklungen der Biberbestände, die mittlerweile auch in anderen deutschen Bundesländern, in Österreich und in mehreren europäischen Ländern begründet worden waren. Mit der Verbesserung der Wasserqualität nahm der ostdeutsche Biberbestand rasch zu und fing an, sich stark auszubreiten. Die Elbe gewann auch ihre ursprüngliche Fischvielfalt wieder. Die Elbauen wurden noch großartiger, als sie damals, in den 1970er-Jahren, ausgesehen hatten. Für den Auwald ging mit dem Ende der Chemikalienbelastung die wohl schlimmste Zeit seiner Existenz vorüber. Eine Wasserstraße blieb die Elbe dennoch. Die Frequentierung wurde stärker. Stark nahm auch die Inanspruchnahme durch Tourismus und Erholungsbetrieb zu. Der Zustand der 1970er- Jahre lässt sich an diesem für mitteleuropäische Verhältnisse typischen Tieflandfluss längst nicht mehr erkennen.
Hochwasser im oberen Donauraum
Über zehn Meter schossen die braunen Fontänen in die Höhe. Es sah aus, als ob Bomben unter Wasser explodierten. Das Plateau aus Stahlbeton und Granit vibrierte heftig. Zwischen der aufschäumenden Flut vor dem Kraftwerk und der wie kochend wirbelnden Wassermasse danach gab es kaum noch einen Höhenunterschied. In einem riesigen Rückstromwirbel hatte sich Treibholz in dichter Masse angesammelt. Für Sekunden tauchte darin der Kopf einer Kuh auf und versank sogleich wieder. Beiderseits des Flusses ragten vom Auwald nur noch die Baumkronen aus dem Wasser. Die Strömung beugte sie nieder und verursachte ein wellenartiges Schwanken. Mehrere Menschen waren zum Kraftwerk gekommen. Sie fotografierten, filmten oder starrten wie gebannt auf die entfesselten Wassermassen, nicht ohne Besorgnis, ob der gewaltige Damm den Wassermassen standhalten würde.
Dreiflüssestadt Passau: Bei Hochwasser staut der wasserreichere Inn (links mit milchiger Flut) die Donau und die Ilz (ganz rechts) zurück.
Es war der 2. Juni 2013. In Passau wuchs mit dem Anstieg der Pegelstände über die bisherigen Hochwassermarken der letzten Jahrhunderte hinaus die Befürchtung, die Flut könnte trotz aller Schutzmaßnahmen außer Kontrolle geraten. Sie tat es. An der Donauseite erreichten die Wassermassen den höchsten Stand seit dem Jahre 1501, seit mehr als einem halben Jahrtausend also. An den historischen Hochwassermarken ließ es sich ablesen. Gerade noch. Wieder einmal staute der Inn mit seinen viel größeren Fluten die Donau zurück, obwohl diese selbst sehr starkes Hochwasser führte. Dabei hatte die Innflut mit ihren über 6.000 Kubikmetern pro Sekunde nicht einmal den Höchststand von 1954 erreicht, wie sich flussaufwärts im davon besonders betroffenen Schärding zeigte. Beide Flüsse, Donau und Inn, führten bei diesem Hochwasser nach ihrer Vereinigung in Passau zusammen weit mehr Wasser als der Nil an seiner Mündung ins Mittelmeer. Im Donautal wurden ganze Ortschaften überschwemmt. Manche Häuser, zumeist ziemlich neu gebaute, standen bis zum Dach unter Wasser.
Hochwasser gab es Anfang Juni 2013 auch an anderen Flüssen im Großraum der Oberen Donau, in Österreich und an der Saale in Thüringen und Sachsen. Dort verliefen die Überschwemmungen aber anders. In der für Tieflandflüsse typischen Weise entstanden großflächige, aber nicht allzu tiefe Überflutungen, die ohne zerstörerische Strömung allmählich abliefen.
Am Inn ist es bei Hochwasser insbesondere die enorm gesteigerte Strömungsgeschwindigkeit, die große Schäden verursacht. Die reißenden Fluten rasieren den Auwald, tragen ganze Inseln mit sich fort und schütten neue auf. Baumstämme schießen mit fünf und mehr Metern pro Sekunde auf dem Wasser dahin. Geht die Flut nach einigen Tagen zurück, sieht alles Betroffene verwüstet aus. Schlick klebt an den Stämmen, die standgehalten haben, Sand liegt im Auwald, aufgeschüttet wie vom Wind geformte Dünen. Neue Seitenarme können sich gebildet haben. Bisherige sind zugeschüttet. Es ist eine Urdynamik, die mit dem Ablauf der Flut sichtbar wird.
Politiker versprechen jedes Mal wieder umfangreiche Maßnahmen für besseren Hochwasserschutz. Doch die Erfahrung lehrt die Menschen am Fluss, dass das nächste Hochwasser früher kommen wird, falls überhaupt wirkungsvolle Schutzmaßnahmen zustande kommen. Denn die Fluten kommen zwar als Wasser vom Himmel, aber wie schlimm sie ausfallen, das entscheidet die Landnutzung im Einzugsbereich der Flüsse. Mit der Erwärmung des Klimas werden Häufigkeit und Stärke der Hochwasser zunehmen, so die Prognosen. Und auch die Dürren.
Natürliches Niedrigwasser, menschengemachtes Restwasser
Nach dem heißen und zudem besonders niederschlagsarmen Sommer 2018 verbreiteten die Medien Bilder ausgetrockneter Flüsse, deren Restwasser zu Rinnsalen geschrumpft war und deren Bodenschlamm zum bezeichnend polygonalen Trockenmuster zerriss. Für eine besonders eindrucksvolle Szenerie musste das Mündungsdelta der alpinen Isar in den Sylvensteinstausee herhalten, wie Kenner des Gebietes sofort sahen. Denn an den regulierten, begradigten und zu Kanälen für die Schifffahrt ausgebauten Flüssen gibt es längst keine großen Schlammflächen mehr, die bei Niedrigwasser frei werden können. Und die damit auch zeigen könnten, dass sie zur normalen, in ökologischer Sicht sogar notwendigen Flussdynamik gehören.
Versiegen die Quellen?
Hochwasser macht Schlagzeilen. Niemand möchte mit Hab und Gut betroffen sein, auch wenn gegen die Schäden noch so gute Versicherungen abgeschlossen sind. Hochwässer fordern Menschenleben; allen Vorsichtsmaßnahmen zum Trotz passiert das immer noch. In einer Region zu leben, in der Überschwemmungen drohen und wo an Niederschlägen – noch – kein Mangel herrscht, verschiebt die Wahrnehmung von Extremereignissen. Den idealen Zustand mit immer genug Wasser ohne Dürren und Fluten gibt es nicht. Sowenig wie bei Wind und Sturm oder den Temperaturen. Das Wetter wechselt ganz naturgemäß zwischen Extremen, mal schneller, mal langsamer, je nach Region und Zeit. Die Trends, die statistisch zur Ermittlung klimatischer Veränderungen errechnet werden, fallen viel schwächer als die wirklichen Schwankungen aus. Daher werden sie im täglichen Leben nicht wahrgenommen. Medienberichte wie »so heiß/kalt/nass/trocken war es noch nie …« sind gewiss nicht immer hilfreich, weil zu viel Alarmismus abstumpft und eher die Bereitschaft mindert, vorsorgende Maßnahmen zu ergreifen. Jedes Wetter wird inzwischen auf den Klimawandel geschoben. Dieser gerät zur perfekten Ausrede, selbst nichts zu tun, aber diesen umso heftiger zu beklagen. Die Verursacher lokaler Schäden könnten sich keine bessere öffentliche Stimmung wünschen. Das nimmt sie nicht in die Verantwortung.
Die Haltung ändert sich schlagartig, sobald man selbst betroffen ist. Die von Hochwasser Geschädigten klagen an, weil sichtbar wird, dass die beschleunigte Ableitung von Niederschlagswasser aus den Fluren und Wäldern die Fluten und die Schäden, die sie verursachen, stark ansteigen ließ. Maisfelder wurden auf Hängen angelegt, Feuchtwiesen umgebrochen zu Ackerland, Gräben aufgefüllt und Moore entwässert. Doch je schneller das Wasser der Niederschläge in die Flüsse abgeleitet wird, desto weniger gelangt davon ins Grundwasser. Dieses unentbehrliche Reservoir nimmt daher auch dann ab, wenn die Niederschlagsmengen im normalen Rahmen schwanken. Beschleunigung des Wasserabflusses begünstigt Dürren. Mehr Wasserentnahme, als nachkommt, auch. Wassermangel hängt daher in erheblichem Maße von der Art der Landnutzung ab, nicht allein von der Regen- oder Schneemenge.
Schwankungen bei den Niederschlägen gibt es von Natur aus ganz ohne Klimawandel regional, über mehrere Jahre oder in längeren Perioden. Steigende Durchschnittstemperaturen können aber mit länger andauernden Hitzeperioden natürliche Fluktuationen verstärken. Das hängt auch damit zusammen, dass die gleiche Niederschlagsmenge unterschiedlich nachwirkt, je nachdem, welchen Temperaturen sie ausgesetzt ist. In den Hitzesommern 2003 und 2018 gab es sehr wohl kräftige Regenfälle, zumindest regional. Aber bei den hohen Temperaturen verdunstete das Wasser viel schneller, sodass Trockenheit resultierte, auch wenn zwischendurch ergiebige Gewitterregen niederging. Umgekehrt können kalte Sommer die Grundwasserneubildung verstärken, auch wenn es durchschnittlich oder sogar etwas unterdurchschnittlich regnet.
Gegenwärtig werden bereits verhältnismäßig kurze Perioden von wenigen Jahren mit Niederschlagsdefizit zum Problem, wie etwa 2018 und 2019, weil die landschaftlichen Strukturen jahrzehntelang zu sehr auf rasche Ableitung von Regenwasser umgebaut wurden. Der Maisanbau ist dabei an erster Stelle zu nennen, denn Maisfelder bedecken nun in Deutschland zweieinhalb Millionen Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche. Bis in den Hochsommer hinein schützen sie den Boden jedoch nicht wirklich. Starkregen laufen daraus viel zu schnell ab. Sie verursachen lokale, nicht selten für die betroffene Bevölkerung verheerende Fluten aus Wasser und Schlamm, der auch die Agrochemikalien enthält, die auf den Maisfeldern ausgebracht werden. Hinzu kommen als zweiter Hauptverursacher die bebauten und »versiegelten« Flächen in Städten und Dörfern. Auch aus diesen wird das Niederschlagswasser viel zu schnell in die Flüsse abgeleitet, anstatt es, wie in früheren Zeiten, in Weihern oder Speicherseen zu halten.
Es verwundert daher nicht, wenn das Versiegen von immer mehr Quellen festgestellt wird. Oft tritt nur noch unregelmäßig oder gar kein Wasser mehr aus. Die kleinen Bäche, die sie gespeist hatten, vertrocknen. Infolge des bayerischen Volksbegehrens geschützte Bachuferbereiche gelten nicht mehr als solche, weil der einstige Bach kein Wasser mehr führt, das stellen immer mehr Landwirte zu ihren Gunsten fest. Wird unseren Flüssen also das Wasser ausgehen, wenn die Entwicklung so weiterläuft? Die Trockenjahre der letzten Zeit alarmieren. Doch wie stets nach schweren Hochwässern ist zu befürchten, dass die nötigen Gegenmaßnahmen viel zu langsam und ganz unzureichend ergriffen werden. Niemand will auch nur einen Quadratmeter hergeben, auch wenn die öffentliche Notwendigkeit noch so klar und so geboten ist. Am wenigsten sind diejenigen bereit, Gegenleistungen für die Allgemeinheit zu erbringen, die am meisten von Subventionen und öffentlichen Meliorierungsmaßnahmen profitiert haben.