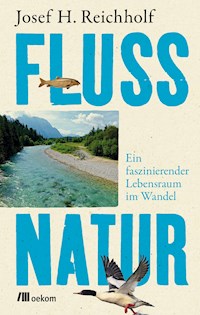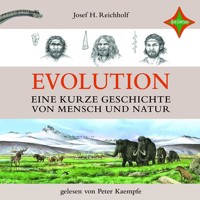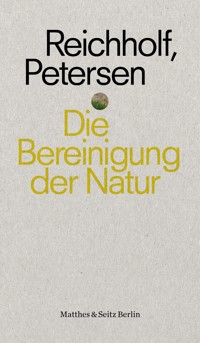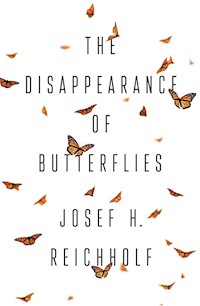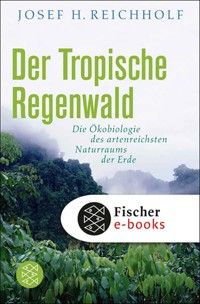12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Warum nichts so bleibt, wie es ist – Die persönliche Rückschau des großen Naturforschers Josef H. Reichholf Vögel, die sich in Wasserfälle stürzen, Ameisen, die unterirdische Pilzgärten anlegen, Jaguare, die ursprünglich in Italien und auf dem Balkan lebten, bevor sie nach Nord- und Südamerika wanderten. Kaum jemand hat so viele Tiere beobachtet – seltene und weitverbreitete – wie der große Naturforscher und bekannte Autor Josef H. Reichholf. Basierend auf der Vielfalt seiner Erfahrungen und Forschungen entwickelte er seine viel diskutierten Thesen zur Ökologie, Evolution und zum Naturschutz. Nach einem halben Jahrhundert blickt er zurück und zieht Bilanz: In der Natur gibt es keinen besten oder einzig richtigen Zustand, Stabilität bedeutet Stillstand und führt zum Niedergang. Leben ist steter Wandel, nichts bleibt so, wie es ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1063
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Josef H. Reichholf
Mein Leben für die Natur
Auf den Spuren von Evolution und Ökologie
Über dieses Buch
Vögel, die sich in Wasserfälle stürzen, Ameisen, die unterirdische Pilzgärten anlegen, Jaguare, die ursprünglich in Italien und auf dem Balkan lebten, bevor sie nach Nord- und Südamerika wanderten. Kaum jemand hat so viele Tiere beobachtet – seltene und weitverbreitete – wie der große Naturforscher und bekannte Autor Josef H. Reichholf. Basierend auf der Vielfalt seiner Erfahrungen und Forschungen entwickelte er seine viel diskutierten Thesen zur Ökologie, Evolution und zum Naturschutz. Nach einem halben Jahrhundert blickt er zurück und zieht Bilanz: In der Natur gibt es keinen besten oder einzig richtigen Zustand, Stabilität bedeutet Stillstand und führt zum Niedergang. Leben ist steter Wandel, nichts bleibt so, wie es ist.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Covergestaltung: hißmann, heilmann, hamburg / Imke Schuppenhauer
Coverabbildungen: AKG Images und Bridgeman Images
Erschienen bei FISCHER E-Books
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2015
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-400778-6
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Gewidmet meiner Frau
Vorwort
Iguaçú Zur Einführung
1. Kapitel Die Anfänge
Ein richtiger Totenkopf
Andere Totenköpfe
Das große Paradies
Ziesel vom Rand der Puszta
Wasservögel
Wasserschmetterlinge
2. Kapitel Südamerika
Nach Brasilien
Muscheln, Krebse, Libellenflug und Schwarze Wespen
Der »tote« Tejú
Von Ostparaguay zur Ruta Transchaco
Fieber und ein reitender Affe
Chulupí
In den Ausläufern der Pampa
Kolibris spielen Fahrstuhl
Medizin
Embaúba – Faultiere und Ameisen
Wunderliches in Amazonien
Üppige Natur auf magerer Erde
Millionenstädte
Costa Rica – ein Rückblick auf Südamerika
3. Kapitel Afrika
Äthiopien
Ostafrika
Tansania
Der Mensch und Afrika
4. Kapitel Inseln
Die verzauberten Inseln
Auf den Ballestas
Seeelefanten und Wale
Auf den Seychellen
Malediven
Australien und Neuseeland
5. Kapitel Ökologie und Naturschutz
Vom Herumstreunen am Inn zur Forschung
Die Zoologische Staatssammlung
Undeutsche Biber
Kritische Vorlesungen
Entenjagd und Wasserqualität
Angeln im Wasservogelschutzgebiet
Gespinstmotten
Insektenforschung und Artenschutz
Wildkaninchen
Rehe
Veränderungen im Auwald
Zeitströmungen
Unsoziale Schwäne
Kormorane, Fischerei und Fischotter
Gülle und Botulismus
Brutkolonien der Lachmöwen
Ökologische Modellvorstellungen …
… und ihre Anwendung
Artendiversität
Die Invasion der Türkentauben
Schmetterlingswanderungen
Die inhärente Schwäche des Naturschutzes
Mein Leben für die Natur – ein Resümee
Ein kleiner Dank für große Unterstützung
Literaturhinweise
Gewidmet meiner Frau
Miki Sakamoto-Reichholf
Vorwort
Dies ist keine Autobiographie. Der Untertitel besagt, worum es geht: Um Evolution und Ökologie, also um zwei Bereiche der biologischen Naturwissenschaften, die eng miteinander verbunden sind. Und um den Schutz der Natur, für den ich mich seit früher Jugendzeit engagiere. Das damit verbundene Persönliche erweckt verständlicherweise den Eindruck, es ginge mir um eine Autobiographie. Das ist nicht so. Die Menschen, die mein Leben begleiteten, die auf mich einwirkten und denen ich umfassend Dank schulde, bleiben ausgeblendet – weitestgehend, denn einige waren im Zusammenhang mit den wissenschaftlichen Fragestellungen unbedingt zu nennen. Wir stehen nicht nur in den Wissenschaften auf den Schultern von Riesen, wie es das geflügelte Wort sehr treffend ausdrückt, und bilden uns dabei ein, weiter als sie schauen zu können. Wir werden ebenso von vielen Menschen getragen, mit denen wir verbunden sind oder waren; auch solchen, die andere Meinungen vertraten. Daran schärften wir die eigene. Das Buch zeigt zunächst, wie mein aus kindlich-jugendlicher Begeisterung heraus entstandenes Interesse an der Natur Gestalt annahm und gestaltet wurde, besonders auch von der Umgebung, in der ich lebte und mich bewegte. Ich hatte das Glück, in einer Gegend mit besonderem Naturreichtum aufgewachsen zu sein. Zwar ging auch dort, im niederbayerischen Inntal, bereits die Zeit der Fülle zu Ende. Aber ich erlebte sie noch, die Wiesen voller bunter Blumen und Schmetterlinge, den Lerchengesang frühmorgens und die Rufe der Rebhühner am Abend, nicht eingeschränkt von Naturschutzbestimmungen, die in der Folgezeit zunehmend die nähere Beschäftigung mit Tieren und Pflanzen beeinträchtigten. Es war eine Zeit des Staunens und Entdeckens, in der man uns, der Jugend, noch nicht mit diesem oder jenem Weltuntergang drohte, die Zukunft schlechtredete und die Menschen selbst noch schlechter.
Der Rückblick zeigt, wie sehr man als Kind und Jugendlicher von Erlebnissen geprägt wird, die für sich genommen wenig bedeutsam erscheinen. Sie wirken nach; sie beeinflussen den weiteren Lebensweg über eine Vielzahl von Entscheidungen, die auch anders hätten ausfallen können. Auf die Ökologie und die Evolution bezogen, kommt in meinem Fall zum Ausdruck, wie vorhandene Konzepte bereits vorab den Blick auf die Natur lenken und in die Interpretation der Befunde eingehen. Wir sehen nur, was wir kennen, heißt es ganz zutreffend. Dieses Vor-Wissen führt zu Vor-Urteilen, nicht zu jenen sachlichen Urteilen, distanziert von der eigenen Überzeugung, die in den Naturwissenschaften selbstverständlich sein sollten und ihren Erfolg ausmachen. Meine Rückschau soll daher auch darlegen, wie sich aus einer Vielzahl zunächst voneinander unabhängiger Eindrücke allmählich Fragestellungen entwickeln, aus denen neue Konzepte hervorgehen. Auch sie sind nur vorläufiges Wissen, das sich bewähren muss, keine letztgültigen Erklärungen.
Nach dem einführenden Überblick über die Anfänge enthält das Großkapitel über Südamerika eine anekdotische Zusammenstellung von Erlebnissen. Sie drücken mein Staunen über all das Neue aus, das ich dort kennenlernte. Im zweiten Hauptkapitel, das Afrika betrifft, rücken aber bereits Themen wie die Evolution des Menschen und das Zustandekommen der Artenvielfalt, der tropischen insbesondere, sowie kritische Überlegungen zu den gängigen Konzepten der Ökologie in den Vordergrund. Aus der erlebten und gesammelten Fülle kamen interessante Querverbindungen zustande. Bilder begannen sich abzuzeichnen. Unstimmigkeiten in den bisherigen Betrachtungsweisen wurden deutlich. Im folgenden Abschnitt über die Inseln vertiefen die Darlegungen den Kontrast zwischen der viel zu statisch betriebenen, von Erdgeschichte und Evolution weitestgehend getrennten Ökologie und den unablässigen Veränderungen in der Natur. Die dabei behandelten, zunächst scheinbar wenig Zusammenhang ergebenden Einzelbeispiele fließen jedoch zu mehreren Hauptsträngen meines Interesses zusammen, die ich im letzten Großkapitel über die Vielfalt meiner eigenen ökologischen Untersuchungen an den Stauseen und in den Flussauen am unteren Inn ausbreite. Sie stellen die Verbindung zum Naturschutz her. Zusammen mit den globalen Erfahrungen begründen sie meine in manchen Bereichen heftige Kritik an der Art und Weise, wie Naturschutz bei uns betrieben wird. Er ist zu einem in Gesetzen und Verordnungen erstarrten System gemacht worden, das der Natur nicht gerecht wird und die interessierten Menschen, vor allem Kinder und Jugendliche, von der näheren Beschäftigung mit Tieren und Pflanzen durch unnütze Verbote abhält. Der einst gutgemeinte, nach wie vor auch notwendige Schutz hat uns Natur genehmigungspflichtig gemacht. Das hatte ich wirklich nicht gewollt, als ich mich ab den späten 1960er Jahren so intensiv für den Naturschutz einsetzte. Mit gutem Gewissen kann ich betonen, dass ich seit einem Vierteljahrhundert gegen die Fehler und Mängel anzukämpfen versuche, die in unserem Naturschutz enthalten sind, die seine Wirksamkeit so sehr einschränken – und die Naturfreunde noch mehr.
Es geht mir schließlich auch darum aufzuzeigen, wie aus einer missdeuteten wissenschaftlichen Ökologie eine Öko-Religion geworden ist, die jenen Totalitätsanspruch erhebt, der viele Religionen kennzeichnet und so gefährlich macht. Sie beherrscht längst die Medien und entspricht mit ihrem morbiden Charme dem Kulturbild Oswald Spenglers vom Untergang des Abendlandes. Unter dem Deckmantel von Ökologie und mit dem Anspruch, »grün« zu sein, übt sie eine Meinungsdiktatur aus, die weder von der Ökologie als Wissenschaft gedeckt noch in der Lage ist, tatsächlich wünschenswerte Änderungen in der Gesellschaft zum Wohle aller herbeizuführen. Wer aber den Menschen durch Verbote die Freude an der Natur nimmt, wer diese zur unantastbaren Kulisse degradiert, wird sich vergeblich um die Erhaltung von Naturschönheiten und der Vielfalt des Lebens bemühen. Und wer die Zeit festhalten will auf einem Status quo, hat die Zukunft bereits verloren. Denn Ökologie und Evolution besagen, dass es in der Natur keinen festen Zustand gibt. Beständigkeit ist ein Wunschbild der Menschen. Doch alles verändert sich, ist in Bewegung, in Entwicklung. Alles hat Geschichte, Naturgeschichte. In diese tauchte ich ein wenig ein mit meinem Leben für die Natur.
Josef H. Reichholf, im Juli 2015
Iguaçú Zur Einführung
Die Szenerie ist atemberaubend. Mit ohrenbetäubendem Getöse stürzen die Wassermassen des Iguaçú in die Schlucht. Gischt steigt in Wolken auf. Sie hüllen alles ein in triefende Nässe. Ein Regenbogen steht über dem ›Teufelsschlund‹, der Hauptschlucht, in die der Fluss zu verschwinden scheint. Von schmalen Uferpfaden und von Stegen aus kann man auf sie hinabschauen: Die Wasserfälle des Iguaçú sind die wohl schönsten überhaupt. Iguaçú bedeutet ›Großes Wasser‹ in der Sprache der Guaraní-Indianer, die einst hier im südostbrasilianischen Bergland lebten. »Groß« ist dieses Wasser wirklich. In der Regenzeit des Südsommers stürzen gut 5000, bei starkem Hochwasser über 7000 Kubikmeter pro Sekunde in die Tiefe. Diese Menge entspricht, kommt mir in den Sinn, den stärksten Hochwässern des Inns, an dem ich aufgewachsen bin. Im Winter führt dieser wasserreichste Alpenfluss allerdings viel weniger Wasser als der Iguaçú. Vergleichbar ist er ohnehin nicht. Es fehlt ihm die Tropennatur.
Daher verdränge ich den albernen Gedanken an den heimatlichen Inn auch gleich wieder. Der Iguaçú bietet Natur der Extraklasse, auch für tropische Verhältnisse. Über fast drei Kilometer Breite erstrecken sich die Wasserfälle. Flach, hufeisenförmig, zerteilt von zahlreichen Inseln, greifen sie um die Schlucht herum, in die dieser Nebenfluss des noch viel gewaltigeren Paraná hinabstürzt. Palmen ragen von den Felswänden auf, Bambusgebüsch und anderes frisches Grün stehen im steten Sprühregen. Über den Fällen kreisen große Vögel; schwarze, breitflügelige Raben- und dunkelbraune, langflügelige Truthahngeier. Papageien kreischen, wenn sie zu Paaren oder in kleinen Gruppen vorüberfliegen. Bunte Tukane schwingen sich in Bögen an den von Lianen behangenen Rändern von Wald und Buschwerk entlang. Ihr Flug wirkt wie zu sehr belastet von den übergroßen Schnäbeln. Die hochstehende Sonne erzeugt auf dem wirbelnden Wasser ein geradezu verwirrendes Spiel von Lichtern und beständig schwankendem Glitzern. Wie heller Milchkaffee, der sahnig aufschäumt, ergießen sich die Fluten über die Felskanten. Sie bilden beiderseits der Hauptschlucht Wasservorhänge unterschiedlicher Breite, die gleichfalls im Teufelsschlund, so genannt von den Brasilianern und Argentiniern, deren Länder sich an den Iguaçú-Fällen treffen, verschwinden.
Wie verweht von der Gischt des Wassers, gleitet ein über handtellergroßer blauer Schmetterling vorüber. Ein Morpho ist es, einer jener berühmten, unfassbar schönen Schmetterlinge der mittel- und südamerikanischen Tropen.
Man macht Fotos, weiß nicht, wo man hinschauen soll, und versucht unablässig, die Kamera vor der Nässe zu schützen. Die Szenerien wechseln fast mit jedem Schritt auf den schlüpfrigen Stegen. Manche überspannen auf der argentinischen Seite kleine Wasserfälle, die dort wie Schleier an den Felswänden hängen. Einzigartig! Wundervoll! Welche Superlative passen zu diesem Naturwunder?
Als ich 1970 an den Iguaçú-Fällen stand und wie berauscht vom zu Schauenden versuchte, die Eindrücke aufzunehmen, herrschte noch kein touristischer Hochbetrieb, der weiterschiebt, wo man verweilen möchte. Ein einfaches Stahlseil sicherte den glitschigen Weg. Manche Stege überflutete gerade das leichte Hochwasser. Wer den Zug des Wassers an bloßen Füßen verspüren wollte, konnte barfuß weitergehen. Obwohl warm, kühlte es bei den subtropischen Lufttemperaturen.
Allmählich wurde es Abend. Unmerklich zunächst, weil die Sonne hier auf 26 Grad südlicher Breite, also nur wenig südlich des Wendekreises des Steinbocks, sehr steile Bögen macht. Dann aber sank sie tropenschnell. Die Gischt über der Schlucht flammte golden auf. Neben dem großen Regenbogen über den Hauptfällen entstanden an den Seiten mehrere kleine. Und da geschah es: Ein schlanker Vogel, schwarz und etwas größer als eine unserer Schwalben, löste sich aus der milchig-goldenen Gischtwolke, schoss geradewegs auf die Wasserwand vor mir zu, und weg war er. Das ging so schnell, dass ich nicht folgen konnte. Er tauchte nicht wieder auf. Weggerissen von der Strömung und zerschmettert in der Tiefe – dachte ich. Es kreisten ja beständig Raben- und Truthahngeier über dem schäumenden Wasser am Fuß der Fälle. Den kleinen Vogelkadaver würden sie aber wohl nicht beachten. Ihre Suche galt den großen Fischen, die vom Sog erfasst worden waren und sich nicht mehr daraus befreien konnten. Zu weiteren Überlegungen kam ich nicht, denn nun sausten Dutzende, Hunderte der schwarzen Vögel heran, und als ob sie Massenselbstmord begehen wollten, verschwanden sie in den Wasservorhängen. Da es so viele waren, die angeflogen kamen, konnte ich durchs Fernglas erkennen, dass es Segler waren. Greisensegler ist ihr deutscher Name. Er nimmt Bezug auf ihre wissenschaftliche Bezeichnung Cypseloides senex. Der Artname senex bezieht sich auf den grauen Kopf, der jedoch nur deutlich wird, wenn man die rasend schnell fliegenden Verwandten unserer Mauersegler aus der Nähe betrachten kann. Oder ein Präparat davon in einer wissenschaftlichen Vogelsammlung in Händen hält. Mit »alt« oder gar »greisenhaft« hat das, wie ihre Flugkünste zeigen, nichts zu tun. Vielleicht brauchen diese Segler, die von den Brasilianern Andorinhas da cachoeira[1],
»Schwalben der Wasserfälle«, genannt werden, diesen hellgrauen Kopf bei ihrer äußerst ungewöhnlichen Nistweise. Denn was ich an jenem Abend, fast starr vor Staunen, erlebte, ist Teil ihrer (für sie) ganz normalen Lebensweise.
Was sie taten, war nichts anderes, als ihren Schlafplatz anzufliegen, nämlich die Felswand hinter den Wasserfällen. Dort klammern sie sich mit ihren kleinen, sichelförmigen Krallen der kurzen Füße an die Felsen und verbringen dicht an dicht, und ohne sich zu rühren, die zwölf Nachtstunden bis zum nächsten Morgen. Dann lösen sie sich aus der Starre. Sie fahren die im Schlaf gesenkte Körpertemperatur wieder auf normale Leistung hoch, schütteln sich vielleicht kurz und werfen sich hinein in die Wasservorhänge. Diese reißen sie zwar ein Stück in die Tiefe, aber nach Bruchteilen einer Sekunde kommen sie wohlbehalten wieder frei und fliegen hinaus zur Jagd nach Fluginsekten über den Wäldern und Savannen.
Ist dieses Nächtigen hinter den Wasserfällen schon staunenswert genug, so geschieht schier Unglaubliches bei der Fortpflanzung. Die Greisensegler bauen nämlich auch ihre Nester in die Felsnischen hinter den Wasservorhängen, bebrüten darin ihre Gelege und ziehen die Jungen groß. Dann heißt es, täglich vielfach das Wasser zu durchfliegen, um die mit Speichel zu Bällchen geformten Kleininsekten, die sie aus dem sogenannten Luftplankton erbeutet haben, an die hungrigen Jungen zu verfüttern. Sind diese ausgewachsen und zum Ausfliegen bereit, müssen sie sich zu ihrer ersten richtig aktiven Lebenstätigkeit vom Nest mit Schwung ins Wasser stürzen und danach sogleich versuchen, Luft unter die Schwingen zu bekommen. Das ist ihr Jungfernflug. Was für eine Lebensweise, stellt man nicht nur als Biologe bewundernd fest. Und es drängt sich die viel größere Frage auf, wie denn so eine Lebensweise zustande kommen konnte. Was in aller Welt mag eine Vogelart, die als Angehörige der Segler ausgeprägter als alle anderen Vögel »in der Luft lebt« und sich im Flug sogar paart, dazu veranlasst haben, ausgerechnet die Felsnischen hinter den tropisch-südamerikanischen Wasserfällen zum Nisten und zum Nächtigen zu benutzen?
Ich war eigentlich nicht hierher an die Iguaçú-Fälle ins Grenzgebiet zwischen Brasilien, Argentinien und Paraguay gekommen, um solche Fragen zu klären. Damals hatte ich nicht einmal gewusst, dass es dieses Phänomen überhaupt gibt. Es ist auch nur eines der unzähligen Beispiele ungewöhnlichster Formen des Lebens in den Tropen. Man muss sicherlich kein Biologe sein, um über die Wunder der Tropenwelt zu staunen. Aber was besagen sie? Was bedeuten sie für die Menschen? Auch für uns, die wir in den klimatisch gemäßigten Breiten leben und den Wohlstand genießen? Sind sie für daran Interessierte etwas dem Besuch eines Zoos, eines botanischen Gartens Vergleichbares, das man auf einer »Studienreise« genießt? Und in welchem Verhältnis stehen sie zur Natur bei uns? Bilden sie lediglich einen exotischen Kontrast dazu?
Um die Tropennatur, um ihre Fülle zu erleben, reiste ich direkt nach Abschluss meines Biologiestudiums nach Südamerika. Schon als Kind hatte ich Naturforscher werden und nach Brasilien, an den Amazonas, gehen wollen. Meine Mutter sagte dies in weinerlichem Ton jedem, der danach fragte, als ich tatsächlich dort war. Zwischen dem Träumen von den Tropen in früher Jugendzeit und meiner Ankunft in Brasilien im Januar 1970 waren zwar etwa ein Dutzend Jahre vergangen, aber in der Rückschau sind dies eigentlich gar nicht so viele. Wann sich die Wunschbilder von den Tropen in mir aufbauten, kann ich anhand eines Buches zeitlich ziemlich genau eingrenzen. Es handelte von der Reise Alexander von Humboldts in die südamerikanischen Tropen und hieß passend für jugendliche Leser Draußen wartet das Abenteuer. Ich verschlang es, wie man ein Buch nur verschlingen kann. 1957, spätestens 1958, muss das gewesen sein, denn ein weiteres Buch aus dieser Zeit wirkte nachhaltig über die Bilder: Die Welt in der wir leben, die deutsche Fassung des amerikanischen The World We Live In, dessen drucktechnisch billigere Volksausgabe ich nach langem Sparen erworben hatte. Es zeigte in großen bunten Bildtafeln auch die Fülle des Lebens im Tropischen Regenwald Südamerikas. Ich saugte die Bilder und die Texte ein wie ein Lebenselixier; auch alles, was darin über die Evolution des Lebendigen enthalten war.
Wahrscheinlich baute sich über diese beiden Bücher der naive Wunsch auf, dies selbst zu erleben, auch wenn das nicht nur im frühjugendlichen Sinne damals unerreichbar schien. Nie würde ich die Mittel dazu haben, wie Alexander von Humboldt in die Äquinoktialgegenden der Neuen Welt zu reisen. Und doch wurde dieses »nie« bereits gut ein Jahrzehnt nach den ersten Phantasien davon, als Naturforscher nach Brasilien zu reisen, Wirklichkeit.
Natürlich dachte ich an die mir damals schon so weit zurückliegend vorkommende frühe Jugendzeit, als ich Seglern zuschaute, die sich in die Wasserfälle stürzten. Sie währte nur kurz, diese Rückschau, wenn ich mich recht erinnere, denn zu viel gab es zu sehen, zu hören, zu erleben an diesem wundervollen Ort. Mit fünfundzwanzig Jahren war ich bestimmt viel zu jung für eine wirklich kontemplative Rückschau auf den noch kurzen Lebensweg, der mich so geradlinig von den Ufern des Inns und dem kleinen Dorf im niederbayerischen Inntal, in dem ich aufgewachsen war, hierher an den Iguaçú und seine unendlich größere Naturschönheit geführt hatte. Der Drang, einzutauchen in die Wunder der Tropenwelt, erfüllte mich voll und ganz. Das Studium lag gerade hinter mir. Ich hatte in Zoologie promoviert und genau den Berufsweg einschlagen können, den ich mir als Naturforscher vorgestellt hatte. Ein für meine finanziellen Verhältnisse sehr großzügiges und für die damalige Zeit gewiss ganz besonderes Stipendium der Studienstiftung des Deutschen Volkes ermöglichte mir die einjährige Südamerikareise ohne Auflagen und Verpflichtungen. Diese Auszeichnung überstieg an nachwirkender Bedeutung wohl auch den Doktortitel. Sie wurde prägend für mein weiteres Leben, insbesondere für die berufliche Entwicklung. Wenn ich jetzt in einer dem Alter angemessenen Rückschau bewerten sollte, welche Ereignisse den Weg, den ich eingeschlagen hatte, eröffneten und welche Erlebnisse die Wahl meiner Forschungsthemen und auch meine allgemeinen Interessen entscheidend beeinflussten, so gebührt dem Jahr in Südamerika sicherlich eine zentrale Position. Es ermöglichte mir, uneingeschränkt von Zeitdruck und Konkurrenz, das freie Sammeln von Eindrücken. Mitzubringen hatte ich nichts von dieser ersten Reise in die Tropenwelt. Mitgebracht habe ich eine Fülle, die zum Quell sich nicht erschöpfender Erfahrungen und Anregungen wurde. Sie bewahrte mich davor, einen Brotberuf zu wählen, der in die Spezialisierung geführt hätte.
Der Reichhaltigkeit der Natur Südamerikas fühlte ich mich anfänglich aber geradezu hilflos ausgeliefert. Ihre Fülle ist erdrückend. Die Segler, die hinter den Wasserfällen schlafen und nisten, hoben sich als einzelnes Erlebnis zwar ab von der Flut des Neuen. Aber sie machten auch Lust auf mehr. Zusammen mit vielen anderen Besonderheiten, die sich Tag für Tag ansammelten, wurden sie zu kleinen Schlüsseln zum Verständnis des großen Ganzen – oder zumindest von dem, was man im Lauf der Zeit aus der Summe der eigenen Erfahrungen dafür hält. Einen umfassenden Einblick gewinnen kann nie gelingen; es übersteigt unsere individuellen Möglichkeiten. Mit der Zeit wird man zu der Einsicht gezwungen zu akzeptieren, dass relativ mehr zwar ein großer Gewinn ist, aber gewiss nicht der Weisheit letzter Schluss. Was jedoch stetig mit ansteigt, ist das Vergnügen, das beim Eindringen in die sogenannten Geheimnisse der Natur aufkommt. Es hält die forschende Begeisterung in Schwung.
Südamerika war für mich damals, 1970, kein vorgefertigter Lehrstoff, wenngleich ich viel gelesen hatte über die Natur dieses Kontinents, auch als Vorbereitung auf die Prüfung in Botanik, zu der ich den Tropischen Regenwald als spezielles Prüfungsthema hatte wählen dürfen. Die eigene Erfahrung übertrifft jedoch meistens doch alles Angelesene – oder rückt es zurecht, wenn im Geschriebenen aus Effekthascherei allzu arg übertrieben worden war. Ich hatte das Privileg, mich mit dem befassen zu können, was ich gerade interessant fand. Reisestrecken und Aufenthaltsdauern brauchte ich nicht zu rechtfertigen. Die Studienstiftung hatte mir nicht nur die Mittel für das Jahr in Südamerika gegeben, sondern mir Freiheit dazu geschenkt. Dass es eine schöpferische Zeit würde, hatte man bei der Vergabe des Stipendiums wohl gehofft. Tatsächlich hatte ich nicht einmal einen konkreten Reiseplan. Die traumhaft schönen Wasserfälle des Iguaçú standen weder am Anfang meines Herumschweifens in Südamerika, noch gehörten sie zu den Hauptzielen, die zu erreichen ich mir vorgenommen hatte. Es waren dies Gebiete mit für die damalige Zeit noch geheimnisvollem Klang: Mato Grosso, Gran Chaco, das Pantanal, der Rio das Mortes (einer der südlichen Quellflüsse des Amazonas mit eher besorgniserregendem Namen). In den Tagen an den Iguaçú-Fällen und im daran anschließenden Nationalpark war ich der Studienstiftung einfach zutiefst dankbar und bin das immer noch. Damals befand ich mich in einer Art Orientierungsphase, in der ich aufzunehmen versuchte aus der Fülle der Tropen- und Subtropennatur Südamerikas, so viel ich zu fassen vermochte und festhalten konnte in meinen Notizbüchern. Vieles entzog sich mir wieder, kaum dass ich es sah oder hörte, weil ich keine geeigneten Bücher zum Bestimmen der Tiere und Pflanzen hatte. Die damals verfügbaren verwirrten eher, als dass sie Klärung brachten. Und das dokumentierende Fotografieren mit Dia-Filmen war teuer und dem Risiko ausgesetzt, dass die Filme in der tropischen Hitze und Schwüle verderben. Jedes Bild wollte genau überlegt sein, ob es wert war, gemacht zu werden. Der Bleibeutel voller unbelichteter Filme war ein Schatz, den ich hüten musste wie meinen Reisepass.
Umso mehr vertiefte ich mich auf der Reise in ein Buch, das bezogen auf Südbrasilien, Paraguay und Ostbolivien für mich das Buch der Bücher über die Natur war: Zwischen Anden und Atlantik von Hans Krieg, erschienen 1948, aber entstanden auf Expeditionen in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen. Für mich sollten sich daraus bemerkenswerte Verknüpfungen und Nachwirkungen ergeben. Davon ahnte ich nichts, als ich versuchte herauszubekommen, um welche Vogelart es sich bei den selbstmörderischen Seglern an den Wasserfällen handelt. Die Angabe im Buch von Hans Krieg konnte nämlich nicht stimmen. Er hatte darin von weißbäuchigen Seglern geschrieben, die an der senkrechten Felswand ihre Nester haben. Die Greisensegler sind aber bis auf den grau aufgehellten Kopf ganz dunkelbraun-schwärzlich, auch auf der Bauchseite. Von ihrem Flug durch die Wasservorhänge schrieb Hans Krieg nichts. Dass mich ausgerechnet meine Bibel hier im Stich ließ, beunruhigte mich. Immer wieder vergewisserte ich mich, dass die Segler nicht weißbäuchig waren und dass es auch keine solchen unter den Seglerschwärmen an den Felswänden der Iguaçú-Schlucht gab. Einen Irrtum – er könnte sie verwechselt haben mit den hier vereinzelt, in Paaren oder kleinen Gruppen herumfliegenden Graubrustschwalben Progne chalybea – wollte ich dem großen Kenner Südamerikas nicht unterstellen. Diese langsam fliegenden, verglichen mit den Greisenseglern sogar deutlich größeren und auf der Rückenseite blaugrün schimmernden Schwalben kannte ich ganz gut von anderen Orten Südbrasiliens. Auch am Hotel in der Nähe der Wasserfälle kamen sie vor. Erst nach der Rückkehr nach Deutschland konnte ich schließlich klären, worum es sich bei den Seglern gehandelt hatte. Hans Krieg war tatsächlich eine Verwechslung unterlaufen, die möglicherweise mit dem umgangssprachlichen andorinha (Schwalbe) in Brasilien zusammenhing. Es war offenbar alles andere als leicht, in die Natur Südamerikas einzudringen, wenn es selbst zu so Spektakulärem Fehldeutungen gab.
Nun wird man nicht einfach Naturforscher und kommt gleich nach der Promotion nach Brasilien. Eine derartige Tropenreise war vor einem halben Jahrhundert ungleich schwieriger als heutzutage, wo schon Jugendliche als Touristen fast überallhin fahren können. Rückblickend mögen die zwölf Jahre vom ersten Aufkeimen der Vorstellung, nach Brasilien zu gehen, bis zur Verwirklichung gleich nach dem Studium wie ein glatter Weg aussehen, dem man einem starken Willen und/oder einer gezielten Förderung zuschreiben könnte. Zu betonen, dass dem nicht so war, gebietet mir die Ehrlichkeit. Wie es tatsächlich war, das ist ein umfassenderes Stück Lebensgeschichte. Warum es so kam, wie es gekommen ist, mag zwar wie geplant aussehen, tatsächlich aber wirkte viel zusammen, was nicht planbar war, sondern sich aus günstigen Umständen heraus ergab.
Die Ähnlichkeiten solch individueller Lebensläufe mit Evolutionsvorgängen sind frappierend. Deutlich werden sie jedoch erst in der Rückschau. Geht man mit der gebotenen Distanz zu sich selbst darauf ein, machen sie vielleicht eher verständlich, warum sich Evolution nicht im strengen Sinne kausal erklären lässt, weil sie kontingent verläuft und nicht kausal in der Art, wie wir gewohnt sind vorauszudenken: »um zu«. Was das bedeutet, wurde mir Jahre später allmählich bewusst, als ich in Afrika an der Wiege der Menschheit stand und darüber nachsann, warum gerade hier und nicht in Südamerika oder Asien, weshalb in den Tropen und nicht in den für uns doch angenehmeren, klimatisch gemäßigten Breiten die Menschen als biologische Gattung und Art entstanden sind. Was unterschied Afrika von Südamerika so tiefgreifend und auch vom tropischen Asien? Warum leben weit mehr Menschen außerhalb der Tropenzone als in dieser? Hier in Brasilien bekam ich einen ersten Eindruck. Mich zog es ins Innere, wo die Natur so vielfältig ist. Aber die Menschen konzentrieren sich auf den Küstenbereich. Ins damals abwertend als interior von den Brasilianern bezeichnete Innere hinein nahm die Bevölkerung stark ab, dünnte aus und ging über in das Land der Indios, die nach damals verbreiteter Ansicht wie die bichos do mato, Viecher des Waldes, lebten. Ihre entfernten Verwandten an der Südspitze Südamerikas, die Feuerländer, hatte Charles Darwin mit seiner für jene Zeit sogar recht wohlwollenden, gegen die Sklaverei gerichteten Sicht noch für lebende Übergänge zum Menschengeschlecht gehalten. Zweifellos waren die Indios in Amazonien zumindest in entlegenen Gebieten weit weniger losgelöst von der Natur als die Europäer, die sie immer tiefer in den Urwald abdrängten. Ob die Indios deswegen im Einklang mit der Natur lebten, galt zumindest bei nicht allzu voreingenommenen Völkerkundlern als nicht mehr so sicher, wie das bis heute viele romantisierende Naturschützer annehmen. Und ich sah auch, wie schon 1970 Tropenwälder gerodet wurden, um Viehweiden daraus zu machen und Soja anzubauen für den Export nach Europa. Brasilien, Amazonien, sie waren keine entlegene Welt, sondern längst, seit Jahrhunderten, global vernetzt und von Nordamerika und Europa massiv beeinflusst. Die Globalisierung hat vor einem halben Jahrtausend mit Kolumbus und Magellan begonnen, beileibe nicht erst in unserer Zeit.
Wohin immer ich kam in Südamerika, stets überformte das Tun und Wirken der Menschen die Natur. Selbst zur größten Tropenfülle gehörten die Menschen und meistens auch das, was sie mitgebracht hatten an Nutzpflanzen und Vieh. In die Wüste an der Westküste Südamerikas waren Scharrbilder gegraben, die von vergangenen, vorkolumbianischen Kulturen zeugten. Das Urvertrauen aller Tiere, die den Menschen nicht als Feind oder Gefahr einstufen und auf sein Auftreten nicht gleich mit Scheu und Flucht reagieren, ließ sich nicht in den amazonischen Wäldern, sondern erst tausend Kilometer westlich des südamerikanischen Kontinents auf den einsamen Galapagosinseln erleben. Einzigartig in dieser Intensität! Früh formten sich für mich daher die drei Kernbereiche, um die sich mein Sammeln von Daten und Fakten konzentrierte: Ökologie, Evolution und Naturschutz. Die Ökologie versucht zu verstehen, wie das Leben lebt und wie die lebendige Natur funktioniert. Die Evolutionsforschung will den Weg des Lebens durch die Zeiten und Räume ergründen. Und wer auch nur ein wenig gesehen hat von der Fülle des Lebens, wird sich aus tiefster Überzeugung für Schutz und Erhaltung der Natur einsetzen.
In der Beobachtung der Segler, die zum Schlafen durch die Wasservorhänge der Iguaçú-Fälle flogen, vereinigten sich für mich ganz unmittelbar diese drei großen Fragen zur Ökologie (Wie leben diese Vögel mit so besonderen Anpassungen?), zur Evolution (Wie mag diese außergewöhnliche Lebensweise zustande gekommen sein und warum?) und zum Schutz (Werden die Segler überleben, und werden diese einzigartigen Wasserfälle erhalten bleiben?). Die Sorge, die sich in letzterer Frage ausdrückte, war sehr berechtigt, denn andere, der Wassermasse nach viel gewaltigere Wasserfälle, die kaum zweihundert Kilometer nördlich davon am Paraná-Fluss gelegenen »Sieben Fälle« (sete quedas), waren gerade erst einem gigantischen Staudamm zum Opfer gefallen: dem damals größten Flusskraftwerk der Welt. Bald würden mich, was ich am Iguaçú noch nicht ahnte, ähnliche Befürchtungen beunruhigen im Hinblick auf die Xavante-Indios jenseits des Todesflusses Rio das Mortes, die ich noch kurz erleben konnte. Und viele weitere Probleme von Ökologie, Evolution und Naturschutz auch, die sich zu einem Geflecht zusammenfügten, das in schier unlösbarer Weise die Lage unserer Zeit und die weitere Entwicklung in die Zukunft charakterisiert. Ratlos, mutlos oder wütend machen die Erfahrungen, weil die »Krone der Schöpfung«, insbesondere in ihrer Version der sogenannten westlichen Zivilisation, offenbar nicht lernfähig oder, wie viele mit Bezug auf die biblische Erbsünde meinen, von Grund auf verdorben ist. Der Klimawandel wäre ja eine vergleichsweise harmlose Folge des westlichen Umgangs mit der Erde, wenn er nicht, wie bisher alle großen Veränderungen, den anderen, den größeren Teil der Menschheit viel schlimmer träfe. Dieses Verdikt gilt auch dann, wenn die Modelle zur Projektion der klimatischen Entwicklung gar nicht stimmen sollten. Der eingeschlagene Weg, auch jener, der vorgibt, die globale Erwärmung des Klimas auf zwei Grad Celsius zu begrenzen, wird zwangsläufig einen Großteil dessen vernichten, was das Leben auf der Erde, auch das menschliche Leben, kennzeichnet: Vielfalt. Südamerika ist hierfür ein Modell für die ganze Erde.
Vielfalt der indigenen Kulturen, Vielfalt der Arten, Vielfalt der Lebensräume – die gesamte Mannigfaltigkeit schwindet dahin. Alles wird vereinheitlicht, gleichgeschaltet, auf schnellstmögliche, höchstmögliche Leistung getrimmt. Wer sich gegenwärtig um die Verhältnisse im Jahr 2100 sorgt, verdrängt, was hier und jetzt abläuft. Die zu große Überwachung der Privatsphäre wird beklagt und mit dem Ausdruck weitgehender Hilflosigkeit bekämpft, während doch eine viel umfassendere Überwachung überfällig wäre, um die Übel unserer Zeit an der Wurzel packen zu können. Für die Zukunft ist es reichlich bedeutungslos, wer mit wem telefoniert oder per E-Mail korrespondiert. Entscheidend ist, was gemacht wird, wie eingegriffen wird in die Abläufe in der Natur, wo welche Veränderungen in welchem Umfang vollzogen werden. Das grüne Streben nach Gleichgewichten ist nichts weiter als die Illusion, den Lauf der Zeit anhalten zu können. Alles geschieht in der Natur wie in der Menschenwelt aus Ungleichgewichten heraus. Unsere Konzepte von Ökologie und Umweltschutz müssen grundlegend überdacht und in den entscheidenden Grundlagen überarbeitet werden. Kein Status quo lässt sich aufrechterhalten, möge er noch so wünschenswert erscheinen. Alles Wirken der Menschen gehört auch zu den Prozessen der Evolution. Sie gibt von sich aus keine Richtung vor. Die von Zivilisationen gewählte Entwicklung entspringt fast immer dem persönlichen Egoismus weniger Menschen. Dem Wohl der Menschheit dient sie nicht.
Die Vorgänge in der menschlichen Geschichte unterscheiden sich, genauer betrachtet, offenbar nicht wirklich von der allgemeinen Geschichte der Natur und dem Gang des Lebens auf der Erde. Menschengeschichte ist ein Seitenzweig der allgemeinen Lebensgeschichte, der biologischen Evolution, so wie auch die Naturgeschichte der Lebewesen ein Spross der Erdgeschichte ist. Seit Darwin 1859 sein epochales Werk über den Ursprung der Arten veröffentlicht hat, kennen wir das Grundprinzip, das er von Herbert Spencer übernahm: Survival of the fittest – Überleben der Tauglichsten. Die Menschheit praktiziert dieses Prinzip in geradezu ungeheuerlicher Konsequenz allen Warnungen besonnener, sozial gesinnter und verantwortungsbewusster Menschen zum Trotz. Die heutige Globalisierung meint die Verdrängung der Schwächeren, der weniger Fitten genauso wie das dominant gewordene politische System. Den politisch Verantwortlichen von heute dienen in die ferne Zukunft projizierte Ängste als höchst willkommene Ablenkung von den hier und jetzt zu lösenden Problemen. Mit vorgeschobenem Engagement und teurem Aktionismus entziehen sie sich der Verantwortung für die Missstände der Gegenwart. Das Ziel ist ebenso klar, wie es geschickt verschleiert wird: Weitermachen wie bisher und neue Steuern eintreiben für unnütze oder schädliche Investitionen.
Doch geklagt wurde bekanntlich über die Zeit und ihre Fehler zu allen Zeiten und mit den unterschiedlichsten Begründungen. Darum geht es mir in diesem Buch nicht. Es hat andere Zielsetzungen. Sie entsprechen den drei Kernthemen. Das erste ist die Kritik an der viel zu statischen Ökologie, die durch eine dynamischere, der Wirklichkeit angemessenere Sicht der Natur abgelöst werden sollte und die das möglich macht, was angeblich angestrebt wird, nämlich die nachhaltige Entwicklung (sustainable development). Die zweite hat die Hinführung zu der Erkenntnis zum Ziel, dass Evolution immer und überall wirkt, auch in menschlichen Gesellschaften. Und dass daher der alten Weisheit endlich zum Durchbruch verholfen werden sollte, dass nichts so bleiben kann und bleiben wird, wie es einmal war oder gerade ist. Drittens schließlich geht es darum, dass sich der Naturschutz von seiner Orientierung daran, wie es einmal war, löst und neue Visionen für die Erhaltung der Lebensvielfalt in einer sich unablässig wandelnden Welt entwickelt. Wer nur am Alten hängt, wird es verlieren.
Es liegt in der Natur einer Rückschau, dass persönliche Entwicklungen und Erfahrungen die Leitlinie bilden auf den Gängen durch die Räume der Ökologie in die Zeiten der Evolution. Eine Autobiographie kommt dadurch nicht zustande, und das Buch soll auch keine werden. Gleichwohl mögen die Schilderungen aber ein Beispiel dafür abgeben, wie viel mit dem jeweils ganz persönlichen Lebensweg verbunden ist. Das sich wandelnde Denken beeinflusst jeden Lebenslauf vergleichbar intensiv wie die äußeren Änderungen von Landschaft, Umwelt und insbesondere die Erfahrungen, die man auf anderen Kontinenten und in fremden Kulturen gewinnt. Im Endeffekt ist alles persönlich. Die Ausführungen können daher nur in ihrem Verhältnis zur Sicht anderer Menschen aufgenommen werden. Optimallösungen sind herrlich einfach denkbar, aber so gut wie nie zu realisieren. Nachvollziehbar werden könnte allenfalls die Begeisterung, die mit der Naturforschung verbunden ist. Sie wird heutzutage den Kindern und Jugendlichen, auch den naturinteressierten Erwachsenen dermaßen erschwert, wenn nicht nahezu gänzlich unmöglich gemacht, dass vieles in meiner Rückschau auch Erinnerung an schönere Zeiten ist, in denen die Natur noch zugänglich und nicht – angeblich zu ihrem Schutz – durch Verordnungen, Gesetze und Zäune versperrt war. Dieser unerträgliche Zustand ließe sich ändern, ganz unabhängig davon, wie es weitergeht mit der großen Welt. Die Entfremdung von der Natur, die sich am deutlichsten ausdrückt in ihrer zunehmenden Pseudorepräsentanz in der virtuellen Welt der Medien, ist im übersatten, verglichen mit dem großen Rest der Welt unvorstellbar reichen Europa und Nordamerika das eigentliche Problem. Je wirkungsvoller die Menschen von der Natur abgehalten werden, desto weniger Widerstand setzen sie den ausbeuterischen Veränderungen entgegen. Wen interessiert, wie lange das zauberhafte Lied des Uirapurú, des Flageolett-Zaunkönigs, im Dämmerlicht amazonischer Regenwälder erklingen wird, wenn man schon bei uns keine Lerchen mehr singen hört, weil Mais, Raps und Windräder »grün & gut« sind, auch wenn sie alles vernichten, was auf unseren Fluren an Restnatur leben könnte? Insofern ist dieser Rückblick auf den eigenen, sehr vielfältigen Weg in die Natur der Versuch, auszudrücken, welche Erlebniswerte in ihr stecken. Alles Menschengemachte lässt sich wiederherstellen. Alles Erlebte ist Erinnerung. Wie ärmlich und wie stark vereinheitlicht sie ausfällt, entscheidet sich in den Entwicklungen unserer Zeit. Es macht mich zutiefst betrübt, dass ausgerechnet der Naturschutz die Menschen am meisten davon abhält, Natur zu erleben.
Daher bin ich dem Leben dankbar für den großen Schatz an Erinnerungen, den ich bei meiner Betätigung in der Natur gewinnen konnte. Sie sind einzigartig und nicht wiederholbar. Das gilt für alles, was dem Lauf der Zeit unterworfen ist. Um Wiederholbarkeit kann es niemals gehen. Umso mehr aber darum, dass die Möglichkeiten zum Naturerlebnis erhalten bleiben. Die Menschen unserer Zeit sollten dies den nachfolgenden Generationen gegenüber als Bringschuld empfinden. Lebendige Natur lässt sich nicht wie Menschenwerk museal magazinieren und bei Bedarf wiederherstellen. Sie braucht die Räume für ihre eigenständige Entfaltung. Und die Bereitschaft, das andere, das nichtmenschliche Leben auch leben zu lassen. Daran mangelt es in unserer Gesellschaft mehr denn je.
Was ich für die nachfolgenden Texte auswählte, ist das, was mir wichtig erschien und was ich in Notizbüchern festgehalten hatte – nicht, was ich aus der Rückschau über mehr als ein halbes Jahrhundert für bedeutsam halten würde. Rote Fäden werden so gut wie immer nachträglich konstruiert. Mitunter sind sie vorhanden, ohne dass man sie bemerkt. Zufälle ergeben neue Notwendigkeiten; vermeintlich Wichtiges verliert an Bedeutung. Wie im Prozess der Evolution! Beurteilt werden kann immer erst vom vorläufigen Ende her. Denn alles ist Zwischenbilanz im Fluss der Zeit. Kaum etwas fällt uns aber so schwer, wie die Vorläufigkeit dessen zu akzeptieren, von dem wir gerade zutiefst überzeugt sind. Mehrfach musste ich meine feste Meinung ändern, weil neue, bessere Befunde dagegenstanden. Und, noch häufiger, Positionen relativieren, die an einem Ort zu bestimmter Zeit ihre Berechtigung gehabt haben mochten, jedoch keineswegs deshalb allgemeine Gültigkeit beanspruchen konnten. Skepsis wurde nötig. Sie ist nötiger denn je, seit große Teile der Gesellschaft geneigt sind, den Computermodellen mehr zu glauben als der Wirklichkeit. Wer glauben will, verwirft die Skepsis. Das ist der gläubigen Menschen gutes Recht, widerspricht aber dem Grundprinzip der Naturwissenschaft. Skeptisch zu sein ist nicht sonderlich schwer, gleichwohl nicht günstig, wenn es um Forschungsgelder geht. Viel schwieriger ist eine vernünftige Abwägung der Befunde und der möglichen Schlussfolgerungen. Vereinfachungen scheitern immer wieder an der Komplexität der Wirklichkeit. Kontrollierte Experimente wie auch Modelle, die uns die Wirklichkeit abbilden sollen, verdienen besondere Skepsis. Modellgläubig wird, wer die Vielfalt ausblendet, bewusst oder unbeabsichtigt. Insofern könnten die nachfolgenden Ausführungen hilfreich dafür sein, nicht allzu schnell über allzu einfache Modelle die Lösung zu suchen oder gar gefunden zu haben zu glauben. Die Mannigfaltigkeit von Natur, Menschheit und Kulturen ist für jegliche Vereinfachung zu groß. Weil diese Vielfalt das Leben selbst und seine Entfaltung repräsentiert, ist sie das höchste Gut.
Fußnoten
[1]
Die genaue Bezeichnung ist eigentlich Andorinhão-velho-da-cascata; die Vergrößerungsform Andorinhão bezeichnet im Brasilianischen die Segler als die »großen Schwalben«, was nicht immer passt, weil manche Segler kleiner als große Schwalben sind. Beide Vogelgruppen sind jedoch nicht näher miteinander verwandt.
1. Kapitel Die Anfänge
Ein richtiger Totenkopf
Ein Totenkopf, ein echter Menschenschädel, bildete das beste Stück des kleinen Laboratoriums, das ich mir daheim in einer engen Dachbodenmansarde in meiner frühen Jugendzeit einrichten durfte. Der Raum war so schmal, dass sich die Tür, die hineinführte, nicht ganz öffnen ließ. In schräger Haltung musste ich ein paar Schritte weitergehen, bis ich in mein verborgenes Reich kam. An der Decke gab es eine Glühbirne. Ein Glasziegel ließ Tageslicht herein. Genau darunter stand mein Labortisch. Er war etwa einen Meter breit. Darauf machte ich verschiedene chemische Experimente oder pflückte die Schädel von Wühlmäusen aus Gewöllen von Eulen. Auch ein Mikroskop zählte zu meinen Schätzen. Es diente mehr der Verzierung des Arbeitplatzes als echten mikroskopischen Studien, denn seine Leistung war miserabel. Dennoch freute es mich unsäglich, ein mit bestimmten chemischen Stoffen eingefärbtes und durch ein tiefblaues Kobaltglas angestrahltes Präparat unter dem Mikroskop aufleuchten zu sehen. Viel lieber aber schaute ich mir mit einer kleinen Lupe die Mäuseschädel an, weil der Blick durchs Mikroskop die Augen zu sehr anstrengte. Irgendwann fand ich draußen im Wald einen Hasenschädel. Der war handlicher, und er ließ sich auch besser mit den gezeichneten Vorlagen vergleichen als die kleinen Schädel der Mäuse.
Den Menschenschädel erhielt ich auf ziemlich ungewöhnliche Weise. Ich war gerade 14 Jahre alt geworden, und das Leben im Dorf hatte sich Ende der 1950er Jahre wieder weitgehend normalisiert. Zahlreiche Fremde waren in den Dörfern in Niederbayern als Heimatvertriebene gestrandet. Unter ihnen war ein Zahnarzt. Niemand wusste so recht, woher er stammte, außer dass er Russe war. Er bekam kaum Patienten. Eine Freundin meiner Mutter hatte ihn am Kriegsende aufgenommen. Dort blieb er, ohne eine richtige Praxis zu eröffnen. Vielleicht war er zu schwach dafür nach den langen Kriegsjahren, unter denen er offenbar schwer gelitten hatte. Diesen Eindruck machte er, wenn man ihn, was selten genug der Fall war, auf der Straße zu sehen bekam. Eines Tages kam die Freundin zu meiner Mutter und erzählte ihr, dass ihr Gast gestorben sei. Er habe keine Angehörigen, wie er ihr noch vor seinem Tode gesagt hatte. Das wenige, was er besitze, könne und solle sie behalten und damit machen, was sie wolle. Unter diesem wenigen war ein Totenkopf; ein richtiger Menschenschädel.
Der Freundin meiner Mutter war so ein Erbstück in höchstem Maße unheimlich. Wer der einstige Träger dieses ganz gut erhaltenen Schädels gewesen sein mochte, darüber wollte sie lieber nicht nachdenken müssen. Deshalb könne ich ihn haben, wenn ich den Schädel wolle. Auf diese Weise erhielt ich den Totenkopf. Mit einem Federzug ließ sich der Unterkiefer, dem ein paar Schneidezähne fehlten, auf- und zuklappen. Die Augenhöhlen waren recht düster geworden. Den Gehirnschädel überzog aber ein feiner bernsteinfarbener Schimmer. Der Totenkopf war auch meiner Mutter ziemlich unheimlich.
Da der Zahnarzt aus Russland stammte, dürfte der Mensch, dessen Schädel ich nun in Händen hielt, wohl ein Russe gewesen sein. Vielleicht stammte er aus noch östlicheren Gebieten, aus Sibirien. Auf der Krim und im Kaukasus war mein Vater im Krieg gewesen. Was er von dort meiner Mutter beim Heimaturlaub erzählte, war stets Gutes über die Russen. Mag sein, dass sie deswegen einverstanden war, dass ich den Schädel annahm, für mein wissenschaftliches Interesse, wie sie mit kaum verborgenem Stolz zu ihrer Freundin meinte. So wurde ich im Alter von vierzehn Jahren Besitzer eines Menschenschädels. Oft hielt ich ihn in Händen, strich über seine Rundungen, unter denen das Gehirn gewesen war, oder sah mir Munddach und Rachen an. Gedanken darüber, was für ein Mensch das gewesen sein mochte, wenn ich dem Schädel in seine leeren Augenhöhlen schaute, machte ich mir wahrscheinlich nie. Die Nasenöffnung sah am wenigsten gut aus. Sie wirkte beschädigt, war aber, wie ich später bemerkte, ganz in Ordnung. Dass einige Zähne fehlten, störte am wenigsten bei meinen Betrachtungen, wie so ein Menschenschädel gebaut ist und wie stark der Gehirnschädel die Gesamtform bestimmt. Ganz anders sahen die Schädel von Mäusen und Hasen aus, die ich schon recht gut kannte; fast ganz Schnauze waren sie, mit wenig Gehirnschädel. Beim Menschenschädel verhalten sich die Anteile genau umgekehrt. Sogar die größte Öffnung, der Mund, scheint nicht so stark nach vorn gerichtet zu sein wie die beiden Augenhöhlen. Diese verleihen dem Kopf weit mehr Gesicht als der Schnauzenteil, der andere Säugetiere so sehr prägt. Und noch etwas fiel mir auf und blieb verhaftet in der Erinnerung: Der Menschenschädel hat seinen Ansatz zum Körper nach unten zu und nicht nach hinten! Brachte ich meine Hasen- oder Mäuseschädel so in Position, dass sich das Hinterhauptsloch mitten auf meiner Handfläche befand, ragten sie mit den Kiefern steil nach oben. Der Menschenschädel lag mir zugewandt in der Hand. Wir Menschen tragen den Kopf oben, wie mir dieser Schädel deutlich machte, und nicht vorn, wie das bei den Säugetieren üblich ist.
Das Hinterhauptsbein, das Occipitale, wie ich es zu benennen lernte, als ich die Knochen studierte, aus denen der Menschenschädel zusammengesetzt ist, wölbt sich ähnlich stark nach hinten und unten wie bei den Vögeln, die auch den Kopf oben haben. Nach vorn bestimmt der Stirnbereich das Aussehen. Unter diesem befindet sich, wie ich gleichfalls bald erfuhr, jene Bildung unseres Gehirns, der Neocortex, dem wir die geistige Leistungsfähigkeit verdanken. Mund und Kiefer werden davon überwölbt. Natürlich kann man all dies auch am Kopf des lebenden Menschen sehen. Aber es ist etwas anderes, einen richtigen Menschenschädel in der Hand zu haben und diesen in aller Ruhe und immer, wenn’s beliebt, herumzudrehen und zu betrachten. Für mich machte es später einen gewaltigen Unterschied, eine noch so gute Nachbildung des gesamten menschlichen Skeletts mitsamt Schädel nur als Plastikpräparat anzuschauen oder echte Knochen in Händen zu haben. Vielleicht interessierten mich Entstehung und Entwicklung des menschlichen Schädels weit mehr als der Rest des Skeletts, obgleich insbesondere Beine und Füße Eigenschaften aufweisen, die zum Verständnis unserer Evolution maßgeblich sind.
Der Schädel kam ins Wandregal neben meinem Arbeitstischchen. Machte ich chemische Experimente, entfernte ich ihn vorsorglich, um ihn auf keinen Fall zu gefährden! Da in mein verborgenes Labor unterm Dach kaum jemals jemand kam, waren Erklärungen zu Herkunft und Bedeutung dieses Totenkopfes nicht nötig. Meine Mutter gewöhnte sich daran wie an andere Merkwürdigkeiten auch, die ihr anfänglich suspekt vorkamen. Als ich fünf Jahre später mit dem Biologiestudium anfing und dabei auch über den Menschen etwas lernen sollte, war mir das wenige, das dazu in der Zoologie geboten wurde, schon bestens vertraut. Meine Kommilitonen wunderten sich manchmal über meine speziellen Kenntnisse zum Bau des menschlichen Schädels. Sie fragten aber nicht nach der Herkunft dieses Wissens. Lieber vertieften sie sich weiter in die Zuchten von Taufliegen (Drosophila), mit denen wir experimentierten, um Genetik zu lernen. Die kleinen Fliegen waren damals das beherrschende Modell der Biologie. In der »Vergleichenden Anatomie der Wirbeltiere« bearbeiteten wir nur die Ratte als Vertreterin der Säugetiere und die Taube für die Vögel. Den Körperbau der Reptilien hatten wir an Landschildkröten mehrerer unterschiedlicher Arten zu studieren. Die Mengen, die dafür an lebenden Schildkröten bereitgestellt wurden, machten mich sehr betroffen, zumal im Praktikum nahezu niemand an der Anatomie der Schildkröten erkennbar interessiert war. Als die Lurche an der Reihe waren, stand der Frosch zur Verfügung. Letzterem mussten oder durften wir – je nach Gemüt fiel die Beurteilung dazu ganz anders aus – »decapitieren«. So hieß das Kopfabschneiden am lebendigen Frosch. Das kannte und konnte ich längst, da ich es, angeleitet durch ein Buch für das zoologische Praktikum, bereits in meiner Schulzeit ausprobiert hatte. Als vielfältiger erwies sich lediglich der Praktikumsteil über die Fische. Hierzu bekamen wir die Köpfe großer Meeresfische in den benötigten Mengen vom Fischmarkt. Aus Eimern konnten wir nach Lust und Laune herausholen, welchen Fischkopf wir zerlegen wollten. An seinen zahlreichen, nur lose zusammenhängenden Knochen verzweifelten viele. Letztlich blieb für mich mein echter Totenkopf das entscheidende Stück, an dem ich unseren Schädelbau während des Zoologiestudiums kennenlernte.
Seine Wirkung verspürte ich zwei Jahrzehnte später wieder, als ich mich mit der Evolution des Menschen befasste. Natürlich ahnte ich das als Jugendlicher und als Student nicht. Aber offenbar hatte der Menschenschädel mein Interesse damals schon so erregt, dass ich gar nicht merkte, wie er weiterhin präsent blieb. Er beeinflusste auch die Wahl meines Lesestoffs. So fing ich schon vor dem Biologiestudium an, mich mit dem großartigen Buch des Biologen Bernhard Rensch Homo sapiens – vom Tier zum Halbgott intensiv zu beschäftigen. Ich las auch alle verfügbaren Werke von Adolf Portmann und arbeitete mich durch seine Vergleichende Morphologie der Wirbeltiere. Vielleicht verdanke ich es diesem Totenkopf, dass ich an der Universität München im 3. Semester im Kurs »Vergleichende Anatomie der Wirbeltiere« als Hilfsassistent mitwirken durfte. Ich war anscheinend durch meine ungewöhnlichen Kenntnisse der Knochen aufgefallen. Frühere Klassenkameraden aus dem Gymnasium bekamen mich, nachdem sie ihren Militärdienst abgeleistet hatten, nun zu ihrer Überraschung und zu unserer gemeinsamen Freude im Praktikum als Hilfsassistent zugeteilt.
Andere Totenköpfe
In den ersten Jahren, in denen ich mich des Besitzes eines echten Menschenschädels erfreute, rückten andere Totenköpfe zeitweise in den Vordergrund. Sie wurden mir gebracht, nachdem ich einmal einen solchen in der Nachbarschaft herumgezeigt hatte. Bei der Kartoffelernte fand ich auf dem Feld glänzend mahagonifarbene Puppen von der Größe eines kleinen Würstchens. Damals, es war in den Jahren 1958 bis 1960, wurden im niederbayerischen Inntal die Kartoffeln noch mit einem einfachen Pflug ausgeackert. Ein Pferd zog langsam Furche für Furche. Die Kartoffeln wurden mit den Händen vollends ausgegraben, in Drahtkörben gesammelt und auf einen Brückenwagen verladen. Kinder und Jugendliche mussten bei der Kartoffelernte helfen. Dabei fand ich die Puppe in unserem Acker in einer vom Pflug nur angerissenen, aber nicht zerstörten Erdhöhle. Sie lag direkt neben großen Kartoffeln. Offenbar war sie unverletzt und lebendig, denn sie zuckte so heftig mit dem Hinterleib, dass ich sie beim ersten Anfassen gleich wieder fallen ließ. Das passierte mir aber nur einmal, dann wusste ich Bescheid. In einer Naturzeitschrift, dem Kosmos oder dem Orion, hatte ich über den Totenkopfschwärmer gelesen. In jenen Jahren, besonders im sehr warmen Sommer 1959, flogen sie recht regelmäßig und offenbar auch in großen Mengen über die Alpen nach Mittel- und Nordeuropa. Die Totenkopfweibchen legten ihre Eier am jungen Kartoffelkraut ab. Die Abbildungen im Heft zeigten die riesigen gelben Raupen mit ihren bläulichen Schrägstrichen an den Seiten und dem geschwungenen, nicht richtig spitz auslaufenden Horn am Körperende. Gesehen hatte ich noch keine. Wie die Puppen aussehen, wusste ich aus diesen Zeitschriften. Nun hielt ich eine solche in Händen!
Wahrscheinlich war ich an dem Tag, an dem ich die erste Totenkopf-Puppe fand, nicht mehr ganz so tüchtig bei der Kartoffelernte. Sie beschäftigte mich. Ich trug sie in einer Tasche meines Hemdes an der Brust und achtete darauf, sie ja nicht zu drücken oder sonst wie zu beschädigen. Daheim gab ich sie in ein Glas, das mir meine Mutter zur Verfügung stellte – nicht gern, weil Einweckgläser mit Glasdeckel damals noch eine kleine Kostbarkeit waren. Aber meiner Puppe durfte nichts geschehen. Sie wurde auf Torfmull gelagert, den ich immer wieder leicht mit Wasser besprühte. Das Glas stellte ich in der Küche ans Fensterbrett. Anfang Oktober hatten wir die Kartoffeln geerntet. Eines Abends um die Mitte des Monats passierte das Erhoffte: Die Puppe zuckte, platzte auf und ein Totenkopfschwärmer kroch langsam daraus hervor. Anscheinend war er ganz in Ordnung. Auf dem Rücken zeigte sich die kleine gelblich-helle Zeichnung, die allerdings nur mit viel morbider Phantasie an einen Totenkopf erinnert. Zu tun hat sie damit natürlich nichts. Mit dieser »Deutung« verhält es sich ähnlich wie mit den Sternbildern. Die Menschen wollen ein Bild sehen, auch wenn keines existiert. Dann erst können sie das Geschaute benennen. Auf diese Weise erkannte man den Totenkopf auf dem großen Schwärmer schon im Mittelalter. Sogleich erhielt er die Aura des Furchterregenden und Bösen. Vielleicht kam noch etwas anderes hinzu. Der Totenkopfschwärmer dringt in Bienenstöcke ein. Mit seinem kurzen, kräftigen Rüssel saugt er Honig aus den Waben. Ein solcher Diebstahl war in jenen Zeiten, in denen der Honig die einzige Süße lieferte, natürlich eine schlimme Tat. Auch wenn sich der Schmetterling dabei höchstens ein paar Tropfen Honig holte, galt er als Schädling. Zudem trug er das Zeichen!
Doch zurück zum ersten geschlüpften Totenkopf: Seine Flügel sahen noch recht zerdrückt und geschrumpft aus. Ich bemerkte rechtzeitig, dass er zu ihrer Entfaltung in die Höhe kriechen können musste. Am glatten Glas gelang das nicht. Also ließ ich ihn auf meinen Finger und von diesem an die Gardine klettern. Nach etwa einem Meter hielt er inne, pumpte mit dem Hinterleib und streckte sich. Die Flügel wurden immer länger. Ihre feine Zeichnung wurde deutlich. Ein paar Stunden mag es wohl gedauert haben, bis die Streckung vollendet war. Dann gab er einen dicken Tropfen milchiger Flüssigkeit ab, das Meconium. Darin ist alles angesammelt, was sich an Abfallstoffen während der Entwicklung von der Raupe zum Falter in der Puppe angesammelt hat und nicht ausgeschieden werden kann. Eingedickt als breiige Harnflüssigkeit, vermindert das Meconium den Wasserverlust während der Umwandlung, der Metamorphose, zum Schmetterling.
Draußen war inzwischen das Wetter schlecht geworden. Kein goldener Oktober stellte sich ein. An ein Freilassen war also nicht zu denken; der Totenkopfschwärmer hätte niemals den Flug über die Alpen geschafft. Auch wusste ich, dass dies ohnehin nur außerordentlich selten einmal gelingt – wenn überhaupt! So las ich es. Warum diese riesigen Schwärmer dennoch über die Alpen fliegen, schien mir unverständlich und rätselhaft. Jedenfalls tötete ich ihn mit Äther und präparierte ihn mit schön gespannten Flügeln für meine Sammlung, die diese Bezeichnung gewiss nicht verdiente, war sie doch mehr ein Sammelsurium von all dem, was irgendwie mein Interesse erregt hatte. Es gab darin einige Käfer, andere Insekten, leere Häuschen von gebänderten Schnecken und auch Steine, die mir gefielen. Richtige, dicht genug schließende Insektenkästen waren damals für mich unerschwinglich teuer. Daher benutzte ich andere Kästen und Schachteln als Ersatz. Ein Sammler wurde ich dennoch nicht, weil es stets nur Stücke der Natur waren, denen mein Interesse galt. Sie hatten mehr die Bedeutung von Belegstücken, als dass sie Teile einer wohlgeordneten, auf Vollständigkeit bedachten Sammlung werden sollten. Der Totenkopfschwärmer wurde darin das Prachtstück. Tatsächlich zeigte ich ihn gelegentlich her, so stolz war ich auf ihn, und entsprechender Bewunderung konnte ich sicher sein. Deshalb erhielt ich von verschiedenen Leuten im nächsten Herbst weitere bei der Kartoffelernte gefundene Puppen zum Züchten. Das klappte so vorzüglich, dass ich mich darüber wundere, warum offenbar keine Puppe von Parasiten befallen war. Eine einzige, die tatsächlich nicht ausschlüpfte, erwies sich später als innerlich vertrocknet, jedoch nicht von Schlupfwespen oder anderen Parasiten befallen. Einer der bei mir geschlüpften Totenköpfe trug ein stark abweichendes Zeichnungsmuster auf einem der beiden Vorderflügel; vielleicht die Wirkung eines verfrühten leichten Nachtfrostes.
Jenes Jahr 1959 war nicht nur ergiebiger dank der Bekannten, die mitsuchten, sondern auch weit wärmer verlaufen als das vorausgegangene. Und es gab nach kurzem Kaltlufteinbruch einen schönen Oktober. Deshalb ließ ich eine ganze Anzahl der gezüchteten Totenkopfschwärmer frei, als sie die entsprechende Kondition erreicht hatten. Ein paar von ihnen saugten bei mir vorher begierig etwas verdünnten Honig. Im dicken Rohr des Rüssels verschwanden schnell ganze Tropfen. Störte ich sie unbeabsichtigt, hoben die Schwärmer abwehrend ihre wie mit flauschigem Samt besetzten Pfötchen. Manchmal wurden sie so gierig, dass ich sie vorsichtig mit zwei Fingern fassen und anheben konnte, ehe sie das Saugen unterbrachen. Dann zeigten sie zur Abschreckung die gelben, von schwarzen Querbinden durchzogenen Hinterflügel, die sie blitzschnell durch Wegziehen der deckenden Vorderflügel mitsamt dem gelb und blauschwarz geringelten, dicken Hinterleib hochschnellen ließen. Das sieht sehr eindrucksvoll aus.
Wie gut es wirkt, demonstrierte ungewollt ein eben geschlüpfter Totenkopf, der seine Flügel ausgestreckt und gestärkt hatte. Als er trocken war, kletterte er noch ein Stückchen weiter die Gardine hoch. Diese Bewegung sah meine Katze. Sie hatte auf dem Sofa darunter gelegen und vor sich hin gedöst, wie meistens am Abend zu dieser Zeit im Herbst, wenn für Katzen draußen nichts mehr los ist. Sie richtete sich auf, streckte sich zur Gardine empor, fasste mit den ausgefahrenen Krallen einer Vorderpfote Halt am Stoff und wollte den großen Schmetterling gerade mit der Nase anstupsen, als ihr dieser mit einem schrillen Quietschton seine Gelb-Schwarz-Zeichnung auf Hinterflügeln und Hinterleib entgegenschnellte. Vor Schreck fiel die Katze aufs Sofa und sogar bis zum Boden hinunter, von wo aus sie, offenbar ziemlich verwirrt, nach oben schaute – und von uns ausgelacht wurde! Die Wirkung dieser »Schrecktracht« war in der Tat ein richtiger Schreck, wie es ein Experiment nicht deutlicher hätte zeigen können. Die Katze, sonst nicht feige in ihrem Verhalten – konnte sie doch sogar den Schäferhund der Nachbarn mit, wie es schien, souveräner Würde auf Abstand halten –, machte keinen zweiten Versuch. Wenn ich sie zu einem Totenkopfschwärmer hinschob, wehrte sie sich und wollte weg, als dieser zu Piepsen anfing.
Offenbar wirkt der hauptsächlich im Ultraschallbereich liegende Ton viel stärker, als wir mitbekommen, weil wir zu wenig davon hören. Es handelt sich sogar um einen der höchst seltenen Fälle aktiver Tonerzeugung bei einem Schmetterling. Ein Kehlkopfdeckel erzeugt im Schlund den schrillen Ton, nicht etwa das Reiben von Hartteilen am Körper wie bei Heuschrecken und anderen Insekten. Für die hochempfindlichen Ohren der Katze wirkte das Quietschen des Schmetterlings weit besser als sein Präsentieren des Farbmusters, weil Katzen direkt vor ihrer Schnauze ja fast nichts sehen können. Sie ertasten sich diesen Nahbereich mit ihren Schnurrhaaren (Vibrissen). Bei einem Vogel zählt hingegen sicherlich weit mehr – wenn nicht sogar ausschließlich – das warnende Farbmuster aus Gelb und Schwarz. Ein so großer und massiger Schmetterling wie der Totenkopfschwärmer, der manchen Kleinvogel an Spannweite der Flügel übertrifft und schwerer wird als kleine Kolibris, würde für Insektenjäger eine attraktive Beute darstellen. Er kann nicht sofort starten, wenn während seiner Ruhestellung Gefahr droht. Seine Flugmuskulatur muss sich warmzittern, um auf die Betriebstemperatur von 35 °C und mehr zu kommen. Dann erst ist der Schwärmer schnell genug, um einem Vogel davonfliegen zu können. Die großen Schwärmer haben wohl auch Fledermäuse kaum zu fürchten, denn diese sind zu langsam, um sie im Flug zu fangen.
Warum aber quietscht dann der Totenkopf, wenn der schrille Ton die Vögel kaum stört und er den Fledermäusen ohnehin davonfliegt? Vielleicht hängt es mit seiner tropisch-afrikanischen Herkunft zusammen. Dort suchen in der Dämmerung, bevor die großen Falter starten, Schleichkatzen und kleine, affenartige Säugetiere, die Galagos, intensiv nach großen, ungiftigen Insekten. Das Gehör dieser Tiere ist empfindlich genug und dem der Katze vergleichbar. Die wildlebenden Vorfahren unserer Hauskatze, die Falbkatzen, stammten aus dem subtropisch-mediterranen Bereich Nordafrikas und nicht wie die mit ihnen sehr nahe verwandten heimischen Wildkatzen aus den europäischen Wäldern.
Wies vielleicht das Erschrecken meiner Katze auf alte Zusammenhänge zwischen katzenartigen Jägern und diesen großen Insekten im fernen Afrika hin? Und ist der kurze, dicke Saugrüssel tatsächlich eine Anpassung zum Saugen von Honig, was mein Totenkopf so begierig praktizierte? Unsere Honigbienen stammen auch aus seiner Heimat. Aus wildlebenden Bienen waren sie vor Jahrtausenden im Nordosten von Afrika zum Haustier gemacht worden. Zur selben Zeit übrigens geschah dies, in der aus der nordafrikanischen Falbkatze unsere Hauskatze entstand.
Der kurze Rüssel des Totenkopfschwärmers taugt gewiss nicht sonderlich gut zum Saugen von Blütennektar, zumal aus dem anstrengenden Schwirrflug heraus. Holte sich der große Schwärmer damit seit jeher Honig von Wildbienen? Hängt sein Piepsen mit dieser Besonderheit der Nahrungssuche zusammen? Wie verhindert er, dass ihn die Bienen gleich totstechen, wenn er in einen Stock eingedrungen ist? Manchmal passiert das zwar, aber der eigentliche Grund mag dann gewesen sein, dass er sich zu voll gesaugt hatte und nicht mehr aus dem engen Einflugloch des künstlichen Bienenstocks herauskommen konnte. In freier Natur lebende Bienen haben meist nicht so extrem enge Einfluglöcher. Beruhigt das Schwirren seiner Flügel die Bienen, weil er damit ihren Eigengeruch verbreitet und vielleicht ihr Summen nachahmt? Verbreitete er sich in historischer Zeit mit der Imkerei nordwärts? Oder war es tatsächlich die amerikanische Kartoffel, die sein Kommen ermöglichte, als sie vor dreihundert Jahren recht plötzlich auf großen Flächen nördlich der Alpen reichlich Raupennahrung bot? Der Bittersüße Nachtschatten Solanum dulcamara, dessen Blätter als Futterpflanzen für die Raupen des Totenkopfschwärmers in Frage kommen, ist eigentlich viel zu selten für eine regelmäßige Nutzung als Nahrungsquelle und den doch so aufwendigen Fernflug über die Alpen. Lag es an der Kartoffel, müssten zu weit geflogene Falter diese neue Nahrung zufällig entdeckt haben. Fragen über Fragen warfen diese »meine« Totenköpfe auf. Die meisten von ihnen sind auch heute noch ungelöst.
Deshalb faszinieren mich diese Schwärmer immer wieder. Heute können ihnen Mini-Funksender auf ihre Wanderflüge über die Alpen mitgegeben werden, um die Geheimnisse ihrer Flugwege zu enträtseln. Doch verhindern die Artenschutzgesetze eine nähere Beschäftigung mit ihnen. Vor vierzig Jahren ging das Züchten von Totenkopfschwärmern noch ohne Genehmigung. Den interessierten Jugendlichen von heute nimmt der von den Naturschützern zuwege gebrachte Artenschutz die Möglichkeiten, frühzeitig an solch spannende Themen des Lebens heranzukommen. Den Totenkopfschwärmern hat das sicherlich nichts gebracht, vernichten doch nicht die jugendlichen Naturforscher ihre Puppen, sondern die vollautomatischen Kartoffelerntemaschinen. Diese dürfen das, während es jungen Menschen verwehrt ist, sich mit den geschützten Schwärmern zu befassen. Nach wie vor wissen wir nicht einmal sicher genug, ob es die im Herbst geschlüpften Falter schaffen, zurück über die Alpen zu kommen. Ansonsten wären ihre Vorstöße nordwärts nichts weiter gewesen als Sackgassen, die seit der Einführung der Kartoffel aus Südamerika lediglich weit aufgetan wurden, aber zu nichts führen. Wie dem auch sei, Totenkopfschwärmer und Kartoffel bilden ein Beispiel für eine wahrlich globale Vernetzung einer ehedem fremden Pflanze aus einem weit entfernten Kontinent und einem in der Antike schon bekannten Großschmetterling aus Afrika im neuen Lebensraum der Ackerfluren von Europa.
Die wenigen als Futterpflanzen geeigneten einheimischen Verwandten der Kartoffeln (Familie der Nachtschattengewächse) sind viel zu selten und könnten höchstens ersatzweise einmal diesen großen Wanderern dienlich sein. Ob das ausgereicht hätte, vor einem halben Jahrtausend oder noch früher die dazu nötigen Wanderflüge über die Alpen, vergleichbar dem Zug der Zugvögel, auszulösen? Jedenfalls prägten auch diese Totenköpfe mein Interesse an Schmetterlingen und speziell an Wanderfaltern auf ähnliche Weise, wie der echte Totenschädel zum Wegbereiter meiner Beschäftigung mit der Evolution des Menschen geworden war. Bemerkt habe ich dies allerdings im Fall des Totenkopfschwärmers weit früher, weil Schmetterlinge, genauer die Wasserschmetterlinge, Thema meiner Doktorarbeit wurden.