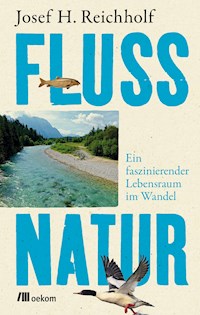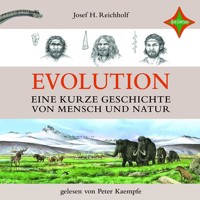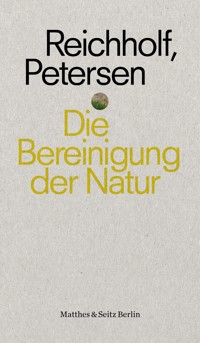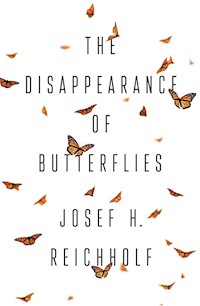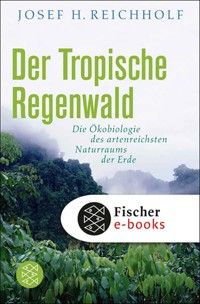Josef H. Reichholf
Stadtnatur
Eine neue Heimat für Tiereund Pflanzen
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
© 2023, oekom verlag Münchenoekom – Gesellschaft für ökologische Kommunikation mbH,Waltherstraße 29, 80337 München
Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, MünchenUmschlagabbildungen: Fuchs: Isselee/Dreamstime.com, Wildschwein: Eric Isselee/shutterstock, Kastanien: New Africa/shutterstockLektorat: Stefanie WeißInnenlayout & Satz: Ines SwobodaKorrektorat: Petra Kienle
E-Book: SEUME Publishing Services GmbH, Erfurt
Alle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-98726-262-3
Allen gewidmet, die gegen die Nachverdichtung kämpfen und sich einsetzen für die Erhaltung innerstädtischer Freiräume mit ihrer Natur.
INHALT
Drei Erlebnisse zur Einführung
Nachtigallen in Berlin • Wanderfalken am Kölner Dom • Braunbär im Museum
Teil IBetrachtungen
»Aus grauer Städte Mauern … • Ist das Wildschwein in der Stadt kein »Wild«-Schwein mehr? • Stadtpark, Naturpark, Nationalpark – suggestive Wörter • Wo beginnt »die Stadt«, wo endet »die Natur«? • Klischeebilder erzeugen Voreingenommenheit
Teil IIBefunde
Am besten erfasst: die Stadtvögel • Schwerer zu beurteilen, die Säugetiere • Kaum zu glauben, die nächtliche Schmetterlingsfülle • Was blüht denn da so alles? • Zwischenbilanz: Biodiversität in der Stadt
Teil IIIBegründungen
Biodiversität und Strukturreichtum • Faktor Stadtwärme • Verfügbarkeit von Nahrung • Der Erstick-Stoff und die Giftbelastung • Naturfreundliche Stadtmenschen
Teil IVBedrohungen
Gefährliches Leben in der Stadt • Direkte Verfolgungen auf dem Land • Rücksichtnahme auf Tiere in der Stadt • Parkpflege ist schonender als Landnutzung • Freiräume in der Stadt ermöglichen die Stadtnatur
Teil VBewertungen
Stadtnatur fördert die Lebensqualität • Nachverdichtung gefährdet Vielfalt und mindert Qualität • Die »gute Mischung« macht’s • Es gibt noch viel zu tun für die Stadtnatur • Die Städte zeigen, dass Mensch & Natur gemeinsam Zukunft haben
Nachgedanken
Über den Autor
Dank
Literatur
Artenregister
Bildnachweis Farbbogen
Drei Erlebnisse zur Einführung
Nachtigallen↱ in Berlin
Ein Abend im Mai. Autos schoben sich im Schritttempo in schier endlosen Kolonnen über eine mehrspurige Straße zur Peripherie der Millionenstadt, die noch nicht wieder Hauptstadt geworden war, dies aber bald werden würde. Das zeichnete sich ab, nachdem sich das historische Wunder der Wiedervereinigung ereignet hatte. Berlin zog nun an, was es aufnehmen sollte und konnte, wie ein gigantischer Strudel, der mit seinem Sog auf ganz Mitteleuropa wirkte. Verkehr, sehr dichten Verkehr, war ich aus München gewöhnt, von wo ich gekommen war. Noch per Flugzeug, weil die Bahnverbindung zu langsam, zu wenig ausgebaut war. Was sich auch bald ändern, verbessern sollte. Die Taxifahrt von Tegel zum Zielort ergab keine besonderen Ausblicke, obgleich ich beim stockenden Verkehr viel Zeit zum Schauen hatte. Doch bei der Ankunft am Hotel änderten sich meine von der Hektik der Reise gedämpften Empfindungen mit einem Schlag. Buchstäblich, denn der »Schlag« einer Nachtigall erreichte meine Ohren durchs Stadtgedröhn. Ich blieb wie angewurzelt stehen, das weiß ich noch ganz genau. Es war nicht nur »ein Schlag«, sondern ein vollständiger, voll klingender Gesang der Nachtigall. Aus einer kleinen Buschgruppe kam er mit dem unvergleichlichen Schluchzen, das dem Gesang der Nachtigall eine globale Spitzenposition unter den Vogelliedern eingetragen hat. Zwischen zwei Strophen sah ich sie von einem bodennahen Zweig zum nächsten huschen. Fast wie ein Mäuschen. Ein paar Schritte ging ich zu auf das Gebüsch. Die Nachtigall störte dies nicht. Sie sang und sang. In einer kleinen Anlage in der Nähe sangen weitere ↰Nachtigallen↱. Anderntags hörte ich ihre Lieder aus anderen Gebüschen und auch in Potsdam.
Von Berliner Ornithologen erfuhr ich, dass es über tausend ↰Nachtigallen↱ sind, die im Stadtgebiet singen. Schier unvorstellbar aus Münchner Sicht, macht doch eine Nachtigall in der »Weltstadt mit Herz«, wie sich München gern bezeichnet, allenfalls auf der Frühjahrswanderung kurz Zwischenrast und singt ein paar Strophen im so schönen Englischen Garten an der Isar, wo er etwas wilder, weniger parkartig wird. Dies ist für Münchner Naturfreunde ein besonderes Ereignis, auch wenn es kaum mehr als einige Tage bzw. Nächte andauert. Dann ist sie weitergeflogen, die Nachtigall, nach Unterfranken vielleicht, wo im Maintal warme Hänge von Rebstöcken überzogen sind, oder eben nach Berlin. Dort lebten damals, Anfang der 1990er-Jahre, allein ähnlich viele ↰Nachtigallen↱ wie in ganz Bayern. Da zudem in München und sogar auf dem (bayerischen) Land die Spatzen angefangen hatten, sich rar zu machen, setzten die Berliner Sperlinge für mich noch eins drauf mit ihrer Allgegenwart bis hinein in die dicht bebauten Zentren. Aus der ornithologischen Fachliteratur wusste ich überdies, dass es im Berliner Stadtwald, dem Grunewald, eine Anzahl (gut untersuchter) Habichtsbruten gab, dass der Schwarzmilan dort nistete und dass im Hochwinter allabendlich riesige Schwärme von Krähen ins Stadtzentrum strebten, um zu übernachten.
Berlin zeichnete sich also durch eine sehr reichhaltige und zahlenstarke Vogelwelt aus. Was sollte ich als Münchner dagegenhalten? So sehr ich nachdachte, es fiel mir keine Vogelart ein, die ich als Besonderheit hätte anführen können. Dabei hatte ich den Nymphenburger Park mit direktem Zugang gleichsam »hinter mir«, solange die Zoologische Staatssammlung im Nordflügel von Schloss Nymphenburg untergebracht war. An diesem Forschungsmuseum, das mit seinen Sammlungen zu den global zehn größten zählt, wie auch das Berliner Museum für Naturkunde, war ich über dreieinhalb Jahrzehnte tätig. Dank günstiger Lage, die sich mit dem Neubau der Zoologischen Staatssammlung ein Stück nordwestlich des Nymphenburger Parks ergab, der 1985 bezogen werden konnte, war eine intensivere Beschäftigung mit der Stadtnatur geradezu vorgegeben. Eine Nachtigall hörte ich in den 36 Jahren zwischen 1974 und 2010 nur ein einziges Mal auf dem Gelände der Zoologischen Staatssammlung, obwohl dieses so günstig aussieht für ↰Nachtigallen↱. Würde es als weitgehend unterirdisch angelegtes Gebäude in Berlin liegen, wäre das, war darauf wächst, gewiss höchst begehrt bei den ↰Nachtigallen↱. Spatzen gäbe es auch und sicherlich mehr Mönchsgrasmücken↱ und andere Kleinvögel. Zu diesem Schluss musste ich nach den Erfahrungen in Berlin kommen. Sie stimmten mich nachdenklich und warfen Fragen auf. Was machte Berlin so attraktiv? Anfang der 1990er-Jahre war mir das noch nicht klar, auch wenn sich etwas zu formen anfing, das mir im Lauf der Jahre eine andere Sichtweise auf die Städte und das, was in ihnen lebt, eröffnete. Eine weitere Berlintour gab dazu einen starken Anstoß.
Wanderfalken↱ am Kölner Dom
Um ↰Wanderfalken↱, die am Roten Rathaus in Berlin horsteten, ging es für eine Fernsehsendung über die ebenso erstaunlichen, wie erfreulichen Erfolge der Ansiedlung dieser global hochgradig gefährdeten Großfalken in Städten. Bruten am Roten Rathaus waren kurz nach der Wiedervereinigung auch im Hinblick auf Berlin selbst höchst attraktiv. Das bewies das Medieninteresse. Als wir mit dem Aufnahmewagen vorfuhren, war wie vorbestellt einer der Falken anwesend. Er saß wie eine Skulptur im oberen Bereich der Fassade und dies sogar recht günstig für die Fernaufnahme von der Straße her. Nach einigen Minuten streckte er sich, glitt wie schwerelos von seinem Sitzplatz und drehte einige Runden über dem Gebäude, als ob ein Falkner einen Schauflug mit seinem edlen Falken bieten wollte. Die Falknerei war in jenen Jahren noch eine große Bedrohung, der die ↰Wanderfalken↱ ausgesetzt waren. Reiche Araber am Persischen Golf zahlten für Jungfalken so viel, wie ein VW Golf kostete. Raub der Jungfalken drohte überall, wo ↰Wanderfalken↱ nisteten. Je rarer sie geworden waren, desto höher stiegen die Schwarzmarktpreise. Das Paar am Roten Rathaus in Berlin blieb davon ganz unbetroffen. Es ließ sich beobachten, wie auch die kleineren, überall in Städten vorhandenen Turmfalken. Bildfüllend bis ins Federdetail mit dem Lichtpunkt im Auge oder gar mit einer Spiegelung der Stadt auf dem Bildschirm, so mussten damals die ↰Wanderfalken↱ nicht gefilmt werden. Sie frei und offensichtlich ganz freilebend zu erblicken, war sensationell genug.
Wenige Jahre vorher drohten die ↰Wanderfalken↱ auszusterben. Global, nicht nur in einzelnen Regionen. Rückstände aus Pflanzenschutzmitteln, allen voran des einstigen Wundermittels DDT, hatten sich in der freien Natur angesammelt, über die sogenannte Nahrungskette enorm angereichert und tierische Nutzer, die sich in Spitzenpositionen befinden, massiv geschädigt. Den ↰Wanderfalken↱ zerbrachen die Eier beim Bebrüten. Andere Vögel, wie große Pelikane, traf es ähnlich, dazu mit Missbildungen der geschlüpften Jungen. DDT-Rückstände fanden sich bei den Pinguinen in der Antarktis und auch in der menschlichen Muttermilch, so dass regional vom Stillen der Babys abgeraten werden musste. Missbildungen wie stark verkürzte Arme, verursacht durch ein damals häufig genutztes Medikament namens Contergan, erschütterten zudem das Vertrauen in die Vorprüfung der Substanzen, die von der Chemischen Industrie auf den Markt gebracht und in riesigen Mengen, insbesondere in der Landwirtschaft, eingesetzt worden waren.
Daher wollte es so gar nicht ins Bild passen, dass das Comeback der ↰Wanderfalken↱ ausgerechnet über die Großstädte klappen sollte. Nicht in der wilden Natur lag offenbar ihre Zukunft, sondern über dem höchst naturfernen Häusermeer! Gute Ausfliegeerfolge an Jungfalken bestätigten, was die Blicke durch Ferngläser auf die über der Stadt jagenden Falken aufdrängten: Die Großstadt passte für sie, irgendwie. Die Fassaden mussten auch nicht so schön, so großartig und einmalig sein wie der Kölner Dom. An diesem, aber auch an Hochhäusern und Türmen von Heizkraftwerken, stellten die ↰Wanderfalken↱ fest, dass es sich durchaus gut leben lässt. Immer wenn ich nach Köln kam, meistens mit der Bahn, galten meine ersten Blicke dem Dom. Jedes Mal umschritt ich den grandiosen Vorplatz und schaute und suchte, bis ich sie wiederfand, die ↰Wanderfalken↱. Sie passten zu diesem gewaltigen Dom. Zudem waren sie willkommen, weil man sich von ihnen eine Dezimierung der Tauben versprach, die Fassaden verschmutzten und generell nicht gern gesehen waren. In jenen Jahren galt dies als praktizierte Ökologie: Die Ansiedlung der ↰Wanderfalken↱ in den Städten ließ sich mit der Bekämpfung der Taubenplage rechtfertigen. Sie waren also nicht nur rar und schön, die Falken, sondern auch nützlich. Das rechtfertigte ihr Leben in der Stadt. Und schützte sie vor der Verfolgung, die ihnen draußen in der freien Natur überall drohte. Von Seiten der Taubenzüchter nämlich, die ihre Zuchttauben, vor allem die für Fernflüge eingesetzten Brieftauben, nicht zum Falkenfutter geraten lassen wollten. Die Falkenhorste an den wilden Felswänden mussten daher rund um die Uhr überwacht werden, bis die Jungen ausgeflogen waren. Was sich von DDT und anderen Umweltgiften gerade erholte, bedrohten nun Falkner und Taubenzüchter. Die Großstädte wurden so automatisch zu besonderen Schutzgebieten für die großen Falken.
Braunbär im Museum
Hätte Bruno, wie der Braunbär genannt worden war, der über hundert Jahre nach der Ausrottung der Bären in den Bayerischen Alpen als Erster auf eigenen Pfoten von Österreich her die Grenze überschritt, hätte er wie die ↰Wanderfalken↱ in München leben können, würde er wohl immer noch am Leben sein. Doch am 26. Juni 2006 wurde er frühmorgens um 4.50 Uhr an der Rotwand, einem Berg in den oberbayerischen Alpen, mit zwei Schüssen geradezu standrechtlich in behördlichem Auftrag erschossen. Der Bär war nicht bloß unerwünscht in der »bayerischen Kulturlandschaft«, sondern nicht zu dulden, zumal er sich nach Bärenart auch aufgerichtet hatte, um die Lage zu sondieren. Was er bei seiner Suche nach Nahrung »anrichtete«, das hätten seine Freunde, und Bruno hatte deren viele, sicherlich liebend gern beglichen, ohne sich finanziell zu ruinieren. Wer der behördlich beauftragte Todesschütze war, das blieb geheim; ein Schutz, der notwendig war. Dass das Todesurteil für Bruno dem damals letztlich in oberster Instanz zuständigen Ministerpräsidenten politisch nicht gut bekam, erfüllte nachträglich viele Menschen mit einer gewissen Genugtuung. Bruno landete, gut präpariert, nach einigem Hin und Her im Münchner Museum Mensch und Natur. Was es dort über die Jahre an eine Art Beileidsbrett an Bekundungen von Betroffenheit, Mitgefühl und Wut auf die für Brunos Tod Verantwortlichen angeheftet zu lesen gab, müsste der Bayerischen Staatsregierung zu denken gegeben haben. Im Museum wurde Bruno zur Verkörperung einer neuen Form von Wildererromantik, die sich gegen »die Jäger, die Behörden, die Obrigkeit« richtete.
Wie sehr dieser Fall, der sich auf absehbare Zeit in ähnlicher Weise wohl nicht mehr wiederholen wird, damals schon bezeichnend war für den Artenschutz, wurde dann ein Jahrzehnt später mit dem Bayerischen Volksbegehren »Rettet die Bienen↱!« deutlich. Unter widrigsten Winterwetterbedingungen unterzeichneten 1,8 Millionen Stimmberechtigte dieses Volksbegehren, also weitaus mehr, als es Landwirte gab, die von den Folgen des besseren Insektenschutzes (ein wenig) betroffen sein würden. »Rettet die ↰Bienen↱!« wurde zum bisher bei weitem erfolgreichsten Volksbegehren in Bayern. Die größte bayerische Volkspartei musste einsehen, dass ihre Haltung das Volk nicht adäquat repräsentierte. Der amtierende Ministerpräsident sah sich genötigt, mit der weitgehenden Übernahme der erhobenen Forderungen einem Volksentscheid zuvorzukommen. Erstmals hatte damit »die Stadt« über »das Land« gestimmt, und dies sogleich so erfolgreich. Denn die weitaus meisten Stimmen kamen von der Stadtbevölkerung. Was dabei zutage trat, überraschte die Parteienpolitik und verunsicherte diese, obwohl es seit vielen Jahren offenkundig war, dass sich ein massiver Konflikt zwischen Stadt und Land aufbaute. Dabei ging es keineswegs nur darum, »gleichwertige Lebensbedingungen« für das Land zu schaffen. Den Städtern ging es um Lebensqualität. Und zu dieser zählt eben auch, vorrangig sogar, die Natur; eine Natur, die sich nicht nur als Grünkulisse plakativ anpreisen lässt, wie eine Großreklame der Landwirtschaft mit üppigst goldgelb blühender Löwenzahnwiese. Die Städter wussten längst, dass kurz nach der Aufnahme eines solchen Bildes gemäht wird, und dies dann mehrfach den Sommer über, so dass nichts mehr blüht, was die (Wild-)↰Bienen↱, Schmetterlinge und andere Insekten↱ besuchen könnten. Es war längst auch nicht zu überriechen, dass die »gute Landluft« vorgegaukelt wird, weil das Land mehrfach im Jahr mit übel stinkender Gülle geflutet wird. Die Städter hatten hinzunehmen, dass die Zufahrten »ins Land« nahezu ausnahmslos für ihre PKWs gesperrt worden waren, während riesige Traktoren, Mähdrescher und andere Landmaschinen auch auf Bundesstraßen mit Fernverkehr weiterhin frei unterwegs sein dürfen. Auch dass frisch versprühtes Gift mit dem Frühlingswind in die randlich gelegenen Privatgärten geweht wird, wo man es absolut nicht haben will. Das Land, »die Natur«, genießen sollten die Städter möglichst nur auf vorgegebenen Wegen und Pfaden.
In der Corona-Pandemie mit ihren Beschränkungen kam dieser Stadt-Land-Konflikt in noch größerer Schärfe zum Ausdruck. Bruno, der Bär, war ein Signal. Verstanden hat man es in der Landespolitik bis heute nicht wirklich. Die Städter sollten auf dem Land nichts zu sagen haben, am wenigsten, wenn es um Bewirtschaftungsformen geht. Auf diese grobe Vereinfachung lässt sich die Haltung vieler Landwirte und Waldbesitzer verdichten. Die Subventionen zahlen sollen sie hingegen bedingungslos, die Städter. Bär und Wolf, Fuchs und Hase, Schmetterling und Biene gehen sie dennoch nichts an. Für sie zuständig sind die, denen das Land gehört. Ein Denkmal wird man dem erschossenen Bären am Ort seines Todes wohl kaum errichten. Im Museum ist er »deplaziert« und in Vergangenes eingeordnet. Doch der Kontrast Stadt – Land bleibt. Eher verschärft er sich. Weil die bösen Städte auch nicht mehr wachsen sollten, denn dabei fressen sie »gutes Land«. Denn die Stadt ist das Ende der Natur! Diese Haltung vertreten sogar einige Naturschutzverbände.
Längst wissen wir es besser und können mit ungetrübten Blicken betrachten, welch vielfältiges und reichhaltiges Naturleben es in den Städten gibt. Doch jede Betrachtung der Städte und ihrer Natur muss die entsprechenden Verhältnisse auf dem Land berücksichtigen. Wie bei uns Menschen auch. In diesem Sinne sind die nachfolgenden Ausführungen zu verstehen. Die Stadtnatur ist Alternative und zugleich auch Spiegel zum Leben auf dem Land.
Teil I
Betrachtungen
»Aus grauer Städte Mauern …
… zieh’n wir durch Wald und Feld. Wer bleibt, der mag versauern, wir fahren in die Welt.« Dieses Lied hatte ich Ende der 1950er-Jahre im Musikunterricht als Schüler eines Gymnasiums in Niederbayern mitzusingen. Wie manch altes Lied, das ins Ohr ging oder das gelernt werden musste, sind mir die Anfangsstrophen noch immer geläufig. Ein paar Jahre später, 1965, erschien Alexander Mitscherlichs Schrift über »Die Unwirtlichkeit unserer Städte«. Beidem sah ich mich gleichsam von heute auf morgen ausgesetzt, als ich im selben Jahr an der Universität München das Biologiestudium begann.
Aufgewachsen in einem Dorf mit knapp tausend Einwohnern im sehr ländlichen niederbayerischen Inntal, zwanzig Kilometer entfernt von den nächsten Kleinstädten mit »höherer Schule«, hatte ich in den Jahren meiner späten Kindheit und in der Schulzeit eine außerordentlich reichhaltige Natur am Unteren Inn erlebt und für mich entdeckt. Sie prägte meine Interessen. Lange vor dem Abitur war mir klar, dass ich Biologie studieren würde. Parallel zu den schulischen Notwendigkeiten als Voraussetzung für ein solches Universitätsstudium versuchte ich, in der Natur, die gleich bei unserem Häuschen am Dorfrand begann, wo ich aufwuchs, so viel wie möglich an Tieren und Pflanzen kennenzulernen. Als Ornithologe fachlich schon anerkannt kam ich nach München und schrieb gleich in den ersten beiden Semestern eine umfangreiche Studie über die Wasservögel an den Innstauseen. Sie wurde sofort als sogenannte Zulassungsarbeit in Zoologie angenommen und trug mir ein Stipendium ein, das auch die Doktorarbeit mit einschloss.
Gleichsam vorbelastet von der Wasserwildnis am Inn mit den Inseln, Auen und Altwässern sah ich mich zu Beginn des Sommersemesters 1965 der Großstadt grauer Mauern und ihrer Unwirtlichkeit ausgesetzt. Das Zoologische und das Chemische Institut der Universität München, wo ich die meisten Vorlesungen und Praktika zu besuchen hatte, lagen im Stadtzentrum Münchens nahe dem Hauptbahnhof. Die Botanik residierte geradezu vornehm in der Nähe von Schloss Nymphenburg im Botanischen Garten. Das Geographische Institut, in dem ich ebenfalls Vorlesungen besuchte, lag an derselben Straße wie die Zoologie, nur ein Stück weiter stadtauswärts, aber am Weg zur Mensa. Den Stachus, Münchens Zentrum des Straßenverkehrs, erreichte ich vom Zoologischen Institut aus in fünf Minuten zu Fuß. Ich lief häufig hin in meinem ersten Semester in München. Denn dort geschah Seltsames, wenn der lange Maientag zu Ende ging. Ein Teil davon nahm scheinbar seinen Anfang am Zoologischen Institut. Scheinbar, weil ich es da zuerst bemerkte und bis zum Stachus weiterverfolgte. Spätnachmittags, bei klarem Wetter eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang, landeten Stare in Schwärmen auf den Robinien vor dem Zoologischen Institut. Es waren so viele, dass die Bäume schwarz wurden. Die Stare machten kurze Flugmanöver. Dabei ging ihr Zwitschern in ein Aufrauschen über, das trotz des Straßenlärms nicht zu überhören war.
Große Starenschwärme↱ kannte ich vom Unteren Inn. Viele Tausende, mitunter bis über eine Million, flogen hinaus auf die Inseln zu ihren Schlafplätzen und gingen nieder auf dem dichten Buschwerk der Silberweiden oder fielen ein ins Schilf. Ihre Flugmanöver beeindruckten mich, insbesondere wenn sie seltsame Formen wie die Bewegungen gigantischer Amöben annahmen. Anlass dazu war stets ein Greifvogel, ein Bussard oder ein Schwarzmilan, den sie mit ihren brausenden Massen regelrecht einwickelten, bis dieser zu Boden ging wie abgestürzt. Stets zogen die Schwärme aber auf größerer Distanz an mir vorbei.
Hier in München konnte ich sie nun durch die Fenster im ersten oder zweiten Stockwerk des Zoologischen Instituts fast zum Greifen nahe ansehen. Vogel für Vogel, Hunderte, Tausende, Zehntausende. Wie auf ein unhörbares Kommando gingen sie unvermittelt in die Luft und strömten quirlend als schwarzer Fluss über die Luisenstraße bis zum Alten Botanischen Garten, einem kleinen Park, und ergossen sich von diesem aus über den Stachus. Im Nu waren die Fassaden der Gebäude rund um den Platz voller Stare. Der Lärm, den die Zehntausenden nun machten, übertönte den Straßenverkehr. Damals galt der Münchner Stachus als verkehrsreichster Platz Europas.
Mehrmals wartete ich auf der lang gestreckten zentralen »Insel« der Straßenbahnhaltestelle mit ihrer Reihe kleiner Bäume, weil ich sehen wollte, wohin die Stare schließlich weiterflogen. Der Platz war hell beleuchtet. Von der Haltestelle aus konnte ich ihn rundum überblicken. Doch die Stare flogen nicht fort. Sie blieben. Neue Schwärme kamen bis in die frühen Nachtstunden an. Sie mussten sich auf den Fassaden der Gebäude angrenzender Plätze, wie dem Lenbachplatz, und an der Sonnenstraße niederlassen. Nach einigen halb durchwachten Nächten wurde mir klar, dass ich besser ganz früh am Morgen kommen sollte. Da erlebte ich den Abflug in alle Richtungen über die Stadt. Kurz vor Sonnenaufgang setzte dieser ein. Eine Viertelstunde nach diesem war alles vorüber.
Groß muss das Einzugsgebiet dieses Schlafplatzes gewesen sein, denn wie ich in den folgenden Monaten sah, gab es innerhalb der Stadt bei weitem nicht genug Brutpaare von ↰Staren, dass eine Schlafplatzmenge von Zehntausend und mehr hätte zustande kommen können. Die Hauptmenge flog auch nicht aus Richtung des Englischen Gartens an der Isar ein, sondern offenbar aus dem Nordosten Münchens, also aus den Fluren des Umlands. Ähnlich wie »bei mir« am Unteren Inn war das Münchner Einzugsgebiet der Schlafplatzflüge nicht die unmittelbare Umgebung. Zudem verhielt es sich am Inn ganz anders. Die Inseln waren so ziemlich die menschenfernsten Orte im Gebiet. Hier in München flogen sie hingegen zum verkehrsreichsten Platz. Krasser hätten die Unterschiede kaum sein können.
Dr. Wolfgang Zedler, ein Münchner Ornithologe und Arzt, der den »Stachusstaren« in mehrjährigen Untersuchungen viel Zeit gewidmet hatte, wusste ebenfalls keine Antwort auf die Frage, warum die Stare ins Stadtzentrum flogen. 1965, zur selben Zeit in der ich nach München kam, hatte er seine Ergebnisse in der Fachzeitschrift der Ornithologischen Gesellschaft Bayerns veröffentlicht. Das Problem, warum die Stare in München zum Schlafen nicht die Bäume im Englischen Garten oder den nachts für die Besucher gesperrten Nymphenburger Park aufsuchten, sondern ausgerechnet zum Stachus flogen, hatte ihn auch beschäftigt. Außerdem lärmten sie dort so ziemlich die ganze Nacht hindurch. Bis heute werden zwar mehrere plausible Erklärungen diskutiert, aber so recht überzeugend wirken diese immer noch nicht.
So soll ein Ort wie der Stachus besser vor Feinden schützen, weil es nachtsüber hell ist und sich Greifvögel und Eulen, die Stare fangen könnten, nicht hintrauen. Längst wissen wir aber, dass Falken sehr wohl auch nachts jagen und das Kunstlicht dabei ausnutzen. Waldkäuze↱ leben in Parks mit alten Bäumen oder dort, wo es Nischen zum Nisten gibt. An den Fassaden herrscht Enge. Auf den Bäumen könnten sich die Stare besser platzieren, ohne den Schutz des Schwarms zu vermindern oder zu verlieren. Außerdem waren die Stachusstare damals ein Unikum, weil sie während der Brutzeit kamen, und nicht, wie es in zahlreichen anderen Städten Europas bereits seit Jahrzehnten üblich war, zu den Zugzeiten im Herbst und Frühjahr oder während des Winters. Die Stachusstare mussten sogar erhebliche Anflugstrecken in Kauf nahmen. Die Attraktivität des Stachus blieb ein Rätsel.
Seit Jahrzehnten kommen sie nicht mehr. Das liegt gewiss nicht an Maßnahmen, die Stare von den Fassaden zu vertreiben, weil sie diese verschmutzten. Ursprünglich nächtigten sie auf Kastanien mitten auf dem Platz. Bereits seit 1933 war der Stachus als Starenschlafplatz bekannt. Zu den Fassaden wechselten sie nach und nach schon bevor die Bäume gefällt und entfernt worden waren und ihnen nichts anderes übrig blieb. Viele Jahre flogen sie allein die Stachusfassaden an. Das Ende kam erst, als die Bestände der Stare europaweit stark abnahmen. Gegenwärtig gibt es ähnliche Spektakel offenbar nur noch in Rom und wenigen weiteren Städten. Zu Schlafplatzansammlungen kam es auch an beleuchteten Ölraffinerien, an Wolkenkratzern in Nordamerika und an anderen technischen Großkonstrukten. Der Star schien im 19. Jahrhundert eine seltsame Vorliebe für Technik zu entwickeln, als diese Verstädterungsphänomene einsetzten.
Dem Türkentaubenpaar↱, das auf einer der Robinien mit dem Nisten angefangen hatte, bevor im Frühjahr die Schlafplatzflüge der Stare einsetzten, blieb damals, 1965, nichts anders übrig, als aufzugeben. Es wurde von den Massen schwarzer Vögel einfach überflutet. Auf der anderen Seite des Zoologischen Instituts fand es einen ruhigeren Nistplatz, wiederum nahe am Fenster. Die Tauben ließen sich bei all ihren Lebensäußerungen am Nest zusehen, ohne von den Menschen hinter der Scheibe irritiert zu werden. Mich beeindruckten die ↰Türkentauben↱ weniger als die Stachusstare, weil in München die gewöhnlichen Stadttauben↱, die Straßentauben, so häufig waren, dass der Hausmeister des Zoologischen Instituts mit einer geradezu lächerlich einfachen Fangvorrichtung Dutzende von ihnen für die Kurse in Vergleichender Anatomie der Wirbeltiere auf dem Bürgersteig direkt vor dem Institut fangen konnte. Niemand regte sich darüber auf. Tauben gab es überall. Im Hauptbahnhof erlebte ich jedoch zu meiner Verblüffung, dass sie sich von den Menschen sogar übersteigen ließen, ohne aufzufliegen. Das akzeptierten nicht einmal die ansonsten völlig zahmen Haustauben in den heimatlichen Dörfern oder die Hühner im Garten.
Die ↰Türkentauben↱ schob ich gleichsam in die Schublade »Taube«, was jedoch, wie sich mir während des Studiums alsbald erschloss, allzu voreilig war. Denn in den Münchner Stadtparks trippelten andere, größere und fein silbrig graublaue Tauben mit markanter Zeichnung an den Halsseiten umher, die mir als Vogelart längst wohl bekannt waren: Ringeltauben↱. Doch anders als die ↰Stadttauben↱ und deutlicher als die ↰Türkentauben hielten sie Abstand von den Menschen. Sie ließen sich auch nicht mit Futter anlocken. In meinem Heimatdorf in Niederbayern gab es keine ↰Ringeltauben↱. Sie lebten dort nur in den Wäldern der Umgebung und waren sehr scheu. In München überwinterten sie in den 1960er-Jahren noch nicht. Dauerhaft in der Stadt zu bleiben, setzte erst Jahrzehnte später ein, obwohl das in südwest- und westdeutschen Städten längst üblich war. In diesen verhielten (und verhalten) sich die ↰Ringeltauben↱ fast so menschenvertraut, wie die ↰Stadttauben↱. Scheue Hochwaldvögel waren und blieben hingegen die den ↰Ringeltauben recht ähnlich sehenden Hohltauben. Turteltauben fand ich in München und anderen Städten nicht. Es gab sie in den Innauen und südlich der Alpen viel häufiger und mit weiterer Verbreitung in unterschiedlichen Biotopen. Die Verallgemeinerung »Taube« war also unangemessen.
Für das Phänomen der Stachusstare bekam ich keine Erklärung. Im Sommersemester 1965 war ich hin- und hergerissen zwischen den Vorlesungen und Praktika, die zu besuchen waren, und der Fülle des Neuen, das es in München zu entdecken gab. Auf jeder »Stadtexkursion« entdeckte ich Faszinierendes für mich. Es gab so viel Tierleben, weit mehr, als ich mir hätte vorstellen können. Von den Münchner Ornithologen erhielt ich jede Menge guter Tipps zu Raritäten wie den Halsbandschnäppern im nördlichen Teil des Englischen Gartens, der Hirschau. Was mich besonders beeindruckte, war die geringe Scheu solcher Vögel, die wie die Enten↱ und Gänse↱ »draußen« sehr flüchtig sind. In der Stadt ließen sie sich aus nächster Nähe beobachten. Staunend erlebte ich, dass ↰Waldkäuze↱ in den Münchner Parks aus Astlöchern alter Bäume hinab auf die Menschen schauten, die auf den Fußgängerwegen spazieren gingen. Am helllichten Tag! Einen Eisvogel↱ beobachtete ich am winzigen Teich des Gartens am Zoologischen Institut. Ich wagte kaum zu atmen. Doch er flog nicht einmal weg, als jemand hinausging, wenige Meter am ↰Eisvogel vorbei.
Mit der Unwirtlichkeit der Städte stimmte es so nicht. Auch mir ging es gut. Das Studium und München genoss ich. Nach wenigen Wochen war ich offen geworden für unvoreingenommene Blicke auf die Großstadt.
Ist das Wildschwein↱ in der Stadt kein »Wild«-Schwein mehr?
Die ↰Wanderfalken↱ am Kölner Dom, am Roten Rathaus in Berlin oder am Heizkraftwerk in München und in anderen Städten wurden angesiedelt. Sie stammten aus Nachzuchten, die als letzte Möglichkeit in Betracht kamen, diesen Großfalken vor dem völligen Aussterben zu bewahren. Im Lauf der Jahrzehnte entwickelte sich eine Stadtpopulation, die dank guter Erfolge bei der Jungenaufzucht wächst und gedeiht. Auch Kleinstädte werden nunmehr von ↰Wanderfalken↱ besiedelt; von sich aus, ohne dass künstliche Ansiedlungen nötig sind. Im »Freiland« haben sich die Bestände ebenfalls erholt, seit DDT und andere Chemikalien verboten sind. Verbesserter Schutz »draußen«, vor allem durch die Bewachung der Falkenhorste, bis die Jungen ausfliegen, und die wachsenden Bestände in den Städten brachten ein eindrucksvolles Comeback zustande. Auch andere Greifvögel erholten sich. In Deutschland stieg die Zahl der Brutpaare beim Seeadler↱ auf über Tausend an. Damit gehört unser Land gegenwärtig zu den am dichtesten mit Seeadlern besiedelten; Tendenz weiter zunehmend. Ähnlich positiv ist die Entwicklung beim Fischadler↱, noch beeindruckender beim Kranich. Relativieren diese Erfolge das mit den ↰Wanderfalken↱ in den Städten Erreichte?
Berlins ↰Nachtigallen↱ waren nicht gerufen oder gar angesiedelt worden. Sie kamen von selbst. Wie einst die Amsel↱ und andere Vögel im 19. Jahrhundert, die man seither in der Stadt anzutreffen erwartet. Sollen diese Arten anders eingestuft werden, weil sie direkt in der Menschenwelt leben? Eine große Tierart, die in unserer Zeit in die Städte eingedrungen ist, verschärft die Frage nach der »Natürlichkeit« und beantwortet sie auf ihre Weise: das ↰Wildschwein↱.
Hebt man Berlin hervor als »Hauptstadt der ↰Nachtigallen↱«, so ließe es sich auch als »Hauptstadt der Wildschweine« charakterisieren. Denn mehrere Tausend echte Wildschweine leben im Stadtgebiet. Und das nicht nur am Rande, sondern integriert mit ziemlich normalem Wildschweinleben, das Führen von Jungen durch den Stadtverkehr mit eingeschlossen. Es kann in manchen Stadtvierteln geschehen, dass sich in einem Vorgarten mit geschütztem Winkel ein trächtiges ↰Wildschwein↱ niederlässt, die Jungen zur Welt bringt, sie dort einige Zeit im Lager hält, versorgt und dann mit der Schar von Frischlingen umherstreift. Die Mutter versteht es, ihre Kleinen über die Straßen zu führen. Sie kommt mit den Verkehrsampeln zurecht, die die Autos immer wieder zum Stehen bringen und so ein gefahrloses Wechseln über die Straße ermöglichen. Die zuständige Behörde zieht vielleicht ein rot-weiß gestreiftes Band um den Frischlingsplatz, um allzu Unvorsichtige vor Mutter ↰Wildschwein↱