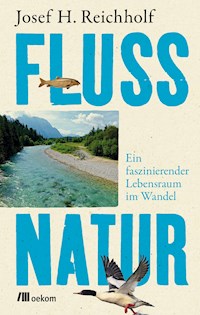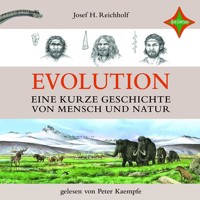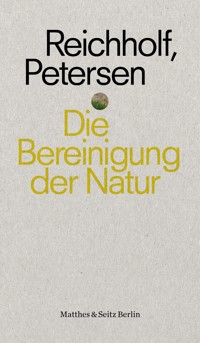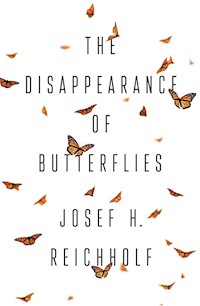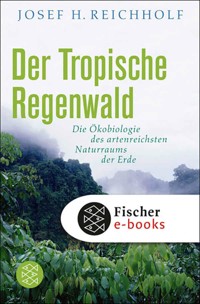Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Vom Feind zum Freund: Wie der Hund auf den Menschen kam. Reichholfs spannende Naturkunde für alle, die ihren Hund und sich selbst besser verstehen wollen.
Einst lebte er frei wie der Wolf. Und er war Wolf. Irgendwann jedoch näherte er sich den Menschen. Zehntausend Generationen später war er Hund – und ein besonderes Lebewesen, das uns zum Spiegel wurde.
Unterhaltsam und mit fachlicher Expertise widmet sich Josef Reichholf einer der ältesten Beziehungen der Menschheitsgeschichte, die immerhin fast zehn Millionen Haushalte in Deutschland kennen. Dafür verbindet er persönliche Geschichten mit aktueller Forschung zur Biologie und zur Evolution des Hundes und fördert Erstaunliches zutage – für alle, die ihren Hund und sich selbst ein klein wenig besser verstehen wollen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 299
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Einst lebte er frei wie der Wolf. Und er war Wolf. Irgendwann jedoch näherte er sich den Menschen. Zehntausend Generationen später war er Hund — und ein besonderes Lebewesen, das uns zum Spiegel wurde.Unterhaltsam und mit fachlicher Expertise widmet sich Josef Reichholf einer der ältesten Beziehungen der Menschheitsgeschichte, die immerhin fast zehn Millionen Haushalte in Deutschland kennen. Dafür verbindet er persönliche Geschichten mit aktueller Forschung zur Biologie und zur Evolution des Hundes und fördert Erstaunliches zutage — für alle, die ihren Hund und sich selbst ein klein wenig besser verstehen wollen.
Josef H. Reichholf
Der Hund und sein Mensch
Wie der Wolf sich und uns domestizierte
Carl Hanser Verlag
Auch für ihn.
Inhalt
Vorbemerkung
Ein Findling und ein Polizeihund
I Wie aus Wölfen Hunde wurden
Wer oder was ist ein Hund?
Eine schöne Geschichte? Wie Steinzeitjäger aus Wölfen Hunde züchteten
Einwände und Alternativen
Die Selbstdomestikation von Wölfen
Auf der Suche nach Fakten
Streunende Hunde
Rangordnungen
Hunde und andere Hundeartige
Beute und Beutegreifer
Läufer unter tropischer Sonne
Wölfe als (Erd-)Höhlenbewohner
Eiszeitland
Wolfsleben im Eiszeitland
Nochmals die Eiszeitmenschen
Jagd und Jagderfolg
Der »Pleistozäne Overkill«
Die Folgen des Overkills für die Neandertaler und die Wölfe
Die (spät-)eiszeitliche Aufspaltung von Wölfen in zwei ökologische Formen
Westeuropa und China: ein oder zwei Ursprungsgebiet(e) des Hundes?
II Die Beziehung zwischen Hund und Mensch
Ein zauberhafter Welpe
Verhaltensweisen
Gieriges Fressen und bedingungsloses Vertrauen
Halb tot aus der Hundepension
Silvester
Sprachverständnis, Bellen und Gespräche mit »er«
Hundeblicke
Was ist das für eine Beziehung?
Die Sinneswelten von Mensch und Hund
Hormone und Spiegel
III Hund und Mensch — und Katze? Ein Ausblick
Die Katze — ein Vergleichsfall?
Die Selbstdomestikation — ein verbreiteter Prozess
Zusammenfassender Rückblick
Nachwort
Dank
Literatur
Register
Einst war er Wolf,
von Menschen gefürchtet,
als Totemtier verehrt,
schaurig sein Heulen.
Dann war er Hund,
Partner und Begleiter,
geschätzt und gezüchtet,
bellend bester Freund.
Vorbemerkung
Wie wurde der Wolf zum Hund?
Warum wurde er Haustier?
Was sind die Folgen?
Um diese Fragen geht es hier. Fast immer wurden sie bisher getrennt behandelt. Und nicht selten aus einer sehr selbstbezogen-überheblichen Position heraus beantwortet — so, als ob es ein klares Ziel spätsteinzeitlicher Domestikation gewesen wäre, aus Wölfen Hunde zu machen. Und der Wolf gar nicht anders konnte, als mitzumachen bei seiner Erniedrigung zum Haustier.
Wir neigen dazu, hinter den Geschehnissen Absichten zu vermuten, wenn Menschen beteiligt sind. Formulierungen wie »… um zu …« verraten dies. Unsere eigene Geschichte lehrt allerdings, dass die Folgen aktueller Entscheidungen für die nächste Generation kaum jemals berücksichtigt werden. Der gegenwärtig beklagte Mangel an Bereitschaft, für die Zukunft vorzusorgen, für eine Zeit, die nur wenige Jahrzehnte vor uns liegt, zeigt dies anschaulich. Wie sollten Menschen der Steinzeit also so weit vorausgeplant haben, dass sie die Domestizierung wilder Wölfe begannen, um irgendwann in ferner Zukunft Hunde halten zu können? Nicht sie selbst und ihre Kinder oder Enkel, sondern die Nachkommen viele Generationen später, in einer unvorstellbar fern liegenden Zeit.
Wölfe sind keine Kuscheltiere. Am Beginn ihrer Hundwerdung, wie immer diese verlief, mussten sich die Menschen mit ihnen arrangieren. Und dabei stets fürchten, gebissen zu werden. Bereits leichte Verletzungen durch Hundebisse können Wundstarrkrampf und andere lebensgefährliche Infektionen verursachen. Selbst unter heutigen Bedingungen, mit wirkungsvoller medizinischer Versorgung und umfangreichem verhaltensbiologischem Wissen, ist die Zähmung wilder Wölfe im großen Stil kaum vorstellbar. Zigtausendfach kommen Hundebisse alljährlich in Deutschland vor, millionenfach global. Wolfsgroße Hunde sind kein lebendiges Spielzeug. Wie konnte die Hundwerdung unter den ungleich schwierigeren Bedingungen der fernen Eiszeit zustande kommen, als die Menschen noch als Jäger und Sammler in kleinen Gruppen umherzogen und über keine Gewehre verfügten, um sich der Wölfe zu erwehren? Und doch haben wir ihn, den Hund, unseren tierisch besten Freund. Wie er wurde, was er ist, das ist eine spannende Geschichte. Sie betrifft uns alle — mit oder ohne Hund.
Ein Findling und ein Polizeihund
Von frühen Erfahrungen hängt viel ab, ob Menschen Hunde mögen oder nicht. In meiner Kindheit und Jugendzeit hatte ich mit zwei ganz unterschiedlichen Hunden zu tun. Ich war noch nicht eingeschult, als wir über eine Tante aus München einen kleinen Hund erhielten. Von der Feuerwehr war er aufgegriffen worden. Unser Häuschen am Rand des Dorfes im niederbayerischen Inntal hatte einen umzäunten Garten. Die Umstände schienen also günstig für den munteren kleinen Schnauzer, der uns gleich begeisterte. Ich war noch zu klein, um genauere Erinnerungen an ihn zu bilden. Umso stärker setzte sich sein jähes Ende in meinem Gedächtnis fest. Das Unheil nahm seinen Lauf, kaum dass wir ihn ein paar Tage bei uns hatten. Lumpi, so nannten wir ihn, war auf Entenjagd dressiert. Unsere Nachbarin hielt gerade eine Schar junger Enten auf einem kleinen Teich neben dem Kuhstall. Wenn sie Hunger hatten, schnatterten die Entlein laut. Das war oft der Fall. Kaum hörte Lumpi die Rufe, suchte oder grub er sich ein Schlupfloch im Zaun, sauste zu den Enten, fasste sich eine und schüttelte sie tot. Schließlich hatte er es so gelernt. Zum Erlegen einer weiteren kam er bei dieser ersten Entenjagd nicht mehr, weil die Bäuerin auf ihn losging und ihn mit lautem Geschrei davonjagte. Lumpi suchte bei uns Zuflucht. So wusste sie sofort, woher das Untier kam.
Von meiner Mutter kassierte sie den Preis, den die fett gewordene Ente ein halbes Jahr später unter günstigsten Umständen vielleicht erzielt hätte. Die tote Jungente behielt sie trotzdem. Auch die nächste und übernächste, die Lumpi in den folgenden Tagen erlegte, bekamen wir nicht. Obwohl wir meinten, alle Schlupflöcher im Zaun gefunden und unpassierbar gemacht zu haben, gelang es ihm auszubrechen, wenn er die Entenrufe hörte. Das Verhältnis zur Nachbarin war zerrüttet. Ich hielt sie für eine alte Hexe, nachdem Lumpi vom Jäger aus dem Dorf erschossen worden war. Der kleine Hund habe ihm leidgetan, sagte er meiner Mutter. Vielleicht wollte er sich dafür entschuldigen, dass das Erschießen so fürchterlich verlaufen war. Nachdem er zunächst nur einen Bauchdurchschuss erzielt hatte, schoss er mit Schrot mehrfach aus nächster Nähe auf den Hund ein. Unsäglich, was dem Kleinen angetan wurde, bloß weil er jenen Impulsen folgte, die ihm andressiert worden waren. Wir begruben ihn im Garten, und ich weinte bitterlich. Die Bäuerin strafte ich fortan mit Verachtung, was ihr ziemlich gleichgültig gewesen sein dürfte. Als sie ein paar Jahre später starb, empfand ich kein Mitleid, sondern kindliche Genugtuung.
Wie unsere Katze damals auf den plötzlichen Tod des Hundes reagierte, weiß ich nicht mehr. Sie hatte ihn die kurze Zeit, die er bei uns lebte, zwar toleriert, aber nach Katzenart umgehend durch ein paar Pfotenschläge mit ausgefahrenen Krallen auf Distanz gehalten. Vagen Erinnerungsbildern zufolge saß sie auf erhöhter Stelle und schaute auf ihn hinab, die Pupillen zusammengekniffen zum Schlitz. Er war zum Spielen aufgelegt und bellte sie an. Das missfiel ihr. Sie sprang direkt vor ihm herunter und schritt, sich nicht weiter um ihn kümmernd, mit hochgerecktem Schwanz davon. Katzen gab es in meiner Kindheit und Jugend immer. Manche legten sich zur bettlägerigen Großmutter und wärmten sie. Meistens hatten wir Kater, aber auch Weibchen, die Junge bekamen. Daher war meine Kinderwelt von Katzen geprägt. Nach dem Desaster mit Lumpi, den im Dorf niemand hatte aufnehmen wollen, weil sein schändliches Tun, stark aufgebauscht (der »Mörderhund«), sogleich die Runde gemacht hatte, gab es in meiner Kindheit und frühen Jugendzeit als Haustiere nur die Katzen. Sie lebten ein sehr selbstständiges Leben, kamen, wenn sie gestreichelt werden wollten, und verschwanden wieder, dass ich sie mitunter tagelang nicht mehr sah. Sie fingen Mäuse, gelegentlich auch Ratten. Einer wurde im Kampf mit einer großen Ratte die Kehle durchgebissen. Die Speiseröhre hing ihr heraus. Ein anderer Nachbar erbarmte sich und tötete sie. Wir wären dazu nicht imstande gewesen. Tierärzte für Kleintiere gab es damals weit und breit nicht, wir hätten uns zudem die gewiss sehr teuere Operation nicht leisten können. Auch diese Katze, die beste Rattenkatze, wie Oma sagte, erhielt im Garten ein Grab. Dass eine andere junge Katze im nächsten Frühjahr drei Kätzchen ins Haus brachte, tröstete mich über den Verlust der Vorgängerin hinweg, die ich sehr gemocht hatte.
Doch dann, gut ein Jahrzehnt nach Lumpi, begann für mich die wunderbare Zeit mit einem riesigen Schäferhund. Direkt neben unserem Häuschen war für Grenzpolizisten ein Vier-Familien-Wohnblock errichtet worden. Die österreichische Grenze war nur einen halben Kilometer vom Dorf entfernt, und auf der deutschen Seite nahm man den Grenzschutz sehr ernst. So ernst, dass die meisten Grenzpolizisten zusammen mit einem ausgebildeten Hund »Streife gehen« mussten. Unregelmäßig zu verschiedenen Tages- und Nachtzeiten selbstverständlich, damit kein System erkennbar wurde. Wir als Anwohner verstanden das nicht, hüben in Bayern wie drüben in Österreich. Die Grenze und mehr noch die Grenzkontrollen hielten wir für völlig überflüssig. Das sah man allerdings in Bonn nicht so, wo die Regierung der Bundesrepublik damals noch saß. Die »Grenzer«, wie sie bei uns genannt wurden, nahmen ihren Dienst durchaus ernst, wenngleich in eher formalem Sinne. Mit der Bevölkerung gerieten sie nicht in Konflikt, weder in Bayern noch in Österreich. Beim sogenannten Innendienst saßen sie ohnehin beisammen in denselben Kontrollstellen an den Grenzübergängen. In dieser gänzlich unproblematischen Lage an der Grenze waren die Streifengänge bei gutem Wetter und vor allem für die Hunde ein Vergnügen. Diese verbrachten ja die übrige Zeit in Zwingern und konnten nichts tun, als sich gegenseitig anzubellen. Das hörten ihre Herren, die am Tag schlafen wollten, natürlich nicht gern, wenn sie von der nächtlichen Tour bei Wind und Wetter zurück waren. Die Hunde sollten sich also zunächst möglichst still und dann aufmerksam verhalten, wenn der Dienstgang begann. Dabei sahen die riesigen Schäferhunde richtig angsteinflößend aus.
Einer dieser Hunde war besonders groß und von den anderen, die in den Zwingern nebenan untergebracht waren, offenbar sehr gefürchtet. Sie wagten kaum, ihn durchs Gitter anzubellen, wenn er draußen im Hof frei lief. Seinen Besitzer fanden wir sehr nett, auch wie er mit dem Hund umging. Das sah mitunter allerdings nach einem Kräftemessen aus, so hart und laut wurden die Kommandos gerufen. Die Grenzerfamilie hatte eine Tochter. Als sie unsere Nachbarn wurden, ging sie wohl noch nicht zur Schule. An manchen Tagen holte die Kleine aber beim Bäcker im Dorf frische Brötchen — zusammen mit dem Hund. Sie führte ihn dabei an kurzer Leine. Da reichte er ihr bis zur Schulter, nur ihr Köpfchen ragte darüber hinaus. Entsprechend gekleidet, hätte sie wie Rotkäppchen mit dem Wolf ausgesehen. Der riesige Hund war wahrscheinlich noch massiger als ein echter Wolf. Er folgte der Kleinen auf jeden Wink. Doch ein gemütlicher Bär war er gewiss nicht. Vor einer solchen Fehleinschätzung warnte sein tiefes Knurren, sobald jemand dem Mädchen zu nahe kam. Ein paar Meter Abstand mussten es sein. Die Leute im Dorf vermieden es tunlichst, angeknurrt zu werden. Der Besitzer des Schäferhundes betonte im Gespräch wiederholt, dass er sich selbst wundere, wie gut die Kleine mit dem Tier umgehen könne. Für Hundetrainer der Polizei sei er nämlich ein echter Problemfall. Beim Training beiße er nicht einfach in den speziell gepolsterten Abwehrarm, sondern suche nach anderen Angriffsmöglichkeiten, sodass er sich kaum bändigen lasse. Sein Töchterlein könne ihm aber das Maul aufmachen, die Zähne untersuchen oder sich auf ihn setzen.
Der Hund und ich lernten uns kennen, weil sich sein Herr wiederholt mit mir über den Zaun hinweg unterhielt, wenn er von einem Dienstgang zurückgekommen war. Dieser erzählte mir dabei, dass er draußen am Fluss Vögel gesehen habe, die mich interessieren könnten. Auch andere Grenzer fingen nach und nach an, mir solche Hinweise mitzuteilen, nachdem wir uns auf den Dämmen nahe der Grenze getroffen hatten, weil ich auch unterwegs war beim Beobachten und Zählen der Wasservögel.
Eines Tages bot mir einer dieser Grenzpolizisten einfach an, seinen Hund mit hinauszunehmen. Er war in den Innendienst versetzt worden, der Hund bekam daher viel zu wenig Auslauf. Weggeben wollte er ihn jedoch nicht. Ero, so hieß er, sei ein ganz braver Schäferhund. Seine Größe und das finstere Aussehen würden täuschen. Ich könne ja im Garten anfangen, mich mit ihm vertraut zu machen. Vom Fenster aus würde er sehen, wie sich der Hund bei mir verhielt und wie ich mich mit ihm anstellte. Das war ein großartiges Angebot. Nicht einmal im Traum hätte ich mir damals vorstellen können, einen Polizeihund an die Hand zu bekommen, und sei es auch an der Leine und für kurze Zeit. Also redete ich durch den Gitterzaun auf Ero ein: »Magst du mit mir hinaus? Hinaus in die Au und zum Wasser? Du bist ein schöner Hund! Und so ein Braver!« Er schaute mich an und wedelte schließlich ein wenig mit dem Schwanz. Daraufhin nahm ihn sein Herr an die Leine, führte ihn zu uns in den Garten und übergab ihn mir. Nun sollte ich ihm ein paar Kommandos, wie »Sitz«, »Platz« und ähnliche, geben, ihn abliegen oder die Leine bringen lassen, ihn zu mir rufen; alles Formen der Dressur, die zur Grundausbildung der Hunde gehören und nichts Polizeispezifisches an sich hatten. Spezielle Polizeikommandos auszuprobieren, in diese vielleicht verlockende Verlegenheit sollte ich besser gar nicht erst kommen.
Alles klappte auf Anhieb. Als mir Ero auf ein kurzes »Pfote« seines Herrn hin sofort die rechte Pfote entgegenstreckte, wirkte es für mich wie ein Handschlag als Zustimmung. Verblüfft sah ich, wie die Pfote auf meiner Hand ruhte. Damit war abgemacht, dass ich ihn mitnehmen würde auf meine Gänge und Radfahrten in die Natur. Und ein wunderbarer Sommer begann. Der Hund durfte mich begleiten, wann immer ich Zeit hatte. Mit seinem Alter von sechs oder sieben Jahren hatte er noch eine sehr gute Kondition. Auch war er nicht betroffen vom Hüftleiden, das viele alternde Schäferhunde befällt und ihnen das Leben schwer und schmerzhaft macht. Meistens japste er mir schon vom Zwinger aus entgegen, wenn er meine Schritte im Hof hörte. Fuhr ich mit dem Fahrrad hinaus zum Fluss, lief er an einer mehrere Meter langen Leine. Manchmal zog er mich so flott hinter sich her, dass ich ihn abbremsen musste, um auf den steinigen Feldwegen nicht zu schnell zu werden. Auf jeden kurzen Ruf hin hielt er inne und schaute mich an, um abzuwarten, wie es weitergehen sollte. Draußen auf den Dämmen durfte er dann frei laufen. Sie waren übersichtlich, und er trottete ohnehin nie zu weit voraus. Aufs Wort blieb er stehen oder kam zu mir zurück.
Der Dammwärter hatte ein Boot; eine »Zille«. Das ist ein langer, flacher Holzkahn mit spitzem Bug und breitem Heck, Schlagrudern und zwei Sitzbrettern. Mit diesem Boot durfte ich hinausfahren zu den Inseln und sogar hinüber ans österreichische Ufer. Dafür hatte ich von der örtlichen oberösterreichischen Behörde eine Anlandegenehmigung (»zu jeder Tages- und Nachtzeit und ohne Ausweiskontrolle«) erhalten. Dem Hund machten die Bootsfahrten großes Vergnügen. Kaum kamen wir in die Nähe des Kahns, sprang er schon hinein und setzte sich am Bug so in Position, dass er bei der Fahrt übers Wasser blicken konnte. Wie eine übergroße Galionsfigur sah er aus. Wir gaben sicher ein eindrucksvolles Bild ab, ich als Ruderer und der große Hund vorn im Boot wie ein vornehmer Passagier, der sich über den großen Fluss chauffieren lässt. Das Schwanken, das beim Rudern gegen starke Strömung nicht zu vermeiden war, machte ihm nichts aus. Als die Wassertemperatur für mich allmählich akzeptabel wurde, badeten wir. Da der aus den Zentralalpen kommende Fluss, der Inn, auch im wärmsten Sommer kaum 15 Grad Celsius Wassertemperatur erreicht, kamen zum Schwimmen hauptsächlich die Lagunen zwischen den Inseln infrage, in denen das Wasser beträchtlich wärmer wurde.
Nicht wissend, wie er sich verhalten würde, hieß ich den Hund beim ersten Mal am Ufer meine Kleider bewachen. Das tat er zwar brav, aber ich merkte, dass es ihn auch ins Wasser und zu mir zog. Also hieß ich ihn kommen. Im Nu war er mit einem mächtigen Satz bei mir und schwamm mit. Sogar den passenden Abstand hielt er ein, der nötig war, damit mich die Krallen seiner Pfoten nicht trafen. Als Hund konnte er das Wasser nur »treten« — etwa so, als ob er an Land weiterlaufen würde —, aber keine ausholenden Seitwärtsbewegungen mit den Beinen machen. Trotzdem schwamm er, wohl dank seiner riesigen Pfoten, mühelos neben mir her und hätte mich wahrscheinlich überholt, wenn er das gewollt hätte. Da mir schneller kalt wurde als ihm mit seinem so dichten Fell, schwamm ich nach etwa einer Viertelstunde zurück zum Ufer. Kaum angekommen, erhielt ich eine kräftige Dusche, weil er sich direkt neben mir abschüttelte. Damit musste ich fortan stets rechnen. Beim Abschütteln eine passende Distanz zu halten, das verstand er nicht, und es war viel Wasser in seinem Fell, wenn er nach längerem Schwimmen herauskam. Die besten Lagunen nutzte natürlich auch die Dorfjugend zum Baden. Schwimmbäder gab es damals weit und breit keine. Mit Hunden waren die Kinder und Jugendlichen vertraut, weil die meisten Bauern einen Hofhund hielten; arme Tiere, die an Ketten hingen und kaum jemals hinaus in die Auen oder an den Fluss kamen. Die Polizeihunde kannte die Dorfjugend natürlich auch, allerdings meist nur als Begleiter der Pistolen tragenden und Furcht einflößenden Herren, wenn diese Streife gingen oder an den Grenzübergängen kontrollierten. Entsprechend distanziert verhielten sich die anderen Jugendlichen nun mir gegenüber. Schwamm ich in einer Lagune, durfte sich auf mehrere Meter Distanz niemand nähern, sonst kam ein angsteinflößendes Knurren übers Wasser entgegen. Lag der Hund dann draußen zum Trocknen neben mir, konnten die Jungs, die ich kannte, näher kommen, um sich mit mir zu unterhalten.
Am ehesten duldete er die Nähe anderer Menschen beim Gang durchs Dorf. Wer uns da entgegenkam oder überholte, brauchte kaum mehr Abstand zu halten, als es normalerweise ohnehin üblich war. Diese ganz von der Situation abhängige Wachsamkeit beeindruckte und beschäftigte mich schon damals. Wie war es möglich, dass der Hund von sich aus die Lage einschätzte? Warum knurrte er nicht, wenn wir auf der Straße an jemandem nahe vorbeimussten? Warum wollte er im Wasser ein Mehrfaches an Abstand gewahrt wissen? Doch wahrscheinlich wunderte ich mich damals eher, als dass ich wirklich nach Antworten auf konkrete Fragen suchte. Ich hatte ja gerade erst angefangen, Erfahrungen mit einem Hund zu sammeln. Seine Vorgeschichte kannte ich nicht. Ich wusste nur, dass er gut dressiert worden und verlässlich war.
Im Auwald gab es an etwas abgelegener Stelle einen Baggersee. Kies für Straßenbau war daraus entnommen worden. Der Abbau reichte mehrere Meter tief ins Grundwasser hinein. Dieses Wasser war wunderbar klar und wurde früh im Sommer bereits warm, schneller als die Lagunen am Inn, in die ab Juni die kalten Fluten von Gletscherwasser einströmten. Diese waren von Schwebstoffen getrübt, Gletschermilch genannt. Der Baggersee hingegen blieb klar, auch wenn er sich auf angenehme Badetemperaturen von um die 25 Grad erwärmt hatte. Sehr unangenehm war allerdings, dass es viele Bremsen und meistens auch massenhaft Stechmücken gab. Diese stammten aus dem von Altwässern und Tümpeln durchsetzten Auwald. Da schwammen wir im Sommer doch lieber im kühleren, getrübten Wasser der Lagunen. Eines schönen Junitages, nach mehreren Stunden vogelkundlicher Untersuchungen im Auwald und entsprechend verschwitzt, hatte ich Lust, im Baggersee zu baden. Es gab zwar eine Zufahrt, ein Überbleibsel vom Kiesabbau, die zum flachen Teil des Gewässers führte. Doch die tiefen, besonders klaren Bereiche befanden sich direkt unterhalb der gut zwei Meter hohen Abbaukanten, die fast senkrecht zum Wasser abfielen. Mit einem Kopfsprung von dort oben einzutauchen schien mir in dem Moment das höchste der Gefühle. Ich zog mich also aus, ließ den Hund bei den Kleidern und sprang. Wie weit ich aus kurzem Anlauf springen musste, um gut einzutauchen, wusste ich aus den Vorjahren, das machte ich ganz automatisch. Als ich auftauchte, spürte ich jedoch, wie mich etwas am Arm packte und zerrte. Kaum war ich mit dem Kopf über Wasser, sah ich, dass der Hund mich erfasst hatte und ans Ufer zog. Das war zwar nur ein paar Meter entfernt, aber steil und durch den ständig nachrutschenden Kies zum Aussteigen ungeeignet. Also dirigierte ich meinen Retter ein Stück parallel zum Ufer, bis wir auf eine schmale Uferbank steigen konnten. Bei der Rettung hatte ich ein paar Kratzer seiner Krallen abbekommen, die in den nächsten Tagen zu roten Streifen wurden, sich aber nicht entzündeten. Überrascht und fasziniert, wie ich war, eilte ich nach oben und machte vom Steilufer gleich den nächsten Kopfsprung. Wie erwartet, fasste mich der Hund beim Auftauchen. Dieses Mal ließ ich mich von ihm bis zum Ufer ziehen. Großartig! Was für ein toller Hund, stellte ich in meiner Begeisterung fest und wollte gleich noch ein drittes Mal ausprobieren, ob er mich retten würde. Ero erkannte meine Absicht, denn nun schob er sich winselnd und mit hohem Bellen klagend vor die Uferkante und versuchte, mich vom Springen abzuhalten. Dies war kein bloßes Theater, sondern zweifellos ernste Absicht. Ich ließ es sein und verstand. Zumindest bildete ich mir ein, den Grund begriffen zu haben: Die Uferkante war gut zwei Meter hoch, und um sauber ins tiefe Wasser eintauchen zu können, musste ich etwa zwei Meter weit springen. Bei einem mit vorgestreckten Händen halbwegs gut geführten Kopfsprung bemerkt man fast nichts vom Aufprall, man taucht »elegant« ein, glatt und mit wenigen Spritzern. Ganz anders verhält es sich beim Hund. Er landet nach mindestens drei Metern schrägen Flugs mit einem Bauchklatscher. Bei einem Gewicht von über fünfzig Kilogramm kommt ein heftiger Aufprall zustande, der sicher wehtut. Nicht ganz so sehr wie beim Menschen, weil unsere Bauchseite nackt ist. Aber auch das Fell am Bauch schützt den Hund sicher nicht gut genug gegen den Aufschlag. Bis heute kann ich mir für sein Verhalten keine bessere Erklärung zusammenreimen. Mit wortreichen Entschuldigungen lobte ich den Hund also und »versprach« ihm, nie wieder so einen Unsinn zu machen. Und hoffte, dass bei ihm alles in Ordnung war. Mit schlechtem Gewissen holte ich ihn anderntags wieder ab. Beruhigt stellte ich fest, dass ihm nichts anzumerken war. Er verhielt sich wie immer munter und unternehmungslustig. Auch weiterhin schwamm er gern mit mir. Warum ich ihn in den Tagen danach so oft und so viel lobte, verstand er sicher nicht. Aber für mich war es wichtig; ich hatte das Bedürfnis, ihm etwas Gutes zu tun.
Mit ungetrübten Freuden verging die Zeit. In den Sommerferien verbrachte er fast jeden Tag mit mir draußen oder wir spielten im Garten »suchen«. Was immer ich versteckte, tarnte oder meterweit ins Gras warf, er fand es und brachte es im Nu herbei. Zerbrechliches transportierte er mit gebleckten Zähnen und hochgezogenen Lefzen ganz vorsichtig. Knochen rührte er nicht an, bis er die Erlaubnis dazu bekam. Ruhten wir irgendwo, streckte er sich entspannt neben mir aus. Als im Winter die Lagunen und schließlich auch große Teile des Stausees zufroren, gab es für uns ein neues Vergnügen: Eislaufen mit Fahrradziehen. Über Kilometer flitzte er dahin wie ein Schlittenhund und zog mich über die lange Leine mit. Das ging auf dem von dünner Schneeschicht bedecktem Eis viel besser als auf den Straßen oder Flurwegen im Sommer und Herbst. Das Fahrrad lief fast ohne Widerstand. Anfangs hatte ich Bedenken, wir könnten einbrechen, weil durch Unterströmungen und wechselnde Wasserführung des Flusses auf einem Stausee keine gleichmäßige Eisdicke wie auf zufrierenden Seen zustande kommt. Doch wie ich bald merkte, spürte er dünnere Stellen frühzeitig genug. Hielt er an, prüfte ich die Eisdicke und stellte stets beruhigt fest, dass wir nicht in gefährliche Zonen geraten waren. Diese Eisfahrten gehören zu meinen schönsten Erinnerungen an ihn. Allzu schnell endete diese großartige Hundezeit jedoch leider, als sein Besitzer versetzt wurde, wie das damals für die Beamten des Grenzschutzes üblich war.
Mit Ero endete mein direkter Kontakt zu Hunden für Jahrzehnte. Ein wenig hatte ich von ihrem Leben und ihren Fähigkeiten kennengelernt. Doch meine beruflichen Umstände erlaubten mir keine Hundehaltung. Das Großstadtleben und häufige, auch längere Abwesenheiten standen dagegen. Für lange Zeit beschränkten sich meine Erfahrungen also auf kursorische Begegnungen. Etwa mit jenen Hunden in Südamerika, Afrika und insbesondere in Asien, die meistens vergessen oder bewusst unberücksichtigt bleiben, wenn es um »die Hunde« geht: die weitgehend frei lebenden, »streunenden« Hunde, die in Indien Parias genannt werden. Sie bilden das Gegenstück zum voll ausgebildeten, perfekt »dressierten« Schäferhund und zum verspielten Kleinhund, der zwar auf Entenjagd trainiert, ansonsten aber eher ein lebendiges Spielzeug gewesen war. Zu dieser Kategorie der Gelegenheitskontakte gehörte auch ein Dackel, mit dem ich in München mehrere Jahre lang fast Tür an Tür lebte. Er lernte es nicht, mich zu erkennen. Jedes Mal, wenn er mich sah oder auch nur hörte, bellte er wie ein Verrückter. Seinen Besitzern war das sehr peinlich, denn auch sie schafften es nicht, ihn umzustimmen. Zu meinen Gunsten hielten sie ihn einfach für zu dumm. Als wir viele Jahre später doch selbst einen Hund bekamen, erlebte ich allerdings mehrere solcher Fälle, in denen unser Hund bestimmte Personen trotz allen guten Zuredens nicht akzeptierte. Kamen diese zu Besuch, führte er sich auf, als ob er auf sie losgehen wollte. Dass er das nicht durfte, quittierte er mit tiefem Grollen. Um diese Formen spontaner Ablehnung bestimmter Menschen wird es in anderem Zusammenhang noch gehen. Sie ist, wie ich meine, ein wichtiger Punkt, wenn man die Hunde und die Hundwerdung verstehen möchte. Meine frühen Erfahrungen mit Hunden enthalten dazu Aspekte, die mir damals nicht bewusst geworden sind und die vermutlich viele Menschen, die Hunde halten, nicht bemerken, weil Hunde »halt so sind«. Ich greife an dieser Stelle einige Aspekte heraus, die später noch einmal im Detail Berücksichtigung finden und dabei tiefere Einblicke in das Hundsein ermöglichen werden.
Besonders schwierig ist die Unterscheidung von erlerntem, andressiertem Verhalten einerseits und natürlichem Verhalten andererseits, auch weil gezielte Zucht über zahlreiche Generationen auf bestimmte Fähigkeiten der Hunde eingewirkt hat. So äußerte sich beim kleinen Lumpi wie beim großen Schäferhund Ero deren jeweils so spezielle Dressur. Doch auch der intensiv trainierte Polizeihund reagierte keineswegs nur »automatisch«, weil er es so gelernt hatte. Sein Versuch, mich vom erneuten Kopfsprung ins Wasser abzuhalten, war ziemlich sicher ein spontan-individuelles Verhalten und nicht angelernt. Auch dass er Unterschiede machte, wie nahe andere Menschen kommen durften, drückt etwas aus, das wir Verständnis zu nennen pflegen. Und das auf das kleine Mädchen bezogene, außerordentlich zahme und fürsorgliche Verhalten des anderen Polizeihundes muss an passender Stelle erneut aufgegriffen werden. Ein weiterer besonderer Aspekt des Hundeverhaltens ist ihre Fähigkeit, der menschlichen Stimme sowohl Kommandos als auch Stimmungen zu entnehmen. Bei oberflächlicher Betrachtung scheint es sich dabei um eine einseitige »Konversation« zu handeln, die dem Hund ein hohes Maß an Anpassung abverlangt. Die Menschen mussten schließlich ihrerseits kein Wolfsgeheul oder nuanciertes Gebell erlernen, um mit Hunden kommunizieren zu können. Verborgen bleibt uns auch die zweifellos sehr große Bedeutung des Geruchs, der den Hunden so viel von uns und von anderen vermittelt, ohne dass wir Menschen das bemerken. Auch die Lebenserwartung von Hunden gestaltet sich anders, als man es erwarten würde. Hätten zum Beispiel Ero und Lumpi beide bis an ihr natürliches Lebensende leben können, wäre ein seltsamer Unterschied zutage getreten: Der Kleine hätte den Großen um mehrere Jahre und höchstwahrscheinlich auch mit weniger Gebrechen überlebt. Ein solcher Befund weicht massiv ab von den üblichen Verhältnissen in der Natur, in der die großen Tiere in aller Regel länger leben als die kleinen, so man vernünftige Vergleiche anstellt. (Unpassend wäre es zum Beispiel, eine Schildkröte von einem Kilogramm Gewicht mit einem Ochsen von einer Tonne zu vergleichen. Aber das soll hier nicht vertieft, sondern nur angedeutet werden.) Bei Hunden liegt die Sache offenbar anders. Ebenfalls erstaunt, dass Bellen bei Weitem charakteristischer für Hunde ist als das wolfstypische Heulen, obgleich sie dieses durchaus auch beherrschen. All diese Befunde und noch viele weitere Details sind aussagekräftig, wenn wir den Hund und die Hundwerdung verstehen wollen, und sie werden an passender Stelle erneut aufgegriffen und in ihrer Bedeutung erläutert.
Doch vorerst liegen nur Puzzlestücke da, die noch kein schlüssiges Bild ergeben können, weil sie dafür bei Weitem nicht vollständig genug sind. Diesem Bild nähern wir uns in den folgenden beiden Teilen von zwei Seiten. In Teil I wird die detaillierte Auseinandersetzung mit evolutionsbiologischen, genetischen, epigenetischen und archäologischen Befunden die Entstehung des Hundes behandeln. In Teil II wird die vertiefte Betrachtung eines Hundes, den wir von ganz klein an großgezogen haben und der bis zu seinem altersbedingten Ende bei und mit (!) uns gelebt hat, diese Erkenntnisse durch einige »persönlichere« Einsichten ergänzen. Doch da es vor allem gilt, »… um zu …«-Erklärungen zu vermeiden, wenn man die Entstehung des Hundes wirklich verstehen möchte, wie ich noch ausführlich begründen werde, unterbreche ich nach diesem Rückblick und behandle zunächst die Frage: Was ist eigentlich ein Hund? Es handelt sich nämlich beim Hund, wie sich zeigen wird, um ein seltsames Zwischenwesen, das sich nicht einfach festlegen lässt. Seltsam allein schon in der Größe. Wären die Hunde »normal«, sollte es auch Menschen so klein wie Gartenzwerge geben dürfen.
I
Wie aus Wölfen Hunde wurden
Wer oder was ist ein Hund?
Die Hunde selbst wissen es und irren sich nicht. Mag der Unterschied auch noch so groß sein, wie zwischen Rehpinscher und Dogge oder zwischen Windhund und Mops. Uns hingegen können auf geringe Entfernung Zweifel kommen, ob es sich um einen Schoßhund oder eine frisierte Katze handelt, die auf dem Arm getragen wird. Oder ob Dackel und Husky wirklich zur gleichen Art gehören können. Gleiche Art? Die Fachleute sind unterschiedlicher Meinung, ob es sich beim Hund um eine eigenständige Tierart oder lediglich um Variationen und Aberrationen des Wolfes handelt. Diese Unsicherheit hat gleich mehrere Gründe. Erstens sind viele Hunde äußerlich so verschieden vom Wolf, dass man gleichsam auf den ersten Blick meint, hier müsse es sich um zwei Arten handeln. Zweitens ist die Rassenvielfalt innerhalb dessen, was wir als Hunde zusammenfassen, geradezu riesig verglichen mit den Wölfen, auch wenn diese durchaus nicht alle gleich aussehen. Es gibt nahezu schwarze und fast weiße, größere und kleinere Wölfe. Dennoch meinen wir auf den ersten Blick sofort in ihnen »den Wolf« zu erkennen. Drittens können sich Hunde mit Wölfen paaren und Nachwuchs zeugen, sofern die Größenunterschiede nicht zu ausgeprägt sind. Die Nachkommen sollten aus biologischen Gründen »Mischlinge« genannt werden, nicht »Hybride«. Denn das wären Nachkommen von Elterntieren, die unterschiedlichen Arten angehören. Daran hält man sich in Züchterkreisen jedoch überhaupt nicht, sondern meint mit Mischlingen die Kreuzungsprodukte unterschiedlicher Hunderassen, also von Züchtungen, die gar keine natürlichen Rassen (= Subspezies) sind. Mischlinge gehen nicht aus Seitensprüngen zu anderen Arten hervor, wie etwa mit Schakalen. Womit, vierter Punkt, beim Hund ein doppeltes Dilemma gegeben ist, nämlich zu unterscheiden, was eine Art ist und was Rassen sind. Hier mischen sich, teils erfolgreich, teils völlig erfolglos, die Genetiker ein. Dem Erbgut zufolge sind Hunde nämlich ganz klar Wölfe. Ausnahmslos.
Also müsste der Hund als eine Unterart (Subspezies, Rasse) von Canis lupus, dem Wolf, geführt werden, und nicht als eigenständige Art Canis familiaris. Auch wenn uns »familiaris« noch so passend familiär klingt, was auch stimmt, nimmt es lediglich Bezug auf Lebensweise und Verhalten des Hundes. »lupus« hat demgegenüber eine zusätzliche, gegenwärtig kaum noch bekannte Bedeutung, die mit Brennen und Hautausschlag zu tun hat und im wissenschaftlichen Namen des Hopfens steckt, der den »kleinen Wolf« (lupulus) kuriert und auch dem Bier Würze und Stabilität verleiht. Man frage nie den Fachmann, ließe sich aus diesen Erläuterungen schließen. Im vorliegenden Fall durchaus mit Berechtigung, denn was eine Art eigentlich ist, können die Spezialisten nicht zweifelsfrei feststellen, nicht einmal mithilfe der modernen Molekulargenetik. Was von ihren Befunden abgeleitet wurde, hat es in letzter Zeit sogar geschafft, viele klare und »offensichtliche Arten« unsicher zu machen oder zu zerlegen, wobei ein ziemliches Durcheinander zustande gekommen ist. Arten sind eben keine fest gefügten Kategorien des Lebendigen. Das sollten wir zwar spätestens seit Darwins epochalem Werk über den Ursprung der Arten von 1859 wissen, aber man will es immer noch nicht wahrhaben. Auch im Hinblick auf uns Menschen nicht. Denn wie stünde es um die Menschheit, wenn wir nicht eine allumfassend einzigartige, rasselose und (r)echte Art wären? So etwas darf nach den Ereignissen der letzten Jahrhunderte gar nicht angedacht werden.
In der Tierzüchtung, bei Rassehunden vornehmlich, wird hingegen Rassereinheit konsequent angestrebt — negativen Konsequenzen zum Trotz, wie stark verkürzten, die armen Hunde beeinträchtigenden Schnauzen, Haarlosigkeit (Nackthunde), Kurz- und Krummbeinigkeit oder extrem dünnen Körpern und anderen Absonderlichkeiten. Nur weil es den Menschen so gefällt — manchen Menschen, ist heftig einschränkend zu betonen —, werden genetische Fehler, Aberrationen, durch gezielte Zucht zum Rassemerkmal gemacht, als ob die ohnehin immensen Variationen, die der Hund bietet, nicht genug wären. Diese »gute Vielfalt«, die Variation, wird sogar zugunsten der Reinheit der Rasse, die einem schier mechanischen Vervielfältigen, einem Klonieren gleichkommt, in der Rassezucht aufgegeben. Welpen ungewollter Rassenpaarungen werden als Mischlinge abqualifiziert und bei der Züchtung »aussortiert«: Rassezucht gegen alle Vernunft, besonders extrem beim Hund.
Offensichtlich wettert hier ein (Evolutions-)Biologe. Das will ich gar nicht verschleiern oder beschönigen. Auf das Züchten muss ich im Zusammenhang mit der Hundwerdung des Wolfes ohnehin ausführlicher zurückkommen. Worum es zunächst geht, ist die Feststellung, dass aus guten und weniger guten Gründen die Festlegung des Hundes als Art und die Gliederung der Vielfalt der Hunde in Rassen und Mischlinge reichlich problematisch werden, sobald wir den Bereich des gesunden Menschenverstandes verlassen. Und den Hund selbst als Beurteiler nicht zulassen. Denn dieser würde ziemlich klar die Trennung vom Wolf und die Zusammengehörigkeit aller Hunde ausdrücken. Etwa dadurch, dass Hütehunde seit vielen Jahrhunderten sehr erfolgreich gegen Wölfe eingesetzt werden. Und dass Wölfe umgekehrt nicht zögern, Hunde anzugreifen und zu töten. Viele im Wissenschaftsjargon so abwertend als Anekdoten bezeichnete Beobachtungen von Laien bekräftigen die »Feindschaft« zwischen Hunden und Wölfen, vor allem wo Letztere noch oder jetzt wieder vorkommen. So schrieb Ernst Jünger1932 in seinem Essay »Dalmatinischer Aufenthalt« von der Adriainsel Korčula: »Wir hörten zuweilen in den Nächten aus den am Strand mündenden Schluchten sein Gebell, das von allen Hofhunden mit jener Mischung von Erregung und Hass beantwortet wurde, mit der jedes Haustier den Ruf des freien und ungezähmten Verwandten vernimmt.« Er meinte nicht den Wolf direkt, sondern den kleineren Verwandten, den GoldschakalCanis aureus. Diesen hatte der Nobelpreisträger und Verhaltensforscher Konrad Lorenz aus verhaltensbiologischen Gründen für die Stammart der Haushunde gehalten. Genetisch steht der Schakal den Wölfen tatsächlich sehr nahe, aber nicht so nahe wie die KojotenCanis latrans von Nordamerika, die sich mit den dort Grauwölfe genannten Wölfen mischen und Hybridpopulationen bilden. Es verhält sich also recht rätselhaft mit dem Hund. Kein Wunder, dass so viel und so Unterschiedliches über die Hundwerdung spekuliert worden ist. Die Frage, was der Hund ist, beantworte ich mit: »ein Hund«, und kein Wolf mehr.
Die Feststellung »kein Wolf mehr« wirft sogleich zwei weitere Fragen auf, nämlich »Seit wann?« und »Warum (ist der Wolf Hund geworden)?«. Die Zeitfrage zu klären, dazu hilft tatsächlich die Genetik weiter. Stellen wir sie aber noch kurz zurück. Und widmen uns davor dem Warum. Denn wenn wir herausbekommen, was der Grund oder die Gründe waren, dass sich Wölfe zu Hunden wandelten, lässt sich die Frage, wann dies geschehen ist, genauer stellen. Zwei Szenarien zur Hundwerdung gibt es derzeit. Sie unterscheiden sich, wie sich rasch zeigen wird, in ganz wesentlichen Teilen sehr stark. Beginnen wir mit der inzwischen »klassisch« zu nennenden, weil am längsten vorhandenen Theorie.
Eine schöne Geschichte? Wie Steinzeitjäger aus Wölfen Hunde züchteten
Eine Theorie ist sie streng genommen gar nicht, sondern eine schöne Erzählung. Und sie geht etwa so: Vor sehr langer Zeit, mehr als 10.000 Jahre ist es her, jagten Steinzeitmenschen, wie so oft, wieder einmal Wölfe. Ihr dichtes Fell wärmt gut, und in den eisigen Winternächten waren wärmende Wolfspelze, auch in der Größe, so ziemlich das Beste, mit dem sich unsere aus dem tropischen Afrika ins nördliche Eiszeitland eingewanderten Vorvorfahren kleiden konnten. Sie kannten und nutzten zwar das Feuer, aber da es vor den gigantischen Eispanzern, die sich von Norden her nach Mitteleuropa geschoben und von den Hochgebirgen der Pyrenäen, Alpen und des Kaukasus ausgebreitet hatten, kaum Bäume gab, war Brennholz knapp. So verheizten sie sogar die riesigen Stoßzähne der Mammuts, die sie in lebensgefährlichen Jagden erbeuteten. Das gab dann wochenlang, vielleicht sogar über Monate Fleisch, also reichlich für den Bauch. Aber die Kälte blieb. Denn nur an wenigen Stellen gab es Höhlen