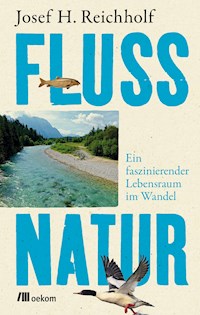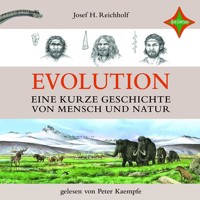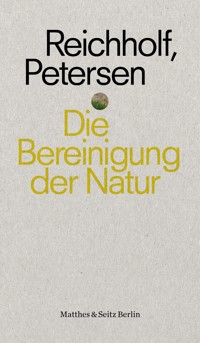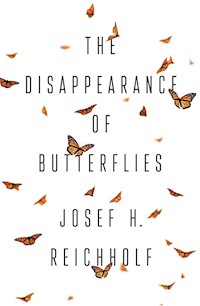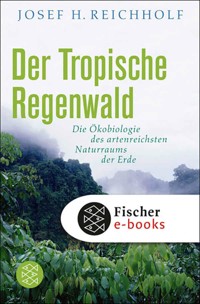8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Von Wasser und Fleisch zu Bier und Brot Wie kam der Mensch aufs Korn? Für die Erfindung des Ackerbaus, die so genannte Neolithische Revolution gab es bislang keine plausible Erklärung: Die Erträge waren viel zu gering. Land musste aufwendig gerodet und Äcker bestellt werden. Egal wie hungrig die Menschen waren: Das Saatgut durfte nicht angetastet werden. Man wurde abhängig vom Klima. Und doch entwickelte sich die Landwirtschaft unabhängig voneinander in drei sehr weit auseinander liegenden Regionen - im Vorderen Orient im »Fruchtbaren Halbmond«, in China und in Mesoamerika - und mit der bäuerlichen Lebensweise wandelten sich auch die Sozialstrukturen. Josef H. Reichholf schaut auf die Jahrtausende vor Beginn der Geschichte und findet eine umfassende Begründung für diese Entwicklung, die zahlreiche wichtige Kulturtechniken der Menschheit erst möglich machte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 342
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Josef H. Reichholf
Warum die Menschen sesshaft wurden
Das größte Rätsel unserer Geschichte
Sachbuch
Über dieses Buch
Von Wasser und Fleisch zu Bier und Brot
Wie kam der Mensch aufs Korn? Für die Erfindung des Ackerbaus, die so genannte Neolithische Revolution gab es bislang keine plausible Erklärung: Die Erträge waren viel zu gering. Land musste aufwendig gerodet und Äcker bestellt werden. Egal wie hungrig die Menschen waren: Das Saatgut durfte nicht angetastet werden. Man wurde abhängig vom Klima. Und doch entwickelte sich die Landwirtschaft unabhängig voneinander in drei sehr weit auseinander liegenden Regionen - im Vorderen Orient im »Fruchtbaren Halbmond«, in China und in Mesoamerika - und mit der bäuerlichen Lebensweise wandelten sich auch die Sozialstrukturen. Josef H. Reichholf schaut auf die Jahrtausende vor Beginn der Geschichte und findet eine umfassende Begründung für diese Entwicklung, die zahlreiche wichtige Kulturtechniken der Menschheit erst möglich machte.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Inhalt
Vorwort: Wir Nomaden
Einleitung
Die Aborigines und Australien – kursorische Gedanken
Teil I Das Problem: Was ereignete sich während der »Neolithischen Revolution«?
Wendezeit
Die Saga vom freien Jäger zum gebundenen Bauern
Zweifel
Eiszeit-Jahreszeiten
Die Eiszeitmenschen im Lauf der Jahreszeiten
Raubtier Mensch (I)
Raubtier Mensch (II)
Raubtier Mensch (III)
Wölfe, Hunde und Bärenfelle
Großtiervernichtung am Ende der Eiszeit
Zwischenbilanz
Teil II Die Herkunft unserer Gattung und Art
Der Primat, der den Wald verließ und Fußgänger wurde
Die »Währung« der Evolution
Erhöhung der Kinderzahl
Verlängerung der Betreuungszeit des Nachwuchses
Häufung von Zufällen oder gerichtete Entwicklung?
Erdgeschichtliche Großereignisse am Ende des Tertiärs
Teil III Steinzeitjäger
Eiszeitliche Höhlenmalereien
War am Anfang das Wort oder die Sprache?
Die Sprache und ihre Folgen
Rückgriff auf den Anfang
Pflanzliche Nahrung im Eiszeitland
Die Farbe Rot
Von reifen Beeren zu reifen Körnern?
Teil IV Die Domestikation von Haustieren
Vorbemerkungen zum Hund
Das Jagdwild wird gezähmt
Fleisch auf Vorrat
Das Einhorn und die Domestikation
Wandernde Herden im Vorderen Orient und in Nordafrika
Teil V Die Wurzeln des Ackerbaus
Nochmals zurück in die Eiszeit
Sprache und Drogen
Die Droge Alkohol
Hopfen, Hanf und Haschisch
Die Geographie von Rauschmitteln und Getreide
Getreide und Bier
Vom Bier zum Brot
Becher und Töpfe – wofür?
Göbekli Tepe
Die »Sesshaften«
Ausblick
Dank
Literaturhinweise
Abbildungen
Register
Vorwort: Wir Nomaden
Unserer Natur nach sind wir Nomaden. Seit Urzeiten streiften die Menschen als Jäger und Sammler umher. Doch vor etwa 10 000 Jahren ereignete sich etwas Besonderes. Im Vorderen Orient wurde der Ackerbau erfunden. Mit ihm begann eine ganz neue Ära. Aus der Vorgeschichte wurde Geschichte, Kulturgeschichte. Alles, was vorher war, gehört zur Naturgeschichte. Erst mit dem Ackerbau löste sich der Mensch aus der Natur, in die er von Anfang an eingebunden war. Seither wird ein zunehmend größerer Teil des zum Leben Benötigten mit eigener Hände Arbeit erzeugt. Es ist nun der Mensch, der produziert, und nicht mehr die Natur allein. Die menschlichen Gesellschaften strukturieren sich um. Ein ganz neuer Weg wird eingeschlagen. Er führt rasch von ersten Ansiedlungen zu städtischen Gemeinschaften. Aus locker miteinander verbundenen Kleingruppen und Stämmen werden Völker und Staaten. Ein starkes Anwachsen der Bevölkerung, das vorher die nomadischen Gruppen bedroht hätte, weil sich die Zahl der Menschen auf die Häufigkeit des Wildes einstellen musste, wird nun vorteilhaft. Denn mit der Zahl der Menschen steigt die Produktivität. Aus ihr geht »Besitz« hervor. Menschen und Besitz verbinden sich zur Macht. Der neue Lebensstil erweist sich dem alten gegenüber als sehr überlegen. Er findet Nachahmer, breitet sich aus und wird dominant. Steinzeitliche Jäger- und Sammler-Kulturen existieren dennoch weiter. Aber sie werden in der neuen Ära der Geschichte immer mehr an die Ränder des Geschehens abgedrängt. Nur in Resten überleben sie bis in unsere Gegenwart. Ihre Lebensweise vermittelte gerade noch rechtzeitig vor ihrem Aussterben einige ungefähre Vorstellungen davon, wie die Menschen in den langen Zeiten der Vorgeschichte lebten. Sie waren Nutzer der natürlichen Produktion. Sie jagten, was es zu jagen gab. Sie nutzten, was verwertbar war. Sie sammelten Wurzelknollen, Beeren, Früchte, Nüsse und andere Pflanzenkost. Sie vermehrten sich nur so stark, wie ihre Umwelt das zuließ. Es gab keine Überbevölkerung. Die Menschen lebten »im Einklang mit der Natur«. Das schließen wir heute daraus. Mindestens neun Zehntel der Zeit, seit es den Menschen als biologische Art gibt, sicherten Jagen und Sammeln das Überleben. Dieses Dasein war gewiss nicht paradiesisch, aber offenbar erfolgreich genug, dass es viele Jahrtausende überdauerte. Plötzlich kam dieser andere, ganz neue Lebensstil auf. Wie konnte die Sesshaftigkeit gleich so viel mehr Lebenssicherheit bieten, dass sie sich von Anfang an als überlegen erwies? Weshalb überdauerten Jäger- und Sammler-Kulturen bis in unsere Zeit nicht in den dafür günstigsten, sondern in den unwirtlichsten Gegenden? Was geschah in jener Zeit, die zu einem neuen Anfang geriet?
Historiker bezeichneten das Geschehen als »Neolithische Revolution«. Revolutionen haben Gründe. Ob gute oder schlechte, darüber wird vorher wie hinterher höchst unterschiedlich geurteilt. Grundlos treten sie jedenfalls nicht auf. Eine »revolutionäre Veränderung«, noch dazu eine solche, die seit rund zehn Jahrtausenden Bestand hat und zu ganz neuen, nicht einmal ansatzweise vorher da gewesenen Lebensformen führte, sollte massive Gründe gehabt haben. Ihnen nachzuspüren, darum geht es in diesem Buch. Der Titel ist das Programm: Warum sind die Menschen sesshaft geworden? Einige Gruppen von Menschen zunächst und auch nur in bestimmten Gebieten, dann immer mehr und schließlich fast die gesamte Menschheit. Unsere Geschichte nahm damit ihren Lauf. Eigentlich ist sie unsere »zweite Geschichte«, denn die erste, die Naturgeschichte von Homo sapiens und der Gattung Mensch, aus der unsere Art hervorgegangen ist, war ihr lange schon vorausgegangen. Wir werden auf diese »erste Geschichte« zurückgreifen müssen, um unsere zweite verstehen zu können. Aber wird sich damit das größte Rätsel der Menschheit, die Entstehung der Kultur, auch lösen lassen?
Einleitung
Im Oktober 1979 bekam ich als deutsches Mitglied der Kommission für Ökologie der Internationalen Naturschutzunion (IUCN) die Möglichkeit, den nordaustralischen Kakadu-Nationalpark zu besuchen. Er liegt östlich der Stadt Darwin und gehört in den tropisch-subtropischen Regionen der Erde zu den am wenigsten von Menschen beeinflussten Wildnissen. Schier endlos dehnt sich krüppelhaft gewachsener, lichter Eukalyptuswald aus. Uralte Sandsteinfelsen ragen stellenweise daraus hervor. Für australische Verhältnisse »große« Flüsse haben bizarre Canyons in diese Urlandschaft geschnitten. Malerische Szenerien begleiten die Ufer, an denen Pandanus-Bäume, zu Deutsch recht unschön Schraubenbäume genannt, mit hellem Grün zum düsteren Rotbraun der Felsen und zum Grau der Wälder kontrastieren. Ufernah stehen sie auf Stelzwurzeln und mit ihrem zumeist verkrümmten Wuchs sehen sie wie Mischwesen zwischen Mangrove und Palmen aus. Weiße Kakadus fliegen laut kreischend in Gruppen umher. Mitunter löst sich aus ihren Scharen, für die sich andere Vögel nicht weiter interessieren, ein besonderer Weißer. Nach Art von Greifvögeln startet er nun einen Jagdflug und enttarnt sich damit als weißer Habicht (Accipiter novaehollandiae). Er hatte sich unter die Corella-Kakadus (Cacatua pastinator) gemischt. In deren Schwärmen bleibt er unentdeckt. Für die von ihm gejagten Kleinvögel stößt der Feind aus den Kakaduschwärmen ganz überraschend zu. Wo es keine weißen Kakadus gibt, kommt dieser Habicht in sogenannter grauer Phase vor. Die Kakadus greift er nicht an. Sie wären für ihn zu stark und mit ihren kräftigen Schnäbeln auch zu gefährlich.
Viele Besonderheiten gibt es in Australien, aus unserer europäischen Sicht zumal, für die dieser Kontinent in vielerlei Hinsicht eine andere Welt ist. Ungereimtheiten kommen hinzu, weil für die Neuheiten keine geeigneten Namen zur Verfügung standen, als sie entdeckt wurden. So heißen mehrere Flüsse in Nordaustralien Alligator River, obgleich es Alligatoren dort gar nicht gibt. Diese amerikanischen Panzerechsen blieben geradezu harmlos verglichen mit den Riesen von Salzwasserkrokodilen (Crocodylus porosus), die an den zur Arafura See hin entwässernden Flüssen leben. Große Salzwasserkrokodile sind auch für Menschen bedrohlich.
Wir fuhren daher in geräumigen Aluminiumbooten mit starken Außenbordmotoren flussaufwärts, bis die Küstenzone weit genug hinter uns lag, in der die gefährlichen Krokodile vorkommen. Auf einer Sandbank unter einer am Ufer wachsenden Gruppe großer Eukalypten wurde Mittagsrast gemacht. Schatten spendeten diese Bäume jedoch kaum, zumal die Sonne senkrecht stand. Ihre Blätter hängen nach unten. Ungehindert lassen sie die Strahlung durch. Bei an die 40 Grad Celsius Lufttemperatur und kaum spürbarer Luftbewegung breitete sich im Canyon eine dösige Stimmung aus. Der Direktor der australischen Nationalparks, der die Exkursion leitete, fragte dennoch, ob jemand Lust hätte, jetzt mit einem als Ranger im Nationalpark tätigen Aborigine in den Busch zu gehen. Dort könnte dieser die Liebeslaube eines Laubenvogels vorführen. Robert E. Ricklefs, Ornithologe und Ökologe wie ich, wollte sich mit mir zusammen diese Möglichkeit nicht entgehen lassen. Wir folgten über den Steilhang hinauf, den der Fluss in das Plateau geschnitten hatte, dem Aborigine in den Wald. Mit einem merkwürdigen, für uns nicht zu schnellen Schlenderschritt strebte dieser auf das nur ihm bekannte Ziel zu. Schon nach wenigen Minuten nahm uns ein völlig gleichförmiger Eukalyptus-Buschwald auf. Die Höhe der Bäume dürfte nur drei bis fünf Meter betragen haben. Alle Stämme waren grauweiß, krumm und ohne markante Unterschiede in Dicke und Wuchsform. Dürres Laub deckte den Boden, sodass wir wie auf einem Teppich dahingingen, der Schritt für Schritt auf dieselbe Weise leise, fast einschläfernd raschelte. Voran ging es, so unser Eindruck, ziemlich geradlinig. Nichts war zu sehen, was uns irgendwie Anhaltspunkte zur Orientierung hätte geben können. Es war um die Mittagszeit. Die ohnehin kaum erkennbaren Schatten der Bäume wiesen keine Richtung. Gespannt Ausschau haltend, ohne aber den Boden aus den Augen zu lassen, folgten wir dem Aborigine. Es ist in solchem Gelände immer gut zu schauen, wohin die Füße treten. Wie viel Zeit verging, versäumten wir festzustellen. Als wir wieder zurück zum Lagerplatz kamen, waren gut zwei Stunden vergangen. Daher dürften wir hin und zurück etwa acht Kilometer zurückgelegt haben. Ganz unvermittelt wies der Aborigine mit ausgestrecktem Arm nach vorne. Und da war sie, die »Laube«. In den Boden gerammte Ästchen, die sich oben schlossen und ineinander verhakten, bildeten einen glatten, sauberen Gang. An beiden Enden dieses Gebildes lagen Dutzende grauweißer Schneckenhäuschen wie grober Kies vor einer Auffahrt zu einem Gebäude. Die sonnengebleichten Schneckenhäuschen erzeugten im dumpfen Grau, Braun und fahlem Grün des Waldes einen auffälligen, auch durchs Krüppelholz schon meterweit erkennbaren Kontrast (Abb. 1).
Hier pflegte er also zu balzen, der Graue Laubenvogel (Chlamydera nuchalis). Mit herabhängenden Flügeln würde er, in Erregung geraten, seinen einzigen Farbschmuck im schuppig grauen Gefieder dem Weibchen zeigen, ein lilafarbenes, rundliches Federbüschel auf dem Hinterkopf. Nur bei heftiger Balz entfaltet das Männchen diesen Farbfleck. In den Genuss eines solchen Schauspiels konnten wir natürlich nicht kommen. Dazu hatten wir uns auch viel zu schnell und zu direkt genähert. Wir hatten keine Zeit, darauf zu warten und zu hoffen, dass tatsächlich ein Weibchen kommen und den Erbauer dieser Laube zum Balzen bringen würde. Ich fotografierte dieses wundersame Gebilde, schlug im Vogelbestimmungsbuch nach, wie er aussieht, der Graue Laubenvogel, und unterließ es, eines der Schneckenhäuschen wegzunehmen. Sicher hatte er sie alle recht mühsam gesammelt. Nach nur wenigen Minuten Aufenthalt ging es wieder zurück durch das Einerlei des Buschwaldes. Jetzt erst überlegte ich, wie sich der Aborigine orientiert haben könnte, um so eine Stelle zu finden, zu der kein Pfad hinführt. Ich konzentrierte mich und versuchte darauf zu achten, ob ich Bäume oder Steine erkennen könnte, die Hinweise auf die Richtung geben. Ohne Erfolg. Hier im Wald gab es nicht eine der Bauten der draußen in den Überschwemmungsebenen so häufigen der Kompass-Termiten. Zwei bis drei oder mehr Meter hoch und lateritrot ragen sie auf. An zwei Seiten sind sie so abgeflacht, dass ihre Schmalseite wie eine »Schneide« genau in Nord-Süd-Richtung weist. Doch auch mit Kompasstermiten ist ohne Uhr und Schatten bei senkrecht stehender Sonne nicht viel anzufangen, wenn man eine bestimmte Richtung sucht.
Mit Schneckenhäuschen geschmückte Laube des Grauen Laubenvogels (Chlamydera nuchalis) im nordaustralischen Kakadu-Nationalpark
Während die bloßen Füße des Aborigine über das Laub am Boden dahinglitten, den krummen Bäumen auswichen, um hinter ihnen sogleich wieder in die eingeschlagene Richtung einzuschwenken, kam mir seine Orientierungsfähigkeit immer rätselhafter vor. Wir beide, die wir ihn begleiteten, zweifelten zwar nicht daran, dass er uns genauso sicher zurückbringen würde, wie er jenes Fleckchen Boden mit der Laube im Busch fand. Aber es beruhigte uns doch, als wir die Stimmen unserer Gruppe wieder hörten. »Ja, die Aborigines, die können das! Sie brauchen keinen Kompass!«, meinte der Nationalparkdirektor. Er hielt dies für selbstverständlich. Vielleicht war es auch gar nichts so Besonderes, wie ich meinte. Die Aborigines hätten sich wohl umgekehrt gewundert, was wir alles benötigen, um uns nur ein Stündchen lang durch den Busch in einer Richtung zu bewegen. Der Wald ist ihre Lebenswelt. Zumindest war er dies, bis vor nur einem Menschenalter Europäer in die letzten Wildnisse Australiens vordrangen, sich darin ansiedelten und das Land nutzten, wo immer etwas aus ihrer Sicht Nutzbares herauszuholen war. Sie waren mit anderen Fähigkeiten als die Aborigines angekommen. Sie betrachteten das Land anders und veränderten Australien in nur zwei Jahrhunderten so sehr, dass es zu einem Ableger Europas, zu einem »Neo-Europa« verwandelt worden ist (Crosby 1986). Nur in wenigen, sehr entlegenen Gebieten blieb der Südkontinent noch ursprüngliches Australien. Die Ureinwohner, die Aborigines, wurden von den europäischen Siedlern an die Ränder abgedrängt und mit ihrer Lebensweise marginalisiert. Den Fähigkeiten der Neuankömmlinge hatten die Aborigines nichts entgegenzusetzen. Sie waren hoffnungslos unterlegen. Ihr Aussterben konnte nur eine Frage der Zeit sein, denn die »Einweisung« in Reservate eröffnete ihnen keine Zukunft. Wie schon an verschiedenen anderen Stellen, aber kaum in solcher Härte, schlug das Darwin’sche ›survival of the fittest‹ zu. Die Europäer waren die Überlegenen, die Fitteren, und nicht die Aborigines, die Zehntausende von Jahren der Auslese der australischen Natur ausgesetzt gewesen waren. Sie hatten sich der Wildnis angepasst. Nun wurde die Wildnis zivilisiert und den Vorstellungen der Europäer angepasst.
Aus der Landschaft herausragende Felsen dienten den Aborigines nicht nur als Landmarken für ihre ausgedehnten Wanderungen, sondern auch als Kultstätten. Das geht aus ihren Felsbildern hervor. An vergleichbaren Stellen entstanden die Eiszeitmalereien in der Kalahari und in der Sahara.
Die Aborigines und Australien – kursorische Gedanken
Der Vorgang der Europäisierung Australiens machte zweierlei deutlich. Dieser Kontinent, der seit vielen Jahrmillionen vom großen Rest der Festländer isoliert geblieben war, hätte Landwirtschaft durchaus zugelassen. Doch die Aborigines hatten keine entwickelt. Warum war das so? Was hinderte sie daran, wenigstens wie ihre Nachbarn und nahen Verwandten, die Papua auf Neuguinea, in einer Art von Gartenbau nährstoffreiche Pflanzen zu kultivieren? Sie hätten damit Vorräte anlegen und ihr umherschweifendes Leben auf eine verlässlichere Basis stellen können. Wenigstens im tropischen Norden und im feuchten Nordosten Australiens, wo die Niederschläge regelmäßig genug kommen, wäre dies möglich gewesen. Im Innern regnet es zu unregelmäßig, um sich mit Pflanzenbau darauf einstellen zu können. Aber Australien besteht nicht nur aus dem »dürren Herzen« des Kontinents, sondern auch aus breiten Randgebieten, die ergiebig genug sind – sogar für die anspruchsvollen Europäer. Wer die Natur so fein beobachten und deuten kann, wie die Aborigines, und wer wie sie in der Lage war, das Wurfholz, den Bumerang, als Jagdwaffe zu entwickeln, dem kann schwerlich von vornherein die grundsätzliche Fähigkeit abgesprochen werden, auch hinter die Geheimnisse von Ackerbau und Viehzucht zu kommen. Australiens Natur ist nicht gerade freigiebig. Der Mangel an jagdbarem Wild und nutzbaren Pflanzen sollte Grund genug geboten haben, sich von der mühsamen, zeitaufwändigen Jagd weniger abhängig zu machen. Die Spärlichkeit des Wildes drückt sich in der Wurftechnik des Bumerangs aus. Er ist gut geeignet für den Wurf auf kleinere Kängurus und einige andere australische Tiere. Traf der Wurf nicht, ging das Jagdwerkzeug nicht verloren wie viele Pfeile, die abgeschossen wurden und das Ziel nicht trafen. Der Bumerang kehrt zum Werfer zurück, wenn dieser die besondere Wurftechnik beherrscht. Aber reicht die Spezialität des Bumerangs aus, um zu erklären, warum die Aborigines in Australien keinerlei Ackerbau und Viehzucht entwickelten? Ganz gewiss nicht. Dieses Problem wird noch größer, wenn man berücksichtigt, dass Australien schon sehr früh von Menschen besiedelt wurde. Die Vorfahren der Aborigines gelangten vor mindestens 40 000 Jahren, wahrscheinlich sogar noch früher, auf diesen Inselkontinent. Damals herrschte in Europa Eiszeit, und es lebten hier die Neandertaler. Nach Australien kamen die Aborigines bereits als Spitze der ersten großen Wanderwelle von Menschen unserer Art, die von Afrika aus an den Küsten des Indischen Ozeans entlangzogen. Damals lag der Meeresspiegel um gut 100 Meter niedriger als heute. Daher gab es von Südostasien bis zu den Kleinen Sunda-Inseln keine Inselwelt wie gegenwärtig, sondern durchgängiges Festland. Auf der gegenüberliegenden Seite war Neuguinea mit Australien verbunden. Also trennten nur zwei oder drei schmale Meeresarme, die vom Pazifik zum Indischen Ozean reichten, Australien von Südostasien. Die Vorfahren der Aborigines müssen diese per Floß überwunden haben. Einen Zugang trockenen Fußes nach Australien gab es nie. Die Aborigines brachten somit schon solche Kenntnisse mit. Sie beherrschten die Bearbeitung von Stein und Holz. In Australien schufen sie ähnlich großartige, naturalistische Felsmalereien (Abb. 3), wie sie in Europa in den späteiszeitlichen Höhlen in Frankreich und Spanien gefunden wurden.
Naturalistische Aborigines-Felsmalerei einer Schildkröte im nordaustralischen Kakadu-Nationalpark
Gezähmt und zu Haustieren gemacht hatten sie jedoch keine australischen Tiere. Nur der Dingo, ein Abkömmling südostasiatischer Haushunde, wurde ihr einziges, aber nicht besonders stark an die Menschen gebundenes Haustier. Da lebten die Aborigines aber schon mehrere zehntausend Jahre in Australien. Die Vorfahren der Dingos erhielten sie wahrscheinlich von Menschen aus Südostasien. Denn die nächsten Verwandten des Dingos sind Hunde, die auf Neuguinea leben. In Australien waren Dingos nicht heimisch. Auf den Kontinent der Beuteltiere gelangten diese Hunde in einer Zeit, als der Meeresspiegel noch niedrig genug lag und die Insel mit Australien verbunden war. Der Wolf (Canis lupus) bildet die Stammart aller Haushunde (Canis familiaris). Die Domestizierung des Hundes fand gegen Ende der letzten Eiszeit, also vor 10 000 bis 12 000 Jahren, in Eurasien statt. Die Vorfahren der Dingos könnten also gerade noch in jener Zeit zu den Aborigines gelangt sein, in der wegen des niedrigen Meeresspiegels Australien mit Neuguinea noch verbunden war. Und zwar nur von Südostasien her. Kulturelle Austauschvorgänge waren über Land sicherlich leichter als mit Hilfe von Seefahrten auf primitiven Flößen. Sie blieben jedoch offenbar selten. Denn die Aborigines entwickelten sich in Australien sehr eigenständig. Die Papua auf Neuguinea auch. Mit den anderen Bewohnern der südostasiatischen Inselwelt scheint es kaum zu Kontakten gekommen zu sein. Der nacheiszeitliche Anstieg des Meeresspiegels erschwerte die Austauschmöglichkeiten beträchtlich. Neuguinea wurde zur Insel und Australien ein Inselkontinent. Die Aborigines lebten seither isoliert. Kein Wissen um die Kultivierung von Pflanzen erreichte sie in den letzten 10 000 Jahren mehr. So blieb in Australien die ursprüngliche Lebensweise der Menschen erhalten, die sie mitbrachten, als sie vor gut 70 000 Jahren aus Afrika nach Asien ausgewandert waren.
Erst mit der Ankunft der Europäer vor rund 200 Jahren bekamen die Aborigines wieder kulturellen Kontakt zu anderen Menschen. Erfanden inzwischen ihre nahen Verwandten, die Papuas von Neuguinea, eigenständig den Gartenbau? Oder erreichten sie die Kenntnisse dazu gerade noch rechtzeitig von Südostasien her, bevor ihr Land durch das steigende Meer zur Insel wurde? Denn anders als die Aborigines waren die Papua vor Jahrtausenden weitgehend sesshaft geworden. Sie entwickelten Gartenbaukulturen rund um ihre Dörfer und eine erstaunliche Vielfalt von ganz eigenständigen Sprachen. Die Aborigines aber blieben Jäger und Sammler. Ihre steinzeitliche Kultur dauerte im Wesentlichen unverändert an, bis sie erst in unserer Zeit am so unvermittelten Zusammenprall mit dem europäischen Lebensstil scheiterte. Bruce Chatwin hat dies höchst eindrucksvoll beschrieben. Die Mythologie der Aborigines ist sehr eng mit dem Land verbunden, in dem sie lebten und in dem es für sie, vom Meer an den Rändern des australischen Kontinents abgesehen, keine Grenzen gegeben hatte. Sie waren dennoch keine primitiven Randgruppen der Menschheit. Sie lebten auf ihre Weise vergleichbar eigenständig wie vor der Ankunft der Europäer die Prärieindianer Nordamerikas. Die Indianer sind den Europäern viel näher verwandt als die Aborigines. Trotzdem waren sie Jäger und Sammler geblieben. Doch es existierten schon zu Zeiten der Prärieindianer am südlichen Rand des nordamerikanischen Kontinents fortschrittliche Ackerbaukulturen, die sogar Pyramiden errichteten. Noch weiter südlich, in Mittel- und Südamerika, waren vor den Zeiten der Prärieindianer mit Mais und Kartoffeln zwei der gegenwärtig global fünf wichtigsten Kulturpflanzen entwickelt worden. Heute aber gehört das einstige Indianerland der nordamerikanischen Prärien zum produktivsten Weizenland der Erde. Hochwertiger Weizen gedeiht in Australien auch auf früherem Aborigines-Land. Ihr Land war also grundsätzlich geeignet für Ackerbau. Jäger und Sammler-Kulturen überlebten keineswegs nur in klimatisch extremen Gebieten, in denen Ackerbau nicht möglich gewesen wäre oder mit einfachen Mitteln nicht genügend Ertrag geliefert hätte. Warum wurde der Ackerbau aber nur in einigen wenigen, zudem sehr weit voneinander entfernten Gebieten »erfunden«? Solche Gedanken gingen mir durch den Kopf, als ich Felszeichnungen von Aborigines im »Röntgenstil« betrachtete (Abb. 4). Nein, an Intelligenz mangelte es ihnen, wie auch all den anderen »Naturvölkern« gewiss nicht, die Jäger und Sammler geblieben sind oder als Hirtennomaden übers Land zogen, bis sie von der neuen Macht der Ackerbauer in die unwirtlichen Randbereiche der Erde abgedrängt wurden. Woran mangelte es ihnen aber dann? Welches Geheimnis verbirgt sich hinter der Formulierung von der »Erfindung des Ackerbaus«?
Felsmalerei von Aborigines im »Röntgenstil« im nordaustralischen Kakadu-Nationalpark
Teil I Das Problem: Was ereignete sich während der »Neolithischen Revolution«?
Wendezeit
Gegen Ende der letzten Eiszeit lebten Menschen schon fast überall in Afrika, Eurasien, Australien sowie in Nord- und Südamerika. Mit Ausnahme der Antarktis waren also alle Kontinente besiedelt, als das Eis zurückging und der Meeresspiegel anstieg. Unbesiedelt waren damals lediglich Madagaskar, Neuseeland und andere sehr abgelegene ozeanische Inseln. In dem Maße, in dem die nordischen Eismassen abschmolzen, die Tausende von Jahre lang große Teile Nordamerikas und Nordwest-Eurasiens bedeckt hatten, rückten Menschengruppen ins eisfrei gewordene Land nach, um die Großtiere zu jagen. Für diese hatten sich mit dem Rückzug der Gletscher neue, sehr ergiebige Lebensräume entwickelt. Die letzte Eiszeit, die Würm- oder Weichselkaltzeit, in Nordamerika Wisconsin-Glacial genannt, war zudem nicht beständig »eisig«, sondern durchaus auch stärkeren klimatischen Schwankungen unterworfen. Diese hielten die Dynamik der Lebensräume in Gang, waren aber nicht ganz so extrem wie am Ende der letzten Eiszeit. Ziemlich rasch, den Eisbohrkernen aus Grönland zufolge vielleicht in kaum mehr als 100 Jahren, stieg vor etwa 14 000 Jahren die Temperatur um über 10 Grad Celsius an. Sie erreichte dabei fast schon den nacheiszeitlichen Durchschnittswert, der unserer Klimazeit zugrunde gelegt wird. Der Anstieg währte allerdings nur kurz. In heftigen Stufen fiel die Temperatur innerhalb von einem Jahrtausend wieder auf jene Kälte ab, aus welcher der erste Anstieg hervorgegangen war, verweilte in diesem Zustand kurz für ein paar Jahrhunderte und schnellte sodann gleich um 16 bis 17 Grad Celsius in die Höhe. Etwa 11 000 bis 9000 Jahre vor heute war es wärmer oder zumindest ähnlich warm wie in der Gegenwart. Vor 8200 Jahren kam ein neuerlicher Kälteeinbruch, bei dem die Temperatur um etwa 3 Grad Celsius zurückging. Darauf folgten sehr warme Zeiten mit Höchstständen der Temperatur, die wahrscheinlich erheblich über die gegenwärtigen Verhältnisse hinausragten (Abb. 5).
Abrupte Klimaschwankungen gegen Ende der letzten Kaltzeit, der Würm-Eiszeit, vor dem Übergang in die gegenwärtige Warmzeit, das Holozän.
Sie dauerten mit kleineren Schwankungen rund drei Jahrtausende an, also bis in die Frühzeit der ersten Hochkulturen um 3000 vor unserer Zeitrechnung. Was die Eisbohrkerne aus Grönland zeigen, geht in ähnlicher Verlaufsform aus den Untersuchungen von Torfschichten in Hochmooren hervor. Darin erhalten gebliebene Pollenkörner von Pflanzen geben Aufschluss über die Vegetation der Umgebung. Da wir die heutigen Lebensansprüche der Pflanzen, von denen die Pollenkörner stammen, und ihre geographische Verbreitung kennen, kann man auf die klimatischen Verhältnisse schließen, die zu den Zeiten herrschten, als die Schichten des Torfes aufgebaut und abgelagert wurden. Sie bestätigen im groben Bild den Anstieg oder Abfall der Temperaturen, die aus den Eisbohrkernen abgeleitet worden sind. Zweifellos hatte es sich in der Endphase der letzten Eiszeit um eine Zeit heftiger klimatischer Veränderungen gehandelt. Sie liefen keineswegs nur in den eisnahen Gebieten ab, sondern betrafen die ganze Erde. Ein ausgeprägter eiszeitlicher Wechsel zwischen warmen Feucht- und etwas kühleren Trockenzeiten ist für die tropischen Regenwälder in Amazonien und in Afrika festgestellt worden. Mit ihnen verbunden waren Anstiege und Absenkungen des Meeresspiegels und sie betrafen insbesondere auch die fünf Jahrtausende der Übergangszeit von der letzten Eiszeit in die erdgeschichtliche Gegenwart, das Holozän. Die Jahrtausende davor, mit Hochständen der Gletscher um 18 000 vor unserer Zeitrechnung, waren klimatisch erheblich stabiler als die fünf folgenden der Übergangszeit und auch in den letzten zehn Jahrtausenden vor heute fluktuierte das Klima nicht mehr annähernd so stark. Das Ende der letzten Eiszeit trat also weder abrupt ein, noch kam es allmählich, sondern mit heftigen Schwankungen, die Jahrtausende anhielten. Um genau diesen Befund geht es. Aus Gründen der Verständlichkeit darf er vereinfacht dargestellt werden, auch wenn, wie so oft, die wirklichen Verhältnisse viel komplexer gewesen sein mögen. Es hängt von der Art der Fragen ab, die behandelt werden sollen, welches Ausmaß an Genauigkeit angebracht ist. Diese Zwischenbemerkung gilt den häufig vorgebrachten »Bedenken«, dass doch alles viel komplizierter gewesen sei und dass man nicht so sehr vereinfachen dürfe. Wer diesen Einwand ernstnimmt, wird nie zu überschaubaren Ergebnissen kommen. Kein Geschichtsbuch ließe sich ohne die vereinfachende Herausarbeitung der Grundlinien und der wichtigsten Vorgänge schreiben.
Der Befund, um den es hier geht, besagt, dass sich in der klimatisch stark schwankenden Übergangsphase von der letzten Eiszeit zur Gegenwart Entwicklungen angebahnt hatten, die zu Ackerbau und Viehzucht führten und damit die »Neolithische Revolution« gebracht haben. Das Neolithikum, die Jungsteinzeit, bezeichnet eine kulturgeschichtliche Einstufung der Lebensweise von Menschen. Auch diese Bezeichnung bezieht sich auf die Übergangszeit zwischen der davor liegenden »alten Zeit«, der Altsteinzeit, und der nach ihr beginnenden historischen Zeit. Sie fällt somit im Wesentlichen mit der klimatischen Übergangszeit von der (letzten) Eiszeit in die nacheiszeitliche Warmzeit zusammen. Dass es bis in unsere Gegenwart zahlreiche Menschengruppen gegeben hat, die noch im Stil der Jungsteinzeit, also mit Steinwerkzeugen als Gerät, lebten und die Metalle, wie Eisen, Kupfer und Bronze, nicht kannten, widerspricht dieser Einstufung nicht. Vielmehr bedeutet sie, dass die großen Veränderungen in der Jungsteinzeit keineswegs alle Menschen gleichzeitig und in gleichem Umfang betroffen hatten. Deshalb lassen sich auch keine klaren Grenzen ziehen zwischen den verschiedenen historischen Epochen. Die Entwicklungen hatten sich ineinander oder aneinander vorbeigeschoben, sodass durchaus ein langes Nebeneinander von Altem und Neuem möglich war. Wer auf klare Abgrenzungen und Zuordnungen bedacht ist, dem missfällt dies vermutlich. Aber ganz ähnlich wie in der Natur herrscht auch in der Geschichte das Fließende über das abgrenzbar Beständige.
Wählen wir nun eine solche makroskopische Betrachtung, dann stimmen die Zeiträume des großklimatischen Wechsels von der letzten Eiszeit in die gegenwärtige Warmzeit und des kulturellen Wechsels vom freien Leben als Jäger und Sammler zur Sesshaftigkeit der Ackerbauern ganz gut überein. Die Annahme, dass es Zusammenhänge gibt, liegt also nahe. Eine Geschichte reimt sich fast von selbst zusammen. Sie könnte, wie nachfolgend ausgeführt, aussehen, und sie wird in vielen Schriften, die sich mit der Neolithischen Revolution befassen, in ganz ähnlicher Weise zu finden sein.
Die Saga vom freien Jäger zum gebundenen Bauern
Gegen Ende der letzten Eiszeit verschlechterten sich die Lebensbedingungen für die Jäger und Sammler in Eurasien. Jahrtausendelang hatten sie Mammuts, Wisente, Hirsche, Wildpferde und andere Großtiere gejagt. Doch nach und nach wurden diese immer seltener. Die Verbesserung der Jagdtechnik konnte lange den Niedergang des Wildes ausgleichen. Mit Pfeilspitzen aus Obsidian und mit Speeren, die von Wurfschlingen wuchtig und treffsicher geschleudert wurden, gelang es, auch scheuere oder große Beute zu erlegen. Da und dort boten sich natürliche Engpässe an, durch die das Wild kommen musste, wenn es im Frühjahr auf die schneefrei werdenden Flächen hinaus- und im Herbst davon wieder zurückzog. Aber die verstärkte Bejagung beschleunigte den Rückgang der Wildbestände. Fleisch, von dem sich die Menschen bisher weitgehend ernährt hatten, wurde bald zur raren Köstlichkeit. Es galt, auf Pflanzenkost auszuweichen. Doch abgesehen von den bisher schon genutzten Pflanzen war kein Ersatz in Sicht. Von den Gräsern und Kräutern, die von den Großtieren beweidet wurden, konnten Menschen nicht leben: von Rentierflechten ebenso wenig wie von der Rinde des weitverbreiteten Weidengebüsches. Im sommerfeuchten, im Winter aber tief gefrorenen Boden gab es außer Zwiebeln, die entweder giftig oder nur als Zusatzkost geeignet waren, keine verwertbaren Knollenfrüchte. Auch Pilze und Beeren boten keinen wirklichen Ersatz für das Wildfleisch. Pilze ließen sich getrocknet den Winter über aufbewahren. Ihr Nährwert ist allerdings gering. Die beginnende Erwärmung zwang deshalb die Eiszeitmenschen immer weiter nach Süden in Regionen, in denen im Sommer recht dürftig anzuschauende Gräser aufwuchsen. An diesen entwickelten sich Körner. Vögel kamen zu Beginn der Reife von weit her geflogen, um sie zu verzehren. Die hungernden Menschen taten es ihnen gleich. Hand für Hand, Stunde um Stunde, tagelang sammelten sie die Körner und zerkauten sie zu einem Brei, der im Mund süßlich zu schmecken anfing und offenbar bekömmlich war. Sie merkten mit der Zeit, dass sich reife, hart gewordene Körner längere Zeit aufbewahren lassen. Man konnte sie als Vorrat für kommende, noch schlechtere Zeiten zurücklegen. Kritisch wurde vor allem das Frühjahr, wenn das ohnehin spärliche, getrocknet gelagert Fleisch aufgezehrt war. Dann war man froh um die Körner. Einige davon blieben übrig, keimten an den Stätten aus, an denen die Menschen überwintert hatten, und entwickelten dort neue Grasbestände, an denen im Sommer oder Frühherbst wieder reife Körner abgesammelt werden konnten. Dieses Sammeln, Bevorraten und Wiederaufwachsen neuer Saat verdichtete sich zu Kenntnissen. Diese reiften zu Einsichten in den zugrunde liegenden Vorgang. Beiläufiges und Zufälliges wandelte sich zur Regelmäßigkeit. Anfänglich bloß weggeworfene Reste wurden zu Saatgut; das Einsammeln der gereiften Körner zur Ernte.
Sicher zeigte sich bald, dass solche Flächen am ertragreichsten wurden, die vor der Aussaat von störendem, die keimenden Pflänzchen behinderndem Wuchs gesäubert worden waren. Reinbestände brachten mehr ein als vereinzelte Ähren in pflanzlichem Mischmasch aus Wildgetreide-Gräsern und anderer Vegetation. Auch waren die Ähren leichter zu sammeln, wenn nicht jede für sich gesucht werden musste. Doch wo das Eingesparte und Nichtverzehrte an Körnern im nächsten Frühjahr ausgesät wurde, dorthin kamen auch die Vögel und bedienten sich, als ob für sie Futter ausgeworfen worden wäre. Sie wurden nun zu Feinden der neuen Ernte. Und wenn die Körner in den Ähren zu reifen begannen, kamen noch mehr Vögel angeflogen. Ihre Schwärme vergrößerten sich mit dem Umfang der zu erwartenden Ernte. In der Zeit zwischen Aussaat und Ernte interessierten sich auch andere Tiere für solche ersten Kulturen. Gazellen kamen, die gerne gejagt wurden, die aber scheu und selten geworden waren. Das neue, schmackhafte Grün zog sie stärker an als das bei den dürren Gräsern der Waldsteppen an den sonnenseitigen Berghängen der Fall war. Wildziegen und Wildschafe weideten dort gern, wohin die Gazellenherden nicht wanderten. Auch diese Grasfresser kannten und schätzten sehr wohl die Qualität der Wildgräser. Auf den neuen Fluren wuchs bestes Futter. Das führte sie in die Falle. Denn in nächster Nähe lauerten gut versteckt Menschen, um ihre Felder zu bewachen und die unerwünschten Gäste fortzujagen oder zu erbeuten. Die neue Vorgehensweise brachte doppelten Ertrag. Die junge Saat, das keimende, heranwachsende Wildgetreide, lockte die Ziegen und Schafe herbei. Das reife Korn aber würde später den Menschen helfen, über die Hungerzeit zu kommen. Einzige Bedingung: Man musste an Ort und Stelle bleiben. Wer jedoch von der Jagd alleine lebte, konnte nicht länger an einem Ort bleiben, denn das vorhandene Wild war schnell dezimiert. Die Jäger mussten dem Wild folgen. Nun aber kam es ganz von selbst herbei. Es konnte direkt gejagt und erlegt, mit etwas Glück und Können auch gefangen werden. Denn in der Zeit der besonders schmackhaften Jungsaat zogen insbesondere die Muttertiere mit ihren Kitzen, Zicklein oder Lämmchen zum frischen Grün. Gelang es den Menschen, die Mütter zu erlegen, blieben die Jungen ganz von selbst. Sie wurden leichte Beute. Waren sie schon groß genug, um sich vom Gras der Umgebung zu ernähren, konnte man sie in Umzäunungen einsperren und später, bei Bedarf, töten. Während ihnen die Menschen Schutz boten, wurden die heranwachsenden Ziegen oder Schafe zutraulicher. Die Haustierwerdung konnte beginnen. Da die Menschen nur an den Körnern, nicht aber an den Wildgräsern selbst interessiert waren, kam eine Verwertungsgemeinschaft zustande, die einander ergänzte. Wer Jungtiere aufzog und in Gefangenschaft hielt, bemerkte sicherlich, dass nach der Fülle des Sommers das Futter immer knapper wurde. Im Nahbereich der kleinen Niederlassung war bald alles abgeweidet. Entweder mussten die Tiere nun geschlachtet oder an andere, noch nicht übernutzte Stellen gebracht werden. So begann das Wanderhirtentum.
Begünstigt wurde es von einer biologischen Eigenart der Tiere, die »Prägung« genannt wird. Die Jungtiere prägen sich in den ersten Lebenswochen das Aussehen desjenigen Lebewesens ein und folgen diesem nach, bei dem sie aufwachsen. Wie klein sie sein müssen, um auf den Menschen geprägt zu werden, hängt von den einzelnen Arten ab und auch von der Möglichkeit, die Jungtiere mit Milch versorgen zu können. Gefangene Muttertiere geben Milch. So lange wenigstens, wie sie das in Freiheit auch tun würden, wenn sie Nachwuchs führen. Muttertiere versuchen oft auch, zu ihren Jungen zu kommen, wenn diese in eine ausweglose Situation geraten sind. Gefangene Jungtiere befinden sich in so einer Lage. Die zunächst flüchtige Mutter lässt sich von den Klagelauten ihres Kindes zurücklocken – und gefangen nehmen. Leben solche Tiere von Natur aus in Gruppen, etwa in Familienverbänden oder in Herden, geht es viel leichter, sie an Menschen als Ersatzgruppe zu gewöhnen als bei Einzelgängern. Nur wenige Tiere passender Größe und Ernährungsweise eignen sich daher ihrer Natur nach für das Zusammenleben mit den Menschen. Sie dürfen körperlich nicht zu groß sein und zu gefährlich werden. Sie sollten aber groß genug sein, um zu lohnen. Zumindest für die Anfänge scheiden solche Tiere aus, die zu schnell zu groß werden. Denn selbst wenn sie bei ihrem Heranwachsen die Menschen nicht direkt bedrohen, brauchen sie in ihren Gehegen zu viel Nahrung.
Ziegen und Schafe haben zweifellos eine günstige Körpergröße. Schon größere Kinder, gewiss aber heranwachsende Jugendliche können mit ihnen zurechtkommen. Bei Rindern geht das nicht so leicht; bei Pferden noch weniger, denn sie können mit ihren ausschlagenden Hufen auch lebensgefährlich sein, wenn man sich von hinten nähert. Tieren, die Geweihe oder Hörner tragen, kann man eher ausweichen. Die weiblichen Hornträger sind in aller Regel von Natur aus friedlicher als die männlichen. Große Tiere lassen sich auch nicht mehr so leicht schlachten; zu kleine sind schwierig unter Kontrolle zu halten, weil sie aus einfachen Gehegen durch Spalten und Lücken entweichen. Für diese einfache Form von Haltung passende Tiere gibt es nicht überall. Aber es kommen Arten genügend vor, die grundsätzlich dafür in Frage kämen. Besonders günstig sollten solche (gewesen) sein, die gleich mehrere Junge pro Wurf gebären und nicht nur eines. Werden die Jungen bis auf eines weggenommen, bleibt noch Milch übrig. Die Menschen können diese nutzen. Das Grundproblem bleibt jedoch in jedem Fall die Ernährung. Nur solche Tiere kommen als Haustiere in Frage, die von den Menschen auch versorgt werden können. Am leichtesten geht dies mit Tieren, die von dem leben, was die Menschen selbst nicht nutzen können oder von ihrer Nahrung übrig lassen. Ganz von selbst kommen wir auf diesem Weg der Betrachtung zu den Ergebnissen, die wir kennen. Ganz bestimmte Arten von Säugetieren, wie Ziegen und Schafe, kleine Rinder und Schweine sowie einige wenige Vögel erfüllen diese Anforderungen und sind Haustiere geworden. Auch wenn man sich scheinbar von einer anderen Seite dem Problem der Domestikation nähert und wie Jared Diamond (1998) die Frage stellt, welche Arten von Säugetieren passender Größe denn in den verschiedenen Regionen der Erde von Natur aus vorhanden waren, die sich für die Haustierwerdung geeignet hätten, kommt dasselbe Ergebnis zustande. Es muss auch zustande kommen, weil wir diese und nicht anders geartete Haustiere vorfinden. Das vorhandene Ergebnis diktiert die Begründung. Wirkliche Alternativen scheint es nicht gegeben zu haben. Vielleicht gab es sie, aber sie bewährten sich nicht. Diese Möglichkeit werde ich in anderem Zusammenhang erneut aufgreifen.
Zurück zu den Gräsern, die wir, weil sie die Vorfahren unserer Getreidesorten sind, Wildgetreide nennen. Allzu schnell gerät man bei ihrer Betrachtung zu den Haustieren, denn diese sind uns vertrauter als Pflanzen, wenn es um ihre Lebensbedürfnisse geht. Was aber braucht das Wildgetreide? Welche natürlichen Bedingungen müssen an ihren Wuchsorten erfüllt sein, damit sie gedeihen können? Meist bedenken wir gar nicht, wie kurzlebig die Getreidepflanzen sind. Der botanischen Bezeichnung nach gehören sie zu den »Einjährigen« (Annuelle). Doch sie leben keineswegs ein Jahr, sondern höchstens ein gutes halbes, meistens nur ein paar Monate. Die Wildformen gedeihen dort am besten, wo der Boden karg ist, Niederschläge unregelmäßig, meist im Winterhalbjahr, fallen und sommerliche Dürre die Reife ihrer Samen (Körner) begünstigt. Für die große Mehrzahl der anderen Pflanzen, die eine geschlossene Vegetationsdecke ausbilden können, sind das keine guten Bedingungen. Solche Verhältnisse eignen sich auch nicht sonderlich für Haustiere, die von Pflanzen leben. Diese ziehen ihrer Natur nach dauerhafte Steppengräser den nur kurze Zeit auftretenden Wildgetreidearten klar vor. Von Anfang an sollte sich daher ein Konflikt aufgetan haben zwischen der einen Notwendigkeit, am Ort zu bleiben, die Äcker zu versorgen und die Ernte abzuwarten, also Bauer zu sein, und der anderen, mit dem Vieh herumzuschweifen, um die jeweils günstigsten Weidegründe aufsuchen zu können. Den Grundkonflikt zwischen der sesshaften Lebensweise der Ackerbauer und der nomadischen der Viehzüchter schildert die Bibel: Der Ackerbauer Kain erschlägt den Hirten Abel, seinen »Bruder«. Das Opfer Abels, Fleisch, war dem gemeinsamen Gott gefälliger gewesen als die Feldfrüchte Kains. Sehr frühzeitig müssten sich also, trotz gleicher Wurzeln, der beginnende Ackerbau, der zur Sesshaftigkeit zwang, und die nomadische Viehzucht auseinanderentwickelt haben. Ackerland kann nicht gleichzeitig Weideland sein. Es blieb unserer Zeit vorbehalten, das Vieh in Ställe zu sperren, in denen es das ganze Jahr über mit Nahrung versorgt wird. Am Anfang einer dauerhaften Viehhaltung stand ohne Zweifel der Nomadismus. Ackerbauern hingegen mussten von Anfang an sesshaft werden. Wie passen beide Lebensformen zusammen?
Das eben kurz zusammengefasste Szenario geht davon aus, dass Mangel an Wild, der sich zunehmend verschärfte, zum Wechsel in der Ernährung geführt hatte. Die mit eigener Hände Arbeit gezogenen Feldfrüchte mussten den Niedergang der Jagd- und Sammelerträge ausgleichen. Der Ackerbau wurde so erfolgreich, dass seine Erträge nicht nur die Bauern selbst ernähren konnten, sondern zunehmend mehr Menschen, die andere Leistungen in die Gemeinschaft einbrachten. Aus den Überschüssen entwickelten sich größere Gemeinwesen. Die anfänglich verstreuten Häuser der Ackerbauern wurden zum Dorf zusammengefasst. Aus zentralen, günstig gelegenen Dörfern entwickelten sich Städte. Das geschah an Orten, die gegen die Begehrlichkeiten anderer, weniger erfolgreicher Menschengruppen gut zu verteidigen waren. Die gespeicherten Erträge des Ackerbaus bedurften befestigter Anlagen; Burgen, die »bergen« und damit nicht nur die Menschen schützen, sondern vor allem auch die Vorräte.
Die Dörfer und Städte wuchsen. Es mag nicht lange gedauert haben, bis konkurrierende Gruppierungen entstanden, die anfingen, sich zu bekriegen. Zunächst dürfte es nur um gespeicherte Vorräte gegangen sein, dann um das Land selbst, das produktiv geworden war, und schließlich um Menschen, die von den Siegern versklavt wurden. Wanderhirten hätten gar kein vergleichbares Sozialsystem entwickeln können, um attraktiv für die Versklavung als Hirten unter fremder Herrschaft zu werden. Das freie Umherziehen hätte sich damit nicht verbinden und vor allem nicht ausreichend kontrollieren lassen. Das Wanderhirtentum hielt die eigene Bevölkerungsentwicklung in vergleichsweise engen Grenzen, weil das Wohl und Wehe der Herden und damit ihre Nutzbarkeit für die Menschen von den äußeren Unwägbarkeiten der Witterung und nicht von eigener Hände Arbeit abhängen. Die Natur setzte der Steigerung der Produktivität enge Grenzen. Die Ackerbauern hingegen veränderten die Natur und machten diese immer produktiver. Erst damit konnte die Bevölkerung wachsen. Auf die Entwicklung des Ackerbaus folgte ein markanter demographischer Wandel. Aus ihm ging nicht nur eine vielfältig strukturierte Gesellschaft hervor, die anfing, zunehmend arbeitsteiliger zu wirtschaften, sondern auch ein starkes Wachstum der Bevölkerung. Auf die Entwicklung des Ackerbaus folgte eine Bevölkerungsexplosion. Wo in früheren Zeiten im Durchschnitt nur einige wenige Menschen pro Quadratkilometer leben konnten, ernährte der Ackerbau nun das Zehnfache und mehr. Die Entwicklung wurde zum Selbstläufer. Mehr Nahrung bedeutete mehr Kinder, größere Bevölkerung mehr Arbeitskräfte und diese eine weitere Steigerung der Produktivität. Eine Zunahme von individueller Sicherheit in größeren Gemeinschaften ergab sich von selbst. Der Ackerbau hatte die Tür zu einem ganz neuen Raum für die kulturelle Entwicklung der Menschen geöffnet. Die Natur wurde fortan Gegensatz zur Kultur. Es gab kein Zurück mehr. Aus dem »colere« der Lateiner stammt unser Wort für Kultur. Darin steckt noch die Ahnung davon, welch grundlegende Bedeutung das Pflegen und Bebauen des Landes am Anfang der Geschichte hatte. Der Mensch wurde damit zum Kulturwesen. Als Wanderhirte hätte er noch weitestgehend »Natur« bleiben können. Naturverbunden zumindest, wie wir diese Lebensweise verstehen wollen, oder »im Einklang mit der Natur«, so die gegenwärtig bevorzugte Phrase.