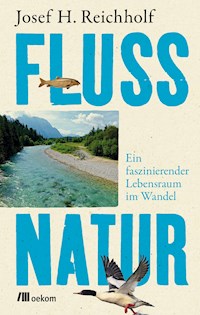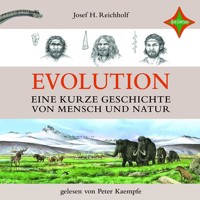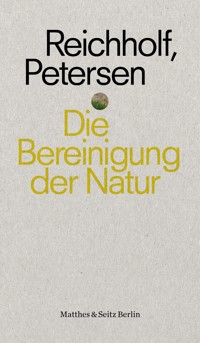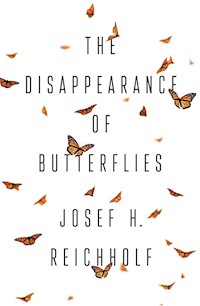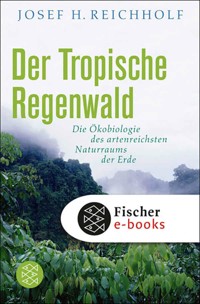8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wie aus Jägern Sportler wurden Bei aller Ähnlichkeit zu den uns nahestehenden Tierarten ist der Mensch doch das einzige Lebewesen, das gewinnen will nur um des Gewinnens willen. Sind Spiel und Sport die natürliche Fortsetzung der Entwicklung zum Homo sapiens? Der international renommierte Evolutionsbiologe Josef H. Reichholf stellt verständlich und spannend dar, wie sich dieses Phänomen entwickelt hat und unseren Alltag nach wie vor prägt. Und er liefert eine verblüffende Erklärung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 385
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Josef H. Reichholf
Warum wir siegen wollen
Der sportliche Ehrgeiz als Triebkraft in der Evolution des Menschen
Sachbuch
Fischer e-books
1. Kapitel:Verrückte Renner
Es herrscht ziel- und zweckloses Durcheinander, zumindest vermittelt diesen Eindruck der erste Blick auf das Treiben an einem Ameisenhaufen. Emsig seien sie, die Ameisen, sagen wir und benutzen dazu die alte, kaum mehr gebräuchliche Bezeichnung »Emse« für Ameise. Neugierige Forscher haben viele der Geheimnisse gelüftet, die sich um das Leben der Ameisen rankten. Manches haben diese mit uns Menschen gemeinsam: Sie bilden volkreiche Staaten, regiert von einer Königin, haben Arbeitsteilung, man könnte fast sagen »Berufe«, und besitzen ein phantastisches Kommunikationssystem. Manche Ameisen führen sogar Kriege gegen andere Ameisenstaaten oder halten Sklaven. Trotz aller körperlicher Unterschiedlichkeit sind uns Menschen daher Ameisen mitunter ähnlicher als unsere tatsächlich nächsten Verwandten, die Menschenaffen. Die haben es nie zur Bildung von Staaten gebracht, und keine Königin regiert sie. Sie scheinen auch keinerlei Gruppennormen zu unterliegen, die für sie festlegen, was »man« tut, es sei denn, es handelt sich um überlebenswichtige Verhaltensweisen. Und sie pflegen, wo immer ihnen das möglich ist, die Ruhe.
Ameisen, Menschen, Schimpansen – was für eine Reihung? Der Verwandtschaft nach gehören die Menschen und die Schimpansen ganz nahe zusammen. Dem Verhalten nach scheinen sich Menschen und Ameisen in mancher Hinsicht viel mehr zu gleichen, auch wenn sie sonst nichts verbindet außer der Tatsache, dass sie beide zum Tierreich gehören. Was aber würde jemand, der nach Art neugieriger Naturforscher uns Menschen beobachtet, für Feststellungen zu unserem typischen Verhalten treffen? Was würde so einem »objektiven Beobachter« besonders auffallen?
Sicher zunächst eine ganze Reihe von Äußerlichkeiten. Der Mensch, zoologisch ein Angehöriger der Primaten mit der allgemein anerkannten wissenschaftlichen Bezeichnung Homo sapiens, ist praktisch weltweit verbreitet. Er lebt zwar in allen Klimazonen, aber mit recht unterschiedlicher Häufigkeit. Seine Gesamtzahl, stark im Steigen begriffen, kann auf einiges über sechs Milliarden geschätzt werden, wovon eineinhalb Milliarden im Südosten der größten Landmasse der Erde angesammelt sind, eine weitere Milliarde in einem großen, grob dreieckigen Fortsatz dieser Landmasse, die äquatorwärts in den kleinsten der drei Ozeane ragt, und eine weitere halbe Milliarde im stark zerklüfteten Westteil dieser größten Landmasse. Zusammen mit den im zentralen und nördlichen Teil vorkommenden Menschen trägt somit diese Landmasse, Asien, mehr als die Hälfte der gesamten Menschheit. Die übrigen Kontinente sind weit dünner besiedelt, weisen aber regional ebenfalls große Ansammlungen von Menschen auf.
Entsprechend dieser globalen Verbreitung gibt es offenbar auch äußerlich erkennbare Unterschiede in Hautfarbe und Wuchsform, aber diese sind wohl nicht von sonderlich großer Bedeutung, weil es große Ansammlungen von Menschen gibt, die aus Mischungen unterschiedlich aussehender Individuen hervorgegangen sind.
Die große Mehrheit dieses Lebewesens Mensch bewohnt künstlich hergestellte Gebilde mit wenigen bis vielen Innenkammern (Räumen), die stark geballt auftreten und Millionen von Menschen auf engstem Raum beherbergen können. Diese Gebilde, Städte genannt, ähneln in frappierender Weise den Bauten der Ameisen. Auch dahingehend, dass von ihnen extrem stark frequentierte Strukturen ausgehen, auf denen sich die Menschen mit zum Teil abenteuerlich hoher Geschwindigkeit hin und her bewegen. Mit entsprechendem Abstand betrachtet sehen diese Gebilde wirklich wie Ameisenstraßen aus. Allerdings kommt es auf diesen Straßen, genauer hingesehen, nur außerordentlich selten zu freundlichen Kontakten untereinander, oft hingegen zu Staus, aus denen sich die Menschen anscheinend nur schwer befreien können, weil sie ihre Straßen gerade so angelegt haben, dass bei der kleinsten Störung des Verkehrs kein Ausweichen mehr möglich ist. In dieser Hinsicht zeigen die Ameisen ein viel vernünftigeres Verhalten. Auch pflegen sie, wenn sie auf ihren Straßen unterwegs sind, häufig Kontakte zu ihresgleichen, die ihnen offenbar nicht unangenehm sind.
In den Menschenansammlungen, wo die Menschen wie die Ameisen zu Millionen zusammengeballt leben, verändert sich das Klima. Meistens jedoch, wiederum anders als im Ameisenbau, nicht so sehr zugunsten der Bewohner. Aber die Menschen scheinen in den meisten Fällen ganz gut damit zurechtzukommen, weil sie im Abstand von fünf Tagen jeweils für zwei Tage, manchmal auch gleich für mehrere Wochen, ihre Städte in gewaltigen Massen verlassen, als ob sie alle aus- und umziehen wollten. Das machen Ameisen nicht. Ihre Tendenz ist eher heimwärts gerichtet. Auswärts bewegen sie sich vornehmlich, um von dort etwas zu holen oder etwas wegzutransportieren.
Natürlich gibt es bei den Ameisen Zeiten, in denen sie offenbar irgendwie übereinkommen, sich fortzupflanzen, und nicht nur weitere Nachkommen der einen eigenen Königin in ihren Staat aufnehmen wollen. Dann finden gewaltige Massenverpaarungen statt, bei denen sie hoch über ihre Baue hinausfliegen. Die Menschen fliegen zwar auch, noch höher hinauf sogar als die Ameisen. Aber mit Verpaarung und Fortpflanzung hat das meistens nichts zu tun, auch wenn das Fliegen so viel Energie kostet.
Die Ameisen leisten sich diesen Luxus des Fliegens tatsächlich nur zu dem einen Zweck der Paarung und Fortpflanzung, was sie für den unbefangenen, neugierigen Forscher wiederum irgendwie vernünftiger erscheinen lässt als die so unablässig hektischen und betriebsamen Menschen, die sich zwar auch vermehren, aber eher nur nebenbei zu ihrer überhöhten Aktivität. Bei den ganz anders gearteten, doch den Menschen so nahe verwandten Schimpansen, insbesondere bei der einen der beiden Schimpansenarten, den Bonobos, rankt sich dagegen der größte Teil ihres täglichen und jährlichen Lebensablaufes um etwas, was mancherorts bei den Menschen als »schönste Nebensächlichkeit« bezeichnet wird. Das gerade empfinden sie als Hauptsache und widmen sich bei jeder Gelegenheit den Freuden der körperlichen Liebe – sogar um Differenzen oder Streit zu schlichten. Sie nutzen diese buchstäblich zur Befriedigung, also, um Frieden zu stiften.
Auch das macht sie für den unbefangenen Beobachter auf ihre Weise recht sympathisch – ganz im Gegensatz zum Homo sapiens, der entgegen seiner Bezeichnung »weiser Mensch« (die er sich allerdings selbst in einer Phase totaler Überheblichkeit oder Selbstverkennung verliehen hat) gerade in dieser Hinsicht überhaupt keine Weisheit zeigt, die gemäß den Leistungen seiner nächsten Verwandten Frieden erhalten oder rasch wiederherstellen würde. Im Gegenteil: Wieder wie manche Ameisen, jedoch weitaus häufiger und mit unvergleichlich schlimmeren Ergebnissen, widmet er einen wesentlichen Teil dessen, oft sogar den größten Teil davon, was er mit seiner Emsigkeit angesammelt und erwirtschaftet hat, der kriegerischen Auseinandersetzung mit seinesgleichen. Bis zum bittersten Ende – die Zerstörung seiner so aufwändig und kostenintensiv aufgebauten Städte oder Maschinen miteingeschlossen. Kein neugieriger Forscher hat bislang gesehen, dass in Ameisenkriegen die so mühevoll aufgebauten, höchst wundervollen Gebilde, die meist leichthin nur als »Haufen« bezeichnet werden, zerstört werden würden. So ein schwachsinniges Verhalten gibt es nicht einmal bei den fast gehirnlosen Ameisen, auch wenn diese sonst manche Merkwürdigkeiten in ihrem staatlich gelenkten Leben der genaueren Beobachtung preisgeben, die uns peinlich berühren.
Es gibt auch Übereinstimmungen, die wir eher belustigt zur Kenntnis nehmen, wie etwa, dass sich nicht wenige Ameisen »Melkkühe« in Form anderer Insekten halten, die begehrte zuckerhaltige Tröpfchen von sich geben, wenn sie von den Ameisen mit ihren Fühlern betrillert werden; oder dass besonders dicke, fast zu keiner eigenständigen Bewegung mehr fähige Ameisen in Vorratsräumen »gehalten« werden als lebendige Konserven von »Honig«. Ihr extrem angeschwollener Hinterleib gibt bei Bedarf seinen so vor dem Verderben geschützten Inhalt an die hungrigen Mitglieder des Volkes wieder ab. Die Unterschiede zum Menschen sind hier so offensichtlich, dass sie nicht besonders ausgebreitet werden müssen. Schimpansen und Bonobos lassen sich dagegen für die anderen Artgenossen nicht als lebendige Vorratsbehälter missbrauchen, sondern teilen ihre Nahrung lieber in – nach ihren Maßstäben – sinnvoller Weise. Wenn es sein muss. Wenn nicht, verstecken sie einen guten Fund, etwa süße Bananen, vor den Artgenossen, um selbst und allein in den Genuss zu kommen. Wie nicht selten auch die Menschen!
Der unbefangene, neugierige Beobachter könnte noch lange fortfahren mit seinen vergleichenden Betrachtungen zum Leben von Ameisen, Menschen und Schimpansen. Vieles Spannende und Interessante, vieles, was übereinstimmt oder unterschiedlich ausgebildet ist, könnte so ein Beobachter entdecken. Manches würde »typisch Ameise« oder »typisch Mensch« sein und so eingeordnet werden. Natürlich findet der neugierige Beobachter weder bei Ameisen noch bei Schimpansen oder anderen Tieren Autos, Flugzeuge, Eisenbahnen, Atomkraftwerke oder Panzer und Kanonen. Der ganze Bereich »Technik« würde logischerweise als »typisch Mensch« eingestuft.
Die Nutzung dieser technischen Produkte lässt sich in jeder Hinsicht auch vom unbefangenen Beobachter nachvollziehen. Sie sind offenbar Hilfsmittel, um etwas zu erreichen oder zu bewirken, was der Mensch selbst ohne diese Hilfsmittel nicht erreichen oder bewirken könnte. Und weil das, was der Mensch solcherart erreichen oder bewirken will, guten oder schlechten Absichten entspringen kann, sind seine technischen Produkte mitunter mal »gut und toll« oder »schlecht und verheerend«. Meistens aber liegt die Beurteilung auf der ganzen Palette der Möglichkeiten zwischen »völlig gut« und »absolut teuflisch«. Wie der Mensch selbst. Somit drücken die technischen Produkte nur eine Bandbreite aus, die schon im Menschen selbst steckt. Der unbefangene, neugierige Forscher erkennt dies, analysiert nach Art der modernen Verhaltensforschung die Motivation und überlässt es den Vertretern von Kultur und Moral, darüber zu urteilen. Um das »typisch Menschliche« in Erfahrung zu bringen, hat dieser neugierige Forscher eigentlich nur einen Umweg gemacht.
Auch tiefer gehende Forschungen an so merkwürdigen Verhaltensweisen wie dem Ausschwärmen großer Massen nach jeweils fünf Tagen aus den Städten heraus ins Umland und der Rückkehr spätestens am Abend des siebten Tages bringen dem neugierigen Betrachter keine allzu aufschlussreichen Erkenntnisse. Anscheinend haben besonders jene Menschen es nötig, sich so zu verhalten, die in sehr großer Siedlungsdichte in hochgradig komplexen Gebilden leben, die recht zutreffend als »Ballungsräume« zu kennzeichnen sind. An den Zielorten ihres Ausschwärmens angekommen, verhalten sie sich wieder weitgehend normal, geselligkeitsliebend (meistens) und mitunter sogar etwas weniger hektisch und angespannt als sonst. Doch das, stellt der Beobachter fest, muss nicht sein. Häufig kommt es lediglich zu einer Verlagerung der übersteigerten Aktivität, die die Menschen so ameisenähnlich macht. Essen und trinken, Letzteres besonders an diesen zwei Tagen zwischen den jeweils fünf »normalen«, lassen sich reichlich beobachten, was aber wiederum, von Feinheiten der Ausführung abgesehen, ziemlich normal wirkt. Auch manche Affen trinken gern gärende Säfte von süßen Früchten und drücken die Folgen in ihren Gesichtszügen aus.
So fahndet der neugierige Forscher in der so außerordentlich großen Vielfalt von Lebensäußerungen der Art Mensch, findet vieles, was ihm bekannt ist von anderen Arten, von nächstverwandten wie von fern stehenden, bemerkt unterschiedliche Stärken der Ausprägung, lernt vielleicht sogar alsbald die so verschiedenartigen Lautäußerungen zu verstehen, welche die Menschen fast unablässig von sich geben, meistens recht lautstark und emotionsbefrachtet. Vielleicht beobachtet der neugierige Forscher auch, dass, ganz ähnlich wie bei anderen, zur Erzeugung lauter Töne befähigten Affen, dem Geschrei einzelner Individuen keine besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird – außer es handelt sich um eine wirklich wichtige Situation, was aber selten der Fall ist.
Vieles, was da so den Tag über und bis in die Nacht hinein gesprochen wird, wiederholt sich erstaunlich häufig und muss demzufolge als überflüssig, weil redundant, eingestuft werden. Aber das macht anscheinend nichts und ist sogar gut, weil es den sozialen Zusammenhalt fördert. Es ist erst dann offenbar alles gesagt, wenn dies auch alle gesagt haben. Dann herrscht Übereinstimmung und die palavernden Menschen sind mit sich und ihrer Umgebung zufrieden. Sehr ähnlich geht es, weniger vielfältig in der Wortwahl, aber mit offensichtlich ganz ähnlichen Emotionen in anderen Primatengruppen zu. Also wieder kein ganz grundlegender, einzigartiger Unterschied. Der neugierige Beobachter wird in seiner Beurteilung bestärkt, dass der Homo sapiens, die Menschenaffen und andere Affen doch sehr eng zusammengehören, auch wenn sich der Homo sapiens so keck hochstreckt und auf zwei Beinen mit stolz erhobenem Haupte durchs Leben schreitet. Die Übereinstimmungen mit den Ameisen haben anscheinend doch mit ganz anderen Gegebenheiten zu tun, die für eine entscheidende Frage im Hintergrund nicht so bedeutsam sind: nämlich die Frage, woher dieser so ungewöhnliche und so außerordentlich erfolgreiche Primat Homo sapiens eigentlich kommt. Gehört er zu dieser Welt oder ist er von einer anderen auf die Erde gekommen? So, wie er sich verhält, wäre eine erdferne Herkunft nicht nur nicht abwegig, sondern vielleicht sogar eine ganz brauchbare Entschuldigung.
Doch mit diesem Problem kann sich der neugierige Beobachter jetzt nicht befassen, denn es ist ihm noch etwas aufgefallen, das ihm sehr zu denken gibt und das zu keinem anderen Vertreter aus dem gesamten Tierreich passen will – ein Verhalten, das aber offensichtlich so außerordentlich bedeutsam ist, dass es praktisch nur auftritt, wenn Zuschauer da sind. Mit einer in höchstem Maße ausgeklügelten Technik, wozu sogar im Weltraum »stationierte« künstliche Monde (Satelliten) eingesetzt werden, die sonst eher kriegerischen Zwecken dienen, wird dieses Verhalten mitunter sogar weltweit elektromagnetisch übertragen. Und mehr als die allermeisten anderen Ereignisse – Katastrophen eingeschlossen, für die zu betrachten der Mensch eine offenbar besondere Vorliebe hat – zieht dieses Verhalten die Aufmerksamkeit von Millionen und Milliarden Artgenossen auf sich und bindet damit große Teile der gesamten Menschheit an die Übermittlungsstellen der bewegten Bilder hierzu: an die Fernsehapparate. (Der neugierige Beobachter kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass, wenn das bei den technischen und sozialen Gegebenheiten möglich wäre, die gesamte Menschheit von Kleinkindern bis zu fast erblindeten Greisen zuschauen würde!)
Wer privilegiert genug ist, es sich leisten zu können, geht, eilt, fährt oder fliegt sogar unmittelbar an die Orte des Geschehens, um selbst mit dabeizusein. Dabei nehmen gerade diejenigen, die es sich dank ihrer Möglichkeiten leisten können, in Kauf, dass sie am Ort des Geschehens den Ereignissen weniger gut folgen können als vor den Fernsehschirmen. Höchst merkwürdig fürwahr und unerklärlich, denn nichts weist darauf hin, dass irgendein vernünftiger Zweck oder gar ein erstrebenswerter Gewinn mit diesem Verhalten verbunden sein könnte. Der Ablauf ist im Prinzip sogar immer der gleiche. Nur die eingesetzten Hilfsmittel oder die Bedingungen variieren, wie auch das Medium, in dem das Ereignis stattfindet: nämlich entweder der Boden, der dafür in aller Regel ganz besonders zurechtgemacht wird, das Wasser oder die Luft. Der neugierige Beobachter fasst ganz richtig zusammen, dass es dabei immer darum geht, gleich wo, wie und mit welchen Hilfsmitteln der Vorgang vollzogen wird, der Erste zu werden! Auch wenn die Betätigung als solche in den unterschiedlichen Sprachen der Völker der Menschheit unterschiedlich bezeichnet wird, sind Regeln und Ablauf gleich.
Es geht um den Sieg, und der Vorgang heißt, wie immer er in den einzelnen Sprachen auch heißen mag, Sport. Dabei geht es um die Ehre, die allerdings auch mit sehr viel Geld verbunden sein kann, Tendenz steigend, stellt der neugierige Beobachter in dieser Hinsicht fest. Aber da sich die Sportler ja auch unglaublich anstrengen um dieses Siegens willen, mag die Belohnung hierfür durchaus auch angebracht sein und weiter antreibend wirken. Um noch mehr siegen zu können. Um neue Rekorde aufstellen zu können. Um über sich selbst hinauszuwachsen als Individuum und als Mensch – um des Siegens willen!
Von allen Merkwürdigkeiten, die dem neugierigen Beobachter am Homo sapiens auffallen, dürfte diese Eigenheit des Menschen die absonderlichste sein. Denn es gibt anscheinend nichts Vergleichbares in der gesamten Natur. Kein anderes Lebewesen kommt auf die Idee (und ist jemals darauf gekommen, nach allem, was wir wissen), um nichts als um die Ehre, der Erste geworden zu sein, über mehr oder minder große Strecken um die Wette zu laufen. Um die »Wette«! Ja, »wetten, dass dieser oder jener gewinnt!« ist eine rein menschliche, in ihren Auswirkungen mitunter höchst unmenschliche Angelegenheit. Schlimmer noch: Um auch im Rennauto Erster zu sein, werden mit vollem Risiko Spitzengeschwindigkeiten aus Motoren und Fahrzeugen herausgeholt, wobei manche Fahrt zur Todesfahrt wird. Oder im Segelfliegen, beim Skifahren, Schlittschuhlaufen, Radfahren, Schwimmen.
Warum nur, fragt der neugierige Beobachter, hat der Mensch und nur der Mensch so ein Verhalten. Warum wollen sie alle, kaum dass sie auf zwei Beinen laufen können, Erste werden und Sieger? Was treibt den, wie er selbst meint, »weisen Menschen« zu so törichtem Verhalten? Es passt doch irgendwie gar nicht so recht in diese Welt!
Kann also dieses Unbedingt-siegen-Wollen natürlichen Ursprungs sein, oder müssen wir vielleicht doch ernsthaft die Möglichkeit in Betracht ziehen, die seit den Entdeckungen von Charles Darwin vor eineinhalb Jahrhunderten ein für alle Male aus der Welt geschafft zu sein schien, nämlich dass der Mensch doch nicht allein von dieser Welt sei? Ansonsten passt doch alles zu seinem natürlichen Ursprung, zu seiner Evolution aus der Stammeslinie der Primaten. Aber nicht einmal bei ihnen findet sich ein so verrücktes Rennen bar jeden Preises. Denn am Ziel steht weder die erstrebte Fortpflanzungspartnerin – auch sie rennt häufig ihrerseits mit anderen Frauen um die Wette – noch ein großer Preis in Form eines Wildschweinbratens oder der Befähigung, eine politische Partei oder gar ein ganzes Land zu führen, das lässt das unablässige Training auch nicht zu. Es geht – in der reinsten Form des Wettlaufs zumindest – um nichts als Ehre, die bei der großen Masse der Sportler durch unnütze Siegesplaketten, Pokale oder Urkunden bestätigt wird.
Es rankt sich also etwas Geheimnisvolles, Rätselhaftes um das Siegenwollen, das wie eine zwanghafte Vorstellung aus dem Inneren zu kommen scheint und eigentlich von äußeren Dingen gar nicht wesentlich beeinflusst wird. Das »Ziel« wird nahezu beliebig festgelegt. Ob es nach fünfzig, hundert oder tausend Metern erreicht wird oder nach 73 oder 166, erscheint reichlich gleichgültig. Gänzlich belanglos, außer wenn es um »den Sieg« geht, sind schließlich die Unterschiede in Bruchteilen von Sekunden, Zehntelsekunden oder Hundertstelsekunden. Sie spiegeln einfach die technischen Möglichkeiten der Messgenauigkeit, sind aber keine sinnvollen Befunde. Doch sie entscheiden!
Wie kommt der Mensch zu dieser schier verrückten Eigenschaft? Wozu sie gut ist, ergibt sich aus den Bilanzen der Sportveranstalter und Fernsehgesellschaften, der Wettbüros und der Hersteller von Sportartikeln. Das liegt auf der Hand, auch wenn es mitunter kaum nachvollziehbar erscheint, dass tatsächlich so viel Geld für »den Sport« ausgegeben wird.
Wozu aber war es einmal gut? Wozu diente dieses Verhalten? Denn irgendeinen Sinn muss es einmal gehabt haben, sonst wäre es nicht entstanden. Und es ist – wie schon gezeigt – nur beim Menschen vorhanden. Oder sollen wir annehmen, der Sport stammt nicht von dieser Welt? Dann hätte uns allerdings eine »andere Welt« etwas in der Tat höchst Merkwürdiges und reichlich Unverständliches mitgegeben. Genau genommen würde dies das Rätsel des Ursprungs nur verlagern, aber nicht lösen. Versuchen wir daher, in »dieser Welt« und ihren Gesetzlichkeiten eine Lösung zu finden – vielleicht angetrieben von derselben Grundmotivation? Wer weiß? Und warum nicht?
2. Kapitel:Mängelwesen …
Was ist der Mensch? Antworten auf solche Fragen sollte man tunlichst vermeiden. Denn erstens besteht der Mensch gegenwärtig aus mehr als sechs Milliarden Angehörigen seiner Art. Und zweitens hat er auch Vorfahren, die ihm sehr nahe gekommen sind. Bei manchen von ihnen würde es uns heute recht schwer fallen, sie nicht als Mensch einzustufen. Zum Beispiel die Neandertaler Homo neanderthalensis. Sie existierten in einem längeren Zeitraum als der bisher jüngste Spross, der Stammeslinie der Menschen (Gattung Homo) und sie dürften den heutigen Menschen hinsichtlich ihrer Körperkräfte ziemlich überlegen gewesen sein. Womit wir eigentlich schon wieder beim Kernthema wären.
Aber zurück zur Ausgangsfrage. Niemand kann alle Menschen, die es gibt und jemals gegeben hat, vollständig überblicken, um aus dieser Kenntnis heraus sagen zu können, was »der Mensch« wohl sei – nicht einmal nur rein biologisch. Ihn als ein »Mängelwesen« zu bezeichnen, wie der Kinderpsychologe Arnold Gehlen das getan hat, mag einen persönlichen Eindruck ganz treffend wiedergeben, aber viel besagt es nicht. Auch nicht die Definition »Spezialisiertsein auf Nichtspezialisiertsein«, wie Konrad Lorenz meinte, den Menschen als Art und im Vergleich zu seiner Primatenverwandtschaft charakterisieren zu können. Der berühmte Verhaltensforscher und Nobelpreisträger hat mit diesem Bonmot genauso wenig ausgesagt wie Arnold Gehlen oder wie viele Philosophen, die nach dem Wesen des Menschen suchten, auch wenn ihre Aussagen auf bestimmte Seiten des Menschseins zutreffen mögen.
So wird niemand bestreiten, dass es dem Menschen als Art offenbar an der Einsicht mangelt zu erkennen, dass es nicht und niemals gut ist, gegen andere Menschen oder – ohne Rücksichtnahme auf die einzelnen Individuen – gar gegen andere Völker, Staaten oder Andersdenkende Krieg zu führen. In dieser Hinsicht ist der Homo sapiens ein echtes Mängelwesen – ein richtiger Versager, wie die Fortdauer von Kriegen und kriegerischen Auseinandersetzungen in unserer »modernen Zeit« hinlänglich beweist.
Der Mensch ist auch nicht von Natur aus darauf spezialisiert, Schuhputzer, Autofahrer oder Welten lenkender Politiker zu sein oder zu werden. Glücklicherweise, denn sonst gäbe es für alle unehrenwerten Tätigkeiten von Menschen von vornherein umfassende Entschuldigungen, und es bestünden keine Aussichten, aus individuellen Fehlern zu lernen. Auch könnten nicht völlig neuartige Gebiete erschlossen werden, wie etwa in den letzten Jahren der Bereich des Computers und des Internets.
Es ist aber sicher eine großartige Idee, im Menschen das Ebenbild Gottes zu sehen. Das drückt den tiefen Glauben an das Gute im Menschen und an das höchst löbliche Streben aus, sich diesem Ebenbild auch als würdig zu erweisen. Dass dies in der Lebenswirklichkeit zumeist kläglich misslingt, liegt sicherlich nicht nur daran, dass der direkte Vergleich von Ebenbild und Gott offensichtlich unmöglich ist, sondern eben ganz wesentlich auch daran, dass der Mensch nicht so »ist«, wie er aus dieser Sicht sein sollte.
Unser neugieriger Beobachter von außerhalb, der feststellen möchte, was der Mensch »ist«, würde genau bei solchen Fragestellungen scheitern oder in der Philosophie landen. In einer »Philosophie« nämlich, die niemand widerlegen könnte, aber der beliebig viele andere Sichtweisen über das eigentliche Wesen des Menschen hinzugefügt werden könnten. Deshalb benutzte der neugierige Beobachter auch die Vergleiche mit Ameisen und Schimpansen oder anderen Lebewesen. Ob passend, wie wohl bei den Schimpansen als unseren nächsten Verwandten, oder eher unpassend, wie bei den Ameisen, mag zunächst zurückgestellt werden. Es geht in unserer zentralen Fragestellung ja darum herauszubekommen, warum wir »siegen« wollen. Und dazu brauchen wir keine grundsätzlichen Überlegungen, was der Mensch ist oder nicht ist oder sein sollte, sondern wir benötigen vernünftige Vergleiche und gute, nachvollziehbare Befunde. Letztere liefern die Messungen bei Sportveranstaltungen und dergleichen in Hülle und Fülle.
Wir haben dazu sogar mehr Fakten als uns lieb sein kann, weil dauernd irgendwo auf der Erde irgendwelche Wettkämpfe abgehalten werden und »Sieger« zu ermitteln sind. Für die Wettkämpfe sind die Bedingungen stark standardisiert – manchmal bis zur Einbeziehung von Rücken- oder Gegenwind oder witterungsbedingter Absagen der Wettkämpfe. Vernünftige Vergleiche mit anderen Arten im Hinblick auf einzelne körperliche Leistungen brauchen wir eigentlich gar nicht, weil ja bei den Wettkämpfen genauestens gemessen wird.
Natürlich meinten auch weder Gehlen noch Lorenz das, sofern sie bei ihren grundsätzlichen Äußerungen über den Menschen überhaupt an Wettkämpfe und Rekorde gedacht haben sollten, was eher unwahrscheinlich ist. Sie stellten ihre Vergleiche selbstverständlich in Beziehung zu anderen, eben vergleichbaren Lebewesen. Das sind unter den biologischen Bedingungen die nächsten Verwandten, die Menschenaffen, und die anderen Primaten; oder andere Säugetiere; oder solche Tiere, die etwas leisten, was der Mensch auch gerne leisten möchte, aber nicht (so gut) kann. Was könnte der neugierige Beobachter herausgebracht haben beim gründlichen Studium der Leistungen von Menschen, die sich direkt mit Leistungen von Tieren vergleichen lassen?
Erstaunlicherweise etwas ganz Anderes, als man bei einem Mängelwesen vermuten würde: nämlich eine hervorragende Kombination von Leistungen und (körperlichen) Fähigkeiten, wie sie kein anderes Tier aus den beiden leistungsfähigsten Tiergruppen überhaupt, den Säugetieren und den Vögeln, in auch nur annähernd vergleichbarer Weise aufweisen kann. Der Mensch ist, einigermaßen gut trainiert und köperlich fit, ein einzigartiger Dauerläufer, ein sehr guter Sprinter, ein im Hinblick auf sein zweibeiniges Springen auch recht gut Platzierter, ein phantastischer Werfer, der die gesamte mögliche Konkurrenz im Tierreich glatt und weit abschlägt, ein guter Kletterer, bezogen auf ein Körpergewicht von fünfzig Kilogramm und mehr, der auf die höchsten Bäume und Berggipfel kommt, ein schlagkräftiger Boxer fast ohne Konkurrenz, ein geschickter Ringer, ein guter Schwimmer, nicht übel im Tauchen, wiederum ein ganz außergewöhnlicher Reiter (demgegenüber sich die wenigen erfolgreichen Versuche anderer Primaten, auf Reittieren voranzukommen, kläglich stümperhaft ausnehmen) und noch einiges andere mehr, wozu Geräte und technische Hilfsmittel gehören, die in einem gewissen, gleichwohl geringen Umfang auch Menschenaffen beherrschen. Solche können zum Beispiel recht gut radfahren, aber alles weist darauf hin, dass den Radprofis bei Sechstagerennen oder der Tour de France niemals in einem von Körperkräften gesegneten Schimpansen eine beschämende Schlappe beigebracht werden könnte.
Sogar beim Freistilringen, oder griechisch-römisch, wären auf gleiche Gewichtsklassen bezogene Siege von Menschen nicht ausgeschlossen, könnte man den Menschenaffen hinreichend verlässlich Fairness beibringen.
Nur beim Fliegen hapert es grundsätzlich. Da geht überhaupt nichts ohne Technik. Aber bei den Vögeln unserer menschlichen Gewichtsklassen ist das nicht anders. Wer immer in der Vogelwelt über fünfzehn bis zwanzig Kilogramm Körpergewicht hinausgewachsen ist, stellt das Fliegen ein und bleibt auf dem Boden. Oder müht sich, wie ein 25 Kilogramm schwerer Schwan in fast bedauernswerter Weise damit ab, das Wasser mit Flügeln und Schwimmhäuten der Füße peitschend, doch noch mit letzter Kraft hochzukommen für einen kurzen, sehr anstrengenden Rundflug, der wieder im Wasser landen muss.
Schon mit dem Kindesalter entwachsen wir der Möglichkeit, mit eigener Muskelkraft und ohne Hilfsmittel zu fliegen. Dafür haben wir inzwischen, als eine der jüngsten Errungenschaften in unserer Fortbewegung, das Gleitfliegen mit Drachen oder Gleitschirmen zu faszinierender Perfektion in technischer Hinsicht gebracht und vieltausendfach erprobt. Die richtigen Fluggeräte mit Motorantrieb lassen wir hier unberücksichtigt, weil sie Instrumente als Hilfsmittel einsetzen und nicht bloße Gewichts- und Positionsveränderungen des von Drachen oder Gleitschirm getragenen Körpers. Wer so gleitend »fliegt«, muss im Steuerzentrum seines Gehirns für etwas »fit« sein, was in seiner biologisch-natürlichen Ausstattung gar nicht vorgesehen war. Wohin das führen kann, zeigt nicht allein die Gefahr von Fehleinschätzungen und Abstürzen, sondern insbesondere der Straßenverkehr, wo das »Wunderding Auto«, das eigentlich genau all das macht, was es soll, dennoch Jahr für Jahr für Zehntausende zur Todesursache wird. Doch von den Siegen mit Hilfe der Technik später mehr. Hier geht es zunächst um eine sachliche Bilanz unserer Leistungen im Vergleich zu denen anderer Lebewesen und um die Bewertung dieser Leistungen.
Das Ergebnis fällt eindeutig aus: Der Mensch nimmt in einer ganzen Anzahl von Leistungsbereichen Spitzenplätze ein und hat auf so gut wie allen anderen, das aktive Fliegen ausgenommen, ebenfalls nicht verdient, ein Mängelwesen genannt zu werden. Ganz im Gegenteil. Der Mensch ist sogar mit Hilfe technischer Erfindungen und Entwicklungen weit über das Leistungsspektrum hinausgegangen, innerhalb dessen er sich von Natur aus betätigen könnte.
Er schießt (mit Gewehren) äußerst präzise auf entfernte Ziele, weit besser und unvergleichlich weiter als die Schützenfische, jagt auf schnellen Segelschiffen, als Einhandsegler oder Surfer übers Meer, veranstaltet in halsbrecherischem Tempo Pferderennen (wobei es schier ein Wunder ist, dass sich Pferde dazu haben bringen lassen, so wahnsinnig zu rennen) oder rast auf Skiern über verschneite oder vereiste Gebirgshänge zu Tal. Über hundert Meter weite Sprünge von Skisprungschanzen, Schlittschuhlaufen auf Eis, Rodeln und Bobfahren empfinden wir mittlerweile als selbstverständlich in den Wintersportwettbewerben. Dazu kommen Kajakfahrten in den wildesten Gewässern oder die ganz und gar unpassende Zusammenstellung von anstrengendem Skilauf mit Zielschießen im Biathlon und ähnliche Kombinationswettbewerbe. Und es werden immer mehr solcher Wettbewerbe erfunden.
Das weist darauf hin, dass wir Menschen offenbar »Bedarf« danach haben, auch wenn wir selbst gar nicht unmittelbar daran teilnehmen. Ganz besonders ausgeprägt drückt sich dieser »Bedarf« bei den alle vier Jahre veranstalteten Olympischen Spielen aus, bei denen, gesondert nach »Sommersportarten« und »Wintersportarten« der Welt eine gigantische Show geboten wird. Die Spiele gelangten nach einer Ruhe von rund zwei Jahrtausenden dank der neuen Medien Rundfunk und Fernsehen innerhalb von nur einem Jahrhundert an die »Spitze« aller Veranstaltungen. Sie finden weit mehr Interesse als alle »Weltgipfel«-Inszinierungen von UNO und anderen weltweiten Organisationen. Zeigt das nicht hinlänglich, dass auch wir Menschen selbst zutiefst von unserer herausragenden Leistungsfähigkeit überzeugt sind? Wir brauchen den Vergleich mit Tieren nicht zu scheuen. Jedes haben wir »überholt« (schon wieder so ein leistungs- und siegbezogener Ausdruck; unsere Sprache ist voll davon). Menschen tauchen in größere Meerestiefen als die größten Wale, fliegen höher und schneller als die besten Flieger unter den Vögeln, fahren weit schneller, als die schnellsten Säugetiere laufen können, reißen mit Maschinen Bäume aus und heben Felsen, an denen die stärksten Elefanten kläglich scheitern würden. Und so fort!
Sogar beim Wühlen in der Erde, durch Fels und Gebirge oder beim Bau von Tunnels unter Flüssen oder durchs Meer haben wir die tierische Konkurrenz so weit zurückgelassen, dass Vergleiche völlig unangebracht erscheinen. Längst sind uns die normalen, sinnvollen Betätigungsfelder ausgegangen. Sie sind alle bereits seit geraumer Zeit besetzt und mit Rekorden und Rekordhaltern belegt. Doch damit gibt sich der Mensch nicht zufrieden. Unablässig sucht er nach neuen Möglichkeiten, Rekorde aufzustellen und den Sieg davonzutragen – wohin eigentlich? Nur nach Hause? Was ist ein Sieg im Weißwurstessen eigentlich wert? Oder im Dauerstehen auf einem Bein? – Das erweckt den Eindruck einer Sucht. Sind wir Menschen unserer Natur nach süchtig nach Siegen?
Warum können wir uns nicht mit einem Sieg zufrieden geben? Warum reicht es uns nicht, zu wissen und dieses Wissen ab und zu nachbestätigt zu bekommen, dass wir als biologische Art sehr dauerhaft mehr als 42 Kilometer weit am Stück und ohne Rast laufen, fast vierzig Kilometer pro Stunde schnell sprinten oder eine mehr als zwei Meter hohe Barriere überspringen können? Warum wollen wir die Rekorde in lächerlicher und völlig übertrieben wirkender Genauigkeit immer weiter hinausschieben, wo wir uns doch, vernünftig betrachtet, lediglich an Leistungsgrenzen annähern?
Dafür riskieren Frauen sogar Hormonbehandlungen zugunsten einer männlicheren, leistungsfähigeren Muskulatur und Männer Dopingmittel, die ihnen entweder sportmäßig zum Verhängnis werden können oder später unkalkulierbare Gesundheitsrisiken mit sich bringen. Nicht nur für den Tag, für einen einzigen Wettbewerb, sondern für das ganze Jahr, das Jahrzehnt oder – am erstrebenswertesten überhaupt – für alle Zeiten wollen sie die Besten sein! Was für ein Zwang! Was für ein Phänomen! Längst weiß doch so gut wie die gesamte Menschheit, dass die in unserer Art steckende Leistungsfähigkeit enorm ist.
Wir brauchen keine immer auf dieselbe oder ganz ähnliche Weise wiederholte Beweisführung. Spitzensport und Spitzenleistungen haben herzlich wenig zu tun mit Überlebensfähigkeit im Alltag unter den so verschiedenartigen Bedingungen, unter denen weltweit Menschen leben. Nicht einmal der ganz jungen Gruppe der Astronauten nützt es etwas, ein guter Drachenflieger gewesen zu sein oder gar ein Sprinter. Ganz abgesehen von der immer dominierenderen Welt des Virtuellen. Wer im Internet surft, braucht kein wirkliches As auf dem Surfbrett zu sein. Dass Sport der Gesundheit dient und gerade für solche Menschen wichtig und gut ist, die zu wenig körperliche Betätigung haben, ist unbestritten, gleichwohl aber gänzlich ohne Belang für den Spitzenleistungssport und den Willen, die Sucht zu siegen! Eher ist das Gegenteil richtig: Wer mäßig und vernünftig, was heißen soll, seinen körperlichen Gegebenheiten und seinem Alter oder Gesundheitszustand angemessen, Sport betreibt, tut sich etwas Gutes. Nicht aber, wer be-treiben mit über-treiben verwechselt!
Sport als körperliche Ausgleichstätigkeit ist also etwas ganz Anderes als der sich selbst das letzte abverlangende Wille zum Sieg. Der neugierige Beobachter hätte im so betriebenen Sport nichts Absonderliches und im gesamten Tierreich Einzigartiges erblickt, sondern den Sport zum körperlichen Fitbleiben als vernünftige Fortsetzung des kindlich-jugendlichen Spiels gesehen. Darin gewinnen die jungen Säugetiere Sicherheit fürs spätere Leben durch die Beherrschung ihres noch wachsenden Körpers. Und dementsprechend hört dieses Spiel mit dem Erwachsenwerden weitestgehend oder ganz auf. Die aus dem langen Schlaf erwachende Katze, die als Kätzchen so wunderschön und unermüdlich gespielt hatte, gähnt und streckt sich. Ein Katzenbuckel, ein Durchstrecken der Vorderbeine, ein paar Schritte in geschmeidigem Gang, und sie ist wieder voll einsatzfähig für die nächtliche Jagd auf Mäuse oder zum Herumklettern im Geäst, für Sprünge auf Fensterbretter und über Zäune oder für das Balancieren auf einer dünnen Stange, ohne in Gefahr zu geraten herunterzufallen.
Ob Stubentiger oder pfeilschnell in der ostafrikanischen Steppe spurtender Gepard, ob schlankbeiniger Wolf in arktischer Kälte, in der die Muskeln steif sein könnten, oder dösender Vogel, den eine unerwartete Gefahr blitzartig zum Abflug zwingt, den er ohne Absturz meistert und nie üben musste – sie alle brauchen keinen Sport, um lebenstüchtig zu bleiben. Hund und Katze vielleicht, wenn sie, zu gut gefüttert und an einigermaßen natürlicher Bewegung gehindert, zu fett zu werden drohen. Sport als Gegenmittel gegen die Verhaustierlichung des Menschen?
Kein angenehmer Gedanke, in der Tat! Wahrscheinlich auch gar nicht so zutreffend – zum Glück! Aber davon später mehr. Hier geht es darum festzuhalten, dass es erhebliche Unterschiede zwischen einer sinnvollen, dem Körper und seiner Leistungsfähigkeit angemessenen und wohlbekömmlichen sportlichen Betätigung und dem Drang zum Sieg im Leistungssport gibt. Und dass wir Letzteren nicht einfach, weil für uns selbst unpassend, weithin ignorieren, sondern fasziniert daran »hängen«, wenn die Wettkämpfe über den Bildschirm flimmern, mitbangen, »Daumen drücken« und uns ärgern, weil »der/die andere« gesiegt hat und nicht unser/e Favorit/in. Eine riesige Zahl von Menschen nimmt die sportlichen Wettkampf-Großveranstaltungen wahr und beteiligt sich unbeteiligterweise daran. Diesen vielen Menschen bedeuten sportliche Wettkämpfe offenbar so viel, dass diese für wert befunden werden, in den Hauptnachrichten aller Fernsehsender regelmäßig und ausführlich präsentiert zu werden – als ob das Wohl und Wehe der Menschheit davon abhinge.
Was dabei dann wirklich zählt, sind die Siege, die zugehörigen Bilder vom »Finale«, die Gesichter, die Siegesposen. Die Athleten und Athletinnen müssen diese offenbar nicht erlernen, sondern bringen sie automatisch mit: hochgerissene Arme, mit denen sie sich selbst »überhöhen« und den bewundernden Blicken der Menge und Fernsehkameras zeigen. Wer sich selbst als Betrachter in einem solchen Moment vom Geschehen distanzieren und das Ganze quasi als Beobachter von außen aufnehmen kann, sieht die beteiligten Menschen gleichsam ganz nackt, so, wie sie sind. Ohne kulturelle Überformungen, ohne Zwänge von außen; einfach als Menschen, die Sieger geworden sind!
Und nochmals verstärkt und präzisiert sich die Frage nach dem Warum! Warum siegen wollen? Wo die Menschen doch so gut, so leistungsfähig sind! Also warum? Nötig hätten wir es doch nicht, aber »gesiegt« will trotzdem werden – immer wieder, ohne Ende, ohne Ziel! Ein absonderliches Wesen ist er schon, dieser Mensch. Seine nächsten Verwandten sind da ganz anders. Ohne Wille zum Sieg. Ohne Bereitschaft, dafür alles zu geben. Auch ohne Chancen für die Zukunft, denn wir haben sie längst besiegt und abgedrängt in letzte, gnädig gewährte, wenngleich höchst unsichere Refugien oder eingesperrt in die Sicherheit der Verwahrung in zoologischen Gärten. Als Art betrachtet sind die beiden Schimpansenarten sowie die mächtigen, uns an Kraft so haushoch überlegenen Gorillas und die so tiefsinnig dreinblickenden Orang-Utans längst die Verlierer. Abhängig von unserer Gnade; abhängig von uns Siegern!
Steckt hier im Kern etwas, das uns stutzig machen sollte? Oder ist es doch nichts weiter als eine bildhafte Umschreibung, wie bei den Kriegen, die Ameisen gegeneinander führen oder wenn sie auf Sklavenjagd gehen? Rätselhafte Seiten hat der Mensch. Seine Erfolge sind nicht immer so ganz geheuer.
Ist ihm der Wille zum Sieg irgendwie angeboren oder zumindest so sehr zu Eigen, dass wir mit Recht davon als einem Kennzeichen des Menschen sprechen können? Und falls ja, warum ist das so? Warum ist das so geblieben bis in unsere Zeit, in der die sportlichen Siege mehr beachtet werden als die prekäre Zukunft der Erde und ihrer Lebensgrundlagen für alle Lebewesen?
3. Kapitel:… oder Superstar?
Die Artisten im Zirkus sind auch Menschen. Selbstverständlich ist das so, auch wenn deren Leistungen mitunter unglaublich erscheinen, denn diese entziehen sich nicht nur den Möglichkeiten der meisten anderen Menschen, sondern manchmal auch unserer Vorstellungskraft. Da werden Körper verbogen und ineinander verschlungen, als ob sie keine Knochen enthalten würden. Am Trapez turnen schier überirdische Wesen wie schwerelos herum, fliegen durch die Luft, als ob dies die natürlichste und einfachste Sache der (Bewegungs-)Welt sei, oder sie zeigen turnerische Fähigkeiten, die den Eindruck von im Geäst herumschwingenden Affen erwecken könnten, wenn sie nicht viel beherrschter, kontrollierter und irgendwie auch »schöner« wären.
Kommen dann die Clowns, die über ihre eigenen Füße stolpern oder auf leichte Stupser hin schon umfallen, müssen wir unweigerlich lachen. Wer die Bewegung nicht beherrscht, wirkt wie ein »Tölpel« oder »Tollpatsch«. Das wird bei Kleinkindern mit Nachsicht und Wohlwollen hingenommen. Sobald der Mensch aber gelernt hat, auf seinen Füßen richtig zu stehen, wird die Unsicherheit im Gehen, Laufen oder in anderen Bewegungsweisen belächelt oder offen ausgelacht. Im Zirkus allerdings darf man das, und die tollpatschigen Clowns sind daher bei Alt und Jung höchst beliebt.
So zeigt ein »normales« Zirkusprogramm sehr deutlich die ganze Bandbreite der Körperbeherrschung: vom Stolpern bis zu Präzisionssprüngen und vom hilflosen Hängen bis zum schwerelosen Schwingen und »Fliegen« in voller Aktion und mit bewegten »Zielen«.
Artisten sind Künstler – nicht nur nach der wörtlichen Bedeutung ihrer Berufsbezeichnung. Sie können das, was sie vorführen, bestens und auf jeden Fall weit besser als wir, die von ihrem Können faszinierten Zuschauer. Was ihr Können auszeichnet, ist die »Perfektion«, mit der sie ihre Artistik präsentieren. Im Bereich des Sports zählt diese Perfektion ganz besonders und wird beim Kunstturnen, -springen, -reiten und so weiter auch richtiggehend benotet. Schimpansen oder Gibbons, die sicherlich auf ihre Weise ebenfalls meisterhaft turnen können, würden hinsichtlich Stil und Perfektion der Ausführung eher schlechter abschneiden. Es fehlt ihnen die Strenge des Stils. Sie pflegen etwas, was man vielleicht der »Kür« gleichsetzen könnte, nicht aber der »Pflicht«. Fast immer bleibt eine Komponente in ihrem Herumturnen, die zum Lachen reizt – selbst dann, wenn alles so herrlich sicher und leicht aussehend vollzogen wird.
Ein Schimpanse, der am Reck einen freien Handstand machen sollte, würde ein klägliches Bild bieten und eine lächerliche Figur machen. Von wegen straff gestreckter Körper von den mit festem Griff haltenden, den Körper hochstemmenden Händen über Arme, Brust, Rücken und Becken bis zur Spitze der Zehen. Des Affen Nummer zu dieser Übung wäre genau das, was man »zirkusreif« nennt.
Nun könnte man meinen, das läge eben daran, dass nicht einmal einem Schimpansen, der sicherlich intelligenter als andere Affen ist, klargemacht werden kann, welche Bedeutung Haltung und Schönheit der Form haben. Aber daran scheitert die Übung nicht, wie etwa die wundervollen, in jeder Hinsicht schönen Sprünge der Delfine zeigen. Mit ihnen können Menschen sicherlich weniger Kommunikation pflegen als mit Schimpansen.
Der Unterschied liegt am jeweiligen Körperbau. Der von Schimpansen kommt uns unwillkürlich irgendwie krumm und nicht einmal so »elegant« wie bei den Gibbons gestaltet vor, weil wir ihn mit uns Menschen selbst vergleichen. Im Delfin erblicken wir hingegen die perfekte Form, die sogar jene der Fische übertrifft. Wenn uns im Wasser Delfine umrunden oder, noch ausgeprägter, unter Wasser Seelöwen oder andere Robben spielerisch umkreisen, haben wir das Gefühl, von diesen weitaus besseren Schwimmern und Tauchern ähnlich belächelt und als grotesk eingestuft zu werden, wie wir das mitunter unseren nächsten Verwandten, den Menschenaffen, gegenüber tun. Als »Knöchelgänger« nach Art der vierbeinigen Fortbewegungsweise der Schimpansen wirken wir natürlich genauso lächerlich wie diese aufgerichtet in zweibeinigem Watschelgang mit Hüftschwung.
Das alles ist so offensichtlich und selbstverständlich, dass es an sich gar nicht nötig wäre, darüber nachzudenken. Dass es sich dennoch lohnt, um unsere Fähigkeiten und Leistungen als Art Homo sapiens und als sehr naher Verwandter der Schimpansen, Gorillas, Orang-Utans und auch der südostasiatischen Gibbons besser beurteilen zu können, zeigt ein anderer Gesichtspunkt: Die Art »Mensch« kann vieles, was andere Primaten können, nicht nur vergleichbar gut, sondern – und das ist das wirklich Besondere – sie kann und beherrscht die Vielfalt der Bewegungsweisen und Leistungsformen in einzigartiger Kombination. Keine andere Primatenart kann das! Noch weiter: Wir können sicher sein, dass es überhaupt kein Lebewesen gibt, das all das, was der Mensch an körperlichen Leistungen zustande bringt, in ähnlicher Kombination und Qualität ebenfalls könnte. Wir müssten, abgesehen vom freien Flug der Vögel und Fledermäuse, praktisch das gesamte Spektrum der Tierwelt zusammenführen, um das Leistungsspektrum des Menschen abdecken zu können. Das ist die eigentliche körperliche Besonderheit des Homo sapiens.
Er ist der völlig unangefochtene Kombinations-Superstar. Kein »Mängelwesen«, kein Schwächling, der überall Verlierer bliebe, sondern unschlagbarer Meister vieler Klassen und Beherrscher des Ganzen. Es ist fast unheimlich: Biologisch betrachtet scheint der Mensch regelrecht auf Erfolg programmiert! Gute bis sehr gute Leistungen in »einer Disziplin« genügen nicht. Auch wirkliche Spitzenleistungen reichen nicht aus, wie etwa seine einzigartige Fähigkeit zum Langstreckenlauf. Kein Rennpferd kann die mehr als vierzig Kilometer eines Marathonlaufes durchhalten, keine leichtfüßige Gazelle. Ganz zu schweigen vom besten Sprinter, dem Geparden. Seine im Vergleich zu menschlichen Sprintern dreimal höhere Spitzengeschwindigkeit endet nach wenigen hundert Metern in Erschöpfung. Schon Dreitausendmeterläufer hätten nur noch wenige Begleiter aus der Tierwelt. Und je länger die Strecke wird, umso mehr fallen aus und bleiben zurück. Die letzten zehn Kilometer eines Marathonlaufes läuft der Athlet einsam, wenn er keine anderen menschlichen Marathonläufer als Begleiter hat.
Recht einsam, wenn nicht unter ihresgleichen, bleiben auch die Bezwinger von Achttausendern unter den Bergsteigern. Kein Säugetier wird ihnen nachsteigen. Ob jemals eines aus eigener Kraft bis auf die höchsten Gipfel des Himalaya gekommen ist, darf bezweifelt werden.
Ohne Konkurrenz ist der Mensch auch im Werfen. Ein Marathonläufer, von denen es ja wirklich viele gibt, kann ohne besonderes Training auch jeden Weitwurf-Wettbewerb mit jedem anderen Säugetier gewinnen. Jeder Bezwinger von Achttausendern auch. Konkurrenzlos sind die Freikletterer in der Säugetier-Gewichtsklasse über fünfzig Kilogramm oder die Gewichtheber. Lediglich beim Schwimmen schneiden wir Menschen ziemlich schlecht ab im Vergleich zu ähnlich schweren Säugetieren oder zu den großen Pinguinen. Das Wasser ist nicht »unser Element«.
Auch mit Langstrecken-Schwimmern beeindrucken wir die Konkurrenz von Delfinen, Walen oder Robben überhaupt nicht. Noch mehr gilt das für das Tauchen ohne Hilfsmittel. Unsere »Disziplinen« sind klar und vorrangig erdgebunden. Beim Turnen zählen Perfektion und Schönheit weit mehr als Geschwindigkeit oder »Reichweite«. Weitsprünge von Baum(ast) zu Baum(ast) fehlen völlig unter den olympischen Disziplinen. Die Kletterfähigkeit wird eher in dörflicher Konkurrenz beim Maibaum-Klettern getestet als unter »ernsthaften Wettbewerbsbedingungen«. Anscheinend ist sie uns nicht mehr so wichtig.
Ein kurzer Seitenblick mag hier angebracht sein: Wenn wir uns bei sportlichen Aktivitäten der Tiere bedienen oder sie wettbewerbsmäßig einsetzen, so gibt es dafür eigentlich nur eine Disziplin: das Laufen. Dementsprechend werden Pferderennen und Straußenrennen abgehalten, jeweils mit einem Menschen als Reiter, versteht sich. Ochsenrennen haben wohl wegen ihrer niedrigen Geschwindigkeiten eher folkloristischen und humoristischen Charakter behalten. Auf Rennen dressieren ließ sich einzig der Hund. Das konnte wahrscheinlich deswegen gelingen, weil die Stammart der Hunde, der Wolf, in schnell und lang laufenden Rudeln jagt und hetzt. Dabei kommt es schon im natürlichen Verlauf einer Hetzjagd zu einer gewissen Konkurrenz der Wölfe untereinander, die »angestachelt« und nicht erst andressiert werden muss. Die Rennpferde brauchen dagegen den Reiter; von sich aus würden sie nicht um die Wette rennen!
Bei einem »Wettfliegen« von Brieftauben wissen hingegen nur die Menschen, worum es geht. Die Tauben fliegen einfach. Nicht weil sie Erste werden wollen. Sie schauen sich nicht nach der Konkurrenz um. Sie fliegen ihrer Kondition gemäß, aber nicht weil auch andere Tauben fliegen.
Diese Befunde lassen sich nun eigentlich leicht zusammenführen. Der »Superstar Mensch« hat zwei klare Bewegungsschwerpunkte, und mit diesen decken sich auch seine Interessen, wenn er andere Tiere dafür einsetzt oder sich technischer Hilfsmittel bedient. Es sind dies Laufen und Geschwindigkeit einerseits sowie artistische Körperbeherrschung und Perfektion andererseits. Wo andere Bewegungsformen in den sportlichen Bereich einbezogen sind, geht es in aller Regel um entsprechende Ziele: der Schnellste im Schwimmen zu werden, im Eisschnelllauf, in den alpinen Abfahrtsläufen oder bei Autorennen, oder die schönste, die perfekteste Form zu bieten, wie im Kunstturnen, Kunstspringen, Tanzen und so weiter. Ums Überleben geht es dabei kaum; entsprechende »Wettbewerbe« sind erst in jüngster Vergangenheit entstanden und entbehren der in der Natur sonst unausweichlichen Konsequenz, möglicherweise doch nicht zum Überleben beitragen zu können.
Bei vielen anderen »Konkurrenzen« steht eher die Belustigung im Vordergrund oder sie ist der alleinige Zweck. Seifenkistenrennen werden noch mit Einschränkungen ernst genommen; Fernsehshows mit kuriosen Wettbewerben sind Unterhaltung und Entertainment. Dementsprechend wird auch der größte Blödsinn noch gut bezahlt.
Eine Gruppierung fehlt noch völlig in diesem Versuch, Ordnung in die Fülle der Bewegungsarten zu bringen und Strukturen erkennbar zu machen. Es sind dies die durchaus sportlichen Wettbewerbe, bei denen es ganz unmittelbar um den Sieg geht, aber nur am Rande um »Schönheit« oder Geschwindigkeit. Es sind dies die »Kämpfe«, bei denen Kräfte gemessen werden; zwischen zwei Personen jeweils oder zwischen »Mann«schaften. Boxkämpfe, Ringkämpfe oder Judokämpfe sind typische Vertreter dieser Gruppe, zu der aber auch etwa das Tennisspiel zu rechnen ist. Kennzeichnend für sie und alle anderen vergleichbaren Sportarten ist die Erstellung und Fortschreibung einer »Rangliste«.
Eine solche gibt es gleichfalls bei den Mannschaftsspielen und der tabellarischen Erfassung von Leistungen über längere Zeiträume (Spielsaisonen), bei denen nicht nur die Siege »zählen«, sondern auch die Unentschieden, und selbst verlorene Spiele nicht gleich das Aus bedeuten. Tore und andere, in »Punkte« umgesetzte Leistungen werden tabellarisch gesammelt und aufsummiert. Ob Baseball, Rugby, Fußball oder Handball, Eishockey oder Polo, die Mannschaftsleistung ist letztlich entscheidend und nicht die momentane Form oder das Ergebnis eines einzigen Spiels (es sei denn, dieses ist das letzte und tatsächlich – wegen des Tabellenstands – entscheidende).
Interessanterweise gehen diese Spiele unter bestimmten Bedingungen zu einem »direkten Kräftemessen« über, bei dem ein Sieg ganz unmittelbar festgestellt wird, zum Beispiel, wenn es sich um so genannte Länderspiele handelt. Dann wird aus jeder Mannschaft gleichsam eine Einheit. Von dieser Einheit wird, wie von dem stärksten Mann, das Land, die »Nation« repräsentiert und wieder »die Ehre« verteidigt, gerettet – oder auch mit der Niederlage verloren. Die Bedingung hierzu ist, dass die betreffende sportliche Auseinandersetzung in den beteiligten Ländern in hinreichendem Umfang wahrgenommen wird. Ein »Länderspiel« mit den jeweils laut Tabellenstand und Jahresergebnis schlechtesten Fußballmannschaften so »bedeutender Fußballnationen« wie Frankreich und Deutschland oder England und Italien würde günstigstenfalls als Spaßveranstaltung betrachtet werden. Die nationalen Emotionen kämen nicht in Wallung, auch wenn es sich jeweils um zwei mal elf Spieler handelt, die in der Absicht antreten, mit ihren Möglichkeiten Fußball zu spielen. Die Augen der Nationen würden sich nicht auf diese Mannschaften richten, wohl aber auf die beste Schüler- oder Jugendelf im edlen Wettstreit der entsprechenden Mannschaften anderer Länder.
Mannschaftswettbewerbe haben eine weitere, wichtige Komponente in sich, die sie sehr stark von den auf »den Sieger« ausgerichteten Wettbewerben unterscheidet. Sie offenbart sich von ihrer dunkelsten Seite, wenn »Schlachtenbummler« zu »Hooligans« werden. Mannschaftsspiele neigen dazu, bitterer Ernst zu werden, und das umso mehr, je größer die Gruppe ist, die eine Mannschaft repräsentiert. Siege und Niederlagen haben dabei andere Qualitäten als im auf Einzelpersonen bezogenen Sport, auch wenn in ihrer höchsten Ausprägung, bei den Olympischen Spielen, die Leistungen aller Einzelathletinnen und -athleten aufsummiert werden zu einem nationenbezogenen Medaillenspiegel. Das Endergebnis sieht dann so aus, als ob nicht die Ermittlung der gegenwärtig Weltbesten das Ziel gewesen wäre, sondern eine Konkurrenz der Nationen; eine Wendung, die uns noch mehr zu denken geben sollte als das Problem »sauberer« Spiele ohne Doping. Leistungssport und Siege sind offenbar doch nicht so sehr »Selbstzweck«, wie man meinen möchte, aber nicht meinen sollte.
Es steckt mehr dahinter! Und eine riesige Industrie versteht es ausgezeichnet, daraus kräftige Gewinne zu ziehen. Ihr Erfolg alarmiert! Wie ist es möglich? Wie kommt ein so immenses und global wirtschaftlich ausbeutbares Interesse am Sport zustande? Warum verdienen Fußballspieler Millionen beim an sich und »wertfrei« betrachtet vergnüglichen Spiel mit einem Ball unter guten, fairen Regeln? Dass die Gründe hierfür als »Hinter-Gründe« in (fast) allen von uns stecken, ergibt sich zwangsläufig aus unserem eigenen Interesse am Sport – und daraus, wie unglaublich viel Geld damit verdient und umgesetzt werden kann.