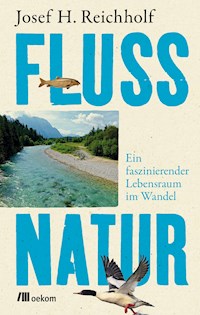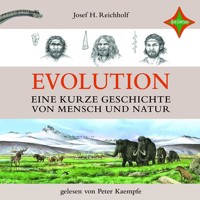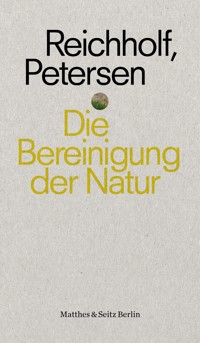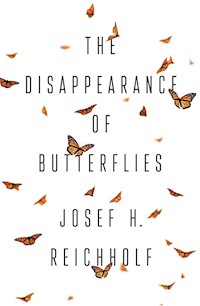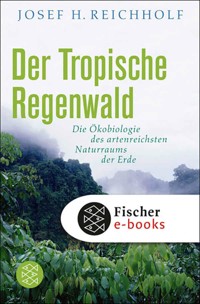Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Die Schmetterlinge sterben aus. Nur noch selten sehen wir Bläulinge, Schachbrettfalter oder Schwalbenschwanz. Der Kleine Feuerfalter und der Segelfalter sind bereits weithin verschwunden. Pestizide, Überdüngung und Monokulturen machen den Insekten den Garaus. Mit ihnen verschwinden die Vögel. Der Biologe und Bestsellerautor Josef H. Reichholf analysiert die drohende ökologische Katastrophe. Doch er entführt uns auch in die wundervolle Lebenswelt der Schmetterlinge. Ein flammendes Plädoyer für den Schutz der Schmetterlinge, z. B. durch Biotope in jeder Kommune. Und ein Buch, das uns wie einst Nabokov der Faszination dieser zauberhaften Lebewesen erliegen lässt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 372
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nur noch selten sehen wir Bläulinge, Schachbrettfalter oder Schwalbenschwanz. Der Kleine Feuerfalter und der Segelfalter sind bereits weithin verschwunden. Pestizide, Überdüngung und Monokulturen machen den Insekten den Garaus. Mit ihnen verschwinden die Vögel. Der Biologe Josef H. Reichholf blickt auf ein halbes Jahrhundert Schmetterlingsforschung zurück. In seinem neuen Buch analysiert er die drohende ökologische Katastrophe.
Doch er entführt uns auch in die wundervolle Lebenswelt der Schmetterlinge: zu kleinen Nymphen, die den Teichen in Luftblasen entsteigen, und zu zutraulichen, vom Gift der Kröten berauschten Schillerfaltern. Ein flammendes Plädoyer für den Schutz der Schmetterlinge, z. B. durch Biotope in jeder Kommune. Und ein Buch, das uns wie einst Nabokov der Faszination dieser zauberhaften Lebewesen erliegen lässt.
Hanser E-Book
Josef H. Reichholf
Schmetterlinge
Warum sie verschwinden und was das für uns bedeutet
Carl Hanser Verlag
Inhalt
Vorwort
Teil I
Die Lebensvielfalt der Schmetterlinge
Ein Rückblick auf 50 Jahre Schmetterlingsforschung
Das bezaubernde Leben der Wasserschmetterlinge
Die Vorzüge der Lichtanlockung
Ein seltsames Verhalten der Schillerfalter
Brennnesselfalter – eine aufschlussreiche Gemeinschaft
Schmetterlinge auf großer Wanderung
Giftige Schmetterlinge – vom Kohlweißling zu den Blutströpfchen
Das geheimnisvolle Leben der Gespinstmotten
Kältetolerante Frostspanner
Zitronenfalter – der Erste im Frühling
Teil II
Das Verschwinden der Schmetterlinge
Die Erfassung der Häufigkeit von Schmetterlingen – ein großes Problem
Die Namen der Schmetterlinge
Die Abnahme der Schmetterlinge
Die Großstadt – Ende der Natur oder Rettung der Artenvielfalt?
Die Unwirtlichkeit des Landes
Die verheerende Wirkung kommunaler Pflegemaßnahmen
Das Ende der Nacht – die Rolle der Lichtverschmutzung
Bilanz – ein Bündel von Ursachen
Das Verschwinden der Schmetterlinge und seine Folgen
Was wir gegen das Verschwinden der Schmetterlinge tun können
Die Schönheit der Schmetterlinge
Zwei Fundstücke anstelle eines Nachworts
Worte des Dankes …
Literaturauswahl
Register
Vorwort
In den letzten fünfzig Jahren nahm die Häufigkeit unserer Schmetterlinge um über achtzig Prozent ab. Nur die älteren Menschen können sich vielleicht noch an die Zeit erinnern, in der die Wiesen voller bunter Blumen waren und zahllose Falter über ihnen umhergaukelten. Niemand hätte damals daran gedacht, sie zählen zu wollen. Warum auch?! Die Schmetterlinge gehörten zum Sommer wie die Bienen und die Feldblumen. Vom frühen Frühling bis zum Beginn des Hochsommers sangen die Lerchen. Vom ersten Tageslicht an hingen sie jubilierend in der Luft über den Fluren. Das ganze Jahr über gab es Goldammern, Rebhühner, Hasen. An den Gräben und Tümpeln lebten Frösche. Laubfrösche riefen noch in den 1970er Jahren an einem am Rand der Flur gelegenen kleinen Teich so laut, dass ihr Chor während eines Telefoninterviews, das der Bayrische Rundfunk mit mir führte, durch die offene Terrassentür zu hören war. Thema: eine Verhandlung des Bayerischen Amtsgerichts über Lärmbelästigung durch Froschkonzerte.
Bereits als Kind lernte ich Schmetterlinge kennen. Die großen, auf ihren ockerfarbenen Flügeln schwarz gegitterten Schwalbenschwänze sah ich zu Dutzenden. Sie flogen zu unserem Gemüsegarten, um Eier am Karottenkraut abzulegen. Über ihre grünen, rot gepunkteten Raupen freute ich mich besonders, wenn ich sie Wochen später entdeckte. Berührte ich sie in Kopfnähe, ließen sie eine höchst merkwürdige, orangegelbe Gabel aus einer Vertiefung hinter dem Kopf emporschnellen. Sie verströmte einen sonderbaren, wie ich später erfuhr, abschreckend wirkenden Geruch.
Bläulinge unterschiedlicher Arten, die ich damals noch nicht unterscheiden konnte, flogen über den Wiesen, die sich von unserem Häuschen am Dorfrand bis zum Auwald erstreckten. Die blau aufschimmernden Falter gab es in solchen Mengen, dass ich rückblickend nicht einmal grobe Angaben machen könnte, wie häufig sie gewesen sein mochten. Kohlweißlinge beachtete man kaum. Sie gehörten zur Natur, die uns umgab, wie der Gesang der Grillen im Mai und Juni und das Gezirpe der Heuschrecken im Hochsommer. Gern kitzelte ich sie mit einem Grashalm aus ihren Wohnröhren. Ihr großer, unförmig und bullig wirkender Kopf belustigte mich. Darin schien nicht viel Intelligenz zu stecken, so leicht ließen sie sich foppen.
In den Kopfweiden am Bach, der sich durch die Wiesen hinter unserem Haus schlängelte, nisteten Wiedehopfe. Mit aufgerichteter Federhaube schritten sie auf den beweideten Flächen kopfnickend umher und stocherten in den Fladen herum, die die Kühe hinterlassen hatten. Diese waren den ganzen Sommer über bis weit in den Herbst hinein tagsüber auf der Weide. Es wimmelte vor Staren. Die immer irgendwie übereifrig wirkenden, schwarz gefiederten Vögel folgten den Kühen. Manchmal setzten sie sich auf deren Rücken. In jedem Garten war für die Stare mindesten ein Nistkasten an hoher Stange befestigt aufgestellt. Reiften die Kirschen, holten sie sich einen beträchtlichen Anteil davon und machten viel Lärm dabei. Stare vom Kirschbaum zu vertreiben war ein großes Vergnügen für ältere Kinder, weil sie dazu in die Baumkrone klettern durften, wo die Kirschen direkt vor ihrem Mund baumelten. An unserem Haus lebte unterm Dach eine Kolonie Spatzen; ein gutes Dutzend, vielleicht auch mehr. Sie waren immer da. Unsere Katze beachteten die Haussperlinge nicht. Sie ging auf Mäusejagd und war sehr erfolgreich dabei. Landidylle. Verklärte Erinnerungen an Kindheit und frühe Jugendzeit im niederbayerischen Inntal?
Trugbilder könnten es sein, die sich die einstige Wirklichkeit im Nachhinein zurechtgebogen haben. Dessen muss man sich bei jedem Versuch bewusst sein, das »Früher« zur Basis für das »Heute« zu rekonstruieren. Das Gedächtnis liefert uns, was wir haben möchten. Und es neigt zu Nostalgie, zu Sehnsucht nach dem Vergangenen. Dennoch beginne ich dieses Buch mit Schilderungen einstmals selbst erfahrener Naturschönheit und -vielfalt, auch um verständlich zu machen, warum mich das Verschwinden der Schmetterlinge so sehr berührt. Der erste Teil des Buchs soll die Basis legen, auf der wir über den Verlust der Arten urteilen können. Die Beispiele wähle ich gezielt so, dass man kein Spezialist sein muss, um Ähnliches selbst beobachten und mitverfolgen zu können.
Zusammengefasst sollen sie aufzeigen, dass die Häufigkeit von Schmetterlingen aus noch zu erläuternden Gründen zwar immer mal wieder stark schwankt, seit mindestens einem halben Jahrhundert jedoch ein allgemeiner Abnahmetrend zu verzeichnen ist. Um dessen Ursachen geht es im zweiten Teil des Buchs. Dafür ist es zentral, die üblichen Fluktuationen vom Trend zu unterscheiden. Nicht nur, um die Abläufe zu verstehen, sondern insbesondere auch, um die richtigen Gegenmaßnahmen zu treffen. Mit der bloßen Verringerung von Gifteinsatz zum Beispiel, so erstrebenswert ein solcher auch ist, wird es nicht getan sein. Und auch, was wir gemeinhin mit »grün« und »öko« verbinden, birgt bezüglich der Erhaltung der Arten so seine Probleme. Der zweite Teil wird daher zwangsläufig umweltpolitisch werden. Die Ökologie hat ihre wissenschaftliche Unschuld verloren, seit sie, wie es meine Überzeugung ist, von politisch einflussreich gewordenen Kreisen zu einer Naturreligion umfunktioniert worden ist. Widerspruch werde ich daher zu erwarten haben. Das bin ich gewohnt, und es gehört zum Prinzip des wissenschaftlichen Diskurses. Von öffentlich festgefahrenen Meinungen unterscheidet sich ein solcher durch die Akzeptanz der besseren Befunde. Das macht die Naturwissenschaft stark, aber auch zunehmend unbeliebt. Weil sie relativiert und flexibel bleibt, wo heute gern dogmatisch Prinzipien entgegengesetzt werden. Skeptiker zu sein ist für Naturwissenschaftler keine Abqualifizierung, sondern lobender Ausdruck dafür, sich nicht Dogmen zu unterwerfen, auch wenn sie gerade en vogue sein sollten.
Entsprechendes gilt für die Beschränkung der Ausdrucksfreiheit unter dem Druck der »political correctness«: Es ändert an der Wirkung nichts, ob wir Pflanzenschutzmittel sagen, wie es manche einfordern, oder sie Gifte nennen. Denn solche sollen sie schließlich sein: Stoffe, die töten, was vernichtet werden soll. Vermeiden lässt sich zudem nicht, immer wieder verallgemeinernd von »der Landwirtschaft«, »den Pflegemaßnahmen« oder »dem Naturschutz« zu schreiben. Landwirte können anders als die Mehrheit ihrer Kollegen insektenfreundlich wirtschaften, ein Pflegetrupp, der an Straßenrändern tätig wird, kann das auch einmal tun, ohne sämtliche Gräser und Blumen niederzumähen, und Gärten können sehr schmetterlingsfreundlich gestaltet sein. Aber für die Durchschnittsverhältnisse stimmen die Bezeichnungen »Landwirtschaft«, »Landschafts- und Gartenpflege« oder auch »Naturschutz« als Organisation und als staatliches Wirken, weil von ihnen bestimmte Folgen ausgehen. Und in diesem Sinne ist in diesem Buch verallgemeinernd von ihnen die Rede. Deshalb hängt die Wirkung meiner Ausführungen auch davon ab, mit welcher Einstellung das Buch gelesen wird. Geschrieben habe ich es aus dem Gefühl der Verantwortung heraus, die wir den kommenden Generationen schulden. Viele, sehr viele äußern sich seit Jahrzehnten zum Thema industrielle Landwirtschaft. Noch immer sind es zu wenige, um den gebotenen politischen Druck zu erzeugen, der eine Wende zum Besseren herbeiführen würde.
Soeben aus der Puppe geschlüpfter Totenkopfschwärmer »Pfötchen gebend«
Teil I
Die Lebensvielfalt der Schmetterlinge
Ein Rückblick auf 50 Jahre Schmetterlingsforschung
Vor schönfärberischen Erinnerungen an frühere Verhältnisse schützen mich meine Aufzeichnungen. Am 15. Dezember 1958 habe ich mit ihnen begonnen. Daher weiß ich, dass wir vor sechzig Jahren im niederbayerischen Inntal kein »weißes Weihnachten« hatten, sondern zwei Grad über Null und leichten Regen. Für den 2. Januar 1959 notierte ich, dass ich draußen am Inn, auf dem völlig eisfreien Stausee, die Wasservögel gezählt hatte: 800 Stockenten, 50 Reiherenten, 69 Saatgänse und 200 Blesshühner. Die meisten Zahlen waren gerundet, weil das Zählen mit dem kleinen Fernglas auf einen halben Kilometer Entfernung nicht genauer ging. Ein einigermaßen leistungsfähiges Fernrohr erhielt ich erst einige Jahre später. Als ich bei den Vorbereitungen auf dieses Buch meine alten Aufzeichnungen hervorholte und durchsah, fand ich auch ein Blatt mit vier von mir selbst gezeichneten Faltern. Erstaunt betrachtete ich es und las, was ich zu den Schmetterlingsbildern »aus meiner Sammlung angefertigt« vermerkt hatte. Neben einem Schwalbenschwanz und einem Paar Himmelblauer Bläulinge Polyommatus bellargus hatte ich einen großen und markant schwarzweißen Schmetterling gezeichnet, einen Weißen Waldportier, und ihn mit dem damals üblichen wissenschaftlichen Namen Satyrus circe benannt. Dieser Fund begeisterte mich, weil es die wunderschöne, so elegant fliegende »Circe« in meiner Heimat schon lange nicht mehr gibt. Sie ist weithin ausgestorben, wie zahlreiche andere Schmetterlingsarten auch, die ich in meiner frühen Jugendzeit noch kennengelernt und beobachtet hatte.
Andere der damals als gewöhnlich eingestuften Arten gibt es zwar noch, aber sie sind inzwischen selten oder sehr selten. Ein passendes Beispiel hierzu fand ich ebenfalls in meinen Aufzeichnungen. Die Notiz vom 12. September 1962 stellt eine aus heutiger Sicht bemerkenswerte Beobachtung dar. Ein fast handtellergroßer Schmetterling war bei der frühmorgendlichen Fahrt zur Schule an einer Station in den Regionalzug geflogen und auf dem roten Hemd eines Mitschülers gelandet. Es war ein Rotes Ordensband Catocala nupta. Die bräunlichgrauen, verwaschen rindenartig gezeichneten Vorderflügel dieses großen Eulenfalters verdecken in der Ruhehaltung die intensiv karminrot gefärbten, von einem gewinkelten schwarzen Band vor dem Außenrand eingefassten Hinterflügel. Noch nicht wissend, dass die Schmetterlinge – wie alle Insekten – die Farbe Rot nicht sehen, schrieb ich dazu: »Das Ordensband wurde also vom Rot des Hemdes angelockt«. Tatsächlich wirkte das rote Hemd eher dunkel. In seiner farblosen Helligkeit, dem sogenannten Grauwert, mochte es ganz gut dunkler Baumrinde und dem Grauwert der deckenden Vorderflügel entsprochen haben. In der Natur wäre die Stelle als Ruheplatz am Tage für diesen dämmerungsaktiven Eulenfalter geeignet gewesen. Die Ordensbänder gab es also vor einem halben Jahrhundert noch so häufig, dass sich eines in den Zug verirrte, vermutlich weil es an der Station von seinem Ruheplatz aufgescheucht worden war.
Rotes Ordensband Catocala nupta präsentiert die Hinterflügel mit abschreckend wirkendem Rot-Schwarz-Muster. Die Vorderflügel tarnen auf Rindenuntergrund
Derartige Notizen aus meiner Schülerzeit blieben Anekdoten, würden die Aufzeichnungen nicht mehr bieten. Zwar hält man viel zu selektiv fest, was gerade ungewöhnlich erscheint, während das Gewohnte unbeachtet bleibt. Dennoch lässt sich aus unsystematischen Notizen Interessantes herauslesen. Beispiele finde ich genug in meinen Tagebüchern. Wie das am 1. August 1960 festgestellte Weißfleck-Widderchen Syntomis phegea, dases im Gebiet längst nicht mehr gibt, oder die Raupe des Wegerichbären Parasemia plantaginis vom 28. Juli 1960. Er kommt nur noch sehr selten vor. All diese und die vielen anderen Notizen zeigen allerdings nur, dass früher Schmetterlingsarten vorhanden waren, die dort heute nicht mehr existieren. Das wirkliche Ausmaß des Rückgangs der Falter und der übrigen Insekten ließe sich aus dem Verschwinden einzelner Arten nicht ableiten. Es können in dieser Zeit ja Arten hinzugekommen sein, die es vorher nicht gegeben hat. Die Natur ist dynamisch. Änderungen können und werden immer auftreten. Die Eingangsbehauptung, dass wir im letzten halben Jahrhundert über achtzig Prozent der Schmetterlinge verloren haben, bezieht sich auf die Gesamthäufigkeit und bedarf zu ihrer Begründung einer viel solideren Basis.
Eine solche hatte ich bei Vögeln zwar schon einmal gewonnen: mit meinen Zählungen der Wasservögel an den Stauseen am unteren Inn, die ich sechs Jahre lang alle zwei bis drei Tage durchführte und die 1966 eine erste ornithologische Fachpublikation ergaben. Eine quantitative Erfassung von Schmetterlingen aber war eine ganz andere Herausforderung, als Vögel zu zählen, die am Ufer ruhen oder auf der Wasseroberfläche schwimmen. Ansätze hierzu formierten sich allmählich während meines Zoologiestudiums an der Universität München. Für meine Doktorarbeit über Wasserschmetterlinge war ein wissenschaftliches Vorgehen geboten. Die fünf verschiedenen Arten solcher Schmetterlinge aus der Familie der Zünsler lernte ich rasch kennen und im Gelände an ihrer Flugweise sicher zu unterscheiden.
Aber die Vielzahl der Schmetterlingsarten erfordert ungleich größere Kenntnisse, wenn man sie möglichst alle erfassen möchte. Die Einarbeitung ist weitaus schwieriger und zeitaufwendiger als das Kennenlernen unserer Vogelwelt. Allein in Südostbayern gibt es mehr als 1100 verschiedene Arten von Schmetterlingen; für ganz Bayern sind 3243 Arten nachgewiesen (Stand 2016). Viele davon sind sehr klein und nur mit spezieller Fachliteratur zu bestimmen. Für die Vögel gab es in den 1960er Jahren schon sehr gute Bestimmungsbücher, die zudem nicht unerschwinglich teuer waren. Mit der Vogelwelt hatte ich mich zunächst weit intensiver als mit den Schmetterlingen befasst. Der Grund hierfür lag nahe, buchstäblich. Die Stauseen und die Auwälder am unteren Inn, zu denen ich zu Fuß oder mit dem Fahrrad gelangen konnte, waren (und sind) Vogelparadiese. Sie gehören zu den artenreichsten Feuchtgebieten im ganzen mitteleuropäischen Binnenland. Als ich 1965 das Zoologiestudium in München begann, war ich dank dieser Umgebung bereits ein anerkannter Ornithologe. Und vertraut mit verschiedenen Vorgehensweisen, die in der Freilandforschung angewandt werden.
Insekten fliegen auf UV-Licht
Während des Studiums lernte ich eine Methode kennen, die sich wie keine andere dafür eignet, die Häufigkeit von Schmetterlingen festzustellen. Es ist dies die Anlockung der nachts aktiven Arten mit UV-Licht. Dies geschieht nicht, wie vordem schon häufig praktiziert und von mir selbst auch ausprobiert, mit großen Mischlichtlampen von 1000 Watt Stärke, mit denen aufgespannte weiße Tücher angestrahlt werden, sondern über eine sinnreiche Konstruktion mit UV-Neonröhren von nur 15 Watt Leistung. Dieses UV-Licht zieht die Schmetterlinge und andere Insekten an. Sie geraten beim Anflug in einen Trichter unter der Röhre, über den ein großer Sack gestülpt ist. Darin landen die Insekten. Um ihnen bis zum nächsten Morgen Schlupfwinkel zu bieten, gibt man beispielsweise Eierkartons hinein. Den Schmetterlingen passiert bei dieser Erfassungsmethode nichts. Im Sack beruhigen sie sich rasch, da sie der Einwirkung des Lichts entzogen sind. Art für Art werden sie am nächsten Morgen bestimmt und gezählt, auch die übrigen Insekten, so weit deren Artbestimmung möglich ist. Dabei werden sämtliche Insekten sogleich wieder frei gelassen. Auf diese Weise kommen quantitativ gut auswertbare und statistisch behandelbare Befunde zustande, die sich bei gleicher Bauausführung der Geräte je nach Fragestellung in jede Richtung bestens vergleichen lassen. Etwa um in ganz verschiedenen Typen von Lebensräumen Häufigkeit und Artenspektrum der nachts aktiven Schmetterlinge festzustellen. Genau dies machte ich ab 1969. Dr. Hermann Petersen optimierte die Methode. Ihm und Elsbeth Werner mit ihrem pestizidfreien Gehöft verdanke ich viel.
Mit Tagfaltern geht Lichtanlockung leider nicht. Um auch für sie in vergleichbarer Weise Änderungen in der Häufigkeit festzustellen, fing ich in den 1970er Jahren an, sie entlang bestimmter, über die Jahre hinweg unverändert beibehaltener Wegstrecken zu zählen. An Waldwegen oder an Feldwegen durch die Flur zum Beispiel. Und an den ohnehin schon als »Strecken« vorgegebenen Dämmen. Mit den Flusskilometer-Tafeln, die in Abständen von jeweils genau zweihundert Metern angebracht sind, bieten sie für solche Streckenzählungen die günstigsten Voraussetzungen. In den 1980er Jahren benutzte ich die auf diese Weise erzielten Befunde vornehmlich für meine Vorlesungen über Ökologie und Naturschutz an der Technischen Universität München und über Ökologische Tiergeografie an der Universität München. Im Lauf der Jahre wurde deutlich, dass die Lichtanflüge und die Streckenzählungen immer weniger Schmetterlinge ergaben. Aus dem »Beifang«, wie ich die übrigen ans Licht geflogenen Insekten nannte, verschwanden sogar die vormals so verbreiteten Maikäfer. Deren Massenanflug hatte mehrmals dazu geführt, dass sich der Sack vom Trichter löste und herunterfiel, weil in der Dämmerung bis an die tausend Käfer hineingeraten waren. Da zur Maikäferzeit Anfang Mai nur sehr wenige, oft fast gar keine Schmetterlinge fliegen, beeinträchtigte so ein Missgeschick die jährlichen Gesamtergebnisse nicht. Aber der ziemlich abrupte Ausfall der Maikäfer irritierte mich. Es war dies ein erstes klares Signal dafür, dass meine Untersuchungen wichtige Daten über die Veränderungen in unserer Natur lieferten. Dennoch ahnte ich in den 1980er Jahren noch nicht, wie stark es abwärts gehen würde mit den Schmetterlingen und den anderen Insekten. Und dass meine Befunde sogar die nahrungsökologische Begründung für den Niedergang der Vögel in Feld und Flur liefern würden.
Stadtschmetterlinge – häufiger als gedacht
In den frühen 1980er Jahren begann ich damit, die Schmetterlingshäufigkeit auch in der Großstadt zu untersuchen. München, wo ich seit 1974 Wissenschaftler an der Zoologischen Staatssammlung war, bot hierfür ideale Verhältnisse. Es gab im Stadtgebiet mehrere geeignete Stellen, um bezüglich Vorkommen und Häufigkeit der nachts aktiven Insekten eine Art Querschnitt von der Innenstadt bis zum Stadtrand zustande zu bringen. Zudem hatte ich die riesigen Sammlungen dieses Forschungsmuseums und die Kollegen als Spezialisten zur Verfügung, um alle Insekten genau bestimmen zu können. Dass ich deren Hilfe nötig hatte, ergab sich gleich nach den ersten Befunden. Sie waren so viel artenreicher als erwartet, dass ich allein damit nicht zurande gekommen wäre. Zudem fielen die Fänge auch bezüglich der Mengen außerordentlich ergiebig aus. Meine Befunde stellten die verbreitete Vorstellung, dass in der Stadt nur ein kläglicher Rest des Artenreichtums vom Land existieren würde, alsbald nicht bloß in Frage. Sie entlarvten diese als Vorurteil.
Über die Jahre und Jahrzehnte kamen so die umfangreichen Forschungsergebnisse zustande, über die ich in diesem Buch berichte. Sie bilden die Bilanz von einem halben Jahrhundert quantitativer Insektenforschung.
In diesen fünfzig Jahren wurde unsere Natur in einem Ausmaß und in einer Geschwindigkeit verändert, wie wohl noch nie zuvor in so kurzer Zeit. Die Befunde sind erschütternd und die Aussichten, die sich daraus ergeben, ausgesprochen düster. Denn beim Hauptverursacher des Niedergangs der Artenvielfalt, der Landwirtschaft, sind keine substanziellen Änderungen zu erwarten. Wer sich mit dem »Problem Landwirtschaft« ein wenig intensiver befasst, wird feststellen, dass es gar nicht um die Bauern geht. Sie wurden im letzten halben Jahrhundert nicht etwa gefördert, wie uns, der großen Masse der Bevölkerung, seitens der Politik vorgegaukelt wird, um die Subventionsmilliarden zu rechtfertigen. Man hat sie der Zahl nach auf ein Zehntel dezimiert. Die Gewinner, das internationale Agro-Business, insbesondere die Erzeuger der Pflanzenschutzmittel, blieben gut verborgen im Hintergrund, während das Sterben der bäuerlichen Landwirtschaft erschreckend parallel zum Niedergang der Schmetterlinge und der Vögel verlief.
Längst ist das so viel geschmähte Leben in der Stadt besser geworden als auf dem Land, wo die Gülle zum Himmel stinkt und Gift in einem ungeahnten Ausmaß ausgebracht wird, wo die Vögel verstummt sind und das Grundwasser nicht mehr zum Trinken taugt. Wie soll das weitergehen? Gibt es keine Chance, den Geistern Einhalt zu gebieten, die einst in guter Absicht gerufen worden waren, um den Bauern die Arbeit zu erleichtern und ihr Leben zu verbessern? Ist für die Agrarwende ein »Schmetterlingseffekt« denkbar? Mein Ausblick am Ende des Buches wird, es mag Sie überraschen, verhalten optimistisch ausfallen. Vielleicht ist die darin zögerlich geäußerte Zuversicht aber auch nur ein Wunschtraum. Weil kommende Generationen nicht schätzen werden, was sie nicht mehr kennenlernten und noch selbst erlebt haben: die Artenvielfalt unserer Natur, unserer Schmetterlinge.
Totenkopfschwärmer – Beispiel für einen Gast, der bei uns kaum noch leben kann
In unserer Zeit verschwinden Arten, deren Kennenlernen Kinder nachhaltig hätte prägen können. Ich denke an das große Staunen, das mich erfasste, als eines Abends Anfang Oktober ein Totenkopfschwärmer im Glas auf der Fensterbank aus der Puppe schlüpfte. Bei der Kartoffelernte hatte ich sie gefunden. Die Kartoffeläcker wurden im Niederbayerischen in den frühen 1960er Jahren noch überwiegend ausgeackert, wie es hieß. Ein Pferd zog den Pflug, dessen Schar so angesetzt war, dass sie an einer Seite im richtigen Abstand so die Furche zog, dass die um etwa zwei Handbreit höhere Zeile mit den Kartoffelstauden gleichsam umgekippt wurde. Einige Kartoffeln lagen dann frei. An ihnen orientierte man sich und fand weitere, die noch von der Erde umschlossen waren. Mit den Händen wurden diese herausgeholt. Auf Niederbayrisch hieß das Kartoffelklauben. Nun fressen aber die Raupen des Totenkopfschwärmers im Sommer am Kartoffelkraut, denn sie sind auf Nachtschattengewächse als Nahrungspflanzen eingestellt. Die zwar ursprünglich aus Amerika stammende Kartoffel gehört zu dieser – giftigen – Pflanzenfamilie.
Aber ihre ferne Herkunft stört nicht nur nicht, sondern begünstigt die Totenkopfschwärmer sogar. Denn von Natur aus würden die Weibchen dieser massigen Schmetterlinge nirgendwo Nachtschattengewächse in solcher Häufigkeit und in so günstigem Wuchs mit offenem Boden um die Stauden finden können. Daher war die amerikanische Kartoffelpflanze schon bald nach der Einführung in Europa im frühen 17. Jahrhundert eine bevorzugte Alternative für den afrikanischen Großschwärmer. Vorher kam er vermutlich nur selten aus dem randtropischen Afrika eingeflogen, weil es hier an geeigneten Futterpflanzen mangelte. Der Bittersüße Nachtschatten Solanum dulcamara bot nicht viel und wächst so verstreut, dass auch gegenwärtig kaum einmal Raupen des Totenkopfschwärmers daran gefunden werden.
Sind diese Raupen erwachsen, graben sie sich knapp unter der Erdoberfläche eine längliche Höhle, in der sie sich verpuppen. Nach Wochen der Puppenruhe schlüpfen die fertigen Schmetterlinge. Und müssen versuchen, nach Süden über die Alpen zu fliegen. Den Winter überleben sie nördlich davon nicht. Mein Totenkopf war so eine erwachsene Raupe. Ich hatte ihn in einem Einweckglas auf Torfmull bebettet und damit locker zugedeckt. Von Zeit zu Zeit besprühte ich den Torf ein wenig, dass die Puppe nicht zu trocken lag. Mit Erfolg. Der frisch geschlüpfte Totenkopfschwärmer, dessen Flügel noch nicht voll entfaltet waren, so dass sie den gelb-schwarz geringelten, sehr dicken Hinterleib nicht zudeckten, schien mir geradezu riesig. Umso mehr, als ich ihn auf den Zeigefinger kriechen ließ, um ihn an die Gardine setzen zu können. In der Hängehaltung sollten sich die Flügel fertig strecken können und flugtauglich werden. Mein Ziel war ja, ihn in der späten Dämmerung fliegen zu lassen, damit er zurück nach Afrika gelangt. Allein die Vorstellung, dass dies vielleicht gelingt und ich dazu beitragen konnte, erregte mich ungemein. Die angeblich an einen Totenkopf erinnernde, hell gelbliche Zeichnung auf dem Rücken beeindruckte mich hingegen nicht. Egal, wie ich sie betrachtete, sie sah überhaupt nicht nach einem Totenschädel aus. Oder mir fehlte die Fantasie, mir einen einzubilden. Auch jetzt, während ich dies schreibe, fällt es mir schwer, vorzustellen, dass Menschen in früheren Zeiten eine so irrige Vorstellung entwickeln konnten. Doch wer im Blatt des Leberblümchens eine Leber sieht, nur weil es aus drei (gar nicht leberartigen) »Lappen« besteht, und daraus auch noch ableitet, so etwas müsse gut gegen Leberbeschwerden sein, der gelangt bei der Rückenzeichnung dieses Schwärmers eben auch zu einem Mini-Totenkopf.
Totenkopf des Totenkopfschwärmers: So sieht sie tatsächlich aus, die Rückenzeichnung. Nur überschießende Fantasie kann darin einen Totenschädel erkennen
Ich weiß es nicht mehr, ob mir gerade Überlegungen zu seinem Namen durch den Kopf gingen, als etwas geschah, das endgültig den Biologen in mir weckte. Unsere Katze, die auf dem Sofa gelegen hatte und nach Katzenart so tat, als würde sie tief und fest schlafen, schlich sich an und reckte ihre Nase zum Totenkopf an der Gardine hoch. Im selben Moment, in dem ein Schnurrhaar ihrer Schnauze den Schmetterling berührte, schnellte dieser den gelb-schwarz geringelten Hinterleib zwischen den Flügeln hervor und piepste schrill. Vor Schreck wich die Katze zurück, fiel übers Sofa herunter und zog sich darunter zurück in volle Deckung.
Die Wirkung dieser Wespen- oder Hornissenzeichnung, verbunden mit dem in den fürs menschliche Ohr nicht mehr hörbaren Ultraschallbereich hineinreichenden Piepston war ein Lehrstück: Kein Buch, keine Schilderung so eines Vorgangs hätte eindrucksvoller vermitteln können, was eine »Schrecktracht« bedeutet und wie sie wirkt. Umso mehr war ich berührt, dass ich den Totenkopf mit meiner Fingerspitze so leicht dazu bringen konnte, sie zu erklettern und sich von mir an die Gardine setzen zu lassen. Jahre später, wenn ich gelegentlich einmal eine Hummel streichelte und damit zu einem leisen Surren anregte, dachte ich an dieses Erlebnis zurück. Der Totenkopfschwärmer, dem in meinem Leben noch Dutzende weitere folgten – bis die Kartoffelernte mechanisiert wurde und keine Puppen mehr zu finden waren bzw. kein Exemplar die harte Behandlung in der Erntemaschine mehr überlebte –, dieser in meiner Obhut geschlüpfte Schmetterling hatte mich berührt.
Totenkopfschwärmerraupe (Foto: Peter Denefleh)
Das bezaubernde Leben der Wasserschmetterlinge
Doch vorerst interessierte ich mich noch mehr für die Wasservögel. Die Ergebnisse meiner sechsjährigen Untersuchungen zu ihrem Vorkommen und ihrer Häufigkeit an den Stauseen am unteren Inn fasste ich kurz nach Beginn meines Zoologiestudiums zusammen und veröffentlichte sie. Die Arbeit wurde mir vom Zoologischen Institut formal als Zulassungsarbeit zur Staatsprüfung anerkannt. Daher konnte ich mich bereits wenige Semester nach Studiumsbeginn auf die Suche nach einer passenden Doktorarbeit machen. Eine Freilandforschung sollte es werden; am liebsten wäre mir eine Vertiefung meiner Wasservogelstudien gewesen. Doch der Dozent, an den ich mich wandte, meinte, ich solle mir so eine große Forschungsarbeit für die Zeit nach dem Doktorat aufbewahren und besser ein Thema bearbeiten, das auch Physiologie enthält. Von den drei Vorschlägen, die er mir gab, gefielen mir die Wasserschmetterlinge am besten. Ihr seltsames Leben hat tatsächlich viel mit Physiologie, mit der Physiologie der Atmung unter Wasser und den damit verbundenen Hautstrukturen der Raupen, zu tun.
Als spezielle Art wählte ich den Seerosenzünsler. Diesem kleinen zarten Schmetterling verdanke ich es, dass ich 1969 zum Dr. rer. nat. an der Ludwig-Maximilians-Universität München promoviert wurde. Einen Doktortitel gibt es für die unterschiedlichsten Forschungen, für reichlich obskure Themen mitunter, deren Sinnhaftigkeit nicht immer gleich von jedem verstanden wird. Mag sein, dass meine Doktorarbeit »Untersuchungen zur Biologie des Wasserschmetterlings Nymphula nymphaeata« auch in diese Kategorie fällt. 1970 wurde sie in der »Internationalen Revue der gesamten Hydrobiologie«, Band 55 (Seiten 687–728) veröffentlicht. Dass es darin um die Lebensweise eines Wasserschmetterlings mit dem (frei übersetzt) sehr hübschen wissenschaftlichen Namen »Kleine Nymphe der Seerosen« ging, lässt sich dem Titel entnehmen. Was aber wirklich in dieser »Biologie« steckt, bedarf einer näheren Schilderung.
Noch immer begeistern mich der zarte Schmetterling und seine nähere Verwandtschaft so sehr, dass mein Herz spürbar schneller schlägt, wenn ich wieder einmal einen von ihnen erblicke oder Neues zu ihrer Lebensweise herausbekomme. Tatsächlich geschieht dies, auch wenn schon so viel Zeit seit meiner Dissertation vergangen ist. In solchen Momenten denke ich, was für ein Glück ich doch gehabt habe mit der Wahl des Doktorarbeitsthemas. Die Kleinen Nymphen der Seerosen prägten mich zum Freilandbiologen, der viel lieber draußen in der Natur als drinnen im Labor forscht. Sie hielten mein wissenschaftliches Streben offen für die Schönheiten, für das Wunder des Lebendigen. Als »Objekte«, als lediglich wissenschaftlich ergiebigen Forschungsgegenstand, hatte ich die kleinen Schmetterlinge nie ansehen oder behandeln können. Ihre Lebendigkeit fesselte mich.
Wie freute ich mich, wenn die kleinen Falter, die ich zum Beobachten daheim in einem Flugkäfig hielt, von meiner Fingerspitze ein Tröpfchen leicht gesüßten Wassers tranken. Danach machten sie immer einen leicht verwirrten Eindruck und suchten mit ihren Rüsseln umher. Was ich ihnen im Käfig mittels einer flachen Wasserschale an Pflanzen aus ihrem natürlichen Lebensraum der Ufer von Kleingewässern angeboten hatte, sagte ihnen offenbar nicht zu. So eingeschlossen, veränderte sich ihr Verhalten, das ich doch erforschen wollte, wahrscheinlich ziemlich stark. Die Raupen der Wasserschmetterlinge ließen sich in kleinen Aquarien leicht halten. Ihr Leben ist ganz auf Nahrungsaufnahme eingestellt. Und auf die regelmäßige Häutung, die sie für das Weiterwachsen nötig haben. Im Fressstadium stellen sie keine besonderen Ansprüche, außer dass sie das richtige Futter in Form der Blätter von Schwimmblattpflanzen bekommen. Selbst an dieses sind sie gar nicht so eng gebunden, wie das aus der bereits vorhandenen Fachliteratur hervorging. Die Entwicklung der Raupen aus den Eiern bis zur Verpuppung und das Schlüpfen der Falter hätte ich also durchaus direkt an meinem Arbeitsplatz im Zoologischen Institut der Universität München mitverfolgen können. Nicht aber das Leben der Falter.
Nymphula nymphaeata, am Ufer ruhendes Männchen, vor 50 Jahren während meiner Freilandforschungen zur Doktorarbeit fotografiert
Doch ich hatte Glück. An die Geheimnisse ihres Lebens kam ich auf andere und viel bessere Weise. Zwar hatte ich »meinen« Wasserschmetterling zuerst im Botanischen Garten in München gefunden, wo die Raupen die Schwimmblätter kleiner (und seltener) Seerosen zerfraßen. Daher waren sie bei den Gärtnern nicht gerade beliebt. Deren Erwartung, dass ich sie mit meinen Forschungen von diesen Schädlingen befreien würde, erfüllte ich nicht, weil ich bald natürliche Vorkommen in der Umgebung meines Heimatortes im niederbayerischen Inntal fand. Die Seerosenzünsler, wie sie in der nüchternen Fachsprache genannt werden, gab es in aufgelassenen, sogar als Müllabladeplätze missbrauchten kleinen Kiesgruben und in Altwassern im Auwald am Inn. Diese Vorkommen konnte ich von zu Hause aus zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen. Als ich dort an schönen Frühsommerabenden mit der Beobachtung der Seerosenzünsler anfing, fühlte ich mich großartig. Zu Beginn der Dämmerung fingen die Männchen mit ihren Suchflügen an. Ein erster, im Abendlicht gut erkennbar elfenbeinfarbener Falter tänzelte aus dem Uferröhricht hervor und flog wie umherirrend zwei bis drei Handbreit hoch über der Wasseroberfläche. Kaum war er draußen, folgten aus dem Röhricht weitere, Dutzende. Im aufsteigenden Dunst, der sich ganz langsam zum Nebel verdichtete, tanzten sie in einer nicht nachvollziehbaren Choreographie. Nymphula, Kleine Nymphe. Welch passender Name, dachte ich, noch nicht ahnend, dass mich noch viel Aufregenderes erwartete.
Abends am Tümpel
Die Wasserfrösche beendeten ihr Gequake, das bei Sonnenuntergang als vielstimmiger Chor einen letzten lautstarken Höhepunkt erreicht hatte und die Wasseroberfläche des Tümpels in der Kiesgrube erzittern ließ. Jetzt brach eigentlich die Tageszeit der Laubfrösche an. Aber nur einer presste kurz ein »äp, äp, äp« aus seiner Kehle und schwieg sodann. Für die Laubfrösche war es bereits zu spät im Jahr. Ihre Konzerte geben sie im April oder Anfang Mai. Den Abfallhaufen an der Böschung untersuchten jetzt Ratten. Sie huschten über Bauschutt und Hausmüll, den sie nach Fressbarem durchsuchten. Für Momente lenkten sie mich vom Beobachten der Wasserschmetterlinge ab. Bei der Betrachtung durchs lichtstarke Fernglas sah ich, dass es Wanderratten aller Größen waren. Wahre Riesen, wie es mir schien, waren dabei. Für Katzen wären sie lebensgefährliche Gegner gewesen. Aber es gab auch kleine, die mit ihren Müttern herumsuchten, zu denen sie erkennbar engen Kontakt hielten. Als ein zitternder Schatten durchs Blickfeld des Fernglases flog, bemerkte ich erst, dass mich auch Fledermäuse umschwirrten. Sie fingen Wasserinsekten über dem Tümpel. Die Abenddämmerung ist Schwärmzeit von Köcherfliegen und Eintagsfliegen. Überall erhoben sie sich in die Luft als ich mit dem gebündelten Strahl meiner Taschenlampe umherleuchtete. Die späte Dämmerung ging in die Dunkelheit über. Ich hatte die Lampe mitgenommen, um zu sehen, wie lange die Wasserschmetterlinge flogen. Anscheinend reichte ihr Flug nicht sehr weit in die Nacht hinein, denn schon im letzten Tageslicht wurden es deutlich weniger, die ich über der Wasseroberfläche erkannte.
Die Falter zogen sich zurück ans Ufer. Aus kurzem Schwirrflug heraus landeten sie an den Stängeln der Pflanzen und rührten sich nicht mehr. Vielleicht war es ihnen zu kühl geworden, dachte ich, und spürte nun selbst die feuchtfrische Kühle der Frühsommernacht. Ich würde also, diesen ersten Eindrücken zufolge, die Abnahme von Helligkeit und Temperatur messen müssen. Mit dem damals, in den 1960er Jahren, noch nötigen Belichtungsmesser zur richtigen Einstellung der Blende am Fotoapparat sollte das für die Helligkeitsabnahme gehen. Bei der Lufttemperatur würde es nicht so einfach werden, wie ich bei Messversuchen mit einem Laborthermometer schnell einsah, denn es zeigte recht unterschiedliche Temperaturen an, je nachdem, wie nahe am Wasserspiegel und am Röhricht ich maß und ob ich das Thermometer weit genug von meinem Körper entfernt gehalten hatte. Von den heutigen Präzisionsmessungen der Temperaturen war man vor einem halben Jahrhundert bei Geländearbeiten noch weit entfernt. Auch das Zählen der fliegenden Schmetterlinge gestaltete sich, zurückhaltend ausgedrückt, ziemlich problematisch. So erratisch schwirrten sie über dem Wasserspiegel umher und am Röhrichtrand entlang. Mit schwächer werdendem Abendlicht wurden es mehr und mehr, dann weniger. Rasch nacheinander wiederholte Zählversuche ergaben peinlich unterschiedliche Zahlen. Meine Euphorie, so zu Daten für eine interessante Doktorarbeit über diese zauberhaften Schmetterlinge zu gelangen, wich in den nächsten Abenden, die ich an den Tümpeln verbrachte, der aufkommenden Sorge, ob ich genügend gute und auch hinreichend neuartige Befunde bekommen würde, dass sie für eine Dissertation reichten. Zweifellos war es doch nötig, die Raupen mit den Wasserpflanzen, an denen sie fraßen, in Aquarien zu halten. Die Flugkäfige für die geschlüpften Falter mussten verbessert und naturnäher gestaltet werden. Denn selbstverständlich war draußen an den Tümpeln nicht jeder Abend zum Beobachten ideal.
Rasch zeigte sich, dass auch unter den günstigen Bedingungen, die Tümpel mit den Wasserschmetterlingen fast vor der Haustüre zu haben, Forschungen im Freiland mit dem Wetter und mit nicht vorhersehbaren Ereignissen zu kämpfen haben. So wurde eine der Kiesgruben wenige Wochen nach Beginn meiner Untersuchungen in einen Karpfenteich umgewandelt. Mit der Folge, dass alsbald alle Wasserpflanzen darin vernichtet waren. Wenigstens gelangten damals noch kaum Dünger und Gifte, die in der Landwirtschaft verwendet wurden, in die Kiesgruben oder in die Altwasser im Auwald. Dass die Gruben alle knapp ein Jahrzehnt nach Abschluss meiner Forschungen vernichtet sein würden, ahnte ich nicht. Sie wurden verfüllt, planiert und mit Bäumen bepflanzt oder in Ackerland zurückverwandelt. Ausgerechnet Naturschützer hatten sie zu »Wunden in der Landschaft« erklärt, die geschlossen werden müssten. Und neue derartige Wunden durfte es zukünftig auch nicht mehr geben, damit die Landschaft »heil« bliebe. Noch immer versetzt es mir einen Stich, wenn ich an den Stellen vorbeikomme, an denen ich die Freilandforschungen zu meiner Doktorarbeit durchführte. Maisfelder decken sie zu. Auf einer wachsen Bäume und bilden ein kleines Gehölz. Verfüllt sind sie alle. Mit solch kleinen Verlusten beginnt die Erosion des Heimatgefühls. Doch weiter mit der Schilderung des Lebenslaufes der Seerosenzünsler. Vielleicht wird daraus ersichtlich, warum mich diese kleinen Wesen so faszinierten, dass sie mein ganzes Zoologenleben hindurch in mir weiterwirkten. Und Stellvertreter für alle Schmetterlinge wurden.
Das verborgene Leben der Kleinen Nymphen
Beginnen wir mit dem erfolgreichen Ende eines frühsommerlichen Suchfluges. Es sind die Männchen, die in der Abenddämmerung herumgeistern. Sie suchen nach Weibchen, nach frisch geschlüpften, die noch nicht begattet sind. Mit einem reizenden kleinen Experiment konnte ich verfolgen, was dabei vor sich geht. Ein daheim im Aquarium geschlüpftes Weibchen setzte ich in einen Mini-Käfig, wie er in der Imkerei für die kurzzeitige Unterbringung von Bienenköniginnen verwendet wird. Über die vergitterten Seiten kann der Lockstoff, den das Weibchen von sich gibt, austreten und von den Luftströmungen verbreitet werden. Auf einem Styropor-Floß ließ ich dieses jungfräuliche Weibchen in der Abenddämmerung aufs freie Wasser des Tümpels hinaustreiben, nachdem der Suchflug der Männchen eingesetzt hatte. Schon nach wenigen Minuten änderten sich deren erratische Flüge und wurden zu zielgerichteten Bahnen. Dutzende Männchen landeten am Käfig. Mit dem durchs Gitter gestreckten Hinterleib versuchten sie zum Weibchen zu gelangen. Ich hatte das Floß an einer Schnur befestigt und konnte es nun näher zu mir ans Ufer ziehen. Die Männchen folgten wie daran festgeklebt. Sie ließen sich auch nicht verscheuchen, als ich den Korken herauszog und das Weibchen auf die schwimmenden Blätter des Wasserknöterichs hinausließ. Kaum war es frei, erfasste es eines der Männchen zur Kopulation. Und gab es nicht mehr frei. Die anderen hatten keine Chance. Sie ließen ab von dem Paar und führten ihre Suchflüge weiter. Da und dort bemerkte ich nun, dass eines landete und sich mit einem anderen Weibchen paarte, das auf einem Schwimmblatt saß. Die etwas trüber getönten Weibchen waren im Dämmerlicht gar nicht so leicht zu entdecken, wenn sie auf einem schwimmenden Blatt saßen.
Am nächsten Morgen startet das frisch begattete Weibchen dann seinen Suchflug. Noch dichter schwirrt es über die Wasseroberfläche, bis es Schwimmblätter findet, deren Ränder noch keine ausgeschnittenen Kerben als klare Fraßspuren bereits vorhandener Raupen tragen. In Frage kommen verschiedene Arten von Wasserpflanzen, deren Blätter sich auf der Wasseroberfläche ausbreiten. Nach der Landung betastet das Weibchen mit den Beinen ausgiebig das Blatt. Schwimmendes Laichkraut Potamogeton natans, Wasserknöterich Polygonum amphibium und Seekanne Nymphoides peltata sowie junge, noch dünne Blätter von Seerosen Nymphaea sp. Für das Wachsen und Gedeihen der Raupen eignen sich die Schwimmblätter der mit gelben Blüten auffallenden Seekanne besonders gut. Aber dieses zur Wasserpflanze gewordene Enziangewächs kommt nur höchst selten vor. Die Unterschiedlichkeit der hier genannten Wasserpflanzen drückt aus, dass die Seerosenzünsler nicht auf bestimmte Futterpflanzen spezialisiert sind. Ihre Raupen ließen sich sogar erfolgreich mit Blättern von grünem Salat füttern. Allerdings mit Wirkungen, mit denen ich nicht gerechnet hatte und die sehr aufschlussreich waren.
Hat das Weibchen ein geeignetes Blatt gefunden, schiebt es sich rückwärts dem Rand entgegen und krümmt die Spitze des Hinterleibs so über den Blattrand, dass sie die Unterseite des Schwimmblattes erreicht. Das fällt gar nicht leicht, da die Oberflächenspannung zu überwinden ist. Nahe am Rand klebt das Weibchen sodann 100 bis 180 Eier in einem Gelege auf die Blattunterseite. Diese werden vom Wasser benetzt. Die Räupchen entwickeln sich rasch. Wie schnell, das hängt davon ab, wie warm das Wasser im Lauf des Frühsommers wird. Beim Schlüpfen beißen sich die Räupchen durch die Haut der Eier und nagen sich in das Gewebe des Blattes hinein. Ist dieses dick, wie bei Seerosen, fressen sie einfach im Blatt weiter. Sie »minieren«, wie man es auszudrücken pflegt. Aus dünneren Blättern schneiden sie sich bald ein Stückchen heraus und bedecken sich damit. Feinste, im Wasser unlösliche Seidenfäden halten das zunächst nur zwei oder drei Millimeter lange Blattstückchen fest.
Die Raupe wird in diesem Zustand und auch noch im nächsten Stadium nach der ersten Häutung in ihrem Mini-Köcher vom Wasser benetzt. Sie atmet durch die Haut. Die schon angelegten Atemöffnungen mit den Röhrchen (Tracheen), die Luft in den Körper hinein- und das ausgeschiedene Kohlendioxid nach außen abgeben, bleiben in den ersten beiden Raupenstadien geschlossen. Nach der ersten Häutung schneidert sich die Raupe einen richtigen Köcher mit Boden und Deckel. Auch dieser enthält Wasser, und die Raupe atmet weiterhin durch die Haut. Doch wenn sie sich zum dritten Larvenstadium häutet, ändert sich dies. Die aus der alten, zu eng gewordenen Haut geschlüpfte Raupe schimmert nun ganz seidig. Wasser perlt von ihr ab. Sie streckt den Kopf über den Wasserspiegel, und sogleich wird sie von einer silbrig glänzenden Luftschicht eingehüllt. Den neuen Köcher schneidet sie nun so groß bemessen, dass sie sich in diesen ganz zurückziehen kann. Er ist mit Luft gefüllt. Der Raupenkörper bleibt nun zur Verpuppung wasserabweisend. Die Atemöffnungen sind offen. Jetzt verläuft der Austausch der Atemgase auf die normale Weise, aber mit einer bedeutenden Besonderheit: Steigt der Gehalt an Kohlendioxid in der Luftblase, die den Raupenkörper umgibt, tritt ein Teil davon ganz von selbst ins Wasser über. Denn Kohlendioxid löst sich »begierig« im Wasser, wie Chemiker salopp zu sagen pflegen. Den dadurch entstehenden Unterdruck gleich Sauerstoff aus, der in Gegenrichtung aus dem Wasser in die Lufthülle der Raupe eindringt. Sie atmet also teilweise mit einer sogenannten physikalischen Lunge. Notwendig ist das noch nicht, denn ab dem dritten Larvenstadium befrisst die Raupe der Seerosenzünsler die Schwimmblätter von der Oberseite. Dabei nimmt sie deren Wachse auf. Diese bewirken, dass das Blatt nicht auch oberseits von Wasser benetzt wird, sondern schwimmt. Ohne den Wachsbelag würde schon ein gewöhnlicher Regenschauer reichen, die Blätter untergehen zu lassen.
Wie die Raupe unter Wasser atmet
Mit dem Wachs in der Nahrung hängt der Wechsel der Raupen vom benetzbaren zum unbenetzbaren Zustand zusammen. Ausgeschieden wird es auf ganzer Oberfläche des Raupenkörpers, und zwar über winzige, kegelförmige Gebilde, deren Seiten stark gerieft und voll davon sind. Daher schimmert die Raupe im wasserabweisenden Zustand so seidig. Nur der Kopf und sein Ansatz am Körper bekommen keine solche Wachsschicht verpasst. Das ist ganz wichtig, denn wäre auch dieser so Wasser abweisend, könnte die Raupe kaum fressen. Die Oberflächenspannung würde sie beständig vom benetzten Blatt wegdrücken. Der Wechsel von der Haut- zur Luftatmung über das für Insekten typische Röhrensystem, die Tracheen, charakterisiert daher das Raupenleben dieses Wasserschmetterlings. Richtig spannend wird es, wenn die Raupe ausgewachsen und zur Verpuppung bereit ist. Sie kriecht dann nämlich nicht etwa mit ihrem Köcher an Land, was aus Sicht von uns Menschen das Nächstliegende wäre, sondern müht sich mit diesem, der ja prall mit Luft gefüllt ist, gegen den Auftrieb am Stängel von Wasserpflanzen abwärts. In zehn bis dreißig Zentimeter Wassertiefe beißt sie einige kleine Löcher in den Stängel von Laichkraut oder Seerose, an deren Blätter sie gefressen hatte, spinnt über dieser Stelle den Köcher daran fest und wandelt sich darin zur Puppe um. Diese entwindet sich der letzten Raupenhaut innerhalb der Luftblase, die mit eingeschlossen ist, lediglich durch Bewegungen des Hinterleibs.
So ruht sie, bis die innere Verwandlung zum Schmetterling vollzogen ist. Da dieser äußerlich ganz ruhige Vorgang viel Energie benötigt, muss die Puppe atmen, was zu knapper werdender Luft im Puppenköcher führen würde, wenn die Raupe nicht die Luft führenden Röhren der Wasserpflanze angezapft hätte, die eigentlich die Wurzeln mit dem benötigten Sauerstoff versorgen. Aus diesen bekommt die Puppe den Sauerstoff. Da sich das bei der Verwandlung zum Falter entstehende Kohlendioxid im Wasser löst, das den Köcher umgibt, entsteht Unterdruck. Dieser saugt Luft aus dem Pflanzenstängel nach. Anders als die Raupe, die mit ihrem mit Luft gefüllten Köcher entweder ohnehin schon an der Wasseroberfläche schwimmt und die Luft darin direkt erneuen kann, ist die Puppe auf die Versorgung aus der Pflanze angewiesen. Es kann sogar sein, dass die im Wasser grün bleibenden Blattstücke lange genug Photosynthese betreiben, um den dabei entstehenden Sauerstoff in die Luftblase der Raupe abzugeben. Das höchst komplizierte Problem der Atmung eines Lufttieres im Wasser wird also auf unterschiedliche Weise gelöst; eine Anpassungsleistung, über die man nur staunen kann.
Per Luftballon nach oben
Das Eindrucksvollste geschieht, wenn der Schmetterling aus der Puppe schlüpft. Er befindet sich, eingeschlossen im Puppenköcher, ein gutes Stück unter Wasser. Diesen drückt er an der nach oben gerichteten Seite auf. Die entweichende Luftblase reißt ihn mit und treibt den Schmetterling wie einen Luftballon mit angehängter Fracht an die Wasseroberfläche. Dort platzt die Blase. Und Nymphula entsteigt dem See. Ein Belag aus langen Schuppen breitet sich sogleich um den Schmetterling aus. Getragen von der Oberflächenspannung, sucht er mit tastenden Beinbewegungen nach dem nächsten Blatt. Auf dieses kriecht er und pumpt die Flügel auf, bis sie voll entfaltet sind. Das Schlüpfen geschieht oft am Vormittag, aber auch am späten Nachmittag und frühen Abend. Solcherart frisch geschlüpfte Schmetterlinge streben zum Ufer hinein ins Pflanzendickicht, sobald sie fliegen können.
Dort landen sie in einer für sie sehr bezeichnenden Haltung mit dem Kopf nach unten. Vom Wasser her betrachtet, wie auch von oben aus der Sicht der Vögel, die im Röhricht nach Insekten suchen, verbirgt diese Haltung die Körperform. Nur wenn man fast genau aus ihrer Sitzhöhe ins Röhricht schaut, erkennt man sie als Schmetterling. Doch selbst dann erschwert das feine Muster gelblicher Kringel und dunklerer Flecken die optische Erfassung. Im Randbereich des Uferröhrichts bleibt es in heißen Tagen feucht genug, dass die kleinen Körper nicht austrocknen. Für die Männchen ist dies noch wichtiger als für die Weibchen, weil diese gleich nach der Ablage der Eier sterben, während die Männchen oft mehrere Abende, vielleicht eine ganze Woche lang mit Suchflügen auf ihre Chance warten müssen, ein frisch geschlüpftes, zur Paarung bereites Weibchen zu finden.
Nur einmal glückte es mir, den Vorgang des Schlüpfens im Aquarium mitzuerleben. Zwar wusste ich, dass dieser etwa so ablaufen würde, wie sonst könnte der Schmetterling aus dem Köcher unter Wasser an die Oberfläche kommen. Aber als ich es selbst sah, war es doch so, als ob soeben ein Wunder geschehen wäre.
Zur Zeit des Schlüpfens der Puppen ist es Hochsommer geworden. Je nachdem, wie das Frühjahr witterungsmäßig verlief, fliegt die zweite Generation der Seerosenzünsler im Juli oder August, manchmal auch noch Anfang September. Wie geht es dann weiter? Der Winter muss überbrückt werden. Die Lösung dieser Schwierigkeit bringt ein besonderer Einschub in den zweiten Lebenszyklus des Jahres. Die noch vom Wasser benetzten Raupen verwandeln sich im Herbst nicht ins dritte Stadium, das Wasser abweisend sein würde, sondern sie kriechen ohne Köcher die Stängel der Wasserpflanzen hinab bis in mindestens dreißig Zentimeter Wassertiefe. Dort beißen sie ein Loch, so der Stängel dick genug dafür ist, fressen sich eine schmale, sackartige Kammer hinein und ziehen sich in gehstockartig gekrümmter Haltung in diese Höhle im Stängel zurück. So verbringen sie die Wintermonate bis in den April oder bis Anfang Mai, wenn die Wasserpflanzen erneut austreiben. Oben sterben die noch vorhandenen Schwimmblätter ab. Die Raupen überwintern in den Stängeln, auch wenn sich oben Eis bildet.
Die Erwärmung der Tümpel lässt die Wasserpflanzen im Frühjahr erneut treiben. Das einsetzende Wachstum gibt offenbar das Signal für die Räupchen in den Stängeln, dass es an der Zeit ist, aktiv zu werden. Sie verlassen ihre Höhle, kriechen nach oben und befressen die neuen Blätter. Das versorgt sie mit dem nötigen Wachs für die Umwandlung in den Wasser abstoßenden Zustand. Im Mai finden sich dann nur noch solche Raupen, die mit Luft gefüllte Köcher tragen und intensiv die neuen Schwimmblätter befressen, bis sie ausgewachsen und bereit für die Verpuppung sind. Die aus den Puppen schlüpfenden Falter bilden die erste Generation. Ihre Nachkommen entwickeln sich ohne Einschub einer Ruhezeit direkt weiter. Über zwei Fortpflanzungszyklen vollendet sich also der Jahreslauf der »Kleinen Nymphe« Nymphula.
Vom Vorteil, im Wasser zu leben