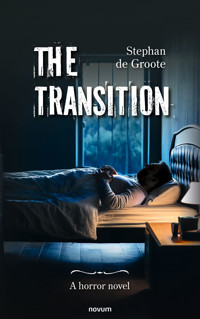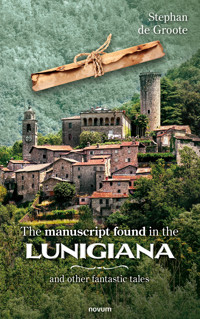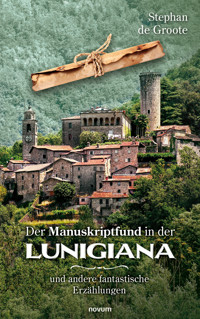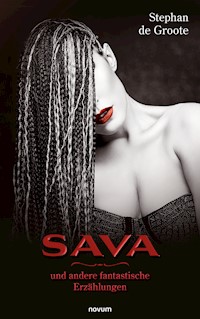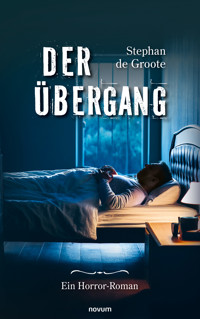
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: novum Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit Motiven des Horror-Genres lässt der Roman das Blut in den Adern gefrieren; eingeschlossen in eine Rahmenhandlung, die auch von Einsamkeit, Verbundenheit und Liebe erzählt. Die Leserinnen und Leser begleiten dabei unseren Freund Rubén d'Aubuisson Hofmann auf seiner Reise in den Wahnsinn. Wird sie doch gut ausgehen oder ist er unrettbar der Verdammnis anheimgefallen? Nichts für schwache Nerven jedenfalls. Sie sind jetzt also gewarnt, was Sie bei der Lektüre erwartet. Den Kaufpreis oder Ihre Gemütsruhe gibt es danach nicht zurück. Von Ironie und Sarkasmus durchzogen ist aber manches. Ernst gemeinte historische Einschübe und Naturbeschreibungen gibt es ebenfalls.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 229
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
© 2025 novum publishing gmbh
Rathausgasse 73, A-7311 Neckenmarkt
ISBN Printausgabe: 978-3-99064-177-4
ISBN e-book: 978-3-99146-968-1
Lektorat: Mag. Eva Reisinger
Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh
www.novumverlag.com
Zitat
Wer könnte für das Grauen empfänglicher sein als Sie?
Der Übergang
Die Geschichte des Chapíns, des Catrachos und der Sorcière
Nach Motiven aus dem „Hexenhammer“ des Dominikanermönchs Heinrich Kramer
Der heute und schon zu seinen Lebzeiten völlig unbekannte honduranische Autor Rubén d’Aubuisson Hofmann (auf dem alten Kontinent von der Polizei gesuchte Glücksritter werden sich in seinem Stammbaum breitgemacht haben) schrieb Anfang der 1920er-Jahre in langen Nächten in seiner Mansardenkammer über der qualmenden Dächersteppe von Paris den Roman „El Traslado“ („Der Übergang“). In einem trüben Arrondissement voller fragwürdiger Existenzen, täglichem Überlebenskampf, lärmiger, verrauchter Tanzlokale, Absinth und mit der kurzen Illusion von gekauftem Glück in schäbigen Absteigen. Wo etliche sich mit zittrigen Händen den ersten Schluck zum Frühstück einschenkten, um für die Herausforderungen des Tages gerüstet zu sein, und Blicke in Spiegel scheuten. Hemingway hätte zwar gesagt, dass er dort in seinem Element ist, aber doch das Ritz vorgezogen. Pittoresk kommt uns das alles heute trotzdem wegen Jean Gabin und gewisser verruchter Chansons vor. Auch wegen der Anarcho-Syndikalisten aus aller Welt, die sich dort tummelten in der sicheren Erwartung einer anbrechenden Revolution, aus der dann jedoch nichts wurde oder allenfalls auf dem Gebiet der freien Liebe. Zu ihnen gehörte d’Aubuisson Hofmann, ganz der Literatur und der magischen Fantasie hingegeben, aber gar nicht oder nur, wenn es kostenlosen Rotwein gab.
Niemand las d’Aubuisson Hofmanns Roman, weder im spanischen Original noch in der von ihm selbst angefertigten französischen Übersetzung, die – man muss es freimütig einräumen, aber das nimmt ihm ja nicht das Allergeringste von seiner Größe – fehlerbehaftet ist. Die Mühsal des Korrekturlesens nahm kein französischer Muttersprachler auf sich, auch sonst niemand. Ein weiterer Ausdruck seiner existenziellen Heimatlosigkeit, in der er gefangen war wie in einem Spinnennetz. Selbst seine Trinkkumpane wandten sich gelangweilt ab und erneut ihren Literflaschen zu, wenn er wieder mal sein Manuskript hervorholte. Dabei gaben sich nicht wenige von ihnen einen intellektuellen Anstrich und etliche waren auch von Übersee an die Ufer der Seine gespült worden. Kein Verleger bequemte sich dazu, das Buch zu veröffentlichen. Nicht einmal für Absagen hielten sie es für würdig. Hierüber beklagte sich d’Aubuisson Hofmann bitter in einem langen verschlungenen Nachwort, das dem Textverständnis der Leserinnen und Leser das Äußerste abverlangt. Er fühlte sich unverstanden und lag damit auch nicht verkehrt. Abgedruckt ist sein Nachwort in dem Buch, das Sie gerade in Ihren Händen halten, nicht, da der Verlag aus Kostengründen darauf bestand, dass seine Druckfassung hundertfünfzig Seiten nicht überschreiten darf, einschließlich des Impressums und der Werbung für das Verlagsprogramm. Den Abdruck nachzuholen, muss späteren, auch kommentierten und mit Anhängen versehenen Editionen vorbehalten bleiben, die es ganz gewiss geben wird. Vielleicht wird man dabei auch mich in der einen oder anderen Fußnote der Erwähnung für würdig erachten. Ich weiß es nicht, überstrahlt doch d’Aubuisson Hofmanns Stern den meiner Beliebigkeit schier unermesslich.
Aus seinem Nachwort geht auch hervor, dass d’Aubuisson Hofmann irgendwann seine Miete nur noch sporadisch bezahlen konnte, nachdem seine Familie in den Tropen, seines in ihren Augen nichtsnutzigen Boheme-Daseins überdrüssig, ihm den Geldhahn endgültig zudrehte, diese Steigbügelhalter und Lakaien der United Fruit Company. Sehr zum Missvergnügen seiner gestrengen Concierge. Aber mit Latino-Charme lässt sich ja manches kompensieren. Auch mit seinem mit Brillantine glatt nach hinten gebürsteten rabenschwarzen Haar, dem nach der Mode seiner Zeit akkurat getrimmten Oberlippenbärtchen, dem herben Geruch nach Rasierwasser und der Nonchalance, mit der er sich eine Zigarette anzuzünden wusste. Stil kann man nicht kaufen, dachte er manchmal mit dem selbstzufriedenen, überheblichen Schnurren eines Katers, der auf die Pirsch geht. Bis ihn dann seine Alltagssorgen wieder einholten.
Kontakt zu Landsleuten suchte er nicht. Darüber war er seit langem hinweg. Es gab ja auch kaum welche in Paris, und er kannte keinen von ihnen. Manchmal kam er sich vor wie ein Wolf, der sich von seinem Rudel entfernt hat und sich jetzt ganz allein den Unbilden des Wetters zu stellen hat. Man konnte ihn einen einsamen Menschen nennen, im Grunde allein zuhause in der Welt seiner Bücher und der fantastischen Literatur.
Seine sonstigen Geschichten, er schrieb ja nach seinem Bekunden beständig, wurden ebenso wenig in irgendeinem Feuilleton oder avantgardistischen Sammelband (nicht mal auf schlechtem Papier und in einer Auflage von gerade mal fünfzig Exemplaren) veröffentlicht, bis er das Porto für deren Einsendung nicht mehr aufbringen konnte. Er mit seinem empfindsamen Gemüt sah sich gezwungen, Tagelöhner-Arbeiten anzunehmen. Lokale auszukehren, Werbung zu verteilen, sich als Weihnachtsmann oder Osterhase zu verkleiden, Türen aufzuhalten, Pissoirs zu säubern, Kotze aufzuwischen, solche Sachen. Wobei er auch noch wegen seines Französischs mit gerollten Zungenspitzen-Rrrs und Nasallauten, von ihm ausgesprochen wie mit triefendem Schnupfen, verspottet und der Lächerlichkeit preisgegeben wurde. Eine Schande für die Grand Nation! Ein vertanes Leben. Ein grandioses!
Leider, was für ein unbeschreiblicher Verlust, sind seine übrigen Erzählungen der Nachwelt wohl nicht erhalten geblieben. Auch bei intensiver Suche nach ihnen in Archiven konnte ich jedenfalls nicht fündig werden. Bekannt sind uns nur die paar Titel, die d’Aubuisson Hofmann in seinem Nachwort erwähnt: „Völlig fehl am Platz“, „Sava“, „Gerettet!“, „Die vielschichtige Nacht“, „Der Manuskriptfund in der Lunigiana“. Ebenso wenig konnte ich zu ihm weitere biografische Details in Erfahrung bringen. Das Internet schweigt sich über ihn aus. Zu ihrem Bedauern teilten mir die zwei, drei d’Aubuissons in Honduras, die ich im Netz ausfindig machen konnte, auf meine beflissenen Anfragen hin mit, dass sie noch nie von ihm gehört haben, aber sich sehr geehrt fühlen. Die wenigen Hofmanns vor Ort schrieb ich nicht an, denn die könnten ja erst 1945 nach Honduras gekommen sein, unter zwielichtigen Begleitumständen. Vielleicht haben sie auch alle irgendwann ihre Schäfchen nach Miami ins Trockene gebracht, wo sie jetzt ein Parasitenleben führen oder umgekehrt als Türsteher von fadenscheinigen Etablissements ihr Dasein fristen. Kennt man ja alles.
Gewiss werden Sie mir beipflichten, dass d’Aubuisson Hofmanns Werk eine zunehmende Tendenz zur Selbstzerstörung und zur Auslöschung von allem durchzieht, und das lässt mich vermuten, dass sie genetisch bedingt, also in seinem Familienerbe angelegt gewesen sein könnte. Düstere Andeutungen von d’Aubuisson Hofmann hier und dort in seinem Buch bestärken mich in dieser Annahme. Ist sein Geschlecht vielleicht mit ihm erloschen wie das des Hauses Usher? Bevor er ihm als Letztes noch mit seinem Roman ein ehrfurchtgebietendes Monument für die Nachwelt setzte? Als hätte sich eine folgenschwere, unheilschwangere Verkündung erfüllt? Das alles zu ergründen, muss ein weites Aufgabengebiet für kommende Generationen von Literaturwissenschaftlern sein. Ich kann hier nur Anstöße für künftige Forschungsprojekte geben. Nicht mehr und nicht weniger. Womöglich wird das auch alles im Dunkeln verharren. D’Aubuisson Hofmann hätte das wohl nicht gewundert.
Nach gegenwärtigem Stand ist uns von ihm nur das Manuskript geblieben, das mir vor einiger Zeit, vergilbt und von Mäusen angefressen, beim Stöbern bei einem Bouquinisten am Seineufer zufällig in die Hände fiel. Oder war es vielleicht gar kein Zufall? Beschleicht Sie nicht auch bisweilen das Gefühl, dass es Bücher gibt, die sich ihre Leserinnen und Leser aussuchen und nicht umgekehrt? Dass sie eine magische Strahlkraft haben, der wir uns nicht entziehen können? Als ob sie leben würden? Geht es Ihnen womöglich auch bei dem Buch so, in dem Sie in diesem Moment versunken sind wie auf dem Meeresgrund? Aber das ist ein weites Feld, das hier nicht weiter vertieft werden soll.
D’Aubuisson Hofmanns Werk zog mich von seinen ersten Zeilen an in seinen Bann, ja, es weckte mein rauschhaftes Interesse. Nicht allein wegen seiner unerreichten Meisterschaft und Sprachkunst, die hierfür wahrlich Gründe mehr als genug gewesen wären. Sondern überdies, weil es in mir Erinnerungen an lange zurückliegende eigene Erlebnisse weckte, die meinen weiteren Lebensweg danach gewiss prägten. Hierauf möchte ich aber an dieser Stelle nicht weiter eingehen. Näheres hierzu wird man meinen nachgelassenen Papieren entnehmen können. Bis ich d’Aubuisson Hofmanns Roman zu Ende gelesen hatte, reagierte ich jedenfalls nicht auf Versuche, mich anzusprechen, auch nicht durch Händeklatschen vor meinen Augen oder mich Zwicken, wie man mir danach glaubwürdig berichtete und mir auch mein absolut vertrauenswürdiger Hausarzt bestätigte. Mein Zustand in jenen denkwürdigen, aufgewühlten Tagen mochte einem unverständigen Betrachter mit ungeschultem Blick wie der eines Zombies angemutet haben. Ob ich dabei Nahrung zu mir nahm oder sie mir zugeführt wurde, vermag ich im Nachhinein nicht zu sagen. Es muss wohl so gewesen sein.
Nachfolgend gebe ich den Roman in den Worten des Autors wieder, in meiner Übersetzung. Manche Textpassagen musste ich dabei mühsam entziffern. Sicherlich, weil seit ihrer Niederschrift mit einer klapprigen Schreibmaschine um die hundert Jahre verstrichen sind, wirken sie verschwommen, so als hätte jemand über ihnen geweint. Rote Flecken von gewiss verschüttetem Rotwein erschwerten ebenfalls das Textverständnis. Von mir vorgenommene ganz geringfügige Änderungen sind dem bisweilen expressionistischen, dem Geschmack seiner Zeit verhafteten Vokabular d’Aubuisson Hofmanns geschuldet, das sich nicht immer nahtlos in heutige Lesegewohnheiten übertragen ließ. So schrieb man in den frühen 1920er-Jahren als Reaktion auf den im Grunde für alle verlorenen Krieg, bevor der Faschismus immer mehr Fahrt annahm und Stiefelknallen und Kraft durch Freude auf den Spielplan gerieten. Aber die weitere Entwicklung gab den Expressionisten ja recht.
D’Aubuisson Hofmann in auch nur einer Handvoll Textstellen ernsthaft zu korrigieren, habe ich mir aber nicht angemaßt. Einige erklärende Anmerkungen indessen, die mir zum besseren Textverständnis für Leserinnen und Leser unserer Zeit erforderlich erschienen, sind als eckige Klammerzusätze […] direkt in den Text eingefügt. Dies ermöglichte auch, insbesondere mit Rücksicht auf die E-Book-Fassung, den Verzicht auf Fußnoten, die den Lesefluss hätten beeinträchtigen können. Wahrscheinliche Fehler gehen dabei allein zu meinen Lasten. Auch meine übersetzerischen Gaben sind begrenzt. Weit gründlichere, überdies kommentierte neue Editionen wird es aber sicherlich geben. Gelehrtenstreit darüber, wie manche Textstellen im Original aufzufassen sind, zweifelsohne ebenfalls. Unumwunden muss ich dabei eingestehen, dass ich bei meiner Übersetzung mitunter vor schier unüberwindlichen Hürden stand. Ich spreche einmal von d’Aubuisson Hofmanns Neigung zur Verwendung von Zentralamerikanismen und Ausdrücken indigener, auch schwarzafrikanischer Herkunft, deren Bedeutung sich mir auch durch Spezial-Wörterbücher und Schriftverkehr mit Fachgelehrten nicht erschloss. Nicht minder gilt dies für d’Aubuisson Hofmanns eigene, dunkle Sprachschöpfungen in magischen, abgründigen Textpassagen. Nicht selten musste ich dabei meine Verständnislücken durch Fantasie und Imagination auszufüllen trachten. Offenkundig absichtsvoll ließ es sich d’Aubuisson Hofmann angelegen sein, über manches eine Art Nebel des Rätselhaften und Unverständlichen zu legen. Ja, man könnte dies geradezu als eines seiner bevorzugten Stilmittel bezeichnen. Vor welche Herausforderungen mich dies als Übersetzer stellte, brauche ich Ihnen gewiss nicht näher darzulegen. Auch d’Aubuisson Hofmann selbst hatte bei der Abfassung seines Werkes schon eine sehr große übersetzerische Aufgabe zu bewältigen. Dazu werden Sie später Eingehenderes erfahren, wenn Sie zum Weiterlesen entschlossen sein sollten. An dieser Stelle sei hierzu nur noch kurz erwähnt, dass bei der Übersetzung einer Übersetzung naturgemäß leicht der Fall eintreten kann, dass am Ende nicht mehr so viel von dem Inhalt des Originals übrig bleibt, ja, er sogar in sein Gegenteil verkehrt sein kann. Übersetzer wissen davon ein Lied zu singen.
Einmal jedoch, in einem Traum, als er über meinen Rücken auf meine Übersetzung linste, klopfte mir d’Aubuisson Hofmann aufmunternd und durchaus auch anerkennend auf die Schulter. Er reckte dabei sogar seinen Daumen nach oben. Ich musste dies als Zeichen werten, auf dem richtigen Weg zu sein. Und als Ansporn, der mich darin bestärkte, in meinen Anstrengungen nicht nachzulassen.
Ich kann bei alldem für mich nur in Anspruch nehmen, der Wegbereiter gewesen zu sein und das Werk der Dunkelheit entrissen zu haben. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ob es ein reines Fantasiekonstrukt ist oder auf wahren Begebenheiten beruht, muss dem verständigen Urteil der geneigten Leserinnen und Leser überlassen bleiben. Auch ob es als düstere Parabel verstanden werden sollte, mit der d’Aubuisson Hofmann spätere weltgeschichtliche Katastrophen voraussah.
Sie werden selbstverständlich Ihre ganz eigenen Leseerfahrungen machen, denen ich unmöglich vorgreifen kann und darf. Ich denke aber, dass sich auch bei Ihnen beim Lesen zunehmend der Gedanke verfestigen wird, dass d’Aubuisson Hofmann in seiner unübertroffenen Sprachgewalt und mit seinem psychologischen Scharfblick wie dem eines Adlers, der Freud studiert hat oder Alfred Adler heißt, gleich zwei Romane auf einmal schrieb: den vordergründigen und den wirklichen. Wie bei einer Unterströmung, die längere Zeit mit dem bloßen Auge nicht wahrnehmbar ist, aber die unter einer spiegelglatten Oberfläche dennoch die See aufwühlt und uns zu einem zunächst ganz unbestimmten Ziel führt, bis wir zunehmend die Realität hinter dem Trugbild des äußeren Scheins erkennen. Und das ist doch die hohe Kunst!
Doch genug der Vorrede! Lassen wir das Manuskript nunmehr für sich selbst sprechen! Schon seine ersten Absätze geben seinen Ton vor.
Dass ich in Varcycourt gewesen bin, steht für mich sicher fest. Aber war das, was ich dort erlebte oder zu erleben vermeinte, Wirklichkeit oder ein Traum, in dem sich das Böse manifestierte? Und bin ich es, der ihn träumte und jetzt zu Papier bringt? Gibt es überhaupt das, was wir „ich“ nennen, oder sind wir nur der Nachtmahr eines übellaunigen Gottes? Unter diesem Vorbehalt muss stehen, wenn im Folgenden von „ich“ und „mir“ die Rede ist. Von jenem Rubén d’Aubuisson Hofmann, der vielleicht ein ganz anderer ist. Oder der gar nicht ist. Ich verdränge diese Gedanken, denn sie kommen mir zu ungeheuerlich vor. Besser, Rotwein zu trinken und das Haar des Wesens zu zerzausen, das neben mir liegt.
In den engen Straßenschluchten hatte eine rabenschwarze Düsterkeit das scheue Tageslicht verdrängt. Die Illumination der Schaufenster und Laternen hatte eine Art Laubengang grellen Lichts geschaffen, in dem Passanten wie flüchtige Schemen in alle Richtungen davonhuschten. Über ihnen hüllten sich die letzten Stockwerke der hohen Häuser in Dunkelheit, und der Himmel war nur noch als Formation dicht zusammengeballter, fliehender Wolken wahrzunehmen. Eine Sturmnacht kündigte sich an. Mit brausendem Wind, der schon jetzt das Rauschen der Menschenmengen und den Autolärm übertönte. Die Luft knisterte, als wollte sie gleich Funken sprühen. Ich schleppte mich nach meinem langen, aber ganz vergeblichen Tagwerk, so ist es immer aufs Neue, müde über die knarrenden Stufen zu meiner Mansardenkammer hinauf, die ich aus Geldmangel bezogen hatte. Das trübe flackernde Gaslicht des Treppenhauses warf meine Schatten gegen die kahlen Wände, manchmal zitterten sie dabei oder ihr Kopf oder andere Körperteile schienen abgeschnitten oder zusammengeschrumpft. Stundenlang konnte ich keinen Schlaf finden. Nicht allein wegen des Sturms, der jetzt orkanartige Stärke angenommen hatte und mit meinen Fensterläden eine wilde Polka tanzte. Ich warf mich in meinem Bett unruhig hin und her. Etwas Unheilschwangeres lag in der Luft. Die Vorahnung von bevorstehendem Verhängnis und nahem Tod. Etwas mich Verschlingendes wie eine schwarze Wolke, die mich umfing. Ich weiß es nicht besser zu sagen.
Liebst du mich? Dann folge mir in die Finsternis!
Der Brief des Chapíns
Da traf es sich, dass mich am folgenden Morgen ein Brief eines entfernten Freundes erreichte, von Ezequiel Sepúlveda Muñoz, einem Guatemalteken schon fortgeschrittenen Alters, dessen Erträge aus geerbten, ausgedehnten Ländereien mit Bananenstauden und wogenden Zuckerrohrfeldern bis zum Horizont (mit Indigenen und Schwarzen, die dort aber gar nicht fröhlich singend die Plantagen bestellten) ihm den Lebensstil eines Grandseigneurs in der französischen Provinz erlaubten. Vielleicht lag es aber auch an irgendwelchen Verwicklungen, die ihn veranlasst hatten, seiner Heimat den Rücken zu kehren, so wie es vielen anderen ebenfalls erging. Unsere Länder spucken etliche von uns aus und nehmen sie nie wieder mit offenen Armen auf wie verlorene Söhne oder Töchter. Sie irren dann durch die Welt wie der fliegende Holländer. Am schmerzhaftesten empfinden sie das, wenn sie nachts keinen Schlaf finden.
Die Karwoche mit ihren Prozessionen im guatemaltekischen Hochland ist für von wo weiß woher Angereiste ein unvergessliches Erlebnis. Die Nachkommen der präkolumbianischen Mayas geißeln sich dabei mit Peitschen bis aufs Blut. Sie schleppen bleischwere Kreuze auf ihrem schier endlosen, qualvollen Weg nach Golgatha. Alles trägt ausgeprägte Züge eines schrecklichen kollektiven Masochismus. Der Untergang der eigenen Kultur wird beweint. Es gibt keinen Hoffnungsschimmer. Unter Wehklagen verwandeln sich Sein Tod und Sein Begräbnis in den Kult des eigenen Todes und der eigenen Bestattung. Der Auslöschung des für sie so unerreichbaren schönen Lebens. Am Ostersonntag dagegen gibt es überhaupt keine Prozessionen mehr. Alles ist so verschlafen wie immer. Die Karwoche der missachteten Nachfahren der vielbewunderten Entdecker der Zahl Null und der visionären, magischen Himmelsstürmer mit ihren aus dem kochenden Dschungel herausstechenden steilen Pyramiden endet ohne Auferstehung.
Der Brief überraschte mich, denn unsere Kontakte, begründet durch gemeinsame oberflächliche Bekannte aus der zentralamerikanischen Diaspora in Paris, waren bis dahin ziemlich sporadischer Natur gewesen. Wenn er mal in Paris weilte, was selten genug vorkam, behagte ihm doch das behäbige, stille Landleben, gefiel es ihm, mit mir durch Künstlerkneipen auf der Rive Gauche zu streifen. Mit dem wohligen Gruseln, das andere in Abnormitätenschauen befällt. Auch wenn er dort mit seinem Monokel, seinem Gehstock und seiner Zigarettenspitze aus Meerschaum gar nicht so fehl am Platz war. In lärmigen Tanzlokalen ebenso wenig. Auch als exotischer Ausländer nicht, von denen es dort ja wimmelte. Seine Wahl war gewiss deswegen auf mich als Begleiter gefallen, weil er bei seinem zurückgezogenen Lebenswandel andere Mittelamerikaner in Paris allenfalls höchst flüchtig kannte. Und weil er sich mit Französisch genauso schwertat wie ich. So gaben wir uns voreinander keine Blöße. Sicherlich lag es aber auch an einer weiteren Gemeinsamkeit, die wir teilten. Die, der parasitären, dekadenten Schichten unserer Länder zu entstammen.
Den Letzten von ihnen töteten die Spanier. So gibt es denn nichts mehr zu berichten. Die Weisheit der Könige ist dahin. Es ist alles vorbei in Quiché, genannt Santa Cruz.
Dass er in sämtlichen Lokalen, wie es seine Art war, generös auftrat und alle Rechnungen ohne mit den Wimpern zu zucken beglich, auch die der Amüsierdamen und Kokotten, denen er mit einer eher väterlichen Attitüde begegnete, die ihnen beileibe nicht missgefällig war, muss ich als feinen, gewinnenden Zug von ihm herausstreichen. Sein großbürgerlicher, kolonialspanischer Habitus war durch Augenzwinkern und Selbstironie abgemildert und damit erträglich. Über seine Heimat sprach er mit mir nie oder nur Unverständliches, das ihm zu viel getrunkener Rotwein zu vorgerückter Stunde eingab. Catracho nannte er mich dann, der Spitzname der Bewohner meines Landes. Eine Verballhornung des Namens von General Florencio Xatruch, sein Leben als posthumer Nationalheld im Honduras des 19. Jahrhunderts im Grunde ein einziger ununterbrochener Putsch und Aufstand. Aber so, wie er es sagte, klang es vertraut und kein bisschen despektierlich. Für mich war er dann der Chapín, wie man die Guatemalteken nach dem Laut chap, chap nennt, der erklingt, wenn hochgestellte Damen mit ihren Stöckelschuhen auf den Pflastersteinen dortiger Kolonialstädtchen lustwandeln, über das geknechtete Volk hinweg.
Natürlich verstand uns dabei kaum jemand. Selbst Lateinamerikaner von anderswo her hatten damit ihre Schwierigkeiten. Vor allem bei Anspielungen in Sätzen, die wir unbeendet lassen konnten, denn die für andere oft diffuse, verschwommene Bedeutung der Wörter kannten wir ja genau. Niemand sonst in unseren Umfeldern. Ein weiteres Bindeglied zwischen uns. Trotz oder vielleicht gerade wegen unseres großen Altersunterschieds, der uns nicht um irgendetwas wetteifern ließ wie junge Heißsporne. Wir konnten auch gemeinsam schweigen. Das können nicht viele. Irgendwie kamen wir beide uns wie Treibgut vor, das an fremden Gestaden angeschwemmt worden war. Ich wusste dennoch sehr wenig über ihn und, wie gesagt, er war ja auch nur äußerst selten in Paris. Umgekehrt erlaubten mir meine eng begrenzten und des Öfteren auch gar nicht vorhandenen Geldmittel keine Reisen in den Süden, zu denen er mich jedes Mal einlud, aber so wie jemand, der das gar nicht ernst meint. Schriftverkehr führten wir nicht, obwohl ich manche Schnorrer-Schreiben versandte. Bei ihm hielten mich Respekt und sicher auch Beschämung davon ab. Dies erklärt gewiss mein Erstaunen, als ich an jenem Tag einen Brief von ihm erhielt.
Wir saßen in weißen Kleidern auf einer Lichtung im Dschungel. Die Nacht war über uns hereingebrochen mit jener übergangslosen Plötzlichkeit, die den Tropen eigen ist. Die Sterne am Firmament blinkten wie Diamanten, die keine Wärme ausstrahlten, sondern die Kälte von Seziermessern. Der vielstimmige Urwald umgab uns. Rauschen, das Hin- und Herwiegen der Bäume wie eine undurchdringliche, aber wabernde Wand, Glühwürmchen wie Irrlichter, das Gekrächze von Papageien und Affen, Laute, die wir keinem Lebewesen zuordnen konnten. Obwohl es mild war – die Hitze und Schwüle des Tages hatte sich in Regenschauern entladen, aber sie hingen noch in der Luft –, fröstelte uns. Wir hielten uns an den Händen. Ein knisterndes Lagerfeuer, die Funken tanzten wie Derwische, spendete Wärme, Flaschen mit selbstgebranntem, hochprozentigem Rum, die von einem zum anderen weitergereicht wurden, noch mehr. Vanhuizen, der dicke holländische Pflanzer, wirkte in sich versunken, als bereitete er sich auf die letzten Minuten seines Lebens vor, und als stellte er sich dabei den Geistern der von seinen Vorfahren Versklavten, sie im stummen Gebet um Vergebung anflehend. Wir begannen, die Trommeln zu schlagen. Erst langsam und wie sich in der Dunkelheit vortastend, dann immer schneller bis zu einem rasenden, entfesselten Rhythmus. Wir sangen afrikanische Lieder mit indigenen Einsprengseln, deren Inhalt nur noch wenige alte, weise Männer und Frauen verstanden, und die hüteten ihr Geheimnis. Aber die Wörter hatten sich uns fest eingebrannt. Sie mussten eine Anrufung sein.
Orisha gigun esin gba ina igbo okun igbàlà ore-ofe Gègè
Touissant, der Schwarze von den Antillen mit seinen hervorstehenden, strahlend weißen Augäpfeln und seinem muskulösen Oberkörper, beträufelte uns mit dem Blut einer Ziege, der er mit seinem Buschmesser die Kehle durchschnitten hatte. Die Polizisten, die Jagd auf uns machten, konnten uns jetzt nichts mehr anhaben. Sie verfolgten uns nur höchst widerstrebend und allein auf massive Drohungen ihrer Vorgesetzten hin, erfüllte sie doch namenloses Grauen vor den Dschungelnächten und ihren Wesen, und konnte auch nur ein einziger falscher Schritt sie nicht in einen Sumpf versinken lassen? Unsere Körper waren unverwundbar für ihre Kugeln geworden. Vanhuizen wand sich plötzlich in Trance auf dem Boden. Wir versuchten, zu ergründen, was der oder die uns sagen wollten, die jetzt aus seinem Munde zu uns sprachen. „Das Grauen, das Grauen!“, waren die einzigen, nasal und gedehnt hervorgestoßenen Worte, die wir verstanden oder zu verstehen meinten. Wir mussten ihm einen Knebel zwischen die Zähne zwängen, denn schon mancher hatte sich in seiner Lage die Zunge abgebissen. Und ein zu Lebzeiten Verstümmelter bleibt das auch nach seinem Flug über den Ozean und seiner Wiedergeburt im magischen Guinée. Dann verstummten wir alle von einem Moment auf den anderen, auch die Tiere des Waldes und sogar der Wind. Wie in gespannter Erwartung auf etwas Unbeschreibliches, die Grenzen des menschlichen Verstandes Sprengendes. Ezilie, die Verlockende, stieg zu uns herab, um sich wieder an dem Blut eines von uns, des von ihr für diese Nacht Auserwählten, zu nähren. Damit er unsterblich werde.
Ezequiels Brief gebe ich nachfolgend wörtlich wieder.
Teurer Freund,
ich hoffe, Du bist wohlauf und hast einen Verleger für Deine Geschichten gefunden. Die Welt muss sie lesen!
Sicherlich wird es Dich überraschen, von mir einen Brief zu erhalten. Und noch weit mehr, wenn Du gleich von meiner inständigen Bitte an Dich liest.
Es liegt mir so fern, Dich beunruhigen zu wollen. Aber ich weiß mir nicht mehr zu helfen. Schwarze Schatten sind in mein Leben getreten wie ein eisiger Luftzug, und sie rücken mir immer näher. Ich muss fürchten, mich ihrer schon bald nicht mehr erwehren zu können, denn meine Kräfte schwinden zunehmend.
Wenn es nur Albträume wären, die mich in der Nacht verfolgen! Sie sind auch zu Wachträumen geworden, die meine Tage wie undurchdringliche Nebelschwaden durchziehen, die mich aufsaugen und verschlingen wollen. Aber ich weiß, dass es keine Traumgespinste sind, die mir meine gewiss angegriffenen Nerven oder meine überhitzte Fantasie vorgaukeln. Alles ist so real wie der Tisch, an dem ich sitze oder das Glas Wasser, das Du trinkst.
Aber wem könnte ich davon erzählen und wen um Rat fragen? Alle würden es als Hirngespinste abtun und mir dringend eine nervenärztliche Behandlung nahelegen. Gut möglich, dass man mich sogar in Gewahrsam nehmen würde, damit ich mir selbst keinen Schaden zufügen kann. Ja, dass man mich entmündigt und in eine Irrenanstalt steckt. Selbst ich kann doch gar nicht die Wesen beschreiben, die mich umringen und nach mir greifen. Oder allenfalls sehr vage, wie etwas, das man in dichtem Dunst oder Dampf nur verschwommen und konturlos zu erkennen vermag.
Fast alle glauben ja nur an das, was sie sehen oder sehen wollen. Sie sind wie kleine Kinder, die sich einreden, das Schreckliche würde verschwinden, wenn sie sich die Bettdecke über den Kopf ziehen und sich die Ohren verstopfen. Dabei steigt es zu ihnen ins Bett, kniet sich auf ihre Brust und schnürt ihnen die Luft ab.
Gewiss wegen unserer gemeinsamen Herkunft aus einem in so vieler Hinsicht magischen Territorium will es mir so erscheinen, dass wir beide mehr von transzendenten, geheimen Übergängen verstehen als fast alle anderen, bis sie plötzlich selbst vor einem stehen und mit unwiderstehlicher Kraft über eine Schwelle gezogen werden, hinter der es kein Zurück mehr gibt.
Aber auch, weil Du einer der nur zwei Freunde bist, die ich bei meinem zurückgezogenen, einst so kontemplativen Lebenswandel in Frankreich habe, der Kontakt zu allen früheren und auch meinen Verwandten in der Heimat ist seit Langem völlig abgebrochen, möchte ich Dich bitten, ja, anflehen, mich für wenigstens ein paar Tage in Varcycourt zu besuchen, um mir in meiner Seelenpein beizustehen.
Wir werden bemüht sein, Dir Deinen Aufenthalt hier so angenehm zu gestalten, wie dies unter den gegebenen Umständen möglich ist. Es wird Dir dort an nichts fehlen. Und um diesen Brief nicht nur düster enden zu lassen: Der Reiz der Landschaft um Varcycourt herum wird Dich entzücken. Nur ich mit meiner besonderen Veranlagung empfinde sie als bedrückend und erstickend. Alle anderen rühmen ihre Schönheit.
Beigefügt findest Du einen Scheck, der Deine Reisekosten sicherlich abdeckt und Dich hoffentlich für Deinen Verdienstausfall und Deine Mühen entschädigt. Wenn nicht, erwartet Dich in Varcycourt sehr viel mehr. Es soll Dein Schaden nicht sein.
Mach Dich, wenn Du Dich dazu entschließen kannst, meinen Wunsch zu erfüllen, aber vielleicht halten Dich unaufschiebbare Verpflichtungen ja davon ab, auf eine lange, beschwerliche Zugfahrt mit Umsteigen-Müssen und längeren Wartezeiten gefasst. Varcycourt ist sehr abgelegen.
Kannst Du mir ein Telegramm schicken, wie auch immer Dein Entschluss ausfällt? Ich werde es Dir gewiss nicht übel nehmen, sondern hätte vollstes Verständnis dafür, wenn Du an einer Reise nach Varcycourt gehindert sein solltest. Zumal nach dem Lesen dieses Schreibens, das gewiss keine Vorfreude auf einen Urlaub aufkommen lässt. Ich weiß, ich weiß, kann aber nicht dagegen an.
Dein Dir sehr ergebener Freund
Ezequiel
Der Brief des Chapíns beunruhigte mich einerseits sehr. Aber ich führte seinen Inhalt auf eine vorübergehende bedrückte Geistesverfassung zurück, wie sie uns bisweilen befällt, und gegen die man etwas durch Gespräche bei ausgedehnten Spaziergängen und Rotwein machen könnte. Zumindest redete ich mir das ein, um nicht in allzu trübe Gedanken zu verfallen. Bei der Langsamkeit der französischen Post waren auch vier, fünf Tage verstrichen, bis das Schreiben mich erreichte, und über so neumodische Dinge wie elektromagnetische Fernsprechübertragungen verfügte ich nicht. Gut möglich, dünkte es mir, dass mich in Varcycourt ein lachender Ezequiel erwarten würde, der es schon bereute, mich eingeladen zu haben. Wie auch immer, ich brauchte nicht zu überlegen. Gewiss aus Besorgnis um meinen Freund, den Chapín. Wirkliche Freunde hatte ich damals im Grunde gar keine anderen. Indes, ich kann es nicht verhehlen, Sie würden es mir ja nicht abnehmen, fraglos auch