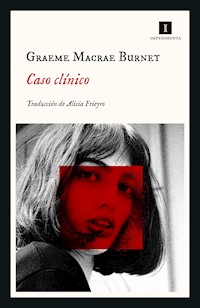Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Europa Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Eigentlich gibt es nichts Außergewöhnliches an dem tödlichen Autounfall auf der A35 unweit des elsässischen Städtchens Saint Louis. Doch eine Frage treibt Kommissar Georges Gorski um: Wo war das Unfallopfer Bertrand Barthelme in der Nacht, in der er mit seinem Wagen frontal gegen einen Baum krachte? Als Barthelmes Spuren zu einer jungen Prostituierten in Straßburg führen, die just in jener Nacht erdrosselt wurde, ist der kauzige Provinzkommissar alarmiert. Schnell verstrickt sich Gorski in einem mysteriösen Rätsel um den Toten, das tief hinter die harmlose Fassade der verschlafen wirkenden Kleinstadt Saint Louis blicken lässt. Und auch Barthelmes Sohn Raymond beginnt dem Geheimnis seines verstorbenen Vaters nachzuspüren, das die wohlgeordnete Welt des 17-Jährigen schon bald gehörig ins Wanken bringt … Bestsellerautor Graeme Macrae Burnet meldet sich mit einem außergewöhnlichen literarischen Kriminalroman zurück, der die Fans von Sein blutiges Projekt und Das Verschwinden der Adèle Bedeau begeistern wird. Gewohnt raffiniert und voller schwarzem Humor blickt er in Der Unfall auf der A35 erneut tief in die Psyche seiner Charaktere und spürt den dunklen Seiten des elsässischen Kleinstadtlebens nach. Ein meisterhafter Kriminalroman, der das Genre ebenso geschickt wie sprachlich brillant neu erfindet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 398
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DerUnfallauf derA35
von Raymond Brunet
Übersetzt und kommentiert vonGraeme Macrae Burnet
Die englischsprachige Originalausgabe ist 2017 unter dem TitelThe Accident on the A35 bei Contraband, einem Imprint von Saraband,Glasgow, Schottland, erschienen.
AUS DEM ENGLISCHEN VON CLAUDIA FELDMANN
1. eBook-Ausgabe 2018© 2017 by Graeme Macrae Burnet © der deutschsprachigen Ausgabe 2018 EuropaVerlag GmbH & Co. KG, München
Umschlaggestaltung und Motiv: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich
Übersetzung: Claudia Feldmann
Layout und Satz: BuchHaus Robert Gigler, München
Konvertierung: Bookwire
ePub-ISBN: 978-3-95890-204-6ePDF-ISBN: 978-3-95890-205-3
Das eBook einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Alle Rechte vorbehalten.
www.europa-verlag.com
INHALT
Vorwort
Der Unfall auf der A35
Nachwort
Danksagung
VORWORT
Am 20. November 2014 wurde per Kurier ein Paket bei den Éditions Gaspard-Moreau in der Rue Mouffetard in Paris abgegeben, adressiert an Georges Pires, Raymond Brunets früheren Lektor. Pires war neun Jahre zuvor einem Krebsleiden erlegen, und so wurde das Paket stattdessen von einem jungen Volontär geöffnet. Es enthielt zwei Manuskripte sowie einen Brief von einer Anwaltskanzlei aus Mülhausen, in dem stand, dass man sie angewiesen habe, die beigefügten Dokumente nach dem Tod von Brunets Mutter an den Verlag zu senden.
Brunet, von dem bisher nur ein Roman veröffentlicht worden war – Das Verschwinden der Adèle Bedeau –, hatte sich 1992 im Bahnhof von Saint-Louis vor einen Zug geworfen. Marie Brunet, die ihren Sohn um zweiundzwanzig Jahre überlebt hatte, war zwei Tage vor der Auslieferung des Pakets im Alter von vierundachtzig Jahren im Schlaf verstorben.
Trotz – oder vielleicht gerade wegen – der anachronistischen Art der Einreichung ahnte der Volontär, der 1982, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von Brunets Roman, noch gar nicht geboren war, nichts von der Bedeutung des Inhalts. Die Manuskripte wurden behandelt wie die meisten anderen und landeten in der Schundecke des Verlags. Erst vier Monate später erkannte eine der älteren Mitarbeiterinnen bei Gaspard-Moreau, was für ein Schatz da im Regal schlummerte. Was Sie jetzt in den Händen halten, ist das erste dieser beiden Manuskripte: L’Accident sur l’A35.
Der Entschluss zur Veröffentlichung wurde nicht übereilt getroffen. Zunächst musste sichergestellt werden, dass Gaspard-Moreau nicht Opfer eines Betrugs geworden war. Doch es stellte sich sehr schnell heraus, dass Brunet die beiden Manuskripte in der Tat kurz vor seinem Selbstmord bei einem Anwalt hinterlegt hatte. Dieser Anwalt, Jean-Claude Lussac, war zwar längst im Ruhestand, aber er erinnerte sich noch gut an den Fall und hatte als einziger Mitwisser die Gerüchte um die Existenz weiterer unveröffentlichter Werke, die nach Brunets Selbstmord kursierten, mit einer Mischung aus Erheiterung und schlechtem Gewissen verfolgt. Ein einfacher Test bewies, dass die Manuskripte auf der Schreibmaschine verfasst worden waren, die immer noch auf dem Schreibtisch im einstigen Arbeitszimmer von Brunets Vater im Haus der Familie in Saint-Louis stand. Doch solche Beweise sind vollkommen überflüssig. Selbst ein beiläufiger Leser wird sofort erkennen, dass Stil, Milieu und thematische Ausrichtung von Der Unfall auf der A35 exakt denen von Brunets erstem Buch entsprechen. Und wer dieses Werk als Schlüsselroman liest, wird verstehen, weshalb Brunet nicht wollte, dass es zu Lebzeiten seiner Mutter erschien.
Graeme Macrae Burnet, April 2017
Was ich soeben geschrieben habe,ist falsch. Ist richtig.Ist weder falsch noch richtig.
Jean-Paul Sartre, Die Wörter
1
An dem Unfall auf der A35 schien absolut nichts ungewöhnlich zu sein. Er geschah an einem vollkommen unspektakulären Streckenabschnitt zwischen Straßburg und Saint-Louis. Ein dunkelgrüner Mercedes Kombi, der in südlicher Richtung unterwegs war, kam von der Fahrbahn ab, schlitterte die Böschung hinunter und knallte gegen einen Baum am Rande eines Wäldchens. Gemeldet wurde der Unfall um 22.45 Uhr, aber da der Wagen von der Straße aus nicht sofort zu sehen war, ließ sich nicht mit Sicherheit feststellen, wann sich der Unfall ereignet hatte. Auf jeden Fall war der einzige Insasse bereits tot, als der Wagen gefunden wurde.
Georges Gorski von der Polizei in Saint-Louis stand auf dem grasbewachsenen Seitenstreifen der Straße. Es war November. Nieselregen überzog die Fahrbahn. Es gab keine Reifenspuren. Die naheliegendste Erklärung war, dass der Fahrer einfach am Steuer eingenickt war. Selbst bei einem Herzinfarkt versuchte ein Fahrer meistens noch, auf die Bremse zu treten oder den Wagen irgendwie unter Kontrolle zu bringen. Dennoch beschloss Gorski, erst einmal alle Möglichkeiten in Betracht zu ziehen. Sein Vorgänger Jules Ribéry hatte ihn stets ermahnt, auf seinen Instinkt zu hören. Fälle löst man hiermit, nicht damit, hatte er oft gesagt und dabei zuerst auf seinen Bauch und dann auf seinen Kopf gezeigt. Doch Gorski war skeptisch, was diese Herangehensweise betraf. Sie ermunterte den ermittelnden Beamten, Details außer Acht zu lassen, die nicht zu seiner Ausgangshypothese passten. Gorski hingegen zog es vor, jedem Detail erst einmal die gleiche Beachtung zu schenken. Ribérys Vorgehensweise war eher dem Wunsch entsprungen, es sich bereits nachmittags in einer der Bars von Saint-Louis gemütlich zu machen. Dennoch lag angesichts dessen, was Gorski nun vor sich sah, die Vermutung nahe, dass er nicht allzu lange nach alternativen Theorien suchen musste.
Als er an der Unfallstelle ankam, war diese bereits abgesperrt worden. Ein Fotograf machte Aufnahmen von dem zerbeulten Wagen. Immer wieder ließ der Blitz die umstehenden Bäume aufleuchten. Ein Rettungswagen und mehrere Streifenwagen mit Blaulicht blockierten die Fahrbahn Richtung Süden. Zwei gelangweilte Gendarmen regelten den spärlichen Verkehr.
Gorski trat seine Zigarette am Straßenrand aus und kletterte die Böschung hinunter. Das tat er nicht so sehr deshalb, weil er glaubte, die Begutachtung der Unfallstelle könne ihm irgendwelche neuen Erkenntnisse zum Unfallhergang liefern, sondern nur, weil es zu seinen Aufgaben gehörte. Diejenigen, die um das Fahrzeug herumstanden, warteten auf sein Urteil. Der Leichnam durfte nicht aus dem Wagen geholt werden, bis der ermittelnde Beamte die Erlaubnis dazu gab. Hätte sich der Unfall nur ein paar Kilometer weiter nördlich ereignet, wäre er unter die Zuständigkeit der Mülhausener Polizei gefallen. Während Gorski den Abhang hinunterbalancierte, war ihm bewusst, dass alle, die unten beim Wäldchen standen, zu ihm herübersahen. Das Gras war rutschig vom abendlichen Regen, und seine dünnen Lederslipper waren denkbar ungeeignet für so einen Einsatz. Um nicht das Gleichgewicht zu verlieren, musste er in einen leichten Laufschritt verfallen, und unten stieß er mit einem jungen Gendarmen zusammen, der eine Taschenlampe hielt. Er hörte unterdrücktes Lachen.
Langsam umrundete Gorski das Auto. Der Fotograf unterbrach seine Arbeit und trat zurück, um ihm den Blick freizugeben. Der Fahrer des Wagens war beim Aufprall mit Kopf und Schultern durch die Windschutzscheibe geschleudert worden. Die Arme hingen neben dem Rumpf herab, was darauf hindeutete, dass er nicht versucht hatte, sich zu schützen. Sein Kopf lag auf der zusammengedrückten Motorhaube. Der Mann hatte einen grauen Vollbart, aber davon abgesehen, konnte Gorski kaum etwas von seinem Äußeren erkennen, da das Gesicht – oder zumindest der Teil, den man sehen konnte –, völlig zerschmettert war. Die Haare klebten nass auf den Überresten der Stirn. Gorski ging weiter um den Mercedes herum. Der Lack auf der Fahrerseite war stark zerkratzt, was vermuten ließ, dass der Wagen auf der Seite liegend die Böschung hinuntergerutscht war und sich erst unten wieder aufgerichtet hatte. Gorski blieb stehen und strich mit den Fingern über das verbeulte Metall, als hoffe er, dass es mit ihm sprechen würde. Doch das tat es nicht. Und als er nun sein Notizbuch aus der Innentasche seines Jacketts nahm und ein paar Worte hineinschrieb, tat er es nur, um die Männer, die um ihn herumstanden und ihn beobachteten, zufriedenzustellen. Die Kollegen von der Unfallermittlung würden zu gegebener Zeit die Unfallursache feststellen. Dazu war keine geniale Eingebung nötig, weder von Gorski noch von irgendjemandem sonst.
Die Beifahrertür hatte sich durch den Aufprall ein Stück geöffnet. Gorski zog sie ein wenig weiter auf und griff in die Innentasche des Mantels, der neben dem Verunglückten auf dem Sitz lag. Er bedeutete dem Einsatzleiter, dass er mit seiner Untersuchung fertig war, und kletterte die Böschung wieder hinauf. Als er in seinem Auto saß, zündete er sich eine neue Zigarette an und klappte die Brieftasche des Unfallopfers auf. Der Tote hieß Bertrand Barthelme, wohnhaft in der Rue des Bois 14, Saint-Louis.
Die Adresse gehörte zu einer der großen Villen am Nordrand der Stadt. Saint-Louis war eine unbedeutende Kleinstadt im sogenannten Dreyeckland, wo Deutschland, Frankreich und die Schweiz aneinandergrenzten. Die rund zwanzigtausend Einwohner ließen sich in drei Gruppen unterteilen: diejenigen, die keinerlei Ehrgeiz hatten, an einem weniger tristen Ort zu leben; diejenigen, denen dazu die Mittel fehlten; und diejenigen, denen es dort aus unerfindlichen Gründen gefiel. Obwohl die Stadt nicht viel vorzuweisen hatte, gab es ein paar Familien, die auf die eine oder andere Weise zu Vermögen gekommen waren, zumindest für dortige Verhältnisse. Ihre Häuser standen nie zum Verkauf. Sie wurden von Generation zu Generation weitergegeben wie in ärmeren Familien Eheringe oder Möbelstücke.
In der Rue des Bois angekommen, parkte Gorski am Straßenrand und zündete sich eine Zigarette an. Das Haus war hinter großen Platanen verborgen. Es war eine von jenen Straßen, in denen ein spätabends abgestellter, fremder Wagen umgehend einen Anruf bei der Polizei auslöste. Gorski hätte die unerquickliche Aufgabe, die Angehörigen zu informieren, ohne weiteres an einen seiner Untergebenen delegieren können, aber er wollte nicht den Eindruck erwecken, dieser Aufgabe nicht gewachsen zu sein. Doch es gab noch einen zweiten, weniger ehrbaren Grund, den sich Gorski selbst kaum eingestehen mochte: Er war wegen der Adresse des Verstorbenen persönlich gekommen. Hätte der Tote aus einem weniger wohlhabenden Viertel der Stadt gestammt, hätte er kaum Bedenken gehabt, einen Beamten niederen Ranges zu schicken. Tatsächlich glaubte er, dass die Leute, die an der Rue des Bois wohnten, das Recht hatten, vom höchsten Gesetzesvertreter der Stadt informiert zu werden. Das erwarteten sie, und wenn Gorski dies nicht persönlich übernahm, würde später darüber getuschelt werden.
Kurz erwog er, die Aufgabe auf den nächsten Morgen zu verschieben – es war schon fast Mitternacht –, doch die späte Stunde bot keinen hinreichenden Vorwand. Schließlich hätte er keinerlei Bedenken, eine Familie in den schäbigen Mietshäusern am Place de la Gare zu jeder beliebigen Tages- und Nachtzeit zu stören. Außerdem konnte es sein, dass die Familie Barthelme in der Zwischenzeit über eine andere Quelle von dem Unfall erfuhr.
Gorski ging knirschend die kiesbestreute Einfahrt hinauf. Wie immer, wenn er sich solchen Häusern näherte, kam er sich wie ein Eindringling vor. Falls ihn jemand fragte, was er hier wollte, würde er sich garantiert erst entschuldigen, bevor er den Ausweis hervorholte, der seine Anwesenheit rechtfertigte. Er erinnerte sich an die Panik früher in seinem Elternhaus, wenn ein unangemeldeter Besucher kam. Seine Eltern wechselten alarmierte Blicke. Seine Mutter sah sich im Zimmer um und strich hastig die Kissen und Schonbezüge glatt, bevor sie die Tür öffnete. Sein Vater zog rasch das Jackett über und richtete sich auf, als wäre es ihm peinlich, in seinem eigenen Zuhause entspannt im Sessel zu sitzen. Eines Abends, als Gorski sieben oder acht gewesen war, klingelten zwei junge Mormonen, die vor Kurzem in die Stadt gezogen waren, bei ihnen an der Wohnung, die über dem Pfandleihhaus seines Vaters lag. Gorski hörte, wie die beiden in gebrochenem Französisch den Anlass ihres Besuchs darlegten. Seine Mutter bat sie in das kleine Wohnzimmer. Albert Gorski stand hinter seinem Stuhl, als erwarte er den Bürgermeister höchstpersönlich. Gorski selbst saß unter dem Fenster auf dem Boden und blätterte in einem Bilderbuch. Für seine kindlichen Augen sahen die beiden Amerikaner genau gleich aus: groß und blond, mit militärisch kurzem Haarschnitt und eng sitzendem dunkelblauem Anzug. Sie blieben im Türrahmen stehen, bis Mme Gorski sie zu den Stühlen am Tisch führte, an dem die Familie ihre Mahlzeiten einnahm. Die beiden wirkten kein bisschen befangen. Mme Gorski bot ihnen Kaffee an, was sie nicht ablehnten. Während sie sich in der schmalen Küche zu schaffen machte, stellten sich die beiden Besucher M. Gorski vor, der lediglich nickte und wieder Platz nahm. Die jungen Männer machten ein paar Bemerkungen darüber, wie ansprechend sie Saint-Louis fanden. Als Gorskis Vater darauf nicht antwortete, breitete sich Stille aus, die andauerte, bis Mme Gorski mit einem Tablett aus der Küche zurückkam, auf dem eine Kanne, die guten Porzellantassen und ein Teller mit Madeleines standen. Sie plauderte munter drauflos, während sie den Besuchern Kaffee servierte, doch es war offensichtlich, dass die beiden kaum etwas von ihrem Monolog verstanden. Für gewöhnlich tranken die Gorskis abends keinen Kaffee. Nachdem diese Förmlichkeiten beendet waren, deutete der junge Mann, der links saß, nach einem aufmerksamen Blick durch das Wohnzimmer auf die Mesusa, die am Türrahmen hing.
»Wie ich sehe, sind Sie Anhänger des jüdischen Glaubens«, sagte er. »Aber mein Kollege und ich würden Ihnen gerne die Botschaft unseres Glaubens vermitteln.«
Es war das erste Mal, dass Gorski eine solche Bemerkung über seine Familie hörte. Religion wurde im Haushalt der Gorskis nie erwähnt und erst recht nicht praktiziert. Die kleine Schriftkapsel am Türrahmen war einfach nur eines von vielen Zierstücken im Raum, die seine Mutter jede Woche abstaubte. Sie hatte keine besondere Bedeutung, oder falls doch, wusste Gorski nichts davon. Er wusste nicht einmal, was der Ausdruck »Anhänger des jüdischen Glaubens« bedeutete, abgesehen davon, dass sie – die Gorskis –, anders waren. Gorski war empört, dass diese Fremden so mit seinem Vater sprachen. Er erinnerte sich nicht an den Rest des Gesprächs, nur noch daran, dass sein Vater, nachdem die Amerikaner das Gebäck seiner Mutter gegessen hatten, die Unterlagen entgegennahm, die sie ihm in die Hand drückten, und ihnen versicherte, er werde sie sich aufmerksam durchlesen. Diese Antwort schien die jungen Männer zu freuen, und sie sagten, sie kämen gerne noch einmal vorbei. Sie dankten Mme Gorski für ihre Gastfreundschaft und gingen. Ihre Kaffeetassen standen unberührt auf dem Tisch. Mme Gorski bemerkte, was für nette junge Männer das doch gewesen seien. M. Gorski blätterte ungefähr eine halbe Stunde in den Unterlagen, die die Amerikaner ihm gegeben hatten, als sei es unhöflich, sie direkt wegzuwerfen. Nach dem Tod seines Vaters fand Gorski sie in der Holzkiste unter dem Fenster, in der wichtige Papiere aufbewahrt wurden.
Gorski wollte gerade ein zweites Mal an der Tür in der Rue des Bois klingeln, als in der Eingangshalle das Licht anging und ein Schlüssel im Schloss umgedreht wurde. Eine stämmige Frau um die sechzig öffnete die Tür. Ihr graues Haar war im Nacken zu einem Knoten gebunden, und sie trug ein Kleid aus dunkelblauer Wolle, das ein wenig zu eng saß. Um ihren Hals hing eine Brille an einem Lederband und ein kleines Kreuz, das sich an ihren Brustansatz schmiegte. Sie hatte kräftige, geradezu männliche Knöchel und trug braune Schnürschuhe. Es sah nicht so aus, als hätte sie sich hastig angezogen, um an die Tür zu gehen. Vielleicht endeten ihre Pflichten erst, wenn der Herr des Hauses zurückgekehrt war. Gorski stellte sich vor, wie sie in ihrem Zimmer saß und bedächtig eine Patience legte, eine brennende Zigarette neben sich im Aschenbecher. Sie musterte Gorski mit jenem Ausdruck verhaltener Abscheu, den er seit Langem gewohnt war und von dem er sich nicht mehr irritieren ließ.
»Guten Abend, Madame«, begann er. »Kommissar Georges Gorski von der hiesigen Polizei.« Er zeigte ihr seinen Ausweis, den er bereits in der Hand gehalten hatte.
»Madame Barthelme hat sich schon zur Nacht zurückgezogen«, erwiderte die Frau. »Bitte seien Sie so gut und kommen Sie zu einer passenderen Tageszeit wieder.«
Gorski widerstand dem Drang, sich für die Störung zu entschuldigen. »Das ist kein gesellschaftlicher Besuch«, sagte er.
Die Frau zog die Augenbrauen hoch und schüttelte leicht den Kopf. Dann setzte sie ihre Brille auf und bat um Gorskis Ausweis. »Was gibt es denn, dass Sie um diese Zeit unbescholtene Leute stören müssen?«
Schon jetzt war Gorski diese wichtigtuerische Person zutiefst unsympathisch. Anscheinend glaubte sie, ihr Status als Wächterin dieses Haushalts verleihe ihr besondere Autorität. Er rief sich ins Gedächtnis, dass sie nichts weiter war als eine Bedienstete.
»Offensichtlich etwas Wichtiges, sonst würde ich nicht um diese Zeit kommen«, entgegnete er. »Wenn Sie jetzt bitte so freundlich wären …«
Die Haushälterin trat von der Haustür zurück und ließ ihn widerstrebend in die riesige holzvertäfelte Eingangshalle. Die Eichentüren der Zimmer im ersten Stock führten zu einem Treppenabsatz, der von einem geschnitzten Geländer eingefasst wurde. Sie ging die Treppe hinauf, wobei sie sich schwer auf den Handlauf stützte, und betrat ein Zimmer zur Linken. Gorski wartete in der dämmrigen Halle. Im Haus war es still. Unter einer geschlossenen Tür auf der rechten Seite des Treppenabsatzes schien ein schmaler Lichtstreifen hindurch. Wenig später kam die Haushälterin wieder herunter. Sie bewegte sich humpelnd und führte das rechte Bein im Bogen, als hätte sie Schmerzen in der Hüfte.
Mme Barthelme, teilte sie ihm mit, würde ihn in ihrem Zimmer empfangen. Gorski war davon ausgegangen, dass die Hausherrin ihn in einen der unteren Räume bitten würde. Die Vorstellung, eine Frau in ihrem Schlafzimmer über den Tod ihres Mannes zu unterrichten, erschien ihm ein wenig anstößig. Doch was blieb ihm anderes übrig? Er folgte der Haushälterin nach oben. Sie wies auf die Tür und ließ ihn vorgehen.
Angesichts des Alters des Verstorbenen hatte Gorski erwartet, eine ältere Frau vorzufinden, die auf einen Haufen bestickter Kissen gestützt war. Laut seinem Führerschein war Barthelme neunundfünfzig gewesen, doch selbst bei der oberflächlichen Begutachtung, die Gorski vorgenommen hatte, war ihm der Mann älter vorgekommen. Sein Bart war dicht und grau und der Schnitt seines dreiteiligen Anzugs altmodisch. Mme Barthelme hingegen war sicher höchstens vierzig, vielleicht sogar jünger. Ihr üppiges hellbraunes Haar war nachlässig hochgesteckt, und ein paar einzelne Locken umrahmten ihr herzförmiges Gesicht. Sie hatte sich einen leichten Schal um die Schultern gelegt, wohl um den Anstand zu wahren, doch ihr Nachthemd war am Ausschnitt so locker zusammengebunden, dass Gorski sich Mühe geben musste, daran vorbeizuschauen. Das Zimmer gehörte eindeutig einer Frau. Es gab eine kunstvoll verzierte Frisierkommode und eine mit Kleidern übersäte Chaiselongue. Der Nachttisch war voll kleiner brauner Tablettenfläschchen. Nichts wies auf die Anwesenheit eines Mannes hin. Offensichtlich hatte das Paar getrennte Schlafzimmer. Mme Barthelme lächelte liebenswürdig und entschuldigte sich dafür, dass sie Gorski im Bett liegend empfing.
»Ich fühle mich leider ein bisschen …« Sie beendete den Satz mit einer vagen Geste ihrer Hand, was ihre Brüste unter dem dünnen Stoff des Nachthemds in Bewegung versetzte.
Für einen Moment vergaß Gorski den Anlass seines Besuchs.
»Thérèse hat mir Ihren Namen nicht genannt«, sagte sie.
»Gorski«, erwiderte er. »Kommissar Gorski.« Beinahe hätte er hinzugefügt, dass sein Vorname Georges war.
»Gibt es denn so viele Verbrechen in Saint-Louis, dass wir einen Kommissar brauchen?«
»Gerade genug.« Normalerweise hätte sich Gorski über eine solche Bemerkung geärgert, aber so, wie Mme Barthelme es sagte, klang es wie ein Kompliment.
Er stand auf halbem Weg zwischen Tür und Bett. Vor der Frisierkommode war ein Stuhl, aber es schickte sich nicht, so eine ernste Nachricht im Sitzen zu überbringen. Die Haushälterin wartete an der Tür. Es gab keinen Grund, weshalb sie nicht dabei sein sollte, doch Gorski wollte seine Autorität bekräftigen, und so drehte er sich um und sagte: »Bitte lassen Sie uns einen Moment allein, Thérèse.«
Die Haushälterin gab sich keine Mühe, ihre Missbilligung zu verbergen, doch nachdem sie demonstrativ die Kissen auf der Chaiselongue zurechtgerückt hatte, verließ sie das Zimmer.
»Und schließen Sie die Tür hinter sich«, fügte Gorski hinzu.
Er schwieg einen Augenblick und setzte eine angemessen ernste Miene auf. »Es tut mir leid, aber ich habe schlechte Nachrichten, Madame Barthelme.«
»Bitte nennen Sie mich Lucette. Sonst komme ich mir vor wie eine alte Jungfer«, erwiderte sie. Der Rest seines Satzes schien keinen Eindruck bei ihr hinterlassen zu haben.
Gorski nickte. »Es hat einen Unfall gegeben«, sagte er. Er sah keinen Sinn darin, um den heißen Brei herumzureden. »Ihr Mann ist tot.«
»Tot?«
Das sagten sie alle. Gorski maß den Reaktionen der Leute, wenn sie von so einer Nachricht erfuhren, keinen besonderen Wert bei. Würde bei ihm zu später Stunde ein Polizist vor der Tür stehen, wäre ihm klar, dass es sich nur um eine schlechte Nachricht handeln konnte. Doch dieser Gedanke schien Zivilisten nicht in den Sinn zu kommen, und im ersten Moment reagierten sie meist mit Unglauben.
»Sein Wagen ist von der A35 abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Er war sofort tot. Es ist ungefähr vor einer Stunde passiert.«
Mme Barthelme stieß einen matten Seufzer aus.
»Nach unserem ersten Eindruck deutet alles darauf hin, dass er am Steuer eingenickt ist. Aber es wird natürlich eine umfassende Untersuchung geben.«
Mme Barthelmes Gesichtsausdruck veränderte sich kaum. Sie wandte den Blick von Gorski ab. Ihre Augen waren blassblau, beinahe grau. Ihre Reaktion war nicht ungewöhnlich. Die Leute stießen in der Regel keine entsetzten Schreie aus, fielen nicht in Ohnmacht und bekamen auch keine Wutanfälle. Dennoch war es eigentümlich, dass sie so gar keine Regung zeigte. Ihr Blick wanderte zu den Tablettenfläschchen auf dem Nachttisch. Vielleicht hatte sie Valium oder irgendein anderes Beruhigungsmittel genommen. Gorski ließ ihr noch ein wenig Zeit. Dann zuckte sie ein wenig zusammen, als hätte sie vergessen, dass er da war.
»Ich verstehe«, sagte sie. Sie hob die Hand und strich sich geistesabwesend eine Locke aus dem Gesicht. Sie war wirklich bezaubernd.
»Möchten Sie ein Glas Wasser?«, fragte er. »Oder vielleicht einen Brandy?«
Sie lächelte, genauso wie in dem Moment, als er das Zimmer betreten hatte. Gorski begann sich zu fragen, ob sie seine Nachricht überhaupt verstanden hatte.
»Nein, danke. Sie sind sehr freundlich.«
Gorski deutete eine knappe Verneigung an. »Ist außer der Haushälterin sonst noch jemand hier?«
»Nur unser Sohn Raymond«, sagte sie. »Er ist in seinem Zimmer.«
»Möchten Sie, dass ich es ihm sage?«
Dieses Angebot schien Mme Barthelme zu überraschen. »Ja, das wäre sehr nett von Ihnen.«
Gorski nickte. Er hatte nicht damit gerechnet, die Nachricht zweimal überbringen zu müssen. In Gedanken war er bereits bei dem Bier gewesen, das er noch im Le Pot trinken wollte. Er widerstand dem Drang, auf die Uhr zu sehen, und hoffte, dass Yves noch nicht geschlossen hatte, wenn er dort ankam. Dann wies er noch darauf hin, dass der Leichnam offiziell identifiziert werden musste. »Wir schicken Ihnen morgen früh einen Wagen«, sagte er.
Mme Barthelme nickte. Sie erklärte ihm, wo das Zimmer ihres Sohns war. Und damit hatte es sich.
Die Haushälterin saß auf einer gepolsterten Bank neben der Tür. Gorski nahm an, dass sie alles gehört hatte.
2
Raymond Barthelme saß auf einem Stuhl in der Mitte seines Zimmers und las Zeit der Reife von Jean-Paul Satre. Das einzige Licht im Raum kam von der Lampe auf dem Schreibtisch, der am Fenster stand. Außer dem Bett gab es noch ein abgewetztes Samtsofa, doch Raymond zog den Holzstuhl vor. Wenn er in einer bequemeren Position zu lesen versuchte, schweiften seine Gedanken immer wieder von den Worten auf der Seite ab. Außerdem hatte sein Freund Stéphane ihm erzählt, dass Sartre selbst auch immer auf einem einfachen Stuhl gesessen hatte, wenn er las. Er war wieder einmal bei dem Kapitel, in dem sich Ivich und Mathieu im Nachtclub Sumatra die Hände aufschlitzen. Die Vorstellung, dass eine Frau sich einfach so mit einem Messer in die Handfläche schnitt, faszinierte Raymond. Zum x-ten Mal las er: Ihr Fleisch war vom Daumenballen bis zur Wurzel des kleinen Fingers offen, das Blut quoll heraus. Und ihr Freund eilte ihr keineswegs zu Hilfe, sondern nahm das Messer und rammte es durch seine eigene Hand in den Tisch. Das Beeindruckendste an der Szene waren jedoch nicht die blutigen Taten selbst, sondern der Satz, der darauf folgte: Der Kellner hatte schon ganz andere Sachen erlebt.
Als das Paar anschließend zum Waschraum ging, verband die Garderobiere ihnen einfach nur die Hände und schickte sie fort. Wen kümmerte es schon, dass sie sich selbst verletzt hatten? Raymond sehnte sich danach, an einem Ort wie dem Sumatra zu sein, unter Leuten, die ihre Hand mit einem Messer an den Tisch nagelten. Aber so einen Club gab es in einem Kaff wie Saint-Louis natürlich nicht. Hier gab es nur gesittete Cafés, in denen man von Frauen mittleren Alters bedient wurde, die nach den Eltern fragten und denen Raymond stets mit vollendeter Höflichkeit begegnete. Raymond wusste nicht, was er von der Szene halten sollte. Er hatte schon ausführlich mit Yvette und Stéphane darüber diskutiert, an ihrem Stammtisch im Café des Vosges. Stéphane war ganz nüchtern an die Passage herangegangen (er hatte auf alles eine Antwort): »Das ist ein acte gratuit, alter Knabe«, hatte er mit einem Achselzucken gemeint. »Er hat keine Bedeutung. Genau darum geht es ja.« Yvette hatte widersprochen: Natürlich hatte die Szene eine Bedeutung. Sie war ein Akt der Rebellion gegen die Bourgeoisie, repräsentiert durch die Frau im Pelzmantel am Nebentisch. Raymond hatte ernst genickt, weil er seinen Freunden nicht widersprechen wollte, doch er fand beide Interpretationen nicht sonderlich einleuchtend. Sie erklärten nicht das Kribbeln, das er beim Lesen der Szene verspürte und das dem nicht unähnlich war, wenn er im Schulflur ganz dicht an bestimmten Mädchen vorbeiging und ihren Duft einsog. Vielleicht ging es gar nicht darum, die Szene auf eine Bedeutung zu reduzieren – sie zu erklären –, sondern darum, sie einfach nur als eine Art Spektakel zu erleben.
Raymond trug sein Haar schulterlang. Er hatte eine ausgeprägte römische Nase, die er von seinem Vater geerbt hatte, und die langbewimperten graublauen Augen seiner Mutter. Mit seinen schmalen Lippen und dem breiten Mund sah er recht einnehmend aus, wenn er lächelte (was allerdings nicht oft vorkam). Seine Haut war glatt, und er rasierte sich nur der Form halber, denn das, was da an seinem Kinn wuchs, war nicht mehr als ein zarter, peinlicher Flaum. Sein Körper war schlank und geschmeidig, und seine Mutter sagte gerne, er sehe aus wie ein Mädchen. Manchmal, wenn er sie abends in ihrem Zimmer besuchte, bat sie ihn, sich auf die Bettkante zu setzen, und dann bürstete sie sein Haar. Raymond störte sich nicht daran, dass seine Mutter ihn so weiblich fand, und gewöhnte sich sogar ein paar mädchenhafte Gesten an, vor allem, um seinen Vater zu ärgern.
Vor Kurzem hatte er alle Poster von den Wänden seines Zimmers genommen und einen großen Teil seiner Sachen weggeworfen. Dann hatte er die Wände weiß gestrichen, sodass sein Zimmer nun wie eine gut ausgestattete Zelle aussah. An der Wand rechts neben der Tür stand ein Regal, aus dem er alle kindlichen Bücher entfernt hatte. Stattdessen waren dort nun ein Plattenspieler und vierzig oder fünfzig Schallplatten untergebracht, Letztere sorgfältig ausgewählt, um bei jedem, der sein Zimmer betrat, den richtigen Eindruck zu erwecken. Er war siebzehn Jahre alt.
Seit etwa fünfzehn Minuten waren Raymonds Gedanken nicht mehr bei seinem Buch. Vor einer Stunde hatte er Autoreifen auf dem Kies in der Einfahrt gehört, und kurz darauf war die Haustür geöffnet worden, und seine Mutter war die Treppe heraufgekommen. Auch ohne das Klackern ihrer Absätze auf den Dielen waren ihre Schritte leicht von denen seines Vaters zu unterscheiden. Seither war es im Haus still gewesen. Normalerweise hätte Raymond erwartet, dass sein Vater spätestens um diese Zeit nach Hause kam, kurz nach seiner Frau sah und sich dann in sein Arbeitszimmer zurückzog, um zu lesen oder ein paar Unterlagen durchzugehen. Raymonds Vater ließ die Tür seines Arbeitszimmers immer einen Spalt offen. Doch das war weniger als Einladung gedacht, hereinzukommen, als vielmehr dazu, das Kommen und Gehen der anderen Mitglieder des Haushalts zu überwachen. Raymonds Zimmer lag neben dem Arbeitszimmer, und wenn er zur Toilette musste oder nach unten in die Küche gehen wollte, um sich etwas zu essen zu holen, führte sein Weg zwangsläufig an der Tür seines Vaters vorbei. Raymond lief im Haus oft in Socken herum, um unbemerkt zu bleiben, doch er hatte stets das Gefühl, dass sein Vater immer wusste, wo er war und was er tat. Jeden Abend, wenn die Haushälterin sich in ihr Zimmer im zweiten Stock zurückzog, hörte Raymond, wie sein Vater leise fragte: »Sind Sie das, Thérèse?«
Im Haus war es so still, dass keine Notwendigkeit bestand zu rufen.
»Ja, Maître«, antwortete sie dann vom Treppenabsatz. »Brauchen Sie noch etwas?«
Woraufhin Maître Barthelme verneinte und beide einander eine gute Nacht wünschten. Dieser stets gleichbleibende Wortwechsel ging Raymond auf die Nerven.
Die Tatsache, dass Maître Barthelme noch nicht zu Hause war, war für sich genommen schon ungewöhnlich. Doch als Raymond um 23.47 Uhr (er sah auf die Digitaluhr, die seine Mutter ihm zum sechzehnten Geburtstag geschenkt hatte) ein Klingeln an der Haustür hörte, wusste er, dass etwas passiert sein musste. Um diese Zeit konnte es eigentlich nur jemand von der Polizei sein. Und wenn es jemand von der Polizei war, konnte das nur schlechte Nachrichten bedeuten. Es war höchst unwahrscheinlich, dachte Raymond, dass die Ankunft eines Polizisten und die Abwesenheit seines Vaters nichts miteinander zu tun hatten. Es musste mindestens ein Unfall geschehen sein. Aber würde die Polizei bei einem gewöhnlichen Unfall um diese Zeit bei ihnen auftauchen? Da hätte doch sicher ein Anruf genügt.
Als Raymond hörte, wie Thérèse nach unten ging und die Tür öffnete, spitzte er die Ohren, doch er konnte nur Gemurmel vernehmen. Kurz darauf, als Thérèse wieder die Treppe erklomm und leise bei seiner Mutter klopfte, stand er von seinem Stuhl auf, stellte sich von innen an seine Zimmertür und lauschte. Falls es noch eine Bestätigung brauchte, dass der Besucher tatsächlich von der Polizei war, so hatte er sie nun. Thérèse war von Natur aus misstrauisch und hätte niemals einen Unbekannten alleine in der Halle warten lassen. Für sie waren alle Händler und Vertreter Diebe, die man keinen Moment aus den Augen lassen durfte, und sie beschwerte sich ständig, dass die Verkäufer in den Geschäften sie übers Ohr hauten. Wenn sie vom Einkaufen zurückkam, wog sie jedes Mal alles, was sie besorgt hatte, ab, um sich zu vergewissern, dass man sie nicht betrogen hatte.
Nachdem Thérèse erneut nach unten gegangen war, wurden in der Halle ein paar unverständliche Worte gewechselt, dann kamen zwei Personen die Treppe herauf und betraten das Zimmer seiner Mutter. Anscheinend blieb die Tür kurze Zeit geöffnet, denn Raymond konnte ein paar Gesprächsfetzen verstehen, bevor Thérèse hinausgeschickt und die Tür geschlossen wurde. Während der folgenden Minuten überlegte Raymond, ob er sich womöglich geirrt hatte und der Besuch des Polizisten gar nicht mit dem Fernbleiben seines Vaters zusammenhing. Vielleicht hatte es in der Nachbarschaft einen Einbruch gegeben, und der Polizist war hier, um zu fragen, ob jemand etwas Ungewöhnliches gesehen oder gehört hatte. In dem Fall würde er sicher auch mit Raymond sprechen wollen. Vielleicht würde der Polizist ihn fragen, wo er gewesen war, und da er kein Alibi hatte – er hatte sein Zimmer den ganzen Abend lang nicht verlassen –, würde er selbst unter Verdacht geraten.
Bis zu diesem Moment war Raymonds Tag vollkommen normal gewesen. Gegen acht Uhr morgens hatte er in der Küche stehend eine Tasse Tee getrunken und ein Stück Brot mit Butter gegessen, im Rücken die Wärme des Herdes. Im Winter war das Haus kalt, da sein Vater wenig vom Heizen hielt, aber in der Küche war es immer geradezu erdrückend warm. Thérèse bereitete mit ihrer üblichen Leidensmiene das Frühstückstablett für seine Mutter vor. Sein Vater hatte das Haus bereits verlassen.
Wie immer holte Raymond auf dem Weg zur Schule Yvette ab, die an der Rue des Trois Rois wohnte. An der Ecke Avenue de Bâle – Avenue Général de Gaulle trafen sie auf Stéphane. Er erzählte ihnen begeistert von einem Buch, das er gelesen hatte, aber Raymond hörte kaum zu. Der Tag war mehr oder weniger ereignislos verlaufen. Mlle Delarue, ihre Französischlehrerin, fehlte, wie so oft, und der Konrektor, der die Vertretung übernahm, gab der Klasse nur eine Aufgabe und verschwand. Raymond verbrachte die Stunde damit, zwei Ringeltauben zu beobachten, die ruckelnd über den Schulhof stolzierten. Mittags aß er in der Schulkantine ein Stück Zwiebelkuchen mit Kartoffelsalat. Da er danach keinen Unterricht mehr hatte, ging er allein nach Hause. Er machte sich eine Kanne Tee, nahm sie mit hinauf in sein Zimmer und hörte ein paar Schallplatten. Dienstags aß sein Vater immer auswärts, und das Abendessen ohne ihn war geradezu befreiend. Seine Mutter war munterer als sonst, und ihre Wangen schienen sogar ein wenig Farbe zu bekommen. Wenn sie Raymond fragte, wie sein Tag gewesen war, erheiterte er sie mit Anekdoten über irgendwelche trivialen Ereignisse in der Schule, und manchmal ahmte er sogar seine Lehrer oder Klassenkameraden nach. Wenn er dabei allzu boshaft wurde, schalt sie ihn, aber so halbherzig, dass sie ihm ganz offensichtlich nicht böse war. Selbst Thérèse erledigte ihre Aufgaben mit weniger düsterer Miene, und manchmal setzte sie sich beim Dessert zu ihnen an den Tisch, wenn es irgendwelche Haushaltsdinge zu besprechen gab. Einmal, als Raymonds Vater überraschend nach Hause gekommen war, war sie von ihrem Stuhl aufgesprungen, als hätte sie sich auf eine Reißzwecke gesetzt, und hatte sich an den Schüsseln auf der Anrichte zu schaffen gemacht. Als Maître Barthelme hereingekommen war, hatte nichts darauf hingedeutet, dass er diesen Regelverstoß mitbekommen hatte, aber zu Raymonds Erheiterung waren Thérèses Wangen rot angelaufen wie bei einem Schulmädchen.
Nach etwa fünf Minuten hörte Raymond, wie die Tür vom Zimmer seiner Mutter geöffnet wurde. Er lauschte den Schritten des Polizisten, die sich der Treppe näherten, dann aber daran vorbeigingen und auf sein Zimmer zukamen. Raymond wich von der Tür zurück. Er schnappte sich sein Buch vom Boden und warf sich aufs Bett. Aber das würde seltsam aussehen, da der Stuhl noch mitten im Zimmer stand, als solle dort ein Verhör stattfinden. Doch es blieb keine Zeit, ihn wegzustellen, außerdem wollte Raymond nicht, dass der Polizist ihn hörte und dachte, er sei dabei, Spuren zu verbergen. Es klopfte an der Tür. Raymond wusste nicht, was er tun sollte. Es wäre unhöflich, wenn er rief: Wer ist da? Das würde implizieren, dass die Erlaubnis hereinzukommen von der Identität des Besuchers abhing. Im Übrigen wäre die Frage unaufrichtig, denn er wusste ja bereits, wer vor der Tür stand. Dieses Dilemma war neu für Raymond. Seine Mutter betrat sein Zimmer nie, und Thérèse tat es nur, wenn er in der Schule war. Sein Vater wiederum weigerte sich anzuklopfen, was Raymond überaus ärgerte, denn es bedeutete, dass er sich in seinem eigenen Zimmer nie richtig entspannen konnte, weil jederzeit ein unangekündigter Besuch drohte. Er wusste nicht einmal, was sein Vater bei ihm wollte. Wenn sie überhaupt miteinander sprachen, dann kurz und angespannt, und so lag die Vermutung nahe, dass sein Vater ihn lediglich kontrollieren und daran erinnern wollte, dass er noch nicht alt genug war, um ein Anrecht auf Privatsphäre zu haben.
Letzten Endes stand Raymond mit dem Buch in der Hand vom Bett auf und öffnete selbst die Tür. Der Mann, der auf dem Treppenabsatz stand, sah nicht aus wie ein Polizist. Er war mittelgroß, mit geradezu militärisch kurzem, grau gesprenkeltem Haar. Er hatte ein einnehmendes Gesicht mit freundlichen, wachen Augen und dichten schwarzen Brauen. Der Stoff seines dunkelbraunen Anzugs glänzte ein wenig. Seine Krawatte war gelockert und der oberste Hemdknopf geöffnet. Er hatte nicht die einschüchternde Ausstrahlung, die Raymond bei einem Polizeibeamten erwartet hatte.
»Guten Abend, Raymond«, sagte er. »Ich bin Georges Gorski von der hiesigen Polizei.«
Er zeigte ihm keinen Ausweis. Raymond fragte sich, ob er überrascht tun sollte, doch dafür war es schon zu spät. So nickte er nur.
»Darf ich?« Der Polizist deutete ins Zimmer. Raymond wich zurück, um ihn hereinzulassen. Gorski trat ein und betrachtete verwirrt den Stuhl, der in der Mitte des Raumes stand. Dann ließ er den Blick über die nackten Wände gleiten. Raymond stand befangen neben seinem Bett. Es war 23.53 Uhr.
Gorski drehte den Stuhl zu sich herum, setzte sich aber nicht hin, sondern ließ nur seine rechte Hand auf der Lehne liegen. Mit sachlicher Stimme sagte er: »Dein Vater ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen.«
Raymond wusste nicht, was er darauf erwidern sollte. Sein erster Gedanke war: Wie soll ich reagieren? Um Zeit zu gewinnen, blickte er zu Boden. Dann setzte er sich aufs Bett. Das war gut. Das taten Leute in so einer Situation: Sie setzten sich hin, als hätte ihnen der Schock alle Kraft aus den Beinen gezogen. Doch Raymond war nicht schockiert. Schon als es an der Tür geklingelt hatte, war er sich sicher gewesen, dass genau das passiert war. Er fragte sich kurz, ob es eine Vorahnung gewesen war, ließ den Gedanken jedoch wieder fallen. Das Wesentliche war nicht, dass er angenommen hatte, sein Vater sei tot, sondern dass er es sich – wenn auch unbewusst –, gewünscht hatte. Wenn er nach dieser Nachricht überhaupt etwas fühlte, dann war es eine Art Erregung, ein Gefühl der Befreiung. Er hob den Kopf und sah den Polizisten an, um zu schauen, ob der seine Gedanken gelesen hatte. Doch Gorskis Blick wirkte gleichgültig.
»Deine Mutter hielt es für das Beste, wenn ich es dir sage«, fügte er in dem gleichen nüchternen Tonfall hinzu.
Raymond nickte langsam. »Danke.«
Er hatte das Gefühl, er müsse noch etwas sagen. Welcher Mensch hatte nichts dazu zu sagen, wenn er vom Tod seines Vaters erfuhr?
»Ein Autounfall?«, fragte er.
»Ja, auf der A35. Er war sofort tot.«
Gorski sah verstohlen auf die Uhr, und Raymond begriff, dass er gehen wollte. Gorski wandte sich zur Tür. »Vielleicht solltest du nach deiner Mutter sehen.«
»Ja. Ja, natürlich«, sagte Raymond.
Der Polizist nickte, froh, dass er seine Pflicht erfüllt hatte. »Wenn du keine Fragen mehr hast, ist das fürs Erste alles. Morgen früh muss der Leichnam identifiziert werden. Es wäre sicher gut, wenn du deine Mutter begleitest.«
Gorski verließ den Raum. Raymond folgte ihm bis zur Zimmertür und sah ihm nach, als er die Treppe hinunterging. Thérèse stand auf dem Treppenabsatz, die Hand auf dem Mund.
Raymond zog sich instinktiv zurück. Er hatte das Gefühl, wenn er sein Zimmer verließ, würde sich alles verändern, und er müsse auf irgendeine Weise Verantwortung übernehmen. Er betrachtete sich im Spiegel an der Innenseite seiner Schranktür, doch er sah genauso aus wie vorher. Er strich sich die Haare aus der Stirn und setzte eine ernste Miene auf, senkte die Augenbrauen und presste die Lippen zusammen. Es sah ziemlich komisch aus, und er musste sich ein Lachen verkneifen.
Er betrat, ohne zu klopfen, das Zimmer seiner Mutter und schloss die Tür hinter sich. Lucette saß aufrecht im Bett. Sie schien nicht geweint zu haben. Da es seltsam gewirkt hätte, wenn er stehen geblieben wäre oder sich auf der Chaiselongue niedergelassen hätte, die ohnehin mit Kleidungsstücken bedeckt war, setzte er sich auf die Bettkante. Lucette streckte die Hand aus, und Raymond nahm sie. Er hielt seinen Blick auf die Wand über dem Bett gerichtet. Das Nachthemd seiner Mutter war nur locker zusammengebunden, und man konnte den Ansatz ihrer Brüste sehen. Er fragte sich, ob sie den Polizisten ebenso nachlässig angezogen empfangen hatte.
»Wie geht es dir?«, fragte er.
Sie lächelte melancholisch. Mit der freien Hand raffte sie ihr Nachthemd zusammen. »Es ist ein ziemlicher Schock.«
»Ja«, sagte er.
Raymond hatte nicht erwartet, seine Mutter in Tränen aufgelöst vorzufinden. Er hatte nie den Eindruck gehabt, dass seine Eltern große Zuneigung füreinander empfanden. Seit er öfter bei seinen Freunden zu Besuch war, hatte er erkannt, dass die steife Förmlichkeit, die zwischen seinen Eltern herrschte, nicht üblich war. Yvettes Eltern lachten und scherzten miteinander. Wenn M. Arnaud nach Hause kam, küsste er seine Frau auf den Mund, und sie schmiegte sich auf eine Weise an ihn, die nahelegte, dass sie ihn sehr gern hatte. Wenn Raymond zum Abendessen dort bleiben durfte, herrschte am Tisch eine gesellige Atmosphäre. Die Familienmitglieder – Yvette hatte noch zwei jüngere Brüder –, unterhielten sich miteinander, als interessierten sie sich tatsächlich für das, was die anderen beschäftigte. Raymond hatte seine Mutter durchaus gern, aber die Stimmung im Hause Barthelme wurde ganz und gar von seinem Vater beherrscht. Das einzige Thema, das Maître Barthelme während der Mahlzeiten interessierte, waren die Haushaltskosten. Wenn Thérèse die Mahlzeiten hereinbrachte, fragte er sie, was dies oder jenes gekostet habe und ob sie die Preise mit denen in anderen Geschäften verglichen habe. Sparsamkeit ist keine Schande, war sein Lieblingssatz, und Thérèse hielt sich eisern daran.
Dass sein Vater der Grund für die frostige Atmosphäre im Hause Barthelme war, zeigte sich besonders durch die gelöstere Stimmung bei Tisch, wenn er nicht da war. Doch selbst während seiner Abwesenheit rissen sich Raymond und seine Mutter sofort wieder zusammen, wenn es einmal etwas heiterer zuging, als könne ihr unpassendes Benehmen gemeldet werden. Raymond fragte sich, ob seine Mutter jetzt – genau wie er –, ein Gefühl der Befreiung verspürte, so wie er es empfand, wenn das Schuljahr zu Ende ging und die Ferien begannen oder wenn der Frühling kam und man das Haus ohne dicken Mantel verlassen konnte.
Doch diese Gedanken behielt Raymond für sich. Stattdessen sagte er: »Der Polizist hat gesagt, der Leichnam muss identifiziert werden.«
Es klang seltsam in seinen Ohren, dass er seinen Vater als »Leichnam« bezeichnete.
»Ja«, erwiderte seine Mutter. »Sie schicken morgen früh einen Wagen.«
Es war erleichternd, sich diesen praktischen Dingen zuzuwenden. Raymond fragte, ob er sie begleiten solle. Sie drückte seine Hand und sagte, das würde ihr sehr helfen. Sie sahen einander einen Moment lang an, dann stand Raymond, da es sonst nichts mehr zu sagen gab, auf und verließ das Zimmer.
3
Während der ersten paar Tage, nachdem seine Frau gegangen war, hatte Gorski die Gelegenheit genutzt und sich im Bad direkt neben dem Schlafzimmer rasiert. Er tat es aus reinem Trotz. Normalerweise rasierte er sich in der engen Toilette im Erdgeschoss. Kaum einen Monat nachdem sie geheiratet hatten und in das Haus an der Rue de Village-Neuf gezogen waren, war er aus dem oberen Bad verbannt worden. Er brauchte zu lange und hinterließ immer einen Ring aus Bartstoppeln im Waschbecken. Das Bad wurde Célines Reich, und selbst in ihrer Abwesenheit hatte Gorski das Gefühl, in ihr Territorium einzudringen. Deshalb war er wieder in die Toilette im Erdgeschoss zurückgekehrt. Dann, nach etwa einer Woche, hatte er beschlossen, sich gar nicht mehr zu rasieren, ganz so als wolle er seine Grenzen austesten. Schließlich konnte er nun, wo Céline fort war, tun, was er wollte. Am gleichen Tag hatte er zu seinem morgendlichen Kaffee in der Küche eine Zigarette geraucht. Allerdings hatte er es nicht über sich gebracht, den benutzten Aschenbecher dort stehen zu lassen. Was, wenn Céline nun ausgerechnet an diesem Tag beschloss zurückzukommen? Den ganzen Tag über hatte sich Gorski in seinem unrasierten Zustand unwohl gefühlt, doch niemand auf der Wache hatte eine Bemerkung zu seiner nachlässigen Erscheinung gemacht. Am Nachmittag war er zu einer älteren Witwe in der Rue Saint-Jean gegangen, die behauptete, ihre Gartengeräte seien gestohlen worden. Als sie ihm die Tür öffnete, musterte sie ihn misstrauisch. Gorski fuhr sich mit der Hand über das stoppelige Kinn und kam sich schlampig und unprofessionell vor. Wie sich herausstellte, waren die Gartengeräte im Schuppen.
»Ach ja«, hatte die Frau gesagt. »Jetzt erinnere ich mich wieder, dass ich sie dahin geräumt habe.«
Aber sie hatte sich nicht dafür entschuldigt, dass er umsonst gekommen war.
Am Morgen nach dem Unfall wusch Gorski sich, kochte Kaffee und setzte sich an den Küchentisch. Er rauchte nicht. Ohne Céline und Clémence fühlte sich das Haus seltsam an. Früher hätte er Mühe gehabt, die Einrichtung und Ausstattung des Raums zu beschreiben, in dem er sich jetzt befand, weil seine Aufmerksamkeit den Bewegungen und dem Geplauder seiner Frau und seiner Tochter galt, die vor Kurzem siebzehn geworden war. Doch nun war nichts mehr da, was ihn von den Küchenschränken, den Fliesen und der Arbeitsfläche ablenkte. Er hatte sich vorgestellt, dass er beauftragt wurde, das Verschwinden seiner eigenen Frau zu untersuchen. Es wäre ihm unangenehm gewesen, einen Ehemann unter solchen Umständen zu befragen.
Hat sie eine Nachricht hinterlassen?
»Ja.«
Und was stand darin?
»Nur dass sie geht.«
Dann würde er, nur um der Korrektheit willen, darum bitten, sich die Nachricht ansehen zu dürfen. Und da sie nicht vorzuweisen war – Gorski hatte sie in den Mülleimer geworfen –, würden darauf unausweichlich weitere Fragen folgen.
Wann haben Sie sie zuletzt gesehen?
Das war natürlich an jenem Morgen gewesen, aber Gorski konnte sich an nichts Besonderes erinnern. Es war ein Tag wie jeder andere. Er und Céline hatten das getan, was sie an zahllosen Morgen zuvor auch getan hatten. Nichts hatte auf ihre Pläne hingedeutet, oder falls doch, hatte er es nicht bemerkt.
Und haben Sie eine Idee, wohin sie gegangen sein könnte?
»Zu ihren Eltern, nehme ich an.«
Haben Sie versucht, sie dort zu erreichen?
Da endete die Szene. In den fünf oder sechs Wochen, seit sie gegangen war, hatten sie keinerlei Kontakt miteinander gehabt. Gorski hätte direkt am ersten Tag anrufen sollen. Danach war die Gelegenheit vorbei gewesen. Wenn er jetzt anriefe, wäre Célines erste Frage: »Warum hast du dich nicht früher gemeldet?«, und daraus würde sich rasch ein Streit entwickeln. Außerdem hatte Gorski keine Erklärung dafür, warum er es nicht getan hatte. Oder zumindest keine, die er Céline gegenüber aussprechen würde. Die Wahrheit war, dass er beim Lesen ihrer Nachricht kaum mehr als eine vage Erleichterung verspürt hatte. Doch das Gefühl hatte nicht lange angehalten. Mittlerweile vermisste er sie und bedauerte es, dass er nicht versucht hatte, mit ihr zu sprechen. Er hätte leicht bei ihr in der Boutique vorbeischauen können, die nur wenige Gehminuten von der Wache entfernt lag. Dass er es nicht getan hatte, war reine Sturheit. Ihm gefiel die Vorstellung, wie wütend sie gewesen sein musste, als er an dem ersten Abend nicht angerufen hatte. Das hatte sie ganz sicher erwartet. Sie hatte erwartet, dass er sie anflehte, wieder nach Hause zu kommen, und versprach, sich zu bessern. Tatsächlich wusste er jedoch gar nicht, was er falsch gemacht hatte. Und deshalb hatte er nicht angerufen. Und natürlich würde Céline nicht den ersten Schritt tun. Indem er nicht anrief, hatte Gorski das Gefühl, einen kleinen Sieg errungen zu haben. Aber es schenkte ihm keine Befriedigung. Jetzt litt er unter ihrer Abwesenheit. Schon nach wenigen Tagen hatten sich die Eigenheiten, die ihn an seiner Frau am meisten störten – ihre Pingeligkeit, ihr Snobismus und ihre Besessenheit, was Äußerlichkeiten anging –, in liebenswerte kleine Marotten verwandelt. Es fehlte ihm, dass ihm beim Frühstück gesagt wurde, er könne unmöglich diese Krawatte zu diesem Hemd tragen. Und während er früher bisweilen absichtlich Sachen angezogen hatte, die nicht zusammenpassten, nur um sie zu ärgern, kleidete er sich jetzt sorgfältig auf eine Weise, von der er meinte, dass sie ihr gefallen würde.
Vor allem jedoch vermisste er seine Tochter. Während der ersten paar Tage hatte er beim Nachhausekommen gehofft, Clémence am Küchentisch vorzufinden, wo sie einen Keks in den Pfefferminztee tunkte, den sie in letzter Zeit so gerne trank. Doch sie war nicht gekommen, und dass er jetzt seine Abende im Le Pot verbrachte, lag zum Teil daran, dass er nach der Arbeit nicht in ein leeres Haus zurückkehren wollte.
Es war bereits nach zehn, als Gorski die Stufen zu der kleinen Eingangshalle der Polizeiwache hinaufging. Der Beamte am Empfang saß in seiner üblichen Haltung am Tresen, nämlich über den L’Alsace