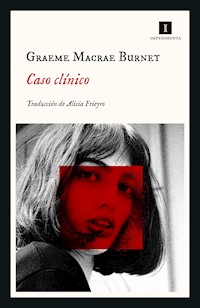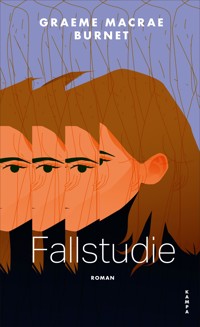
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Ich bin davon überzeugt, dass Dr Braithwaite meine Schwester Veronica getötet hat. Damit meine ich nicht, dass er sie im üblichen Wort- sinn ermordet hat, dennoch ist er für ihren Tod verantwortlich, als hätte er sie mit seinen eigenen Händen erwürgt.« Zwei Jahre zuvor, im Herbst 1963, ist Veronica am Bridge Approach in Camden von einer Überführung gesprungen und vom 4:45-Uhr-Zug nach High Barnet überfahren worden. Niemand hätte ihr das zugetraut. Am wenigsten ihre Schwester. Und so wird diese bei Dr Braithwaite, Veronicas charismatischem Therapeuten, vorstellig, allerdings unter falschem Namen: als zutiefst aufgewühlte Patientin Rebecca Smyth. Sie ist entschlossen, der seltsamen Beziehung zwischen Braithwaite und Veronica auf den Grund zu gehen, die Umstände des Selbstmords ihrer Schwester zu klären. Wird ihre Darstellung den Psychologen überzeugen? Ein hochspannendes Katz-und-Maus-Spiel zwischen einem Therapeuten und seiner Patientin. Was ist wahr, was Täuschung? Wer ist wer, wer glaubt wem was - und was dürfen, was können wir Leser glauben?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 420
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Graeme Macrae Burnet
Fallstudie
Roman
Aus dem Englischen von Georg Deggerich
Kampa
Vorwort
Ende 2019 bekam ich eine E-Mail von einem gewissen Martin Grey aus Clacton-on-Sea. Er schrieb, er besitze Notizbücher seiner Cousine, von denen er glaube, sie könnten die Grundlage für ein interessantes Buch abgeben. Ich bedankte mich für das Vertrauen, wies aber darauf hin, dass wohl niemand besser geeignet sei, aus dem betreffenden Material ein Buch zu machen, als er, Mr Grey, selbst. Er wandte ein, er sei kein Schriftsteller und habe sich auch nicht zufällig an mich gewandt. Er erklärte, er sei durch einen Blog-Eintrag von mir über den heute in Vergessenheit geratenen Psychotherapeuten Collins Braithwaite aus den 1960er-Jahren auf meinen Namen gestoßen. In den Notizbüchern gehe es um gewisse Anschuldigungen gegen Braithwaite, die mich sicher interessieren würden.
Damit hatte er meine Neugierde geweckt. Einige Monate zuvor war mir im notorischen Chaos von Voltaire & Rousseau, dem berühmt-berüchtigten Glasgower Antiquariat, ein Exemplar von Braithwaites Buch Untherapie in die Hände gefallen. Braithwaite war ein Zeitgenosse von Ronald D. Laing und so etwas wie das Enfant terrible der sogenannten antipsychiatrischen Bewegung der sechziger Jahre. Das Buch, eine Sammlung von Fallstudien, war skandalös radikal und faszinierend. Das Internet lieferte mir nur dürftige Informationen über den Autor, doch meine Faszination war groß, sodass ich beschloss, das kleine Archiv der Universität von Durham, vierzig Kilometer von Braithwaites Heimatstadt Darlington entfernt, aufzusuchen.
Das »Archiv« bestand aus ein paar Kartons mit den stark annotierten Manuskripten von Braithwaites Büchern (vielfach mit obszönen, wenn auch nicht unkünstlerischen Strichzeichnungen versehen), einigen ausgeschnittenen Zeitungsartikeln und einer überschaubaren Anzahl von Briefen, hauptsächlich von Braithwaites Lektor, Edward Seers, und von seiner zeitweiligen Geliebten, Zelda Ogilvie. Während ich die Details von Braithwaites außergewöhnlicher Lebensgeschichte zusammentrug, kam mir der Gedanke, eine Biographie über ihn zu schreiben, eine Idee, die bei meinem Agenten und meinem Verleger auf wenig Begeisterung stieß. Warum, fragten sie, sollte sich irgendwer für einen vergessenen Autor von zweifelhaftem Ruf interessieren, dessen Werke seit Jahrzehnten vergriffen waren? Eine, wie ich zugeben musste, berechtigte Frage.
Vor diesem Hintergrund begann meine Korrespondenz mit Mr Grey. Ich erklärte ihm, ich würde mir die Notizbücher nun doch gern ansehen, und teilte ihm meine Adresse mit. Zwei Tage später traf ein Päckchen ein. Das beigefügte Anschreiben enthielt keinerlei Bedingungen bezüglich einer Veröffentlichung. Mr Grey verlangte kein Honorar und wollte lediglich, dass aus Rücksicht auf die Privatsphäre der Familie seine Anonymität gewahrt bleibe. Grey, bekannte er, sei nicht sein richtiger Name. Sollten die Notizbücher nicht mein Interesse finden, wünsche er nur, dass ich sie ihm zurückschickte. Er war sich aber offenbar sicher, dass dieser Fall nicht eintreten würde, denn er hatte keinen Absender notiert.
Ich las die fünf Notizbücher an einem Tag. Alle Vorbehalte, die ich gehabt hatte, waren schlagartig vergessen. Die Verfasserin erzählte nicht nur eine fesselnde Geschichte, sondern tat dies – trotz der schwerwiegenden Anschuldigungen, um die es ihr ging – auf eine sehr unterhaltsame Art. Gleichzeitig wirkte der Text ganz formlos, was aber nur, so schien mir, die Glaubwürdigkeit dessen, was die Verfasserin sagen wollte, hervorhob.
In den kommenden Tagen beschlich mich dennoch der Verdacht, dass man mir einen Streich spielen wollte. Was war einfacher, als mich mit angeblich zufällig gefundenen Notizbüchern zu ködern, in denen es um die gefährlichen Machenschaften einer Person ging, über die ich geforscht hatte? Wenn es sich allerdings um einen Streich handelte, dann hatte Mr Grey sehr viel Arbeit und Mühe auf ihn verwandt, nicht zuletzt mit dem Abfassen der Texte selbst. Ich beschloss, einige Nachforschungen anzustellen. Die Notizbücher (einfache Schreibhefte der Firma Silvine) waren damals als Schulhefte gebräuchlich. Sie waren undatiert, aber aus verschiedenen Hinweisen im Text ließ sich das Geschehen auf den Herbst 1965 datieren, als Braithwaite tatsächlich in Primrose Hill gelebt hatte und sich dem Höhepunkt seines Ruhms näherte. Die im ersten Notizbuch eingehefteten Seiten aus Untherapie stammen aus der ersten Auflage des Buches und dürften schwer aufzutreiben gewesen sein, sollten die Notizbücher erst in jüngster Zeit geschrieben worden sein. Viele Details stimmten mit dem überein, was ich im Universitätsarchiv oder in Zeitungsartikeln aus der damaligen Zeit gelesen hatte. Das besagte allerdings nicht viel. Wenn es sich bei den Notizbüchern um Fälschungen handelte, hätte ihr Verfasser nur die gleichen Nachforschungen wie ich betreiben müssen. Andere Details wiesen Unstimmigkeiten auf. Der in den Aufzeichnungen genannte Pub beispielsweise heißt korrekt Pembroke Castle und nicht, wie in den Notizbüchern, Pembridge Castle. Allerdings deutete ein solcher Fehler eher auf eine Verfasserin hin, die unbedarft ihre Gedanken notierte, als auf einen Betrüger, der eine möglichst überzeugende Fälschung ins Werk setzen wollte. Zudem hatte Mr Grey an einer Stelle der Notizbücher einen wenig schmeichelhaften Auftritt, was wohl nicht der Fall gewesen wäre, hätte er sie selbst geschrieben.
Außerdem war da die Frage der Motivation. Mir fiel kein Grund ein, warum sich jemand die Mühe machen sollte, mich hinters Licht zu führen. Genauso wenig wahrscheinlich war es, dass Braithwaite, dessen Karriere in Schmach und Schande geendet hatte und der kaum mehr als eine Fußnote in der Geschichte der Psychiatrie darstellte, diskreditiert werden sollte.
Ich schrieb eine E-Mail an Mr Grey. Das Material, erklärte ich, sei zweifellos interessant, aber bevor ich mich darauf einließe, bräuchte ich einen eindeutigen Beweis der Echtheit. Er schrieb zurück, er wisse nicht, welche Art von Beweis er mir geben könne. Er habe die Notizbücher beim Ausräumen des Hauses seines Onkels in Maida Vale entdeckt. Außerdem habe er seine Cousine ihr Leben lang gekannt, und die Sprache und Ausdrucksweise in den Notizbüchern entspreche genau der Art, wie sie geredet habe. Er könne sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass jemand anders sie geschrieben haben sollte. Natürlich war das kein Beweis, wie ich ihn mir erhofft hatte. Ich fragte Mr Grey, ob er bereit sei, sich mit mir zu treffen. Aber er lehnte ab, mit dem zutreffenden Einwand, dass auch seine Person nichts beweise. Wenn ich, so schloss er, an seiner Aufrichtigkeit zweifelte, solle ich die Notizbücher einfach zurückschicken, und diesmal nannte er mir die Nummer eines Postfachs.
Natürlich tat ich das nicht. Alles in allem sah ich keinen Grund, an der Echtheit der Notizbücher zu zweifeln. Wofür ich hingegen nicht bürgen kann, ist der Wahrheitsgehalt der Texte selber. Vielleicht sind die beschriebenen Ereignisse nur der blühenden Phantasie einer jungen Frau mit literarischen Ambitionen entsprungen, einer jungen Frau, die sich obendrein – nach ihren eigenen Worten – in einem Zustand großer innerer Unruhe befand. Doch ich habe mir gesagt, dass es letztendlich nicht darauf ankommt, ob sich die Dinge tatsächlich so ereignet haben. Entscheidend war vielmehr, dass die Texte – wie Mr Grey es in seinem ersten Schreiben formuliert hatte – in der Tat die Grundlage für ein interessantes Buch ergeben würden. Der Umstand, dass die Notizbücher unmittelbar im Anschluss an meine eigenen Nachforschungen auftauchten, war ein glücklicher Zufall, der genutzt werden wollte. Ich machte mich erneut an die Arbeit, besuchte die genannten Orte, fertigte eine genauere Untersuchung von Braithwaites Arbeiten an und führte eine Reihe von Interviews mit ihm nahestehenden Personen und präsentiere nun hiermit – in leicht überarbeiteter Form – die Notizbücher zusammen mit meiner eigenen biographischen Arbeit.
G M B, April 2021
Das erste Notizbuch
Ich habe beschlossen, alle Ereignisse aufzuschreiben, weil ich fürchte, dass ich womöglich selbst in Gefahr gerate, und falls ich recht behalten sollte (wovon ich zugegebenermaßen nicht ausgehe), kann dieses Notizbuch als eine Art Beweis dienen.
Dummerweise, das wird man leider schnell bemerken, besitze ich wenig Talent zum Schreiben. Allein wenn ich den letzten Satz betrachte, zucke ich zusammen. Aber wenn ich lange über Stilfragen brüte, werde ich wohl gar nicht von der Stelle kommen. Miss Lyle, meine Englischlehrerin, hat immer gesagt, ich würde zu viele Gedanken in einen Satz packen. Sie meinte, das sei ein Zeichen für einen wirren Geist. »Überleg zuerst, was du sagen möchtest, dann drück es klar und deutlich aus.« Das war ihr Mantra, und auch wenn es zweifellos hilfreich ist, habe ich bereits dagegen verstoßen.
Ich habe gesagt, dass ich unter Umständen selbst in Gefahr geraten könnte, und schon beginne ich haltlos abzuschweifen. Aber anstatt noch einmal von vorn anzufangen, mache ich einfach weiter. Worauf es hier ankommt, ist allein der Inhalt, nicht der Stil. Diese Seiten sollen ein Protokoll dessen sein, was geschieht. Würde ich zu sehr an meinen Sätzen feilen, würden sie möglicherweise an Glaubwürdigkeit verlieren. Als würde die Wahrheit in sprachlichen Ungeschicklichkeiten liegen. Ich kann Miss Lyles Ratschlag ohnehin nicht befolgen, denn ich weiß noch gar nicht, was ich sagen möchte. Aus Rücksicht auf alle, die – aus welchen Gründen auch immer – sich genötigt sehen, dies hier zu lesen, werde ich jedoch versuchen, mich so klar wie möglich auszudrücken.
In diesem Sinne werde ich also am besten mit den Fakten beginnen.
Mit der Gefahr, von der ich zu Beginn gesprochen habe, meinte ich die Person von Collins Braithwaite. Sie werden von ihm gehört haben. In den Zeitungen wurde er »der gefährlichste Mann Großbritanniens« genannt, und zwar wegen seiner Ideen zur Psychiatrie. Ich halte allerdings nicht nur seine Ideen für gefährlich. Ich bin vielmehr davon überzeugt, dass Dr Braithwaite meine Schwester Veronica getötet hat.
Damit meine ich nicht, dass er sie im üblichen Wortsinn ermordet hat, aber dennoch ist er für ihren Tod verantwortlich, als hätte er sie mit seinen eigenen Händen erwürgt. Vor zwei Jahren sprang Veronica in Camden, in der Bridge Approach, von der Fußgängerüberführung und wurde vom 4-Uhr-45-Zug nach High Barnet überrollt. Man konnte sich schwerlich eine weniger suizidgefährdete Person vorstellen als Veronica. Sie war sechsundzwanzig Jahre alt, intelligent, erfolgreich und mehr oder weniger attraktiv. Dennoch hatte sie seit einigen Wochen Dr Braithwaite konsultiert, ohne dass mein Vater und ich davon wussten. Ich habe dies aus seinen Aufzeichnungen erfahren.
Wie die meisten Briten kannte ich Dr Braithwaites Stimme, mit ihrem immer leicht rüde wirkenden nordenglischen Akzent, lange bevor ich ihn persönlich traf. Ich hatte ihn im Radio gehört und ihn auch einmal im Fernsehen gesehen, in einer Diskussionsrunde über Psychiatrie, die von Joan Bakewell moderiert wurde.1 Braithwaites Äußeres war so abstoßend wie seine Stimme. Er trug ein offenes Hemd und kein Jackett. Seine Haare, die bis auf den Kragen reichten, waren ungekämmt, und er rauchte ununterbrochen. Seine Gesicht wirkte übertrieben groß, wie in einer Karikatur, aber selbst auf dem Fernsehbildschirm hatte er etwas, das die Blicke unmittelbar anzog. Die anderen Studiogäste nahm ich nur am Rande wahr. In Erinnerung geblieben ist mir weniger das, was er sagte, als die Art, wie er es sagte. Ihn umgab die Aura eines Mannes, dem zu widersprechen zwecklos war. Er redete mit einer müden Autorität, als habe er es aufgegeben, sich vor den Ahnungslosen zu rechtfertigen. Die Teilnehmer saßen in einem Halbkreis mit Miss Bakewell in der Mitte. Während alle anderen aufrecht wie in der Kirchenbank saßen, hing Dr Braithwaite vornübergebeugt auf seinem Platz, das Kinn auf die Handfläche gestützt, wie ein flegelhafter Schüler. Er schien die anderen Gesprächsteilnehmer mit einer Mischung aus Verachtung und Langeweile zu betrachten. Als sich die Sendung ihrem Ende nähert, suchte er unvermittelt seine Rauchutensilien zusammen und verließ – eine Verwünschung murmelnd, die hier nicht wiederholt zu werden braucht – das Studio. Miss Bakewell war einen Augenblick irritiert, gewann dann aber schnell die Fassung zurück und sagte, dass die Weigerung ihres Gastes, sich einer Diskussion mit Fachkollegen zu stellen, ja wohl ein deutliches Eingeständnis der Schwäche seiner Argumente sei.
Die Zeitungen verurteilten Dr Braithwaites Verhalten am nächsten Tag aufs Schärfste: Er sei die Verkörperung all dessen, woran Großbritannien heute kranke. Seine Bücher seien voller Obszönitäten und zeichneten ein Bild vom Menschen, das zutiefst erniedrigend sei. Natürlich ging ich am folgenden Tag in der Mittagspause zu Foyles und fragte nach seinem neuesten Buch mit dem wenig ansprechenden Titel Untherapie. Der Angestellte gab mir den Band am ausgestreckten Arm, als sei er kontaminös, und sah mich mit vorwurfsvollem Blick an, wie ich es seit dem Kauf von D.H. Lawrence’ Skandal-Roman nicht mehr erlebt hatte. Ich packte das Buch erst aus, nachdem ich mich nach dem Abendessen in mein Zimmer zurückgezogen hatte.
Ich sollte hinzufügen, dass mein Wissen von der Psychotherapie bis dahin ausschließlich auf Filmszenen beruhte, in denen ein Patient ausgestreckt auf einer Couch liegt und einem bärtigen Arzt mit deutschem Akzent seine Träume erzählt. Das mag der Grund sein, warum ich dem Einführungskapitel von Untherapie nur mit Mühe folgen konnte. Es enthielt zahllose mir unbekannte Wörter, und die Sätze waren so lang und verschachtelt, dass man dem Verfasser eine Miss Lyle mit ihrem Mantra gewünscht hätte. Das Einzige, was ich der Einleitung entnahm, war, dass Braithwaite das Buch ursprünglich gar nicht hatte schreiben wollen. Seine »Besucher«, wie er sie nannte, waren Individuen, keine »Fallstudien«, die man wie Jahrmarktsattraktionen vorführte. Wenn er ihre Geschichten im Folgenden dennoch erzähle, so Braithwaite, dann nur deswegen, um seine Ideen gegen den Spott zu verteidigen, mit dem das Establishment (ein von ihm häufig benutztes Wort) sie überschütte. Sich selbst bezeichnete er als »Untherapeuten«, der es sich zur Aufgabe gemacht habe, die Menschen davon zu überzeugen, keine Therapie zu brauchen. Seine Mission sei es, das »primitiv zusammengeschusterte Gebäude« der Psychiatrie zum Einsturz zu bringen. Mir kam diese Einstellung etwas seltsam vor, aber wie gesagt, ich bin nicht bewandert auf diesem Gebiet. Das Buch, so Braithwaite, sei in gewisser Weise ein Begleitband zu seinen bisherigen Arbeiten und versammle vor allem Berichte, basierend auf seinen Beziehungen zu Menschen, die sich mit ihren Problemen an ihn gewandt hatten. Ihre Namen und alle wiedererkennbaren Details seien selbstverständlich geändert worden, aber er könne versichern, dass jeder Bericht in seinem Kern wahr sei.
Nachdem ich das verwirrende Einleitungskapitel hinter mich gebracht hatte, war ich von den nachfolgenden Berichten wie gefesselt. Ich vermute, es hat etwas Beruhigendes, wenn man von den Sorgen solcher Gestrauchelten liest, die unsere eigenen Verschrobenheiten im Vergleich ganz harmlos erscheinen lassen. Nach der Hälfte des Buches hatte ich das Gefühl, vollkommen normal zu sein. Erst im vorletzten Kapitel stieß ich auf die Geschichte von Veronica. Ich glaube, es ist das Beste, die Seiten hier einfach einzufügen:
Dorothy war eine hochintelligente Frau Mitte zwanzig. Sie war die ältere von zwei Schwestern und war in einer Mittelstandsfamilie in einer englischen Großstadt aufgewachsen. Ihre Eltern waren gefühlskalte Angelsachsen. Dorothy hatte nie ein Zeichen von Zuneigung zwischen ihnen erlebt. Streitigkeiten wurden, wie sie erklärte, dadurch beigelegt, dass ihr Vater, ein sanftmütiger Beamter im öffentlichen Dienst, sich dem Willen der Mutter fügte. Bis zum plötzlichen Tod ihrer Mutter, als Dorothy sechzehn war, hatte sie keinerlei traumatische Erfahrungen gemacht, doch die Frage, ob sie ihre Kindheit als glücklich bezeichnen würde, wusste sie zunächst nicht zu beantworten. Schließlich gab sie zu, sich schon in frühen Jahren schuldig gefühlt zu haben, weil sie im Gegensatz zu so vielen anderen in relativem Wohlstand aufwuchs, aber bis heute fühle sie sich nicht glücklich. Sie habe jedoch oft Fröhlichkeit vorgetäuscht, um ihrem Vater zu gefallen, dessen eigenes Glück von ihr abzuhängen schien. Ständig forderte er sie zu gemeinsamen Spielen auf und dergleichen, während sie lieber für sich allein blieb. Ihre Mutter wiederum wurde nicht müde, Dorothy und ihre Schwester daran zu erinnern, was für ein privilegiertes Leben sie doch führten, was dazu führte, dass sie sich von frühester Kindheit an Zurückhaltung auferlegte, vor allem in Bezug auf die vielen Dinge, mit denen ihr Vater sie verwöhnte: Geburtstagsgeschenke, Eis, Süßigkeiten und so weiter. Schon als Kind hatte sie eine starke Abneigung gegenüber ihrer Schwester empfunden. Wie sie betonte, handelte es sich dabei nicht um die übliche Eifersucht, die sich mit der Ankunft eines jüngeren Geschwisterkinds einstellt, mit dem man die Aufmerksamkeit und Liebe der Eltern teilen muss. Der Grund lag vielmehr darin, dass die jüngere Schwester oft aufbrausend und ungezogen war, aber dennoch von den Eltern nicht anders als sie, Dorothy, behandelt wurde. Sie empfand es als ungerecht, dass ihr eigenes vorbildliches Betragen keine Anerkennung fand, während gleichzeitig die Launen ihrer Schwester ohne Strafe blieben.
Dorothy war eine ausgezeichnete Schülerin und erhielt ein Stipendium für ein Mathematikstudium in Oxford. Auch dort überflügelte sie ihre Kommilitonen und konnte sich im Alltag, trotz ihrer Introvertiertheit, leidlich gut behaupten. In Oxford fand sie heraus, dass es keine Verpflichtung gab, »mitzumachen« oder gute Laune vorzutäuschen. Sie hielt sich daher abseits, ging auf Distanz. Es war das erste Mal, sagte sie, dass sie »sie selbst« sein konnte. Dennoch spürte sie eine brennende Eifersucht, wenn ihre Kommilitonen tanzen gingen oder spontane Zimmerpartys veranstalteten. Sie schloss mit einem Einser-Examen ab. Während sie an ihrer Doktorarbeit schrieb, lernte sie einen jungen Assistenten der Fakultät kennen, mit dem sie sich verlobte. Sie sagte, sie habe keine starken Gefühle für ihn empfunden und ganz gewiss kein sexuelles Verlangen. Dennoch sei sie einverstanden gewesen, ihn zu heiraten, weil sie das Gefühl hatte, er entspreche dem Bild eines anständigen jungen Mannes, der das Wohlwollen ihres Vaters gefunden hätte. Später löste Dorothys Partner die Verlobung, mit der Begründung, er wolle sich zunächst auf seine berufliche Karriere konzentrieren. Dorothy glaubte, der wahre Grund für seinen Rückzug sei gewesen, dass sie an den anhaltenden Folgen eines Nervenzusammenbruchs litt und kurze Zeit in einem Sanatorium verbracht hatte. Er fürchtete offenbar, sie könnte psychisch labil sein. Zuletzt war sie erleichtert darüber, dass die Hochzeit geplatzt war, da sie sich selbst nicht für die Ehe geeignet fühlte.
Bei ihrem ersten Besuch in meiner Praxis erschien Dorothy gut gekleidet und gab sich professionell, als handle es ich um ein Bewerbungsgespräch. Obwohl es ein warmer Tag war, trug sie ein Tweedkostüm, was sie älter erschienen ließ, als sie tatsächlich war. Sie war nur dezent oder gar nicht geschminkt. Es ist nicht ungewöhnlich für Besucher aus dem gehobenen Mittelstand, betont souverän aufzutreten. Sie wollen einen guten Eindruck machen und gleich klarstellen, dass sie nichts mit den sabbernden Irren zu tun haben, die sie für das übliche Klientel eines Seelenklempners halten. Aber Dorothy ging einen Schritt weiter. Noch bevor wir Platz genommen hatten, fragte sie daher: »Also, Dr Braithwaite, wie wollen wir vorgehen?«
Hier legte eine junge Frau größten Wert darauf, die Lage unter Kontrolle zu haben. Ich erwiderte schroff: »Wir können vorgehen, wie Sie wollen.«
Um Zeit zu gewinnen, zog sie ihre Handschuhe aus und verstaute sie sorgfältig in der Handtasche zu ihren Füßen. Dann begann sie verschiedene praktische Fragen zu erörtern, zur Häufigkeit der Sitzungen und so weiter. Ich ließ sie reden, bis sie nichts mehr zu sagen wusste. In solchen Situationen ist die Stille das wertvollste Instrument des Therapeuten. Mir ist noch kein Besucher begegnet, der dem Drang widerstehen konnte, sie zu füllen. Dorothy überprüfte mit flinken Händen ihre Frisur und strich den Saum ihres Rocks glatt. Sie war sehr exakt in ihren Bewegungen. Dann fragte sie, ob wir anfangen könnten.
Ich sagte ihr, dass wir bereits angefangen hätten. Sie wollte offenbar widersprechen, besann sich dann aber anders.
»Ja, selbstverständlich haben wir das«, sagte sie. »Ich nehme an, Sie haben meine Körpersprache beobachtet. Vermutlich denken Sie, ich versuche zu vermeiden, Ihnen zu sagen, warum ich hier bin.«
Ich signalisierte mit einer Kopfbewegung, dass dies zutreffen könnte.
»Und Sie glauben, wenn Sie nichts sagen, werde ich drauflosplappern und Ihnen meine tiefsten Geheimnisse verraten.«
»Niemand zwingt Sie, irgendetwas zu sagen«, sagte ich.
»Aber alles, was ich sage, kann aufgeschrieben und möglicherweise gegen mich verwendet werden.« Sie lachte über ihren eigenen kleinen Scherz.
Intellektuelle sind schwer zu knackende Nüsse. Sie wollen immer Eindruck machen und zeigen, dass sie die Situation durchschauen. Sie neigen dazu, sich beim Reden selbst zu kommentieren. »Sieh an, da versuche ich wieder vom eigentlichen Thema abzulenken«, sagen sie, oder: »Ich vermute, Sie finden diese Aussage ausgesprochen aufschlussreich.« Alles nur, um zu beweisen, dass sie mir ebenbürtig sind und dass sie ihre Probleme sehr gut selbst analysieren können. Das ist natürlich Unsinn. Wenn sie es könnten, würden sie nicht zu mir kommen. Sie verstehen nicht, dass gerade ihr Verstand – mit dem sie unaufhörlich ihr eigenes Verhalten rationalisieren – in den meisten Fällen die Wurzel ihres Problems darstellt.
In diesem Fall war Dorothys kleiner Scherz sehr aufschlussreich: Sie hatte das Gefühl, angeklagt zu werden, als stünde sie vor Gericht. Und trotz der Tatsache, dass sie freiwillig zu mir gekommen war, betrachtete sie mich als ihren Gegner. Ich sagte ihr zu diesem Zeitpunkt nichts davon, sondern wiederholte bloß meine Frage, wie sie fortfahren wollte.
»Nun, ich habe gedacht, das zu entscheiden sei Ihre Aufgabe«, sagte sie. Und dann fügte sie mit einem albernen Lachen hinzu: »Wofür bezahle ich Sie sonst?« So ist das bei Leuten aus der Mittelschicht: Zuletzt landen sie immer beim Geld und glauben, einen darauf hinweisen zu müssen, dass man für sie arbeitet.
Dorothy war mit dem Auftreten einer Person zu mir gekommen, die es gewohnt ist, das Kommando zu führen, aber sobald man ihr das Kommando überließ, lehnte sie es ab. Oder sie wusste nicht, was sie damit machen sollte. Ich sprach sie darauf an.
Sie lachte nur. »Aber ja. Sie haben natürlich vollkommen recht, Dr Braithwaite. Klug bemerkt. Ich verstehe langsam, warum alle eine so hohe Meinung von Ihnen haben.« (Schmeichelei: eine andere Ablenkungsstrategie.)
So unterhaltsam es war, wurde die Situation doch rasch ermüdend, und natürlich spricht am Ende nichts dagegen, die Erwartungen eines Besuchers zu erfüllen. Ich fragte sie daher, was sie zu mir geführt habe.
»Nun, das ist der entscheidende Punkt«, sagte sie, »und vielleicht auch der Grund für mein vieles Gerede. Ich bin nicht sicher, ob ich es wirklich sagen kann.« Ich ermutigte sie fortzufahren. »Ich meine, ich bin nicht verrückt. Ich höre keine Stimmen oder habe irgendwelche Erscheinungen. Ich möchte nicht mit meinem Vater schlafen oder etwas in der Richtung. Ich bin sicher, es gibt jede Menge Leute, die verrückter sind als ich.«
»Das muss sich noch zeigen«, sagte ich.
»Vielleicht könnte ich irgendeine Art Test machen«, schlug sie vor. »Mit Tests kenne ich mich aus. Vielleicht den mit den Tintenklecksen. Ich sage Ihnen gleich, für mich sehen die alle aus wie Schmetterlinge.«
»Ach, wirklich?«, sagte ich.
Sie senkte den Blick, sah auf ihre Hände. »Nein, eigentlich nicht.«
Ich hatte kein Interesse, mit ihr einen Rorschach- Test zu machen. Ich bin auch kein Freund der bei Psychiatern so beliebten Fünfzig-Minuten-Sitzungen, auch wenn der Gedanke an die tickende Geld-Uhr durchaus ein Ansporn sein kann. Man kann sicher sein, dass jeder Klient, der jemals zu einer Therapiesitzung erschienen ist, die Situation im Kopf hundertmal durchgespielt hat, und die Vorstellung, er könnte hinausgehen, ohne das anzusprechen, was ihn hergeführt hat, ist schlechterdings undenkbar. Gerade eine praktisch veranlagte, nüchtern denkende Person wie Dorothy würde dieser Dynamik folgen. Als geübte Mathematikerin glaubte sie vermutlich, wenn sie mir ihre Symptome beschriebe, würde ich sie einfach in ein entsprechendes Schema einordnen und so eine wundersame Heilung einleiten. Ungeachtet dessen, was gewisse Theorien uns einreden wollen, existiert aber kein allgemeines Schema, mit dem sich das menschliche Verhalten beschreiben ließe. Als Individuen werden wir von zahllosen Umständen beeinflusst, die für jeden von uns verschieden sind. Wir sind die Summe dieser Umstände und unserer Reaktionen auf sie.
Ich sah, wie Dorothy auf die Herrenarmbanduhr an ihrem Handgelenk blickte. Sie atmete tief ein. »Sie werden mich für furchtbar dumm halten«, begann sie, »aber ich habe diese Träume, in denen ich erdrückt werde – als würde ich ganz langsam zerquetscht.«
Ich nickte. »Träume, sagen Sie? Ich weiß nicht, ob ich an Träumen besonders interessiert bin.«
»Nun, es sind nicht nur Träume«, fuhr sie fort. »Es sind auch Gedanken, die ich tagsüber habe. Ich stelle mir vor, erdrückt zu werden, von einem Gebäude, einem Auto oder einer Menschenmenge. Manchmal sogar von ganz kleinen Dingen. Einer Fliege zum Beispiel.
Erst vor einigen Tagen flog eine Schmeißfliege in meinem Schlafzimmer herum, und ich hatte das entsetzliche Gefühl, wenn sie auf mir landete, würde sie mich zerquetschen.«
Mehrere Monate lang besuchte Dorothy mich zweimal die Woche. Ihr Bedürfnis, in jedem Moment die Lage zu kontrollieren, ließ allmählich nach. Tatsächlich schien sie es bald schon zu genießen, eine gefügigere Rolle einzunehmen. Bei ihrem fünften oder sechsten Besuch fragte sie, ob sie auf der Couch – auf der sie bislang gesessen hatte – liegen dürfe. Ich sagte ihr, sie könne tun, was sie wolle. Sie bräuchte keine Erlaubnis von mir.
»Aber ist es besser, wenn ich liege oder wenn ich sitze?«, fragte sie.
Ich antwortete darauf nicht, und sie legte sich ganz vorsichtig hin, wie auf einem Nagelbrett. Nie habe ich eine Person auf einer Couch liegen gesehen, die weniger entspannt wirkte. Aber nach einigen Wochen zog sie gleich zu Beginn der Sitzung ihre Schuhe aus und streckte sich mit einem Anflug von Wohlbehagen aus.
Beinahe alles, was ich über Dorothy wissen musste, erfuhr ich in unseren ersten Sitzungen. Als Kind hatten Vater und Mutter sie nach je entgegengesetzten Prinzipien erzogen: Ihr Vater wollte sie verwöhnen und tat alles, um sie glücklich zu machen, während ihre Mutter ihr bei jedem angenehmen Erlebnis Schuldgefühle einredete. Es war ihr unmöglich, beiden Elternteilen gleichzeitig gerecht zu werden, und da sie sich stets der Wirkung ihres Verhaltens auf diese Kontrollinstanzen bewusst war, entwickelte sie nie die Fähigkeit, eigene Freuden zu empfinden. Die Abneigung gegenüber ihrer Schwester beruhte eindeutig auf der Tatsache, dass diese sich so verhielt, wie Dorothy es gerne getan hätte, ohne dafür bestraft zu werden.
Anders als in den Fällen von John und Annette aus den vorherigen Kapiteln, die davon überzeugt waren, ihr eigentliches Selbst verloren zu haben, verspürte Dorothy nicht den Wunsch, zu einem idealisierten »wahren Selbst« zurückzukehren. Tatsächlich hatte sie nie das Gefühl für ein eigenes Selbst entwickelt. Bei unserer siebten Sitzung gestand Dorothy auf mein Insistieren hin, beim Tod ihrer Mutter ein Gefühl der Befreiung empfunden zu haben. Es war, erklärte sie, als sei ein verhasstes Regime abgesetzt worden, und sie sei nun frei zu tun, was immer sie wolle. Sie verglich das Ereignis scherzhaft mit dem Tod Stalins, um sich sogleich – ihrer Gewohnheit entsprechend – für diesen unpassenden Vergleich zu tadeln.
Als ich sie fragte, in welcher Weise diese veränderte Situation ihr Verhalten beeinflusst habe, antwortete sie, es habe keinerlei Auswirkungen gehabt. Es wäre auch kaum angebracht gewesen, erklärte sie, schließlich sei der Tod der Mutter kein freudiges Ereignis. Ich fragte sie, was sie denn gerne gemacht hätte.
Sie konnte mir darauf keine genaue Antwort geben. »Es war nicht so, dass ich irgendetwas Bestimmtes tun wollte. Es war eher der Gedanke, dass, wenn es etwas gegeben hätte, mich niemand daran gehindert hätte, es zu tun.«
Während ihrer Zeit in Oxford experimentierte Dorothy nicht mit jenen Dingen, die normalerweise zum Erwachsenwerden dazugehören, mit Sex, Alkohol oder Drogen. Sie rauchte nicht einmal eine Zigarette. Es war nicht so, beteuerte sie, dass sie sich diese »vermeintlichen Genüsse« versagte, vielmehr verspürte sie erst gar kein Verlangen danach.
Ich fragte sie, ob ihr akademischer Erfolg ihr Befriedigung verschaffe. Sie schüttelte den Kopf. Das alles bedeute ihr nichts. Dennoch empfand sie eine gewisse Zufriedenheit darüber, ihren Vater stolz zu machen. Auch was ihre kurzlebige Verlobung betraf, war sie froh, die Aufmerksamkeit eines attraktiven jungen Mannes auf sich gezogen zu haben. Als ich sie fragte, was sie an ihrem Verlobten geschätzt habe, wusste sie nichts Besseres zu sagen, als dass er gepflegt gewesen sei und sie nie unangenehm bedrängt habe.
Ich ließ einige Wochen verstreichen, bevor ich Dorothy wieder auf ihre Angst ansprach, erdrückt zu werden. Zuerst versuchte sie, das Ganze als Scherz abzutun.
»Ich glaube, ich habe da ein wenig dramatisiert«, sagte sie. »Seit ich zu Ihnen komme, habe ich dieses Gefühl nicht mehr gehabt.«
Dennoch hakte ich nach. Die Gedanken, sagte ich, seien real gewesen, und als sie mir davon erzählt habe, sei sie sichtlich aufgewühlt gewesen.
»Ja«, erwiderte sie, »aber ich weiß natürlich, dass Gebäude nicht einfach so einstürzen und mich unter sich begraben.«
Ich hatte ihr bereits zuvor erklärt, dass sie mit ihrer Angewohnheit, die Dinge zu rationalisieren, nur davon abwenden2 würde, wie sie diese Gedanken erlebte. Die Tatsache, dass ein Gebäude nicht plötzlich einstürze und sie begrabe, sei irrelevant. Ihre Furcht davor sei sehr real.
Ich fragte sie noch einmal nach der Geschichte mit der Schmeißfliege, die sie bei unserer ersten Sitzung erzählt hatte. Die Sache schien ihr peinlich zu sein. Von einem Haus oder einem Wagen zerdrückt zu werden, war zumindest physikalisch möglich, aber nicht von einer Fliege. Wieder versuchte sie, ihre Ängste wegzurationalisieren: Schmeißfliegen seien schmutzige Insekten, die jede Menge Krankheiten übertrugen. Das stimme, erwiderte ich, aber es habe nichts mit der Angst zu tun, die sie mir geschildert habe. Vielleicht sei die Schmeißfliege ein Symbol, schlug sie vor, offenbar in dem Glauben, bei einem Psychoanalytiker auf der Couch zu liegen. Ich erklärte ihr, Symbole würden mich nicht interessieren. Mich interessierten die Dinge an und für sich. Sie wandte ein, in der Mathematik würde man häufig Symbole und Zeichen zur Lösung von Problemen verwenden. Ich sagte ihr, wenn ihre Probleme auf mathematischem Wege gelöst werden könnten, hätte sie dies schon längst getan.
Das Problem waren natürlich weder Gebäude noch Schmeißfliegen, sondern dass Dorothy das Gefühl hatte, von der Außenwelt bedrängt und erdrückt zu werden. Ihre Art, damit umzugehen, bestand darin, jedes eigene Verlangen zu leugnen. Dorothy bestritt dies. Der von ihr aufgebaute Repressionsmechanismus funktionierte so gründlich, dass sie ihn nicht einmal bemerkte. Für sie war es einfacher zu glauben, sie habe keine eigenen Wünsche, als zu akzeptieren, dass sie sie unterdrückte. Sie davon zu überzeugen, dass die Außenwelt sie nicht erdrücke, war nicht weiter schwer (ich musste dazu nur an ihren ausgeprägten Rationalismus appellieren). Weitaus schwieriger war es, ihr deutlich zu machen, dass der Druck, den sie spürte, nicht von außen, sondern von innen kam. Die Repression war so stark, dass die ganze Art ihres In-der-Welt-Seins eine Reaktion auf ein gänzlich eingebildetes System von Zwängen darstellte.
»Ich wäre also mehr ich selbst, wenn ich mir weniger Zwänge auferlegte?«
»Es geht nicht darum, mehr Sie selbst zu sein«, erklärte ich ihr. »Ihr Selbst ist keine von Ihrem aktuellen Wesen getrennte Instanz. Es geht vielmehr darum, weniger Sie selbst zu sein, ein anderes Selbst zu sein.«
Dorothy schien einige Zeit darüber nachzudenken. Ich musste an die Berichte von Häftlingen in Auschwitz denken, die sich nach der Befreiung durch die Alliierten sträubten, das Lager zu verlassen. »Aber wenn ich ein anderes Selbst werden würde, wäre ich nicht mehr dieselbe Person. Ich wäre jemand anders.«
Ich sagte ihr, wenn sie mit ihrem »Selbst« zufrieden gewesen wäre, hätte sie bestimmt keinen Therapeuten aufgesucht.
Es erschien mir nicht angebracht, das Thema weiter auszuführen. Zweifellos hätte es nicht einer gewissen Ironie entbehrt, wenn Dorothy, deren ganzes Wesen darauf ausgerichtet war, anderen zu gefallen, ihr Verhalten nur mir zuliebe geändert hätte. Ich beendete deshalb die Sitzung, wohl wissend, dass sie als intelligente junge Frau in der Lage war, ihre eigenen Schlüsse zu ziehen.
In der Sitzung, die unserer letzte sein sollte, bat ich sie schließlich, sich vorzustellen, sie hätte für vierundzwanzig Stunden die Erlaubnis, alles zu tun, was sie wolle. Niemand würde erfahren, was sie getan hätte, und keine ihrer Taten hätten irgendwelche Konsequenzen. Was, fragte ich, würde sie unter diesen Umständen tun? Sie wusste nichts Rechtes damit anzufangen und stellte zahllose Fragen zu den geltenden Regeln. Nach längeren Erklärungen begann sie, ernstlich über die Frage nachzudenken. Schließlich errötete sie leicht. Ich fragte, woran sie denke. Sie errötete noch stärker, ein Beweis dafür, dass ich mein Ziel erreicht hatte. Sie musste ihre Gedanken gar nicht aussprechen, es reichte, dass sie sie hatte. Für Dorothy war dies ein Fortschritt. Ich forderte sie auf, sich ganz auf das zu konzentrieren, woran sie gerade dachte, und fragte sie, welche Konsequenzen es hätte, wenn sie ihren Gedanken in die Tat umsetzte.
»Keine«, sagte sie. »Es hätte keinerlei Konsequenzen.«
Ich sagte ihr, sie könne tun, was immer sie wolle. Sie schien von einer großen Last befreit zu sein. Sie sagte, sie wolle nicht länger Dorothy sein. Sie bedankte sich und verließ – zum ersten Mal in all den Monaten – leichten Fußes meine Praxis.
Als ich den Text zum ersten Mal las, hatte ich mich darüber amüsiert, dass es zwischen dieser »Dorothy« und Veronica eine gewisse Ähnlichkeit gab. Doch Dr Braithwaite hatte die realen Gegebenheiten so gründlich geändert, dass ich zunächst keinen Verdacht schöpfte. Veronica hatte in Cambridge studiert, nicht in Oxford, unser Vater war Ingenieur, kein Beamter. Vor allem die Beschreibung von Dorothys Verhältnis zu ihrer Schwester war irreführend. Veronica und ich waren vielleicht nicht so vertraut miteinander, wie man das von Schwestern erwartet, aber sie hatte mir gegenüber niemals irgendeine Form von Ablehnung empfunden. Doch dann fielen mir immer mehr Ähnlichkeiten auf, die nicht nur Zufall sein konnten. Braithwaites Beschreibung, wie sich seine Patientin vorsichtig auf der Couch ausstreckte, entsprach so sehr Veronicas Art, dass ich laut lachen musste. Genau wie Dorothy hatte auch Veronica eine übertriebene Furcht vor Wespen, Bienen, Motten und Schmeißfliegen. Außerdem achtete sie penibel auf die Einhaltung von Regeln. Was am Ende jedoch den Ausschlag gab, war ein einziges Wort. Wenn ich mich in jungen Jahren übertrieben für etwas begeisterte oder auch mich über etwas empörte, machte Veronica meinen Enthusiasmus für gewöhnlich mit dem Satz zunichte: »Oh, musst du immer so dramatisieren?« Genau mit diesem Wort hatte sie sich gegenüber Dr Braithwaite selbst getadelt. Später, als ich herausfand, dass seine Praxis nur wenige Minuten zu Fuß von der Überführung entfernt war, von der Veronica gesprungen war, war ich überzeugt, dass sie nicht »leichten Fußes«, wie er behauptete, gegangen war, sondern mit dem festen Vorsatz, ihrem Leben ein Ende zu setzen. Oder aber es war genau dieser Vorsatz, der ihren Gang so leicht gemacht hatte. Um nicht vorschnell zu urteilen und da man mir schon oft meine blühende Phantasie vorgehalten hat, ging ich am nächsten Tag erneut zu Foyles.
Ich wandte mich an einen ernsten jungen Mann, der eine Drahtgestellbrille und einen Fair-Isle-Pullunder trug. Er sah nicht danach aus, als würde er am Geschmack seiner Kunden Anstoß nehmen. Mit gedämpfter Stimme erklärte ich, ich hätte gerade Untherapie gelesen und wollte fragen, ob Collins Braithwaite noch etwas anderes geschrieben habe. Der junge Mann sah mich an, als sei ich soeben der Arche Noah entstiegen. »Etwas anderes?«, wiederholte er. »Das kann man wohl sagen!« Mit einem Wink seines Kopfes bedeutete er mir, ihm zu folgen. Ich hatte das Gefühl, an einer geheimen Verschwörung teilzunehmen. Zwei Stockwerke höher gelangten wir in die Abteilung für Psychologie. Er zog ein Buch aus dem Regal, drückte es mir in die Hand und raunte: »Verdammt brisant.« Ich sah auf das Buch. Auf dem Umschlag prangte die Silhouette eines menschlichen Körpers, der in lauter Einzelteile zersplittert war. Der Titel des Buches lautete: Töte dein Selbst. Zurück im Büro, hatte ich das Gefühl, im Besitz von Hehlerware zu sein. Ich konnte mich nicht konzentrieren und sagte Mr Brownlee, ich hätte furchtbare Kopfschmerzen, und bat ihn, mich früher gehen zu lassen. In meinem Zimmer packte ich das Buch sogleich aus. Leider muss ich gestehen, dass sich mir die »Brisanz« nicht erschloss, da es für mich keinerlei Sinn ergab. Ich bezweifle nicht, dass meine begrenzten intellektuellen Fähigkeiten daran schuld waren, aber mir kam das Buch wie die Aneinanderreihung von lauter unverständlichen Sätzen vor, von denen keiner in irgendeiner Verbindung zu dem Satz davor oder danach stand. Dennoch ließ mich der Titel erschauern, denn er schien mir zu bestätigen, dass Dr Braithwaite offensichtlich wahnsinnig war.
Ohne lange zu überlegen, beschloss ich, zur Polizei zu gehen. Am nächsten Morgen rief ich Mr Brownlee an und sagte ihm, ich würde später ins Büro kommen. Er fragte, ob ich immer noch krank sei, und ich erklärte, ich müsse im Zusammenhang mit einer Straftat eine Zeugenaussage machen. Meinem Vater sagte ich nichts, aber als ich beim Frühstück meinen Toast mit Butter bestrich, stellte ich mir vor, wie ich die Polizeiwache in der Harrow Street betrat und erklärte, ich wolle Anzeige wegen Mordes erstatten. Und wenn man mich fragte, welche Beweismittel ich hätte, würde ich Dr Braithwaites Bücher auf den Tresen legen. »Alles, was Sie wissen müssen«, würde ich mit erhobener Stimme sagen, »finden Sie in diesen Seiten.«
Ich kam nicht weiter als bis zur Ecke der Elgin Avenue. Ich stellte mir das entgeisterte Gesicht des ahnungslosen Beamten hinter dem Tresen vor, der mich fragte, was genau mein Anliegen sei. Vielleicht würde er einen unsichtbaren Vorgesetzten zurate ziehen oder hinter einer Trennwand verschwinden und seinen Kollegen erzählen, da draußen stehe eine Irre. Ich stellte mir vor, wie sie alle lachten und ich knallrot anlief. Jedenfalls wurde mir klar, dass mein Vorhaben ohne handfeste Beweise zum Scheitern verurteilt war und ich mich nur blamieren würde.
Viel einfacher war es dagegen, einen Termin mit Dr Braithwaite zu vereinbaren. Ich fand seine Nummer in den Gelben Seiten unter »Verschiedene Dienste«. Ich rief an einem Nachmittag vom Büro aus an, als Mr Brownlee außer Haus war. Es meldete sich eine fröhlich klingende junge Frau. Ich fragte nervös, ob ich einen Besuchstermin vereinbaren könne. »Selbstverständlich«, antwortete sie, als sei es die normalste Sache der Welt. Ich musste lediglich meinen Namen nennen. Wir vereinbarten einen Termin am kommenden Dienstag um halb fünf. Es war nicht komplizierter, als sich einen Termin beim Zahnarzt zu holen, aber als ich auflegte, hatte ich das Gefühl, die kühnste Tat meines Lebens vollbracht zu haben.
Eine Stunde vor der vereinbarten Zeit stieg ich in Chalk Farm aus der U-Bahn. Draußen fragte ich nach dem Weg zur Ainger Road. Der Mann, den ich angesprochen hatte, begann den Weg zu beschreiben, brach plötzlich ab und bot an, mich zu begleiten. Ich lehnte ab, da ich keine Lust auf eine Unterhaltung hatte. Auf keinen Fall wollte ich über die Gründe befragt werden, warum ich mich in dieser Gegend aufhielt.
»Ist keine große Sache«, sagte er. »Ich muss sowieso in die Richtung.« Er war ein gut aussehender Kerl Ende zwanzig und trug einen Fischerpullover und eine kurze schwarze Jacke. Er war glatt rasiert, hatte aber etwas von einem Beatnik. Er trug keinen Hut und hatte dichtes dunkles Haar, das ihm in einer imposanten Tolle über die Stirn fiel. Er hatte einen Akzent, den ich nicht zuordnen konnte, der aber nicht unangenehm klang. Ich hatte mir die Situation selbst eingebrockt. Bevor ich ihn angesprochen hatte, hatte ich mehrere harmlos aussehende Personen vorbeigehen lassen. Jetzt saß ich in der Klemme.
»Keine Angst, ich werde Sie nicht belästigen«, sagte er, bevor er lachend hinzufügte: »Es sei denn, Sie fordern mich dazu auf.«
Ich stellte mir vor, wie er mich in ein Gebüsch zerrte und sich auf mich warf. Zumindest hätte ich dann Gesprächsstoff bei meinem Termin mit Dr Braithwaite. Da ich keine Möglichkeit sah, mich anders aus der Affäre zu ziehen, machten wir uns schließlich auf den Weg. Mein Begleiter drückte seine Hände tief in seine Jackentaschen, als wolle er demonstrieren, dass er nicht die Absicht hatte, mich unsittlich zu berühren. Er sagte mir seinen Namen und fragte mich nach meinem. Der Austausch persönlicher Informationen dieser Art ist, glaube ich, vollkommen normal, sodass ich keinen Grund sah, die Gelegenheit nicht zu nutzen, um meine neue Identität auszuprobieren.
»Rebecca Smyth«, sagte ich. »Mit Y.«
Für den Namen hatte ich mich beim Tee bei Lyons auf der Elgin Avenue entschieden. Alle anderen Kandidaten hatte ich als unglaubwürdig verworfen: Olivia Carruthers, Elizabeth Drayton, Patricia Robson. Keiner davon klang echt. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite hatte ein Lieferwagen mit der Aufschrift James Smith & Söhne, Heizungsinstallateur geparkt. »Smith« war genau die Sorte Allerweltsname, die niemand als Decknamen wählen würde, und war deshalb ideal für meine Zwecke. Als mir der Gedanke kam, die Schreibweise abzuwandeln, begann sich bereits eine klar umrissene Person vor mir abzuzeichnen. »Smyth mit Y«, würde ich beiläufig sagen, als hätte ich den Satz schon tausendmal im Leben gesagt. Der Name Rebecca hatte mich schon immer fasziniert, vielleicht wegen des Romans von Daphne du Maurier. Ich mochte das Gefühl der drei kurzen Silben in meinem Mund und den gehauchten Laut bei geöffneten Lippen am Schluss. Mein eigener Name besaß nichts vergleichbar Sinnliches. Er war ein einsilbiger Ziegelstein, geeignet für Schülersprecherinnen in derben Schuhen. Warum sollte ich nicht ausnahmsweise einmal eine Rebecca sein? Vielleicht würde ich Dr Braithwaite erklären, mein psychisches Leiden käme daher, dass ich dem Bild meines Namens nicht gerecht wurde. Ich übte im Bad vor dem Spiegel und streckte mir die Hand entgegen, im Stil einer selbstbewussten Frau, wie zum Handkuss, mit leicht gekrümmten Fingern. Dann sah ich mit einem Lächeln auf, das ich für kokett hielt. Ich hatte bereits Gefallen daran gefunden, Rebecca Smyth zu sein. Und nun hatte ich den Namen zum ersten Mal Tom gegenüber (oder wie auch immer er hieß) laut ausgesprochen, und er hatte nicht mit der Wimper gezuckt. Warum sollte er auch? Er war nicht der Typ, den ein Mädchen mit einem nom d’emprunt abschrecken konnte.
»Und was führt Sie nach Primrose Hill, Rebecca Smyth?«
Ich beschloss, dass Rebecca nicht zu denjenigen gehörte, die sich für derlei schämten, und erwiderte, ich hätte einen Termin bei einem Psychiater.
Er blieb daraufhin nicht wie angewurzelt stehen, aber sah mich zumindest prüfend an. Er schob die Unterlippe vor. »Verzeihen Sie bitte, aber Sie scheinen mir nicht der Typ zu sein.«
»Der Typ?«, antwortete ich.
Tom sah mich unsicher an, als befürchtete er, mich verletzt zu haben.
»Sie meinen, ich sehe nicht aus wie eine Irre?«, sagte ich.
»Nun, wenn Sie das so sagen, nein, Sie sehen nicht aus wie eine Irre.«
»Ich versichere Ihnen, ich bin so verrückt wie ein Märzhase«, sagte ich mit Rebeccas gewinnendstem Lächeln.
Er schien nicht im Geringsten irritiert. »Nun, Sie sind der hübscheste Märzhase, dem ich je begegnet bin«, sagte er.
Ich reagierte darauf nicht. Ein Mädchen wie Rebecca wäre solche Schmeicheleien gewohnt. »Und was machen Sie hier?«, fragte ich.
»Ich habe in der Nähe mein Studio«, sagte er. »Ich bin Fotograf.«
»Wollen Sie mich nicht fragen, ob ich für Sie posieren möchte?«, fragte ich. Es machte richtig Spaß, Rebecca zu sein.
»Ich bin leider nicht die Sorte Fotograf«, sagte er. »Ich fotografiere Gegenstände, keine Menschen. Küchenmixer, Besteckkästen, Dosensuppen, solche Sachen.«
»Klingt aufregend«, sagte ich.
»Der sichere Weg zu Hohn und Tod«, erwiderte er.
»Wie bitte?«, fragte ich. Sollte das eine Anspielung auf sein bescheidenes Auskommen sein?
»Hohn und Tod. Lohn und Brot«, sagte er, und ich begriff, dass er bloß einen billigen Kalauer gemacht hatte. Immerhin war er so anständig, meine Verlegenheit zu teilen.
Mit Schauern registrierte ich, dass wir genau in diesem Moment die Überführung erreichten, von der Veronica sich hinuntergestürzt hatte. Ich sah sie zum ersten Mal. Es war ein trostloser Ort, um seinem Leben ein Ende zu machen, aber vermutlich nicht schlechter als jeder andere.
»Ist Ihnen kalt?«, fragte Tom. Er war definitiv einer von der besorgten Sorte.
Ich zog meinen Mantel am Hals zusammen und lächelte ihn an. »Es ist nur die frische Brise.«
Wir bogen in eine Art Einkaufsstraße ab. Tom blieb an einer Kreuzung stehen und zeigte in die Richtung der Ainger Road. Rebecca Smyth streckte ihre Hand aus. Tom nahm sie und erklärte, es sei ihm ein Vergnügen gewesen.
»Ganz meinerseits«, sagte ich, drehte mich auf dem Absatz um und ging.
»Sie sehen immer noch nicht aus wie eine Irre«, rief er mir hinterher. Ich erwartete fast, er würde mir nachlaufen und nach meiner Telefonnummer fragen, aber das tat er nicht. Als ich mich nach einer angemessenen Zeit umdrehte (man möchte ja nicht wie ein aufgeregter Backfisch wirken), war er verschwunden.
Ainger Road war eine unauffällige Straße mit Reihenhäusern. In den schmalen Vorgärten rosteten Dreiräder neben umgekippten Geranientöpfen vor sich hin. Ein paar kränkliche Bäume säumten den Bürgersteig. Die letzten Novemberblätter klammerten sich an die Zweige, als wüssten sie um ihr Schicksal. Die Häuser wirkten düster und unbewohnt. Alles kündete von Verfall. Ungewöhnlich war immerhin, dass die Häuser nicht auf der einen Straßenseite gerade und auf der anderen Seite ungerade Nummern trugen, sondern durchgehend nummeriert waren und so eine Art Schleife bildeten. Die angegebene Adresse unterschied sich in nichts von den anderen Häusern.3 Das Haus musste nachträglich geteilt worden sein, denn es gab zwei Türklingeln, eine über der anderen. Ein kleines Schild aus Pappe am Türpfosten mit der Aufschrift Braithwaite war der einzige Hinweis darauf, dass hier der berühmt-berüchtigte Seelenklempner seine Praxis hatte. Mein Termin war erst in vierzig Minuten. Ich lief deshalb noch einmal zurück zu einer Teestube in der Einkaufsstraße, an der ich zuvor mit Tom vorbeigekommen war.
Der Laden hieß Clays. Eine Türglocke kündigte mein Betreten an. Der Raum war leer, was angesichts der Tatsache, dass es kurz vor vier an einem Dienstagnachmittag war, nicht gerade überraschend war. Die übliche Klientel würde um diese Zeit zu Hause eifrig Kartoffeln schälen und die Heimkehr ihrer Göttergatten erwarten. Eine Matrone hinter der Theke grüßte mit einem gezwungenen Lächeln und beobachtete mich, wie ich in den hinteren Teil des Café ging, wo ich am wenigsten auffallen würde. Dann kam sie zu mir, und ihre ganze Haltung verriet mir, dass ihr mein Erscheinen lästig war. Mrs Clay war ein passender Name, denn sie hatte etwas von einem Golem, der bekanntlich aus einem großen Klumpen Lehm geschaffen worden war. Ich bestellte ein Kännchen Tee und – um ihren Unmut zu besänftigen – ein süßes Brötchen mit Marmelade. Ein Schild über der Theke verkündete, dass im Geschäft ausschließlich mit Butter statt mit Margarine gebacken wurde, »weil er den Unterschied schmeckt!«. Ich fragte mich, ob Tom jemand wäre, der den Unterschied schmecken würde. Ich vermutete nicht. Oder er würde sich eher mit wichtigeren Dingen beschäftigen als mit den Zutaten eines süßen Brötchen. Ich teilte seine Haltung. Ich habe nie in meinem Leben süße Brötchen gebacken (abgesehen von einem erfolgreich verdrängten Versuch im Fach Hauswirtschaft) und habe auch nicht vor, es je zu probieren. Mein Ehemann, wenn ich denn jemals einen haben sollte, wird ohne süße Brötchen durchs Leben gehen müssen. Oder sich anderweitig nach süßen Brötchen umsehen müssen, haha. Genauso wenig kann ich mir vorstellen, dass Rebecca Smyth ihre sorgfältig manikürten Hände in eine Schüssel Mehl steckt, und selbst wenn sie es täte, würde sie selbstverständlich nicht im Traum auf die Idee kommen, so etwas Ordinäres wie Margarine als Zutat zu verwenden.
Die Ladenbesitzerin brachte meinen Tee. Mein Versuch, mich bei ihr einzuschmeicheln, schien gescheitert zu sein. Sie stellte Tasse und Untertasse gleichgültig auf den Tisch, und als sie das süße Brötchen brachte, knallte sie den Teller so hart auf die Tischplatte, dass das Messer zu Boden fiel. Ich fischte neben meinen Füßen danach und bedankte mich unterdessen bei ihr. Ich fragte mich, ob vielleicht der unabsichtliche Verstoß gegen irgendeine Regel des Etablissements für den frostigen Empfang verantwortlich war. Die einfachste Erklärung – mit der ich recht gut leben konnte – war die, dass ich eine Fremde war und keine besondere Beachtung verdiente. Dieser Verdacht wurde bestätigt, als die Türglocke ging und eine ältere Dame in einem Kamelhaarmantel und einem Wollschal eintrat. Auf dem Kopf trug sie einen Herrenhut aus Tweed, an dem ein paar kecke bunte Federn steckten, und in der rechten Hand einen Gehstock. Mrs Clays Verhalten änderte sich schlagartig. Sie begrüßte den neuen Gast – eine Mrs Alexander – so überschwänglich, dass es mich nicht gewundert hätte, wenn sie hinter ihrer Theke hervorgetreten wäre und Rosenblätter vor ihr ausgestreut hätte. Die Dame setzte sich an ihren Stammtisch am Fenster und bekam in kürzester Zeit ein Kännchen Tee und ein Stück Victoria-Sponge-Kuchen, das die Ladenbesitzerin, wie ich bemerkte, behutsam vor ihr auf den Tisch stellte.
Ich holte ein Buch aus meiner Handtasche und begann zu lesen. Es war ein Unterhaltungsroman und unter meinem Niveau, aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass Mrs Clay sich für Literaturkritik interessierte. Gleichzeitig musste ich an die Worte meines vorherigen Begleiters denken. Er hatte gesagt, ich sähe nicht nach einer Irren aus. Normalerweise würde man das als Kompliment verstehen, aber in Anbetracht meiner aktuellen Mission war es das eher nicht. Ich hatte am Morgen mehr Sorgfalt auf mein Aussehen verwandt als üblich, und bevor ich Mr Brownlees Büro verlassen hatte, war ich auf der Toilette auf dem Flur verschwunden und hatte neues Make-up aufgelegt. Das war ein Fehler gewesen. Geisteskranke lassen ihr Haar nicht bei Stephen’s in St John’s Wood machen. Und sie tragen auch kein schickes Halstuch in der Farbe ihres Lidschattens oder Strümpfe von Peterson’s. Irre verwenden keine Zeit auf solche Äußerlichkeiten. Wenn ich in diesem Aufzug bei Dr Braithwaite erschiene, hätte er mich sofort durchschaut. Ich ging zur Toilette des Cafés und betrachtete mich im Spiegel. Kein Lippenstift für Irre, dachte ich und wischte ihn mit dem Handrücken ab. Mit dem Finger verschmierte ich das Mascara um meine Augen, um mir den typischen Panda-Look von Leuten zu verpassen, die seit Wochen nicht richtig geschlafen haben. Ich wusch mir die Hände, zog anschließend die Klammern aus meinem Haar und verstrubbelte es mit den Fingern. Das Halstuch musste ebenfalls verschwinden. Ich nahm es ab und stopfte es in die Manteltasche. Dann klappte ich den Toilettendeckel herunter und setzte mich darauf. Die Tat schmerzte mich (ich hatte zehn Shilling dafür bezahlt), aber ich beugte mich herab und ritzte mit dem Daumennagel eine Laufmasche in meinen Nylonstrumpf, gleich unterhalb des linken Knies. Es war der letzte Schliff, denn keine Frau bei klarem Verstand würde so etwas durchgehen lassen. Ich stand auf und überprüfte mein Aussehen im Spiegel über dem Handwaschbecken. Zu viel des Guten. Ich sah aus wie frisch entlaufen. Da ich nicht gleich in die nächste Klapsmühle abtransportiert werden wollte, befeuchtete ich einen Klumpen Toilettenpapier und entfernte das Mascara um die Augen. Die Grundierung musste ebenfalls weg. Zuletzt war ich zufrieden. Ich sah bleich wie der Tod aus. Männer haben natürlich keine Ahnung, wie viel Arbeit wir darauf verwenden, ihnen ein attraktives Äußeres zu bieten, aber ich hoffte, Dr Braithwaite würde meine Anstrengungen in die gegenteilige Richtung zu würdigen wissen.
Ich spülte die Toilette und ging zurück an meinen Platz. Das kratzende Geräusch des Stuhls auf dem Boden ließ die Besitzerin zu mir herüberblicken. Sie starrte mich an, als sei eine völlig andere Person von der Toilette zurückgekommen. Mein Tee war kalt, und obwohl ich nicht den geringsten Appetit verspürte, bestrich ich das Brötchen mit Butter und der Aprikosenmarmelade aus dem Schälchen und aß es hastig auf. Es würde doch sonderbar wirken, ein süßes Brötchen zu bestellen und es nicht zu essen! Als ich zum Bezahlen zum Tresen ging, lobte ich die Wirtin für ihre Backkunst, um auf keinen Fall mit den Banausen in einen Topf geworfen zu werden, die man mit Margarine abspeisen konnte.
Sie sah mich ungläubig an. Ich erwartete, dass sie eine Bemerkung zu meinem Aussehen machen würde, aber sie hielt sich zurück und tippte den Betrag in die Kasse ein. Ich zahlte und legte zwei Pence Trinkgeld auf den Unterteller, in der Hoffnung, damit ihre gute Meinung von mir wiederherstellen zu können.
Draußen war es inzwischen dunkler geworden. Die Ainger Road wirkte nun eher bedrohlicher als bloß heruntergekommen. Ich ging zum Eingang von Hausnummer *** und drückte auf die untere der beiden Klingeln. Da sich nichts rührte, öffnete ich die Tür und trat in einen schmalen Flur. An der Wand lehnte ein Fahrrad. Eine Notiz am Treppengeländer wies Besuchern den Weg nach oben. Der