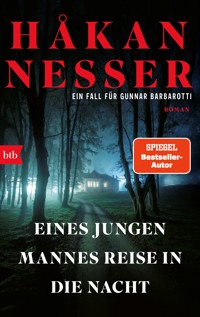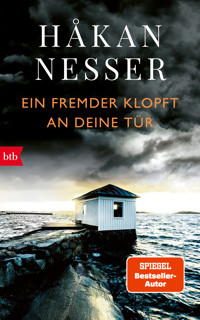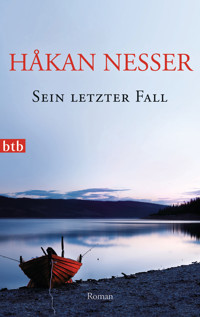11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Van-Veeteren-Krimis
- Sprache: Deutsch
Kommissar Van Veeteren schwört Rache: Sein Sohn Erich, seit Jahren das Sorgenkind der Familie, wird ermordet aufgefunden, gerade als er wieder anfing, im bürgerlichen Leben Fuß zu fassen. Hat er sich auf kriminelle Geschäfte eingelassen? Wenig später wird die Leiche einer jungen, unbescholtenen Frau entdeckt – von derselben Waffe erschlagen wie Erich Van Veeteren. Was verband die beiden jungen Leute? Wer hatte ein Interesse, sie aus dem Weg zu räumen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 435
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Buch
Es ist eine neblige, nasskalte Nacht. Der Regen gießt in Strömen, und der Junge, der am Straßenrand geht, ist kaum zu sehen. Als der Mann den Aufprall hört, ist es bereits zu spät: die Verletzungen des Jungen sind tödlich — und der schwer angetrunkene Fahrer gerät in Panik und macht sich aus dem Staub. Warum sollte er sein ganzes Leben zerstören wegen dieses Unglücksfalls? Sich von seiner Karriere verabschieden? Seine Zukunft aufs Spiel setzen, die auf einmal in leuchtenden Farben vor ihm steht? Er kann nicht wissen, dass seine Feigheit schließlich drei weiteren Menschen den Tod bringen wird und seine Vertuschungsmanöver ihn letztlich gründlicher ruinieren werden, als seine Todesfahrt es je gekonnt hätte ...
Autor
Håkan Nesser, Jahrgang 1950, ist einer der interessantesten und aufregendsten Krimiautoren Schwedens. In seiner Heimat gilt er als der unbestrittene Star in seinem Genre. Für seine Kriminalromane um Kommissar Van Veeteren erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, sie sind in mehrere Sprachen übersetzt und wurden erfolgreich verfilmt. Håkan Nesser lebt in Uppsala.
Die Van Veteeren-Serie bei btb
Das grobmaschige Netz. Roman Das vierte Opfer. Roman Das falsche Urteil. Roman Die Frau mit dem Muttermal. Roman Der Kommissar und das Schweigen. Roman Münsters Fall. Roman Der unglückliche Mörder. Roman Der Tote vom Strand. Roman Die Schwalbe, die Katze, die Rose und der Tod. Roman Sein letzter Fall. Roman Der Verein der Linkshänder. Roman
Inhaltsverzeichnis
»In the natural order of things, fathers do not bury their sons.«
PAUL AUSTER, The Red Notebook
I
1
Der Junge, der bald sterben würde, lachte und befreite sich aus der Umarmung. Wischte sich einige Chipskrümel vom Hemd und stand auf.
»Ich muss jetzt los«, sagte er. »Wirklich. Der letzte Bus geht in fünfzehn Minuten.«
»Ja«, sagte das Mädchen. »Das musst du wohl. Ich trau mich einfach nicht, dich hier übernachten zu lassen. Ich weiß nicht, was meine Mutter sagen würde, sie kommt in zwei Stunden nach Hause. Hat heute Abend Spätdienst.«
»Schade«, sagte der Junge und zog sich den dicken Pullover über den Kopf. »Wäre schön, bei dir zu bleiben. Könnten wir denn nicht ... ich meine ...«
Er wusste nicht, wie er den Satz beenden sollte. Sie lächelte und nahm seine Hand. Hielt ihn fest. Sie wusste, dass er nicht wirklich meinte, was er da sagte. Wusste, dass er nur so tat. Er würde sich niemals trauen, dachte sie. Würde mit so einer Situation einfach nicht umgehen können ... und für eine kurze Sekunde spielte sie mit dem Gedanken Ja zu sagen. Ihn bleiben zu lassen.
Nur um seine Reaktion zu testen, natürlich. Um zu sehen, ob er der Situation gewachsen wäre oder ob er seine Maske fallen lassen würde.
Nur um ihn einen Moment lang glauben zu lassen, sie wolle sich wirklich nackt mit ihm ins Bett legen.
Könnte doch witzig sein. Könnte ihr allerlei über ihn beibringen, aber sie tat es dann doch nicht. Gab den Gedanken auf; es wäre nicht gerade aufrichtig, und sie mochte ihn viel zu sehr, um sich so egoistisch und berechnend zu verhalten. Sie mochte ihn ungeheuer gern, wenn sie es recht bedachte, und deshalb würden sie früher oder später sowieso dort landen. Mit ihren nackten Körpern unter derselben Decke liegen ... doch, das fühlte sie seit einigen Wochen, es gab keinen Grund, diese Tatsache zu leugnen.
Der Erste. Er würde der Erste sein. Aber noch nicht an diesem Abend.
»Ein andermal«, sagte sie und ließ ihn los. Fuhr sich mit den Händen durchs Haar, um sich von der statischen Elektrizität zu befreien, die sein glatter Hemdenstoff hervorgerufen hatte. »Ihr denkt auch nur an das eine, ihr verdammten Gorillamännchen!«
»Äh«, sagte er und versuchte eine Miene kleidsamer Enttäuschung zu zeigen.
Er ging in die Diele. Sie strich ihren Pullover gerade und folgte ihm.
»Wir könnten ganz still sein, du könntest dich schlafend stellen, und ich könnte mich morgen ganz früh davonschleichen«, sagte er, um sich nicht zu früh geschlagen zu geben.
»Wir holen das alles nach«, sagte sie. »Nächsten Monat hat meine Mutter Nachtschicht — dann vielleicht?«
Er nickte. Stieg in seine Stiefel und suchte nach Schal und Handschuhen.
»Verdammt, ich hab mein Französischbuch liegen lassen. Würdest du es für mich holen?«
Das tat sie. Nachdem er seinen Mantel zugeknöpft hatte, umarmten sie sich noch einmal. Durch alle Stoffschichten hindurch konnte sie seinen steifen Penis spüren; er drückte sich gegen sie und sie registrierte kurz eine zitternde Mattigkeit. Das war ein schönes Gefühl, wie zu fallen, ohne an die Landung denken zu müssen, und sie begriff, dass die Verbindungen zwischen Vernunft und Gefühl, zwischen Hirn und Herz, genauso schwach sind, wie ihre Mutter behauptet hatte, als sie kürzlich beim Frühstück ein ernstes Gespräch geführt hatten.
Wenig, worauf Verlass war. Die Vernunft ist nur ein Taschentuch, mit dem wir uns danach die Nase putzen, hatte ihre Mutter gesagt und ausgesehen, als wisse sie, wovon sie da redete.
Was natürlich auch der Fall war. Drei Männer hatte sie gehabt, und keiner davon war ein Sammlerstück gewesen, wenn die Tochter das richtig verstanden hatte. Ihr Vater am allerwenigsten. Sie biss sich in die Lippe und schob ihn weg. Er lachte leicht verlegen.
»Ich mag dich, Wim«, sagte sie. »Wirklich. Aber jetzt musst du los, sonst verpasst du den Bus.«
»Ich mag dich auch«, sagte er. »Deine Haare ...«
»Meine Haare?«
»Du hast so verflixt schöne Haare. Wenn ich ein kleines Tier wäre, würde ich darin wohnen wollen.«
»Also echt«, sie lachte. »Willst du damit sagen, ich hätte Ungeziefer in den Haaren?«
»Nicht doch.« Er verzog den Mund zu einem breiten Grinsen. »Ich meine nur, wenn ich vor dir sterbe, dann will ich als kleines Tier wiedergeboren werden und in deinen Haaren wohnen. Damit wir trotzdem noch zusammen sind.«
Sie wurde ernst.
»So darfst du nicht über den Tod sprechen«, sagte sie. »Ich mag dich so sehr, aber sprich nicht so leichtfertig über den Tod, bitte.«
»Verzeihung«, sagte er. »Ich hatte vergessen ...«
Sie zuckte mit den Schultern. Ihr Großvater war einen Monat zuvor gestorben, sie hatten sich eine Weile darüber unterhalten.
»Das macht nichts. Ich mag dich trotzdem. Wir sehen uns morgen in der Schule.«
»Machen wir. Aber jetzt muss ich wirklich gehen.«
»Soll ich dich nicht wenigstens zur Bushaltestelle bringen?«
Er schüttelte den Kopf. Öffnete die Wohnungstür.
»Sei nicht albern. Es sind doch nur zwanzig Meter.«
»Ich mag dich«, sagte das Mädchen.
»Ich dich auch«, sagte der Junge, der bald sterben würde. »Und wie!«
Sie umarmte ihn zum letzten Mal, und er lief die Treppen hinunter.
Der Mann, der bald töten würde, sehnte sich nach Hause.
Nach seinem Bett oder nach seiner Badewanne, das wusste er nicht so genau.
Nach beidem vermutlich, entschied er, während er heimlich auf seine Armbanduhr schaute. Zuerst ein richtig heißes Bad, dann das Bett. Warum sollte man entweder-oder sagen, wenn man auch sowohl-als-auch haben konnte? Himmel, er saß hier jetzt schon seit über vier Stunden mit diesen Trotteln zusammen. . . vier Stunden! Er schaute sich am Tisch um und fragte sich, ob einer von den anderen dasselbe Gefühl haben könnte. Und alles ebenso satt haben wie er selber.
Es sah nicht danach aus. Muntere und entspannte Gesichter überall; ein wenig kam das natürlich vom Alkohol, aber die anderen schienen sich in dieser Gesellschaft offenbar wohl zu fühlen. Sechs Herren in ihren besten Jahren, dachte er. Erfolgreich und wohlhabend, zumindest nach normalen Maßstäben. Möglicherweise sah Greubner ein wenig müde und niedergeschlagen aus, aber vermutlich kriselte es wieder einmal in seiner Ehe ... oder in der Firma. Oder warum nicht in beidem, wie gesagt?
Nein, jetzt reicht es, beschloss er und kippte den letzten Cognacrest. Wischte sich mit der Serviette die Mundwinkel und erhob sich langsam.
»Ich sollte jetzt wohl«, setzte er an.
»Schon?«, fragte Smaage.
»Ja. Morgen ist auch noch ein Tag. Und mehr hatten wir doch nicht auf der Tagesordnung?«
»He«, sagte Smaage. »Wenn, dann noch ein Cognäcchen. He.«
Der Mann, der bald töten würde, erhob sich endgültig.
»Ich sollte jetzt auf jeden Fall«, sagte er noch einmal und ließ den Satz absichtlich in der Schwebe. »Darf man den Herren eine gute Nacht wünschen, und sumpft hier nicht mehr allzu lange herum.«
»Prost«, sagte Kuijsma.
»Friede, Bruder«, sagte Lippmann.
Draußen im Foyer merkte er plötzlich, dass er wirklich ziemlich viel getankt hatte. Es fiel ihm schwer, in den Mantel zu finden, so schwer jedenfalls, dass der tätowierte Athlet hinter dem Garderobentresen sich die Mühe machte, dahinter hervorzukommen, um ihm zu helfen. Das war unleugbar ein wenig peinlich. Eilig lief er die kurze Treppe hinunter, in die erfrischende Kühle der Nacht hinaus.
Regen hing in der Luft, und die schwarz glänzenden Pflastersteine auf dem Markt erzählten von dem Guss, der sie vor nicht langer Zeit getroffen hatte. Der Himmel wirkte unruhig und verhieß noch weitere Schauer. Der Mann band sich sein Halstuch um, bohrte die Hände in die Taschen und ging an der Zwille entlang zum großen Platz, wo sein Wagen stand. Gar nicht blöd, so ein kleiner Spaziergang, dachte er. Schon nach einigen hundert Metern wird man viel klarer im Kopf. Was bestimmt nicht schadet.
Die Uhr am Warenhaus Boodwick zeigte zwanzig Minuten nach elf, als er an dessen hell erleuchteten Eingang vorüberkam, doch der Ruyders Plein lag dunkel und verlassen da wie eine vergessene Grabstätte. Über der Langgraacht hing jetzt der Nebel, und als er die Eleonorabrücke überquerte, rutschte er einige Male aus; die Temperatur konnte nur um weniges über Null liegen. Er schärfte sich ein, vorsichtig zu fahren. Überfrierende Nässe und Alkohol im Blut waren keine gute Kombination. Für einen kurzen Moment erwog er sogar, sich ein Taxi zu nehmen, aber er konnte keins sehen, und so ließ er diese Idee wieder fallen. Außerdem würde er am nächsten Morgen das Auto sehr früh brauchen, und die Vorstellung, es auf dem großen Platz stehen zu lassen, kam ihm nicht sonderlich attraktiv vor. Obwohl er erst kürzlich eine ziemlich aufwändige Alarmanlage hatte einbauen lassen, wusste er ja, wie die Lage war. Es wäre keine Kunst für zwei geschickte Diebe, das Auto aufzubrechen, die Stereoanlage herauszuholen und sich in Sicherheit zu bringen, ehe irgendwer auch nur begriffen hätte, was vor sich ging. So war es nun einmal, stellte er mit nüchterner Resignation fest und bog in die Kellnerstraat ab.
Ansonsten war es ja nicht das erste Mal, dass er mit etwas Schnaps im Leib losfuhr. Es war schon ein- oder zweimal vorgekommen, und es hatte niemals Probleme gegeben. Als er jetzt quer über den Platz auf seinen roten Audi zuging, versuchte er sich zu erinnern, wie viel er sich an diesem Abend zu Gemüte geführt hatte, aber es gab da doch etliche Unklarheiten, und er kam zu keinem sicheren Ergebnis. Also öffnete er mit der Fernbedienung den Wagen und ließ sich hinters Steuer fallen. Stopfte sich vier Halstabletten in den Mund, ließ den Motor an und dachte an sein Schaumbad.
Eukalyptus, beschloss er. Schaute auf die Uhr. Es war zwei Minuten nach halb zwölf.
Der Bus fuhr in dem Moment an ihm vorbei, als er aus dem Haus kam.
Er hob die Hand, in dem reflexmäßigen Versuch, den Fahrer zum Anhalten zu bewegen. Danach fluchte er ausgiebig und sah zu, wie die Rücklichter auf der leichten Steigung zur Universität hin verschwanden.
Scheiße, dachte er. Warum muss der ausgerechnet heute Abend den Fahrplan einhalten? Typisch. Verflixt typisch!
Doch als er auf die Uhr sah, stellte er fest, dass er fast fünf Minuten zu spät dran war, und dass deshalb alles nur seine Schuld war.
Seine und Katrinas, nicht zu vergessen. Beim Gedanken an sie hob sich seine Laune ein wenig. Energisch zog er seinen Rucksack gerade, streifte die Kapuze über und setzte sich in Bewegung.
Er hatte eine gute Dreiviertelstunde vor sich, aber er würde auf jeden Fall um kurz nach zwölf zu Hause sein. Das war nicht so schlimm. Seine Mutter würde am Küchentisch sitzen und auf ihn warten, davon konnte er natürlich ausgehen. Sie würde am Tisch sitzen und diese zutiefst vorwurfsvolle Miene an den Tag legen, die sie im Laufe der Jahre zu großer und stummer Dramatik entwickelt hatte, aber das war nicht die Welt. Jeder kann schließlich den Bus verpassen, das kommt in den besten Familien vor.
Beim Keymerfriedhof spielte er mit dem Gedanken an eine Abkürzung. Aber er beschloss, den Friedhof zu umrunden; zwischen Gräbern und Kapelle sah es nicht gerade einladend aus, schon gar nicht in dieser kalten Finsternis mit frostigen Nebelfetzen, die durch Gassen und Gänge und aus den schwarzen Kanälen krochen. Offenbar wollten sie die Stadt in eine nächtliche Decke hüllen. Ein für alle Mal.
Ihn schauderte, und er beschleunigte sein Tempo. Ich hätte bei ihr bleiben können, dachte er plötzlich. Hätte Mama anrufen und bei Katrina bleiben können. Sie hätte natürlich zuerst herumgequengelt, aber was hätte sie schon tun können? Der letzte Bus war ja schließlich weg. Ein Taxi konnte er sich nicht leisten, und weder Uhrzeit noch Witterung ließen es angebracht erscheinen, dass ein Junge ganz allein unterwegs war.
Oder dass eine Mutter ihn dazu ermunterte.
Doch das waren nur Gedankenspielereien. Zielstrebig ging er weiter. Durch den Stadtwald — über den spärlich beleuchteten Geh- und Radweg — lief er fast und erreichte damit die Hauptstraße schneller als erwartet. Jetzt noch das letzte Stück, dachte er. Die lange, triste Wanderung entlang der Hauptstraße, keine besonders angenehme Strecke, wenn man es genau nahm. Es war kaum Platz für Radfahrer und Fußgänger. Nur den schmalen Streifen zwischen Straßengraben und Fahrbahn, und die Autos fuhren schnell. Es gab keine Geschwindigkeitsbegrenzung und keine nennenswerte Straßenbeleuchtung.
Zwanzig Minuten Wanderung über eine dunkle Straße im November. Er war erst zweihundert Meter weit gekommen, als ein kalter Wind aufkam und den Nebel zerriss, und dann brach der Regen über ihn herein.
Verdammt, dachte er. Jetzt könnte ich in Katrinas Bett liegen. Nackt, und ganz dicht bei Katrina, mit ihrem warmen Körper und ihren behutsamen Händen, ihren Beinen und ihrer Brust, auf die er fast die Hand hätte legen dürfen ... dieser Regen musste ein Zeichen sein.
Doch trotz allem ging er weiter. Ging weiter durch Regen und Wind und Dunkelheit und dachte an sie, die die Erste sein sollte.
Die die Erste hätte sein sollen.
Er hatte ein wenig schräg geparkt, musste rückwärts aus der Lücke fahren und als er gerade glaubte, es geschafft zu haben, schrammte seine rechte Heckflosse an einem dunklen Opel vorbei.
Zum Teufel, dachte er. Warum habe ich mir kein Taxi genommen? Vorsichtig öffnete er die Tür und schaute nach hinten. Erkannte, dass wirklich so gut wie gar nichts passiert war. Eine Bagatelle. Er schloss die Tür wieder. Man musste ja auch bedenken, überlegte er weiter, man musste ja auch bedenken, dass die Fenster beschlagen waren und die Sicht fast minimal.
Warum genau man das bedenken musste, wollte er nicht weiter untersuchen. Er fuhr rasch vom Platz und überquerte die Zwille ohne Probleme. Es herrschte kaum Verkehr, er ging davon aus, dass er in einer Viertelstunde oder höchstens zwanzig Minuten zu Hause sein würde, und während er am Alexanderlaan auf Grün wartete, fragte er sich, ob von dem Eukalyptusschaum wirklich noch etwas übrig sein könnte. Als die Ampel wechselte, brüllte der Motor auf ... das kam von dieser verdammten Feuchtigkeit. Danach fuhr er einen zu engen Bogen und knallte gegen die Verkehrsinsel.
Das aber nur mit dem Vorderrad. Kein größerer Schaden passiert ... oder gar keiner, wenn man genauer hinsah. Er brauchte einfach nur ein fröhliches Gesicht aufzusetzen und weiterzufahren, redete er sich ein, aber dann ging ihm plötzlich auf, dass er um einiges betrunkener war, als er gedacht hatte.
Verdammt, dachte er. Ich muss auf jeden Fall wach bleiben. Wäre gar nicht komisch, wenn ...
Er kurbelte das Seitenfenster zehn Zentimeter nach unten und drehte das Gebläse voll auf, um zumindest die Fenster frei zu kriegen. Danach fuhr er lange in vorbildlich niedrigem Tempo weiter und passierte Bossingen und Deijkstra, wo sich während der vergangenen fünfunddreißig Jahre kein Verkehrspolizist mehr hatte sehen lassen, und als er die Hauptstraße erreichte, ging ihm auf, dass er sich unnötig vor Frostglätte gefürchtet hatte. Inzwischen regnete es heftig; er schaltete die Scheibenwischer ein und verfluchte zum fünfzigsten Mal in diesem Herbst, dass er immer wieder vergaß, sich neue zuzulegen.
Morgen, dachte er. Morgen fahre ich als Erstes zur Tankstelle. Es ist doch Wahnsinn zu fahren, ohne richtig sehen zu können ...
Später konnte er einfach nicht sagen, ob er zuerst etwas gehört oder gesehen hatte. Der weiche Aufprall und das leichte Rucken des Lenkrades jedenfalls hatten sich seiner Erinnerung am deutlichsten eingeprägt. Und seinen Träumen. Dass das hier, was für den Bruchteil einer Sekunde am Rand seines Blickfeldes vorüberwirbelte, mit der kleinen Vibration zusammenhing, die seine Hände wahrnahmen, begriff er nicht sofort. Jedenfalls nicht bewusst.
Das passierte erst beim Bremsen.
Es passierte erst später — nach diesen fünf oder sechs Sekunden, die vergangen sein mussten, nachdem er den Wagen angehalten hatte und über die triefnasse Fahrbahn gelaufen war.
Dabei dachte er an seine Mutter. Daran, wie sie einmal, als er krank war — es musste während der allerersten Schuljahre gewesen sein — ihre kühle Hand auf seine Stirn gelegt hatte, während er kotzte und kotzte und kotzte; grüngelbe Galle in einem roten Plastikeimer. Es hatte so teuflisch wehgetan, und diese Hand war so kühl und schön gewesen, und er fragte sich, warum in aller Welt er gerade jetzt daran denken musste. Diese Erinnerung lag mehr als dreißig Jahre zurück und er glaubte nicht, seither noch einmal daran gedacht zu haben. Seine Mutter war seit über einem Jahrzehnt tot, es war wirklich ein Rätsel, warum die Erinnerung jetzt auftauchte und wieso er ...
Er entdeckte den Jungen erst, als er fast schon an ihm vorbei war und er wusste sofort, dass er tot war.
Ein Junge in einem dunklen Dufflecoat. Er lag unten im Graben; seltsam verzerrt, mit dem Rücken an einem zylindrischen Zementrohr, das Gesicht dem Mann zugekehrt. Als starre er ihn an und versuche irgendeinen Kontakt aufzunehmen. Als wolle er ihm etwas sagen. Seine Gesichtszüge waren teilweise unter seiner Kapuze versteckt, aber die rechte Gesichtshälfte — die allem Anschein nach gegen den Zement geschleudert worden war — lag entblößt da wie ein ... wie ein anatomisches Objekt.
Er blieb stehen und kämpfte gegen seinen Brechreiz an. Dieselben Reflexe, dieselben alten Reflexe wie vor dreißig Jahren, zweifellos. Zwei Wagen fuhren vorüber, in entgegengesetzten Richtungen, aber niemand schien ihn bemerkt zu haben. Er spürte, dass er jetzt zitterte. Er holte zweimal tief Luft und stieg in den Graben. Kniff die Augen zusammen und riss sie nach einigen Sekunden wieder auf. Beugte sich vor und tastete behutsam nach dem Puls des Jungen, an dessen Handgelenken und an dem blutverschmierten Hals.
Es gab keinen. Verdammt, dachte er und spürte, wie Panik in ihm aufstieg. Verdammte Pest, ich muss ... ich muss ... ich muss ...
Ihm fiel nicht ein, was er musste. Vorsichtig schob er die Arme unter den Körper des Jungen, ging in die Knie und hob ihn hoch. Seine Lendenwirbel knackten, der Junge war schwerer, als er gedacht hatte, vielleicht machten dessen durchnässte Kleider sich bemerkbar. Falls er überhaupt etwas gedacht hatte. Warum hätte er es tun sollen? Der Rucksack war ein kleines Problem. Rucksack und Kopf, beide wollten immer wieder auf wirklich unmögliche Weise nach hinten kippen. Er registrierte, dass das Blut aus dem Mundwinkel in die Kapuze tropfte und dass der Junge höchstens fünfzehn oder sechzehn Jahre alt sein konnte. Ein Junge von fünfzehn, sechzehn ... ungefähr so alt wie Greubners Sohn. Das sah er an den ein wenig unfertigen Gesichtszügen, trotz der Verletzungen ... ein ziemlich gut aussehender Junge, nahm er an, würde zweifellos ein attraktiver Mann werden.
Hätte es werden sollen.
Er stand eine ganze Weile mit dem Leichnam auf den Armen unten im Graben, während die Gedanken durch seinen Kopf wirbelten. Der Hang zur Fahrbahn war nur einen Meter hoch, doch er war steil und der Regen machte ihn glitschig und trügerisch; der Mann glaubte nicht, darauf Halt finden zu können. Während er dort stand, kam kein Auto vorbei, doch er hörte in der Ferne, wie ein Moped sich näherte. Oder vielleicht auch ein Motorrad, dachte er. Als es vorüberfuhr, registrierte er, dass es sich um einen Roller handelte, und für einen Moment wurde er von den Scheinwerfern geblendet. Vermutlich — zumindest war er später davon überzeugt — vermutlich brachte ihn diese eine Sekunde blendender Helligkeit wieder zu Bewusstsein. Half seinem Denken wieder in rationale Bahnen zurück.
Behutsam lehnte er den Leichnam gegen die Röhre. Spielte mit dem Gedanken, sich im nackten Gras das Blut von den Händen zu wischen, gab diese Idee dann aber auf. Kletterte zurück auf die Fahrbahn, lief zurück zu seinem Auto.
Registrierte, dass er rein reflexhaft den Motor ausgeschaltet haben musste, dass die Scheinwerfer jedoch noch brannten. Registrierte, dass der Regen wie eine wahnsinnige Naturkraft herunterprasselte. Registrierte, dass er fror.
Er ließ sich hinter das Lenkrad sinken und schloss die Tür. Schnallte sich an und fuhr los. Die Sicht hatte sich jetzt verbessert, so, als habe der Regen die Fensterscheiben auch von innen abgewaschen.
Nichts ist passiert, dachte er. Rein gar nichts.
Er nahm die ersten Anzeichen heraufziehender Kopfschmerzen wahr, doch wieder tauchte die Erinnerung an die kühlen Hände seiner Mutter auf, und plötzlich war er sich ganz sicher, dass die Eukalyptusflasche doch noch nicht ganz leer war.
2
Er erwachte und spürte als Erstes eine unbeschreibliche Erleichterung.
Die hielt drei Sekunden an, dann ging ihm auf, dass es kein böser Traum gewesen war.
Sondern Wirklichkeit.
Der prasselnde Regen, das plötzliche leichte Rucken des Rades, der glitschige Straßengraben; all das war Wirklichkeit. Das Gewicht des Jungen in seinen Armen und das in die Kapuze tropfende Blut.
Zwanzig Minuten lang lag er wie gelähmt im Bett. Das Einzige, was in dieser Zeit passierte, war, dass ihn ab und zu ein Schauder durchfuhr. Es begann ganz unten unter der Fußsohle, wanderte dann durch seinen Körper nach oben, um schließlich in seinem Kopf wie ein einziger weißer Blitz zu detonieren, und jedes Mal hatte er das Gefühl, als werde dabei ein wichtiger Teil seines Gehirns und seines Bewusstseins zerschossen. Zu Eissplittern gefroren oder verbrannt, um niemals wieder repariert und wieder in Gebrauch genommen werden zu können.
Lobotomie, dachte er. Ich werde einer Lobotomie unterzogen.
Als die starrköpfig roten Ziffern auf seinem Radiowecker sich bis zu 07.45 Uhr vorgearbeitet hatten, griff er zum Telefon und rief an seinem Arbeitsplatz an. Erklärte mit einer Stimme, die so brüchig war wie Eis, das nur eine Nacht alt ist, die aber doch trug, dass er eine Grippe erwischt habe und einige Tage zu Hause bleiben müsse.
Grippe, ja.
Ja, wirklich Pech, aber nun einmal nicht zu ändern.
Doch, sie könnten natürlich anrufen, wenn sie eine Auskunft brauchten.
Nein, er würde im Bett bleiben. Ein paar Tabletten nehmen und so viel trinken wie möglich.
Ja. Doch. Nein.
Eine halbe Stunde später stand er auf. Trat ans Küchenfenster und schaute hinaus auf die triste Vorortstraße, wo der Regen sich zufälligerweise zurückgezogen und einem schweren, grauen Morgennebel Platz gemacht hatte. Und während er noch dastand, stellte sich nach und nach langsam ein Gedanke ein, der, wie er sich erinnerte, schon am vergangenen Abend zur Stelle gewesen war — und später, in den verzweifelten, durchwachten Stunden, nach denen er dann endlich doch hatte einschlafen können.
Nichts war passiert. Rein gar nichts.
Er ging hinaus in die Küche. In der Speisekammer stand eine ungeöffnete Whiskyflasche. Glenalmond, von einer Sommerreise. Er drehte den Verschluss ab und nahm zwei große Schlucke. Konnte sich nicht daran erinnern, das in seinem Leben schon einmal getan zu haben. Whisky direkt aus der Flasche getrunken, nein, niemals.
Er setzte sich an den Küchentisch, stützte den Kopf in die Hände und wartete darauf, dass der Alkohol sich in seinem Körper verteilte.
Nichts ist passiert, dachte er.
Danach stellte er Kaffeewasser auf und machte sich an die Analyse seiner Lage.
In den Morgenzeitungen stand keine Zeile. Weder im Telegraaf, den er abonniert hatte, noch im Neuwe Blatt, das er am Kiosk kaufte. Für einige glückliche Augenblicke konnte er sich fast einreden, dass er doch nur geträumt habe, doch sobald er sich an Regen und Graben und Blut erinnerte, wusste er, dass er sich täuschte. Es war wirklich. So wirklich wie der Whisky auf dem Tisch. Wie die Krümel neben dem Toaster. Wie seine eigenen Hände, die ohnmächtig und mechanisch in den Zeitungen blätterten, sie auf den Boden fegten und zur Flasche zurückkehrten.
Er hatte einen Jungen getötet.
War in angetrunkenem Zustand Auto gefahren und hatte einen halbwüchsigen Jungen von fünfzehn oder sechzehn Jahren umgebracht. Hatte im Regen im Straßengraben gestanden, mit dem Leichnam im Arm, und hatte ihn dann liegen lassen und war nach Hause gefahren.
So war das. Nichts daran zu ändern. Unwiderruflich.
Erst um einige Minuten vor zehn schaltete er das Radio ein, und die Zehn-Uhr-Nachrichten brachten dann die Bestätigung.
Ein Junge. Vermutlich auf dem Heimweg nach Boorkheim. Name noch nicht bekannt.
Der Unfallort dafür umso mehr.
Irgendwann in der Nacht. Zwischen elf und ein Uhr, vermutlich. Der Leichnam war erst am frühen Morgen gefunden worden.
Aller Wahrscheinlichkeit nach sofort tot.
Keine Zeugen.
Von einem Auto angefahren; auch dies aller Wahrscheinlichkeit nach. Der Fahrer musste den Zusammenstoß bemerkt haben. Aufruf an alle, die während der Nacht die Unfallstätte passiert hatten, und an alle, die glaubten, irgendwelche Auskünfte erteilen zu können. Die Polizei wollte gern Kontakt aufnehmen zu allen, die ...
Unfallort abgesperrt, der Regen hatte die Arbeiten erschwert, gewisse Hinweise sichergestellt ... Fahndung nach dem Fahrer, der Fahrerflucht begangen hatte ... abermaliger Aufruf an alle, die ...
Er schaltete das Radio aus. Trichterte sich noch zwei Schluck Whisky ein und kehrte ins Bett zurück. Lag dort eine ganze Weile, in einem Chaos von Gedanken, doch als er an diesem grauen, nebligen Donnerstagmorgen zum zweiten Mal aufstand, hatten sich drei davon herauskristallisiert.
Drei schwer wiegende Gedanken. Minutiös herausgearbeitete Schlussfolgerungen, an denen er nicht mehr rütteln wollte. Von denen er sich nicht entfernen würde, mochte kommen, was da wollte. Sein Entschluss stand fest, ganz einfach.
Zum Ersten: Der Junge im Straßengraben war tot, und er trug daran die Schuld.
Zum Zweiten: Egal, was er auch machte, der Junge würde davon nicht wieder zum Leben erweckt.
Zum Dritten: Nichts wäre damit gewonnen, dass er sich der Polizei stellte. Rein gar nichts.
Im Gegenteil, dachte er, was den dritten Punkt betraf. Warum ein zerstörtes Leben durch ein weiteres ersetzen? Sein eigenes?
Wenn er sich das auf diese Weise überlegte, wusste er endlich, dass er auf dem richtigen Weg war. Endlich kannte er sich wieder. Endlich. Er musste einfach nur stark bleiben. Durfte sich nicht zerbrechen lassen.
Mehr nicht.
Während des Nachmittags ging er praktisch vor.
Wusch in der Garage das Auto, von innen und von außen. Doch so genau er auch den rechten Teil von Front und Kotflügel unter die Lupe nahm, er konnte doch keine Schäden oder Spuren entdecken: Er nahm an, dass er den Jungen ziemlich weit unten getroffen hatte, vermutlich in Kniehöhe mit der Stoßstange, einfach ein ganz leichter Stoß. Als er noch einmal versuchte, sich die Szene in dem nassen Straßengraben vorzustellen, hatte er den Eindruck, als sei der fatale Ausgang dieser Begegnung eher der Kollision mit der Zementröhre zuzuschreiben als dem Zusammenstoß auf der Fahrbahn. Was — auf eine seltsame, perverse Art — auch sein Schuldbewusstsein erleichterte. So kam es ihm zumindest vor. Er wollte, dass es ihm so vorkam.
Im Auto, auf dem Vordersitz, fand er einen einzigen Grund zur Besorgnis: einen dunkleren ovalen Flecken, ungefähr eigroß, weit rechts, auf dem beigen Bezug. Er hatte guten Grund zu der Annahme, dass es sich hierbei um Blut handelte, und er verbrachte eine halbe Stunde bei dem Versuch es wegzuschrubben. Das gelang ihm nicht, der Fleck ließ sich nicht beeindrucken, er war offenbar tief in den Stoff eingedrungen, und er beschloss, sich in nächster Zeit einen Schonbezug zuzulegen. Nicht sofort ... in einigen Wochen wohl besser, wenn der Fall ein wenig in Vergessenheit geraten war.
Das Blut des Jungen hatte auch noch andere Spuren hinterlassen, auf Rad und Gangschaltung, aber es war kein Problem, die loszuwerden. Die Kleidungsstücke, die er am vergangenen Abend getragen hatte, suchte er sorgfältig zusammen und verbrannte sie unter einer gewissen Rauchentwicklung im offenen Kamin des Wohnzimmers. Danach überkam ihn für einen Moment die Panik, bei dem Gedanken, was er machen sollte, wenn er nach dieser Kleidung gefragt würde. Rasch beruhigte er sich jedoch wieder; es war doch höchst unwahrscheinlich, dass ihm jemand auf die Spur kommen und von ihm Rechenschaft für solche Belanglosigkeiten verlangen würde. Für eine schnöde Cordhose? Eine alte Jacke und ein blaugraues Baumwollhemd? Er hätte sich ihrer auf tausend legitime Weisen entledigen, hätte sie wegwerfen oder in die Altkleidersammlung geben können, was auch immer.
Doch vor allem: Niemand würde ihm auf die Spur kommen.
Später an diesem Nachmittag, als die Dämmerung sich gesenkt und ein Nieselregen eingesetzt hatte, ging er zur Kirche. Zur alten Vroonsbasilika, die zwanzig Gehminuten von seinem Haus entfernt lag. Dort saß er eine halbe Stunde lang mit gefalteten Händen in einem Seitenschiff und versuchte sich für Stimmen aus seinem Inneren — oder von irgendwo weiter oben — zu öffnen, aber nichts machte sich bemerkbar und nichts tauchte auf, was ihn hätte beunruhigen müssen.
Als er die menschenleere Kirche verließ, sah er ein, wie wichtig es war, dass er sich diesen Besuch gegönnt hatte: dass er sich die Zeit genommen hatte, einfach so im Seitenschiff zu sitzen. Ohne weitere Absichten oder Hoffnungen. Ohne falsche Vorspiegelungen und Beweggründe.
Sah ein, dass es eine Art Probe gewesen war und dass er sie bestanden hatte.
Es war seltsam, aber dieses Gefühl war stark und unzweideutig, als er das dunkle Gewölbe verließ. Es ähnelte einer Katharsis. Auf dem Heimweg kaufte er zwei Abendzeitungen, beide brachten auf der Titelseite das Bild des toten Jungen. Dasselbe Bild übrigens, mit unterschiedlichem Vergrößerungsgrad; ein fröhlich lächelnder Junge mit Lachgrübchen, leicht schräg stehenden Augen und dunklen, nach vorn gekämmten Haaren. Keine Kapuze, kein Blut. Er erkannte ihn nicht wieder.
Zu Hause konnte er dann feststellen, dass der Junge Wim Felders geheißen hatte, dass er in wenigen Tagen sechzehn geworden wäre und dass er das Weger-Gymnasium besucht hatte.
Beide Zeitungen brachten Details, Informationen und Spekulationen, und die allgemeine Sicht der Ereignisse wurde in der Poost auf der dritten Seite zusammengefasst:
HELFEN SIE DER POLIZEI, DEN FLÜCHTIGEN FAHRER ZU FASSEN!
Auch die möglichen Folgen wurden erwähnt, für den Fall, dass die Polizei den Täter ausfindig machen konnte. Zwei bis drei Jahre Gefängnis schienen durchaus im Bereich des Möglichen.
Er zählte seinen Alkoholpegel dazu — der sich sicherlich mit Hilfe des aufmerksamen Restaurantpersonals rekonstruieren lassen würde — und erhöhte diese Zahl auf fünf bis sechs. Mindestens. Trunkenheit. Unachtsamkeit im Verkehr und fahrlässige Tötung. Fahrerflucht.
Fünf bis sechs Jahre hinter Schloss und Riegel. Wozu sollte das gut sein?, fragte er sich. Wem könnte eine solche Entwicklung irgendeine Freude machen?
Er warf die Zeitungen in den Mülleimer und griff zur Whiskyflasche.
3
Drei Nächte lang träumte er von dem Jungen, danach war er verschwunden.
Wie auch in den Zeitungen. Die schrieben am Freitag, am Samstag und am Sonntag über Wim Felders, doch als dann am Montag die neue Arbeitswoche begann, beschränkten sie sich auf die kurze Meldung, dass die Polizei noch immer im Dunkeln tappe. Keine Zeugen hatten sich gemeldet, keine eindeutigen Spuren hatten sich sichern lassen — was immer eine solche Formulierung bedeuten mochte. Der Junge war von einem unbekannten Fahrer getötet worden, der sich danach im Schutze von Regen und Dunkelheit vom Tatort davongemacht hatte; das war von Anfang an bekannt gewesen und war es auch nach vier Tagen noch.
Am Montag ging er dann auch wieder zur Arbeit. Ihm erschien das als Erleichterung, aber auch als eine Art Eselsbrücke zurück in ein normaleres Leben. Wieder rollte das Leben in alten, vertrauten Gleisen dahin, vertraut und zugleich seltsam fremd, und mehrmals ertappte er sich an diesem Tag bei der Überlegung, wie dünn sie eigentlich war, diese Haut zwischen Alltag und Erschrecken.
Wie dünn und wie unerhört leicht zerreißbar. Die Haut.
Nach Feierabend fuhr er zum Einkaufszentrum in Löhr und kaufte neue Schonbezüge für seinen Wagen. Fand sofort einen Farbton, der im Grunde mit der alten Sitzfarbe identisch war, und nachdem er später an diesem Abend in der Garage mit einiger Mühe die elastischen Bezüge angebracht hatte, hatte er das Gefühl, endlich in Sicherheit zu sein. Die Parenthese hatte sich geschlossen. Die Parenthese um gar nichts. Er hatte letzte Hand an die Sicherheitsstrategien gelegt, die er nach genauer Überlegung entworfen hatte. Alle Maßnahmen waren getroffen worden, alle Spuren verwischt, und mit leichtem Erstaunen ging ihm auf, dass seit dem Unfall noch keine Woche vergangen war.
Und es gab keine Spuren. Rein gar nichts war aufgetaucht, das darauf hinweisen könnte, dass ihm irgendwann für diese schicksalhaften Sekunden am Donnerstagabend Rechenschaft abverlangt werden würde. Für diese entsetzlichen und zusehends unwirklicheren Sekunden, die hastig immer tiefer in die Dunkelheit des Vergangenen hineingewirbelt wurden.
Er würde es schaffen. Er seufzte tief und wusste, dass er es schaffen würde.
Es war zwar behauptet worden — in einigen Zeitungen und in den Fernsehsendungen, die er verfolgt hatte —, dass die Polizei gewisse Spuren verfolge, aber er wusste, dass das nur leere Worte und Phrasen waren. Ein unbeholfener Versuch, sich kenntnisreicher und kompetenter zu stellen, als man in Wirklichkeit war. Wie üblich.
Nirgendwo war auch nur mit einem Wort ein roter Audi erwähnt worden, der mit brennenden Scheinwerfern in der Nähe des Unfallortes am Straßenrand gestanden hatte. Und das war seine größte Angst gewesen; vielleicht nicht, dass irgendwer sich Farbe oder Autotyp eingeprägt hatte — und die Autonummer schon gar nicht —, sondern dass das Fahrzeug überhaupt gesehen worden war. Immerhin waren zwei Autos vorübergefahren, während er unten im Straßengraben stand . . . oder während er noch auf der Straße gewesen war? Er wusste es nicht mehr. Zwei Autos und ein Motorroller, nur daran konnte er sich noch erinnern. Der Fahrer des Wagens, der aus der Gegenrichtung gekommen war — aus Boorkheim oder Linzhuisen — konnte seinen Audi durchaus für ein ihm entgegenkommendes Auto gehalten haben, überlegte er, aber die beiden anderen, ja, die müssten eigentlich den Wagen gesehen haben, der mit brennenden Scheinwerfern am Straßenrand gestanden hatte.
Oder konnte man so etwas vergessen? Gehörte das zu den Erinnerungsfetzen, die man nur für einige Sekunden oder eine halbe Minute behielt und dann für immer verlor? Schwer zu sagen, schwer zu wissen, aber zweifellos eine Frage, die ihn nachts um den Schlaf bringen würde. Diese möglichen, potenziellen Zeugenaussagen.
Am Donnerstag — nach einigen Tagen des Schweigens in den Medien und eine Woche nach dem Unfall — kam ein Aufruf der Familie des Jungen, Mutter, Vater und eine jüngere Schwester. Sie tauchten im Fernsehen und im Radio auf und wurden in mehreren Zeitungen abgebildet, und sie baten ganz einfach den Täter, auf sein Gewissen zu hören und sich zu stellen.
Seine Schuld einzugestehen und seine Strafe auf sich zu nehmen.
Dieses Vorgehen, das war ja klar, war natürlich ein weiteres Indiz dafür, dass die Polizei noch immer im Dunkeln tappte. Keine Hinweise, keine Spuren. Als er die Mutter sah — eine dunkle, unerwartet gefasste Frau von Mitte vierzig —, die auf ihrem Sofa saß und sich direkt an ihn richtete, packte ihn zuerst eine plötzliche Angst, doch sowie die Mutter vom Bildschirm verschwunden war, gewann er sein Gleichgewicht wieder. Spürte und erkannte, dass er solchen Anfällen zwar ab und zu ausgesetzt sein würde, doch dass er immer genug Kraft finden würde, um sich zusammenzureißen. Einen Weg aus der Schwäche zu finden. Wenn er nur nicht die Besinnung verlor.
Es war gut zu wissen, dass er sie noch hatte, dass er dieses Wichtige besaß. Die Kraft.
Trotzdem hätte er gern mit ihr gesprochen.
Warum, hätte er sie gern gefragt.
Was hättest du davon, mich für fünf Jahre ins Gefängnis zu stecken?
Ich habe deinen Sohn getötet, ich bedaure es aus tiefstem Herzen, aber es war ein Unfall, und was wäre gewonnen, wenn ich mich stellte?
Er fragte sich, was sie wohl antworten würde. Hatte sie ihm denn wirklich einen Vorwurf zu machen? Es war doch ein Unglück gewesen, und ein Unglück hat keinen Täter. Es hat überhaupt keine Akteure, sondern nur Faktoren und Objekte, die sich jeglicher Kontrolle entziehen.
Später an diesem Abend spielte er dann mit dem Gedanken, der Familie einen anonymen Brief zu schicken. Oder einfach anzurufen und seinen Standpunkt darzulegen, aber er wusste, dass das zu riskant sein würde, und deshalb gab er diese Idee wieder auf.
Er verzichtete auch darauf, zu Wim Felders Beerdigung, die am Samstag, zehn Tage nach dem Unfall, in der voll besetzten Keymerskirche stattfand, einen Kranz zu schicken.
Aus demselben Grund: dem Risiko.
Neben Angehörigen und Freunden nahmen an der Zeremonie viele Schüler und Lehrer des Wegergymnasiums teil, dazu die Vertreter der verschiedenen Organisationen der Verkehrsopfer. Das konnte er am Sonntag im Neuwe Blatt ausführlich lesen, aber das war dann auch der letzte große Bericht über den Fall.
Zu seiner Überraschung stellte er am Montag fest, dass er sich leer fühlte.
Als habe er etwas verloren.
Wie damals, als ich Marianne verloren habe, dachte er etwas später mit derselben Überraschung; es war ein seltsamer Vergleich, aber irgendeinen Vergleich musste er doch ziehen. Zehn Tage lang hatte dieses entsetzliche Ereignis sein Leben dominiert. War durch jede Pore und in jeden Winkel seines Bewusstseins gesickert. Obwohl er seine Panik relativ schnell in den Griff bekommen hatte, war sie doch die ganze Zeit vorhanden gewesen. Unter der Oberfläche, bereit zum Ausbruch. Seine Gedanken waren fast in jeder Sekunde um diese höllische Autofahrt gekreist, um den leichten Knall und das Rucken des Lenkrades; um den Regen, den leblosen Jungenkörper und den glitschigen Straßengraben ... Tag und Nacht, und als es nun vorkam, dass er zeitweise nicht daran dachte, hatte er auf irgendeine Weise das Gefühl, dass ihm etwas fehlte.
Eine Art Leere, wie gesagt.
Wie nach einer elf Jahre langen, kinderlosen Ehe ... doch, da gab es Parallelen.
Ich muss ein sehr einsamer Mensch sein, dachte er während dieser Tage. Seit Marianne mich verlassen hat, hat eigentlich nichts etwas für mich bedeutet. Rein gar nichts. Mir passieren Dinge, aber ich handele nicht. Ich existiere, aber ich lebe nicht.
Warum habe ich mir keine neue Frau gesucht? Warum habe ich mir nicht einmal diese Frage gestellt? Und jetzt bin ich plötzlich ein anderer.
Wer? Wer bin ich?
Dass solche Gedanken auftauchten, weil er einen Jungen totgefahren hatte, war natürlich schon eigentümlich genug, aber etwas untersagte ihm, zu tief an der Sache zu rühren. Er beschloss, alles gelassen hinzunehmen und die Sache anzugehen, neues Terrain zu betreten, und ehe er sich’s versah — noch ehe er sich die Zeit zum Nachdenken und Bereuen gegeben hatte —, hatte er eine Frau zum Essen eingeladen. Er hatte sie in der Kantine kennen gelernt, sie hatte sich an seinen Tisch gesetzt, wie üblich hatte es kaum freie Plätze gegeben. Er wusste nicht, ob er sie je zuvor gesehen hatte.
Vermutlich nicht.
Aber sie hatte angenommen.
Sie hieß Vera Miller. Sie war fröhlich und rothaarig, und in der Nacht zwischen Samstag und Sonntag — etwa über drei Wochen, nachdem er zum ersten Mal in seinem Leben einen Menschen getötet hatte —, liebte er zum ersten Mal seit fast vier Jahren eine Frau.
Am nächsten Vormittag wiederholten sie das, und danach erzählte sie, dass sie verheiratet war. Sie sprachen eine Weile darüber, und er sah, dass ihr das wesentlich mehr zu schaffen machte als ihm.
Am Montag kam der Brief:
Einige Zeit ist verstrichen, seit Sie den Jungen ermordet haben. Ich habe darauf gewartet, dass Ihr Gewissen erwacht, aber jetzt, weiß ich, dass Sie ein schwacher Mensch sind, der nicht wagt, für seine Taten einzustehen.
Ich verfüge über unmissverständliche Informationen, die Sie ins Gefängnis bringen werden, sowie ich die Polizei davon informiere. Mein Schweigen kostet zehntausend Gulden, einen Klacks für einen Mann in Ihrer Position, aber ich gebe Ihnen trotzdem eine Woche (genauer gesagt: sieben Tage), um diese Summe zu beschaffen. Seien Sie bereit!
Auf Wiederhören.
Ein Freund
Handgeschrieben. Mit schmalen, regelmäßig geneigten Buchstaben. Schwarzer Tinte.
Er las den Brief fünfmal hintereinander.
4
»Bedrückt dich irgendetwas?«, fragte Vera Miller beim Essen. »Du kommst mir ein wenig niedergeschlagen vor.«
»Nein.«
»Sicher?«
»Wirklich nicht«, beteuerte er. »Ich fühl mich nur nicht so ganz wohl, ich habe leichtes Fieber, glaube ich.«
»Es hat doch wohl nichts mit mir zu tun? Mit uns, meine ich?«
Sie spielte mit ihrem Weinglas und musterte ihn mit ernster Miene.
»Nein, zum Henker ...«
Er versuchte zu lachen, hörte aber selber, wie falsch es klang. Also leerte er lieber sein Glas.
»Ich finde, es hat so gut angefangen, das mit uns«, sagte sie. »Ich möchte gern auch noch das zweite und das dritte Kapitel erleben.«
»Natürlich. Glaub mir, ich bin ein bisschen müde, aber das hat nichts mit dir zu tun. Mir geht es wie dir ... das verspreche ich dir.«
Sie lächelte und streichelte seinen Arm.
»Gut. Ich hatte fast vergessen, dass Liebe so schön sein kann. Unglaublich, dass du vier Jahre auf Eis gelegen hast. Wie war das nur möglich?«
»Ich habe auf dich gewartet«, sagte er. »Gehen wir ins Bett?«
Als sie ihn an diesem Sonntag verlassen hatte, sehnte er sich fast sofort nach ihr. Sie hatten sich bis in den frühen Morgen geliebt, und es war genauso, wie sie gesagt hatte: dass diese starken Gefühle möglich waren, war fast ein Rätsel. Er ging wieder ins Bett und bohrte den Kopf ins Kissen. Nahm in langen Zügen ihren Duft in sich auf und versuchte, wieder einzuschlafen, aber das gelang ihm nicht. Die Leere war viel zu groß. Und das war doch wirklich verdammt merkwürdig.
Der größte Unterschied der Welt, dachte er. Der zwischen einer Frau, die daliegt, und einer Frau, die gerade gegangen ist. Einer geliebten Frau. Einer neuen Frau?
Nach einer Weile gab er auf. Holte die Zeitung, frühstückte und zog dann noch einmal den Brief hervor.
Das war natürlich unnötig. Er kannte ihn schon auswendig. Jede Formulierung, jedes Wort, jeden Buchstaben. Er las ihn noch zweimal. Strich mit dem Daumen darüber, schätzte die Papierqualität ein. Sie war hoch, zweifellos, Papier und Umschlag vom selben Design. Dickes Büttenpapier, er nahm an, dass es in einem Buchladen in der Innenstadt gekauft worden war, wo Einzelstücke zu haben waren.
Exquisiter Farbton noch dazu. Briefmarke mit Sportmotiv, eine Frau, die mit einem Diskus eine schwingende Bewegung beschrieb. Auf den Millimeter genau oben in der rechten Ecke platziert. Sein Name und seine Adresse waren in denselben leicht schrägen, spitzen Buchstaben geschrieben, in denen der Brieftext verfasst war. Der Ortsname war unterstrichen.
Das war alles. Alles, was sich über diesen Brief sagen ließ. Mit anderen Worten, nichts. Oder auf jeden Fall fast nichts. Nicht einmal, ob der Brief von einem Mann oder einer Frau stammte, ließ sich feststellen. Er neigte ein wenig zu der Annahme, dass es sich um einen Mann handelte, aber das war eine bloße Vermutung. Möglich war alles.
Zehntausend, überlegte er sich zum hundertfünfzigsten Mal seit dem Montagabend. Warum nur zehntausend?
Natürlich war auch das eine ansehnliche Summe, aber dennoch — wie im Brief ja ganz richtig erwähnt wurde —, es war keine direkt überzogene Forderung. Auf der Bank hatte er mehr als das Doppelte, er hatte ein Haus und andere Vermögenswerte, die zehnmal so viel wert waren. Der Erpresser (wenn es also ein Mann war) hatte außerdem den Ausdruck »ein Mann in Ihrer Position« benutzt, was andeutete, dass er mit Lebensumständen und Einkommenshöhe seines Opfers vertraut war.
Warum sich also mit zehntausend begnügen? Vielleicht kein »Klacks«, aber doch immerhin ein geringer Preis. Sogar spottbillig, wenn man bedachte, worum es hier ging.
Der Briefschreiber war außerdem aller Wahrscheinlichkeit nach ein ziemlich gebildeter Mensch. Seine Handschrift war gleichmäßig und sauber, im Brief gab es keine sprachlichen Schnitzer, und alles war präzise formuliert. Zweifellos müsste (musste?) dem Betreffenden klar sein, dass er mehr herausholen könnte. Dass er für sein Schweigen einen geringen Preis forderte.
Zu diesem Schluss kam er immer wieder. Schließlich staunte er auch darüber, wie leicht es ihm gefallen war, in diesen ziemlich rationalen Bahnen zu denken. Der Brief war bei ihm wie eine Bombe eingeschlagen, aber sowie er angefangen hatte, sich an die Tatsache zu gewöhnen und sie als solche zu akzeptieren, hatte er sich mit den logischen und relevanten Fragen beschäftigt.
Während der ganzen Woche und jetzt, am Sonntagnachmittag.
Warum nur zehntausend?
Was bedeutete das? Sollte das nur die erste Rate sein?
Und wer war es? Wer hatte ihn gesehen und sah nun die Möglichkeit, an seinem Unglück Geld zu verdienen? Und an dem des Jungen?
Der Fahrer des Motorrollers oder eines der beiden Autos, die vorübergefahren waren, als er mit dem leblosen Leichnam in den Armen unten im Graben gestanden hatte? Oder oben am Straßenrand.
Gab es noch andere Alternativen? Das glaubte er nicht.
Auf jeden Fall musste es das Auto gewesen sein, sein eigener roter Audi, der ihn verraten hatte, davon musste er nun langsam ausgehen. Irgendwer hatte sich darüber gewundert, dass der auf diese ungewöhnliche Weise am Straßenrand stand, hatte sich die Autonummer eingeprägt und auf diese Weise den Besitzer feststellen können.
Er war davon überzeugt, dass es so gewesen sein musste. Mehr und mehr überzeugt; er glaubte kaum noch, dass es auch andere Möglichkeiten geben könne — bis ihm ein weiterer entsetzlicher Gedanke kam.
Der Junge konnte an diesem Abend Gesellschaft gehabt haben. Es konnte sich doch um zwei junge Menschen gehandelt haben, die an der Straße entlanggegangen waren, doch dann war nur der Junge auf so fatale Weise gegen die Zementröhre geschleudert worden.
Ein Stück weiter entfernt ... einige Meter auf der anderen Seite der Röhre könnte eine benommene Freundin gelegen haben. . . nein, keine Freundin, die war in der Stadt gewesen, das hatte er in der Zeitung gelesen ... eher ein Kumpel oder ein zufälliger Begleiter ... der ohnmächtig im Schutz der Dunkelheit gelegen hatte. Oder der unter Schock stand und in panische Angst ausgebrochen war angesichts des toten Jungen und des Mannes, der den Jungen in den Armen hielt, während Blut in die Kapuze tropfte ...
Das war natürlich ein grauenhaftes Szenario, und obwohl er sich immer wieder sagte, dass es nicht sonderlich glaubhaft war, so stellte es sich doch mit einer gewissen Hartnäckigkeit immer wieder ein. Rein klinisch versuchte er ebenfalls, sich diese makabre Variante — diese unwahrscheinliche Möglichkeit — aus dem Kopf zu schlagen, da sie auf jeden Fall unwichtig war. Irrelevant. Es spielte keine Rolle, wer ihn in der Unglücksnacht gesehen oder wie diese Person Kenntnis von den Umständen des Unfalls erhalten hatte. Die anderen Fragen verlangten Aufmerksamkeit und Konzentration.
Und Entschlusskraft.
Konnte er sich also darauf verlassen, dass es mit diesem einen Mal getan sein würde?
Mit zehntausend Gulden. Dass er dieses eine Mal und später nie wieder bezahlen müsste?
Das war der springende Punkt. Welche Garantie konnte der Briefeschreiber (die Briefeschreiberin?) ihm dafür geben, dass — nachdem das Geld einkassiert und ausgegeben worden war — nicht nach einigen Monaten neue Forderungen gestellt werden würden? Oder nach einigen Jahren?
Oder dass dieser Mensch nicht auf jeden Fall zur Polizei gehen und ihn anzeigen würde?
Sollte er eine solche Garantie verlangen? Und wie könnte diese dann aussehen?
Oder — und das war natürlich die allerwichtigste Frage — sollte er nicht einsehen, dass er sich in einer unmöglichen Situation befand? Sollte er nicht begreifen, dass das Spiel verloren war und dass er nun selber die Polizei informieren musste?
Sollte er nicht aufgeben?
Am Sonntagabend war er noch immer nicht zu einer endgültigen Antwort auf diese Fragen gelangt. Dass er bereits am Freitag bei der Sparkasse vorbeigeschaut und elftausend von seinem Konto abgehoben hatte, musste nicht unbedingt als Entscheidung gelten.
Sondern nur als Zeichen dafür, dass er sich weiterhin alle Türen offen hielt.
Er dachte aber auch an das Gespräch, das sie am Samstag geführt hatten.
»Dein Mann?«, hatte er gefragt, als sie sich nach einem langen Strandspaziergang wieder dem Auto näherten. »Hast du es ihm gesagt?«
»Nein«, hatte sie geantwortet und ihre Haare aus ihrer Strickmütze befreit. War mit der Hand hindurchgefahren und hatte sie mit einer Bewegung ausgeschüttelt, die ihm übertrieben vorgekommen war, sicher hatte sie Zeit zum Nachdenken gewinnen wollen. »Ich wusste ja nicht, wie ernst die Sache mit dir werden würde ... zu Anfang, meine ich. Jetzt weiß ich es. Aber ich habe noch keine Gelegenheit gefunden, mit ihm zu sprechen. Dazu braucht es doch Zeit und den richtigen Moment.«
»Du bist dir ganz sicher?«
»Ja.«
»Dass du dich von ihm scheiden lassen willst?«
»Ja.«
»Warum habt ihr keine Kinder?«
»Weil ich keine wollte.«
»Mit deinem Mann oder überhaupt?«
Sie schüttelte vage den Kopf. Er begriff, dass sie über dieses Thema nicht sprechen wollte. Sie schwiegen eine Weile und betrachteten das aufgewühlte Meer.
»Wir sind erst seit drei Jahren verheiratet. Und es war von Anfang an ein Fehler. Es war idiotisch.«
Er nickte.
»Was hat er für einen Beruf?«
»Im Moment ist er arbeitslos. Hat bei Zinders gearbeitet. Aber die haben den Betrieb ja eingestellt.«
»Hört sich traurig an.«
»Ich habe auch nie behauptet, dass es besonders lustig ist.«
Sie lachte. Er legte den Arm um ihre Schultern und drückte sie an sich.
»Aber du hast wirklich keine Zweifel?«
»Nein«, sagte sie. »Ich will nicht mit ihm zusammenleben, das habe ich die ganze Zeit gewusst.«
»Warum hast du ihn geheiratet?«
»Das weiß ich nicht.«
»Dann heirate doch lieber mich!«
Das war ihm einfach so herausgerutscht, aber ihm ging sofort auf, dass er es wirklich meinte.
»Wow«, hatte sie geantwortet und gelacht. »Wir haben uns schon zweimal getroffen, und erst jetzt fragst du endlich, ob wir heiraten sollen. Sollten wir nicht auf jeden Fall zuerst zu dir fahren und etwas essen, so wie wir das geplant hatten?«
Er dachte nach.
»Vielleicht«, sagte er. »Doch, du hast schon Recht, ich habe einen Wolfshunger.«
Später an diesem Abend hatte er seinen Heiratsantrag nicht wiederholt, er hatte ihn aber auch nicht zurückgezogen. Er fand, das Thema könne ein wenig in der Luft schweben, ohne eine Stellungnahme oder einen Kommentar zu benötigen. Wie eine zwischen ihnen gespannte Saite, die nicht angeschlagen werden musste, die aber doch vorhanden war und sie miteinander verband. Er glaubte auch Vera anzusehen, dass sie nichts dagegen hatte. Dass es ihr ähnlich erging.
Es war eine Art Geheimnis. Und ein Bund.
Als sie sich später liebten, hatten sie das Gefühl, aus dem Brunnen der Liebe zu trinken.
Unbegreiflich, im Grunde war es unbegreiflich.
Wie konnte das Leben ohne Vorwarnung in ganz neue Bahnen geworfen werden, in Bahnen, die alles Vertraute, alle Vernunft und alle Lebenserfahrung auf den Kopf stellten? Wie war das möglich?
Und noch dazu in nur wenigen Wochen. Zuerst war der entsetzliche Donnerstagabend gekommen, danach Vera Miller und die Liebe. War das denn überhaupt noch zu verstehen?
Während des restlichen Sonntagabends lag er vor allem auf dem Sofa, er hatte nur eine Kerze angezündet und dachte darüber nach, wie er zwischen den Extremen hin und her geschleudert wurde. Zwischen der Empfindung einer schwankenden, bebenden und brechenden Wirklichkeitsauffassung einerseits — und einer sehr ruhigen und rationalen Bewertung seiner eigenen Situation andererseits. Vernunft und Gefühl, aber ohne Verbindung, ohne Synapsen.
Nach und nach beschloss er, dass hier trotz allem nicht die Rede davon sein konnte, er sei völlig aus der Bahn geworfen worden. Es gab nur eine Wirklichkeit, und die spielte sich die ganze Zeit ab; seine Empfindung dieser Wirklichkeit und sein Versuch, sie zu kontrollieren, waren unverändert, nur sein Blickwinkel wechselte. Seine Perspektive.
Die Vorder- und die Kehrseite der Medaille, dachte er. Wie ein Wechselstromschalter. Das Alltägliche und das Unbegreifliche. Leben und Tod? Die dünne Haut dazwischen.
Seltsam.
Nachdem er im Radio die Elf-Uhr-Nachrichten gehört hatte, griff er wieder zu dem Brief. Las ihn noch einmal, dann setzte er sich an seinen Schreibtisch. Blieb eine ganze Weile dort sitzen und ließ seinen Gedanken freien Lauf, und bald, sehr bald, zeigte sich ihm eine weitere Handlungsalternative, wo er vorher nur zwei gesehen hatte.
Ein dritter Weg! Das sprach ihn an. Er saß noch lange und versuchte Vor- und Nachteile abzuwägen.
Noch war es jedoch zu früh, um einen endgültigen Entschluss zu fassen. Noch viel zu früh. Solange dieser »Freund« ihm keine genaueren Instruktionen erteilt hatte, konnte er nur warten.
Auf die Montagspost!