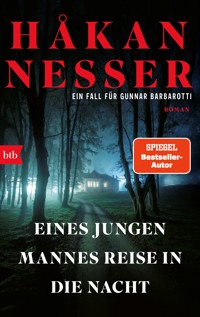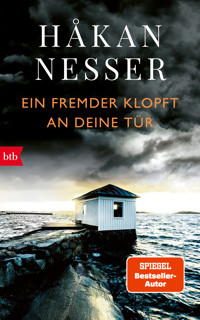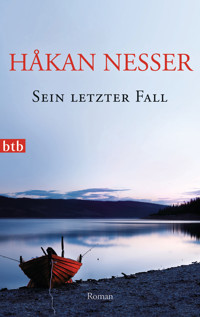2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wo ist Sara? Vierzehn Monate ist es her, dass Erik und Winnie Steinbecks vierjährige Tochter verschwunden ist. Beim Spielen von einem fremden Mann auf der Straße angesprochen, in einem dunklen, großen Wagen mitgenommen. Das ist alles, was man weiß. Danach verliert sich die Spur. Kein Erpresserbrief, kein Hinweis auf mögliche Täter. Es ist nicht der erste Schicksalsschlag für Winnie – war doch ihr erster Mann zusammen mit der gemeinsamen Tochter tödlich verunglückt. Um Abstand zu gewinnen, schlägt Winnie Erik deshalb vor, in die USA zu ziehen. Die beiden lassen sich in New York nieder. Und zunächst scheint dies die rettende Idee. Winnie fängt wieder an zu malen, Erik geht jeden Tag in eine öffentliche Bibliothek, um dort zu schreiben. Schon bald jedoch kippt die Situation. Seltsame Dinge geschehen. Winnie behauptet zu wissen, dass Sara noch lebt. Sie malt ein Bild, das exakt die Situation der Entführung wiedergibt, alles ist fotogenau wiedergegeben – bis auf das Gesicht des Mannes. Erik ist beunruhigt. Durch Zufall entdeckt er, dass seine Frau heimlich aus dem Haus geht, wenn er fort ist. Dass sie obskure Bekanntschaften pflegt. Sie streitet es ab. Und dann erfährt er, dass Winnie ihm nicht die Wahrheit gesagt hat über ihre Vergangenheit …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 350
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Håkan Nesser
Die Perspektive des Gärtners
Roman
Aus dem Schwedischen von Christel Hildebrandt
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Die schwedische Originalausgabe erschien 2009 unter dem Titel »Maskarna på Carmine Street« bei Albert Bonniers Förlag, Stockholm.
Copyright © 2009 by Håkan Nesser Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2010 by btb Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, München Satz: Uhl + Massopust, Aalen ISBN 978-3-641-04778-8 V002 www.btb-verlag.de
I
1
Mit vier vollgepackten Koffern und zwei leeren Herzen kamen wir nach New York.
Auf dem kurzen Weg zwischen der Carmine Street und der Bibliothek in der Leroy Street kommt mir diese Formulierung in den Sinn. Vielleicht ist es nicht gerade die beste Einleitung, aber ich habe schon seit ein paar Tagen um einen Eingangssatz gerungen. Als wenn es nur um diese simple Sache ginge – um einen Schlüssel, der die Erzählung öffnet, ein Siegel, das gebrochen werden muss, oder eine Art Zaubertrick, der, wenn man ihn erst einmal durchschaut hat, alles andere in die richtigen Bahnen lenkt.
Aber dem ist nicht so. Erzählungen müssen auf jeder Seite neu geboren werden, unablässig, unter Schmerzen und manchmal auch unter Freuden, Zeile für Zeile, Zentimeter für Zentimeter, und es gibt keine Abkürzung. Und genau so will ich vorgehen, wenn ich jetzt einen Bericht darüber schreibe, was in den letzten Jahren passiert ist und was genau in diesem Moment passiert, und das wird nicht einfach sein. Ich bin mir nicht einmal sicher, dass es überhaupt irgendwohin führt, aber manchmal hat man keine andere Wahl.
Ich gebe keinerlei Versprechen. Vielleicht wird es eine zusammenhängende Geschichte, vielleicht auch nicht.
Es sind jetzt ein paar Wochen vergangen, seit ich diese kleine Zweigstelle der New York Public Library gefunden habe – The Hudson Park Branch steht an der Wand zum James Walker Park hin –, und seitdem sitze ich jeden Tag ein paar Stunden lang in den schmutzig braunen, heruntergekommenen Räumen. Nicht immer zur gleichen Zeit, es gibt unterschiedliche Öffnungszeiten, nur sonntags haben sie durchgehend geschlossen. Aber es ist auf jeden Fall der richtige Ort, das spüre ich deutlich; die Umgebung ist mir beim Schreiben immer wichtig gewesen, und in diesem Fall ist sie noch wichtiger als sonst.
Es ist Herbst. Ende September, aber immer noch sehr warm. Die Leute reden die ganze Zeit vom Treibhauseffekt, es ist jetzt das dritte Jahr in Folge so, und die New York Times, die ich mit der Beharrlichkeit eines Idioten täglich kaufe und lese, kommt in regelmäßigen Abständen auf dieses Thema zurück. Der ehemalige Präsidentschaftskandidat Gore hat in dieser Angelegenheit sogar einen Oscar bekommen, und vielleicht stimmt es ja. Vielleicht ist unsere Erde dabei, überzukochen und unterzugehen.
Was uns persönlich betrifft, Winnie und mich, so haben wir unseren Untergang schneller erlebt. Seit der Katastrophe sind zwei Sommer vergangen, siebzehn Monate insgesamt. Anfang August sind wir in New York angekommen, nach ein paar Tagen haben wir die Wohnung gefunden, in der wir jetzt in Greenwich Village zu Hause sind, nachdem wir ein schweineteures und inakzeptables Rattenloch nach dem anderen verworfen hatten. Die kleine Dachwohnung, für die wir uns schließlich entschieden haben, ist ebenfalls schweineteuer, aber sie ist zumindest sauber und bewohnbar.
Vier vollgepackte Koffer, zwei leere Herzen. Die Koffer haben wir geleert, ihre Inhalte in schmale Schränke und wacklige Kommoden gestopft, mit unseren Herzen ist es etwas anderes. Winnie sagt, sie wolle wieder ernsthaft anfangen zu malen, aber sie muss bei diesem Schaffensprozess alleine sein, aus diesem Grund begebe ich mich jeden Tag für ein paar Stunden außer Haus. Natürlich brauche auch ich die Einsamkeit, ich muss sehen, dass ich die Worte wiederfinde, eines aufs andere lege, Satz an Satz füge und schließlich etwas zustande bringe, was aus mehr als einer traurigen, trostlosen Wanderung in immer den gleichen Kreisen besteht.
Jede Geschichte sucht ihre Form und findet sie.
Oder sie stirbt.
Mein Name ist Erik Steinbeck, um es gleich vorweg zu sagen. Zum jetzigen Zeitpunkt bin ich 38 Jahre alt. Seit einem guten Jahrzehnt kann ich mich Schriftsteller nennen, aber jetzt sind bereits drei Jahre vergangen, ohne dass ich etwas Neues produziert hätte. Fünf Romane, das ist meine ganze Ausbeute, aber zwei von ihnen sind erfolgreich verfilmt worden, und so werden wir finanziell zurechtkommen, auch wenn ich in den nächsten Jahren kein einziges Wort zu Papier bringe. Das ist allerdings auch schon die einzige Prognose, die ich bezüglich der Zukunft abzugeben wage. Wir werden nicht verhungern vor der letzten Seite dieses zweifelhaften Romans.
Meine Ehefrau Winnie ist bildende Künstlerin, in gewisser Weise ist sie anerkannter als ich und in ihrer künstlerischen Karriere weiter, aber ich bin derjenige, der bis jetzt ökonomisch am erfolgreichsten war. Ich weiß selbst nicht, warum ich die Zeit mit diesen trockenen Fakten zu unseren Lebensverhältnissen verschwende. Vielleicht liegt dem ein altes, calvinistisches Rechtfertigungsbedürfnis zugrunde, vielleicht ist es auch nur eine Möglichkeit, das, worüber ich eigentlich sprechen will, noch ein wenig hinauszuzögern.
Wir sind seit sieben Jahren verheiratet. Vor siebzehn Monaten ist unsere vierjährige Tochter Sarah verschwunden, und das ist auch der Grund, warum wir uns in New York befinden.
Das ist auch der Grund, warum wir einander fremd geworden sind.
In etwa ist dies auch der Ausgangspunkt für diesen Bericht, wobei ich selbst diese Aussage nicht einfach so schlucken würde. Aber irgendwo muss man ja einen Ausgangspunkt setzen. Irgendwo muss man anfangen.
Genug der Ausflüchte. Ich habe bereits die schwere Tür zur Bibliothek geöffnet, als ich beschließe, zunächst doch noch einen Spaziergang am Fluss zu machen. Ich brauche nur fünf Minuten, um zum Hudson River Park zu gelangen. An diesem Morgen liegt Nebel über dem Wasser; New Jersey zeigt sich hübsch und gepflegt auf der anderen Flussseite, fast wider Willen. Ich bleibe eine Weile ganz vorne auf einem der Piers stehen, es ist fast windstill, die Schiffe und Schlepper verschwimmen ineinander und gleiten wie schwere, unförmige Urzeitwesen durch den gelbweißen Dunst. Es sieht aus wie in meinem Inneren, denke ich, meine Gedanken weisen die gleiche klumpige Unschärfe auf, ich weiß nicht genau, wie es sich bei Winnie verhält, aber ich glaube, dass es bei ihr um andere Fragen geht. Ich schreibe »glaube«, ich meine aber »weiß«. Wir stehen zwar beide am Abgrund der Verzweiflung, aber der Abgrund der Verzweiflung streckt sich in die Länge, und unsere Positionen liegen weit voneinander entfernt. Wir sind nicht einmal mehr in der Lage, einander die Hand zu reichen, um gemeinsam von einer Klippe oder einer Brücke zu springen, und das, genau das ist es, was alles so viel schwerer macht, als es sowieso schon ist.
»Erträgst du es noch mit mir?«, fragte sie mich neulich. Ich antwortete, dass ich mir nichts sehnlicher wünschte, als wenn wir wieder einen Weg zueinander fänden, aber womöglich ist das nicht die ganze Wahrheit, beschwören könnte ich es nicht. Man sagt Dinge, die passend klingen, und wir haben uns seit dem Zeitpunkt, als Sarah verschwand, nicht ein einziges Mal geliebt; manchmal ist es schwer zu begreifen, warum wir uns mit so einer Hartnäckigkeit immer noch aneinander klammern.
Ich wandere die Chelsea Piers hinauf, dann zurück durch den Meatpacking District und das West Village. Kaufe Kaffee und einen Bagel im Delikatessengeschäft an der Ecke Hudson/Barrow, und als ich den Platz an meinem Tisch in der Bibliothek einnehme, ist es Viertel nach zehn.
Ich hole meinen schwarzen Block und meine Stifte heraus. Schaue durch das hohe Fenster mit den Bleiglasfenstern nach draußen; die Bäume entlang der Leroy weisen noch keine Spur von Gelb auf, der Sommer reicht wirklich weit in den September. Hinten von den Sportplätzen im James Walker Park sind Rufe und Flüche der Spieler zu hören. Ich trinke einen Schluck Kaffee, beiße vom Bagel ab und starre auf die erste leere Seite.
Beschließe dann, den Satz mit den Koffern und den Herzen zu akzeptieren, plötzlich habe ich das Gefühl, dass er gar nicht mehr so wichtig ist, wie ich gedacht habe. Alles ist möglich.
Ich schaue auf, mein Blick begegnet dem von Mr. Edwards.
Mr. Edwards ist ein Mann in den Siebzigern. Er sitzt an einem Tisch weiter hinten im Raum, er ist Stammkunde, genau wie ich, und genau wie ich ist er damit beschäftigt, etwas zu schreiben. Er ist hochgewachsen, macht einen vitalen Eindruck, obwohl er eine Glatze hat und sich nur mühsam vorwärtsbewegen kann. Allem Anschein nach ist es die Hüfte, die ihm Probleme bereitet. Sein Gesicht ist länglich, mit einer kräftigen Kieferpartie und tief liegenden Augen, seine Hautfarbe zeugt davon, dass Latino- oder karibisches Blut in seinen Adern fließt. Vielleicht verdünnt, aber nicht mehr als fifty-fifty. Wir haben uns einander nie vorgestellt, aber ich habe gehört, wie das Personal ihn mit »Mr. Edwards« ansprach. Seit ich in die Bibliothek gehe, also seit zwei Wochen, hat er immer auf seinem Platz gesessen. Wir begrüßen uns durch ein vorsichtiges Kopfnicken, aber mehr auch nicht.
Auch an diesem Morgen nickt er leicht; ich nehme an, dass er bemerkt hat, dass ich mit dem Schreiben angefangen habe und dass er mir dazu gratulieren will. Oder mich zumindest wissen lassen will, dass er es bemerkt hat, es handelt sich um eine äußerst diskrete Annäherung, dennoch durchströmt mich ein Hauch von Wärme und Zuversicht.
Eine Sekunde, höchstens zwei, dauert das an; ich erwidere sein Nicken und fange an, das durchzulesen, was ich bis jetzt zustande gebracht habe.
Es ist halb drei, als ich die Bibliothek verlasse. Ich setze mich mit einem Kaffee draußen vors The Grey Dog’s Café und rufe Winnie an. Ich kann schräg gegenüber eines unserer Fenster sehen, aber es ist zu klein und zu weit oben, als dass ich hineinschauen könnte. Ich kann nicht abschätzen, ob sie zu Hause ist oder nicht.
Ich erhalte keine Antwort. Was alles Mögliche bedeuten kann. Sie kann daheim sein, aber nicht drangehen wollen, weil sie arbeitet. Sie kann im Schwimmbad in der 36. Straße sein; da geht sie mindestens zweimal die Woche hin, schwimmt und ruht sich aus, Stunde um Stunde, sie behauptet nie, dass es der Heilung dienen könnte, aber vielleicht tut es das ja doch. Vielleicht ist das der Grund für ihre Besuche dort, bewusst oder unbewusst, sie hat schon immer eine besondere Beziehung zum Wasser gehabt.
Vielleicht ist sie aber auch nur in der Stadt unterwegs. Anfangs hat sie sich täglich Kunst angesehen. Metropolitan und Neue Galerie. Guggenheim und MoMA und die Galerien in Chelsea und am West Broadway. Aber damit hat sie jetzt aufgehört. Jetzt malt sie stattdessen, und zwar auf mindestens vier Leinwänden, wenn ich richtig gezählt habe. Öl und Eiöltempera. Bisher durfte ich noch nichts sehen, so ist es immer gewesen, seit wir uns zum ersten Mal begegnet sind. Bilder sind für Blicke gemacht, sagt sie. Wenn sie erst einmal fertig sind, ist das ihre einzige Funktion, aber während sie geboren werden, darf man sie noch keinen Blicken aussetzen. Ist es mit deinen Texten nicht das Gleiche?
Meistens stimme ich ihr zu, ja, mit meinen Texten ist es das Gleiche. Die Worte müssen sich erst ein wenig setzen, eine Zeit lang zur Ruhe kommen, bis sie das Tageslicht ertragen. Koagulieren, so nennen wir es.
Als ich das zweite Mal anrufe, geht sie ran. Sie ist auf dem Heimweg von einem Laden für Künstlerbedarf unten am Canal. Ich frage, ob ich ihr entgegenkommen soll. Sie antwortet, lieber nicht, ich kann ihrer Stimme anhören, dass sie ein oder zwei Gläser getrunken hat. Ich denke, dass wir in genau einem Monat unseren siebten Hochzeitstag haben.
Plötzlich bin ich unsicher, ob wir es jemals bis dahin schaffen werden.
2
Es war am 25. November 1999. Mein dritter Roman, Die Perspektive des Gärtners, war im September herausgekommen, und ich befand mich in meiner achten Lesewoche.
Was nun genau dafür ausschlaggebend war, konnte ich nicht sagen, aber ich empfand einen zunehmenden Ekel sowohl mir selbst als auch dem Buch gegenüber, das ich Abend für Abend an verschiedenen Orten in verschiedenen Teilen des Landes vorstellte. Ich konnte die gesichtslosen Hotelzimmer nicht mehr voneinander unterscheiden, das vielköpfige Publikum nicht von dem des Vortages oder von dem der letzten Woche, aber an den letzten Abenden hatte ich Gesellschaft von drei anderen Autoren gehabt, die sich alle mehr oder minder in der gleichen misslichen Lage befunden hatten wie ich. Es war eine Erleichterung, nicht allein zu sein, zumindest versicherten wir uns das gegenseitig zwischen unseren Auftritten, um die gute Laune und den sogenannten Schwung aufrechtzuerhalten.
Im Nachhinein weiß ich natürlich, dass die Stadt Aarlach hieß, aber ich bin mir nicht sicher, ob mir das klar war, als ich hinter dem wolkenmarmorierten Rednerpult auf der Bühne meinen Platz einnahm, um wieder einmal die immer gleichen Worte, die immer gleichen versprengten Beobachtungen und leicht dahin geworfenen Wahrheiten über das Leben und unsere grundlegenden Lebensbedingungen von mir zu geben, denen ich zu diesem Zeitpunkt schon so viel Saft ausgepresst hatte, dass ich bezweifelte, es könnte noch einen einzigen Zuhörer geben, der nicht bemerkte, wie blutleer das alles klang.
Obwohl das Ganze anfangs den anspruchsvollen Stempel des reinen Ernstes und der unverfälschten Berichterstattung getragen hatte, dessen war ich mir sicher. In dieser Absicht bin ich an das Ganze gegangen, und so war es auch gewesen. Aber welche Geschichte, welche Episode erträgt es schon, Abend für Abend für Abend wiederholt zu werden? Wer ist dazu in der Lage?
Natürlich, es gibt solche Geschichten und auch solche Erzähler, ich bin der Erste, der das einräumt. Mein Gefühl des Versagens habe ich einzig und allein mir selbst zuzuschreiben. Und zwar damals wie heute.
Die Veranstaltung fand in einem alten, umgebauten Kino im Art-déco-Stil statt. Die Anzahl der Plätze betrug vier- bis fünfhundert, es gab nicht einen einzigen freien Stuhl im Raum. Als ich nach ungefähr vierzehn Minuten damit begann, meinen Sechs-Minuten-Text aus dem zweiten Kapitel vorzulesen, trat etwas Sonderbares ein, was mir bis heute unerklärlich ist.
Ich wurde plötzlich blind. Der Text – und das Buch und die Hände, die das Buch hielten, und das Rednerpult und das gesamte vierhundertfünfzigköpfige Publikum – verschwand vor meinen Augen, und eine Sekunde lang dachte ich, meine letzte Stunde hätte geschlagen. Ich würde hier auf der Bühne, während meines Auftritts, sterben. Möglicherweise gelang es mir sogar – in aller Hast –, diesem finsteren Gedanken ein wenig bittere Süße abzugewinnen, denn auch wenn meine Romane in zehn, zwanzig oder dreißig Jahren bestimmt vergessen sein werden, so würde der eine oder andere Bücherwurm sich gewiss noch daran erinnern, wie ich meine Tage beendet hätte. Und Berühmtheit, in welcher Gestalt auch immer, ist nie zu verachten.
Aber so schlimm kam es nicht. Ich umklammerte mit der linken Hand die hervorstehende, etwas spitze Seitenkante des Pultes, mit der rechten das Buch, und da der Text sich mir nach all den Vorstellungen bis zur letzten Atempause und bis zum kleinsten Semikolon eingeprägt hatte, las ich einfach weiter, als wenn nichts wäre. Ich blätterte sogar an der richtigen Stelle um, und nach einem gewissen Zeitraum, den ich damals nicht einschätzen konnte, von dem ich jedoch im Nachhinein annehme, dass er ungefähr zwei Minuten betrug, kehrte mein Augenlicht zurück.
Der Text erschien wieder vor mir – das Buch, meine Hände, die ein wenig zitterten, ich hatte es nicht bemerkt, aber jetzt sah ich es, das Scheinwerferlicht und die Gesichter der Menschen, die in den ersten zwei, drei Reihen saßen –, und mir war klar, dass ich etwas sehr, sehr Ungewöhnliches erlebt hatte.
Vielleicht war es ein Zeichen oder ein Omen, aber ich habe nie auch nur annähernd begriffen, wie es zu deuten wäre.
Eine halbe Stunde später – ich war der letzte Autor gewesen, der auftrat – befanden wir uns in dem obligatorischen Restaurant. Analyse, Nachgespräch, der Leichenschmaus. Wir waren so um die zwanzig, ein Quartett an Schriftstellern, eine Handvoll Organisatoren, ein paar Buchhändler, einige Journalisten und drei oder vier weitere Gäste. Die Tafel wurde nach einer guten Stunde aufgehoben, da einige sich noch ein wenig bewegen wollten, und ich landete bei einer dunklen Dame in den Dreißigern, ich hatte ihre Funktion am Abend nicht herausgefunden, und sie offenbarte sich mir auch nicht. Auch ihren Namen nannte sie mir nicht.
»Mir gefällt Ihr Buch sehr gut«, begann sie stattdessen das Gespräch.
Das war keine ungewöhnliche Einleitung, wenn man die Umstände bedachte, und ich begnügte mich damit, ihr zu danken.
»Es gab da vor allem einen Abschnitt, der mich tief bewegt hat«, fuhr sie fort.
Ich murmelte etwas Unverbindliches als Antwort, fühlte mich wie immer in so einer Situation etwas unsicher und verlegen. Entblößt und bereit für die Obduktion, wie ein Kollege die Sache zu bezeichnen pflegt.
»Es geht um dieses Gedicht«, sagte sie. »Gibt es das wirklich? Ich meine, Sie behaupten in Ihrem Buch, dass es von diesem russischen Dichter verfasst wurde, aber ich könnte mir denken, dass Sie es selbst geschrieben haben.«
»Da denken Sie ganz richtig«, erwiderte ich.
»Sie haben es selbst geschrieben?«
»Ja«, gab ich zu, »auch dafür bin ich verantwortlich.«
Sie legte mir eine Hand auf den Arm und schien sich zu konzentrieren. Ich trank einen Schluck Wein und fühlte mich bedrängt, aber gleichzeitig auch geschmeichelt, das will ich gar nicht leugnen.
»Sechs Fuß unter der Erde«, zitierte sie, »in der Morgendämmerung, zwei blinde Würmer, die verweilen.«
»Ja«, sagte ich. »So steht es da.«
»Und Sie sind derjenige, der es geschrieben hat?«
»Ja.«
Ich wand mich. Es ist eine Sache, dass jedes Buch als ein Gespräch zwischen zwei Personen betrachtet werden kann, nämlich einem Autor und dem Leser. Es ist etwas ganz anderes, wenn der Schutz, den das Buch ausmacht, wegfällt, wenn der Abstand zwischen den Gesprächspartnern zu einem Nichts zusammenschrumpft. Eine dumpfe Welle der Unlust durchfuhr mich, und ich wünschte, ich hätte Mumm genug besessen, einfach aufzustehen und das Lokal zu verlassen. Aber das hatte ich nicht.
Sie bemerkte meine Verlegenheit. »Entschuldigung«, sagte sie. »Ich wollte Sie nicht belästigen. Ich bin Ihnen zu nahe getreten, das war dumm von mir.«
Ich schaute mich am Tisch um, während ich versuchte, mich irgendwie wieder in den Griff zu bekommen. Alle anderen Gäste saßen in kleinen Gruppen ins Gespräch vertieft, einige hatten Zigaretten oder Zigarren angezündet, und keiner von ihnen nahm auch nur die geringste Notiz von mir und der unbekannten Frau. Ich trank noch einen Schluck Wein.
»Wer sind Sie?«, fragte ich und stellte mein Glas ab. »Ich glaube, wir sind einander nicht vorgestellt worden.«
Sie lachte, nahm dabei jedoch nicht ihre Hand von meinem Arm.
»Sie sind so altmodisch«, sagte sie. »Das gefällt mir. Möchten Sie, dass ich Sie in Ruhe lasse?«
»Ich weiß es nicht«, antwortete ich wahrheitsgemäß. »Ich weiß es wirklich nicht. Ich bin nicht ganz bei der Sache heute Abend, es war eine anstrengende Woche.«
»Sie möchten, dass ich Sie in Ruhe lasse?«, wiederholte sie.
Ich betrachtete ihr Gesicht, dessen Konturen sich plötzlich aufzulösen schienen. Einen Moment lang fürchtete ich, ich könnte wieder mein Sehvermögen verlieren, doch dann stabilisierte sich alles, und erst da stellte ich fest, wie schön sie war.
»Was wollen Sie von mir?«, fragte ich. »Wer sind Sie?«
»Ich heiße Winnie Mason«, sagte sie. »Lassen Sie uns von hier verschwinden. Ich muss ernsthaft mit Ihnen reden.«
Zwei Minuten später standen wir draußen auf dem Bürgersteig im Regen. In Aarlach, es war Viertel nach elf Uhr abends, der 25. November 1999. Und ich stand dort mit einer Frau, die Winnie Mason hieß.
3
Ich bleibe noch eine Weile im Grey Dog sitzen.
Spüre eine Art Unentschlossenheit, die mich aber nicht stört. Sie muss nicht hinterfragt werden; ich betrachte die Menschen, die vorbeigehen, und stelle fest, dass es mir gefällt, hier zu sitzen. In gewisser Weise spiegelt sich hier die ganze Welt. Alle Rassen, alle Altersgruppen, alle Temperamente sind in diesem Viertel vertreten. Junge Frauen und Männer, die ihr Leben selbst bestimmen und auf Traditionen pfeifen; zumindest möchte ich mir das einbilden, und leider ist ja die Illusion oft stärker als die Wirklichkeit, da es allein die Illusion ist, die wir sehen und mit der wir uns befassen, zu mehr bleibt keine Zeit; ältere Damen und alte Greise außerdem, Schwarze, Weiße, Latinos und Juden. Eine Gruppe von Kindern unterschiedlicher Hautfarbe strömt aus der katholischen Schule an der Ecke zur Bleecker Street; der alte Russe mit seinem hinkenden Hund schleppt sich vorbei, und Mr. Mo, der Chinese, dem der Waschsalon gehört, betritt den Bürgersteig und zündet sich eine Zigarette an. Blinzelt in die Sonne. Zwerge und Fotomodelle, Bucklige und O-beinige; Koreaner, Kubaner, Homosexuelle und Heterosexuelle; ein vermutlich asexueller Neuseeländer namens Ingolsen, zumindest vermuten Winnie und ich, dass er asexuell ist, seit wir einmal mit ihm an einem Tisch in The Noodle Bar gegenüber der Kirche gesessen und uns eine Stunde lang unterhalten haben, an einem unserer ersten Abende hier in der Stadt … alle Arten, wie gesagt, jede denkbare Variante, jeder vorstellbare Kompromiss; wenn man diesen Bürgersteigverkehr nur eine einzige Minute stoppte und erfragte, von welchen Orten auf der Welt die Eltern der Vorbeigehenden einmal kamen, Vater und Mutter, gewissenhaft und systematisch, ohne jemandem zu nahe zu treten, und wenn man anschließend kleine Nadeln mit bunten Köpfen auf einem Globus befestigte, ja, dann würde man ein wunderbar breites Bild bekommen.
Gedanken dieser Art habe ich mir eigentlich täglich gemacht, seit wir hier sind, womöglich hat es etwas damit zu tun, dass wir uns auf einer Art Flucht befinden und dass eine Art beruhigende Feststellung darin liegt, in den hier vorgestellten mentalen Bahnen zu wandern, in den Gräben der Fremde, wie es einmal jemand genannt hat, ein Däne oder Belgier bestimmt … während man sich gleichzeitig einbildet, in der großen weiten Welt zu sein, ja, so ist es wahrscheinlich. Jungfräulicher Boden.
Die paradoxe Einfachheit der Vielfalt; vielleicht gibt es irgendwo dort auch einen Stecknadelkopf, der Sarah zugeordnet ist. Ich trinke meinen Kaffee aus und sehe Winnie unten bei dem Gitarrengeschäft um die Ecke kommen. Ich spüre einen heftigen Schmerz im Herzen; von all diesen Menschen, in dieser wimmelnden Vielfalt, sehe ich plötzlich nur noch sie. Ich weiß, dass ich mir manchmal wünsche, das uns verbindende Band wäre nicht so stark. Dass auch sie nur eine Illusion wäre, die ich mit angenehmem Abstand genießen könnte. Aber in diesem Moment wünsche ich mir das nicht, ich habe das Gefühl, als wäre sie ein Teil meines Blutkreislaufs.
Wir gehen hinauf in unsere Wohnung. Die eigentlich nur aus einem einzigen großen Raum besteht; an einer Wand die Küchenzeile, das Schlafzimmer hat die Größe eines gewöhnlichen Schranks, und oben unter dem Dach befindet sich ein Loft von einigen Quadratmetern, wo Gäste für eine Nacht unterkommen können. Zumindest ein Gast. Das Zimmer reicht hinauf bis zum First, zwei große Dachfenster geben ihm den Anschein eines Ateliers oder einer Kirche. Winnie zögerte keine Sekunde, nachdem wir zum ersten Mal die Treppen hinaufgestiegen waren.
Aber wir haben nie Gäste. Winnie hat ihre Puppen und ihre Malerutensilien ins Loft hinaufgebracht. Hier oben steht sie – oder besser gesagt, sitzt sie, denn es gibt fast keinen Platz, um zu stehen –, wenn sie arbeitet, sie sagt, das Licht, das durch die schmutzigen Fenster fällt, sei ideal, fast zu gut, in den ersten Tagen war es sogar hinderlich, jetzt jedoch nicht mehr.
Wir wärmen uns eine Suppe vom Vortag in der Mikrowelle auf, dann sitzen wir einander an dem hohen Steinmeyertisch aus Stahl und Glas gegenüber: die Suppe, dunkles Brot mit Ziegenkäse aus Murray’s phantastischem Käseladen auf der Bleecker Street gleich um die Ecke, jeder mit einem Glas Weißwein. Winnie wird nach der Mahlzeit betrunken sein, das ist ihrem Blick jetzt schon anzusehen.
Ich frage, ob sie malt. Sie nickt und fragt, ob ich schreibe. Ich antworte, dass ich tatsächlich glaube, an etwas dran zu sein, sie schenkt mir ein etwas skeptisches Lächeln.
»An etwas dran sein?«, fragt sie. »Meinst du das wirklich?«
»Ich glaube schon«, sage ich.
»In dieser düsteren Bibliothek?«
»Ja.«
»Ich könnte niemals dort arbeiten.«
»Ich brauche nicht so viel Licht wie du.«
»Es ist einfach zu dunkel dort, ganz gleich, was man auch macht. Es erinnert mich an meinen Großvater.«
Als Winnie zehn Jahre alt war, versuchte ihr Großvater, sich zu erhängen. Das Seil riss, oder vielmehr brach der Querbalken, an dem er es befestigt hatte. Er lebt immer noch, die letzten zwanzig Jahre hat er in einer Anstalt in einem Vorort von Rotterdam gesessen. Oder gelegen. Ich habe ihn nie getroffen; seit wir verheiratet sind, hat Winnie ihn zweimal besucht.
Ihre Eltern sind tot, genau wie meine. Ich habe keine Geschwister. Winnie hat eine Schwester in London. Bis zu dem Zeitpunkt, als Sarah verschwand, hatten sie miteinander losen Kontakt, aber nur per Email oder Telefon; ich habe sie nie gesehen, und im letzten Jahr ist der Kontakt eingeschlafen. Ich glaube, es war Winnies Entscheidung.
»Ich bin mir nicht sicher, ob es klappt«, sage ich. »Aber die Bibliothek gefällt mir. Zumindest bis auf weiteres.«
Winnie erwidert nichts. Etwas ist mit ihr heute, an diesem Tag, passiert, das kann ich sehen. Es ist nicht nur der leichte Schwips, da ist noch etwas anderes. Eine Art fiebriger Energie, die sie zu verbergen versucht, sie hat einen Ausdruck in den Augen, der da gestern noch nicht war, den ich noch nie gesehen habe, seit wir hierher gekommen sind.
Etwas ist passiert. Normalerweise gefällt mir diese Wortkonstellation, aber heute nicht.
»Wie geht es dir?«, frage ich.
Wie vorsichtig wir miteinander reden, denke ich. Wir nähern uns einander mit einer Rücksichtnahme an, die nur als Maskierung für das Gegenteil dient; unsere Worte fallen ebenso natürlich und liebenswürdig aus wie die Höflichkeiten vor einem Duell oder die Häppchen nach einer Beerdigung.
Nein, so schlimm ist es nicht, nicht wirklich. Aber das Schweigen hat seine Grenzen, es fällt mir schwer, es zu ertragen.
»Es ist etwas passiert«, sagt sie und holt gleich danach tief Luft, als fiele es ihr schwer, genügend Sauerstoff zu bekommen. »Heute ist etwas passiert.«
»Was?«, frage ich.
»Sarah«, sagt sie. »Mir ist klar, dass sie lebt. Jetzt ist es mir klar geworden.«
4
Wir gingen um eine Ecke und fanden eine Bar. Sie hieß Styx und sah nicht besonders einladend aus, aber der Regen ließ uns keine großen Möglichkeiten, wählerisch zu sein. Wir fanden einen Tisch unter einer düsteren Piranesi-Reproduktion, sie entschuldigte sich dafür, dass sie sich mir so aufdrängte, und ich erklärte meinerseits, dass ich nur dankbar war, mal wegzukommen. Wir bestellten eine Karaffe Rotwein und einen Käseteller. Sie erzählte mir von ihrem Leben.
Dass sie Künstlerin sei. Dass sie erst vor einigen Monaten nach Aarlach gezogen sei, nachdem sie sich von ihrem Mann habe scheiden lassen, der auch Künstler war und in ihrer gemeinsamen Wohnung in Berlin geblieben war.
Dass sie keinerlei Hintergedanken hege – sie benutzte genau dieses Wort, Hintergedanken – und dass ich mich in keiner Weise gezwungen fühlen solle, hier bei ihr zu sitzen und mit ihr zu reden, wenn mir nicht danach war. Erneut versicherte ich ihr, dass sie sich deswegen keine Gedanken machen müsse, und fügte hinzu, was meine Person betreffe, so hätte ich meine Scheidung schon etwas länger hinter mir, gut anderthalb Jahre.
Außerdem betonte ich, dass ich seit zwei Monaten unterwegs sei und über mein Buch spreche und mich etwas erschöpft fühle, sowohl physisch als auch psychisch.
Dann müssen wir eine Weile über die Bedingungen schöpferischer Arbeit gesprochen haben, ich glaube, wir verglichen die unterschiedlichen Voraussetzungen fürs Schreiben und Malen – den sprachlichen bzw. bildlichen Ausdruck –, aber inzwischen kann ich mich nicht mehr genau an unser Gespräch erinnern, und höchstwahrscheinlich kamen wir auf keine neuen Erkenntnisse. Aber ich weiß, dass ich sie fragte, ob sie in irgendeiner Weise geholfen habe, den abendlichen Autorenauftritt zu organisieren, weil sie beim Nachklapp im Restaurant dabei war. Sie erklärte, dass sie den Kulturredakteur der Zeitung kenne, die die Veranstaltung gesponsert hatte, und dass sie ihn ganz einfach gebeten hatte, doch mitkommen zu dürfen.
»Und der Grund dafür?«, wollte ich wissen.
»Ihr Buch«, antwortete sie, ohne zu zögern. »Ja, genauer genommen dieses Gedicht.«
Ich erklärte, dass es mir schwer falle, ihr in diesem Punkt Glauben zu schenken, sie saß eine Weile schweigend da, ohne den Blick von mir zu wenden, es schien mir, als würde sie irgendwie mit sich kämpfen. Als hätte sie sich noch nicht entschlossen. Anschließend beugte sie sich nach unten und holte ein schwarzes Notizheft aus ihrer Tasche, die sie neben ihren Stuhl auf den Boden gestellt hatte.
Sie blätterte einige Sekunden lang darin hin und her, dann räusperte sie sich und las erneut die Zeilen vor, die sie bereits im Restaurant zitiert hatte.
»Sechs Fuß unter der Erde,
in der Morgenröte,
zwei blinde Würmer, die verweilen …«
Ich nickte und spürte erneut Unbehagen in mir aufsteigen. Nach einer kurzen Pause las sie vier weitere Zeilen.
»… die verwundert
den Stimmen von oben lauschen,
die Richtung ändern und aufeinandertreffen,
wie aus Zufall.«
Ich murmelte etwas, irgendwas, sie klappte das Heft zu und betrachtete mich mit einem neuen, fast mahnenden Blick.
»Die Perspektive des Gärtners kam im September heraus, nicht wahr?«
»Ja, am zwölften, das stimmt.«
»Und wir sind uns noch nie begegnet?«
»Das müsste ich auf jeden Fall wissen.«
»Und die paar Zeilen, die ich eben gelesen habe, auf Seite zweihundertsechsundzwanzig in Ihrem Buch, stammen von diesem fiktiven russischen Poeten?«
Ich zuckte mit den Schultern. Mein Unbehagen wuchs beträchtlich. »Ja, sicher.«
Sie verzog kurz den Mund und verschränkte die Hände um das Glas, das vor ihr auf dem Tisch stand. »Dann kommen wir zu des Pudels Kern. Die Gedichtzeilen, die ich vorgelesen habe, stammen nicht aus Ihrem Roman. Ich habe sie selbst genau in dieses Notizbuch geschrieben, und zwar Mitte Mai. Können Sie mir dafür eine vernünftige Erklärung geben?«
»Wie bitte?«
Sie räusperte sich und wiederholte. »Ich habe diese Zeilen vier Monate, bevor Die Perspektive des Gärtners herausgekommen ist, geschrieben. Haargenau so, wie sie in Ihrem Buch stehen. Wort für Wort. Dafür hätte ich gern eine Erklärung.«
Ich saß schweigend da. Die Gedanken schlugen Salto in meinem Kopf.
»Das ist nicht möglich«, sagte ich schließlich.
Ein Gedanke blieb jedoch haften. Sie ist wahnsinnig, sagte er. Die Frau, die dir gegenüber in dieser verfluchten Bar in dieser gottverlassenen Stadt Aarlach sitzt, ist durch und durch wahnsinnig. Das hättest du sofort bemerken müssen.
Trink dein Glas aus und geh umgehend zurück ins Hotel, fügte er hinzu.
Sie saß da, die Unterarme auf dem Tisch, und betrachtete mich mit ernstem Blick. Es vergingen einige Sekunden, dann senkte sie plötzlich den Blick, ließ die Schultern fallen, als wäre sie plötzlich unschlüssig geworden.
»Ich weiß, es klingt unmöglich«, sagte sie langsam und geradezu versöhnlich. »Ich verstehe es ja auch nicht. Ich bekam einen Schock, als ich Ihr Buch gelesen habe.«
Vielleicht doch nicht total verrückt, korrigierten sich meine Gedanken.
»Aber ist es nicht möglich, dass Sie ein Gedicht zitiert haben, das jemand anderes geschrieben hat?«, fuhr sie fort.
»Auf keinen Fall«, versicherte ich ihr.
Natürlich weiß ich und wusste ich, dass unbewusste (und bewusste) Diebstähle in der Autorenwelt vorkommen, es ist schlicht nicht möglich, das, was man gelesen hat, immer von dem zu trennen, von dem man glaubt, es selbst geschaffen zu haben.
Aber sieben ganze Zeilen? Nein, das hielt ich für vollkommen ausgeschlossen … doch dazu später mehr, natürlich werde ich darauf noch zurückkommen, doch zunächst möchte ich der Chronologie folgen.
»Morgenröte«, sagte sie. »Das ist kein besonders oft benutztes Wort.«
»Ich weiß«, nickte ich. »Aber es gefällt mir.«
»Mir auch.«
»Darf ich einmal sehen?«, bat ich. Sie öffnete ihr Notizheft erneut, drehte es um und reichte es mir. Ich las. Es stimmte, Wort für Wort, mir war klar, dass sie es natürlich möglicherweise aus meinem Buch abgeschrieben hatte und nur hinsichtlich des Zeitpunkts log. Gleichzeitig fühlte ich, dass ich ihre Worte nicht in Zweifel ziehen wollte. Das würde ja bedeuten, dass ich sie schlicht und einfach als Lügnerin hinstellte. Ich registrierte, dass die sieben Zeilen mitten auf einer Seite standen, es gab ganz oben auf derselben Seite einige durchgestrichene Worte, beim Notizheft handelte es sich um einen üblichen Spiralblock mit festem, schwarzem Einband, und er schien bis zur Hälfte mit ihren Notizen gefüllt zu sein. Die betreffenden Zeilen standen auf einer rechten Seite ungefähr im ersten Drittel des Heftes. Ich schlug es wieder zu und überreichte es ihr.
»Mai?«, fragte ich nach. »Sie sagen, Sie haben das im Mai geschrieben?«
Sie nickte. »In der Nacht zum Fünfzehnten«, sagte sie. »Ich kann mich noch genau daran erinnern. Es war die Nacht, in der ich beschloss, meinen Mann zu verlassen.«
Der Gedanke, sie wäre wahnsinnig, tauchte wieder für einen kurzen Augenblick auf. Ich jagte ihn davon.
»Schreiben Sie viele Gedichte?«, fragte ich vorsichtig.
»Ab und zu«, sagte sie. »Ich versuche es. Manchmal habe ich das Gefühl, Bilder würden nicht genügen. Es gibt Dinge, die man in Worten ausdrücken muss, ja, das hier ist ja ziemlich selbstredend.«
»Nicht für alle«, wandte ich ein. »Haben Sie schon etwas veröffentlicht?«
Sie schüttelte den Kopf. »Nein, ich habe nicht das Bedürfnis, es jemand anderen lesen zu lassen. Das Bedürfnis besteht nur darin, es zu formulieren, dieses Innere, was da nagt und drängt.«
Ich sagte ihr, dass ich verstünde, wovon sie sprach. Dass Lyrik und Prosa aus unterschiedlichen Quellen stammen und dass ich für meinen Teil nicht im Traum daran dächte, eine Lyriksammlung zu veröffentlichen. Das Gedicht in der Perspektive des Gärtners erfüllte eine andere Funktion als die poetische, ich behauptete, dass ich mir selbst nicht darüber im Klaren wäre, welche, dass dies aber bei einzelnen Komponenten in einem Romankonstrukt nicht ungewöhnlich sei.
Ich erinnere mich, dass ich an diesem verregneten Novemberabend in dieser Bar in Aarlach wirklich eine ganze Zeit lang versuchte, ihr diese Tatsache zu erklären, doch während ich noch dabei war, drängte sich mir ein ganz anderer Gedanke auf, und ich brach ab.
»Was ist?«, fragte sie. »Warum reden Sie nicht weiter?«
»Der Zeitpunkt«, sagte ich.
»Der Zeitpunkt?«
Ich trank einen Schluck Wein und dachte nach. »Ja«, sagte ich. »Er stimmt. Ich habe diese Zeilen auch im Mai geschrieben.«
»Interessant«, sagte sie. »Ich habe über diesen Aspekt schon nachgedacht. Wollte Sie genau danach fragen.«
»Das Buch ist Anfang Juni in Druck gegangen«, erklärte ich. »Aber ich kann mich daran erinnern, dass ich das Gedicht erst wenige Wochen vor Drucklegung im Kasten hatte. Ja, Mitte Mai, denke ich.«
»Vielleicht am fünfzehnten?«, fragte sie.
»Warum nicht?«, stimmte ich zu.
Eine Weile saßen wir schweigend da. Ein junges Paar kam und ließ sich am Tisch neben uns nieder. Winnie beugte sich vor und senkte ihre Stimme.
»Glauben Sie, dass ich lüge?«
»Nein«, antwortete ich. »Ich weiß nicht, warum, aber das glaube ich nicht.«
»Sie haben keine Angst, eine Wahnsinnige getroffen zu haben?«
»Nein.«
Sie sah mich an, als wollte sie den Wahrheitsgehalt meiner beiden Antworten ausloten. Soweit ich weiß, bestand ich den Test.
»Ich wollte nur Gewissheit haben«, sagte sie. »Ich möchte versuchen zu verstehen, wie so etwas möglich sein kann.«
Ein Kellner kam und nahm die Bestellung des jungen Paares auf, und wir saßen wieder eine Weile schweigend da. Dann holte ich tief Luft und versuchte eine Zusammenfassung.
»Zwei Personen«, sagte ich, »ein Mann und eine Frau, die einander nicht kennen, schreiben ungefähr zum gleichen Zeitpunkt sieben identische Gedichtzeilen. Wort für Wort identisch. Nein, ich habe keine Erklärung. Und ich bin Ihrer Meinung: Das ist schon etwas schockierend.«
»Hängen Sie einem Glauben an?«, fragte sie.
»Nein«, antwortete ich. »Ich betrachte mich nicht als gläubig.«
»In keiner Weise?«
»Was meinen Sie damit? Ich mag keine Vereinfachungen, das sollten Sie wissen, wenn Sie mein Buch gelesen haben.«
»Selbstverständlich«, erwiderte sie. »Ich wollte nur wissen, ob Sie sich vorstellen können, irgendeine Art von paranormaler Lösung zu akzeptieren?«
»Paranormale Lösung?«, wiederholte ich etwas irritiert. »Was zum Teufel meinen Sie denn damit?«
»Nennen Sie es, wie Sie wollen«, sagte sie nur, »Sie wissen schon, was ich meine.«
Was ich natürlich tat.
»Und wie ist es mit Ihnen?«, fragte ich zurück. »Welche Lösung akzeptieren Sie?«
Sie lachte laut auf. »Nicht besonders viele«, sagte sie. »Aber auf jeden Fall bin ich nicht so beschränkt, dass ich nur das schlucke, was ich begreifen kann.«
»So beschränkt bin ich auch nicht«, versicherte ich ihr. »Aber wenn Sie sich also eine Art von Erklärung denken können, warum sitzen wir dann hier?«
Sie lehnte sich zurück und sah mich mit einem Blick an, der … ja, was deutete er an? Dass ich nicht ganz ihren Erwartungen entsprach? Dass ich irgendwie ein Betrüger war und es ihr schuldig war, das eine oder andere zu erklären? Und wenn ja, was?
Vielleicht handelte es sich auch nur um diese natürliche weibliche Überlegenheit, die für einen Moment aus dem leichten Kräuseln ihrer Lippen schien. Auf jeden Fall spürte ich, wie zwei widerstreitende Impulse in mir kämpften. Der eine riet mir, mit der Faust auf den Tisch zu hauen, aufzustehen und das Lokal zu verlassen. Der andere, ihr Gesicht zu mir zu ziehen und sie zu küssen.
Wobei ich mir gar nicht so sicher bin, inwieweit diese Impulse einander wirklich ausschlossen.
»Aber begreifen Sie denn nicht?«, fragte sie schließlich. »Begreifen Sie nicht, dass ich den Mann, der irgendwo in seinem Inneren mit mir identisch sein muss, zumindest einmal treffen wollte?«
Danach zog ich es vor zu schweigen.
Auch Winnie schwieg. Ich goss den Rest aus der Karaffe in unsere Gläser, wir sahen einander mit einer Art erschlaffter Kühnheit an und tranken aus. Ich bat den Kellner um die Rechnung, und nachdem ich bezahlt hatte und Winnie ihr schwarzes Notizbuch wieder in der Tasche verstaut hatte, legte sie ihre Hand auf meine.
»Trauen Sie sich, mit mir nach Hause zu kommen?«
»Wieso benutzen Sie so ein Wort?«, fragte ich. »Trauen?«
»Entschuldigen Sie«, sagte sie. »Ich habe das Gefühl, dass ich zusehen muss, die Oberhand zu behalten. Hätten Sie etwas dagegen, zu mir nach Hause zu kommen, das wollte ich sagen. Ich wohne nur fünf Minuten von hier.«
Es war ein Gefühl, als stünde ich mit der Hand in einer Trommel voller Lose da. Zur Hälfte Ja-, zur Hälfte Nein-Lose. Ich rollte den kleinen Papierzylinder auf und las die Antwort.
»Ja«, sagte ich, »ich glaube, ich will, und ich traue mich.«
Das ist mir seitdem im Kopf geblieben, dieses Bild einer Lostrommel. Einmal, ein paar Monate vor Sarahs Geburt, erzählte ich Winnie davon. Sie schlug mir darauf mit geballter Faust direkt ins Gesicht, meine Nase begann sofort zu bluten, und ich kann mich erinnern, dass ich, noch während ich im Badezimmer stand und versuchte, den Blutfluss zu stoppen, dachte, dass es genau das war, was ich verdient hatte.
Es war übrigens das einzige Mal, dass es zu einer Art Handgreiflichkeit zwischen Winnie und mir gekommen ist.
5
Mir ist klar, dass sie lebt. Jetzt ist es mir klar geworden.
Ich ziehe es vor, das Thema zu vermeiden. Es ist nicht das erste Mal, dass Winnie mit dieser Art von Behauptungen kommt, und meine übliche Reaktion ist, möglichst keine zu zeigen. Oft, wenn auch nicht immer, lässt sie die Sache dann fallen, und ich kann selten sagen, ob sie mein Desinteresse als reine Skepsis definiert. Oder denkt sie, dass ich sie nicht ernst nehme? Und deshalb das Thema nicht anspreche?
Weiterhin bin ich mir nicht im Klaren darüber, wie viel meine Skepsis für sie bedeutet. Vermutlich recht wenig, wenn es die noch lebende Sarah ist, die auf der anderen Waagschale liegt. Doktor Vargas gab mir den Rat, meiner Frau gegenüber nicht allzu viel in Frage zu stellen; er betonte das zweimal, sowohl als Winnie aus dem Krankenhaus entlassen wurde als auch beim letzten Mal, als wir uns sahen, ein paar Wochen, bevor wir hierherzogen. Ich kann mich noch an seinen forschenden, etwas schielenden Blick erinnern: Ihnen ist klar, worum es geht, nicht wahr? Sie wissen, wie Sie mit ihr umgehen müssen, wenn Sie diese Sache gemeinsam bewältigen wollen?
Keine Konfrontation. Keine Provokation. So habe ich es interpretiert. Gar nicht erst versuchen, meine Frau zu der Einsicht zu bringen, dass Sarah mit größter Wahrscheinlichkeit für alle Zeiten verloren ist. Ein dünner Hoffnungsstreifen kann einen Menschen länger am Leben halten, als wir es uns normalerweise vorstellen. In den meisten Fällen bis zu seinem natürlichen Ende.
Ebenso wahr ist, dass es das Schrecklichste ist, mit der Ungewissheit leben zu müssen. Es gibt verschiedene Arten von Wahrheiten, jeder sollte die finden, die er am besten ertragen kann.
»Ich möchte, dass du dir mein Bild ansiehst«, erklärt sie unvermutet, als ich aus dem Badezimmer komme. »Ich glaube, ich habe alles so eingefangen, wie es sein soll, aber du musst mir mit dem Letzten helfen.«
Sie hat die Leinwand bereits vom Loft heruntergeholt, jetzt dreht sie sie richtig herum und stellt sie auf einen der Küchenstühle. Schaltet ein Spotlight ein und richtet es direkt auf das Bild. Ich bin vorbereitet, kann mich aber dennoch nicht gegen den starken Eindruck wehren, den das Gemälde bei mir hinterlässt. Oder was immer es ist. Die Leinwand ist nicht größer als vierzig mal sechzig Zentimeter; Eiöltempera, das ist schon immer ihre Lieblingstechnik gewesen, das Motiv eines der üblichen, aber dieses Mal weist das Bild eine fast fotografische Schärfe auf.
Ein Stück unseres Rasens im Vordergrund, mit einer hellgelben Decke und ein paar Stofftieren. Der rote Briefkasten und die niedrige Steinmauer. Das parkende grüne Auto. Sarah, die in ihrem kurzen blauen Rock, ihrer etwas helleren Bluse und mit ihrer kleinen, abgewetzten Schultertasche auf dem Bürgersteig steht. Ihr rotbraunes Haar, das vom Wind etwas angehoben wird, man gewinnt den Eindruck, sie hätte mitten in einem Schritt innegehalten, wäre stehen geblieben, weil der Mann, der vor dem Auto steht, die linke Hand auf der Motorhaube, ihr gesagt hat, sie solle stehen bleiben. Er steht irgendwie ziemlich locker da, der Schwerpunkt liegt auf dem rechten Bein; er ist relativ groß und dünn, trägt dunkle Schuhe und eine lange Hose und einen dünnen Mantel, der fast, aber nicht ganz, den gleichen Farbton hat wie das Auto.
Er trägt ein weißes Hemd, das am Hals aufgeknöpft ist, und er hat kein Gesicht.