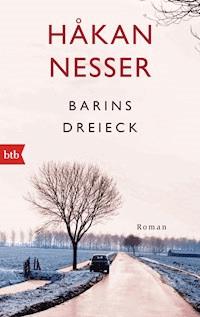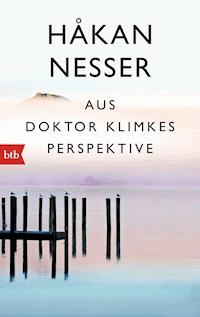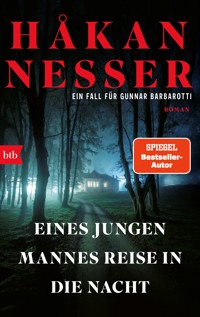11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
„Trotz allem, was du vielleicht glaubst, bist du nicht wichtig für die Welt.“ Das waren die Worte, die Adalbert Hanzons Vater ihm als Kind mitgab. Vielleicht nicht das ermutigendste Motto, aber Adalbert kommt trotzdem ganz gut zurecht. Zumindest bis die Liebe und der Wahnsinn, der so oft darauf folgt, zuschlagen. 43 Jahre und eine Haftstrafe später ist Adalbert Hanzon ein dem Alkohol zugeneigter älterer Herr mit Rückenproblemen und zunehmend nachlassendem Gedächtnis. Plötzlich holt ihn die Vergangenheit ein: bei einem Apothekenbesuch glaubt er die einzige Frau, die ihm jemals etwas bedeutet hat, wiederzuerkennen. Und die einzigen Menschen, die ihm helfen können, Licht in das Dunkel zu bringen, was vor fast einem halben Jahrhundert passiert ist, sind sein nervtötender Nachbar und seine allzu gesprächige Cousine. Aber Not ist die Mutter der Erfindung, und Adalbert fest entschlossen, der Wahrheit auf den Grund zu gehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 333
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Zum Buch:
»Trotz allem, was du vielleicht glaubst, bist du nicht wichtig für die Welt.« Das waren die Worte, die Adalbert Hanzons Vater ihm als Kind mitgab. Vielleicht nicht das ermutigendste Motto, aber Adalbert kommt trotzdem ganz gut zurecht. Zumindest bis die Liebe und der Wahnsinn, der so oft darauf folgt, zuschlagen. Dreiundvierzig Jahre und eine Haftstrafe später ist Adalbert Hanzon ein dem Alkohol zugeneigter älterer Herr mit Rückenproblemen und zunehmend nachlassendem Gedächtnis. Plötzlich holt ihn die Vergangenheit ein: Bei einem Apothekenbesuch glaubt er die einzige Frau, die ihm jemals etwas bedeutet hat, wiederzuerkennen. Und die einzigen Menschen, die ihm helfen können, Licht in das Dunkel zu bringen, was vor fast einem halben Jahrhundert passiert ist, sind sein nervtötender Nachbar und seine allzu gesprächige Cousine. Aber Not ist die Mutter der Erfindung und Adalbert fest entschlossen, der Wahrheit auf den Grund zu gehen.
Zum Autor:
Håkan Nesser, geboren 1950, ist einer der beliebtesten Schriftsteller Schwedens. Für seine Kriminalromane erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, sie sind in über zwanzig Sprachen übersetzt und mehrmals erfolgreich verfilmt worden. Håkan Nesser lebt in Stockholm und auf Gotland.
Håkan Nesser
Der Halbmörder
Roman
Aus dem Schwedischen von Paul Berf
Die schwedische Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel »Halvmördaren. Krönika över Adalbert Hanzon i nutidoch dåtid författad av honom själv« im Albert Bonniers Förlag, Stockholm.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Zitat aus Jón Kalman Stefánsson: Himmel und Hölle. Aus dem Isländischen von Karl-Ludwig Wetzig. Stuttgart: Reclam 2009.
Copyright © 2019 by Håkan Nesser
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2022 by btb Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestaltung: semper smile, München
Covermotiv: © Stocksy/ZHPH Production; © Shutterstock/eragraphics
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-25890-0V001
www.btb-verlag.de
www.facebookcom/btbverlag
»Mit ihm stimmte von Anfang an etwas nicht.«
Rune Larsson
1
Zwei Mieter wohnen in meinem Kopf. Sie leben dort seit Langem, bezahlen keine Miete und ziehen niemals aus. Ihre Namen sind Schuld und Scham, sie müssen erwähnt werden, und jetzt ist es getan.
Aber ich möchte meine Chronik nicht mit diesen beklemmenden Begleitern einleiten, da verliere ich gleich den Mut. Ich schiebe sie in die Zukunft, vielleicht bis ans Ende, und beginne stattdessen mit einem anderen Namen. Meinem eigenen.
Ich heiße Adalbert Hanzon.
Es gab eine Zeit, in der ich Bert Hansson hieß, aber das ist lange her. Heute bin ich dreiundsiebzig, und mein Gedächtnis ist nicht mehr, was es einmal war. Vielleicht bin ich auch einen Hauch dement, aber falls es so sein sollte, habe ich keine Lust, mich näher damit zu befassen. Dazu besteht keine Veranlassung, und ich versuche, meinem mentalen Verfall entgegenzuwirken, so gut es eben geht. Mit der Zeit werde ich auf das eine wie das andere zurückkommen, aber das ist kein Versprechen. Ich habe noch nie ein Buch geschrieben, und es ist nicht gesagt, dass es mir gelingt, die Sache glücklich zu Ende zu bringen, aber seit einiger Zeit treibt mich ein innerer Zwang an, es wenigstens zu versuchen. Dafür gibt es gute Gründe.
Ich sitze an meinem Küchentisch. Es ist ein grauer Vormittag in der ersten Septemberhälfte. Durch das Fenster kann ich Henry Ullberg sehen, der auf der anderen Straßenseite aus seiner Haustür tritt und sich mit seinem Rollator in Richtung Marktplatz und Einkaufsmöglichkeiten schleppt. Er geht jeden Tag einkaufen, auch wenn es gar nicht nötig ist. Manchmal sehe ich ihn mit kaum mehr als einer Tüte Möhren und einer Zeitung zurückkommen.
Henry Ullberg ist im Großen und Ganzen der einzige Mensch, mit dem ich in Kontakt stehe. Er ist sturer als ein Esel. Wir treffen uns ungefähr einmal im Monat, meistens bei ihm, weil ihm das Gehen schwerfällt, wenn er besoffen ist. Und besoffen werden wir immer, wir trinken nämlich Drinks, die wir aus Single Malt Whisky und Trocadero mixen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, die Getränke zu variieren, aber Henry, dieser starrsinnige Dickkopf, weigert sich. Und weil er stets den Whisky beisteuert, mache ich gute Miene zum bösen Spiel. Sein Sohn Robert schickt ihm das Gesöff aus Schottland, wo er als eine Art Jurist arbeitet. Er hat seinen Vater seit fünfzehn Jahren nicht mehr besucht, aber die Pullen kommen regelmäßig an.
Bei unseren Trinkgelagen zerstreiten wir uns häufig, Henry Ullberg und ich, und beschließen fast immer, uns nie wieder zu sehen. Er ist jedoch genauso einsam wie ich, und nach zwei oder drei Wochen greift deshalb immer einer von uns zum Telefonhörer und schlägt vor, dass wir demnächst einen Drink nehmen und ein bisschen quatschen. Meistens rufe ich an, Henry ist generell ein ziemlich zugeknöpfter Typ. Er ist etwas älter als ich, und wir kennen uns seit mehr als vierzig Jahren. Gott sei Dank haben wir uns nicht durchgehend gesehen, aber während einer ziemlich langen Zeitspanne war es täglich und sogar stündlich. Ob wir wollten oder nicht, auch darauf werde ich zurückkommen.
Das Schreiben zehrt an meinen Kräften. Ich sitze hier gerade einmal eine halbe Stunde, bin aber bereits erschöpft und ein wenig entmutigt. Ich bringe meine Worte in einem ziemlich großen Notizbuch mit einem festen, gelben Einband zu Papier. Ich besitze vier Stück davon, gekauft im Sommerschlussverkauf, ohne zu wissen, wofür es gut sein sollte. Ich schreibe nur auf den rechten Seiten, das habe ich vor vielen Jahren bei meiner ersten und einzigen Begegnung mit einem professionellen Schriftsteller gelernt. Es war ein halbwegs berühmter schwedischer Autor, eine Frau schleifte mich dorthin; mir fallen gerade ihre Namen nicht ein, weder der des Schriftstellers noch der der Frau. Dagegen erinnere ich mich, dass ich mitten in seinem Vortrag eingeschlafen bin. Die Frau, sie war groß und rothaarig, weckte mich mit einem ärgerlichen Ellbogenschubser, als es Zeit war zu applaudieren, also muss er das, nur auf den rechten Seiten zu schreiben, am Anfang gesagt haben. Er war übrigens groß und erinnerte mich ein bisschen an einen alten Bandyspieler aus meiner Heimatstadt, der Frasse Finkel hieß. Manche Namen sitzen wie Warzen in der Erinnerung, und jetzt mache ich eine Pause und lege mich im Wohnzimmer einen Moment hin.
Ich habe eine Methode, um gegen das Vergessen anzukämpfen. Man sagt ja, dass das Gehirn beschäftigt werden muss, damit es nicht völlig einrostet. Es tut ihm einfach gut, zu arbeiten und sich anzustrengen, deshalb versuchen Menschen in meinem Alter wohl auch, auf unterschiedliche Weise aktiv zu bleiben. Man löst Sudokus und Kreuzworträtsel, man nimmt an Preisausschreiben teil, man bloggt, schreibt Beiträge für den Eurovision Song Contest und wird Mitglied im Verein der vitalen Senioren. Abgesehen von den Kreuzworträtseln spricht mich nichts von all dem an. Aber ich lese recht viel und schaue die Fernsehnachrichten, das reicht mir völlig.
Meine Methode, mich besser zu erinnern, besteht darin, mir ins Gedächtnis zu rufen, wie manche Leute heißen. Oder hießen, falls sie schon tot sind, was häufig der Fall ist.
Sonntagabends greife ich nach einem Papier (halbsteifer Karton, Postkartenformat, ich besitze einen Vorrat davon) und schreibe eine Liste mit sieben Personen. Auf der einen Seite notiere ich eine kurze Beschreibung der fraglichen Person, auf der anderen ihren Namen. Zum Beispiel: Der Mann, der im Fernsehen Löffel verbogen hat – Uri Geller.
In der folgenden Woche lese ich jeden Morgen die Beschreibung und versuche anschließend, mich an den Namen zu erinnern. Natürlich ohne das Blatt umzudrehen und mir die Auflösung anzuschauen. Ich darf erst aufstehen, wenn ich mindestens sechs geschafft habe. Manchmal dauert das ziemlich lange, das gebe ich gerne zu.
So sieht die Liste für die laufende Woche aus:
Das deutsche Spionweib – Mata Hari
Der Typ, der den Schlager 34 gesungen hat – Per Myrberg
Linker Mittelfeldspieler bei Djurgården und in der Nationalmannschaft – Sigge Parling
Der erste Mann auf dem Mond – Neil Armstrong
Meine Handarbeitslehrerin – Elvira Stalin
Die Frau, die im Fernsehen immer mit dem Handrücken winkte – Ria Wägner
Dieser Fensterputzer – Gösta Pumpman
Es kann sich also um allseits bekannte Menschen handeln wie Sigge Parling oder Neil Armstrong – aber auch um Leute, zu denen ich eine persönliche Beziehung hatte und von denen kein anderer jemals gehört hat. Zum Beispiel Elvira Stalin und Gösta Pumpman; Letzterer schuldet mir übrigens immer noch fünf Kronen, aber da er mittlerweile tot sein dürfte, werde ich sie wohl niemals zurückbekommen.
Wenn man an jemanden denkt und anfängt, sich die Person vorzustellen, taucht das Individuum selbst ja meistens lange vor dem Namen auf. Man sieht sozusagen den ganzen Menschen vor seinem inneren Auge, und obwohl man sich an eine Menge Details und Zusammenhänge erinnert, ist es manchmal verflucht schwer, sich ins Gedächtnis zu rufen, wie dieser Bursche hieß, der 34 gesungen hat. Oder diese hinkende Handarbeitslehrerin, die später, lange nach ihrer Pensionierung, zwischen Flen und Katrineholm vom Zug überfahren wurde. Jedenfalls funktioniert es in meinem Schädel so, und es hilft nicht immer, dass ich den Namen einen oder drei oder sechs Tage vorher auf ein Blatt geschrieben habe.
Und wenn ich mich nun anschicke, die Geschichte zu erzählen, die ich mir zu erzählen vorgenommen habe, ja, wie um Himmels willen soll das gehen?
Aber es ist nun einmal so, dass ich spüre, ich muss es tun. A man’s gotta do what a man’s gotta do. Man muss es zumindest versuchen; es geht ja auch gar nicht darum, das Ganze einfach nur zu erzählen, es gibt da vielmehr ein paar Dinge, die genauer untersucht werden müssen. Ein Rätsel, würde ich beinahe behaupten wollen, und es erfordert wohl einen so aufgeblasenen Idioten wie mich alten Schreiberling, um einen derart zum Scheitern verurteilten Auftrag zu übernehmen.
Nein, nicht zum Scheitern verurteilt, ich weigere mich, diese Beschreibung zu akzeptieren. Wenn ich nicht glauben würde, dass es möglich ist, die Sache auf unergründliche Weise hinzukriegen, würde ich keinen Finger rühren. So einfältig bin ich nun auch wieder nicht.
Und das alles, dieses ganze Gefühl, dass ich wirklich etwas Wichtiges zu erledigen habe, etwas Ernstes und Drängendes, bevor ich den Löffel abgebe, hängt also damit zusammen, dass mir vor einem Monat eine ganz bestimmte Frau ins Auge gefallen ist. Wäre ich an jenem warmen Nachmittag des sechsten August nicht zur Apotheke gegangen, würde ich hier nicht mit meinem Notizbuch, meinen vier kürzlich erworbenen Stiften und einem Schädel voller Fragezeichen sitzen. Das Leben ist schon ein seltsamer Schlamassel.
Aber ich bin nun einmal dorthin gelatscht. Mir war das Samarin ausgegangen, und wenn es etwas gibt, woran ich leide und was ich verabscheue, dann ist es mein regelmäßiges nächtliches Sodbrennen. Vor allem, wenn ich etwas zu viel oder abends etwas zu spät gegessen habe. Oder mit Henry Ullberg Whisky und Trocadero getrunken habe, dann ist es am schlimmsten. Selbst wenn ich nach einem solchen Besäufnis mein übliches Glas vor dem Schlafen hinuntergekippt habe, muss ich in den frühen Morgenstunden fast immer noch einmal aufstehen und ein weiteres Glas trinken. Es ist vielleicht noch keiner an Sodbrennen gestorben, aber mein Gott, es ist unangenehm.
Vermutlich wäre es gar nicht nötig gewesen, zur Apotheke zu gehen, um an Samarin zu kommen; wahrscheinlich führt der Drogeriemarkt es auch, aber die Einrichtungen liegen direkt nebeneinander, es war also egal. Hätte ich mich allerdings für den Drogeriemarkt entschieden, würde ich jetzt nicht hier am Küchentisch sitzen und im Schweiße meines Angesichts arbeiten.
Sie war hübsch, das war das Erste, was mir an der Frau auffiel, die in Erwartung eines Rezepts auf einem der roten Stühle saß. Soweit man noch hübsch sein kann, wenn man um die siebzig ist. Denn das muss sie sein.
Wenn sie es wirklich war, und das war der zweite Gedanke, der mir durch den Kopf schoss. Gütiger Herr im Himmel, schrie es in meinem Schädel, das gibt es doch gar nicht! Die Frau da drüben sieht tatsächlich aus wie … und dann stellte sich kein Name ein. Wie kann man nur den Namen der einzigen Frau vergessen, die man jemals geliebt hat? Wenn auch nur für ein paar Sekunden. (Den Namen vergessen, meine ich, die Liebe währte etwas länger.)
Andrea Altman.
In diesem Kaff. In dieser erbärmlichen Apotheke. Nach all den Jahren. Folglich am Leben.
Kein Wunder, dass mir schwindlig wurde. Aber wenn sie es tatsächlich war, wollte ich natürlich ganz sicher nicht ohnmächtig werden und wie ein umgekippter Müllsack vor ihren Füßen landen. Ich bekam etwas zu packen, vermutlich den Arm eines jungen Mannes, der gerade durch die Tür trat, machte eine Kehrtwende und verließ das Drogengeschäft Krone, oder wie der Laden heute heißt, nachdem sie das Apothekenmonopol abgeschafft haben, unverrichteter Dinge. Wie gesagt, an etwas Sodbrennen ist noch keiner gestorben.
Fünfundvierzig Jahre, rechnete ich aus, als ich am Fluss war und mich auf einer Bank niedergelassen hatte. So lange war es her, dass ich sie zum ersten Mal gesehen hatte. In jenen schicksalsschweren Tagen im August 1974. Ja, die Zeit hat es nicht eilig, aber sie verrinnt, das tut sie. Und sie macht keine Pausen, nicht für eine einzige blasse Sekunde.
Aber war sie es wirklich? Wie konnte das sein? Wahrlich eine berechtigte Frage, und noch berechtigter: Ist es überhaupt möglich, jemanden nach fast einem halben Jahrhundert wiederzuerkennen?
Während ich auf meiner Bank saß und auf das träge fließende Gewässer blickte, dachte ich, dass mir das ungefähr so wahrscheinlich erschien wie, dass Greta Garbo die große Schwester des Papstes war.
Und trotzdem. Trotzdem?
O ja, denke ich, heute genauso wie damals auf der Bank. Ich muss das sehr ernst nehmen. Alles aufschreiben, was ich fast vergessen habe. Denn erst wenn man die Dinge nicht mehr in Worte fasst, die Verhältnisse und Ereignisse, verschwinden sie unter der Oberfläche, jede Wette, dass es so ist. Wie Ria Wägner und Mata Hari. Denn die Worte sind die Haken, an denen man sie herausfischt: die wichtigen Dinge, die man im Strom der Zeit verloren hat.
Sieh einer an, eine richtig gediegene Beobachtung eines alten Schädels noch dazu, wenn ich das an dieser Stelle sagen darf. Und ich habe nichts überstürzt. Fast einen Monat habe ich gewartet und gedacht, dass es mich vielleicht wieder loslassen würde, dieses unbezwingbare Gefühl, diese unwahrscheinliche Begegnung in einer ganz gewöhnlichen, allgemeingültigen Apotheke in einer gewöhnlichen, allgemeingültigen schwedischen Stadt. Dass die Sache im Sande verlaufen würde wie alles andere. Aber das tut sie einfach nicht. Sie lässt mich nicht los und verläuft nicht im Sand, aber genug davon.
Jetzt lege ich eine weitere Denkpause ein, was das Hineingleiten in die Vergangenheit angeht. Ich werfe einen Blick aus dem Fenster und sehe, dass Henry Ullberg von seiner Besorgungsrunde zurückgekehrt ist. Heute ist es eine ungewöhnlich ausgedehnte Eskapade gewesen, vielleicht ist er beim Zahnarzt oder in der Poliklinik gewesen, im Korb seines abgenutzten Rollators liegt jedenfalls nur eine jämmerlich kleine Tüte, die nichts anderes zu enthalten scheint als eine Packung Würstchen und eine Tube Kaviarpaste. Und natürlich eine Zeitung. Mit zunehmendem Alter mag ich mich selbst immer weniger, aber es tut gut, festhalten zu können, dass es zumindest einen alten Sack in unserer Stadt gibt, der noch schlimmer ist als ich.
2
Wo fängt man an?
Vielleicht mit dem Ersten, was in der Erinnerung auftaucht, und wenn nichts auftaucht, ist es wohl besser, man fängt erst gar nicht an.
Doch nun sehe ich tatsächlich dieses verschwommene, aber nach und nach immer deutlicher werdende alte Bild von einem Schulhof Mitte der fünfziger Jahre. Die Stavaschule. Es ist ein ganz normaler Herbsttag. Spätsommer würde manch einer sagen, denn das Wetter ist schön. Sonne und ein wolkenbetupfter Himmel, warme Luft, ginge man nicht in die Schule, könnte man barfuß laufen. Vielleicht zum Hultsjön radeln und schwimmen gehen. Eine Woche ist seit Schulbeginn vergangen. Einige von uns lungern rund um den toten Kastanienbaum vor dem Werkraum herum und warten darauf, dass es zum Ende der großen Vormittagspause klingelt. Damals gab es zwei große Pausen, eine zwischen Viertel vor zehn und zehn am Morgen, eine zweite zwischen zwei und Viertel nach zwei am Nachmittag. Beide verfolgen unausgesprochen den gleichen Zweck: Die Lehrer, Bröstlund, Allansson, Fintling und die anderen, sollen eine wohlverdiente Pause von der heranwachsenden Generation erhalten. Im Lehrerzimmer in der dritten Etage in Sesseln und auf Sofas sitzen und mit höchst wünschenswertem Wohlbefinden Kaffee trinken. Mit Zimtschnecken und einer zweiten Tasse, ist anzunehmen. Vielleicht auch mit einem Stück Marmorkuchen aus der Konditorei Svea.
Einige bevorzugen andere Orte als den Kastanienbaum. Manche treiben sich auf der Rückseite des Schulgebäudes herum und spielen Fußball. Andere, vor allem die Mädchen aus den beiden sechsten Klassen, treffen sich gern hinter den Fahrradständern zur Hagagatan hin, wo sie aus fast allen Winkeln und Ecken außer Sichtweite sind – während manche gemischten Gruppen beiderlei Geschlechts ein wenig ziellos auf dem gesamten Schulhof umhertreiben. Seilchen springen, einander an den Haaren ziehen, Bälle werfen oder Filmstars und Gedanken austauschen.
Ich bin zehn Jahre alt. Bis zu diesem Tag, ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Donnerstag ist, ist mein Name Bert Hansson gewesen. Ich trage eine kurze Hose, ein kariertes Hemd und blaue Turnschuhe, die meisten haben lange Hosen an, aber ich bin nicht der Einzige, der seine Knie zeigt. Mein bester Freund Rune zum Beispiel trägt auch eine kurze Hose. Er steht neben mir und kratzt Wundschorf von seinem Ellbogen. Rune erfährt es als Erster von allen.
»Ab heute heiße ich Adalbert Hanzon.«
Das z hört man natürlich nicht, aber ich habe mir das reiflich überlegt. Das eine wie das andere.
»Adalbert?«, sagt Rune. »So kann man doch echt nicht heißen.«
Ich: »Und ob man das kann. So steht es in meiner Geburtsurkunde.«
Rune: »In deiner Geburtsurkunde?«
Ich: »Genau.«
Rune: »Adalbert?«
Ich: »Ja.«
Rune: »Das ist ja ein Ding.«
Ich habe tatsächlich in besagter Geburtsurkunde nachgesehen. Sie liegt in der obersten Schublade für wichtige Papiere in der Kommode im Wohnzimmer in einem braunen Umschlag, zusammen mit meinen Zeugnissen aus der Stavaschule und einer Bescheinigung mit drei Stempeln, aus der hervorgeht, dass Tante Gunhild meine Erziehungsberechtigte ist. Stig Adalbert Hansson steht dort. Geboren am sechzehnten Oktober 1945. Mutter Claudine Colbert, Vater Hans Teodor Hansson.
Auf dem Blatt mit den Stempeln steht darüber hinaus, dass meine Mutter drei Monate nach meiner Geburt gestorben ist und mein Vater sieben Jahre später.
Er hat sich mit einem Jagdgewehr in den Mund geschossen, von seinem Schädel ist nichts übrig geblieben, aber dieses Detail wird nicht erwähnt. Auch gut. Die Büchse hatte er von meinem Großvater Stig geerbt, der gerne Füchse und Hasen jagte und wiederum lange vor meiner Ankunft in dieser Welt bei einem Grubenunglück in Stråssa umgekommen war. Mein Vater hat auf unserem Hinterhof manchmal auf Flaschen und Blechdosen geschossen, aber das einzige Lebewesen, dem er jemals das Leben genommen hat, war er selbst.
Kurz bevor das geschah, erzählte er mir, meine Mutter habe auf dem Namen Adalbert bestanden. Sie wollte, dass mich etwas Französisches auf meinem Lebensweg begleitete, weil sie dorther stammte. Mitten im Krieg war sie nach Schweden gekommen, meinem Vater zufolge gingen in ihrem Heimatland die Männer aus, die auf den Schlachtfeldern wie die Fliegen starben, deshalb hatte sie sich auf den Weg nach Norden gemacht. Aber ich weiß nicht, über ihre Geschichte ist mir im Grunde nichts bekannt. Im Sommer 1944 taucht sie jedenfalls in der Gegend von Vretestorp auf einem Tanzboden auf und lernt meinen Vater kennen. Die beiden heiraten ein halbes Jahr später, sie bringt mich zur Welt, lebt noch eine Zeitlang und verschwindet aus der Geschichte. Es gibt zwei Fotos von ihr, eins zusammen mit meinem Vater und eins, auf dem sie neben einem Fahrrad vor einer Herde schwarz-weißer Kühe steht. Sie lacht auf beiden Bildern, sie hat dunkle, lockige Haare, und ich finde sie ziemlich hübsch. Es hat mir immer leidgetan, dass sie gestorben ist.
Mein Vater nahm dieses Adal- niemals in den Mund, es wurde schlicht Bert daraus. Bevor er sich erschoss, arbeitete er als Maler. Er soff und war unglücklich. Wenn er betrunken war, sprach er mit mir häufig über ernste Themen.
»Du spielst keine Rolle«, pflegte er zu sagen. »Vergiss das nicht, Bert. Auch wenn du es glaubst, spielst du auf der Welt nicht die geringste Rolle. Ich auch nicht. Es wäre besser gewesen, wenn es dich und mich gar nicht gäbe.«
Ich begriff nicht immer, was er meinte, ich war ja erst siebeneinhalb, als er sich das Leben nahm, aber dass ich kein besonders wichtiger Mensch war, das verstand ich. Und wenn es seine Schwester Gunhild nicht gegeben hätte, weiß ich nicht, wohin es mich verschlagen hätte. In irgendein Kinderheim vermutlich. Vielleicht nach Söderbacka, das Heim lag fünf Kilometer von der Stadt entfernt auf dem flachen Land, und ein paar der Kinder dort gingen in die Stavaschule, allerdings nicht in Runes und meine Klasse.
»Ich verstehe«, sagt Rune jetzt. Wir sind auf dem Weg in unsere Klasse. »Der verdammte Typ aus Hällefors.«
»Genau«, erwidere ich. »Der Typ aus Hällefors.«
Eine Woche zuvor, zwei oder drei Tage nach Beginn des Schulhalbjahrs, war er in unsere Klasse gekommen. Ein ziemlich kräftig gebauter Junge mit großen Ohren und einem Topfschnitt. In seinem Oberkiefer fehlt ein halber Schneidezahn. Eine blaue, leicht abgewetzte Trainingsjacke, auf deren Rücken in einem Halbkreis SPORTVEREINHÄLLEFORS stand.
Nichts von all dem ist ein Problem. Nicht die Frisur. Nicht der kaputte Zahn. Nicht die Jacke.
Das Problem ist, dass er, genau wie ich, Bert Hansson heißt.
Als er uns den Neuankömmling vorstellt, erlaubt sich unser Klassenlehrer Allansson eine scherzhafte Bemerkung darüber. »Jetzt haben wir zwei Bert Hanssons in der Klasse«, sagt er. »Das ist toll, denn wenn wir bei den Mathearbeiten ihre Punktzahlen zusammenzählen, kommen sie gemeinsam vielleicht sogar auf eine Vier.«
Alle lachen außer Bert Hansson und Bert Hansson. Ich selbst lande in der Regel bei einer Vier minus, was bedeutet, dass ich nur zwei oder drei Aufgaben von zwölf geschafft habe. Oder ich bekomme schlimmstenfalls eine Fünf, wenn ich einen schlechten Tag habe und gar nichts hinbekomme. Rune ist ein bisschen besser, aber wir sind uns einig, dass Mathematik nicht unsere Paradedisziplin ist.
Wenn man keine Rolle in der Welt spielt, dann spielt es verdammt noch mal auch keine Rolle, ob man rechnen kann oder nicht, denke ich des Öfteren.
Aber dass es einen zweiten Bert Hansson gibt, spielt eine Rolle. Als ich ihn da vorne am Lehrerpult stehen und etwas zurückhaltend mit Allanssons Hand auf seiner Schulter grinsen sehe, finde ich das richtig traurig. Fast so, als würde ich verschwinden. Als wäre ein anderer, dieser Fremde mit dem Topfschnitt, in die Stavaschule gekommen, um meinen Platz in der Welt einzunehmen. Es ist ein seltsames Gefühl, nie zuvor habe ich etwas Vergleichbares erlebt, und mir schießen Tränen in die Augen.
Glücklicherweise heule ich nicht los, denn das wäre der endgültige Beweis dafür gewesen, was für ein hoffnungsloser Fall ich bin. Stattdessen balle ich die Hände zu Fäusten und denke: Verflucht, ich muss mir etwas einfallen lassen. Das geht einfach nicht; wenn man nicht einmal seinen Namen für sich behalten darf, gilt es, sich zu wehren.
Eine Prügelei auf dem Schulhof wäre natürlich eine alternative Lösung, aber der Junge aus Hällefors ist mindestens fünf Zentimeter größer als ich und außerdem kräftiger. Ich habe mich noch nie an einer richtigen Schlägerei beteiligt, und bei einer Niederlage wäre ich für alle Zeit blamiert.
Es dauert ein paar Tage, bis mir das mit meinem Namen einfällt, aber sobald der Gedanke auftaucht, spätabends, kurz vor dem Einschlafen, erkenne ich, dass ich die Lösung gefunden habe. Adalbert Hansson … nein, zum Teufel, Hanzon! Ich habe das Gefühl, dass eine schwere Bürde von meinen hängenden Schultern fällt, und am nächsten Tag sorge ich dafür, dass Rune es als Erster erfährt. Ihm geht ziemlich schnell ein Licht auf.
Etwas schwerer von Begriff ist Studienrat Allansson, aber als ich ihm zwei Tage später meine Geburtsurkunde zeige, ist er einverstanden. Die Änderung von Hansson zu Hanzon geht einfach mit durch, und ab Mitte September ist mein neuer Name im Klassenbuch und an allen anderen wichtigen Stellen vermerkt.
Ich spiele vielleicht noch immer keine Rolle im großen Ganzen, aber wenigstens befinde ich mich mit meiner Nase wieder über der Wasseroberfläche.
So viel dazu. Ansonsten soll nicht unerwähnt bleiben, dass der Junge aus Hällefors die Klasse schon im nächsten Jahr wieder verlässt, ich glaube, er zieht nach Säffle, möglicherweise auch nach Åmål, aber es kommt mir niemals in den Sinn, zu meinem alten Namen zurückzukehren. Wenn ich recht sehe, gibt es genügend Berts auf der Welt.
3
Es vergehen ein paar Tage, bis ich mich mit meinem gelben Schreibheft erneut an den Küchentisch setze. Es ist nach wie vor September und ein weiteres Mal früher Vormittag. Es ist ein grauer Tag, und der Wind zerrt an der lichten Hecke auf der anderen Straßenseite vor der Reihe von Mietshäusern, wo Henry Ullberg in Nummer 14 wohnt. Es ist bald zehn, und ich gehe davon aus, dass der alte Sack in einer halben Stunde, plus minus einige Minuten, aus seinem Bau kommt. Menschen in unserem Alter haben feste Gewohnheiten, man steht immer um die gleiche Uhrzeit auf, man frühstückt immer das Gleiche, und passend zu den Nachrichten und zum Wetterbericht schaltet man das Radio ein. Belegte Brote zum Mittagessen und ein Nickerchen am Nachmittag. Und so weiter.
Nun aber werde ich diese Schreibarbeit in meinen Zeitplan einschieben. Und da mein Tagesablauf ungefähr so luftig ist wie eine Wolke oder ein Furz, sollte das wohl kein Problem darstellen. Von Zeit zu Zeit eine oder zwei Stunden, es dauert so lange, wie es dauert. Die einzige Deadline, die ich mir auferlege, ist diese: Das Ganze soll fertig sein, bevor ich sterbe. Oder es kommt ins Stocken, und ich verbrenne den ganzen Mist. Plan B, wie man so sagt.
Eins ärgert mich ein wenig. Als ich sie auf dem Stuhl im Drogengeschäft Krone gesehen habe, warum bin ich da nicht einfach zu ihr gegangen und habe sie gefragt, ob sie möglicherweise identisch mit einer gewissen Andrea Altman ist? Schlicht und ergreifend, damit wäre die Sache ja gewissermaßen aus der Welt gewesen.
Aber dann fällt mir ein, dass ich in dem Moment, in dem sie mir ins Auge gefallen ist, beinahe ohnmächtig geworden wäre und es nur mit Mühe und Not wieder auf den Platz hinausgeschafft habe. Darauf schiebe ich es, aber es ist eine unsinnige Entschuldigung; im tiefsten Inneren weiß ich, dass ich mich das unter gar keinen Umständen getraut hätte.
Man kennt sich selbst eben ganz gut. Andrea Altman ist eine Größe, der ich mich mit äußerster Vorsicht nähern muss, oder gar nicht. Wie Napoleon oder Marilyn Monroe. Nicht dass Andreas Ruhm auch nur annähernd an Napoleons oder Marilyns heranreichen würde, so meine ich das nicht. Aber für mich persönlich, für den Menschen, der Adalbert Hanzon heißt und im Spillkråkevägen 17 in dieser Stadt in der Ebene wohnt, ist – oder vielleicht sollte ich sagen, war – sie die Achse, um die das Leben kreist. Verzeihung, kreiste. Einst, als das Gras noch duftete und die Kirschen noch nach Kirschen schmeckten.
Sollte ich stattdessen lieber ein Gedicht schreiben? Ein Sonett, so heißen diese Vierzehnzeiler doch? An diesem bleichen Vormittag beschleicht mich das Gefühl, dass mein Genre als Schriftsteller eher der Lyrik als der Prosa zuzuordnen ist. Aber wie soll das gehen, wie soll ich alles, was ich sagen möchte, in ein erbärmliches, kleines Gedicht zwängen? Nein, es gibt keine Abkürzungen, und die Poesie ist, zumindest in meinem Fall, wohl nichts anderes als eine verlockende, aber faule Abkürzung. Ich labere mir heute vielleicht etwas zusammen. Man könnte meinen, ich säße für ein paar Drinks mit Henry Ullberg zusammen, und zum Teufel, als mir dieser Gedanke in den Sinn kommt und ich ihn aufs Papier kritzele, tritt er da unten auf der anderen Straßenseite torkelnd aus seinem Hauseingang.
Ich schreibe torkelnd, weil es fast so aussieht, als wäre er betrunken. Aber mein Gott, es ist doch noch früh am Tag. Ich nehme fürs Erste an, dass er schlecht geschlafen oder auch einen dieser Minigehirnschläge bekommen hat, von denen man liest, und lege ihn vorerst zu den Akten. Wenn er in einer Stunde nicht zurück ist, werde ich wohl ausrücken müssen.
Vier Tage sind vergangen, seit ich mit jemandem gesprochen habe, wenn man von den rudimentären Konversationen absieht, die ich mit Nachbarn und Menschen im Dienstleistungsbereich geführt habe. Guten Morgen – Moin. Das ist alles? – Ja. Möchten Sie die Quittung? – Brauche ich nicht.
Von den Nachbarn grüße ich übrigens nur zwei. Einen jungen Einwanderer vom Erdgeschoss, ich glaube, er heißt Hassan, und Witwe Bolin gleich nebenan. Sie ist einiges über achtzig und hat einen Hauskater, der manchmal, allerdings höchstens dreimal im Jahr, ins Treppenhaus entwischt, wo es ihm große Freude bereitet, pinkelnd sein Revier abzustecken. Er heißt Sixten, genau wie Frau Bolins verblichener Gatte. Vielleicht schlich sich Sixten, der Erste, auch ab und zu hinaus, es erscheint mir nicht undenkbar. Nein, Moment, darüber weiß ich nun wirklich nichts. Ich muss mich am Riemen reißen, richtige Schriftsteller bringen bestimmt nicht jeden leichtfertigen Gedanken zu Papier, den ihre düsteren Gehirne absondern.
Der Mensch, mit dem ich vor vier Tagen gesprochen habe, war Ingvor Stridh. Wie üblich am Telefon. Wie üblich rief sie an. Sie behauptet, sie sei eine Cousine von mir, oder zumindest eine Großcousine, aber ich bin mir nicht sicher, wie es sich damit eigentlich verhält. Mein Vater soll eine Halbschwester gehabt haben (das heißt, abgesehen von seiner Schwester Gunhild, von der ich später erzählen werde), und Ingvor ist die Tochter dieser Rigmor. Und wenn ich es recht bedenke: Warum sollte sie bei so etwas lügen? Es ist ja beim besten Willen keine Ehre, mit Adalbert Hanzon verwandt zu sein. So schlecht kann es um keinen Menschen bestellt sein.
Ein gutes Jahrzehnt ist es mittlerweile her, dass sie zum ersten Mal Kontakt zu mir aufgenommen hat, bis dahin hatte sie im Ausland gelebt, war aber nach Schweden zurückgekehrt. Später, als sie in Rente gegangen ist, hat sie sich außerdem hier in der Stadt niedergelassen, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, und von Angesicht zu Angesicht begegnet sind wir uns bei drei Gelegenheiten. Zweimal bei ihr daheim in der Prästgårdsgatan (ein Weihnachtstag und ein Ostersamstag), einmal im Restaurant des Stadthotels (ihr Geburtstag, ich habe sie eingeladen).
Es ist nicht so, dass ich etwas gegen Ingvor vorzubringen, ihr irgendetwas vorzuwerfen hätte, aber sie redet so, dass einem die Trommelfelle wehtun, und sie geht mit Walking-Stöcken. Letzteres ist mir eigentlich völlig egal, aber sie kann es einfach nicht lassen, darüber auch noch zu reden – und darüber, was für eine große und positive Veränderung für mich damit verbunden wäre, wenn ich auch mit diesem Stöckchenschlurfen anfangen würde. Sie könne mir Instruktionen geben, sagt sie, theoretische und praktische, und anschließend könnten wir gemeinsam lange, sinnvolle Spaziergänge machen. Wenn ich nur daran denke, graut es mir schon. Wenn ich sterbe und in die Hölle komme, gehe ich jede Wette ein, dass Ingvor an der Pforte steht und mir ein Paar dieser erbärmlichen Glasfaserstöcke überreicht.
Sie behauptet, ich hätte ein paar Kilo zu viel auf den Rippen. Einem Verwandten könne man so etwas sagen, behauptet sie außerdem. Ich meinerseits behaupte, dass ich diese Kilos während des letzten Vierteljahrhunderts mit mir herumgeschleppt habe, und sollte man mich nicht in den Sarg kriegen, wenn der Tag gekommen ist, wird man sie wohl abschaben müssen.
Ich würde das alles über Ingvor nicht schreiben, wenn ich nicht einen Plan hätte. Er ist vermutlich fast etwas einfältig, aber ich habe zwei Tage über ihn nachgedacht, und mir ist einfach nichts Besseres eingefallen. Wenn er nicht funktioniert, hat er auch keinen Schaden angerichtet. Also warum nicht?
Alles hängt von zwei Dingen ab: vom Schwimmen und einer Tätowierung.
Ich beginne mit der Tätowierung. Zu jener Zeit (der allzu kurzen Zeit in meiner Jugend wunderschönstem Frühling, kann ich mir nicht verkneifen hinzuzufügen, obwohl ich damals eigentlich schon auf die dreißig zuging), als ich Andrea Altman ein wenig näher kannte, war diese Form der Körperkunst nicht sonderlich weit verbreitet. Oder wie man es nennen soll. Ich spreche von der ersten Hälfte der siebziger Jahre. Meines Wissens ließen sich vor allem Seeleute und Verbrecher tätowieren, aber das mag eine Fehleinschätzung sein, ich bin der Sache niemals auf den Grund gegangen. Jedenfalls hatte Andrea Altman eine kleine Tätowierung. Es war ein Datum, so geschrieben, wie man es früher machte: 14/6. Keine Jahreszahl, nur diese Ziffern und der Schrägstrich, und sie war so klein, dass sie auf einer Briefmarke Platz gefunden hätte. Die Stelle war hübsch gewählt: hoch oben auf der linken Brust, aber sie hatte nichts mit ihrem hübschen Busen zu tun. Es war vielmehr so gedacht, dass die Tätowierung genau über dem Herzen sitzen sollte, und das Datum war der Tag, an dem ihr Vater gestorben war. Ein Zeichen dafür, dass sie ihn liebte und er ihr für immer in Erinnerung bleiben würde als der beste, edelste, lustigste, intelligenteste und liebevollste Mensch, der jemals in einem Paar Schuhe gegangen war. Das alles erläuterte sie mir ziemlich ausführlich, aber auch, wie er gestorben war. Sein Tod war ein wenig speziell, und als es passierte, hatte Andrea gerade ihren vierzehnten Geburtstag gefeiert.
Andris Altman war Fallschirm gesprungen, und sein Fallschirm hatte sich nicht geöffnet. Er war keine fünfzig Meter von der Stelle aufgeschlagen, an der Andrea und ihre Mutter als Zuschauer standen. Es hatte sich um eine Art Vorführung gehandelt, die auf einem Militärflughafen in der näheren Umgebung der Stadt stattfand, in der sie aufgewachsen war und wo wir uns einige Jahre später begegnen sollten. Ich werde sie M nennen.
Am fünften Jahrestag des Unfalls ließ sie sich das Datum eintätowieren, heimlich auf einer Klassenfahrt nach Kopenhagen. Ihre Mutter, die nach dem Unfall zu einem äußerst komplizierten Menschen geworden war, hätte ihr das niemals erlaubt. Aber für Andrea war es eine wichtige Maßnahme, die sie seit Jahren geplant hatte.
Jetzt beschleicht mich allerdings das Gefühl, dass ich den Ereignissen vorgreife. Andererseits muss ich das mit der Tätowierung natürlich erklären, und auch meinen Plan.
Gerade sehe ich übrigens Henry Ullberg aus der Stadt zurückkommen. Er torkelt nicht mehr, schlurft nur auf seine typische, steifbeinige Art, und im Korb liegt die obligatorische halb leere Plastiktüte aus dem ICA-Supermarkt. Ich entschließe mich zu einem Nickerchen, bevor ich die zweite Zutat meines Plans in Angriff nehme: das Schwimmen.
Sie war verrückt nach Wasser. Ich weiß nicht, ob es irgendwie mit ihrer Flugangst zusammenhing; dass sie es nach dem traurigen Tod ihres Vaters nicht mochte, hoch in der Luft zu sein. Aber vielleicht war es so. Wasser soll ja das Gegenteil von Luft sein, einem anderen Element, wie man es in früheren Zeiten betrachtete, und Andrea ging es so gut wie nie, wenn sie in einem See umherschwimmen durfte. Oder einem Meer, einem Fluss oder einem Schwimmbecken, das spielte keine Rolle.
Wenn ich nicht mindestens eine Stunde am Tag schwimmen darf, sterbe ich, sagte sie manchmal. Verstehst du, Adalbert?
Ich erwiderte, dass ich es verstünde. So lautet meine Standardantwort, wenn mir jemand diese Frage stellt. Zu sagen, dass man etwas nicht versteht, wird leicht als unhöflich empfunden, und wenn mir in Bezug auf Andrea Altman etwas wichtig war, dann, höflich zu sein. Mich ganz generell als fürsorglicher, talentierter und gütiger Gentleman zu präsentieren. Auf Dauer half das nicht, aber so hat mein Leben nun einmal ausgesehen: Früher oder später geht alles zum Teufel. Im Laufe der Jahre habe ich gelernt, von Anfang an darauf gefasst zu sein. Wenn man mit der Niete in der Hand dasteht, kann es ein recht befriedigendes Gefühl sein, innerlich ausrufen zu können: So, so, habe ich es nicht gesagt? Das habe ich mir doch gleich gedacht.
Aber zurück zu Andrea Altman. In der kurzen Zeit, die wir zusammen waren, badeten und schwammen wir viel. Im Sommer im Rossvaggasjön (es waren ja zwei Sommer, der erste war der bessere), im Lyssnaviksbad und während der anderen Jahreszeiten im Hallenbad von M. Vor allem im letztgenannten, in den Herbst- und Wintermonaten waren wir treue Besucher des alten Chlorpalasts. So wurde er im Volksmund genannt, Der Chlorpalast, und Andrea ging nicht selten zweimal am Tag dorthin. Morgens vor der Arbeit allein, abends zusammen mit mir. Ich erinnere mich, dass wir ausrechneten, dass sie im Durchschnitt zwanzig Stunden in der Woche im Wasser verbrachte, auf und ab schwimmend, Bahn für Bahn in einem ruhigen Rhythmus im Fünfundzwanzigmeterbecken, in ihrem roten Badeanzug und der gelben Badekappe. Ich selbst verbrachte in der Regel die Hälfte der Zeit mit einer Zeitung und einer Thermoskanne Kaffee auf der Tribüne, und wenn das Bad um neun Uhr abends geschlossen wurde, waren sie und ich und ein Schwimmmeister nicht selten die Einzigen, die sich noch in dem ganzen Palast aufhielten. Ich meine mich zu entsinnen, dass das Gebäude ein paar Jahre später abgerissen wurde.
Ich fragte mich wie gesagt, woher es wohl rührte, dieses intensive Bedürfnis, von Wasser umgeben zu sein. Ob es auf irgendeine Weise mit dem Tod ihres Vaters zusammenhing oder ob es dafür andere Gründe gab. Aber wir sprachen nicht viel darüber.
»Es ist, wie es ist«, sagte sie beispielweise. »Manche Menschen brauchen fünf Tassen Kaffee am Tag, um zu funktionieren, ich brauche das Schwimmen.«
»Vielleicht bist du ja in einem früheren Leben ein Hai gewesen?«, versuchte ich bei irgendeiner Gelegenheit zu scherzen.
»Es würde mir schon reichen, wenn ich im nächsten eine Makrele sein darf«, erwiderte Andrea.
Aber ich warte mit der Geschichte von Andrea Altman und mir noch etwas. Zurück zu meinem einfältigen Plan.
Wenn, denke ich also … wenn es sich wirklich so verhalten sollte, dass die Frau, die ich auf dem Wartestuhl im Drogengeschäft Krone gesehen habe, identisch ist mit Andrea Altman, dann müsste sie süchtig nach diesem Element sein: dem Wasser. Auch heute noch, oder? Und wie befriedigt man ein solches Bedürfnis in einer Stadt wie unserer? (Wenn es mir gelingt, es in diesem Stil aufzuschreiben, finde ich trotz allem, dass es logisch und scharfsinnig klingt, dieses Lob bin ich mir schuldig.) Nun, man geht ins Bollgren-Bad.
Lars Gustaf Bollgren, LG genannt, war bis zu seinem Tod vor ein paar Jahren der starke Mann der Stadt. Mehr als drei Jahrzehnte ein lokaler Sozibonze und Strippenzieher, der überall seine Finger im Spiel hatte, und zu den Spuren, die er hinterlassen hat, zählt ein prächtiges Schwimmbad in unmittelbarer Nähe der Sportplätze oben in Väster. Ich habe es einige Male besucht, in letzter Zeit allerdings nicht mehr; ich finde überhaupt immer weniger Gefallen daran, unter Menschen zu gehen, und wenn man alt, blässlich fett und misanthropisch ist, bekleckert man sich in halb nackter Gesellschaft wahrlich nicht mit Ruhm.
Ich wundere mich darüber, welche Worte und Begriffe mir in den Sinn kommen, wenn ich beim Schreiben erst einmal richtig in Schwung gerate … blässlich fett und misanthropisch … bekleckert man sich wahrlich nicht mit Ruhm … Woher kommen diese Worte? Ich habe natürlich ziemlich viel gelesen, das hat schon in meiner Pubertät angefangen. Über den Daumen gepeilt drei, vier Bücher im Monat. Ich besuche regelmäßig die Stadtbücherei; oft bringe ich die Bücher ein paar Tage zu spät zurück, aber sie drücken immer ein Auge zu.
Darüber hinaus werden die Leerräume in meiner Zeit von Kreuzworträtseln gefüllt, was ich möglicherweise schon erwähnt habe. Jede Woche kaufe ich ein Kreuzworträtselheft und jeden Freitag die Zeitung Svenska Dagbladet mit dem großen Rätselteil. Ich würde schätzen, dass ich mindestens eine Stunde am Tag der Aufgabe widme, waagerecht und senkrecht die richtigen Buchstaben zu finden. Aber ich schicke meine fertigen Lösungen niemals ein, das ist die Mühe nicht wert.
Aber jetzt habe ich mal wieder den Faden verloren, und es kommt mir vor, als würde die Geschichte, oder womit ich hier beschäftigt sein mag, in alle möglichen Richtungen schwenken, wenn ich nicht aufpasse. Wo war ich?
Ach ja. Das Bollgren-Bad. Mein Plan.