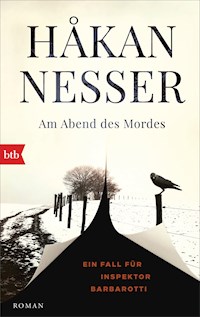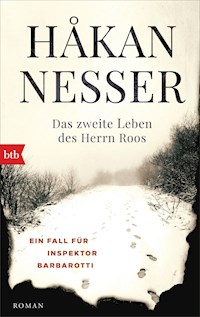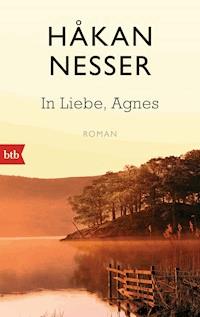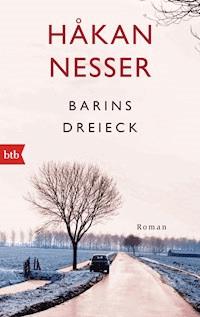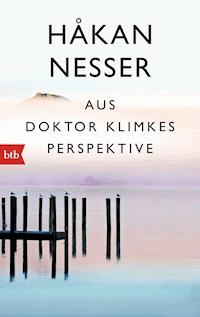9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Spiel und Leben und Tod – ungewöhnlich packend, mörderisch philosophisch
Ein seltsames Testament und ein längst gesühntes Verbrechen: Jahrelang saß der 54-jährige Bibliotheksangestellte Maertens wegen Mordes an seinem Professor im Gefängnis. Inzwischen wieder in Freiheit, lebt er völlig zurückgezogen. Doch plötzlich gerät sein sorgsam ausgetüfteltes Dasein aus dem Gleichgewicht: Sein einstmals bester Freund Tomas ist gestorben und hat ihm ein ungewöhnliches Erbe hinterlassen. Als Maertens es antritt, wird ihm allmählich klar, dass sein Freund ihn vor Jahren brutal hintergangen hat …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 360
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
1. Inferno
1
Kein Monat kann sich wie der Januar bis in alle Ewigkeit erstrecken.
So beginnt es. Spätabends sitzt er vor dem alten Stück. Im Lichtkegel über dem Schreibtisch treten Gestalten hervor. Sie leben und sprechen. Lieben, leiden und sterben unter seiner Feder, und die Welt dort draußen in ihrer eigenen Winterdunkelheit ist weder deutlicher noch beständiger als die ihre, sondern ganz genau gleich. Genau gleich.
So ist es ja auch gedacht. Das ist die Idee des Spiels. Verzaubert und ganz vertieft beugt er sich über den Tisch – vertieft in Einsicht, den leichten Schmerz ignorierend, der ihm wie eine unklare alte Erinnerung die Lendenwirbel hinunterläuft.
Er taucht die Feder ins Tintenfass, spürt die Wärme der Lampe auf dem Handrücken. Die Spitze auf dem Papier, wie sie die Worte balanciert, auf der messerscharfen Schneide zwischen Wirklichkeit und Wirklichkeit.
Das ist nicht nur mein düstrer Mantel, Mutter.Auch nicht der Brauch der Trauer, schwarze Tracht.
Es klingelt. In diesem Moment klingelt das Telefon, und alles wechselt auf ein anderes Gleis, er spürt es unmittelbar, versucht dennoch, sich an das Alte und Gewohnte zu halten. Für ein Weilchen. An das Alte, Sichere und Andersartige.
Er ignoriert das erste Signal. Hat es bereits verdrängt, als es noch in den Wänden hängt. Es verhallt. So, als hätte es nie Raum beansprucht. Ungerührt fährt er mit seiner Arbeit fort bis zum nächsten Signal. Versucht dann, auch dieses in die Flucht zu treiben, aber vergebens. Unerbittlich drängt es sich auf. Unerbittlich wie eine Vorahnung in der Nacht. Wie der Blick einer Mutter. Es klingelt. Er gibt auf. Hebt die Feder vom Papier und wartet.
Wartet. Zählt.
Drei. Nicht das Seufzen und Stöhnen meines beklommenen Atems.
Vier. Wenn es nach sechs Mal aufhört, dann ist es Birthe. Nicht das Seufzen ... Er hat keine Lust, mit Birthe zu sprechen. Nicht heute, nicht an so einem Tag.
Sieben. Dann kann es jemand anderer sein.
Er nimmt die Treppe in drei Sätzen. Spürt einen kurzen Schmerz in der Leiste. In der rechten Leiste, immer rechts. Der Flur liegt im Dunkel: Seit dem frühen Nachmittag hat er dagesessen und geschrieben, er hat nicht die Gelegenheit gehabt, Licht oberhalb der Erde zu machen, aber jetzt schnitzt das Telefon weiße Lichtspäne aus der Dunkelheit, und die Dringlichkeit steht ihm plötzlich klar vor Augen.
Wie ist das möglich? Wovon nährt sich diese Vorahnung?
Er weiß es nicht. Kann das mit diesem pochenden Herzen und diesem in die Jahre gekommenen Körper nicht verstehen. Außerdem hat er ein Glas getrunken. Er ergreift den Hörer und antwortet.
»Maertens.«
Das ist jetzt seit so vielen Jahren schon sein Name, dass er nicht mehr darüber nachdenkt, dass er früher einmal anders geheißen hat. Aber nun ist nur Schweigen zu hören, und er hat Zeit, sich an sein gesamtes Leben zu erinnern.
»Maertens«, wiederholt er und lauscht. Hört – oder spürt – den Puls seiner eigenen Schläfe am kühlen Bakelit. Hört – oder spürt – seine schwere Kurzatmigkeit. Sonst nichts.
Nichts.
Doch nichts.
Ungefähr so. Wenn das Geschehen einen Anfang haben soll, dann beginnt es hier. Genau in diesem unerwarteten Riss. Eines Abends Ende Januar steht er in seiner eigenen Dunkelheit in seinem eigenen Flur und hält den Telefonhörer ans Ohr gedrückt. Im Kellerraum trocknet bereits die Tinte. Die Gestalten verblassen und verstummen. Aus der Küche sickert ein Hauch von kaltem Zigarettenrauch, aber ansonsten machen sich die Welt und die nähere Umgebung nicht besonders bemerkbar. Was möglicherweise zu vernehmen sein sollte, ihre unklaren Signale und Rufe, befindet sich dort drinnen in der Verlängerung der Telefonmuschel. Dort drinnen, dort in der Ferne, an einem anderen Ende. Weit von ihm im Zimmer entfernt oder ganz nah bei ihm.
Das hält ihn fest. Der Riss wird größer, und das Schweigen im Hörer nagelt ihn wie eine unbezahlte Schuld fest, doch genau in diesem Moment erscheint das nicht besonders bemerkenswert. Ganz und gar nicht bemerkenswert. Erst später, als er endlich aufgelegt hat, da überfällt ihn die Verwunderung.
Die Verwunderung. Doch während er dasteht und lauscht, vergisst er alles Andere um sich herum. Sein Bewusstsein liegt in anderen Händen. Seine Gedanken und Wahrnehmungen werfen alle Taue von sich und lassen sich entführen. Widerstandslos und sekundenschnell wird Schicht für Schicht vom Schweigen und der Entfernung abgetragen, so dass zum Schluss nur noch der Kern selbst zurückbleibt.
Der Mensch. Mann oder Frau. Jung oder alt. Tief drinnen in diesem Unbekannten befindet sich die unhörbare Stimme eines anderen Menschen. Freund oder Feind. Irgendjemand dort draußen, dort in der Ferne, richtet sich an diesem Abend mit einem stummen Gebet an ihn, eingehüllt in dieses Schweigen wie ein Wort in eine Wolke.
Ein Schweigen, das er unter tausend Schweigen wiedererkennen wird.
Ungefähr so. So fängt es an.
Du bist nicht ganz gescheit, Maertens, denkt er hinterher und schaltet das Licht ein. Wieder einmal. Eines dieser Tiefs, sie kommen näher und näher, die verspätete Vorhut des Alters und Verfalls. Sein Blick fällt auf den Kalender von Clauson & Clauson und findet das heutige Datum: Donnerstag, der 26. Zwei Kästchen weiter, über Samstag, den 28., hat er mit rotem Stift B: 48 geschrieben.
Birthe achtundvierzig. Da muss er wohl ein Geschenk kaufen. Wahrscheinlich in der Mittagspause am nächsten Tag. Wann sonst? Eine Flasche Parfüm oder einen guten Wein. Was sonst?
Keinen Wein. Unter keinen Umständen Wein, beschließt er. Beim letzten Mal wollte sie seinen Château Margaux für spätere Gelegenheiten aufbewahren, statt ihn in seiner Gesellschaft zu trinken. So eine Dummheit will er nicht noch einmal begehen. Mit Parfüm ist sie zweifellos besser bedient.
Hinaus in die Küche und eine Zigarette anzünden. Der einzige Ort im Haus, wo er es sich immer noch gestattet zu rauchen. Er setzt sich an den Tisch. Immer noch ein leichter Schmerz in der Leiste, der Rücken jetzt besser. Die Wachstischdecke ist hässlich, aber nicht hässlicher als gestern. Dann sitzt er da und versucht die Dinge in den Griff zu bekommen, die Dunkelheit des Januars und die Gedanken, die nur darauf warten, hervorbrechen zu dürfen.
Oder aber sie zurückzuhalten, das ist nicht so ganz klar. Etwas ist passiert, er weiß nicht was, aber es gibt eine Tatsache, die schneller als alles andere Treibgut an Land geschwemmt wird und sich begreiflich macht, nämlich dass es genau in diesem Augenblick einen Ort geben muss – weit entfernt oder ganz nah, vielleicht eine Küche, genau wie seine eigene –, einen Ort, an dem jemand anders auch im Halbdunkel sitzt und mit zitternder Hand eine Zigarette zum Mund führt. Jemand anders.
Wie er selbst, Maertens. Einer, der keine Stimme hat, um zu sprechen, Freund oder Feind, der sich ihm aber genähert haben muss. In Maertens’ eigene Welt eingedrungen sein muss.
Jemand, dessen Gesicht nicht hervortreten will, dessen Person, Persönlichkeit und Bedingungen ihm vielleicht nur zu bekannt sind, dessen Bild deutlich werden könnte, wenn es Maertens nur gelänge, nicht krampfhaft zu versuchen, es herbeizurufen. Ja, er redet sich ein, dass es sein könnte, wenn es einem nur gelingt, nicht an dieses Schweigen zu denken, das man unter tausend Schweigen erkennen würde, und stattdessen ruhig und still dasäße, rauchte und aus dem Fenster schaute in den Januardunst, der die Straßen und Straßenlaternen und Bäume in einen weichen, fremden und gleichzeitig vertrauten Nebel einhüllt, dass es dann sein könnte, dass plötzlich, simsalabim, der Mensch leibhaftig vor dem inneren Auge erschiene.
Freund oder Feind.
So ist es. Alles zerrinnt. Die Zigarette brennt unerbittlich herunter, ohne irgendeinen Nutzen gehabt zu haben. Er drückt sie wütend aus, spült eventuelle Glutreste unter dem Wasserhahn ab, wäscht den Aschenbecher aus und stellt ihn kopfüber zum Abtropfen. Das sieht hässlich aus, aber nicht hässlicher als gestern. Du bist ein verdammter Teufel, Maertens.
Ende Januar.
Kalte Nebelschwaden.
Er kehrt wieder in den Kellerraum zurück. Läuft eine Weile unschlüssig und unruhig hin und her. Klappt das Schreibheft zu, löscht das Licht, geht hoch und legt sich schlafen.
Ahnt kaum etwas. So ist es meistens.
2
Der nächste Tag ist ganz normal.
Normal und aufdringlich wie die Steife in den Schultern und das Warten auf das, was nie kommt. Er wacht auf, ohne geschlafen, ohne geträumt zu haben. Im Aquarium treibt das Regenbogenmännchen mit dem Bauch nach oben im Wasser. Zumindest ist anzunehmen, dass es das Männchen ist. Die Kenntnisse, die er über seine Nächsten und Liebsten hat, sind ziemlich dürftig. Draußen auf der Straße hupt Bernard bereits. An Frühstück ist nicht zu denken, es ist halt einer dieser Morgen.
Auf dem Treppenabsatz schlägt ihm ein kalter Wind entgegen. Er schlägt den Mantelkragen hoch und bleibt eine Sekunde in simuliertem Zögern stehen. Wenn der Tod käme oder eine andere unbekannte Größe und böte ihm in so einem Moment die Hand, würde er dann nicht ...?
Doch nichts geschieht. Nun gut, also geht er hinaus in die Welt. Aus dem Autoradio strömt eine diffuse Klaviersonate. Bernard sieht unrasiert und grau verfroren aus, dennoch hat er sein Morgengrinsen aufgesetzt, bevor Maertens es noch schafft, die Tür wieder zu schließen.
»Freitag!«, ruft er mit infamer Munterkeit aus. »Trost und Belohnung aller Schiffbrüchigen!«
Dann fängt er an zu husten. Seine Stimmbänder haben sich noch nicht an einen neuen, fremden Tag gewöhnt. Maertens wird ihm wegen dieses Lächelns irgendwann noch einmal eins in die Fresse hauen. Dieses Morgengrinsen. Das ist ihm schon seit langem klar, verdammt klar. Eines Tages werden alle Gedanken zwangsläufig in Handlungen übergehen und eine höhere Stufe erklimmen. Irgendwann einmal, aber nicht an diesem Morgen.
Bernard redet sich warm.
»Du brauchst dir nur die ersten fünfzehn Minuten anzugucken, oder vielleicht die ersten siebzehn, wenn wir ganz genau sein wollen, mit Rügers beiden Toren und Mussets hohem Kopfball an die Latte, das lässt mich schlicht und einfach an ein Sonett denken. Ein Sonett!«
Maertens sagt nichts.
»Genauso wie Andersson gegen Portisch sechsundsiebzig mich an verlorene Eier erinnert hat. Es ist irgendwie dasselbe. Verstehst du? Verstehst du?«
»In Brest?«, fragt Maertens. Gähnt. Es knackt in den Gelenken.
»In Brest. Wo sonst?«
So geht es weiter. Maertens reagiert, hört aber nicht wirklich zu. Er registriert nichts, findet keinen Anlass dafür. Bernard redet im Kreis. In dem Bereich, in dem er etwas zu sagen hat, wiederholt sich alles immer wieder, Maertens hat das im Laufe der Jahre gelernt. Analogien verändern sich, werden ausgetauscht und ausgeschmückt – aber das Muster, das möglicherweise gewollte, ist immer zu greifen. Es kommt stets in seiner bleichen Dürftigkeit an die Oberfläche.
Zumindest stellt er es sich so vor, und wenn es denn anders sein sollte, könnte er doch nichts daran ändern. Bernard spinnt seinen Wortkokon weiter, beharrlich und unermüdlich, in gewisser Weise eisenhart, eine Schicht wird über die andere gelegt, tagein, tagaus. Über Essen und Fußball spricht er. Über Schach. Über alte Radchampions. Über Frauen.
»Weißt du, Maertens, mit den Frauen, das ist doch etwas Besonderes!«
Etwas Besonderes? Maertens zündet sich die erste Zigarette des Tages an und denkt an Straßenbahnen. Wie es wäre, stattdessen mit der Straßenbahn zur Arbeit zu fahren. Das ist ein geliebter, angenehmer Zwangsgedanke, der sich jeden Morgen auf den dreihundert Metern zwischen den Bahngleisen und dem Fluss in ihm festsetzt. Kein großer Gedanke, aber praktisch wie ein Topflappen oder eine Lebenslüge, und nach einer Weile lässt er ihn wieder fallen, und im gleichen Moment, im gleichen alten, üblichen Moment, ist der neue Tag über ihn hereingebrochen. Dieses unklare, traumhafte Gefühl, das diesen speziellen Tag aus der langen Reihe vergangener und zukünftiger Tage heraussiebt. Die Diktatur des Jetzt, das hat er irgendwo gelesen, ihre Anwesenheit ist stark und überraschend, er bietet ein paar Sekunden lang Widerstand, resigniert dann aber und holt tief Luft. Wirft einen Blick zu Bernard hinüber. Könnte es sein, dass dieses genau die Gebrauchsanweisung zurückhält, die Maertens braucht? Dieser Bernard. Ja, ist es denn nicht so? So ist es um die Welt bestellt! Auf diese Art und Weise verhält es sich mit Dingen und Sachen! Es ist etwas Besonderes mit den Frauen.
Und er braucht nicht einmal zuzuhören. Nie eine eigene Meinung auszudrücken, vielleicht ist das ein Privileg.
»Du solltest die Scheiben kratzen«, sagt er schließlich an diesem Morgen, weil er nicht hinaussehen kann.
»Quatsch«, erwidert Bernard. »Das wird klar, wenn die Heizung in Gang kommt. Außerdem findet sie den Weg von allein.«
Sie biegen ab auf den Alexanderviadukt. Im Laufe der vielen Jahre, die sie zusammen fahren, ist es noch nie vorgekommen, dass die Heizung in Gange gekommen wäre. Und das Pronomen sie bezieht sich auf das Fahrzeug selbst, die Fortbewegungsmaschine, wenn man so will. Sie hat eine dunkle Geschichte, aber sicher verhält es sich so, wie Bernard sagt: Sicher ist sie früher einmal eine Schönheit gewesen mit durchgehend weiblichen Vorzeichen. Eine junge, himmelblaue Vidette. Inzwischen ist sie in die Jahre gekommen, immer noch auffallend und an einzelnen Punkten zwar schick, an anderen, und deren Zahl überwiegt, aber umso ramponierter. Sie bewegt sich ziemlich unbeholfen, macht außerdem ziemlich viel Lärm, und eines schönen Tages wird es wohl passieren, dass sie ein für alle Mal stehen bleibt. Wer weiß?
Er drückt seine Zigarette in dem überquellenden Aschenbecher aus. Schließt die Augen, um nicht abgelenkt zu werden. Lehnt den Kopf gegen die Nackenstütze, die es nicht gibt, und konzentriert sich. Zuerst aufs Schachspiel, dann auf das andere. Das Schweigen.
»Dann spielen wir also heute Abend bei Freddy’s eine Partie?«
Maertens schaut auf. Bernard hat seine Brille abgenommen, er sitzt da und reibt sie mit seinem Schal sauber. Die Scheiben sind immer noch vereist. Der Morgenverkehr dort draußen dröhnt dicht und herausfordernd. Maertens nickt. Freitagabend ... Freddy’s, natürlich. Was sonst? Welche anderen Wege würden überhaupt offen stehen? Welche?
Birthe natürlich, aber der Samstag ist ja schon ausgemacht.
Schreiben?
An der Ampel auf der Hohenzoller Allé kommt die Frage nach der Arbeit. Immer genau in der Sekunde, bevor sie auf Grün umspringt, es ist ein verdammtes Rätsel, wie er das wissen kann ... »Der Job, Maertens! Wie ist die Woche gewesen? Hamsterrad oder Mühlstein? Hat sie das Wohlbefinden und den Wohlstand befördert? Antworte mir, Maertens, was ist mit dir an diesem schönen Morgen nur los?«
Mühlstein? Nein, er hat nichts anzumerken. Sein Los ist nicht schlechter als das anderer. Insbesondere nicht mehr, seitdem die Aufmerksamkeit auf das staatliche Kulturhaus verlagert wurde, das in ihrer Stadt wie in so vielen anderen errichtet wurde. In Maertens’ und Bernards Stadt. Er denkt eine Weile darüber nach. Fragt sich, warum. Kein Mensch scheint sagen zu können, wozu so ein Gebäude eigentlich gut sein soll. Aber vielleicht haben seine Väter und Erbauer einfach nur etwas zu Stande bringen wollen, vielleicht verhält es sich so. Eine Art Andenken, ein Monument für sich selbst und die Zeit, in der man lebt. Vielleicht.
»So ist es mit Denkmälern, so kommen sie zu Stande«, hat Bernard einmal festgestellt, an einem anderen Morgen, als Maertens sich in den für heute erledigten Überlegungen zu verlieren schien. »Wer bist du, dass du meinst, klagen zu dürfen«, will Bernard heute wissen. »Kipp nicht das Kind und noch so einiges mit dem Bade aus. Eine neue Bibliothek und rückenfreundliche Stühle, was willst du mehr?«
»Ich kann nicht klagen.«
»Das ist gut, mein Freund, ich will ja nichts Unmögliches von dir verlangen. Gut, schon gut.«
Die Tomasbrücke ist wieder verstopft. Wie üblich.
Maertens reibt mit dem Mantelärmel ein Guckloch auf der Scheibe frei. Er betrachtet den Fluss und die Schiffe, die für den Winter verankert am Kai liegen, ein einsamer Schlepper steuert durch den Nebel, die Sonne steht niedrig und wirft keinen einzigen Lichtstreifen übers Wasser. Dunkel und wie aus einem Guss sieht es aus. Die Enten und ein hübsches, kaum voneinander unterscheidbares Schwanenpaar liegen noch in verfrorenem Nachtschlaf auf Karlsöns Strand. Bernard spricht jetzt von Majakowski, von der Hyperbel als Stil- und Wirkungsmittel, und von einer Frau, die er schon lange kennt. Frida. Frida Arschel. Seine Worte werden von einem Nachrichtensprecher und einer Straßenbahn, die vorbeischeppert, übertönt. Was wird aus all deinen Worten, Bernard? Wohin gehen sie?
Erneut widmet er einige Gedanken dem Telefongespräch, aber es ist schwer, sich in dieser Morgenkakophonie den Begriff Schweigen vorzustellen. Und ganz besonders so ein Schweigen.
Er wird am Zeitungskiosk am Markt herausgelassen. Als er vier Schritte gegangen ist, ruft Bernard durch das heruntergekurbelte Seitenfenster:
»Vergiss nicht, Fräulein Kemp von mir zu grüßen!«
Darauf pfeift er La donna è mobile, peitscht den Motor hoch und fährt weiter. Seit geraumer Zeit ist Bernard in Maertens Chefin, Marie-Louise Kemp, verliebt. Das ist eine Eigentümlichkeit, die sie bereits verschiedene Male diskutiert haben. Maertens hat auch schon beim Werben Beistand geleistet. Aber das Ergebnis ist bis heute ziemlich dürftig, kaum der Rede wert. Fräulein Kemp ist keine Frau, der man sich ohne weiteres nähert, ganz und gar nicht. Überhaupt ist das Ganze eine düstere Geschichte, und das Einzige, was Bernard als Begründung anführt, ist sein Alter.
»Wenn man die Fünfzig überschritten hat«, sagt er, »dann muss man sich ein neues Frauenideal suchen.«
Fräulein Kemp sollte also dem alten widersprechen ...?
Nein, Maertens hat keinen Blick dafür. Auch an diesem Morgen nicht. Aber schließlich ist das auch nicht sein Problem.
Die Sonne spiegelt sich im Denkmal.
Mitten im Zentrum steht es. Auf der nördlichen Seite des S-Marktes, eingerahmt von hanseatischen Prachtgiebeln, Jugendstilfassaden, wuchernden Linden – ein grober, phallusförmiger Riesenzylinder aus Glas, Stahl und farbigem Beton. Vielleicht wollte der Architekt auf eine andere Heimstatt in den höheren Sphären verweisen oder etwas in der Art. Unter den einfacheren Leuten der Stadt wurde er schlicht und einfach Der Steife genannt. Oder auch Der Große Steife. Maertens überlegt, kann sich aber nicht daran erinnern, jemals einen anderen Namen für das Gebäude gehört zu haben, aber irgendwie wird es sicher heißen. Einen schöneren Namen muss es ja wohl haben. Für die Staatsbibliothek sind jedenfalls die beiden untersten Stockwerke vorgesehen, so dass die Gefahr, jemand, der einfach nur Bücher ausleihen oder lesen möchte, könnte sich in die höheren Gefilden verirren, ausgeschlossen ist. Absolut ausgeschlossen.
Fräulein Kemp ist die Chefbibliothekarin. Er stößt mit ihr bereits in der Garderobe zusammen. »Guten Morgen«, sagt sie nur. »Kalt?«
Sie verbraucht so viel von dem Sauerstoff in dem kleinen Raum, dass ihm für einen Moment schwindlig wird. Aber nur für einen Moment. Auf seine eigenen Atemzüge braucht er sich wahrscheinlich nichts einzubilden, und er beschließt, die Grüße ihres weißen Ritters nicht zu übermitteln. Er will ihn nicht in ein schlechtes Licht setzen. Das schafft er mit Sicherheit selbst, Maertens kennt ihn so gut wie seine eigene Hosentasche.
Er hängt Mantel und Schal auf und schlüpft auf die Toilette. Spritzt sich kaltes Wasser ins Gesicht und spült den Mund aus, es gibt solche und solche Morgen.
Dann geht er in den Aufenthaltsraum. Begrüßt Roaldsen und Leon Markovic. Er gießt sich aus der Kaffeemaschine Kaffee in einen Becher ein, auf dem »Coffee – the heartblood of tired men« steht. Chandler.
»Du siehst alt aus«, sagt Roaldsen.
Er nickt und verbrennt sich am Kaffee. Fräulein Kemp kommt herein. Sie zeigt eine feine Runzel über der Brille, und ihr erdfarbenes Tweedkostüm sieht aus wie frisch gebügelt. Sie schaut auf ihre Armbanduhr. Zweifellos ist es an der Zeit.
An der Zeit, die Arbeitsaufgaben des Tages anzupacken. Ein neues Frauenideal?
Als die Kunden hereingelassen werden, steht die Witwe Loewe als Erste in der Schlange.
Maertens hilft ihr behutsam über die Schwelle. Führt sie vorsichtig die acht Treppenstufen hinauf – seit den hektischen Tagen vor Weihnachten gibt es immer wieder Probleme mit dem Fahrstuhl – und hilft ihr, die Ausleihzeit für den zweiten Band von »Krieg und Frieden« zu verlängern. Anschließend unterhalten sie sich eine Weile, ob das Schicksal es wohl zulassen wird, dass sie noch das ganze Werk zu Ende liest, bevor ihre Tage ein Ende finden werden. Obwohl man das ja nie wissen kann.
Anschließend bringt er sie zur Haltestelle auf der anderen Seite des Markts und passt auf, dass sie in die richtige Straßenbahn steigt. Die Sechsundzwanzig, die Linien sind nach Neujahr verändert worden. Oder vielmehr die Ziffern, die Schienen liegen da, wo sie immer gelegen haben.
Ein Freitag im Januar, denkt er, als er wieder hinter dem Ausleihtresen sitzt. Ein Tag wie jeder andere im Leben.
Es ist kein neuer Gedanke.
3
Freddys Bar liegt in Pampas. So hieß die Gegend im Volksmund schon immer, dieses lang gestreckte, nur teilweise bebaute Gebiet zwischen dem träge dahinfließenden Fluss und dem Südlichen Stadtwald. In welchem Jahr Freddy seine Tore geöffnet hat, das weiß Maertens nicht, aber es muss irgendwann während seiner eigenen langen Abwesenheit gewesen sein. Als er schließlich zurückkam, stand sie da, als hätte sie sich schon immer dort befunden: die kleine Nachbarschaftskneipe an der Ecke, der Zufluchtsort und Schutz aller Einsamen in Pampas. All diese Verirrten und Verlassenen, die einigen der zahllosen Stunden all ihrer Wochen, Monate und Jahre zu entfliehen suchen. Die mit ihrem Tod, das ist ihre letzte Hoffnung, einzig und allein den Kreis ihres eigenen Lebens schließen und sonst nichts.
Die auch nur aus lauter Barmherzigkeit existieren, das ist ihre kleinlaute Entschuldigung.
Er kommt zu spät, Bernard hat bereits die Spielfiguren aufgestellt. Sie bestellen Dunkelbier und beginnen mit einer Partie. Istvan und der Chinese wechseln den Tisch, lassen sich bei ihnen nieder und schauen zu. Istvan hat eine neue Frau dabei, sie heißt Ingrid und sieht nordisch aus. Sehr nordisch mit langem Hals und hellem, fast weißem Haar. Bernard redet ununterbrochen, jetzt am Abend mit noch weniger Widerstand, über den neuen Akkord in der Fahrradfabrik, in der er arbeitet, über bevorstehende Spiele in den Fußballligen, mit dem Chinesen über Möglichkeiten, fürs Wochenende ein Haus am Meer zu mieten, mit Grete, Freddys besserer Hälfte, über das aktuelle Tagesmenü.
Denn sobald die Partie zu Ende ist – ein kühnes, russisches Ersatzremis –, ist es Zeit zu essen. Gretes solide Kochkünste bieten an diesem Freitag ein prachtvolles Kalbsragout mit Pilawreis und Pilzen. Sie teilen sich dazu eine Flasche richtigen Bourgogne zu viert. Istvan trinkt nie etwas anderes als Bier. Sein Magen kommt sonst durcheinander, wie er behauptet. Er verträgt kaum Wasser.
Nach dem Essen kommt Freddy selbst und setzt sich eine Weile zu ihnen. Er bringt die niederschmetternde Nachricht, dass er vermutlich »The Duchess of Malfi« erschießen muss.
The Duchess, das ist Freddys und Gretes Hofhund. Eine riesige Neufundländerhündin, die ihren Platz und ihr gesamtes anspruchsloses Revier zwischen der Heizung und der Garderobe hat und die ein äußerst würdevolles Tier ist. Sie hat nie viel Aufmerksamkeit verlangt, höchstens mal eine buschige Augenbraue gehoben, wenn nicht mehr ganz so standfeste Gäste Bier auf ihr Fell gekippt hatten oder ihr zu hart auf den Schwanz traten.
Und sie lebt bei Freddy, solange irgendjemand zurückdenken kann. Aber in letzter Zeit hat sie angefangen zu riechen, und jetzt war der Tierarzt da und hat das Urteil über sie gesprochen.
»Sie muss der älteste Hund der Welt sein«, sagt Istvan.
»Ach, sie hat so ein liebes Wesen«, lispelt der Chinese.
»Das Schlimmste«, erklärt Freddy, »ist, dass ich gezwungen bin, sie sozusagen vom Fleck weg zu erschießen. Wenn wir versuchen, sie woandershin zu bringen, dann würde sie sofort den Braten riechen.«
Es wird einhellig genickt. Es ist betrüblich. Es ist unverantwortlich. Einige flüchtige Augenblicke lang betrachtet man die zum Tode Verurteilte, und Maertens weiß, dass jeder Einzelne in diesen Sekunden denkt, dass sie alle im gleichen Boot wie die Hündin sitzen. Alle zusammen. Es ist ein großes, nicht in Worte zu fassendes Gefühl. Dann spricht der Chinese einen Toast aus, das macht er immer, sobald sich die Gelegenheit bietet, und Freddy widmet sich wieder seiner Arbeit.
Durch noch zwei weitere Partien arbeiten sie sich: noch ein Remis und eine sich lange hinziehende Spanische Partie, bei der Maertens zum Schluss einen Bauern nach mehr als fast achtzig Zügen in einen Sieg verwandelt. Bernard notiert das Ergebnis in seinem gelben Notizheft und teilt den Jahrespunktstand mit: 8,5 : 6,5 zu Maertens’ Gunsten.
Genau in dem Moment, als Bernard das Heft wieder in seine Innentasche schiebt, wird Maertens an diesem Abend von dem Gefühl der Sinnlosigkeit überfallen. Ganz genau in dieser zähen Sekunde. Wie ein Schlag auf den Kopf trifft es ihn. Hart und schonungslos. Der anonyme und allmächtige Fürst ist das Ganze jetzt leid, diese windgetriebenen Marionetten da drinnen in Freddys Bar sind an diesem Freitagabend ihres Lebens überdrüssig. Entschlossen fällt sein Riesenhammer aufs Dach und geradewegs auf Maertens’ Kopf, um allem endlich ein Ende zu bereiten.
Allem, was ihn schon seit längerem in keiner Weise mehr amüsiert.
Maertens beobachtet Bernards Hand, als diese die Innentasche verlässt. Sie taucht hinter dem Jackenrevers unter, ändert die Richtung, um die Krawatte zu richten, seine würstchenartigen Finger sehen zögernd und resigniert aus, immer langsamer bewegen sie sich, das Bild von ihnen flimmert und zuckt wie die letzten Kästchen eines Filmstreifens, der gerissen ist. Oder gerade reißt, die letzten Zehntelsekunden, bevor alles still wird. Dunkel und still.
Das ist nichts Neues. Natürlich hat er das schon früher erlebt, all das, es ist an diesem Abend nur außergewöhnlich deutlich. Er zögert vor diesem Gedanken, zwingt sich aber, ihn aufzunehmen. Stößt auf die gleiche Stimme wie immer. Die gleiche, beharrlich auffordernde Stimme, die ihre dunklen Fragen rezitiert: über die Vergangenheit, über das nie Geklärte. Wie es möglich ist, dass man hier bei Freddy’s sitzt und wie man sich denn von hier fortbegeben will? Begreift man nicht, dass etwas anderes vor sich geht? Dass es eine andere Wirklichkeit und andere Aufgaben gibt, denen man sich widmen muss? Eine andere Strömung im Dasein, deren Sog so viel stärker ist, deren Wasser so viel klarer ist. Deren Ziel so viel wertvoller ist, versteht man das wirklich nicht?
Nein, Maertens versteht überhaupt nichts. Er beendet sein Grübeln und will nicht mehr zuhören. Ist der Meinung, dass die Stimme an diesem Abend wie ein scheinheiliger und umnebelter Seelenfischer klingt, und trinkt entschlossen ein Bier, um sie abzustellen. Es schmeckt nach Metall auf der Zunge. Eisen wahrscheinlich.
Er sehnt sich nach Hause. Heim zu seinem Schauspiel mit den alten Gestalten und ihrem unveränderlichen Leben.
Bevor sie sich für diese Nacht voneinander verabschieden, bittet er Bernard noch um einen Gefallen. Er bittet ihn anzurufen, sobald er zu Hause angekommen ist.
Nur anzurufen und ein paar Minuten in den Hörer zu schweigen. Oder bis er, Maertens, selbst auflegt. Bernard versteht zunächst nicht den Sinn dieser Bitte und argumentiert eine Weile. Sie stehen draußen vor dem Sportplatz unter einer Straßenlaterne. Bernard hält sich an ihr fest und gestikuliert eifrig mit dem anderen Arm. Es ist deutlich zu merken, dass er betrunkener als üblich ist, sein gedrungener Körper sieht unter dem unruhigen Licht grotesk aus. Ein boshafter Zwerg. Ein geiles Gorillamännchen.
»Was zum Teufel meinst du, Maertens?«, fragt er zum fünften Mal. »Erklär mir zum Teufel, was du meinst?«
Maertens schüttelt den Kopf. »Mach es, wie du es für richtig hältst, Bernard«, erklärt er. »Entweder du rufst an, oder du lässt es bleiben. Ich erkläre es dir ein andermal.«
Er verlässt Bernard, geht das letzte Stück allein. Es hat angefangen zu schneien. Mit seinen Händen versucht er die leichten Flocken aufzufangen, aber sie sind so durchscheinend, dass sie schon die Nähe seiner Haut nicht zu ertragen scheinen.
Und nicht den geringsten Augenblick einer Berührung.
Das Telefon klingelt jedenfalls. Natürlich, sie kennen sich ja schon lange.
Wieder einmal steht er auf dem Flur und horcht auf das Schweigen. Es ist bei weitem nicht das gleiche. Deutlich, ganz deutlich kann er Bernards schwere Gestalt am anderen Ende des Drahtes vernehmen. Er legt nach weniger als einer Minute auf, spürt, dass er vom Kalbsragout Sodbrennen bekommen hat, und trinkt ein Glas Selters, bevor er ins Bett geht.
Nichts ist passiert, denkt er. Nichts, was diesen Tag von allen anderen Tagen im Leben unterscheidet. Ob es sich nun um seine eigenen oder die aller anderen handelt. Absolut nichts.
4
Im Gefängnis stellte er sich diese Frage:
Ist ein Mensch, der vierzehn Jahre seines Lebens verloren hat, älter oder jünger als sein eigentliches Alter?
Erst als er wieder freigekommen war, begriff er, dass keine der beiden Alternativen richtig war. Es war einfach nur eine dieser immer wieder auftauchenden Fragen, auf die es keine Antwort gibt. Fragen in fremden Federn. Der siebenunddreißigjährige Mann, der die Haftanstalt mit schlechter Haltung und durchsichtiger, bleicher Gefangenengesichtsfarbe hinter sich ließ, war etwas anderes. Etwas radikal anderes. Die Frage nach dem Alter war beliebig und inhaltslos, plötzlich gab es nur Raum, gibt es nur Raum, Jahr für Jahr hat er gezählt und in alle erdenklichen Zeitabschnitte eingeteilt: Monate, Wochen, Tage – und die kleineren Einheiten: Sekunden, bis das Duschwasser abgestellt wird, Minuten, die der Abendfreigang noch währt, Stunden, in denen das Licht des Morgengrauens in sein Zellenfenster fällt und ein Muster wie das eines unregelmäßigen Sterns an die Wand wirft ... aber als er schließlich herauskommt, als er schließlich frei ist, bleibt all das mit der Zeit hinter den Mauern zurück.
Vieles andere auch. Das Bild von seinem Leben beispielsweise.
Das wird ihm erst viel später bewusst. Das mit dem Bild. Nachdem Jahr um Jahr vergangen ist, nachdem er Bernard wiedergetroffen und ihm erzählt hat, wer er eigentlich ist.
Gewesen ist. Bernard und Birthe. Die, die davon wissen.
Bei einem Glas Bier in Darms vernebeltem Café kratzt Bernard seine Pfeife aus und fragt: »Was für ein Bild hast du von deinem Leben?«
Er antwortet ausweichend, dass er keines habe. Bernard stopft den Tabak umständlich nach und lässt nicht locker. Versucht zu erklären, worum es bei der Frage geht, was es bedeutet, ein Bild von seinem eigenen Leben zu haben. Etwas, das alle in sich tragen sollten: etwas, das unumgänglich ist, ein Spiegel, ein Muttermal. In schlechten wie in guten Zeiten.
Das Bild.
Aber Maertens hat keins. Er hatte wohl eins bis zum Alter von dreiundzwanzig Jahren, aber jetzt gibt es keines mehr.
Kein Bild von seinem Leben. Nur das Leben selbst. Bernard zündet sich die Pfeife an und zieht einen Rauchvorhang vor.
Denn als er herauskam, da gab es nur einen Anfang. Vielleicht die Andeutung einer Richtung, aber mehr nicht, die ersten Schritte den Anstieg eines riesigen Berges hinauf. Mit dem Rücken zur Steilwand. Kein Punkt, an dem irgendetwas anfängt. Keine Basis, um etwas aufzubauen, und keine Verbindungsglieder. Er hat später nicht mehr begriffen, was es denn hätte sein sollen, was er erwartet hatte. Stand nur mit den Händen in den Taschen da und einer bleichen Sonne im Gesicht, plötzlich etwas so verdammt Übermächtigem gegenüber, einer neuen Felswand, einem Wald aus dichter, nicht festgezurrter Zeit, die so dicht um ihn herum wuchs, dass ihre Zweige seine Haut zerkratzten und tief in seinen Blutkreislauf hineinragten. Mitten ins Leben geworfen, ein Fötus mittleren Alters ohne Heute und Morgen. Ein Soldat im fremden Land. Weder noch.
Ungefähr so.
Als er sich an diesen Zustand gewöhnt hatte, wurde er ihm schließlich vertraut wie die eigenen Hände. Von dieser Plattform aus begann er. Ohne Vorstellung von Ziel oder Sinn, nie mehr als einen Tag im Fokus. Oft nur ein paar Stunden.
Und er verwarf seinen Namen. Vielleicht hatte er ja geglaubt, dass er im Laufe der Jahre in Vergessenheit geraten würde, aber dem war nicht so. Er lernte das herostratische Gesetz und konnte darüber lachen: dass die meisten aus dem Gedächtnis der Allgemeinheit verschwinden – Staatsmänner, Helden, gefeierte Künstler und Ähnliches –, dass man jedoch niemals einen Missetäter vergisst. Einen Mörder vergisst man nicht.
So wurde er Maertens. Wenn es nur um ihn gegangen wäre, er nur sich selbst vor Augen und im Spiegel sähe, dann hätte er gut mit dem Namen der Schande leben können. Es störte ihn nicht in seinem neuen Leben. Aber es gab da einen Faktor. Einen einzigen, der ihn mit der Haftzeit verband... nicht mit dem Gefängnis, sondern mit der Zeit, ein dünner Faden, ein Nabelstrang, eine Unzeitgemäßheit, mit der er nie abschließen konnte.
Es gab eine Frau.
Birthe.
Sie erschien wie ein Engel in diesem schwarzen zehnten Jahr, und sie wurde die Seine. Verlassen von einem Seekadetten – der sich, statt ihr das Leben in Glanz und Überfluss zu geben, das er ihr vorgegaukelt hatte, eines düsteren Dezemberabends aufhängte –, war sie zum einen von einer unsagbaren Trauer und Verzweiflung überfallen worden, zum anderen von dem Bedürfnis, etwas Gutes in diesem Leben auszurichten. Was erschien da natürlicher, als sich eines der Unglückskinder der Gesellschaft anzunehmen, das sein jämmerliches Leben hinter Schloss und Riegel darben musste? Ganz und gar nichts. Gesagt, getan. Sie trat in den Verein »Rette deinen eigenen Häftling« ein und kam eines kalten Februarnachmittags mit frisch gebackenen Scones und Brombeermarmelade zu Maertens.
Sie heirateten in der Gefängniskapelle, sie planten eine gemeinsame Zukunft, und sie versuchten, ein Kind zu bekommen.
Ihre besten Jahre fielen in die Zeit, als er noch im Gefängnis saß. Als sie sich nur ein- oder zweimal in der Woche trafen und einander von den kleinen, anspruchslosen Ereignissen aus ihren so getrennten Welten, in denen sie lebten, berichten konnten. Ja, wie leicht und problemlos verhielt sich da alles zwischen ihnen. Wie unbeschwert.
Als er dann später entlassen wurde, als sie plötzlich in der gleichen Welt verkehren sollten, sogar unter dem gleichen Dach, stellte sich heraus, dass sie einander nicht mehr so viel zu sagen hatten. Eigentlich so gut wie gar nichts. Sie trennten sich nach zwei tapferen Jahren. Maertens zog in das kleine Haus in Pampas, das er von seinem mütterlichen Erbe kaufte. Birthe blieb in der Wohnung, und beide schöpften erleichtert tief Luft.
Nun befanden sie sich wieder auf sicherem Abstand. Die Beziehung konnte, wenn auch nicht aufblühen, so doch zumindest in aller Mäßigung wieder aufkeimen. Wie eine Pflanze, die zwar niemals Früchte tragen würde, aber doch soviel Nahrung bekam, dass sie sich am Leben hielt.
So verhielt es sich. Ungefähr so.
Verhält es sich heute noch.
Sie gehen nie zusammen aus, Birthe und Maertens. Nicht ins Theater. Nicht ins Kino und nicht in Konzerte, nicht einmal einen gemeinsamen Restaurantbesuch gönnen sie sich. Der gemeinsame Nenner für ihre Beziehung ist von anderer Art.
Die Fleischeslust. Das Bedürfnis zu bumsen. Manchmal spürt man die Neigung, die Dinge beim rechten Namen zu nennen, zumindest was Maertens betrifft. Aus diesem Grunde treffen sie sich ab und zu, mal daheim bei ihm, mal daheim bei Birthe. Sie essen eine Kleinigkeit, schauen eine Weile Fernsehen, und dann gehen sie ins Bett. Das ist in Ordnung so, und auch hiervon hat er kein bewusstes Bild.
In dieser Art geht es nun seit zehn Jahren, und eine andere Frau hat Maertens sich nicht angeschafft. Der Gedanke taucht manchmal in seinem Kopf auf, wie Gedanken es halt so tun, aber er erscheint nie besonders wichtig. Nicht dringend. Wie es bei Birthe mit anderen Männern aussieht, das weiß er nicht. Er nimmt an, dass es einfach keine Bedeutung für ihn hat, zumindest redet man sich so etwas gern ein. Sie existieren füreinander nur während der Zeit, in der sie zusammen sind, vielleicht sollte man die Sache so betrachten, wenn man sie überhaupt betrachtet.
Und nichts ändert sich. Alles geht seinen Gang ... obwohl möglicherweise ...
...möglicherweise hat er eine kleine Besonderheit bemerkt – ein gewisses zunehmendes Interesse für religiöse Fragen von Birthes Seite aus in der letzten Zeit. Das wäre das Einzige, und ein gewisses Maß an Spiritualität hat sie ja eigentlich immer schon gepflegt, oder? Eine Art Beseeltheit, die nie Nahrung in ihrer Beziehung gesucht hat, jedenfalls nicht, soweit er sich erinnern kann. Auf jeden Fall hat er seit Mitte November ab und zu kleine Heftchen in ihrer Wohnung bemerkt. Pamphlete verschiedener Sekten – besonders von einer Versammlung, die sich die Kirche des Reinen Lebens nennt, was immer das auch sein mag.
Er hat die Sache so nebenbei angesprochen, doch, das hat er gemacht, aber keine richtige Antwort bekommen. Überhaupt reden sie selten über etwas Wesentliches, es ist, wie es ist. Eine wichtige Voraussetzung für ihr gemeinsames Sexualleben scheint zu sein, dass sie alles andere außen vor lassen. Alles. Besonders Maertens respektiert das eigentlich immer als eine Art Grundbedingung, und wenn Birthe es damit nicht ganz so genau nimmt, dann kann es ihm eigentlich egal sein. Sie ist auch, wie sie ist, mit einem Parfüm ist sie sicher gut bedient, man kann nicht erwarten, dass ein Mensch allen Anforderungen gerecht wird, nur weil jemand auf die Idee kommt, sie an ihn zu stellen.
Aber das Reine Leben?
Es geht auch an diesem Abend gut.
Sie essen Lammkoteletts, dann waschen sie gemeinsam ab. Hinterher sitzen sie auf Birthes Sofa und schauen Fernsehen. Er weiß, dass sie sich wie gewöhnlich den Slip ausgezogen hat. Sie macht einige unmotivierte Bewegungen mit den Beinen, so dass ihr Kleid langsam, wie zufällig, ein gutes Stück über die Knie hoch rutscht. Die Bilder auf dem Fernsehschirm nehmen sie immer mehr gefangen, und als er ihr die Hand auf die Schenkelinnenseite legt, schiebt sie den Unterleib vor, so dass seine Finger sogleich mit ihrem feuchten Schritt in Berührung kommen. Sie starrt vollkommen konzentriert auf eine Ansagerin, als hätten ihre obere und untere Körperhälfte keine Verbindung mehr miteinander. Eine Art Kurzschluss, ein Kollaps der Synapsen, die Seele löst sich vom Fleisch, erhaben, befreit und auf das Fernsehen gerichtet. Das ist verrückt, und eine Sekunde lang ist es ihm peinlich, dass es ihm gefällt.
Sie schlafen miteinander – lieben sich, wenn man so will – dort auf dem Sofa, während der Fernseher läuft. Hinterher gehen sie ins Bett und machen es noch einmal.
Dann schlafen sie bis zum nächsten Morgen. Er wacht davon auf, dass sie im Bett sitzt und ihn ansieht.
»Was ist das?« Sie tupft vorsichtig auf den schmerzhaften Fleck unterhalb seiner linken Brustwarze. Es ärgert ihn ein wenig, dass es ihm nicht gelungen ist, ihn zu verbergen.
»Ein Muttermal. Das weißt du doch.«
»Ein Muttermal? Nennst du das hier ein Muttermal? Das ist doch ganz weich und merkwürdig.«
Er zieht die Decke hoch.
»Maertens!«
Er dreht sich weg und wünscht sich nichts sehnlicher, als woanders zu liegen. In seinem eigenen Bett oder wo auch immer. In einem Graben, in einem Wald, ganz gleich, wo. Die Fleischeslust kann diesen Preis einfach nicht wert sein, denkt er.
»Wieso habe ich das vorher nie gesehen? Natürlich weiß ich, dass du da ein Muttermal hast, aber das hier ist ja ganz angeschwollen ... Lass mich noch mal sehen!« Sie zieht die Bettdecke herunter und drückt vorsichtig auf den Fleck. Die Berührung ist ganz leicht, dennoch spürt er einen stechenden Schmerz. Als säße sie da und bohrte den Finger in eine offene Wunde.
»Wie lange ist das schon so?«
»Ein paar Wochen ... drei.«
»Warst du beim Arzt?«
»Nein ...«
»Du bist nicht ganz gescheit. Du musst sofort zum Arzt gehen, Maertens, hörst du. Das kann Krebs sein, weißt du.«
Ihre Direktheit ist bewundernswert. Er weiß, dass sie möglicherweise Recht hat. Sehr wahrscheinlich sogar. Er hat sich in der Bibliothek entsprechende Lexika angesehen und ist auf drei mögliche Diagnosen gekommen: Verruca seborrhoica, Basaliom, Malignes Melanom. Die beiden Ersteren sind relativ harmlos, das Dritte umso ernster, vermutlich auch viel wahrscheinlicher.
Er hat beschlossen, nicht weiter zu forschen. Nicht herausfinden zu wollen, welche Alternative zutrifft. Das wird sich sowieso zeigen, insgesamt sind inzwischen sieben Wochen vergangen, seit er den wachsenden Fleck bemerkt hat. Bis jetzt war es ihm gelungen, ihn vor Birthe zu verstecken, aber jetzt ist er also entdeckt worden.
»Und?«
»Und was?«
»Wann willst du zum Arzt gehen?«
»Ich habe nächste Woche einen Termin«, lügt er.
»Bei was für einem Arzt?«
»Bei einem Onkologen«, sagt er. »Wo denn sonst?«
Damit gibt sie sich zufrieden. Maertens atmet auf. Sie deckt ihn wieder zu und steht auf. Er bleibt liegen und lauscht ihren Geräuschen aus dem Badezimmer. Überlegt einen Augenblick, sofort nach Hause zu gehen. Der Morgen danach mit Birthes Faible für heiße Schokolade gehört zu den anstrengendsten Aspekten ihrer Beziehung, den er am liebsten schwänzen würde, indem er davonliefe.
Aber er bleibt. Hört sie in der Küche rumoren. Tastet selbst mit den Fingern die Stelle ab. Er weiß, wie die Entwicklung laut Alternative drei aussehen wird. Sie wird schnell vonstatten gehen. Ganz plötzlich. Mehr als zwei Jahre werden nicht nötig sein, nicht, wenn man die Behandlung so lange wie möglich hinausschiebt.
Ich habe Krebs, denkt er.
Ich werde in zwei Jahren sterben.
So sieht mein Leben aus.
Es ist kein Krebs, denkt er dann. Nur eine gutartige Seborrhoica. Ich werde noch leben, wenn ich hundert bin.
Diese beiden Identitäten sind möglich. Eine dritte gibt es nicht, und diese Feststellung macht ihn fast vergnügt. Nicht wissen zu können, welche zutrifft. Die Möglichkeit, mit diesen beiden Alternativen gleichzeitig zu leben – die eine schließt die andere aus, und dennoch stehen sie Seite an Seite –, ist in höchstem Maße verlockend. Er weiß, warum:
Haben und nicht haben. Alles oder nichts.
Nein, alles und nichts.
Ein Bild seines Lebens?
Er steht auf und kann riechen, dass Birthe die Milch in der Küche hat überkochen lassen. Ein unterdrückter Fluch entfährt ihr. Er beginnt sich anzuziehen. Stellt fest, dass das Reine Leben sie noch nicht ganz in seiner Gewalt hat.
5
Ein paar Wochen später ist er wieder einmal auf dem Heimweg.
Es ist ein ruhiger, grauer Sonntag. Plötzlich ist Wärme in der Luft zu spüren. Als er den Fluss entlang geht, kann er fühlen, dass feuchter Wind vom Meer hereinweht und sich nass auf seinem Gesicht niederlässt. Es gibt keine Schneeflecken mehr im Schatten, der Winter scheint für dieses Mal vorüber zu sein. Wenn man in dieser Küstenlandschaft überhaupt von Winter reden kann.
Er geht in gemütlichem Tempo und ist guten Mutes. Er hat es nicht eilig, ins Haus zu kommen, bewegt sich fast bewusst langsam, um genau das hinauszuzögern. Will andererseits auch keine Umwege machen, einen Spaziergang konstruieren, er will nur die Zeit ausdehnen, so weit es möglich ist. Er weiß, dass dieses Gefühl einer postkoitalen Widerstandslosigkeit sich verlieren wird, sobald er zu Hause ist. Es wird von ihm abfallen wie ein verirrtes Lachen, dieser einzigartige Zustand, der einzige, in dem ein Mensch ausruhen kann. Bei Nielemann’s bleibt er stehen und kauft sich eine Zeitung. Einen Monat weiter im Jahr könnte er sich auf eine Bank setzen und sich in die Zeitung vertiefen. Jetzt ist es dafür noch zu früh. Er muss sich damit begnügen, sie einzurollen und unter den Arm zu klemmen.
Dann bleibt er noch eine Weile stehen. Betrachtet den Fluss und denkt: der Fluss