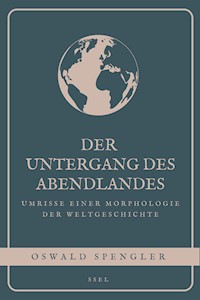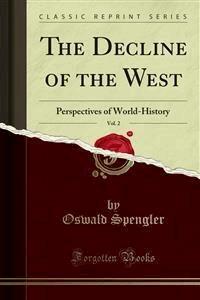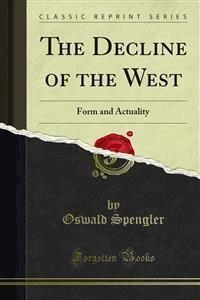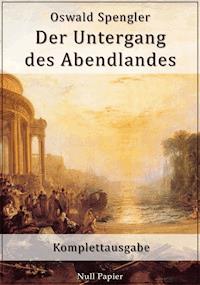
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Sachbücher bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Komplettausgabe Das meist diskutierte Geschichtswerk seiner Zeit. Auch heute noch missverstanden, umgedeutet, fehlinterpretiert und missbraucht. Der Titel ist zum Fanal, zum Schlagwort geworden. Spengler lokalisiert die abendländische Kultur in ihrer Zivilisationsphase und damit in ihrer Endphase – eine damalige Ungeheuerlichkeit. Spenglers Werk wird in Zyklen immer wieder neu entdeckt. Samuel P. Huntington greift mit seinen Thesen vom »Kampf der Kulturen« wesentlich auf Spenglers »Untergang« zurück. In globalen Krisenzeiten wird Spenglers konsequente Weltsicht der schicksalhaften Entwicklung von Imperien als Horoskop der Weltgeschichte gesehen. Eine brauchbare Blaupause zur Lösungsfindung stellen sie nicht dar. Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1940
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Oswald Spengler
Der Untergang des Abendlandes
Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte
Oswald Spengler
Der Untergang des Abendlandes
Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte
Original: Braumüller, Wien, 1918 & C.H. Beck München, 1922
Überarbeitung, Umschlaggestaltung: Null Papier Verlag
Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected]
2. Auflage, ISBN 978-3-95418-664-8
Umfang: 1593 Normseiten bzw. 1944 Buchseiten
www.null-papier.de/330
Verlag
Informationen über Neuveröffentlichungen, Angebote und Geschenkaktionen erhalten Sie im regelmäßig erscheinenden Newsletter:
www.null-papier.de/newsletter
Der Untergang des Abendlandes
»Der Untergang des Abendlandes« ist das Hauptwerk von Oswald Spengler. Der erste Band wurde von 1918 an herausgegeben, der zweite Band 1922.
Die Jahreszeiten von Imperien
Schon in den ersten Sätzen wird dem Leser die Mammut-Aufgabe, die Hybris bewusst, der sich Spengler stellt: »In diesem Buche wird zum erstenmal der Versuch gewagt, Geschichte vorauszubestimmen. Es handelt sich darum, das Schicksal einer Kultur, und zwar der einzigen, die heute auf diesem Planeten in Vollendung begriffen ist, der westeuropäisch-amerikanischen, in den noch nicht abgelaufenen Stadien zu verfolgen.«
Man beachte die Punkte: „Geschichte vorauszubestimmen“ und „noch nicht abgelaufenen Stadien“. Spengler will den Untergang der westlichen Kultur voraussagen. Ein gewagtes Unterfangen.
Er vergleicht das europäisch-nordamerikanische Abendland unter verschiedenen Gesichtspunkten mit anderen vergangenen Hochkulturen - u.a. der ägyptischen, der chinesischen und der indischen Kultur und liefert dazu eine ungeheure Fleißaufgabe ab auf den Gebieten der Mathematik, der Künste, der Religionen, der Staatsphilosophie und der Ökonomie.
Er lokalisiert die abendländische Kultur in ihrer Zivilisationsphase und damit in ihrer Endphase – eine damalige Ungeheuerlichkeit. Spengler richtet sich gegen eine lineare Geschichtsschreibung, welche die Geschichte der Menschheit als Geschichte des Fortschritts erzählt. Stattdessen vertritt er die Zyklentheorie, dass Kulturen immer wieder neu entstehen, eine Blütezeit erleben und nach dieser Vollendung untergehen, gleich den Jahreszeiten von Imperien.
Von Nietzsche zu Hitler
Von Nietzsche und seinem Super-Radikalismus beeinflusst will er »aus seinem Ausblick einen Überblick« machen. Er will die Geschichtswissenschaften, die bisher in der Vergangenheit operieren und Geschichte als Abfolge von einmaligen Ereignissen verstehen in eine prognostische Wissenschaft wandeln. Es stellt sich dabei die Frage, ob das Schicksal von Nationen und Kulturen zwangsläufig, abwendbar oder zumindest herauszuzögern ist. Dies bleibt unbeantwortet.
Viel kritisiert wurde und wird seine Theorie der unabänderlichen historischen Gesetzmäßigkeiten besonders unter linken Intellektuellen. Aber selbst Adorno kann noch nach dem 2. Weltkrieg Spenglers Gedanken als deskriptive Wissenschaft viel abgewinnen und sieht die blanke Kritik an Spengler als zu einfach. Allerdings spricht sich auch Adorno gegen einen historischen Fatalismus aus, der Aufstände und Kriege als unausweichlich hinnimmt. Thomas Mann spricht – obwohl von der literarischen Qualität der beiden Bände überzeugt – von einem »humanistischen Pessimismus eines Schopenhauer«.
Spengler, ein preußischer Antidemokrat aus Tradition, wird schon früh von den Nationalsozialisten für ihre Propaganda vereinnahmt. Ob Spengler selbst den Nazis nahestand, ist bis heute umstritten, spricht er sich doch in einigen Aufsätzen und Interviews gegen Hitler aus. Allerdings wird er zeitlebens ein großer Verehrer von Mussolini bleiben. Man kann also vermuten, dass Spengler eher ein Gegner der Nazis aus praktischen und persönlichen denn aus politisch-prinzipiellen Gründen war.
Spenglers Werk wird in Zyklen immer wieder neu entdeckt. Samuel P. Huntington greift mit seinen Thesen vom »Kampf der Kulturen« wesentlich auf Spenglers »Untergang« zurück. In globalen Krisenzeiten wird Spenglers konsequente Weltsicht der schicksalhaften Entwicklung von Imperien als Horoskop der Weltgeschichte gesehen. Eine brauchbare Blaupause zur Lösungsfindung stellen sie nicht dar.
»Die ungeheure Wirkung dieses Buches und der aufregende Neuheitseindruck, mit dem es entgegengenommen wurde, ist psychologisch nur aus der Niederlage Deutschlands im Kriege zu verstehen.« [Max Scheler, 1973]
Erster Band – Gestalt und Wirklichkeit
Vorwort
Gestalt und Wirklichkeit
Wenn im Unendlichen dasselbeSich wiederholend ewig fließt,Das tausendfältige GewölbeSich kräftig ineinander schließt;Strömt Lebenslust aus allen Dingen,Dem kleinsten wie dem größten Stern,Und alles Drängen, alles RingenIst ewige Ruh in Gott dem Herrn.
Goethe
Am Schlusse einer Arbeit, die vom ersten kurzen Entwurf bis zur endgültigen Fassung eines Gesamtwerks von ganz unvorhergesehenem Umfang zehn Lebensjahre umfaßt, ziemt sich wohl ein Rückblick auf das, was ich gewollt und erreicht, wie ich es aufgefunden habe und wie ich heute dazu stehe.
In der Einleitung zur Ausgabe von 1918 – einem Fragment nach außen und innen – hatte ich gesagt, daß hier nach meiner Überzeugung die unwiderlegliche Formulierung eines Gedankens vorliege, den man nicht mehr bestreiten werde, sobald er einmal ausgesprochen sei. Ich hätte sagen sollen: sobald er verstanden sei. Denn dazu bedarf es, wie ich mehr und mehr einsehe, nicht nur in diesem Falle, sondern in der Geschichte des Denkens überhaupt einer neuen Generation, die mit der Anlage dazu geboren ist.
Ich hatte hinzugefügt, daß es sich um einen ersten Versuch handle, mit allen Fehlern eines solchen behaftet, unvollständig und sicherlich nicht ohne inneren Widerspruch. Diese Bemerkung ist bei weitem nicht so ernst genommen worden, wie sie gemeint war. Wer je einen tiefen Blick in die Voraussetzungen lebendigen Denkens getan hat, der wird wissen, daß eine widerspruchslose Einsicht in die letzten Gründe des Daseins uns nicht gegeben ist. Ein Denker ist ein Mensch, dem es bestimmt war, durch das eigene Schauen und Verstehen die Zeit symbolisch darzustellen. Er hat keine Wahl. Er denkt, wie er denken muß, und wahr ist zuletzt für ihn, was als Bild seiner Welt mit ihm geboren wurde. Es ist das, was er nicht erfindet, sondern in sich entdeckt. Es ist er selbst noch einmal, sein Wesen in Worte gefaßt, der Sinn seiner Persönlichkeit als Lehre geformt, unveränderlich für sein Leben, weil es mit seinem Leben identisch ist. Nur dieses Symbolische ist notwendig, Gefäß und Ausdruck menschlicher Geschichte. Was als philosophische Gelehrtenarbeit entsteht, ist überflüssig und vermehrt lediglich den Bestand einer Fachliteratur.
So vermag ich denn den Kern dessen, was ich gefunden habe, nur als »wahr« zu bezeichnen, wahr für mich, und, wie ich glaube, auch für die führenden Geister der kommenden Zeit, nicht wahr »an sich«, abgelöst nämlich von den Bedingungen von Blut und Geschichte, denn dergleichen gibt es nicht. Aber was ich im Sturm und Drang jener Jahre schrieb, war allerdings eine sehr unvollkommene Mitteilung dessen, was deutlich vor mir stand, und es blieb die Aufgabe der folgenden Jahre, durch die Anordnung von Tatsachen und den sprachlichen Ausdruck meinen Gedanken die mir erreichbare eindringliche Gestalt zu geben.
Vollenden läßt sie sich nie – das Leben selbst vollendet erst der Tod. Aber ich habe noch einmal versucht, auch die ältesten Teile auf die Höhe anschaulicher Darstellung zu heben, die mir heute zu Gebote steht, und damit nehme ich Abschied von dieser Arbeit mit ihren Hoffnungen und Enttäuschungen, ihren Vorzügen und Fehlern.
Das Ergebnis hat inzwischen seine Probe für mich bestanden, auch für andre, wenn ich nach der Wirkung urteilen darf, die es auf weite Wissensgebiete langsam auszuüben beginnt. Um so schärfer habe ich die Grenze zu betonen, die ich mir selbst in diesem Buch gesetzt habe. Man suche nicht alles darin. Es enthält nur eine Seite von dem, was ich vor mir sehe, einen neuen Blick allein auf die Geschichte, eine Philosophie des Schicksals, und zwar die erste ihrer Art. Es ist anschaulich durch und durch, geschrieben in einer Sprache, welche die Gegenstände und die Beziehungen sinnlich nachzubilden sucht, statt sie durch Begriffsreihen zu ersetzen, und es wendet sich allein an Leser, welche die Wortklänge und Bilder ebenso nachzuerleben verstehen. Dergleichen ist schwer, besonders wenn die Ehrfurcht vor dem Geheimnis – die Ehrfurcht Goethes – uns hindert, begriffliche Zergliederungen für Tiefblicke zu halten.
Da erhebt sich denn das Geschrei über Pessimismus, mit dem die Ewiggestrigen jeden Gedanken verfolgen, der nur für die Pfadfinder des Morgen bestimmt ist. Indessen habe ich nicht für solche geschrieben, welche das Grübeln über das Wesen der Tat für eine Tat halten. Wer definiert, der kennt das Schicksal nicht.
Die Welt verstehen nenne ich der Welt gewachsen sein. Die Härte des Lebens ist wesentlich, nicht der Begriff des Lebens, wie es die Vogel-Strauß-Philosophie des Idealismus lehrt. Wer sich nichts von Begriffen vormachen läßt, empfindet das nicht als Pessimismus, und auf die andern kommt es nicht an. Für ernste Leser, welche einen Blick auf das Leben suchen statt einer Definition, habe ich angesichts der allzu gedrängten Form des Textes in den Anmerkungen eine Anzahl von Werken genannt, die diesen Blick über fernliegende Gebiete unseres Wissens hinleiten können.
Zum Schlusse drängt es mich, noch einmal die Namen zu nennen, denen ich so gut wie alles verdanke: Goethe und Nietzsche. Von Goethe habe ich die Methode, von Nietzsche die Fragestellungen, und wenn ich mein Verhältnis zu diesem in eine Formel bringen soll, so darf ich sagen: ich habe aus seinem Ausblick einen Überblick gemacht. Goethe aber war in seiner gesamten Denkweise, ohne es zu wissen, ein Schüler von Leibniz gewesen. So empfinde ich das, was mir zu meiner eigenen Überraschung zuletzt unter den Händen entstanden ist, als etwas, das ich trotz des Elends und Ekels dieser Jahre mit Stolz nennen will: als eine deutsche Philosophie.
Blankenburg a. H., Dezember 1922
Oswald Spengler
Vorwort zur ersten Ausgabe des 1. Bandes
Dies Buch, das Ergebnis dreier Jahre, war in der ersten Niederschrift vollendet, als der große Krieg ausbrach. Es ist bis zum Frühling 1917 noch einmal durchgearbeitet und in Einzelheiten ergänzt und verdeutlicht worden. Die außerordentlichen Verhältnisse haben sein Erscheinen weiterhin verzögert.
Obwohl mit einer allgemeinen Philosophie der Geschichte beschäftigt, bildet es doch in tieferem Sinne einen Kommentar zu der großen Epoche, unter deren Vorzeichen die leitenden Ideen sich gestaltet haben.
Der Titel, seit 1912 feststehend, bezeichnet in strengster Wortbedeutung und im Hinblick auf den Untergang der Antike eine welthistorische Phase vom Umfang mehrerer Jahrhunderte, in deren Anfang wir gegenwärtig stehen.
Die Ereignisse haben vieles bestätigt und nichts widerlegt. Es zeigte sich, daß diese Gedanken eben jetzt und zwar in Deutschland hervortreten mußten, daß der Krieg selbst aber noch zu den Voraussetzungen gehörte, unter welchen die letzten Züge des neuen Weltbildes bestimmt werden konnten.
Denn es handelt sich nach meiner Überzeugung nicht um eine neben andern mögliche und nur logisch gerechtfertigte, sondern um die, gewissermaßen natürliche, von allen dunkel vorgefühlte Philosophie der Zeit. Das darf ohne Anmaßung gesagt werden. Ein Gedanke von historischer Notwendigkeit, ein Gedanke also, der nicht in eine Epoche fällt, sondern der Epoche macht, ist nur in beschränktem Sinne das Eigentum dessen, dem seine Urheberschaft zuteil wird. Er gehört der ganzen Zeit; er ist im Denken aller unbewußt wirksam und allein die zufällige private Fassung, ohne die es keine Philosophie gibt, ist mit ihren Schwächen und Vorzügen das Schicksal und das Glück – eines Einzelnen.
Ich habe nur den Wunsch beizufügen, daß dies Buch neben den militärischen Leistungen Deutschlands nicht ganz unwürdig dastehen möge.
München, im Dezember 1917
Oswald Spengler
Einleitung
1
In diesem Buche wird zum erstenmal der Versuch gewagt, Geschichte vorauszubestimmen. Es handelt sich darum, das Schicksal einer Kultur, und zwar der einzigen, die heute auf diesem Planeten in Vollendung begriffen ist, der westeuropäisch-amerikanischen, in den noch nicht abgelaufenen Stadien zu verfolgen.
Die Möglichkeit, eine Aufgabe von so ungeheurer Tragweite zu lösen, ist bis heute offenbar nicht ins Auge gefaßt, und wenn dies der Fall war, sind die Mittel, sie zu behandeln, nicht erkannt oder in unzulänglicher Weise gehandhabt worden.
Gibt es eine Logik der Geschichte? Gibt es jenseits von allem Zufälligen und Unberechenbaren der Einzelereignisse eine sozusagen metaphysische Struktur der historischen Menschheit, die von den weithin sichtbaren, populären, geistig-politischen Gebilden der Oberfläche wesentlich unabhängig ist? Die diese Wirklichkeit geringeren Ranges vielmehr erst hervorruft? Erscheinen die großen Züge der Weltgeschichte dem verstehenden Auge vielleicht immer wieder in einer Gestalt, die Schlüsse zuläßt? Und wenn – wo liegen die Grenzen derartiger Folgerungen? Ist es möglich, im Leben selbst – denn menschliche Geschichte ist der Inbegriff von ungeheuren Lebensläufen, als deren Ich und Person schon der Sprachgebrauch unwillkürlich Individuen höherer Ordnung wie »die Antike«, »die chinesische Kultur« oder »die moderne Zivilisation« denkend und handelnd einführt – die Stufen aufzufinden, die durchschritten werden müssen, und zwar in einer Ordnung, die keine Ausnahme zuläßt? Haben die für alles Organische grundlegenden Begriffe, Geburt, Tod, Jugend, Alter, Lebensdauer, in diesem Kreise vielleicht einen strengen Sinn, den noch niemand erschlossen hat? Liegen, kurz gesagt, allem Historischen allgemeine biographische Urformen zugrunde? Der Untergang des Abendlandes, zunächst ein örtlich und zeitlich beschränktes Phänomen wie das ihm entsprechende des Untergangs der Antike, ist, wie man sieht, ein philosophisches Thema, das in seiner ganzen Schwere begriffen alle großen Fragen des Seins in sich schließt.
Will man erfahren, in welcher Gestalt sich das Schicksal der abendländischen Kultur erfüllen wird, so muß man zuvor erkannt haben, was Kultur ist, in welchem Verhältnis sie zur sichtbaren Geschichte, zum Leben, zur Seele, zur Natur, zum Geiste steht, unter welchen Formen sie in Erscheinung tritt und inwiefern diese Formen – Völker, Sprachen und Epochen, Schlachten und Ideen, Staaten und Götter, Künste und Kunstwerke, Wissenschaften, Rechte, Wirtschaftsformen und Weltanschauungen, große Menschen und große Ereignisse – Symbole und als solche zu deuten sind.
2
Das Mittel, tote Formen zu erkennen, ist das mathematische Gesetz. Das Mittel, lebendige Formen zu verstehen, ist die Analogie. Auf diese Weise unterscheiden sich Polarität und Periodizität der Welt.
Das Bewußtsein davon, daß die Zahl der weltgeschichtlichen Erscheinungsformen eine begrenzte ist, daß Zeitalter, Epochen, Lagen, Personen sich dem Typus nach wiederholen, war immer vorhanden. Man hat das Auftreten Napoleons kaum je ohne einen Seitenblick auf Cäsar und Alexander behandelt, von denen der erste, wie man sehen wird, morphologisch unzulässig, der zweite richtig war. Napoleon selbst fand die Verwandtschaft seiner Lage mit derjenigen Karls des Großen heraus. Der Konvent sprach von Karthago, wenn er England meinte, und die Jakobiner nannten sich Römer. Man hat, mit sehr verschiedenem Recht, Florenz mit Athen, Buddha mit Christus, das Urchristentum mit dem modernen Sozialismus, die römischen Finanzgrößen der Zeit Cäsars mit den Yankees verglichen. Petrarca, der erste leidenschaftliche Archäologe – die Archäologie ist ja selbst ein Ausdruck des Gefühls, daß Geschichte sich wiederholt –, dachte in bezug auf sich an Cicero, und erst vor kurzem noch Cecil Rhodes, der Organisator des englischen Südafrika, der die antiken Cäsarenbiographien in eigens für ihn angefertigten Übersetzungen in seiner Bibliothek besaß, an Kaiser Hadrian. Es war das Verhängnis Karls XII. von Schweden, daß er von Jugend auf das Leben Alexanders von Curtius Rufus in der Tasche trug und diesen Eroberer kopieren wollte.
Friedrich der Große bewegt sich in seinen politischen Denkschriften – wie den »Considérations« von 1738 – mit vollkommener Sicherheit in Analogien, um seine Auffassung der weltpolitischen Lage zu kennzeichnen, so, wenn er die Franzosen mit den Makedoniern unter Philipp und die Deutschen mit den Griechen vergleicht. »Schon sind die Thermopylen Deutschlands, Elsaß und Lothringen, in Philipps Hand.« Damit war die Politik des Kardinals Fleury vorzüglich getroffen. Hier findet sich weiterhin ein Vergleich zwischen der Politik der Häuser Habsburg und Bourbon und den Proskriptionen des Antonius und Oktavian.
Aber das alles blieb fragmentarisch und willkürlich und entsprach in der Regel mehr einem augenblicklichen Hange, sich dichterisch und geistreich auszudrücken, als einem tieferen historischen Formgefühl.
So sind die Vergleiche Rankes, eines Meisters der kunstvollen Analogie, zwischen Kyaxates und Heinrich I., den Einfällen der Kimmerier und der Magyaren morphologisch bedeutungslos, nicht viel weniger der oft wiederholte zwischen den hellenischen Stadtstaaten und den Renaissancerepubliken, von tiefer, aber zufälliger Richtigkeit dagegen der zwischen Alkibiades und Napoleon. Sie sind bei ihm wie bei andern aus einem plutarchischen, d. h. volkstümlich romantischen Geschmack gezogen worden, der lediglich die Ähnlichkeit der Szene auf der Weltbühne ins Auge faßt, nicht mit der Strenge des Mathematikers, der die innere Verwandtschaft zweier Gruppen von Differentialgleichungen erkennt, an denen der Laie nichts sieht als die Verschiedenheit der äußeren Form.
Man bemerkt leicht, daß im Grunde die Laune, nicht eine Idee, nicht das Gefühl einer Notwendigkeit die Wahl der Bilder bestimmt. Von einer Technik der Vergleiche blieben wir weit entfernt. Sie treten, gerade heute, massenhaft auf, aber planlos und ohne Zusammenhang; und wenn sie einmal in einem tiefen, noch festzustellenden Sinne treffend sind, so verdankt man es dem Glück, seltener dem Instinkt, nie einem Prinzip. Noch hat niemand daran gedacht, hier eine Methode auszubilden. Man hat nicht im entferntesten geahnt, daß hier eine Wurzel, und zwar die einzige, liegt, aus der eine große Lösung des Problems der Geschichte hervorgehen kann.
Die Vergleiche könnten das Glück des geschichtlichen Denkens sein, insofern sie die organische Struktur der Geschichte bloßlegen. Ihre Technik müßte unter der Einwirkung einer umfassenden Idee und also bis zur wahllosen Notwendigkeit, bis zur logischen Meisterschaft ausgebildet werden. Sie waren bisher ein Unglück, weil sie als eine bloße Angelegenheit des Geschmacks den Historiker der Einsicht und der Mühe überhoben, die Formensprache der Geschichte und ihre Analyse als seine schwerste und nächste, heute noch nicht einmal begriffene, geschweige denn gelöste Aufgabe zu betrachten. Sie waren teils oberflächlich, wenn man z. B. Cäsar den Begründer einer römischen Staatszeitung nannte, oder, noch schlimmer, äußerst verwickelte und uns innerlich sehr fremde Erscheinungen des antiken Daseins mit heutigen Modeworten wie Sozialismus, Impressionismus, Kapitalismus, Klerikalismus belegte, teils von einer bizarren Verkehrtheit wie der Brutuskult, den man im Jakobinerklub trieb – den jenes Millionärs und Wucherers Brutus, der als Ideologe der oligarchischen Verfassung unter dem Beifall des patrizischen Senats den Mann der Demokratie erstach. [Vgl. Bd. II, S. 1105, Anm. 1.]
3
Und so erweitert sich die Aufgabe, die ursprünglich ein begrenztes Problem der heutigen Zivilisation umfaßte, zu einer neuen Philosophie, der Philosophie der Zukunft, soweit aus dem metaphysisch erschöpften Boden des Abendlandes noch eine solche hervorgehen kann, der einzigen, die wenigstens zu den Möglichkeiten des westeuropäischen Geistes in seinen nächsten Stadien gehört: zur Idee einer Morphologie der Weltgeschichte, der Welt als Geschichte, die im Gegensatz zur Morphologie der Natur, bisher fast dem einzigen Thema der Philosophie, alle Gestalten und Bewegungen der Welt in ihrer tiefsten und letzten Bedeutung noch einmal, aber in einer ganz andern Ordnung, nicht zum Gesamtbilde alles Erkannten, sondern zu einem Bilde des Lebens, nicht des Gewordenen, sondern des Werdens zusammenfaßt.
Die Welt als Geschichte, aus ihrem Gegensatz, der Welt als Natur begriffen, geschaut, gestaltet – das ist ein neuer Aspekt des menschlichen Daseins auf dieser Erde, dessen Herausarbeitung in ihrer ungeheuren praktischen und theoretischen Bedeutung als Aufgabe bis heute nicht erkannt, vielleicht dunkel gefühlt, oft in der Ferne erblickt, nie mit allen ihren Konsequenzen gewagt worden ist. Hier liegen zwei mögliche Arten vor, wie der Mensch seine Umwelt innerlich besitzen und erleben kann. Ich trenne der Form, nicht der Substanz nach mit vollster Schärfe den organischen vom mechanischen Welteindruck, den Inbegriff der Gestalten von dem der Gesetze, das Bild und Symbol von der Formel und dem System, das Einmalig-Wirkliche vom Beständig-Möglichen, das Ziel der planvoll ordnenden Einbildungskraft von dem der zweckmäßig zergliedernden Erfahrung oder, um einen noch nie bemerkten, sehr bedeutungsvollen Gegensatz schon hier zu nennen, den Geltungsbereich der chronologischen von dem der mathematischen Zahl. [Es war ein noch heute nicht überwundener Mißgriff Kants von ungeheurer Tragweite, daß er den äußern und innern Menschen zunächst mit den vieldeutigen und vor allem nicht unveränderlichen Begriffen Raum und Zeit ganz schematisch in Verbindung brachte und weiterhin damit in vollkommen falscher Weise Geometrie und Arithmetik verband, an deren Stelle hier der viel tiefere Gegensatz der mathematischen und chronologischen Zahl wenigstens genannt sein soll. Arithmetik und Geometrie sind beides Raumrechnungen und in ihren höheren Gebieten überhaupt nicht mehr unterscheidbar. Eine Zeitrechnung, über deren Begriff der naive Mensch sich gefühlsmäßig durchaus klar ist, beantwortet die Frage nach dem Wann, nicht dem Was oder Wieviel.]
Es kann sich demnach in einer Untersuchung wie der vorliegenden nicht darum handeln, die an der Oberfläche des Tages sichtbar werdenden Ereignisse geistig-politischer Art als solche hinzunehmen, nach »Ursache« und »Wirkung« zu ordnen und in ihrer scheinbaren, verstandesmäßig faßlichen Tendenz zu verfolgen. Eine derartige – »pragmatische« – Behandlung der Geschichte würde nichts als ein Stück verkappter Naturwissenschaft sein, woraus die Anhänger der materialistischen Geschichtsauffassung kein Hehl machen, während ihre Gegner sich nur der Gleichheit des beiderseitigen Verfahrens nicht hinreichend bewußt sind. Es handelt sich nicht um das, was die greifbaren Tatsachen der Geschichte an und für sich, als Erscheinungen zu irgendeiner Zeit sind, sondern um das, was sie durch ihre Erscheinung bedeuten, andeuten. Die Historiker der Gegenwart glauben ein übriges zu tun, wenn sie religiöse, soziale und allenfalls kunsthistorische Einzelheiten heranziehen, um den politischen Sinn einer Epoche zu »illustrieren«. Aber sie vergessen das Entscheidende – entscheidend nämlich, insofern sichtbare Geschichte Ausdruck, Zeichen, formgewordenes Seelentum ist. Ich habe noch keinen gefunden, der mit dem Studium der morphologischen Verwandtschaft, welche die Formensprache aller Kulturgebiete innerlich verbindet, Ernst gemacht hätte, der über den Bereich politischer Tatsachen hinaus die letzten und tiefsten Gedanken der Mathematik der Hellenen, Araber, Inder, Westeuropäer, den Sinn ihrer frühen Ornamentik, ihrer architektonischen, metaphysischen, dramatischen, lyrischen Grundformen, die Auswahl und Richtung ihrer großen Künste, die Einzelheiten ihrer künstlerischen Technik und Stoffwahl eingehend gekannt, geschweige denn in ihrer entscheidenden Bedeutung für die Formprobleme des Historischen erkannt hätte. Wer weiß es, daß zwischen der Differentialrechnung und dem dynastischen Staatsprinzip der Zeit Ludwigs XIV., zwischen der antiken Staatsform der Polis und der euklidischen Geometrie, zwischen der Raumperspektive der abendländischen Ölmalerei und der Überwindung des Raumes durch Bahnen, Fernsprecher und Fernwaffen, zwischen der kontrapunktischen Instrumentalmusik und dem wirtschaftlichen Kreditsystem ein tiefer Zusammenhang der Form besteht? Selbst die nüchternsten Tatsachen der Politik nehmen, aus dieser Perspektive betrachtet, einen symbolischen und geradezu metaphysischen Charakter an, und es geschieht hier vielleicht zum ersten Male, daß Dinge wie das ägyptische Verwaltungssystem, das antike Münzwesen, die analytische Geometrie, der Scheck, der Suezkanal, der chinesische Buchdruck, das preußische Heer und die römische Straßenbautechnik gleichmäßig als Symbole aufgefaßt und als solche gedeutet werden.
An diesem Punkte stellt es sich heraus, daß es eine theoretisch durchleuchtete Kunst der historischen Betrachtung noch gar nicht gibt. Was man so nennt, zieht seine Methoden fast ausschließlich aus dem Gebiete des Wissens, auf welchem allein Methoden der Erkenntnis zur strengen Ausbildung gelangt sind, aus der Physik. Man glaubt Geschichtsforschung zu treiben, wenn man den gegenständlichen Zusammenhang von Ursache und Wirkung verfolgt. Es ist eine merkwürdige Tatsache, daß die Philosophie alten Stils an eine andere Möglichkeit der Beziehung zwischen dem verstehenden menschlichen Wachsein und der umgebenden Welt nie gedacht hat. Kant, der in seinem Hauptwerk die formalen Regeln der Erkenntnis feststellte, zog, ohne daß er oder irgendein anderer es je bemerkt hätte, allein die Natur als Objekt der Verstandestätigkeit in Betracht. Wissen ist für ihn mathematisches Wissen. Wenn er von angeborenen Formen der Anschauung und Kategorien des Verstandes spricht, so denkt er nie an das ganz anders geartete Begreifen historischer Eindrücke, und Schopenhauer, der von Kants Kategorien bezeichnenderweise allein die der Kausalität gelten läßt, redet nur mit Verachtung von der Geschichte. [Man muß es fühlen können, wie sehr die Tiefe der formalen Kombination und die Energie des Abstrahierens auf dem Gebiete etwa der Renaissanceforschung oder der Geschichte der Völkerwanderung hinter dem zurückbleibt, was für die Funktionentheorie und theoretische Optik selbstverständlich ist. Neben dem Physiker und Mathematiker wirkt der Historiker nachlässig, sobald er von der Sammlung und Ordnung seines Materials zur Deutung übergeht.] Daß außer der Notwendigkeit von Ursache und Wirkung – ich möchte sie die Logik des Raumes nennen – im Leben auch noch die organische Notwendigkeit des Schicksals – die Logik der Zeit – eine Tatsache von tiefster innerer Gewißheit ist, eine Tatsache, welche das gesamte mythologische, religiöse und künstlerische Denken ausfüllt, die das Wesen und den Kern aller Geschichte im Gegensatz zur Natur ausmacht, die aber den Erkenntnisformen, welche die »Kritik der reinen Vernunft« untersucht, unzugänglich ist, das ist noch nicht in den Bereich theoretischer Formulierung gedrungen. Die Philosophie ist, wie Galilei an einer berühmten Stelle seines »Saggiatore« sagt, im großen Buche der Natur »scritta in lingua matematica«. Aber wir warten heute noch auf die Antwort eines Philosophen, in welcher Sprache die Geschichte geschrieben und wie diese zu lesen ist.
Die Mathematik und das Kausalitätsprinzip führen zu einer naturhaften, die Chronologie und die Schicksalsidee zu einer historischen Ordnung der Erscheinung. Beide Ordnungen umfassen, jede für sich, die ganze Welt. Nur das Auge, in dem und durch das sich diese Welt verwirklicht, ist ein anderes.
4
Natur ist die Gestalt, unter welcher der Mensch hoher Kulturen den unmittelbaren Eindrücken seiner Sinne Einheit und Bedeutung gibt. Geschichte ist diejenige, aus welcher seine Einbildungskraft das lebendige Dasein der Welt in bezug auf das eigene Leben zu begreifen und diesem damit eine vertiefte Wirklichkeit zu verleihen sucht. Ob er dieser Gestaltungen fähig ist und welche von ihnen sein waches Bewußtsein beherrscht, das ist eine Urfrage aller menschlichen Existenz.
Hier liegen zwei Möglichkeiten der Weltbildung durch den Menschen vor. Damit ist schon gesagt, daß es nicht notwendig Wirklichkeiten sind. Fragen wir also im folgenden nach dem Sinn aller Geschichte, so ist zuerst eine Frage zu lösen, die bisher nie gestellt worden ist. Für wen gibt es Geschichte? Eine paradoxe Frage, wie es scheint. Ohne Zweifel für jeden, insofern jeder Mensch mit seinem gesamten Dasein und Wachsein Glied der Geschichte ist. Aber es ist ein großer Unterschied, ob jemand unter dem beständigen Eindruck lebt, daß sein Leben ein Element in einem weit größeren Lebenslauf ist, der sich über Jahrhunderte oder Jahrtausende erstreckt, oder ob er es als etwas in sich selbst Gerundetes und Abgeschlossenes empfindet. Sicherlich gibt es für die letztere Art des Wachseins keine Weltgeschichte, keine Welt als Geschichte. Aber wie, wenn das Selbstbewußtsein einer ganzen Nation, wenn eine ganze Kultur auf diesem ahistorischen Geiste beruht? Wie muß ihr die Wirklichkeit erscheinen? Die Welt? Das Leben? Bedenken wir, daß sich im Weltbewußtsein der Hellenen alles Erlebte, nicht nur die eigne persönliche, sondern die allgemeine Vergangenheit alsbald in einen zeitlos unbeweglichen, mythisch gestalteten Hintergrund der jeweils augenblicklichen Gegenwart verwandelte, dergestalt, daß die Geschichte Alexanders des Großen noch vor seinem Tode für das antike Gefühl mit der Dionysoslegende zu verschwimmen begann, und Cäsar seine Abstammung von Venus mindestens nicht als widersinnig empfand, so müssen wir zugestehen, daß uns Menschen des Abendlandes mit dem starken Gefühl für zeitliche Distanzen, aus dem heraus das tägliche Rechnen mit Jahreszahlen nach und vor Christi Geburt etwas Selbstverständliches geworden ist, ein Nacherleben solcher Seelenzustände beinahe unmöglich wird, daß wir aber nicht das Recht haben, dem Problem der Geschichte gegenüber von dieser Tatsache einfach abzusehen.
Was Tagebücher und Selbstbiographien für den einzelnen, das bedeutet Geschichtsforschung im weitesten Umfange, wo sie auch alle Arten psychologisch vergleichender Analyse fremder Völker, Zeiten, Sitten einschließt, für die Seele ganzer Kulturen. Aber die antike Kultur besaß kein Gedächtnis, kein historisches Organ in diesem besonderen Sinne. Das »Gedächtnis« des antiken Menschen – wobei wir allerdings einen aus dem eignen Seelenbilde abgeleiteten Begriff ohne weiteres einer fremden Seele unterlegen – ist etwas ganz anderes, weil hier Vergangenheit und Zukunft als ordnende Perspektiven im Wachsein fehlen und die »reine Gegenwart«, die Goethe an allen Äußerungen antiken Lebens, vor allem an der Plastik so oft bewundert hat, es mit einer uns ganz unbekannten Mächtigkeit ausfüllt. Diese reine Gegenwart, deren größtes Symbol die dorische Säule ist, stellt in der Tat eine Verneinung der Zeit (der Richtung) dar. Für Herodot und Sophokles wie für Themistokles und für einen römischen Konsul verflüchtigt sich die Vergangenheit alsbald in einen zeitlos ruhenden Eindruck von polarer, nicht periodischer Struktur – denn das ist der letzte Sinn durchgeistigter Mythenbildung –, während sie für unser Weltgefühl und inneres Auge ein periodisch klar gegliederter, zielvoll gerichteter Organismus von Jahrhunderten oder Jahrtausenden ist. Dieser Hintergrund aber gibt dem Leben, dem antiken wie dem abendländischen, erst seine besondere Farbe. Was der Grieche Kosmos nannte, war das Bild einer Welt, die nicht wird, sondern ist. Folglich war der Grieche selbst ein Mensch, der niemals wurde, sondern immer war.
Deshalb hat der antike Mensch, obwohl er die strenge Chronologie, die Kalenderrechnung und damit das starke, in großartiger Beobachtung der Gestirne und in der exakten Messung gewaltiger Zeiträume sich offenbarende Gefühl für Ewigkeit und für die Nichtigkeit des gegenwärtigen Augenblicks in der babylonischen und vor allem der ägyptischen Kultur sehr wohl kannte, sich innerlich nichts davon zu eigen gemacht. Was seine Philosophen gelegentlich erwähnen, haben sie nur gehört, nicht geprüft. Und was vereinzelte glänzende Köpfe namentlich asiatischer Griechenstädte wie Hipparch und Aristarch entdeckten, ist von der stoischen wie der aristotelischen Geistesrichtung abgelehnt und außerhalb der engsten Fachwissenschaft überhaupt nicht beachtet worden. Weder Plato noch Aristoteles besaßen eine Sternwarte. In den letzten Jahren des Perikles wurde in Athen ein Volksbeschluß gefaßt, der jeden mit der schweren Klageform der Eisangelie bedrohte, der astronomische Theorien verbreitete. Es war ein Akt von tiefster Symbolik, in dem sich der Wille der antiken Seele aussprach, die Ferne in jedem Sinn aus ihrem Weltbewußtsein zu verbannen.
Was die antike Geschichtsschreibung betrifft, so richte man seinen Blick auf Thukydides. Die Meisterschaft dieses Mannes besteht in der echt antiken Kraft, Ereignisse der Gegenwart aus sich selbst heraus verstehend zu erleben, und dazu kommt jener prachtvolle Tatsachenblick des geborenen Staatsmannes, der selbst Feldherr und Beamter gewesen war. Diese praktische Erfahrung, die man leider mit historischem Sinn verwechselt, läßt ihn geschichtsschreibenden bloßen Gelehrten mit Recht als unerreichtes Muster erscheinen. Was ihm aber vollkommen verschlossen bleibt, ist jener perspektivische Blick über die Geschichte von Jahrhunderten hin, der für uns mit Selbstverständlichkeit zum Begriff des Historikers gehört. Alle guten Stücke antiker Geschichtsdarstellung beschränken sich auf die politische Gegenwart des Autors, im schärfsten Gegensatz zu uns, deren historische Meisterwerke ohne Ausnahme die ferne Vergangenheit behandeln. Thukydides würde schon an dem Thema der Perserkriege gescheitert sein, von einer allgemein griechischen oder gar ägyptischen Geschichte ganz zu schweigen. Bei ihm wie bei Polybios und Tacitus, ebenfalls praktischen Politikern, geht die Sicherheit des Blickes sofort verloren, wenn sie in der Vergangenheit, oft im Abstand weniger Jahrzehnte, auf treibende Kräfte stoßen, die ihnen in dieser Gestalt aus ihrer eigenen Praxis unbekannt sind. Für Polybios ist der erste Punische Krieg, für Tacitus schon Augustus nicht mehr verständlich, und der – an unsrer perspektivischen Forschung gemessen – gänzlich unhistorische Sinn des Thukydides erschließt sich durch die unerhörte Behauptung gleich auf der ersten Seite seines Buches, daß vor seiner Zeit (um 400!) in der Welt Ereignisse von Bedeutung nicht vorgefallen seien ουμεγάλαγενέσθαι [Die ohnehin sehr spät einsetzenden Versuche der Griechen, nach dem Muster Ägyptens etwas wie einen Kalender oder eine Chronologie zustande zu bringen, sind von höchster Naivität. Die Olympiadenrechnung ist keine Ära wie etwa die christliche Zeitrechnung, und außerdem ein später, rein literarischer Notbehelf, nichts dem Volke Geläufiges. Das Volk besaß überhaupt kein Bedürfnis nach einer Zählung, mit welcher man Erlebnisse der Eltern und Großeltern festlegen konnte, mochten einige Gelehrte immerhin sich für das Kalenderproblem interessieren. Es kommt hier nicht darauf an, ob ein Kalender gut ist oder schlecht, sondern ob er im Gebrauch ist, ob das Leben der Gesamtheit danach läuft. Aber auch die Olympionikenliste vor 500 ist eine Erfindung so gut wie die ältere attische Archonten- und die römische Konsulnliste. Von den Kolonisationen gibt es kein einziges echtes Datum (Ed. Meyer, Gesch. d. Alt. II, 442; Beloch, Griech. Gesch. I, 2, 219). »An eine Aufzeichnung von Berichten über historische Begebenheiten hat überhaupt niemand in Griechenland vor dem 5. Jahrhundert gedacht« (Beloch, I, 1, 125). Wir besitzen die Inschrift eines Vertrages zwischen Elis und Heräa, der »hundert Jahre von diesem Jahre an« gelten sollte. Welches Jahr das war, ließ sich aber nicht angeben. Nach einiger Zeit wird man also nicht mehr gewußt haben, wie lange der Vertrag bestand, und offenbar hatte das niemand vorausgesehen. Wahrscheinlich werden diese Gegenwartsmenschen ihn überhaupt bald vergessen haben. Es kennzeichnet den legendenhaft-kindlichen Charakter des antiken Geschichtsbildes, daß man eine geordnete Datierung der Tatsachen etwa des »Trojanischen Krieges«, der der Stufe nach doch unsern Kreuzzügen entspricht, geradezu als stilwidrig empfinden würde. – Ebenso steht das geographische Wissen der Antike weit hinter dem ägyptischen und babylonischen zurück. Ed. Meyer (Gesch. d. Alt. III, 102) zeigt, wie die Kenntnis der Gestalt Afrikas von Herodot (nach persischen Quellen) bis auf Aristoteles gesunken ist. Dasselbe gilt von den Römern als den Erben der Karthager. Sie haben die fremden Kenntnisse erst nacherzählt und dann langsam vergessen.]
Infolgedessen ist die antike Geschichte bis auf die Perserkriege herab, aber auch noch der überlieferte Aufbau sehr viel späterer Perioden das Produkt wesentlich mythischen Denkens. Die Verfassungsgeschichte Spartas – Lykurg, dessen Biographie mit allen Einzelheiten erzählt wird, war vermutlich eine unbedeutende Waldgottheit des Taygetos – ist eine Dichtung der hellenistischen Zeit, und die Erfindung der römischen Geschichte vor Hannibal war noch zur Zeit Cäsars nicht zum Stillstand gekommen. Die Vertreibung der Tarquinier durch Brutus ist eine Erzählung, zu der ein Zeitgenosse des Zensors Appius Claudius (310) Modell gestanden hat. Die Namen römischer Könige sind damals nach den Namen reichgewordener plebejischer Familien geformt worden (K. J. Neumann). Von der »servianischen Verfassung« ganz abgesehen, ist das berühmte licinische Ackergesetz von 367 zur Zeit Hannibals noch nicht vorhanden gewesen (B. Niese). Als Epaminondas die Messenier und Arkader befreit und zu einem Staat gemacht hatte, erfanden sie sich sofort eine Urgeschichte. Das Ungeheuerliche ist nicht, daß dergleichen vorkam, sondern daß es eine andere Art von Geschichte kaum gab. Man kann den Gegensatz des abendländischen und des antiken Sinnes für alles Historische nicht besser zeigen, als wenn man sagt, daß die Römergeschichte vor 250, wie man sie zur Zeit Cäsars kannte, im wesentlichen eine Fälschung, und daß das wenige, was wir festgestellt haben, den späteren Römern ganz unbekannt war. Es kennzeichnet den antiken Sinn des Wortes Geschichte, daß die alexandrinische Romanliteratur stofflich den stärksten Einfluß auf die ernsthafte politische und religiöse Historik ausgeübt hat. Man dachte gar nicht daran, ihren Inhalt von aktenmäßigen Daten grundsätzlich zu unterscheiden. Als Varro gegen Ende der Republik daran ging, die aus dem Bewußtsein des Volkes rasch schwindende römische Religion zu fixieren, teilte er die Gottheiten, deren Dienst vom Staate aufs peinlichste ausgeübt wurde, in di certi und di incerti ein – solche, von denen man noch etwas wußte, und solche, von denen trotz des fortdauernden öffentlichen Kultes nur der Name geblieben war. In der Tat war die Religion der römischen Gesellschaft seiner Zeit – wie sie nicht nur Goethe, sondern selbst Nietzsche ohne Argwohn aus den römischen Dichtern hinnahmen – größtenteils ein Erzeugnis der hellenisierenden Literatur und fast ohne Zusammenhang mit dem alten Kultus, den niemand mehr verstand.
Mommsen hat den westeuropäischen Standpunkt klar formuliert, als er die römischen Historiker – Tacitus ist vor allem gemeint – Leute nannte, »die das sagen, was verschwiegen zu werden verdiente, und das verschweigen, was notwendig war, zu sagen«.
Die indische Kultur, deren Idee vom (brahmanischen) Nirwana der entschiedenste Ausdruck einer vollkommen ahistorischen Seele ist, den es geben kann, hat nie das geringste Gefühl für das »Wann« in irgendeinem Sinne besessen. Es gibt keine echte indische Astronomie, keine indischen Kalender, keine indische Historie also, insofern man darunter den geistigen Niederschlag einer bewußten Entwicklung versteht. Wir wissen vom sichtbaren Verlaufe dieser Kultur, deren organischer Teil mit der Entstehung des Buddhismus abgeschlossen war, noch viel weniger als von der antiken, sicherlich an großen Ereignissen reichen Geschichte zwischen dem 12. und 8. Jahrhundert. Beide sind lediglich in traumhaft-mythischer Gestalt festgehalten worden. Erst ein volles Jahrtausend nach Buddha, um 500 n. Chr., entstand auf Ceylon im »Mahavansa« etwas, das entfernt an Geschichtsschreibung erinnert.
Das Weltbewußtsein des indischen Menschen war so geschichtslos angelegt, daß er nicht einmal die Erscheinung des von einem Autor verfaßten Buches als zeitlich feststehendes Ereignis kannte. Statt einer organischen Reihe persönlich abgegrenzter Schriften entstand allmählich eine vage Textmasse, in die jeder hineinschrieb, was er wollte, ohne daß die Begriffe des individuellen geistigen Eigentums, der Entwicklung eines Gedankens, der geistigen Epoche eine Rolle gespielt hätten. In dieser anonymen Gestalt – es ist die der gesamten indischen Geschichte – liegt uns die indische Philosophie vor. Mit ihr vergleiche man die durch Bücher und Personen physiognomisch aufs schärfste herausgearbeitete Philosophiegeschichte des Abendlandes.
Der indische Mensch vergaß alles, der ägyptische konnte nichts vergessen. Eine indische Kunst des Porträts – der Biographie in nuce – hat es nie gegeben; die ägyptische Plastik kannte kaum ein anderes Thema.
Die ägyptische Seele, eminent historisch veranlagt und mit urweltlicher Leidenschaft nach dem Unendlichen drängend, empfand die Vergangenheit und Zukunft als ihre ganze Welt, und die Gegenwart, die mit dem wachen Bewußtsein identisch ist, erschien ihr lediglich als die schmale Grenze zwischen zwei unermeßlichen Fernen. Die ägyptische Kultur ist eine Inkarnation der Sorge – dem seelischen Gegenwert der Ferne –, der Sorge um das Künftige, wie sie sich in der Wahl von Granit und Basalt als künstlerischem Material, [Demgegenüber ist es ein Symbol ersten Ranges und ohne Beispiel in der Kunstgeschichte, daß die Hellenen ihrer mykenischen Vorzeit gegenüber, und zwar in einem an Steinmaterial überreichen Lande, vom Steinbau zur Verwendung des Holzes zurückkehrten, woraus sich das Fehlen architektonischer Reste zwischen 1200 und 600 erklärt. Die ägyptische Pflanzensäule war von Anfang an Steinsäule, die dorische Säule war eine Holzsäule. Darin spricht sich die tiefe Feindseligkeit der antiken Seele gegen die Dauer aus.] in den gemeißelten Urkunden, in der Ausbildung eines peinlichen Verwaltungssystems und dem Netz von Bewässerungsanlagen ausspricht, [Hat je eine hellenische Stadt auch nur ein umfassendes Werk ausgeführt, das die Sorge um kommende Generationen verrät? Die Straßen- und Bewässerungssysteme, die man in mykenischer, d. h. vorantiker Zeit nachgewiesen hat, sind seit der Geburt antiker Völker – mit dem Anbruch der homerischen Zeit also – verfallen und vergessen worden. Um das Bizarre der Tatsache zu begreifen, daß die Buchstabenschrift von der Antike erst nach 900 angenommen wurde, und zwar in bescheidenstem Umfang und sicherlich nur zu den dringendsten wirtschaftlichen Zwecken, was der Mangel an Inschriftfunden mit Sicherheit beweist, bedenke man, daß in der ägyptischen, babylonischen, mexikanischen und chinesischen Kultur die Ausbildung einer Schrift in grauer Vorzeit beginnt, daß die Germanen sich ein Runenalphabet schufen und später ihre Ehrfurcht vor der Schrift durch die immer wiederholte ornamentale Ausbildung von Zierschriften bezeugten, während die Frühantike die vielen im Süden und Osten gebräuchlichen Schriften durchaus ignorierte. Wir besitzen zahlreiche Schriftdenkmäler aus dem hethitischen Kleinasien und aus Kreta, aus homerischer Zeit nicht ein einziges, vgl. Bd. II, S. 737 ff.] und der notwendig damit verknüpften Sorge um das Vergangene. Die ägyptische Mumie ist ein Symbol vom höchsten Range. Man verewigte den Leib des Toten, wie man seiner Persönlichkeit, dem »Ka«, durch die oft in vielen Exemplaren ausgeführten Bildnisstatuen, an deren in einem sehr hohen Sinne aufgefaßte Ähnlichkeit sie gebunden war, ewige Dauer verlieh.
Es besteht eine tiefe Beziehung zwischen dem Verhalten gegen die historische Vergangenheit und der Auffassung des Todes, wie sie sich in der Form der Bestattung ausspricht. Der Ägypter verneint die Vergänglichkeit, der antike Mensch bejaht sie durch die gesamte Formensprache seiner Kultur. Die Ägypter konservierten auch die Mumie ihrer Geschichte: die chronologischen Daten und Zahlen. Während von der vorsolonischen Geschichte der Griechen nichts überliefert ist, keine Jahreszahl, kein echter Name, kein greifbares Ereignis – was dem uns allein bekannten Rest ein übertriebenes Gewicht gibt –, kennen wir aus dem 3. Jahrtausend und noch weiter zurück die Namen und selbst die genauen Regierungszahlen zahlreicher ägyptischer Könige, und im Neuen Reich muß man ein lückenloses Wissen von ihnen gehabt haben. Als ein grauenvolles Symbol dieses Willens zur Dauer liegen heute noch die Körper der großen Pharaonen mit kenntlichen Gesichtszügen in unseren Museen. Auf der leuchtend polierten Granitspitze der Pyramide Amenemhets III. liest man noch jetzt die Worte: »Amenemhet schaut die Schönheit der Sonne« und auf der andern Seite: »Höher ist die Seele Amenemhets als die Höhe des Orion und sie verbindet sich mit der Unterwelt«. Das ist Überwindung der Vergänglichkeit, der bloßen Gegenwart, und unantik im höchsten Maße.
5
Gegenüber dieser mächtigen Gruppe ägyptischer Lebenssymbole erscheint an der Schwelle der antiken Kultur, der Vergessenheit entsprechend, die sie über jedes Stück ihrer äußern und innern Vergangenheit breitet, die Verbrennung der Toten. Der mykenischen Zeit war die sakrale Heraushebung dieser Bestattungsform aus den übrigen, die von primitiven Völkern der Steinzeit nebeneinander ausgeübt wurden, durchaus fremd. Die Königsgräber sprechen sogar für den Vorrang der Erdbestattung. Aber in homerischer Zeit so gut wie in vedischer erfolgt der plötzliche, nur seelisch zu begründende Schritt vom Begräbnis zur Verbrennung, die, wie die Ilias zeigt, mit dem vollen Pathos eines sinnbildlichen Aktes – der feierlichen Vernichtung, der Verneinung aller historischen Dauer – vollzogen wurde.
Von diesem Augenblick an ist auch die Plastizität der seelischen Entwicklung des Einzelnen zu Ende. Sowenig das antike Drama echt historische Motive gestattet, so wenig läßt es das Thema der innern Entwicklung zu, und man weiß, wie entschieden sich der hellenische Instinkt gegen das Porträt in der bildenden Kunst aufgelehnt hat. Bis in die Kaiserzeit kennt die antike Kunst nur einen ihr gewissermaßen natürlichen Stoff: den Mythos. [Von Homer bis zu den Tragödien Senecas, ein volles Jahrtausend hindurch, erscheinen die mythischen Gestalten wie Thyest, Klytämnestra, Herakles trotz ihrer begrenzten Zahl unverändert immer wieder, während in der Dichtung des Abendlandes der faustische Mensch zuerst als Parzival und Tristan, dann im Sinne der Epoche verwandelt als Hamlet, als Don Quijote, als Don Juan, in einer letzten zeitgemäßen Verwandlung als Faust und Werther und dann als Held des modernen weltstädtischen Romans, immer aber in der Atmosphäre und Bedingtheit eines bestimmten Jahrhunderts auftritt.] Auch die idealen Bildnisse der hellenistischen Plastik sind mythisch, so gut es die typischen Biographien von der Art Plutarchs sind. Kein großer Grieche hat je Erinnerungen niedergeschrieben, die eine überwundene Epoche vor seinem geistigen Auge fixiert hätten. Nicht einmal Sokrates hat über sein Innenleben etwas in unserem Sinne Bedeutendes gesagt. Es fragt sich, ob in einer antiken Seele dergleichen überhaupt möglich war, wie es die Entstehung des Parzival, Hamlet, Werther doch als natürlichen Trieb voraussetzt. Wir vermissen bei Plato jedes Bewußtsein einer Entwicklung seiner Lehre. Seine einzelnen Schriften sind lediglich Fassungen sehr verschiedener Standpunkte, die er zu verschiedenen Zeiten einnahm. Ihr genetischer Zusammenhang war kein Gegenstand seines Nachdenkens. Aber schon am Anfang der abendländischen Geistesgeschichte steht ein Stück tiefster Selbsterforschung, Dantes »Vita Nuova«. Allein daraus folgt, wie wenig Antikes, d. h. rein Gegenwärtiges Goethe in sich hatte, der nichts vergaß, dessen Werke seinen eigenen Worten nach nur Bruchstücke einer großen Konfession waren.
Nach der Zerstörung Athens durch die Perser warf man alle Werke der älteren Kunst in den Schutt – aus dem wir sie heute wieder hervorziehen – und man hat nie gehört, daß jemand in Hellas sich um die Ruinen von Mykene oder Phaistos zum Zwecke der Ermittlung geschichtlicher Tatsachen gekümmert hätte. Man las seinen Homer, aber man dachte nicht daran, wie Schliemann den Hügel von Troja aufzugraben. Man wollte den Mythos, nicht die Geschichte. Von den Werken des Aischylos und der vorsokratischen Philosophen war schon in hellenistischer Zeit ein Teil verloren gegangen. Dagegen sammelte bereits Petrarca Altertümer, Münzen, Manuskripte mit einer nur dieser Kultur eigenen Pietät und Innerlichkeit der Betrachtung als historisch fühlender, auf entlegene Welten zurückschauender, nach dem Fernen sich sehnender Mensch – er war auch der erste, der die Besteigung eines Alpengipfels unternahm –, der im Grunde ein Fremder in seiner Zeit blieb. Die Seele des Sammlers versteht man nur aus seinem Verhältnis zur Zeit. Noch leidenschaftlicher vielleicht, aber von einer andern Färbung ist der chinesische Hang zum Sammeln. Wer in China reist, will »alten Spuren«, ku-tsi, folgen, und nur aus einem tiefen historischen Gefühl ist der unübersetzbare Grundbegriff chinesischen Wesens, tao, zu deuten. [Vgl. Bd. II, S. 910f.] Was dagegen in hellenistischer Zeit allenthalben gesammelt und gezeigt wurde, waren Merkwürdigkeiten von mythologischem Reiz, wie sie Pausanias beschreibt, bei denen das streng historische Wann und Warum überhaupt nicht in Betracht kam, während die ägyptische Landschaft sich schon zur Zeit des großen Thutmosis in ein einziges ungeheures Museum von strenger Tradition verwandelt hatte.
Unter den Völkern des Abendlandes waren es die Deutschen, welche die mechanischen Uhren erfanden, schauerliche Symbole der rinnenden Zeit, deren Tag und Nacht von zahllosen Türmen über Westeuropa hin hallende Schläge vielleicht der ungeheuerste Ausdruck sind, dessen ein historisches Weltgefühl überhaupt fähig ist. [Abt Gerbert (als Papst Sylvester II.), der Freund Kaiser Ottos III., hat um 1000, also mit dem Beginn des romanischen Stils und der Kreuzzugsbewegung, den ersten Symptomen einer neuen Seele, die Konstruktion der Schlag- und Räderuhren erfunden. In Deutschland entstanden auch um 1200 die ersten Turmuhren und etwas später die Taschenuhren. Man bemerke die bedeutsame Verbindung der Zeitmessung mit dem Gebäude des religiösen Kultus.] Nichts davon begegnet uns in den zeitlosen antiken Landschaften und Städten. Bis auf Perikles herab hat man die Tageszeit nur an der Schattenlänge abgeschätzt und erst seit Aristoteles erhält ᾣρα die – babylonische – Bedeutung »Stunde«. Vorher gab es überhaupt keine exakte Einteilung des Tages. In Babylon und Ägypten waren die Wasser- und Sonnenuhren in frühester Zeit erfunden worden, aber erst Plato führte eine als Uhr wirklich verwendbare Form der Klepsydra in Athen ein, und noch später übernahm man die Sonnenuhren, lediglich als unwesentliches Gerät des Alltags, ohne daß sie das antike Lebensgefühl im geringsten verändert hätten.
Hier ist noch der entsprechende, sehr tiefe und nie hinreichend gewürdigte Unterschied zwischen antiker und abendländischer Mathematik zu erwähnen. Das antike Zahlendenken faßt die Dinge auf, wie sie sind, als Größen, zeitlos, rein gegenwärtig. Das führte zur euklidischen Geometrie, zur mathematischen Statik und zum Abschluß des geistigen Systems durch die Lehre von den Kegelschnitten. Wir fassen die Dinge auf, wie sie werden und sich verhalten, als Funktionen. Das führte zur Dynamik, zur analytischen Geometrie und von ihr zur Differentialrechnung. [Bei Newton heißt sie bezeichnenderweise Fluxionsrechnung – mit Rücksicht auf gewisse metaphysische Vorstellungen vom Wesen der Zeit. In der griechischen Mathematik kommt die Zeit gar nicht vor.] Die moderne Funktionentheorie ist die riesenhafte Ordnung dieser ganzen Gedankenmasse. Es ist eine bizarre, aber seelisch streng begründete Tatsache, daß die griechische Physik – als Statik im Gegensatz zur Dynamik – den Gebrauch der Uhr nicht kennt und nicht vermissen läßt und, während wir mit Tausendsteln von Sekunden rechnen, von Zeitmessungen vollständig absieht. Die Entelechie des Aristoteles ist der einzige zeitlose – ahistorische – Entwicklungsbegriff, den es gibt.
Damit ist unsere Aufgabe festgelegt. Wir Menschen der westeuropäischen Kultur sind mit unserem historischen Sinn eine Ausnahme und nicht die Regel, »Weltgeschichte« ist unser Weltbild, nicht das »der Menschheit«. Für den indischen und den antiken Menschen gab es kein Bild der werdenden Welt und vielleicht wird es, wenn die Zivilisation des Abendlandes einmal erloschen ist, nie wieder eine Kultur und also einen menschlichen Typus geben, für den »Weltgeschichte« eine so mächtige Form des Wachseins ist.
6
Ja – was ist Weltgeschichte? Eine geordnete Vorstellung des Vergangenen, ein inneres Postulat, der Ausdruck eines Formgefühls, gewiß. Aber ein noch so bestimmtes Gefühl ist keine wirkliche Form, und so sicher wir alle die Weltgeschichte fühlen, erleben, sie mit vollster Gewißheit ihrer Gestalt nach zu übersehen glauben, so sicher ist es, daß wir noch heute Formen von ihr, aber nicht die Form, das Gegenbild unseres Innenlebens kennen.
Sicherlich wird jeder, den man fragt, überzeugt sein, daß er die innere Form der Geschichte klar und deutlich durchschaut. Diese Illusion beruht darauf, daß niemand ernsthaft über sie nachgedacht hat und daß man noch viel weniger an seinem Wissen zweifelt, weil niemand ahnt, an was allem hier gezweifelt werden könne. In der Tat ist die Gestalt der Weltgeschichte ein ungeprüfter geistiger Besitz, der sich, auch unter Historikern von Beruf, von Generation zu Generation vererbt und dem ein kleiner Teil der Skepsis, welche seit Galilei das uns angeborne Naturbild zergliedert und vertieft hat, sehr not täte.
Altertum – Mittelalter – Neuzeit: das ist das unglaubwürdig dürftige und sinnlose Schema, dessen unbedingte Herrschaft über unser geschichtliches Denken uns immer wieder gehindert hat, die eigentliche Stellung der kleinen Teilwelt, wie sie sich seit der deutschen Kaiserzeit auf dem Boden des westlichen Europa entfaltet, in ihrem Verhältnis zur Gesamtgeschichte des höheren Menschentums nach ihrem Range, ihrer Gestalt, ihrer Lebensdauer vor allem richtig aufzufassen. Es wird künftigen Kulturen kaum glaublich erscheinen, daß dieser Grundriß mit seinem einfältigen geradlinigen Ablauf, seinen unsinnigen Proportionen, der von Jahrhundert zu Jahrhundert unmöglicher wird und eine natürliche Eingliederung der neu in das Licht unseres historischen Bewußtseins tretenden Gebiete gar nicht zuläßt, gleichwohl in seiner Gültigkeit niemals ernstlich erschüttert wurde. Denn es bedeutet gar nichts, wenn es unter Geschichtsforschern längst zur Gewohnheit geworden ist, gegen das Schema Einspruch zu erheben. Sie haben damit den einzig vorhandenen Grundriß nur verwischt, ohne ihn zu ersetzen. Man mag noch so viel von griechischem Mittelalter und germanischem Altertum reden, ein klares und innerlich notwendiges Bild, in dem China und Mexiko, das Reich von Axum und das der Sassaniden einen organischen Platz finden, ist damit nicht gewonnen. Auch die Verlagerung des Anfangspunktes der »Neuzeit« von den Kreuzzügen zur Renaissance und von da zum Beginn des 19. Jahrhunderts beweist nur, daß man das Schema selbst für unerschütterlich hielt.
Es beschränkt den Umfang der Geschichte, aber schlimmer ist, daß es auch ihren Schauplatz begrenzt. Hier bildet die Landschaft des westlichen Europa [Hier steht der Historiker auch unter dem verhängnisvollen Vorurteil der Geographie (um nicht zu sagen unter der Suggestion eines Landkartenbildes), die einen Erdteil Europa annimmt, worauf er sich verpflichtet fühlt, auch eine entsprechende ideelle Abgrenzung gegen »Asien« vorzunehmen. Das Wort Europa sollte aus der Geschichte gestrichen werden. Es gibt keinen »Europäer« als historischen Typus. Es ist töricht, im Falle der Hellenen von »europäischem Altertum« (Homer, Heraklit, Pythagoras waren also »Asiaten«?) und von ihrer »Mission« zu reden, Asien und Europa kulturell anzunähern. Das sind Worte, die aus einer oberflächlichen Interpretation der Landkarte stammen und denen nichts Wirkliches entspricht. Es war allein das Wort Europa mit dem unter seinem Einfluß entstandenen Gedankenkomplex, das Rußland mit dem Abendlande in unserm historischen Bewußtsein zu einer durch nichts gerechtfertigten Einheit verband. Hier hat, in einer durch Bücher erzogenen Kultur von Lesern, eine bloße Abstraktion zu ungeheuren tatsächlichen Folgen geführt. Sie haben, in der Person Peters des Großen, die historische Tendenz einer primitiven Völkermasse auf Jahrhunderte gefälscht, obwohl der russische Instinkt »Europa« sehr richtig und tief mit einer in Tolstoi, Aksakow und Dostojewski verkörperten Feindseligkeit gegen das »Mütterchen Rußland« abgrenzt. Orient und Okzident sind Begriffe von echtem historischem Gehalt. »Europa« ist leerer Schall. Alles, was die Antike an großen Schöpfungen hervorbrachte, entstand unter Negation jeder kontinentalen Grenze zwischen Rom und Cypern, Byzanz und Alexandria. Alles, was europäische Kultur heißt, entstand zwischen Weichsel, Adria und Guadalquivir. Und gesetzt, daß Griechenland zur Zeit des Perikles »in Europa lag«, so liegt es heute nicht mehr dort.] den ruhenden Pol (mathematisch gesprochen, einen singulären Punkt auf einer Kugeloberfläche) – man weiß nicht warum, wenn nicht dies der Grund ist, daß wir, die Urheber dieses Geschichtsbildes, gerade hier zu Hause sind –, um den sich Jahrtausende gewaltigster Geschichte und fernab gelagerte ungeheure Kulturen in aller Bescheidenheit drehen. Das ist ein Planetensystem von höchst eigenartiger Erfindung. Man wählt eine einzelne Landschaft zum natürlichen Mittelpunkt eines historischen Systems. Hier ist die Zentralsonne. Von hier aus erhalten alle Ereignisse der Geschichte ihr wahres Licht. Von hier aus wird ihre Bedeutung perspektivisch abgemessen. Aber hier redet in Wirklichkeit die durch keine Skepsis gezügelte Eitelkeit des westeuropäischen Menschen, in dessen Geiste sich dies Phantom »Weltgeschichte« entrollt. Ihr verdankt man die uns längst zur Gewohnheit gewordene ungeheure optische Täuschung, wonach in der Ferne die Geschichte von Jahrtausenden wie die Chinas und Ägyptens episodenhaft zusammenschrumpft, während in der Nähe des eignen Standortes, seit Luther und besonders seit Napoleon, die Jahrzehnte gespensterhaft anschwellen. Wir wissen, daß nur scheinbar eine Wolke um so langsamer wandert, je höher sie steht, und ein Zug durch eine ferne Landschaft nur scheinbar schleicht, aber wir glauben, daß das Tempo der frühen indischen, babylonischen, ägyptischen Geschichte wirklich langsamer war als das unsrer jüngsten Vergangenheit. Und wir finden ihre Substanz dünner, ihre Formen gedämpfter und gestreckter, weil wir nicht gelernt haben, die – innere und äußere – Entfernung in Rechnung zu stellen.
Daß für die Kultur des Abendlandes das Dasein von Athen, Florenz, Paris wichtiger ist als das von Lo-yang und Pataliputra, versteht sich von selbst. Aber darf man solche Wertschätzungen zur Grundlage eines Schemas der Weltgeschichte machen? Dann hätte der chinesische Historiker das Recht, eine Weltgeschichte zu entwerfen, in der die Kreuzzüge und die Renaissance, Cäsar und Friedrich der Große als belanglos mit Stillschweigen übergangen werden. Warum soll, morphologisch betrachtet, das 18. Jahrhundert wichtiger sein als eins der sechzig voraufgehenden? Ist es nicht lächerlich, eine »Neuzeit« vom Umfang einiger Jahrhunderte, noch dazu wesentlich in Westeuropa lokalisiert, einem »Altertum« gegenüberzustellen, das ebensoviel Jahrtausende umfaßt und dem die Masse aller vorgriechischen Kulturen ohne den Versuch einer tieferen Gliederung einfach als Anhang zugerechnet wird? Hat man nicht, um das verjährte Schema zu retten, Ägypten und Babylon, deren in sich geschlossene Historien, jede für sich, allein die angebliche »Weltgeschichte« von Karl dem Großen bis zum Weltkriege und weit darüber hinaus aufwiegen, als Vorspiel zur Antike abgetan, die mächtigen Komplexe der indischen und chinesischen Kultur mit einer Miene der Verlegenheit in eine Anmerkung verwiesen und die großen amerikanischen Kulturen, weil ihnen der »Zusammenhang« (womit?) fehlt, überhaupt ignoriert?
Ich nenne dies dem heutigen Westeuropäer geläufige Schema, in dem die hohen Kulturen ihre Bahnen um uns als den vermeintlichen Mittelpunkt alles Weltgeschehens ziehen, das ptolemäische System der Geschichte und ich betrachte es als die kopernikanische Entdeckung im Bereich der Historie, daß in diesem Buche ein System an seine Stelle tritt, in dem Antike und Abendland neben Indien, Babylon, China, Ägypten, der arabischen und mexikanischen Kultur – Einzelwelten des Werdens, die im Gesamtbilde der Geschichte ebenso schwer wiegen, die an Großartigkeit der seelischen Konzeption, an Gewalt des Aufstiegs die Antike vielfach übertreffen – eine in keiner Weise bevorzugte Stellung einnehmen.
7
Das Schema Altertum-Mittelalter-Neuzeit ist in seiner ersten Anlage eine Schöpfung des magischen Weltgefühls, welche zuerst in der persischen und jüdischen Religion seit Kyros Vgl. Bd. II, S. 31 f., 848. hervortrat, in der Lehre des Buches Daniel von den vier Weltaltern eine apokalyptische Fassung erhielt und in den nachchristlichen Religionen des Ostens, vor allem den gnostischen Systemen, Windelband, Gesch. d. Phil. (1900), S. 275 ff. zu einer Weltgeschichte ausgestaltet wurde.
Innerhalb der sehr engen Grenzen, welche die geistige Voraussetzung dieser bedeutenden Konzeption bilden, bestand sie durchaus zu Recht. Hier fällt weder die indische noch selbst die ägyptische Geschichte in den Kreis der Betrachtung. Das Wort Weltgeschichte bezeichnet im Munde dieser Denker einen einmaligen, höchst dramatischen Akt, dessen Schauplatz die Landschaft zwischen Hellas und Persien war. In ihm gelangt das streng dualistische Weltgefühl des Morgenländers zum Ausdruck, nicht polar wie in der gleichzeitigen Metaphysik durch den Gegensatz von Seele und Geist, Gut und Böse, sondern periodisch, [Im neuen Testament ist die polare Fassung mehr durch die Dialektik des Apostels Paulus, die periodische durch die Apokalypse vertreten.] als Katastrophe angeschaut, als Wende zweier Zeitalter zwischen Weltschöpfung und Weltuntergang, unter Absehen von allen Elementen, die nicht einerseits durch die antike Literatur, andrerseits durch die Bibel oder das heilige Buch, das in dem betreffenden System deren Stelle einnahm, fixiert waren. In diesem Weltbilde erscheint als »Altertum« und »Neuzeit« der damals handgreifliche Gegensatz von heidnisch und jüdisch oder christlich, antik und orientalisch, Statue und Dogma, Natur und Geist in zeitlicher Fassung, als Schauspiel der Überwindung des einen durch das andere. Der historische Übergang trägt die religiösen Merkmale einer Erlösung. Ohne Zweifel ein auf engen, durchaus provinzialen Ansichten beruhender, aber logischer und in sich vollkommener Aspekt, der indessen an dieser Landschaft und diesem Menschentum haftete und keiner natürlichen Erweiterung fähig war.
Erst durch die Hinzufügung eines dritten Zeitalters – unserer »Neuzeit« – auf abendländischem Boden ist in das Bild eine Bewegungstendenz gekommen. Das orientalische Bild war ruhend, eine geschlossene, im Gleichgewicht verharrende Antithese, mit einer einmaligen göttlichen Aktion als Mitte. Von einer ganz neuen Art Mensch aufgenommen und getragen, wurde es nun plötzlich, ohne daß man sich des Bizarren einer solchen Änderung bewußt geworden wäre, in Gestalt einer Linie fortgesponnen, die von Homer oder Adam – die Möglichkeiten sind heute durch die Indogermanen, die Steinzeit und den Affenmenschen bereichert – über Jerusalem, Rom, Florenz und Paris hinauf oder hinab führte, je nach dem persönlichen Geschmack des Historikers, Denkers oder Künstlers, der das dreiteilige Bild mit schrankenloser Freiheit interpretierte.
Man fügte also den komplementären Begriffen Heidentum und Christentum den abschließenden einer »Neuzeit« hinzu, die ihrem Sinne nach eine Fortsetzung des Verfahrens nicht gestattet, und, nachdem sie seit den Kreuzzügen wiederholt »gestreckt« worden ist, einer weiteren Dehnung nicht fähig erscheint. [Der verzweifelte und lächerliche Ausdruck »Neueste Zeit« läßt das erkennen.] Man war, ohne es auszusprechen, der Meinung, daß hier jenseits von Altertum und Mittelalter etwas Endgültiges beginne, ein drittes Reich, in dem irgendwie eine Erfüllung lag, ein Höhepunkt, ein Ziel, das erkannt zu haben von den Scholastikern an bis zu den Sozialisten unserer Tage jeder sich allein zuschrieb. Es war das eine ebenso bequeme als für ihren Urheber schmeichelhafte Einsicht in den Lauf der Dinge. Man hatte ganz einfach den Geist des Abendlandes, wie er sich im Kopfe eines einzelnen spiegelte, mit dem Sinn der Welt gleichgesetzt. Aus einer geistigen Not haben dann große Denker eine metaphysische Tugend gemacht, indem sie das durch den consensus omnium geheiligte Schema, ohne es einer ernsthaften Kritik zu unterziehen, zur Basis einer Philosophie erhoben und als Urheber ihres jeweiligen »Weltplanes« Gott bemühten. Die mystische Dreizahl der Weltalter hatte für den metaphysischen Geschmack ohnehin etwas Verführerisches. Herder nannte die Geschichte eine Erziehung des Menschengeschlechts, Kant eine Entwicklung des Begriffs der Freiheit, Hegel eine Selbstentfaltung des Weltgeistes, andere anders. Wer aber in die schlechthin gegebene Dreizahl der Abschnitte einen abstrakten Sinn gelegt hatte, glaubte über die Grundformen der Geschichte genügend nachgedacht zu haben.
Gleich an der Schwelle abendländischer Kultur erscheint der große Joachim von Floris († 1202), [Burdach, Reformation, Renaissance, Humanismus (1918), S. 48 ff.] der erste Denker vom Schlage Hegels, der das dualistische Weltbild Augustins zertrümmert und mit dem Vollgefühl des echten Gotikers das neue Christentum seiner Zeit als etwas Drittes der Religion des Alten und Neuen Testaments entgegenstellt: die Zeitalter des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Er hat die besten Franziskaner und Dominikaner, Dante, Thomas bis ins Innerste erschüttert und einen Weltblick geweckt, der langsam von dem ganzen Geschichtsdenken unserer Kultur Besitz ergriff. Lessing, der seine Zeit im Hinblick auf die Antike manchmal geradezu als Nachwelt [Der Ausdruck »Die Alten« kommt schon, dualistisch gemeint, in der Isagoge des Porphyrius (um 300 n. Chr.) vor.] bezeichnet, hat den Gedanken für seine »Erziehung des Menschengeschlechts« (mit den Stufen des Kindes, Jünglings und Mannes) aus den Lehren der Mystiker des 14. Jahrhunderts übernommen, und Ibsen, der ihn in seinem Drama »Kaiser und Galiläer« (wo das gnostische Weltdenken in der Gestalt des Zauberers Maximos unmittelbar hineinragt) gründlich behandelte, ist in seiner bekannten Stockholmer Rede von 1887 keinen Schritt darüber hinausgekommen. Augenscheinlich ist es eine Forderung des westeuropäischen Selbstgefühls, mit der eignen Erscheinung eine Art Abschluß zu statuieren.
Aber die Schöpfung des Abtes von Floris war ein mystischer Blick in die Geheimnisse der göttlichen Weltordnung. Sie mußte jeden Sinn verlieren, sobald sie verstandesmäßig gefaßt und zur Voraussetzung wissenschaftlichen Denkens gemacht wurde. Und das ist in immer steigendem Maße seit dem 17. Jahrhundert geschehen. Aber es ist eine völlig unhaltbare Methode, Weltgeschichte zu deuten, wenn man seiner politischen, religiösen oder sozialen Überzeugung die Zügel schießen und den drei Phasen, an denen man nicht zu rütteln wagt, eine Richtung angedeihen läßt, die genau dem eignen Standort zuführt und, je nachdem, die Herrschaft des Verstandes, die Humanität, das Glück der Meisten, die wirtschaftliche Evolution, die Aufklärung, die Freiheit der Völker, die Unterwerfung der Natur, den Weltfrieden und dergleichen als absoluten Maßstab an Jahrtausende anlegt, von denen man beweist, daß sie das Richtige nicht begriffen oder nicht erreicht haben, während sie in Wirklichkeit nur etwas anderes wollten als wir. »Es kommt offenbar im Leben aufs Leben und nicht auf ein Resultat desselben an« – das ist ein Wort Goethes, das man allen törichten Versuchen, das Geheimnis der historischen Form durch ein Programm zu enträtseln, entgegenstellen sollte.
Das gleiche Bild wird von den Historikern jeder einzelnen Kunst und Wissenschaft, Nationalökonomie und Philosophie nicht zu vergessen, gezeichnet. Da sehen wir »die« Malerei von den Ägyptern (oder den Höhlenmenschen) bis zu den Impressionisten, »die« Musik vom blinden Sänger Homers bis nach Bayreuth, »die« Gesellschaftsordnung von den Pfahlbaubewohnern bis zum Sozialismus in linienhaftem Aufstieg begriffen, dem irgend eine gleichbleibende Tendenz zugrunde gelegt wird, ohne daß man die Möglichkeit ins Auge faßt, daß Künste eine gemessene Lebensdauer besitzen, daß sie an eine Landschaft und eine bestimmte Art Mensch als deren Ausdruck gebunden sind, daß also diese Gesamtgeschichten lediglich die äußerliche Summierung einer Anzahl von Einzelentwicklungen, von Sonderkünsten sind, die nichts als den Namen und einiges von der handwerklichen Technik gemein haben.
Von jedem Organismus wissen wir, daß Tempo, Gestalt und Dauer seines Lebens und jeder einzelnen Lebensäußerung durch die Eigenschaften der Art, zu welcher er gehört, bestimmt sind. Niemand wird von einer tausendjährigen Eiche vermuten, daß sie eben jetzt im Begriff ist, mit dem eigentlichen Lauf ihrer Entwicklung zu beginnen. Niemand erwartet von einer Raupe, die er täglich wachsen sieht, daß sie möglicherweise ein paar Jahre damit fortfährt. Hier hat jeder mit unbedingter Gewißheit das Gefühl einer Grenze