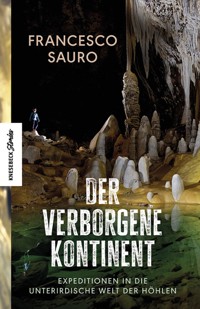
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knesebeck Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Eine abenteuerliche Expedition zu den Geheimnissen unter der Erdoberfläche Der letzte unerforschte Kontinent liegt direkt unter unseren Füßen und wartet auf diejenigen, die sich in seine Höhlen wagen und seine verborgenen Seen und Flüsse befahren. Höhlenforscher Francesco Sauro nimmt uns mit auf eine spannende Entdeckungsreise in das unterirdische Reich voller Geheimnisse und Abenteuer. Von den Höhlen der Dolomiten zu den vulkanischen Grotten der Galapagosinseln, von den unterirdischen Bächen Grönlands bis zu den Klüften des Himalaya zeigt Der verborgene Kontinent, was die Wissenschaft über diese letzte Grenze unseres Planeten erzählen kann. Eine fesselnde Expedition in die Welt unter der Erde – und zugleich eine Erkundung der Grenzen der Menschheit. Packende Reportage und spannende wissenschaftliche Einblicke Die Welt unter der Erdoberfläche ist das letzte unerforschte Gebiet unseres Planeten. Ein geheimnisvolles Universum, ein Tunnelnetz, in dem man auf gewaltige Wasserfälle, leuchtende Kreaturen, mysteriöse Echos, höllische Dämpfe und vor allem sehr viel Dunkelheit und Unbekanntes stößt. Francesco Sauro faszinieren Höhlenwelten schon seit seiner Kindheit. In Der verborgene Kontinent berichtet er packend und mitreißend von seinen Expeditionen in diese unerforschten Welten. Er schildert, welche Überraschungen die unterirdischen Höhlenwelten bereithalten, wie enorm wichtig die Erkenntnisse für die Zukunft von Wissenschaft und Forschung sind und bringt so ein wenig Licht ins Dunkel dieser geheimnisvollen Welt. Kommen Sie mit auf eine Entdeckungsreise in den unterirdischen Kosmos aus Höhlen und Labyrinthen, Tunneln und Kammern, Brunnen und Seen – ein geheimnisvolles und faszinierendes Netzwerk, das die letzte unerforschte Grenze unseres Planeten darstellt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 380
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
FRANCESCO SAURO
Der verborgene Kontinent
EXPEDITIONEN IN DIE UNTERIRDISCHE WELT DER HÖHLEN
Aus dem Italienischenvon Ingrid Ickler
Questo libro è stato tradotto grazie ad un contributo alla traduzione assegnato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano.
Der Verlag dankt dem italienischen Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und internationale Kooperation, das die Übersetzung dieses Buches gefördert hat.
Titel der Originalausgabe: Il continente buio. Caverne, grotte e misteri sotterranei. Alla scoperta del mondo sotto i nostri piedi
Erschienen bei Il Saggiatore, Milano (Italien)
Copyright © 2021 Il Saggiatore
Die deutsche Ausgabe wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Michael Gaeb, Berlin.
Deutsche Erstausgabe
Copyright © 2023 von dem Knesebeck GmbH & Co. Verlag KG, München
Ein Unternehmen der Média-Participations
Projektleitung: Dr. Hans Peter Buohler
Übersetzung: Ingrid Ickler, Bensheim
Lektorat: Christiane Burkhardt, München
Gestaltung: Favoritbüro, München
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
Herstellung: Arnold & Domnick, Leipzig
ISBN 978-3-95728-798-4
Gedruckt ist folgende Ausgabe erhältlich:
ISBN 978-3-95728-683-3
Alle Rechte vorbehalten, auch auszugsweise.
www.knesebeck-verlag.de
In memoriam
Giovanni Badino, Giuseppe Troncon, Gianni Cergol,
Freunde, Lehrer und Entdecker des dunklen Kontinents
Nul être humain ne nous a précédé dans ces profondeurs, nul ne sait où nous allons ni ce que nous voyons, rien d’aussi étrangement beau ne s’est jamais présenté à nos yeux, ensemble et spontanément nous nous posons la même question réciproque: est-ce que nous ne rêvons pas?
Kein Mensch vor uns ist bis in diese Tiefen vorgedrungen, niemand weiß, wohin wir gehen und was uns erwartet, nichts von solch bizarrer Pracht bekamen wir je zu sehen, und spontan stellen wir uns die Frage: Ist das nicht alles nur ein Traum?
Édouard-Alfred Martel, Les Causses du Languedoc, 1889
Inhalt
Einführung
Erster Teil Im Inneren der Erde
Die Schwelle
Die Dunkelheit
Die Stille
Die Tiefe
Das Labyrinth
Die Zeit
Die Extreme
Bildteil
Zweiter Teil Die letzten Entdecker
Der Fluss und das Licht
Homo Explorator
Odyssee
Dritter Teil Andere Welten
Verlorene Welten
Die dunkle Seite
Der Ausgang
Dank
Über den Autor
Einführung
Ich habe die ganze Zeit über berichtet. Die Sterne, der Himmel, die vollkommen schwarze Farbe des Himmels. Die Sterne sind etwas deutlicher zu sehen, es sind leuchtende Punkte, die sich sehr schnell im Sichtfenster bewegen. Der Horizont ist sehr schön. Die Krümmung der Erde ist zu erkennen. Um die Erde herum, direkt an der Oberfläche, ist die Farbe ganz zartblau, dann wird sie immer dunkler. Erst Rottöne, dann wird es vollkommen schwarz.«
Wir schreiben den 13. April 1961. Am Vortag ist Juri Gagarin als erster Mensch in den Weltraum geflogen und hat mit seinem Raumschiff einmal die Erde umrundet. Nun kann er seine Sicht auf unseren Planeten schildern, die Krümmung der Erde, die Dunkelheit des Weltraums, das Blau der Atmosphäre.
So fasst er in Worte, was ein Mensch zum allerersten Mal wahrnehmen kann: die Erde in ihrer Gesamtheit, eine ins Weltall geworfene Kugel.
Diese eindrucksvolle Beschreibung schien damals das Ende der Erkundung unseres Planeten und den Beginn der Erforschung des Weltraums einzuläuten. Die Kontinente konnten auf einen Blick wahrgenommen werden, die Meere, die Berge, die Seen, die Wüsten und Wälder – all das war nicht länger nur bildliche Darstellung, sondern faktische Realität. Von oben betrachtet blieb nur der Kontrast zwischen der Farbenpracht der Erde und der undurchdringlichen Finsternis des Universums, das sie umgab.
Doch unsere Entdeckungsreise bis zu dieser Komplettansicht der Erde begann schon weit vor diesem Frühlingstag, nämlich vor mehr als 200 000 Jahren in einer afrikanischen Savanne. Anfangs wurde unsere Umwelt nur als Ressource für das Überleben des Menschen wahrgenommen. Jeder Schritt jenseits des Sichtbaren hatte das Ziel, unsere Grenzen und Möglichkeiten zu erweitern, neue Territorien zu erobern und unbekannte Landschaften zu erkunden. Der Mensch war schon ein Entdecker, bevor ihm das überhaupt bewusst wurde. Die Welt endete an den Grenzen des Bekannten, dahinter lagen Dunkelheit und Legenden. Bei dieser mühsamen Erforschung neuer Territorien, bei dem Wunsch, bestehende Grenzen zu überwinden, war die Höhle eine Art Welt im Kleinen. Häufig wurde sie als Schutzraum gegen unwirtliche Witterungsverhältnisse genutzt. Je weiter man in die Höhle vordrang, desto dunkler wurde es: eine unüberwindliche Finsternis, in der sich furchteinflößende Geschöpfe zu verstecken schienen.
Die Entdeckung des Feuers erlaubte den ersten Schritt, in diesem Moment begann sich der Mensch seiner selbst bewusst zu werden. Der ständige Widerstreit zwischen Angst und Neugier sorgte dafür, dass dem Vordringen in Höhlen und in die Welt unter der Erdoberfläche schon immer ein gewisser Zauber anhaftete. Das Feuer war zweifellos ein Freund, aber seine Flammen konnten nur einen Teil der Dunkelheit erhellen, bevor sie wieder erloschen und den Entdecker in der Dunkelheit zurückließen. Alles, was dahinterlag, was man glaubte, in den Schatten erkannt zu haben, war Imagination. Und es stellten sich die gleichen Fragen wie bei der Betrachtung des Himmels in einer sternenklaren Nacht.
Während die Unterwelt ein Mysterium blieb, ging die Erforschung der Erdoberfläche weiter. Vor 30 000 Jahren erkundeten wir große Teile Europas und Australiens. Vor 25 000 Jahren drangen wir zu Fuß von Sibirien bis nach Nordamerika vor, weil sich während der damaligen Eiszeit durch das Absinken des Meeresspiegels eine Landbrücke gebildet hatte. Anschließend überwanden wir Wälder und Bergketten in verschiedenen Klimazonen, entdeckten neue Lebewesen und unbekannte Landschaften, bis wir vor 14 000 Jahren nach einer 35 000 Kilometer langen Reise quer durch die amerikanischen Kontinente Patagonien erreichten. Vor etwas mehr als 1000 Jahren hatte der Mensch fast alle bewohnbaren Gebiete erforscht, war im Norden bis nach Grönland und im Süden bis nach Neuseeland vorgedrungen. Trotzdem verschwanden manche Gebiete im Lauf der Generationen wieder aus unserem Blickfeld, als hätte sich ein Schleier darübergelegt. Nur wenige Regionen wurden konkret wahrgenommen, während der Blick auf andere durch die zeitliche und räumliche Distanz sowie durch jeweils vorherrschende Glaubenssätze verzerrt wurde.
Als diese lange Entdeckungsreise an der Erdoberfläche langsam ihrem Ende entgegenging, meldete sich das Forschergen des Menschen. Vielleicht war es die Entstehung der Epen und der Schrift, die uns die Möglichkeit gab, unsere wahre Natur zu erkennen. Der blinde Homer konnte die Welt durch Odysseus’ Augen sehen und von ihr erzählen. Dieser staunende Blick auf die Wunder der Natur, auf Meeresungeheuer, unbekannte Inseln, Männer und Frauen, die sich unter den Völkern der Erde verirrten – all das machte Angst und sorgte dafür, dass man wieder strenge Grenzen zog, die nicht einmal in der Fantasie überschritten werden durften. Aber der Drang nach Wissen lässt sich nicht aufhalten, wie Dante im 26. Gesang des Inferno erzählt, wenn Odysseus zwischen den Säulen des Herkules hindurchfährt, um dann vom Meer verschlungen zu werden, weil er die Grenzen menschlichen Wissens überschritten hatte.
Christoph Kolumbus überquerte 1492 mit drei Karavellen den Atlantik, um schließlich Amerika zu erreichen. Er war nicht nur der Entdecker, sondern bereitete den Weg, mit dessen Hilfe die Geografie der Welt allmählich als Ganzes wahrgenommen wurde. Jetzt waren die Meere die Oberfläche, die es zu entdecken galt, ein zusammenhängender homogener Raum, das Bindeglied zwischen den Kontinenten. Bald danach umsegelte Magellan die Erde und lieferte damit den praktischen Beweis, dass die Erde eine Kugel ist. Die Wahrnehmung der Welt war auf den Kopf gestellt. Jeder Ort konnte gleichzeitig Anfangs- und Endpunkt einer Erdumrundung sein. Die Erdoberfläche war plötzlich begrenzt und nicht mehr unendlich, man nahm deutlich ihre Grenzen wahr. Und diese Grenzen waren nicht mehr der Rand einer Karte, sondern das, was sich über und unter uns befand. Unser irdisches Paradies lag zwischen Himmel und Erde. Weiter ging es nicht.
Und dennoch gab es auf der Erde immer noch unbekannte Orte, an denen die Umweltbedingungen wie die Höhe über dem Meeresspiegel oder die Temperatur ein Überleben ohne technische Hilfsmittel oder die Anpassung des menschlichen Körpers unmöglich machten. Es sollte allerdings weniger als ein Jahrhundert dauern, um auch diese Gebiete zu erobern. Die Entdeckung der Pole ist eines der faszinierendsten Kapitel der Menschheitsgeschichte, auch wenn es darin kaum mehr als einen Wimpernschlag einnahm. Die Überwindung von Tausenden Kilometern Kontinental- oder Meereis, nur weil man die äußersten Punkte des Planeten erreichen will, führte uns weit aus unserer »Komfortzone« heraus. Aber diesen Menschen ging es nicht ums Überleben, ihr Antrieb war reiner Wissensdrang. Südpol und Nordpol sind nicht nur entgegengesetzte geografische Orte, sie bilden auch die Endpunkte der Achse, um die sich die Erde dreht. Als Roald Amundsen und Robert Falcon Scott zu Beginn des letzten Jahrhunderts im Abstand von wenigen Wochen den Südpol erreichten, fanden sie außer einem riesigen Eisschild nichts Besonderes vor. Um die Bedeutung dieses Moments zu verstehen, musste man die Position der Erde im Universum begriffen haben. Es war das erste Mal, dass Expeditionen ausgeschickt wurden und Menschen bereit waren, ihr Leben zu riskieren, nur um eine geografische Entdeckung zu machen. Und tatsächlich: Scott und seine Männer starben auf der Rückkehr zum Basislager.
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde auch der höchste Berg der Erde bezwungen. Die göttliche Mutter der Erde, der Chomolungma, besser bekannt als Mount Everest, wurde zum ersten Mal von Menschen betreten. Tenzing Norgay und Edmund Hillary erklommen seinen Gipfel im Jahr 1953. Wenige Jahre später, 1960, erreichte das Tiefseetauchboot Triest mit Jacques Piccard und Don Walsh an Bord in 10 916 Metern unter dem Meeresspiegel den tiefsten Punkt der Erde im Marianengraben. Genau wie im Weltall herrscht auch in der Tiefsee eine undurchdringliche Dunkelheit. Die Technologie hatte auch diese Herausforderung bezwungen.
Etwa zur gleichen Zeit umrundete das Raumschiff Wostok 1 die Erde. Endlich konnte die Erde in ihrer Gesamtheit vom Menschen aus dem Orbit betrachtet werden. Während dieses ersten bemannten Weltraumfluges, der weniger als zwei Stunden dauerte, sagte Gagarin mehr als zwanzigmal in einer Stunde den Satz »Vizu Zemlju«, »ich sehe die Erde«.Das Sehenkönnen ändert alles. Zum Beispiel nachdem wir am Fuße eines hohen Berges standen und uns schon den Gipfel ausmalten, obwohl wir noch nie dort gewesen waren. Oder nachdem wir den Ozean hinterm Horizont aus dem Blick verloren haben: Erst dieses Sehenkönnen ermöglicht so etwas wie Geografie.
Aber was geschieht, wenn wir nichts sehen können? Auf seiner Entdeckungsreise hat der Mensch den Ort bisher eher gemieden, der komplett im Dunkeln liegt: die Höhle. In diesem Hohlraum unter der Erde sind die Grenzen vom letzten Licht der Taschenlampe vorgegeben. Die Dunkelheit, die sich direkt unter unseren Füßen erstreckt, können wir uns nur vorstellen, aber nicht sehen. Und dort, am Übergang zwischen Licht und totaler Finsternis, an der Grenze zwischen Realität und Vorstellung, beginnt der dunkle Kontinent, das Thema dieses Buches.
Ich hatte in den letzten zwanzig Jahren das Privileg, überall auf der Welt unter die Erdoberfläche schauen zu können. Das Bild, das wir davon haben, ist gezwungenermaßen lückenhaft, denn der dunkle Kontinent ist kein Berg, den man betrachten kann, ohne ihn zu besteigen. Die unterirdische Welt der Höhlen kann nur Schritt für Schritt entdeckt werden, indem man immer weiter in sie vordringt. Das ist schon seit Tausenden von Jahren so, als der Homo sapiens erstmals eine Höhle betrat und damit die Grenzen seiner Wahrnehmung überwand. Auch in einer Zeit, in der uns Sonar-, Radar- und Satellitentechnik erlauben, sogar den Meeresboden hochauflösend abzubilden, in der wir die Baumkronen der Regenwälder durchdringen und den Boden darunter genau visualisieren können, gibt es noch kein Instrument, das das Erdinnere sichtbar macht. Damit ist der dunkle Kontinent die letzte große Barriere für den menschlichen Erkundungsdrang. Ein Ort, an dem wir noch spielen und unsere Entdeckerlust ausleben können.
In all den Jahren war ich überall unterwegs, von Europa bis Zentralasien, in Wüsten und in den Wäldern Mexikos, im Grönlandeis, unter philippinischen Stränden und in den Urwäldern des Ural, in den Vulkankratern der Kanarischen Inseln und den Gletschern der Alpen, bis hin zu den Gebirgen des Amazonasgebiets in Brasilien, Kolumbien und Venezuela. Ich habe Wege kartiert, die mehr als 1000 Meter unter der Erdoberfläche liegen. Trotz aller Erfahrung komme ich noch immer aus dem Staunen nicht heraus. Bei meinen Expeditionen habe ich viele Gleichgesinnte und Weggefährten getroffen, die in der Höhlenforschung ihre Erfüllung gefunden haben.
Ich denke, es ist an der Zeit, Licht ins Dunkel dieser geheimnisvollen Welt zu bringen. Doch diesen Schleier zu lüften, kann bedeuten, die Unterwelt ihrer Faszination zu berauben, sie der Realität preiszugeben. Aber das macht mir keine Sorgen, denn die Magie wird bleiben. Ich habe immer wieder erlebt, dass der dunkle Kontinent in Wirklichkeit noch aufregender ist, als er es in meiner Vorstellung je hätte sein können.
Egal, ob ein Kind oder ein Wissenschaftler diese Entdeckungsreise unternimmt: Die Perspektive bleibt die gleiche. Egal, ob man diese Welt aus dem Blickwinkel der Vernunft oder der Philosophie jahrtausendealter Mythen betrachtet: Sie fühlt sich immer wie etwas Heiliges an. Man steht jedes Mal wieder vor neuen Rätseln und muss akzeptieren, dass es keine Gewissheiten gibt.
Der Begriff Speläologie stammt vom griechischen spélaion (»Höhle«) und logos (»Lehre«). Es geht dabei um Höhlen, ihre Beschaffenheit, ihre Erkundung, aber auch darum, von dem Schatten zu erzählen, den der Mensch in ihrem Inneren geworfen hat. Deshalb habe ich dieses Buch in drei Teile gegliedert. Der erste beschäftigt sich mit der Höhle selbst und ihren wesentlichen Elementen, mit der Schwelle, der Dunkelheit und der Stille. Die Betrachtung der Gesamtheit des dunklen Kontinents besteht aus der Tiefe des Abgrunds, die sich in den Gängen des Labyrinths fortsetzt, in denen man unzählige Richtungen einschlagen kann und sich dennoch verläuft. Man sollte sich unbedingt bewusst machen, dass dort auch die vierte Dimension eine wichtige Rolle spielt: die Zeit. Einige Höhlen sind Millionen von Jahren alt, andere flüchtiger als ein Menschenleben. Auf dem Weg in die Tiefe suchen wir nach Wurzeln, entdecken auf unserer Reise ins Erdinnere Hohlräume, Vulkane, Lavaströme und wie diese mit der Energie im Kern unseres Planeten verbunden sind. Bis wir schließlich die tiefsten Erdschichten erreichen, Orte, wo selbst unsere Vorstellungskraft an Grenzen stößt.
Den zweiten Teil widme ich den letzten geografischen Entdeckern unserer Zeit: den Speläologen. Ihre Forscherleidenschaft und ihre Begeisterung für das Unbekannte haben eine Geschichte geschrieben, die die letzten zwei Jahrhunderte umspannt und die dazu beigetragen hat, den dunklen Kontinent näher zu bestimmen. Höhlenforscher mögen manchmal etwas verrückt wirken und unverständlich klingen, aber sie sind bereit, alles zu geben und unglaubliche Risiken einzugehen, nur um einen weiteren Meter zu erforschen. Während meiner Arbeit hatte ich das Glück, mit Wissenschaftlern aus allen möglichen Fachgebieten zusammenzuarbeiten. Mit Erstaunen habe ich festgestellt, dass Speläologen Astronauten nicht unähnlich sind. Beide erkunden auf den ersten Blick konträre Sphären, die aber bei näherer Betrachtung durchaus Ähnlichkeiten haben. Beide beschäftigen sich mit der Dunkelheit – die einen im Erdinneren, die anderen im Universum. Es ist kein Zufall, dass ich meine Einleitung mit Gagarins Worten begonnen habe.
Im dritten Teil des Buches geht es schließlich darum, wie ich mir andere dunkle Kontinente vorstelle: die geheimnisvollen Höhlensysteme in den Tepuis Venezuelas, die gigantischen Lavabecken unter der grauen Mondoberfläche oder die tiefen Krater auf der roten Marsoberfläche. Es ist keine Reise zu bekannten Gefilden, sondern eine Suche nach dem, was sein könnte, was aber noch jenseits unseres Horizonts liegt. Nach dem »unbeschriebenen Blatt« jenseits unserer geografischen Karten. Das Streben danach, immer mehr Grenzen zu überschreiten, bildet die Grundlage der Menschheitsgeschichte, ja vielleicht sogar die des Lebens selbst.
Erster TeilIm Inneren der Erde
Die Schwelle
Das erste Gefühl ist Angst. Sie erfasst einen, ja flutet einen, und der Puls beschleunigt sich. Instinktiv will man den Blick abwenden, an etwas anderes denken, so tun, als gäbe es die Öffnung im Fels gar nicht. Ich erinnere mich nur noch vage an diesen Tag. Auf einem Foto, das meine Mutter gemacht hat, sieht man ein felsiges Halbrund, davor stehen meine Großeltern mütterlicherseits. Meine Schwestern und ich tragen verschrammte Plastikhelme, die doppelt so groß sind wie unsere Köpfe. Ich habe eine Glocke aus Messing in der Hand. In meiner Erinnerung habe ich damit geläutet, als wir die Höhle betraten. Ich hatte Angst vor dem, was ich nicht sehen konnte, in diesem Fall vor einem Fuchs. So hieß die Höhle nämlich: la Grotta della Volpe, die Fuchsgrotte. Natürlich nahm ein vierjähriges Kind an, beim Streifen durch die Gänge auf dieses Tier zu stoßen, das sicherlich nicht erfreut war, wenn man in seinem Bau auftauchte. Und wenn es zubiss? Konnte uns das Läuten der Glocke davor bewahren?
Mein Vater zwängte sich durch die Öffnung und machte mir Mut: Nach wenigen Minuten stünden wir in einem breiten Höhlengang, in dem man bequem gehen könne, auch an die Dunkelheit werde ich mich bald gewöhnen. Aber damit überzeugte er mich nicht – im Gegenteil! Mein Gefühl der Ohnmacht gegenüber der Finsternis verstärkte sich noch. Irgendwann wurde die Angst übermächtig, und ich brach in Tränen aus. Während meine Schwestern vorangingen, drehte ich mich zur halbdunklen Felsöffnung um und suchte nach meiner Mutter. Ich hatte die Schwelle zur Höhle überschritten, aber die Angst war geblieben. Die Grotta della Volpe ist einer von vielen Zugängen zu den Lessinischen Bergen, eine Gebirgskette der Voralpen nahe dem Gardasee. Es handelt sich um ein Karstgebiet, wo das Wasser die Oberfläche durchdringt und den Kalkstein nach und nach auflöst, sodass sich im Lauf von Jahrmillionen geheimnisvolle Hohlräume gebildet haben. Die unterirdischen Bäche erreichen auf meist unbekannten Wegen Montorio, eine Gemeinde mit zahlreichen Quellen, nördlich von Verona.
Als Kind verbrachte ich die Wochenenden und Ferien in diesen Bergen, im Haus meiner Großeltern väterlicherseits. Auf Wanderungen durch den Wald, zusammen mit meinen Eltern, oder bei kurzen Spaziergängen kam ich oft an Öffnungen im Boden vorbei, die die Einheimischen »splughe« nannten. Es waren Eingänge zu gefährlichen, senkrecht abfallenden Höhlen, die oft mit Stacheldraht umzäunt waren. Es gab sehr viele dieser Erdöffnungen, vor allem auf den Almwiesen, wo das Vieh weidete. Man hatte immer Angst, eines der Tiere könnte hineinfallen. Auch meine Großmutter hatte Angst, wenn wir ihr von unseren Abenteuern erzählten, allerdings ging es ihr weniger um die Kühe als um uns.
Grotten, tiefe Erdlöcher und unterirdische Hohlräume wurden nicht als interessante Orte, sondern als Gefahr wahrgenommen, als Zugänge zu einer Welt, die man sich lieber nicht aus der Nähe ansah. Man musste sie verschließen, mit Steinen, Erde, Zweigen und Blättern füllen, bis sie nicht mehr zu sehen und auch aus der Erinnerung getilgt waren. Vergeblich: Der Regen schwemmte alles wieder frei, ein Beweis für die Riesenausmaße dieser Höhlen.
Wie um alle anderen Höhlen auf der Welt rankten sich auch um die Grotten der Lessinischen Berge zahlreiche Mythen und Legenden. Am Ende der Grundschulzeit fand ich im Regal meines Großvaters ein Buch mit dem Titel Filò-Geschichten. Der Filò ist die Zeit, wenn sich die Familie abends im Stall versammelt, in dem es durch die Tiere schön warm ist. Bevor man ins Bett ging, erzählten die Männer, was tagsüber passiert war, die Frauen spannen Wolle, und die älteren Mädchen hofften, ein junger Mann aus der Nachbarschaft käme zu Besuch. Die kleinen Kinder warteten ungeduldig darauf, dass jemand ein Märchen erzählte. Eine Tradition, die mit dem Einzug des Fernsehers völlig verschwunden ist. Aber ein alter Mann aus dem Dorf kannte alle Geschichten und hatte sie in dem Buch festgehalten, das ich gerade in Händen hielt. Jeden Abend vor dem Schlafengehen las ich eine Geschichte. Die meisten waren ziemlich furchteinflößend, und oft ging es um die Welt unter der Erde. In den Höhlen, die im örtlichen Dialekt »cóvoli« genannt werden, hausten die »fade« und die »orchi«, Ungeheuer, die alle verschlangen. Jeder, der sich dorthin traute und vom Versprechen des ewigen Lebens hineinlocken ließ, war in höchster Gefahr. Hatte der Wagemutige die Höhle erst einmal betreten, schloss sich der Fels hinter ihm, und er saß bis in alle Ewigkeit in der Falle. In anderen Höhlen hausten Räuber oder Betrüger, die dort ihre Fälscherwerkstatt eingerichtet hatten, trieben dort ihr Unwesen. Wer nachts darin unterwegs war, lief Gefahr den Basilisk zu wecken, eine fliegende Schlange mit Hahnenkamm. Jeder, der ihn zu Gesicht bekam, war für immer verstummt und konnte deshalb nicht mehr erzählen, was er gesehen hatte. Alle Geschichten spielten an real existierenden Orten, deren Namen mir Angst, aber auch Neugier einflößten. Offensichtlich hatte man den Kindern diese Schauermärchen erzählt, um sie vor den dort lauernden Gefahren abzuhalten. Trotz meiner Angst war ich so fasziniert, dass ich danach nicht einschlafen konnte.
Eines Tages, ich dürfte sieben gewesen sein, nahm mein Vater uns Kinder mit nach Camposilvano, ein kleines Dorf in den Lessinischen Bergen, berühmt für das »Valle delle Sfingi«, das Sphinx-Tal, in dem sich jahrhundertealte Felsformationen befinden, die ägyptischen Sphinxen ähneln. Mitten im Wald liegt der Eingang zu einer riesigen Höhle. Um sie zu erreichen, muss man einen schmalen Saumpfad hochsteigen, der an einem verwitterten Steinhäuschen beginnt. Ich erinnere mich noch, dass ein alter Mann auf einem Baumstumpf davorsaß. War das der Wächter? Er hatte ein runzliges Gesicht, in einer seiner riesigen Hände hielt er eine Zigarette, deren Rauch sich in der Luft kringelte. Attilio war ein Freund meines Vaters und freute sich, uns zu sehen. Neben der Haustür befand sich eine rötliche Steintafel mit Abdrücken von Wirbeln und spitzen Zähnen. Auch auf anderen Steinen in der Nähe waren seltsame Gebilde zu erkennen, keines glich dem anderen. Attilio bemerkte meine Neugier, kam auf mich zu und sagte: »Schau, das ist die Wirbelsäule eines riesigen Hais aus der Kreidezeit, damals, als es noch Dinosaurier gab. Und das sind die versteinerten Schlangen der Sintflut.«
In den Lessinischen Bergen heißt es, die »Cóvolo di Camposilvano« habe Dante zu seinem Inferno in der »Göttlichen Komödie« inspiriert. Am Grund der Grotte stieß man tatsächlich auf eine Eisschicht, so wie Dante seinen Höllengraben »Tolomea« beschreibt.© Raffaele Curiel
Diese Mischung aus Wissenschaft und Märchen beeindruckte mich. Dann begriff ich, dass ich vor Attilio Benetti stand, dem Autor des Buches, das mich bis in meine Träume verfolgt hatte. Um meine Neugier noch mehr zu steigern, fügte er hinzu: »Geh in die Cóvolo und schau dir die Höhlendecke an, dort sind diese Figuren ebenfalls zu sehen. Und wenn du wieder zurückkommst, erkläre ich dir, was es damit auf sich hat.«
Im Gegensatz zur Grotta della Volpe mit ihrer finsteren, schlammigen Öffnung betritt man die Cóvolo di Camposilvano wie durch ein breites Tor. Wenn man aus dem Wald kommt, sieht man ein felsiges Halbrund, das wie ein Amphitheater wirkt, mit Mauern, die mehr als zehn Meter hoch sind. Geht man auf dem Pfad weiter, der sich zwischen den Felsblöcken hindurchschlängelt, erreicht man den eigentlichen Eingang. Der Anblick überrascht, denn durch den Kontrast der warmen Außenluft zur kalten Luft im Inneren der Höhle bilden sich weiße Wölkchen, die für eine geheimnisvolle Atmosphäre sorgen. Sobald man die Schwelle überschreitet, weicht das Licht nach und nach der Dunkelheit. Der Übergang sorgt für Licht- und Farbenspiele, wie man sie oft an Höhleneingängen beobachten kann. Das Licht fällt erst auf das Geröllfeld, dann auf einen üppigen Farnwald, reflektiert das Grün und zeichnet mythische Figuren auf die feuchten Felswände.
Dieses Mal hatte ich ganz andere Gefühle als in der Grotta della Volpe. Die Cóvolo zog mich magisch an, meine Angst hielt mich nicht zurück. Nachdem ich darin eine Weile durchs Geröll hinabgestiegen war, drehte ich mich um und erahnte das Licht vom Eingang. Das Höhleninnere faszinierte mich, ich hatte das Gefühl, einen Tempel zu betreten. In meiner Fantasie erkannte ich in jedem Felsen eine antike Statue, während mich ein riesiger Felsblock in der Mitte der unterirdischen Halle an einen Wal erinnerte. Dahinter erstreckte sich ein Gang, dessen Boden mit Eis bedeckt war, er verlor sich in der Dunkelheit. Es war beißend kalt, das in der Ferne schemenhaft erkennbare Sonnenlicht, das durch das Blätterdach der Bäume vor dem Höhleneingang drang, lockte uns wieder nach draußen. Als ich mich in diesem Moment noch einmal Richtung Dunkelheit drehte, mischte sich Angst mit Neugier. Was es hier wohl zu entdecken gab?
Die Faszination der Finsternis habe ich erst viele Jahre später verstanden, als ich die Worte Leonardo da Vincis las, die er notiert hatte, als er eines Tages vor dem Eingang einer Höhle stand. Er hat uns eine wichtige Erkenntnis hinterlassen, die den Menschen im Angesicht des Unbekannten umtreibt: »Sofort wurden in mir zwei Gefühle geweckt, Angst und Verlangen. Angst vor der Dunkelheit der geheimnisvollen Höhle und das Verlangen nachzusehen, ob darin wirklich etwas Geheimnisvolles verborgen liegt.« Es ist die Angst vor dem, was man nicht sehen kann, was man nicht kennt, was man sich nicht vorstellen kann. Aber gleichzeitig wird unsere Neugier geweckt, die Faszination für das Unbekannte, der Wunsch, diesen Ort zu betreten und herauszufinden, was sich dort verbergen könnte. Es ist so, wie eine Flamme in der Dunkelheit zu entzünden: Die Hitze kann uns die Finger verbrennen, aber das Licht, das sich um uns herum ausbreitet, enthüllt die Umrisse der Umgebung und eröffnet neue Perspektiven, die wir in der Finsternis nicht wahrnehmen konnten.
Leonardo hat seine Gefühle angesichts der »dunklen Höhle« bestimmt nicht vergessen. Die Angst und die Anziehungskraft des Unbekannten in der Natur begleiteten ihn auf seinem Schaffensweg und nahmen auf ungewöhnliche Weise in zwei Altarbildern Gestalt an: in den beiden Fassungen der Vergine delle Rocce, der Felsgrottenmadonna. Der Auftrag der »Bruderschaft der Unbefleckten Empfängnis« für das Altarbild in der Mailänder Franziskanerkirche war unmissverständlich und betont klassisch: eine prächtig gekleidete Madonna mit Kind, dahinter Gottvater in Gold gehüllt, zwei Propheten und um sie herum musizierende Engel. Doch Leonardos Werk ist anders, es wirkt geheimnisvoll: Als erstes fällt die Abwesenheit Gottes im oberen Teil des Gemäldes auf. Stattdessen sieht man das Gewölbe einer Grotte mit Stalagmiten und anderen Tropfsteingebilden. Anscheinend hatte sich der florentinische Künstler von seinem Besuch der Höhle, aber auch von den Apokryphen inspirieren lassen. Darin heißt es, Maria und Elisabeth, die vor Herodes geflüchtet waren, seien von Gott gerettet wurden, der einen Engel zur Höhle schickte, um ihnen auf ihrer Flucht Licht zu spenden.
Wenn ich an diese widerstreitenden Gefühle denke, an die Angst und die Neugier, werden zahlreiche andere Kindheitserinnerungen geweckt. Die Höhle ist ein klares, starkes Sinnbild für das, was Menschen im Angesicht der unbekannten Natur empfinden. Wir werden als Entdecker geboren und bewegen uns, getrieben von der Neugier, aber gebremst von der Angst, durch die Welt. Als Erwachsene vergessen wir dieses Bild und flüchten uns in die beruhigende Gewissheit, dass alles, was uns umgibt, Teil der bekannten Welt ist, gestützt auf eigene (vielleicht auch auf fremde) Erfahrungen und Beobachtungen. Wir leugnen das Unbekannte, weil es unser Selbstverständnis als Erwachsene erschüttern würde. Nur wenn wir wieder zu Kindern werden, können wir über die selbst gewählte Grenze hinausschauen und hinter die Oberfläche gucken.
Attilio wusste bestimmt, was beim Überschreiten der Schwelle, beim Übergang von Licht zu Dunkelheit, mit mir passiert war. Nach unserem Höhlenbesuch griff er nach einem Schlüsselbund, öffnete die Tür des kleinen Steinhauses und winkte mich hinein. Auf verstaubten Regalbrettern und in Vitrinen stapelten sich Tausende von Ammoniten, spiralförmige Abdrücke im Gestein: keine versteinerten Schlangen wie in den Legenden, sondern Fossilien längst ausgestorbener Muscheln.
Fossile Ammoniten sind zu Stein gewordene Weichtiere, die vor Jahrmillionen die Meere unseres Planeten bevölkerten. Ihre Spiralform im Gestein hat den Menschen zu vielen Geschichten und Legenden über das Leben unter der Erdoberfläche inspiriert.© Nastasic, DigitalVision Vectors, via Getty Images
Ihre gewundene Form symbolisierte eine Art Weg, der ins Gestein eindrang. Ich hatte das Gefühl eine Schatzkammer betreten zu haben, und Attilio beobachtete zufrieden, wie ich mich mit leuchtenden Augen umsah. Inmitten der vielen Fossilien erregte etwas meine besondere Aufmerksamkeit: ein riesiger Schädel mit messerscharfen Zähnen, fliehender Stirn und kräftigem Kiefer. Auf einem handgeschriebenen Schild stand: »Ursus spelaeus, Schädel eines Höhlenbären, gefunden in den Cóvoli di Velo, 1956.« Das Foto daneben zeigte Attilio im Tarnanzug, mit Helm und Karbidlampe. Im Inneren einer Höhle voller Stalaktiten und Stalagmiten.
Dieses Erlebnis war so eindrücklich, dass ich meine Eltern jede Woche anflehte, Attilio und seine Fossiliensammlung besuchen zu dürfen. Mit elf Jahren fuhr ich oft ganz allein mit dem Rad durch das Tal, das den Wohnort meiner Großeltern von Camposilvano trennte. Hatte ich sein Häuschen erreicht, klopfte ich an die Tür, und Attilio ließ mich wortlos herein. Seine imposante Gestalt war von einer Rauchwolke umgeben, das Zimmer voller Gerätschaften, Fossilien, Bücher, verblasster Fotografien, Zeichnungen und Karten. In all dem Durcheinander stand ein Computer, an dem er wissenschaftliche Artikel verfasste – immer dann, wenn er neue Ammoniten entdeckt hatte. An einer Wand hing ein gerahmter Sinnspruch: »Was immer du tun kannst oder träumst, es zu können, fang damit an. Mut hat Genie, Kraft und Zauber in sich. Beginne es jetzt!« Ich ging ihn besuchen, weil ich neugierig auf die Geschichten seiner Entdeckungen war. Attilio war Autodidakt, kein Geologe im akademischen Sinn, aber zweifellos ein großartiger Höhlenforscher. Sein Interesse galt der Welt unter der Erdoberfläche, das war offensichtlich, wenn man sich in seinem Häuschen umsah. Ihm eine Geschichte aus seinem Forscherleben zu entlocken, war nicht leicht. Zwischen einem Satz und dem nächsten lagen immer lange Pausen, was die Spannung nur noch steigerte. Er war nahe einer großen Höhle geboren und aufgewachsen, hatte unzählige Mythen und Legenden gehört. Nach dem Zweiten Weltkrieg war er nach Belgien gegangen, um dort in den Kohleminen zu arbeiten. Dabei hatte er die Neugier auf das Unbekannte in sich entdeckt. 1952 reiste er in die Pyrenäen, wo wagemutige Pioniere der Speläologie den Gouffre de la Pierre Saint-Martin erforschten, die damals tiefste bekannte Höhle der Welt. Der Unfall von Marcel Loubens, der in den 320 Meter tiefen Eingangsschacht gestürzt war, hatte eine internationale Rettungsaktion ausgelöst. Attilio hatte sich bereit erklärt, sich in eine Felsspalte abzuseilen, um das Hochziehen der Rettungstrage zu dirigieren. Aber leider waren alle Bemühungen vergebens: Loubens war wenige Stunden vor Attilios Ankunft gestorben. Eine der dramatischsten Höhlenrettungsaktionen endete mit einem Misserfolg. Davon unbeeindruckt, hatte Attilio nach seiner Rückkehr in die Lessinischen Berge eine Gruppe von Gleichgesinnten um sich geschart und mit der Erforschung der heimischen Höhlen begonnen.
Während er mir von seinen abenteuerlichen Expeditionen erzählte, war ihm durchaus bewusst, dass er damit auch mir eine unstillbare Neugier einpflanzte. Ich hörte ihm zu, ohne den Mut zu haben, ihm all die Fragen zu stellen, die mir auf den Lippen brannten. Aber eines Tages hielt ich es nicht mehr aus und fragte ihn nach dem Bärenschädel.
»Das ist die traurige Geschichte einer Entdeckung, die kein gutes Ende hatte.«
»Warum? Dieser Schädel ist doch eine Sensation. So etwas habe ich noch nie gesehen«, erwiderte ich etwas enttäuscht.
»Das Problem bei Entdeckungen ist, dass sie manchmal etwas ans Tageslicht bringen, was besser im Dunkeln geblieben wäre. Ist es erst mal für alle sichtbar, ist die Gefahr der Zerstörung groß.«
»Aber zum Glück hast du diesen Schädel hier in dein kleines Museum gebracht, und alle können ihn bewundern«, gab ich etwas verwundert über seine negative Aussage zu bedenken.
»Darum geht es nicht. Dort liegen noch zahllose Skelette, nicht nur von Höhlenbären. Das Ganze geschah während der Erforschung der Cóvoli di Velo. Von klein auf war ich von diesem Höhlensystem fasziniert und hatte mir die Geschichten der Einheimischen angehört. Es hieß, dort unten würden Skelette von Tieren liegen, die während der Sintflut ertrunken sind. Schon als Kind, etwa in deinem Alter, war ich auf den Geröllfeldern am linken Talhang unterwegs, und immer wenn ich in die Nähe der Höhlen kam, wurde der Drang, sie zu betreten, fast unerträglich.«
»Und wann bist du zum ersten Mal hineingegangen?«
»Erst in den 1950er Jahren, nachdem ich aus Belgien zurück war. Mit einer Karbidlampe bin ich einen langen Korridor bis zu einer Engstelle gegangen, durch die ich nicht gepasst habe. Durch diese Spalte drang Luft, dahinter mussten also noch andere Hohlräume liegen. Ich beschloss, sie zu verbreitern. Und nach einigen Tagen konnte ich noch tiefer in die Höhle vordringen.«
An diesem Punkt hielt er inne und steckte sich eine weitere filterlose Zigarette an. Ich wartete, atemlos vor Neugier, sagte aber nichts, um seinen Gedankengang nicht zu unterbrechen. Es vergingen ein, zwei Minuten, vielleicht auch mehr, und während sich das Zimmer mit Rauchwolken füllte, sprach Attilio endlich weiter. »Hinter dem Spalt lag eine große Halle. Der Boden war lehmbedeckt, daraus ragten Skelette von Höhlenbären hervor, es waren Dutzende.«
Ich malte mir die Szene aus, die von Attilios Lampe erleuchteten Schädel, dann sprudelte es nur so aus mir heraus.
Aus den Cóvoli-di-Velo-Höhlen in den Lessinischen Bergen wurden zahlreiche Schädel von Höhlenbären geraubt.© Ursus spelaeus von Meyers
»Und warum hast du sie nicht mitgenommen? In deinem Museum sind sie jedenfalls nicht.«
Attilio schüttelte den Kopf.
»Nein, auf keinen Fall. Weißt du, es war wie eine Zeitreise. Diese riesigen Tiere waren vor 30 000 Jahren in der Höhle gestorben, während der Eiszeit. Ich war der erste Mensch, der diesen Ort betrat, mein Licht war das erste, das dorthin fiel. Meine Schritte waren die ersten Geräusche, die ihren ewigen Schlaf störten. Ich konnte die Knochen nicht einfach mitnehmen. Nach dieser Entdeckung habe ich den Durchgang sofort wieder verschlossen, niemand sonst sollte ihre Ruhe stören.«
»Und sie sind immer noch dort?«, fragte ich verblüfft, während ich glaubte, Attilio hätte mir gerade sein größtes Geheimnis anvertraut.
»Leider nein, die Dummheit des Menschen macht auch nicht vor dem Unbekannten halt. Bei den Grabungsarbeiten hatten mir einige Jungs aus dem Dorf geholfen, und obwohl ich sie um Stillschweigen gebeten hatte, verbreitete sich die Nachricht wie ein Lauffeuer. Einige Tage später erzählte man mir, Grabräuber wären in die Höhle eingedrungen. Ich ertappte sie, als sie gerade eine Kiste mit einem gut erhaltenen Schädel herausschleppten – nicht von einem Höhlenbären, sondern von einem Höhlenlöwen.«
»Und hast du es verhindern können?«
»Sie waren zu viert, mit Schaufeln und Spitzhacken. Ich hingegen war ganz allein, da konnte ich nichts ausrichten. Ich konnte nur den Schädel des Bären retten, den du in der Vitrine siehst. Den hatten sie liegen lassen, um ihn später zu holen, aber ich kam ihnen zuvor und brachte ihn zu einem Paläontologen.«
In seinen Worten lag die ganze Bitterkeit eines Mannes, der eine faszinierende Entdeckung gemacht hat, die aber durch gierige, ignorante Menschen zunichtegemacht worden ist. Trotzdem wagte ich zu fragen: »Meinst du, dort gibt es noch mehr zu erforschen? Weitere Spalten, die zu anderen Hohlräumen führen?«
»Wahrscheinlich.«
»Und hast du noch welche gefunden?«
»Nach diesem Erlebnis habe ich beschlossen, niemandem etwas zu erzählen, falls ich dort oder woanders noch etwas finden sollte.« Er lächelte, denn er wusste, dass er mit diesen Andeutungen etwas in mir entfachte, das mich noch viel weiter bringen sollte als in die Cóvoli di Velo.
Ich musste unbedingt bis in diese Höhle vordringen, um meine Fantasie mit der Realität abzugleichen. Aber natürlich ging das nicht auf eigene Faust, dazu hatte ich viel zu viel Angst, zumal es gefährlich werden konnte.
In meinem Cousin Giovambattista fand ich den idealen Partner. Er war zwei Jahre älter als ich, ein abenteuerlustiger Bursche und der Schrecken meiner Schwestern, denen er gemeine Streiche spielte. Auch ich hatte immer ein wenig Respekt vor ihm, und mir war klar, dass er für mein Vorhaben perfekt war. Er hatte vor nichts Angst, und die Vorstellung, in eine finstere Höhle hinabzusteigen, schien ihn nicht im mindesten zu schrecken. Ich erinnerte mich an Attilios Ausrüstung, die ich auf den Fotos gesehen hatte. Wir beschafften uns Bauarbeiterhelme, Taschenlampen, einen Tarnanzug und einen Mechanikeroverall und machten uns auf ins Tal der Cóvoli di Velo. Mit einer Gartenhippe schnitten wir den Weg frei, räumten alles fort, was uns behinderte. Wo genau sich die Höhle befand, wussten wir nicht, wir folgten einfach einem zugewucherten Pfad. Während Giovambattista sich in seiner Rolle als Entdecker pudelwohl fühlte, hatte ich das Gefühl, der Sache nicht gewachsen zu sein. Attilios Geschichten drängten mich jedoch weiterzumachen, auch wenn ich fürchtete, dass wir in Schwierigkeiten geraten könnten.
Wir kamen zu einer Felswand, an deren Fuß sich fünf Löcher befanden. Welche Öffnung würde uns in die Bärenhöhle führen? Wir zwängten uns durch den breitesten Spalt, der sich nach ein paar Metern zu einem Gang weitete. Dieser wurde von Lichtstrahlen, die durch zwei Öffnungen eindrangen, spärlich erhellt. Der Gang führte immer weiter ins Innere des Berges. Anfangs konnte man aufrecht gehen, aber schon bald mussten wir kriechen. Nach ungefähr 100 Metern endete der Weg. Von Attilios Durchgang und der Halle mit den Skeletten keine Spur. Enttäuscht verließen wir die Höhle und fragten uns, ob all diese Geschichten vielleicht doch nur der Fantasie eines alten Mannes entsprungen waren und die Welt unter der Erde gar nicht so spannend und geheimnisvoll war wie gedacht. Wir versuchten es mit drei weiteren Spalten, ohne Erfolg. Nur eine blieb übrig, die wir bisher kaum beachtet hatten.
Ich erinnere mich noch genau, wie ich davorstand. Der Temperaturunterschied zwischen der kalten feuchten Luft innen und der Wärme außen war deutlich zu spüren. Auch der Geruch war anders. Im Freien roch es nach frischem Grün, die von innen kommende Luft hatte etwas Mineralisches. Dieser Hohlraum war definitiv anders als die anderen. Wir wagten es und zwängten uns hinein. Nach einer Weile wurde der Gang breiter und höher, und wir konnten uns aufrecht bewegen, fast wie in einem Eisenbahntunnel. Wir hatten unser Ziel erreicht: die Bärenhöhle. Sie war genau so, wie ich sie mir vorgestellt hatte, nur noch geheimnisvoller.
Wie elektrisiert wagten wir uns weiter vor. Keiner sagte ein Wort, aber wir wussten, dass wir hier richtig waren. Der Gang verengte sich wieder, wir erreichten eine Felsspalte mit deutlichen Grabungsspuren, durch die ein kräftiger Luftstrom drang. Ich hatte keine Angst mehr, sondern wollte nur noch weiter. Wir zwängten uns hindurch und kamen in einen saalartigen, hohen Raum mit einer prächtigen Kalksteinkaskade. Vor meinem inneren Auge sah ich einen riesigen Bären in seinem jahrtausendelangen Winterschlaf. Dann tauchte ein Löwe auf der Suche nach Beute auf. Wer weiß, wie der Kampf zwischen den beiden Giganten ausgegangen war?
Während ich mich meiner Fantasie überließ, hatte Giovambattista einen etwa zehn Zentimeter langen Bärenknochen gefunden, den er mir wie einen Schatz präsentierte. Attilios Geschichte stimmte.
Als wir wieder ans Tageslicht kamen, waren wir nicht mehr dieselben wie vorher. Von da an beherrschte uns die fixe Idee, andere Höhlen zu finden und weitere Zeitreisen zu machen. Die Schwelle vom Licht zur Dunkelheit zu überschreiten, hatte etwas Magisches, so als würde man in die Ewigkeit eintreten, dort, wo die Zeit stehengeblieben war. Wir begriffen, warum der Mensch in den Legenden aller Kulturen anders aus einer Höhle herauskommt, als er hineingegangen ist. Egal, ob vor Tausenden von Jahren oder heute: Die Höhle war und ist ein Ort der Initiation.
In den folgenden zwei Sommern erkundeten wir alle Felsspalten und Erdlöcher, von denen wir gehört hatten. Wir quetschten uns durch schmale Öffnungen und forderten uns gegenseitig heraus: Keiner wollte dem anderen gegenüber zugeben, dass er doch hin und wieder Angst hatte. Manchmal mussten wir aufgeben: Wenn die Felsspalten zu tief waren und wir es ohne die richtige Ausrüstung und die nötige Erfahrung nicht wagten, weiter vorzudringen. Wir konnten nur einen Stein hineinwerfen und lauschen, wie er irgendwann in der Tiefe aufschlug. Seitdem hat es etwas Magisches für mich, einen Stein in einen tiefen Schacht zu werfen. Dieses Fallen, dieses von der Schwerkraft hinabgezogen und von der Dunkelheit verschluckt zu werden, dieses Aufprallen weckte meine Fantasie. Wie sah es dort aus? Was wohl dort unten war? Vielleicht ein See, eine Halle mit von Kristallen überzogenen Wänden? Wenn ich abends im Bett lag, gingen meine Gedanken auf die Reise. Losgelöst von meinem Körper, flog ich über alle Hindernisse hinweg und konnte trotz der Dunkelheit bis in jede Ecke sehen.
Anfangs war es nur Forscherdrang, die Lust, etwas Neues zu entdecken, wie bei unserem ersten Ausflug in die Cóvoli di Velo. Aber schon bald hatten wir konkretere Ziele. Dann lockte das Unbekannte im geografischen Sinn und all die Fragen, die sich daraus ergaben: Wohin führten diese unterirdischen Gänge? Wie weit konnten wir vordringen?
Vor unseren Augen öffnete sich eine neue Welt, ohne Begrenzungen durch Straßen, Wege, Berge und Wälder: geheime Orte, die nur uns gehörten, unser Spielplatz, der weit über unser Vorstellungsvermögen hinausging, Erlebnisse, die wir unseren Schulkameraden und Freunden nur schwer beschreiben konnten.
Aus unseren meist harmlosen Streifzügen, über die wir uns bei unseren Eltern eher bedeckt hielten, stach eine Exkursion hervor, die nur mit Glück nicht in einem Fiasko endete. Wir hatten schon einiges über einen künstlichen Tunnel gehört, der in den 1970er Jahren gegraben worden war, um einen Fluss in ein schmales Tal umzuleiten. Dort sollte eine Staumauer gebaut werden und ein Stausee entstehen, ein Wasserreservoir für ein Gebiet, in dem es keine natürlichen Gewässer gab. Aber das Projekt kam nur schleppend voran, immer wieder gab es Schwierigkeiten, die Ingenieure und Geologen waren der Aufgabe nicht gewachsen. Der Tunnel bestand aus zwei Teilen, der erste drei, der zweite sechs Kilometer lang. Er sollte den Berg durchqueren, in dem sich die Cóvoli di Velo und andere, weniger bekannte Höhlen befanden.
Das erste Problem tauchte schon nach einem halben Kilometer auf. Nach einer Sprengung spürten die Arbeiter, wie Frischluft hereinströmte. Statt vor einer Felswand standen sie plötzlich vor einer großen Höhle, in deren Mitte ein Wasserfall etwa 70 Meter in die Tiefe stürzte. Sie riefen die Ingenieure herbei, die sprachlos waren und ahnten, dass das ganze Projekt in Gefahr war. Vielleicht konnten sie eine Brücke durch den Hohlraum bauen, aber vorher musste die Höhle vermessen werden. Die aktivsten Höhlenforscher der Region Verona waren damals in der Grotte-Falchi-Sektion organisiert, die von dem berühmten Fotografen Mario Cargnel geleitet wurde. Die »Falken« boten sich an, als Freiwillige eine Topografie der Höhle zu erstellen, die den Ingenieuren weiterhelfen konnte. Dafür hatten sie nur zwei Tage Zeit, der Bau musste weitergehen. Die Speläologen seilten sich in die Höhle ab und vermaßen sie, von der ersten Halle zweigten mehrere, schier endlose Nebengänge ab. Das Höhlensystem hatte einen Durchmesser von 50 Metern und war 70 Meter hoch. Auf dem Boden lagen riesige Felsbrocken, was auf eine instabile Decke hinwies. Es schien wenig ratsam, hier weiterzugraben. Die Ingenieure beschlossen, den Tunnel zu versetzen, um kein Risiko einzugehen. Der Taioli-Tunnel, so hieß die Passage, wurde versiegelt, um zu verhindern, dass sich hier jemand in Gefahr begab.
Doch das war nur die erste Warnung des Berges. Als der zweite Abschnitt fertig war, zeigten technische Untersuchungen, dass darunter Hohlräume waren und ein in diese Röhre umgeleiteter Fluss nicht abzusehende Konsequenzen haben würde. Eingedenk der erst zehn Jahre zurückliegenden Staudammtragödie im Vajont-Tal wurde beschlossen, das Projekt ganz aufzugeben.
Die topografische Karte der »Falken« existierte allerdings noch, sie zeigte uns alles, was man über die Höhle wusste. Wir hatten sie in einem Buch meines Vaters entdeckt und genau studiert. Dabei stellten wir uns vor, wie viele Nebengänge damals unentdeckt geblieben waren, man hatte ja nur zwei Tage Zeit gehabt. Es musste Höhlen ohne direkte Verbindung zur Erdoberfläche geben, ein faszinierender Gedanke. Das überstieg alles, was wir bisher erlebt hatten. Wenn eine Höhle einen oberirdischen Zugang hatte, dann konnte der Mensch dort einsteigen und sie erforschen. Aber wenn es diesen nicht gab, wie sollte man dann überhaupt von ihrer Existenz erfahren? Diese Frage trieb mich um. Unter jedem Berg konnten Höhlen liegen. Unerreichbare Orte, die meinen Forschergeist weckten.
Aber wir waren nicht die Ersten, die sich damit befassten, denn als wir den versiegelten Tunnel erreichten, entdeckten wir ein Loch im Beton, durch das der Wind pfiff. Irgendjemand hatte, wahrscheinlich geführt von einem Bauarbeiter, der sich noch an die Position der Höhle erinnerte, einen Durchgang freigelegt. Wir tauchten in die absolute Dunkelheit der unterirdischen Halle ein. Doch der Abstieg war schwierig. Zum Abseilen hatten wir Nylonseile, Klettergurte, Seilbremsen und Bergsteigerhelme mit Stirnlampen besorgt. Unten angekommen, begannen wir die Gänge rechts und links der Halle zu erforschen, die nicht auf der Karte verzeichnet waren. Wir mussten verschlammte Engstellen überwinden, uns durch ein Labyrinth vorantasten und erreichten schließlich einen hohen Gang, der abrupt vor einem Schacht endete, der sich in pechschwarzer Tiefe verlor. Es war unsere erste wirkliche Forschertour, denn wir waren in einem Gebiet unterwegs, das auf keiner Karte verzeichnet war. Uns wurde klar, dass wir die Grenzen des Bekannten überschritten hatten, was unseren Entdeckerdrang erst recht anheizte. Am nächsten Wochenende waren wir wieder in der Höhle, mit zwei 30-Meter-Kletterseilen und mehreren Felsnägeln. Ich vertraute Giovambattista, der die Nägel in die Spalten trieb und dabei äußerst selbstsicher wirkte, doch in Wahrheit wussten wir natürlich nicht, ob sie unser Körpergewicht halten würden. Voller Adrenalin ließen wir uns in einen Schacht von mehr als 20 Metern Tiefe hinab. Doch das war noch gar nichts gegen das, was uns danach erwartete: ein unglaublich enger Spalt, selbst für einen 13- und einen 15-Jährigen. Doch auch dieses Hindernis konnte unsere Entdeckerlust nicht bremsen. Um unsere Anstrengungen verständlich zu machen, nannten wir den Spalt »das Nadelöhr«. Es war nicht nur eng, sondern auch total verschlammt, mit der Folge, dass mein Anzug immer wieder an den Wänden kleben blieb, genau wie der Helm und die Handschuhe. So etwas habe ich in den darauffolgenden Jahren in keiner Höhle mehr erlebt. Dahinter lag eine riesige Halle, von oben stürzte ein Wasserfall hinab. Wir waren hochgradig angespannt, befestigten ein Seil an einem Felsblock und ließen uns in die Dunkelheit hinab, das Licht unserer Stirnlampen reichte nicht einmal bis zu den Wänden. Als wir uns weiter vortasteten, entdeckten wir etwas völlig Unerwartetes: zwei Rucksäcke zwischen den Felsen. War jemand vor uns hier gewesen? Unmöglich! Es dauerte eine Weile, bis der Groschen fiel: Das waren unsere Rucksäcke, die wir in der Eingangshalle zurückgelassen hatten, bevor wir mit unserer Entdeckungstour begonnen hatten. Diese Halle kannten wir schon, nur aus einem anderen Blickwinkel. Die Unterwelt hatte uns einen Streich gespielt. Wir waren Stunden unterwegs gewesen, hatten in tiefen Schächten unser Leben riskiert und uns durch unüberwindbar scheinende Spalten zwischen den Felsen gequetscht. Und waren dabei im Kreis gegangen, hatten jeglichen Sinn für Raum und Zeit verloren. Anfangs waren wir tief enttäuscht, aber dann setzten wir uns, betrachteten unsere schlammverschmierten Gesichter und brachen in lautes Gelächter aus. Denn trotz allem war das unser bisher schönstes und faszinierendstes Abenteuer.





























