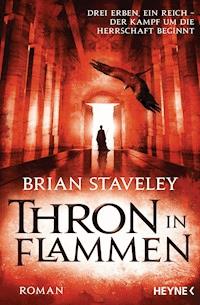11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Thron-Serie
- Sprache: Deutsch
Als der Kaiser von Annur heimtückisch ermordet wird, geht die Verantwortung für das Reich auf seine drei Kinder über. Seit acht Jahren haben sich die Geschwister nicht mehr gesehen, denn für jeden von ihnen ist ein anderes Schicksal vorherbestimmt: Kaden, der Thronerbe, wird in einem Bergkloster, fernab vom Zugriff seiner Feinde, darauf vorbereitet zu herrschen. Valyn wird auf einer abgelegenen Insel zum Elitekrieger ausgebildet, und Adare ist die oberste Ministerin am Kaiserhof. Entschlossen, den Tod ihres Vaters zu sühnen, machen sich die drei auf die Suche nach dem Täter – nicht ahnend, dass der Mord am Kaiser erst der Beginn einer gewaltigen Intrige ist, die Annur in seinen Grundfesten erschüttern wird ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1003
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Brian Staveley
Der verlorene
Thron
Roman
Aus dem Amerikanischen übersetztvon Michael Siefener
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Titel der amerikanischen Originalausgabe
THEEMPEROR’SBLADES – CHRONICLEOF
THEUNHEWNTHRONEBOOK 1
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so über nehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Redaktion: Joern Rauser
Copyright © 2013 by Brian Staveley
Copyright © 2015 der deutschsprachigen Ausgabe und
der Übersetzung by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Das Illustrat, München, unter Verwendung
eines Motivs von Shutterstock/Andrey Arkusha
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-641-15436-3V002
www.randomhouse.de
Für meine Eltern, die mir so
viele Geschichten vorgelesen haben
Prolog
Die Fäule. Es war die Fäule, die sein Kind befallen hatte, dachte Tan’is, als er in die Augen seiner Tochter starrte.
Schreie und Verwünschungen, Bitten und Schluchzen zitterten durch die Luft, als die langen Reihen der Gefangenen das Tal füllten. Der Geruch von Blut und Urin lag schwer unter der Mittagshitze. Doch Tan’is beachtete das alles nicht, sondern konzentrierte sich ganz auf das Gesicht seiner Tochter, die vor ihm kniete und seine Knie umfasst hielt. Treua war inzwischen zu einer Frau geworden – dreißig Jahre und einen Monat alt. Warf man bloß einen flüchtigen Blick auf sie, so wäre sie vielleicht gesund erschienen – mit den hellen grauen Augen, den schmalen Schultern und starken Gliedern. Aber die Csestriim brachten schon seit Jahrhunderten keine gesunden Kinder mehr zur Welt.
»Vater«, jammerte die Frau, während ihr Tränen die Wangen herunterliefen.
Auch diese Tränen waren ein Symptom der Fäule.
Natürlich gab es noch andere Wörter dafür. Die Kinder nannten das Leiden in ihrer Unwissenheit oder Unschuld Alter, aber wie so oft irrten sie sich auch in dieser Hinsicht. Das Alter war nicht mit Hinfälligkeit gleichzusetzen. Tan’is war alt, schon Hunderte Jahre alt, und doch waren seine Sehnen noch immer stark, und sein Geist bewegte sich flink. Wenn es nötig war, konnte er den Tag und die Nacht und auch noch den größten Teil des nächsten Tages hindurch laufen. Die meisten Csestriim waren noch älter, Tausende und Abertausende Jahre, und doch wandelten sie noch immer über die Erde – zumindest jene, die nicht in den langen Kriegen gegen die Nevariim gefallen waren. Nein, die Zeit verging, die Sterne zogen in stillen Bögen über den Himmel, die Jahreszeiten lösten einander ab, und doch brachte all dies aus sich selbst heraus keinerlei Schaden. Es war nicht das Alter, sondern die Fäule, die an den Kindern nagte, ihre Eingeweide und Gehirne verzehrte, ihnen die Kraft aussaugte und die geringen Reste der Intelligenz zerfraß, die sie einst besessen hatten. Zuerst kam die Fäule und dann der Tod.
»Vater«, jammerte Treua. Doch sie schaffte es nicht, über dieses einzelne Wort hinauszukommen.
»Tochter«, erwiderte Tan’is.
»Du … nicht …«, keuchte sie und warf einen Blick über die Schulter auf die Stelle, wo die Doran’se den Graben aushoben. Stahl blitzte dort im Sonnenschein auf. »Du … kannst … nicht …«
Tan’is hielt den Kopf schräg. Er hatte versucht, seine Tochter zu verstehen, so wie er versuchte, alle Kinder zu verstehen. Er war zwar kein Heiler, aber als Soldat hatte er vor langer Zeit gelernt, sich um gebrochene Knochen, zerrissenes Fleisch und schwärende Wunden zu kümmern und auch den Husten der Männer zu behandeln, die zu lange im Feld gewesen waren. Doch dies hier … Er verstand die Natur dieses Verfalls genauso wenig, wie er ihn zu behandeln vermochte.
»Sie hat dich im Griff, Tochter. Die Fäule hat dich erwischt.«
Er senkte die Hand und fuhr mit dem Finger über die Falten in Treuas Stirn, dann zeichnete er die zarten Linien neben ihren Augen nach und hob eine dünne silberne Strähne aus den braunen Locken. Als sie damals gesund und schreiend zwischen den Schenkeln ihrer Mutter erschienen war, hatte er sich gefragt, ob sie vielleicht unversehrt aufwüchse. Diese Frage hatte ihn einige Zeit beschäftigt, und nun war sie beantwortet.
»Noch ist ihr Griff sanft«, betonte er, »aber er wird stärker werden.«
»Und deswegen musst du das hier tun?«, schrie sie ihm entgegen und deutete mit dem Kopf ruckartig auf den frisch ausgehobenen Graben im Erdreich. »Muss es denn dazu kommen?«
Tan’is schüttelte den Kopf. »Das war nicht meine Entscheidung. Der Rat hat abgestimmt.«
»Warum? Warum hasst ihr uns?«
»Hassen?«, erwiderte er. »Das ist dein Wort, mein Kind, nicht unseres.«
»Es ist nicht nur ein Wort. Es beschreibt ein Gefühl – etwas Echtes. Es drückt eine Wahrheit über die Welt aus.«
Tan’is nickte. Er kannte solche Einwände bereits. Hass, Mut, Angst. All jene, die die Fäule bloß als ein Leiden des Fleisches betrachteten, hatten keine Ahnung. Sie höhlte auch den Geist aus und rüttelte an den Grundfesten von Verstand und Denken.
»Ich entstamme deinem Samen«, fuhr Treua fort, als folge dies logisch aus dem bereits Gesagten. »Du hast mich gefüttert, als ich klein war!«
»Das ist so bei vielen Geschöpfen: bei den Wölfen, den Adlern und den Pferden. Wenn sie jung und abhängig sind, müssen sie sich auf ihre Erzeuger verlassen.«
»Aber Wölfe, Adler und Pferde beschützen ihre Kinder!«, wandte sie ein. Nun weinte sie offen und klammerte sich an seine Beine. »Ich habe es gesehen! Sie beschützen ihre Nachkommen, füttern sie und ziehen sie auf.« Mit einer zitternden, bettelnden Hand fuhr sie ihrem Vater über das Gesicht. »Warum willst du uns nicht aufziehen?«
»Die Wölfe ziehen ihre Jungen auf, damit sie Wölfe werden«, erwiderte ihr Vater und schob die Hand seiner Tochter beiseite. »Und aus kleinen Adlern werden große Adler. Du aber …«, sagte er und runzelte die Stirn. »Wir haben euch aufgezogen, doch ihr seid gebrochen. Verseucht. Geschwächt. Du kannst es selbst erkennen«, sagte er und deutete auf die gebeugten, besiegten Gestalten, die am Rande der Grube warteten. Es waren Hunderte. »Selbst ohne das hier würdet ihr bald sterben.«
»Aber wir sind das Volk. Wir sind deine Kinder.«
Müde schüttelte Tan’is den Kopf. Es war nicht gut, mit jemandem zu rechten, dessen Verstand gerade zerfiel. »Ihr könnt niemals das sein, was wir sind«, sagte er und zog sein Messer.
Beim Anblick der Klinge gab Treua ein kehliges, ersticktes Geräusch von sich und zuckte zurück. Tan’is fragte sich, ob sie versuchen werde wegzulaufen. Einige taten es. Sie kamen nie weit. Doch diese Tochter lief nicht davon. Sie ballte die Hände zu weißen, zitternden Fäusten, dann stand sie unter sichtlich großen Anstrengungen auf. Nun konnte sie ihm unmittelbar in die Augen sehen, und auch wenn ihr die Tränen noch die Haare an die Wangen klebten, weinte sie doch nicht mehr. Ganz kurz hatte der entstellende Schrecken sie verlassen. Nun sah sie beinahe gesund und kräftig aus.
»Und ihr könnt uns nicht für das lieben, was wir sind?«, fragte sie mit langsamen Worten, die zum ersten Mal seit langer Zeit wieder fest klangen. »Selbst wenn wir verseucht und gebrochen sind? Ihr könnt uns in diesem Zustand nicht lieben?«
»Liebe«, sagte Tan’is und rollte die beiden seltsamen Silben auf der Zunge herum, während er das Messer an den Rippen vorbei in das rasende Herz seiner Tochter trieb, »ist wie Hass – es ist dein Wort, Tochter, nicht das unsere.«
1
Die Sonne stand dicht über den Gipfeln; ihr wütendes Glühen tauchte die Granitfelsen in ein blutiges Rot. Zu dieser Zeit entdeckte Kaden den zerschmetterten Kadaver der Ziege.
Seit Stunden schon hatte er das Geschöpf über mühselige Bergpfade hinweg verfolgt. Dort, wo der Boden weich genug war, hatte er nach Spuren gesucht, und wenn es nur nackten Felsen gab, hatte er raten müssen und war jedes Mal umgekehrt, wenn sich seine Vermutung als falsch erwiesen hatte. Es war ein langsames und anstrengendes Vorankommen gewesen – und damit genau die Aufgabe, die ältere Mönche gern ihren Schülern stellten. Als die Sonne versank und der östliche Himmel die Purpurfärbung eines Blutergusses annahm, fragte er sich, ob er die Nacht zwischen den hohen Berggipfeln und mit nur einer grob gewobenen Kutte als Schutz würde verbringen müssen. Nach dem annurischen Kalender hatte der Frühling schon vor Wochen eingesetzt, aber die Mönche schenkten dem Kalender genauso wenig Aufmerksamkeit wie das Wetter, das noch immer kalt und ungemütlich war. Flecken schmutzigen Schnees lagen in den langen Schatten, Kälte stieg aus den Steinen auf, und die Nadeln der wenigen knorrigen Wacholderbüsche waren eher grau als grün.
»Du alter Bastard«, murmelte er und überprüfte eine weitere Spur. »Du willst hier draußen genauso ungern schlafen wie ich.«
Das Gebirge bildete ein Labyrinth aus Schluchten und Tälern, ausgewaschenen Flussbetten und steinübersäten Felsvorsprüngen. Kaden hatte bereits drei Flüsse durchquert, die Schmelzwasser führten und gegen die hohen Schluchtwände gischteten, von denen sie eingeschlossen wurden. Seine Kutte war ganz nass. Wenn die Sonne vollständig untergegangen war, würde es frieren. Er hatte keine Ahnung, wie es der Ziege gelungen sein mochte, das fließende Wasser zu überqueren.
»Wenn du mich noch länger um diese Gipfel jagst …«, begann er schon, doch die Worte erstarben auf seinen Lippen, als er seine Beute endlich erspähte. Sie befand sich etwa dreißig Schritt von ihm entfernt in einer engen Kluft. Nur ihre Hinterläufe waren sichtbar.
Obwohl er keinen guten Blick auf das Geschöpf hatte – es schien sich selbst zwischen einem großen Felsbrocken und der Kluftwand festgeklemmt zu haben –, wusste er doch sofort, dass etwas nicht stimmte. Die Kreatur war still, zu still. Daran sowie an der Art, wie sie die Hinterläufe abgespreizt hatte, war etwas Unnatürliches.
»Na los, Ziege«, murmelte er, als er sich ihr näherte. Er hoffte, dass sich das Tier nicht allzu schwer verletzt hatte. Die Schin-Mönche waren nicht reich und auf ihre Viehherden angewiesen, wenn es um Milch und Fleisch ging. Falls Kaden mit einem verletzten – oder schlimmer noch: einem toten – Tier zurückkehrte, würde ihm sein Umial eine schwere Bestrafung auferlegen.
»Na komm, alter Knabe«, sagte er und bahnte sich langsam einen Weg durch die Schlucht. Die Ziege schien festzustecken, aber falls sie noch laufen konnte, wollte er sie keineswegs durch all die Knochenberge jagen müssen. »Unten lässt es sich besser grasen. Wir gehen gemeinsam dorthin zurück.«
Die Abendschatten verbargen das Blut, bis er beinahe darin stand; die Lache war breit und dunkel und starr. Etwas musste das Tier ausgeweidet haben, von der Hüfte aus bis in den Magen geschnitten und damit die Muskeln durchgetrennt und das Gedärm zerdrückt haben. Während Kaden den Kadaver betrachtete, tropfte das letzte Blut heraus, das aus dem weichen Bauchfell eine verfilzte Masse hatte werden lassen und nun an den steifen Beinen herunterlief. Wie Urin.
»Bei Schael«, fluchte er und sprang über den Steinblock. Es war nicht ungewöhnlich, dass eine Felsenkatze eine Ziege riss, aber nun blieb ihm nichts anderes übrig, als den Kadaver den ganzen Weg bis hinunter zum Kloster auf den Schultern zu tragen. »Du musstest ja unbedingt herumwandern«, sagte er. »Du …«
Er verstummte und erstarrte, als er das Tier endlich in seiner vollständigen Gestalt sehen konnte. Kalte Angst hauchte über seine Haut. Er unterdrückte dieses Gefühl sofort wieder, indem er tief Luft holte. Die Schin-Ausbildung war nicht zu vielem nütze, aber nach acht Jahren war es ihm immerhin gelungen, seine Empfindungen zu dämpfen. Er verspürte zwar noch immer Angst, Neid, Wut oder Überschwang, aber all das drang nicht mehr so tief in ihn ein wie früher. Doch auch aus der Festung seiner Ruhe heraus gelang es ihm nicht, den Blick abzuwenden.
Was immer die Ziege ausgeweidet hatte, es war damit nicht zufrieden gewesen. Irgendein Wesen – Kaden konnte sich nicht vorstellen, worum es sich dabei handeln mochte – hatte dem Tier den Kopf von den Schultern gehackt und die starken Sehnen und Muskeln mit scharfen, heftigen Schlägen durchtrennt, bis nur noch der Halsstumpf übrig geblieben war. Felsenkatzen nahmen sich manchmal ein zu langsames Tier aus der Herde, aber doch nicht auf diese Weise. Diese Wunden waren bösartig, unnötig und zeigten nicht die übliche Effizienz, mit der sonst in der Wildnis getötet wurde. Dieses Tier war nicht nur geschlachtet worden; man hatte es gründlich vernichtet.
Kaden sah sich um und suchte nach dem Rest des Kadavers. Geröll und Geäst waren mit den Frühlingsfluten von den Bergen heruntergeschwemmt worden und hatten sich an der engsten Stelle der Kluft zu einer Masse aus Schlick und skelettartigen, von der Sonne ausgebleichten Holzfingern zusammengeballt. So viel Schutt war in die Kluft gespült worden, dass es eine Weile dauerte, bis er den Kopf gefunden hatte, der in einiger Entfernung auf der Seite lag. Ein großer Teil des Fells war abgerissen und der Schädel gespalten worden. Das Hirn war verschwunden – wie aus der Schale gelöffelt.
Kadens erster Gedanke galt der Flucht. Noch immer tropfte Blut aus dem Fell der Ziege; es wirkte im abnehmenden Licht eher schwarz als rot, und was immer diese Verwüstung angerichtet haben mochte, es konnte sich noch zwischen den Felsen befinden. Keines der hiesigen Raubtiere würde es wagen, Kaden anzugreifen – für seine siebzehn Jahre war er groß. Und ein halbes Leben körperlicher Arbeit hatte ihn schlank und stark gemacht. Aber er wusste doch auch, dass keines der hiesigen Raubtiere einer Ziege den Kopf abhacken und ihr Hirn fressen würde.
Er wandte sich dem Eingang der Kluft zu. Die Sonne war nun hinter der Steppe versunken und ließ nur einen verbrannten Streifen über dem Grasland im Westen zurück. Schon füllte die Nacht die Schlucht an wie Öl, das in eine Schüssel sickerte. Selbst wenn er sofort aufbrach und so schnell wie möglich rannte, würde er die letzten Meilen bis zum Kloster in völliger Finsternis zurücklegen müssen. Auch wenn er seine Angst vor einer Nacht in den Bergen schon lange abgelegt hatte, gefiel ihm die Vorstellung gar nicht, über den holprigen Felsenpfad zu stolpern und dabei möglicherweise von einem unbekannten Raubtier durch die Dunkelheit verfolgt zu werden.
Er machte einen Schritt weg von der zerschmetterten Kreatur, dann zögerte er.
»Heng wird ein Bild davon haben wollen«, murmelte er und zwang sich zurück zum Ort des Abschlachtens.
Mit einem Stück Pergament und einem Pinsel konnte jeder ein Gemälde herstellen, aber die Schin erwarteten mehr von ihren Novizen und Akolythen. Ein Bild war das Ergebnis des Sehens, und die Mönche sahen auf eine ganz eigene Art. Sie nannten es Saama’an: »der Geschnitzte Geist«. Es war natürlich nur eine Übung – ein Schritt auf dem langen Weg, der zur letzten Befreiung und in die Vaniate führte, aber diese Übung besaß durchaus ihre eigenen Vorteile. Während seiner acht Jahre in den Bergen hatte Kaden gelernt, die Welt richtig zu sehen: so wie sie war. Er kannte die Spur des gefleckten Bären, die Zahnung des Gabelblatts, die Furchen der fernen Gipfel. Er hatte zahllose Stunden, Wochen, Jahre damit verbracht, die Dinge zu betrachten, zu sehen und sie sich einzuprägen. Er konnte Tausende Pflanzen oder Tiere bis in die letzte Einzelheit malen und war in der Lage, eine neue Szenerie innerhalb nur weniger Herzschläge in sich aufzunehmen.
Er brauchte zwei langsame Atemzüge und räumte einen Platz in seinem Kopf frei – wie eine leere Schiefertafel, auf der nun jedes Detail eingeritzt werden konnte. Die Angst blieb, aber sie war ein Hindernis, und so dämpfte er sie und richtete seine ganze Aufmerksamkeit auf die vor ihm liegende Aufgabe. Als er die Schiefertafel vorbereitet hatte, machte er sich an die Arbeit. Es dauerte nur wenige Atemzüge, bis er den abgetrennten Kopf, die Lachen aus dunklem Blut und den zerfetzten Kadaver des Tieres eingeritzt hatte. Die Linien waren kräftig und fest, feiner als jeder Pinselstrich, und im Gegensatz zu einer gewöhnlichen Erinnerung hinterließ dieser Prozess ein scharfes, lebhaftes Bild in ihm, das so haltbar war wie die Steine, auf denen er stand, und an das er sich jederzeit nach seinem Willen erinnern und es eingehend betrachten konnte. Er beendete den Saama’an und stieß langsam und vorsichtig die Luft aus.
Angst ist Blindheit, murmelte er und wiederholte damit einen alten Schin-Aphorismus. Ruhe hingegen ist Klarsicht.
Diese Worte spendeten angesichts der blutigen Szenerie, die da vor ihm lag, zwar nur schwachen Trost, doch nun, da er die Einritzung besaß, konnte er von hier fortgehen. Er warf einen kurzen Blick über die Schulter, suchte die Felsen nach Anzeichen des Raubtiers ab und wandte sich dann der Schluchtöffnung zu. Während der dunkle Nebel der Nacht über die Berggipfel rollte, rannte er in der Finsternis über die trügerischen Pfade; mit sandalenbewehrten Füßen hastete er an umgestürzten Baumstämmen und hinterhältigen Steinen vorbei. Seine Beine, die nach so vielen Stunden des Anschleichens an die Ziege kalt und steif geworden waren, erwärmten sich unter der Bewegung allmählich, während sein Herz zu einem stetigen Schlag zurückfand.
Du läufst nicht davon, sagte er sich. Du gehst nur nach Hause.
Dennoch stieß er etwa eine Meile weiter den Pfad hinunter einen leisen Seufzer der Erleichterung aus, als er einen Felsenturm umrundete, den die Mönche »die Kralle« nannten. In der Ferne erblickte er Aschk’lan. Tausende Fuß unter ihm hockten die kleinen Steinhäuser zusammengedrängt auf einem schmalen Felsvorsprung, als versuchten sie, sich so weit wie möglich vom Abgrund fernzuhalten. Warme Lichter leuchteten in einigen Fenstern. In der Refektoriumsküche würde ein Feuer knistern, in der Meditationshalle brannten sicherlich die Lampen, und die Schin würden sanft und leise summen, während sie ihre abendlichen Waschungen und Rituale durchführten. Sicherheit. Ungebeten stieg das Wort in seinen Gedanken auf. Dort unten herrschte Sicherheit, und trotz seiner Entschlossenheit wurde Kaden schneller, rannte auf jene wenigen, schwachen Lichter zu und floh vor dem, was die unbekannte Finsternis hinter ihm durchstreifen mochte.
2
Im Laufschritt überquerte Kaden die Felsvorsprünge außerhalb von Aschk’lans zentralem Platz und wurde erst langsamer, als er diesen betrat. Seine Angst, die so scharf und stark gewesen war, als er die abgeschlachtete Ziege zum ersten Mal gesehen hatte, war auf dem Abstieg von den Gipfeln bis hierher zu der Wärme und Gemeinschaft des Klosters schwächer geworden. Als er sich nun zwischen den Hauptgebäuden bewegte, kam er sich närrisch vor, weil er so schnell gelaufen war. Was immer das Tier getötet hatte, es würde ein Rätsel bleiben, und dumm war es von ihm gewesen, in der Dunkelheit so schnell über die gefährlichen Bergpfade zu rennen. Kaden zwang sich zu einem Spazierschritt und sammelte seine Gedanken.
Es ist schon schlimm genug, dass ich die Ziege verloren habe, dachte er reuevoll. Heng hätte mich auspeitschen lassen, wenn ich mir während des Laufens auch noch das Bein gebrochen hätte.
Der Kies auf den Wegen des Klosters knirschte unter seinen Füßen; es war hier der einzige Laut neben dem Jaulen des Windes, das in Böen anschwoll und wieder nachließ und durch die verkrümmten Zweige und zwischen den kalten Steinen entlangfuhr. Die Mönche waren allesamt bereits drinnen, hockten entweder über ihren Schüsseln oder fasteten in der Meditationshalle auf der Suche nach der vollkommenen Leere. Als er das lange, niedrige Steingebäude des Refektoriums erreicht hatte, das von Sturm und Regen verwittert war und fast wie ein Teil des Berges wirkte, blieb Kaden stehen und trank ein wenig Wasser aus dem hölzernen Fass neben der Tür. Während das Wasser durch seine Kehle rann, zwang er sich, ruhiger zu atmen. Auch sein Herzschlag verlangsamte sich. Es wäre nicht gut, wenn er sich seinem Umial in einem Zustand geistigen Aufruhrs näherte. Schließlich schätzten die Schin vor allem Stille und Klarheit. Kaden war von seinen Meistern schon ausgepeitscht worden, weil er sich ungebührlich schnell bewegt, gerufen und unbedacht gehandelt hatte. Außerdem war er jetzt zu Hause. Was immer die Ziege getötet hatte, zwischen diesen strengen Gebäuden würde es vermutlich nicht auf die Jagd gehen.
Aus der Nähe wirkte Aschk’lan nicht sonderlich beeindruckend – vor allem nicht in der Nacht. Es bestand aus drei langen Steinhallen mit hölzernen Dächern: dem Dormitorium, dem Refektorium und der Meditationshalle, die zusammen drei Seiten eines annähernden Rechtecks bildeten. Ihre bleichen Granitwände wirkten im Mondenschein, als wären sie mit Milch abgewaschen worden. Die Gebäude hockten am Rand einer Klippe, und die vierte Seite des Rechtecks öffnete sich hin zu den Wolken, dem Himmel und einem ungehinderten Blick auf das Vorgebirge und die ferne Steppe im Westen. Die Grasebene tief unten leuchtete in einer Gischt aus Frühlingsfarben: wogende blaue Chalender, Büschel aus Nonnenblüten und Ansammlungen winziger weißer Glaubensknoten. Doch in der Nacht und unter dem kalten, unergründlichen Blick der Sterne war die Steppe unsichtbar. Kaden starrte über den Vorsprung hinaus und fand sich einer gewaltigen Leere gegenüber – einem mächtigen dunklen Abgrund. Fast hatte er den Eindruck, als befände sich Aschk’lan am Ende der Welt. Es klammerte sich an die Klippen und hielt Wacht gegen ein Nichts, das die gesamte Schöpfung zu verschlingen drohte. Nach einem zweiten Schluck Wasser wandte er sich ab. Die Nacht war kalt geworden, und nun, da er nicht mehr lief, drangen die Windböen, die von den Knochenbergen herabwehten, wie Eissplitter durch seine verschwitzte Kutte.
Mit einem Grummeln im Magen wandte er sich dem gelben Schein und dem Murmeln der Gespräche zu, die durch die Fenster des Refektoriums zu hören waren. Zu dieser Stunde – kurz nach Sonnenuntergang, aber noch vor dem Nachtgebet – nahmen die meisten Mönche ein bescheidenes Abendmahl aus gesalzenem Hammel, Steckrüben und hartem, dunklem Brot zu sich. Heng, Kadens Umial, war sicherlich bei den anderen im Innern des Gebäudes, und mit ein wenig Glück konnte Kaden einen Bericht über das abgeben, was er gesehen hatte, dann ein rasches Bild von der grausigen Szenerie malen und sich schließlich zu einem warmen Mahl niedersetzen. Die Speisen der Schin waren viel magerer als die Köstlichkeiten, an die er sich aus seinen frühen Jahren im Palast der Dämmerung erinnerte, bevor sein Vater ihn weggeschickt hatte. Doch es gab ein Sprichwort unter den Mönchen: Der Hunger ist die Würze.
Die Schin waren Meister der Sprichwörter, die sie von einer Generation an die nächste weitergaben, als wollten sie damit das Fehlen von Ritualen und Liturgien im Orden wettmachen. Der Leere Gott gab nichts um den Prunk und das Gepränge der städtischen Tempel. Während sich die Jungen Götter an Musik, Gebet und Gaben mästeten, die auf reich verzierten Altären für sie bereitgelegt wurden, forderte der Leere Gott von den Schin nur eines: das Opfer – keinen Wein oder Reichtum, sondern das Selbst. Der Geist ist eine Flamme, sagten die Mönche. Blase sie aus.
Auch noch nach acht Jahren war sich Kaden nicht sicher, was das bedeutete, und während sein Magen ungeduldig knurrte, hatte er keine Lust, jetzt über diese Frage nachzudenken. Er stieß die schwere Refektoriumstür auf, und das sanfte Gemurmel der Stimmen überspülte ihn. Überall in der Halle saßen die Mönche. Einige hatten sich an den groben Tischen niedergelassen und hielten die Köpfe über ihre Schüsseln, andere standen vor einem Feuer, das im Kamin am anderen Ende des Raumes knisterte. Mehrere saßen vor Spielsteinen und betrachteten mit leeren Augen die Linien des Widerstands und Angriffs, die sich auf dem Brett zeigten.
Die Männer waren so unterschiedlich wie die Länder, aus denen sie stammten. Es gab große, blasse und stämmige Edischer aus dem hohen Norden, wo das Meer das halbe Jahr hindurch gefroren war, dazu waren drahtige Hannaner zu sehen, deren Hände und Unterarme von den Tintenmustern der Dschungelstämme nördlich des Hüftlandes überzogen waren, und sogar ein paar grünäugige Manjari waren anwesend, deren Haut noch eine Nuance dunkler war als die von Kaden. Trotz ihrer verschiedenartigen Erscheinung teilten die Mönche jedoch etwas: die Härte und Stille, die aus dem Leben in den harten und stillen Bergen herrührte. Sie alle schienen weit entfernt von den Bequemlichkeiten der Welt, in der sie aufgewachsen waren.
Die Schin waren ein kleiner Orden, der kaum zweihundert Mönche in Aschk’lan zählte. Die Jungen Götter – Eira, Heqet, Orella und der Rest – zogen Anhänger aus drei Kontinenten an und besaßen Tempel in fast jedem Dorf und jeder Stadt. Es waren prunkvolle Orte voller Seide und Gold, und einige kamen den Behausungen der reichsten Minister und Atrepe gleich. Heqet allein hatte sicherlich Tausende Priester und noch zehnmal so viele, die an seinem Altar beteten, wenn sie sich Mut machen wollten.
Die weniger angenehmen Götter besaßen ebenfalls ihre Anhänger. Es gingen viele Geschichten über die Hallen von Rassambur und die blutigen Diener Ananschaels um – Geschichten über Kelche, die aus Hirnschalen bestanden und aus denen das Mark tropfte; Geschichten über Neugeborene, die im Schlaf erdrosselt wurden; Geschichten über dunkle Orgien, in denen sich Lüsternheit und Tod auf scheußlichste Weise mischten. Einige behaupteten, dass nur ein Zehntel all jener, die durch die Türen dieser Kulte traten, je wieder herauskamen. Zu sich genommen vom Herrn der Knochen, flüsterten die Menschen untereinander. Zu sich genommen vom Tod persönlich.
Die Älteren Götter, die weit von der Welt entfernt waren und sich nicht in die Angelegenheiten der Menschen einmischten, zogen weniger Gläubige an. Dennoch hatten auch sie ihre gewichtigen Namen – Intarra und ihr Gemahl, der »Hull die Fledermaus« genannt wurde, Pta und Astar’ren. Diese waren über die drei Kontinente verteilt; Tausende beteten ihre Namen an.
Nur der Leere Gott war namenlos und gesichtslos. Die Schin waren der Ansicht, dass er der Älteste, der Kryptischste und auch der Mächtigste war. Außerhalb von Aschk’lan wurde er im Allgemeinen für tot erachtet, und etliche glaubten sogar, er habe nie existiert. Einige behaupteten, er sei von Ae ermordet worden, als sie die Welt und den Himmel und die Sterne erschaffen hatte. Das schien Kaden durchaus glaubhaft zu sein. In all den Jahren, in denen er nun schon die Bergpässe hinauf- und hinunterlief, hatte er nie ein Anzeichen dieses Gottes gesehen.
Er suchte den Raum nach seinen Akolythen-Gefährten ab, und an einem Tisch drüben vor der Wand fing Akiil seinen Blick auf. Er saß auf einer langen Bank zusammen mit Serkhan und dem fetten Phirum Prumm – dem einzigen Akolythen in ganz Aschk’lan, der trotz des endlosen Laufens, Schleppens und Bauens, das die älteren Mönche von ihnen verlangten, seinen Leibesumfang behalten hatte. Kaladin nickte und wollte schon zu den dreien hinübergehen, als er auf der anderen Seite der Halle Heng bemerkte. Er unterdrückte einen Seufzer, denn der Umial würde seinem Schüler irgendeine unangenehme Buße auferlegen, sollte Kaden sich erdreisten, am Tisch Platz zu nehmen, ohne zuerst seinen Bericht abgegeben zu haben. Hoffentlich würde die Geschichte der abgeschlachteten Ziege nicht zu viel Zeit in Anspruch nehmen, denn erst danach durfte sich Kaden zu den anderen gesellen und seine Schüssel mit Eintopf erhalten.
Huy Heng war kaum zu übersehen. Eigentlich schien er eher in eine der feinen Weinhallen Annurs als hierher zu gehören – in ein Kloster eingesperrt, das hundert Meilen jenseits der Reichsgrenze lag. Während die anderen Mönche ihren Tätigkeiten mit stiller Nüchternheit nachgingen, pflegte er zu singen, wenn er große Säcke mit Lehm aus den Tiefen holte, und andauernd strömten Scherze aus seinem Mund, wenn er Rüben für die Kochtöpfe des Refektoriums schnitt. Er konnte sogar Witze erzählen, während er seine Schüler blutig schlug. Im Augenblick unterhielt er die Brüder an seinem Tisch mit einer Geschichte, die offenbar äußerst verwickelter Handbewegungen und dazu noch einiger Vogelrufe bedurfte. Als er Kaden näher kommen sah, wich jedoch das Grinsen aus seinem Gesicht.
»Ich habe die Ziege gefunden«, sagte Kaden ohne jede Einleitung.
Heng streckte beide Hände aus, als wollte er die Worte aufhalten, bevor sie ihn erreichten.
»Ich bin nicht mehr dein Umial«, sagte er.
Kaden blinzelte. Scial Nin, der Abt, wies jedes Jahr die Akolythen und Umiale einander neu zu, aber für gewöhnlich gab es dabei keine Überraschungen. Und für gewöhnlich geschah es auch nicht während des Abendessens.
»Was ist passiert?«, fragte er; nun war er auf der Hut.
»Es ist Zeit für dich voranzuschreiten.«
»Jetzt?«
»Die Gegenwart ist die Gegenwart. Morgen wird immer noch ›jetzt‹ sein.«
Kaden schluckte eine ätzende Bemerkung herunter. Selbst wenn Heng nun nicht mehr sein Umial war, konnte der Mönch ihn doch immer noch auspeitschen. »Wen bekomme ich?«, fragte er stattdessen.
»Rampuri Tan«, antwortete Heng mit ausdrucksloser Stimme und ohne sein übliches Lachen.
Kaden betrachtete ihn ungläubig. Rampuri Tan nahm keine Schüler an. Manchmal schien Rampuri Tan gar kein richtiger Mönch zu sein, trotz seiner verblichenen braunen Kutte und dem geschorenen Kopf und trotz all der Tage, die er mit überkreuzten Beinen dasaß und den Blick starr auf die Anbetung des Leeren Gottes gerichtet hatte. Es war nichts, was Kaden hätte benennen können, aber auch die Novizen spürten es und hatten hundert Theorien entwickelt, in denen sie dem Mann eine Reihe unmöglicher Vergangenheiten andichteten, die bisweilen glorreich, bisweilen auch sehr schattenhaft anmuteten. Einige behaupteten, er hätte die Narben in seinem Gesicht bei einem Kampf gegen wilde Tiere in der Arena in Boogen erhalten; andere sagten, er sei ein Mörder und Dieb, der seine Verbrechen bereut habe und nun ein Leben der Kontemplation führe; wieder andere schworen, er sei der enteignete Bruder eines Lords oder Atrepen, der sich in Aschk’lan nur so lange versteckte, bis er seine Rache üben konnte. Kaden war nicht geneigt, irgendeine dieser Geschichten zu glauben, doch er hatte deren Gemeinsamkeit bemerkt: Gewalt. Gewalt und Gefahr. Wer immer Rampuri Tan gewesen sein mochte, bevor er in Aschk’lan eingetroffen war – Kaden war nicht gerade erpicht darauf, diesen Mann zu seinem Umial zu haben.
»Er erwartet dich«, fuhr Heng fort, und etwas wie Mitleid schwang nun in seiner Stimme mit. »Ich habe ihm versprochen, dich zu seiner Zelle zu schicken, sobald du wieder hier bist.«
Kaden warf einen kurzen Blick über die Schulter zu dem Tisch, an dem seine Freunde saßen, ihren Eintopf löffelten und die wenigen freien Augenblicke, die ihnen jeden Tag gewährt wurden, im Gespräch genossen.
»Sofort«, sagte Heng und durchbrach damit seine Gedanken.
Es war nicht weit vom Refektorium zum Dormitorium: hundert Schritte quer über den Platz, dann einen kurzen Pfad zwischen zwei Reihen von gedrungenen Wacholderbüschen entlang. Kaden brachte die Strecke rasch hinter sich, denn er wollte nur so lange wie unbedingt nötig im Wind verweilen, und drückte die schwere Holztür auf. Alle Mönche – sogar Scial Nin – schliefen in gleichförmigen Kammern, die an einem langen Mittelkorridor lagen. Die Zellen waren so klein, dass kaum eine Pritsche hineinpasste. Außerdem lag in jeder eine gewebte Matte, und es gab ein paar Regale; das war alles. Doch die Schin verbrachten die meiste Zeit draußen in den Werkstätten oder bei der Meditation.
Als er dem schneidenden Wind entkommen war und sich im Innern des Gebäudes befand, wurde Kaden langsamer und bereitete sich auf die Begegnung vor. Es war schwer zu sagen, was ihn erwartete. Manche Meister liebten es, einen neuen Schüler sofort auf die Probe zu stellen; andere zogen es vor abzuwarten, zu beobachten und die Fähigkeiten und Schwächen des jüngeren Mönchs zu bewerten, bevor sie sich zu der einen oder anderen Art der Ausbildung entschlossen.
Er ist nicht mehr als noch so ein neuer Meister, sagte Kaden zu sich selbst. Heng war vor einem Jahr ebenfalls neu für dich, und du hast dich schnell an ihn gewöhnt.
Doch irgendetwas an dieser Situation war seltsam und beunruhigend. Zuerst die abgeschlachtete Ziege, dann diese unerwartete neue Zuweisung, wobei er doch eigentlich auf der langen Bank sitzen, eine dampfende Schüssel voller Eintopf vor sich haben und mit Akiil und dem Rest der Akolythen sprechen sollte …
Langsam füllte er seine Lunge mit Luft, dann atmete er wieder aus. Es half ihm doch nichts, wenn er sich Sorgen machte.
Lebe jetzt, sagte er sich und wiederholte dabei einen der üblichen Schin-Aphorismen. Die Zukunft ist nichts als ein Traum. Dennoch erinnerte ihn eine Stimme in seinem Kopf – eine Stimme, die sich weder unterdrücken noch überzeugen ließ – daran, dass nicht alle Träume angenehm waren und es manchmal unmöglich war aufzuwachen, wie sehr man sich auch herumwälzen und im Schlaf um sich schlagen mochte.
3
Rampuri Tan saß mit dem Rücken zur Tür auf dem Boden seiner kleinen Zelle; ein großes, leeres Pergamentblatt lag ausgebreitet vor ihm auf den Fliesen. In der linken Hand hielt er einen Pinsel, hatte ihn bisher aber nicht in die Schale mit schwarzer Tinte neben ihm getaucht, wie lange er auch immer bereits hier sitzen mochte.
»Herein«, sagte der Mann und winkte mit der freien Hand, ohne sich zur Tür umzudrehen.
Kaden überquerte die Schwelle und hielt inne. Die ersten Augenblicke mit einem neuen Umial konnten die Grundstimmung der gesamten Beziehung zu ihm festlegen. Die meisten Mönche wollten ihren Schülern sehr früh verdeutlichen, was sie erwartete, und Kaden hatte keine Lust, eine zermürbende Strafe zu erhalten, nur weil er einen unvorsichtigen Schritt gemacht oder einen falschen Schluss gezogen hatte. Doch Tan schien damit zufrieden zu sein, schweigend auf das leere Blatt zu starren, und so ermahnte sich Kaden zur Geduld und wandte sich seinem neuen Meister zu.
Es war deutlich zu sehen, warum die Novizen auf den Gedanken gekommen waren, der ältere Mönch könnte in der Arena gekämpft haben. Auch wenn Tan schon in seinem fünften Lebensjahrzehnt stand, war er noch immer kräftig und so massig wie ein Felsbrocken; Schultern und Hals waren dick und voll mächtiger Muskeln. Zerfurchte Narben, die sich blass von der dunkleren Haut abhoben, verliefen durch die Stoppeln auf der Kopfhaut. Es wirkte, als hätte eine Bestie immer wieder ihre Krallen in seinen Kopf getrieben; das Fleisch war irgendwann einmal bis auf die Schädeldecke aufgerissen worden. Was immer diese Wunden verursacht haben mochte, es musste eine schrecklich qualvolle Erfahrung gewesen sein. Kadens Gedanken hüpften zurück zu dem Ziegenkadaver, und er zitterte.
»Du hast das Tier gefunden, das du für Heng suchen solltest«, sagte der ältere Mönch unvermittelt. Es war keine Frage, und Kaden zögerte einen Augenblick.
»Ja«, sagte er schließlich.
»Hast du es zu seiner Herde zurückgebracht?«
»Nein.«
»Warum nicht?«
»Es ist getötet worden. Auf bestialische und abscheuliche Weise.«
Tan legte den Pinsel ab, erhob sich in einer fließenden Bewegung, drehte sich um und sah seinen neuen Schüler zum ersten Mal an. Er war groß, fast genauso groß wie Kaden selbst, und plötzlich schien in der kleinen Zelle nur noch sehr wenig Platz zu sein. Dunkle und harte Augen, die wie Nägelköpfe wirkten, richteten sich auf Kaden. Zu Hause in Annur gab es Männer aus dem westlichen Eridroa und dem tiefen Süden – Tierbändiger –, die in der Lage waren, Bären und Jaguare allein mit der Kraft ihres Blickes zu bezwingen. Kaden fühlte sich nun wie eine dieser Kreaturen, und es kostete ihn große Kraft, seinen neuen Umial noch weiter anzusehen.
»Eine Felsenkatze?«, fragte der ältere Mönch.
Kaden schüttelte den Kopf. »Etwas hat dem Tier den Hals durchtrennt; es hat ihn durchgehackt. Und dann hat es das Hirn verschlungen.«
Tan betrachtete ihn und deutete auf den Pinsel, die Schale und das Pergament, das noch auf dem Boden lag. »Male ein Bild davon.«
Kaden setzte sich mit einiger Erleichterung. Auch wenn ihn unter Tans Lehrerschaft möglicherweise noch etliche Überraschungen erwarteten, teilte der ältere Mönch doch wenigstens einige Angewohnheiten mit Heng: Wenn er etwas Ungewöhnliches hörte, wollte er ein Bild davon haben. Nun, das war leicht. Kaden atmete zweimal tief durch, sammelte seine Gedanken und rief dann den Saama’an herbei. Der Anblick erfüllte seinen Kopf mit allen Einzelheiten – das nasse Fell, die herabhängenden Fleischfetzen, die leere Hirnschale, die wie eine zerbrochene Schüssel beiseitegeworfen worden war. Er tunkte die Pinselspitze in die Schale und begann mit dem Bild.
Die Arbeit ging rasch voran – sein Studium bei den Mönchen hatte ihm viel Zeit gelassen, seine Fähigkeiten zu vervollkommnen –, und als er schließlich fertig war, legte er den Pinsel ab. Das Gemälde auf dem Pergament hätte durchaus das Abbild seines Geistes sein können, gespiegelt im stillen Wasser eines Teiches.
Stille erfüllte den Raum hinter ihm – eine Stille, die so groß und schwer war wie ein Stein. Kaden war versucht sich umzudrehen, aber er hatte die Anweisung erhalten, sich zu setzen und zu malen, nichts sonst, und so blieb er sitzen, auch noch, nachdem er seine Aufgabe erfüllt hatte.
»Das hast du gesehen?«, fragte Tan schließlich.
Kaden nickte.
»Und du hast die Geistesgegenwart besessen, für den Saama’an dort zu bleiben.«
Zufriedenheit stieg in Kaden hoch. Vielleicht war die Ausbildung unter Tan gar nicht so schlecht.
»Sonst noch etwas?«, fragte der Mönch.
»Nichts.«
Die Peitsche knallte so hart und unerwartet auf ihn nieder, dass sich Kaden auf die Zunge biss. Schmerz flammte in seinem Rücken auf, während sich sein Mund mit dem kupferigen Geschmack des Blutes füllte. Er wollte die Hände nach hinten ausstrecken und den nächsten Schlag abwehren, doch konnte er seinen Instinkt bezwingen. Tan war jetzt sein Umial, und es war das Vorrecht dieses Mannes, Schmerzen und Strafen auszuteilen, wenn er sie als angemessen erachtete. Der Grund für diesen plötzlichen Angriff blieb ihm zwar ein Rätsel, aber Kaden wusste, wie er sich zu verhalten hatte, wenn er ausgepeitscht wurde.
Acht Jahre bei den Schin hatten ihn gelehrt, dass Schmerz ein viel zu allgemeiner Begriff für die Vielzahl von Empfindungen war, die er zu umschreiben versuchte. Er hatte die grausamen Schmerzen kennengelernt, die in seine Füße fuhren, wenn diese zu lange in eiskaltem Wasser steckten, und er kannte das Stechen und Jucken, wenn sie wieder warm wurden. Er hatte auch den tiefen Wundschmerz von Muskeln erfahren, die überanstrengt worden waren, ebenso die Qualblüten gesehen, die sich am nächsten Tag öffneten, wenn er das zarte Fleisch mit seinen Daumen massierte. Und dann gab es noch den raschen, durchdringenden Schmerz einer sauberen Messerwunde und den dumpfen, pochenden Kopfschmerz nach dem Fasten einer ganzen Woche. Die Schin waren große Anhänger des Schmerzes. Sie sagten, er sei eine Erinnerung daran, wie eng wir an unser eigenes Fleisch gebunden sind. Eine Erinnerung an das Versagen.
»Beende das Bild«, sagte Tan.
Kaden rief den Saaama’an in seine Erinnerung zurück und verglich ihn mit dem Pergament vor ihm. Er hatte alle Einzelheiten getreu wiedergegeben.
»Es ist fertig«, erwiderte er zögernd.
Die Peitsche ging wieder auf ihn nieder, aber diesmal war er vorbereitet. Sein Geist leitete den Schock ab, während sein Körper sanft unter dem Schlag schaukelte.
»Beende das Bild«, wiederholte Tan.
Kaden zögerte. Für gewöhnlich zog es unweigerlich eine Bestrafung nach sich, wenn man seinem Umial eine Frage stellte, aber da er bereits geschlagen worden war, konnte ein wenig Klarheit kaum einen noch größeren Schaden anrichten.
»Ist das eine Probe?«, fragte er vorsichtig. Die Mönche dachten sich alle Arten von Proben für ihre Schüler aus, in denen die Novizen und Akolythen ihre Fähigkeiten und ihr Verständnis unter Beweis stellen mussten.
Die Peitsche fuhr ihm wieder zwischen die Schultern. Die ersten beiden Schläge hatten die Kutte aufgerissen, und Kaden spürte, wie nun die nackte Haut zerfetzt wurde.
»Es ist, was es ist«, erwiderte Tan. »Von mir aus kannst du es eine Probe nennen, aber der Name ist nicht dasselbe wie der Gegenstand.«
Kaden unterdrückte ein Ächzen. Welche Seltsamkeiten Tan auch aufweisen mochte, er redete in derselben verrätselten Weise wie die übrigen Schin.
»Ich erinnere mich an nichts weiter«, sagte Kaden. »Das ist der gesamte Saama’an.«
»Das reicht nicht«, sagte Tan, aber diesmal schlug er nicht zu.
»Das ist alles«, wandte Kaden ein. »Die Ziege, der Kopf, die Blutlachen und sogar ein paar Fellbüschel, die an einem Felsen klebten. Ich habe alles abgemalt.«
Dafür erhielt Tan zwei weitere Peitschenschläge.
»Jeder Narr kann sehen, was da ist«, meinte der Mönch trocken. »Ein Kind, das die Welt betrachtet, kann dir sagen, was sich vor ihm befindet. Aber du musst auch das sehen, was nicht da ist. Du musst das sehen, was nicht da ist.«
Kaden bemühte sich, einen Sinn in diesen Worten zu erkennen. »Was immer die Ziege getötet hat, es ist nicht da«, begann er langsam.
Ein weiterer Peitschenhieb.
»Natürlich nicht. Du hast es verscheucht. Oder es ist von selbst weggegangen. Wie dem auch sei, man darf nicht erwarten, ein wildes Tier über seiner Beute anzutreffen, wenn es einen Menschen riecht oder hört.«
»Also suche ich nach etwas, das da sein sollte, aber nicht da ist.«
»Denke in deinen Gedanken. Benutze deine Zunge nur dann, wenn du wirklich etwas zu sagen hast.«
Auf diese Worte ließ Tan drei weitere heftige Peitschenschläge folgen. Die Striemen weinten Blut. Kaden spürte, wie es heiß, feucht und klebrig an seinem Rücken herunterrann. Er war schon schlimmer ausgepeitscht worden, aber immer nur dann, wenn er einen schwerwiegenden Fehler begangen hatte. Stets hatte es sich um eine ernste Bestrafung gehandelt; nie aber war diese während eines einfachen Gesprächs erfolgt. Es wurde immer schwerer, die durchdringenden Schmerzen nicht zu beachten, und er bemühte sich, seine Gedanken auf die vor ihm liegende Aufgabe zu richten. Aus Gnade würde Tan nicht mit dem Peitschen aufhören; das war inzwischen klar.
Du musst etwas sehen, das nicht da ist.
Das war typischer Schin-Unsinn, aber wie der meiste Unsinn würde er sich am Ende wohl als wahr herausstellen.
Kaden betrachtete den Saama’an. Jeder Teil der Ziege war dort wiedergegeben, sogar die Eingeweide, die als schlaffe weiße Seile unter dem Bauch des Tieres in einem Haufen lagen. Das Hirn war verschwunden, aber den aufgebrochenen Schädel hatte er deutlich gemalt und genau gezeigt, wo es entfernt worden war. Was sonst erwartete Tan noch zu sehen? Kaden war der Ziege bis in die Schlucht gefolgt und …
»Spuren«, sagte er und begriff. »Wo sind die Spuren des Wesens, das die Ziege getötet hat?«
»Das ist eine sehr gute Frage«, sagte Tan. »Waren sie da?«
Kaden versuchte sich zu erinnern. »Ich bin mir nicht sicher. Sie sind nicht auf dem Saama’an … aber ich hatte mich ganz auf die Ziege konzentriert.«
»Es scheint, dass deine goldenen Augen auch nicht besser sehen als alle anderen.«
Kaden blinzelte. Nie zuvor hatte ein Umial seine Augen erwähnt – es wäre der Erwähnung seines Vaters oder seines Geburtsrechts zu nahe gekommen. Die Schin waren durch und durch egalitär. Novizen waren Novizen; Akolythen waren Akolythen; und die vollwertigen Brüder waren vor dem Leeren Gott allesamt gleich. Doch Kadens Augen waren wirklich einzigartig. Tan hatte sie »golden« genannt, aber tatsächlich strahlte ihre Iris. Als Kind hatte Kaden in die Augen seines Vaters gestarrt – alle annurischen Kaiser hatten solche Augen – und sich über die Art und Weise gewundert, wie die Farben darin zu wirbeln und zu brennen schienen. Manchmal loderten sie auch auf wie ein Feuer im Luftzug, manchmal glühten sie in dunkelroter Hitze. Seine Schwester Adare hatte ebenfalls solche Augen, doch diese schienen Funken zu sprühen und wie ein Feuer aus grünen Zweigen zu zucken. Als das älteste der kaiserlichen Kinder hatte Adare den Blick nur selten auf ihre jüngeren Brüder gerichtet, und wenn sie es doch getan hatte, dann war es für gewöhnlich in Verärgerung geschehen. Der Familienlegende zufolge stammten die brennenden Augen von Intarra, der Herrin des Lichts persönlich, die vor Jahrhunderten oder Jahrtausenden – niemand schien sich in dieser Hinsicht sicher zu sein – Menschengestalt angenommen und einen von Kadens Vorfahren verführt hatte. Diese Augen bezeichneten ihn als den wahren Erben des Unbehauenen Throns und Annurs selbst, des Reiches, das sich über zwei Kontinente erstreckte.
Die Schin hatten an Menschenreichen natürlich kein größeres Interesse als an Intarra. Die Herrin des Lichts war eine der alten Gottheiten, älter als Meschkent oder Maat, älter sogar als Ananschael, der Herr der Knochen. Sie bewirkte den bogenförmigen Lauf der Sonne durch den Himmel, die Hitze des Tages und das Leuchten des Mondes. Doch den Mönchen zufolge war sie ein Kind, das im gewaltigen Haus der Leere mit Feuer spielte – im endlosen und ewigen Abgrund, der die Heimat des Leeren Gottes bedeutete. Eines Tages würde Kaden nach Annur zurückkehren und seinen Platz auf dem Unbehauenen Thron beanspruchen, doch solange er in Aschk’lan lebte, war er bloß ein Mönch wie alle anderen auch, einer, der arbeiten und gehorchen musste. Seine Augen retteten ihn keineswegs vor Tans brutaler Befragung.
»Vielleicht hat es Spuren gegeben«, schloss Kaden leise. »Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen.«
Eine Weile schwieg Tan, und Kaden fragte sich, ob das Auspeitschen gleich fortgesetzt würde.
»Die Mönche waren zu nachsichtig mit dir«, meinte Tan schließlich mit ruhiger, aber harter Stimme. »Diesen Fehler werde ich nicht machen.«
Erst später, als Kaden wach in seiner Koje lag und nur flach atmete, damit die brennenden Schmerzen im Rücken nicht allzu stark wurden, begriff er, was sein neuer Umial gesagt hatte: »Die Mönche.« Als gehörte Rampuri Tan nicht zu ihnen.
4
Trotz der scharfen und salzigen Brise, die vom Meer herbeiwehte, stanken die Leichen.
Adaman Fanes Geschwader hatte das Schiff vor zwei Tagen auf einer Routinepatrouille entdeckt. Die Segel waren zerfetzt und flatterten im Wind, an der Reling klebte getrocknetes Blut, und die Mannschaft war in Stücke gehackt worden. Nun verweste sie auf dem Deck. Als die Kadetten eintrafen, hatte die sengende Frühlingssonne bereits mit der Arbeit begonnen; sie hatte die Leiber aufgedunsen und die Haut fest über Knochen und Schädel gespannt. Fliegen krochen aus den Ohren der toten Seeleute, drangen zwischen die schlaffen Lippen und rieben sich die Beißwerkzeuge über ausgetrockneten Augäpfeln.
»Irgendwelche Theorien?«, fragte Ha Lin und stieß den Leichnam, der ihr am nächsten lag, mit dem Zeh an.
Valyn zuckte die Schultern. »Ich glaube, wir können einen Kavallerieangriff ausschließen.«
»Sehr hilfreich«, erwiderte sie, schürzte die Lippen und kniff ihre mandelförmigen Augen zusammen.
»Wer immer das gemacht hat, er war gut. Sieh dir das hier an.«
Er hockte sich hin und entfernte die blutverkrustete Kleidung des Leichnams über der Stichwunde knapp unterhalb der vierten Rippe. Lin kniete sich daneben, beleckte ihren kleinen Finger und steckte ihn bis zum zweiten Knöchel in die Wunde.
Ein Fremder, der Ha Lin auf der Straße begegnen mochte, konnte sie für die sorgenfreie Tochter eines Kaufmanns an der Schwelle zum Erwachsenendasein halten: heiter und unbeschwert, mit sonnengebräunter Haut und glänzenden schwarzen Haaren, die zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden waren. Aber sie hatte die Augen eines Soldaten. In den letzten acht Jahren hatte sie die gleiche Ausbildung wie Valyn und alle anderen Kadetten durchlaufen, die sich gegenwärtig an Deck des verfluchten Schiffes befanden, und die Kettral hatten sie schon lange an den Anblick des Todes gewöhnt.
Dennoch sah Valyn in ihr die anziehende junge Frau, die sie auch war. Grundsätzlich vermieden die Soldaten romantische Abenteuer auf den Inseln. Drüben auf Hook waren Huren beiderlei Geschlechts billig zu haben, und niemand legte es auf Liebesstreitigkeiten zwischen Männern und Frauen an, die dazu ausgebildet waren, auf Dutzende verschiedener Arten zu töten. Dennoch wanderten Valyns Blicke hin und wieder von den Aufgaben, die vor ihm lagen, zu Ha Lin hinüber: zum Lächeln ihrer Lippen und zu den Umrissen ihrer Gestalt unter der schwarzen Kampfkleidung. Er versuchte seine Blicke zu verbergen – sie waren peinlich und unangemessen –, aber er schloss aus dem ironischen Grinsen, das manchmal über ihr Gesicht zuckte, dass ihr seine Aufmerksamkeiten nicht entgangen waren.
Es schien ihr gleichgültig zu sein. Manchmal erwiderte sie sein Starren sogar mit entwaffnender Offenheit. Unwillkürlich fragte er sich, was sich wohl zwischen ihnen entwickelt hätte, wenn sie irgendwo anders aufgewachsen wären, an einem Ort, wo die Ausbildung nicht ihr gesamtes Leben auffraß. Natürlich war dieses »irgendwo anders« für Valyn hui’Malkeenian der Palast der Dämmerung, der seine ganz eigenen Regeln und Tabus hatte; als Mitglied der kaiserlichen Familie hätte er sie aber genauso wenig lieben können wie als Soldat.
Vergiss es, sagte er wütend zu sich selbst. Er sollte sich auf die Aufgabe konzentrieren, die vor ihm lag, und den Morgen nicht mit Tagträumen über ein anderes Leben verbringen.
»Professionell«, sagte Lin anerkennend; offenbar war ihr entgangen, dass seine Gedanken abgeschweift waren. Sie zog den Finger heraus und wischte sich das verkrustete Blut an ihrer schwarzen Kleidung ab. »Tief genug, um die Niere zu treffen, aber nicht so tief, dass die Klinge stecken bleiben kann.«
Valyn nickte. »Es gibt noch viele andere – mehr, als man von Amateuren erwarten würde.«
Er betrachtete die purpurfarbene Wunde ein wenig länger, dann richtete er sich auf und schaute über die Wellen des Eisenmeeres. Nach all dem Blut tat es gut, eine Minute lang das makellose Blau und die Weite des Himmelskreises zu betrachten.
»Genug ausgeruht!«, bellte Adaman Fane und versetzte Valyn einen Schlag gegen den Hinterkopf, als er auf dem Deck an ihm vorbeischritt und über die Leichen trat, als wären sie Sielstücke oder abgebrochene Sparren. »Schiebt euren Hintern aufs Achterdeck!« Der stämmige, kahlköpfige Ausbilder war schon seit mehr als zwanzig Jahren bei den Kettral und schwamm noch immer jeden Morgen vor Anbruch der Dämmerung durch die Meerenge nach Hook. Er hatte nur wenig Geduld mit Kadetten, die während seiner Übungen lediglich herumstanden.
Valyn begab sich zu den anderen. Natürlich kannte er sie alle; die Kettral waren eine kleine Eliteeinheit. Die gewaltigen Vögel, auf denen sie hinter die feindlichen Linien flogen, konnten nicht mehr als fünf oder sechs Soldaten gleichzeitig tragen. Das Reich verließ sich ganz auf die Kettral, wenn eine Mission schnell und geräuschlos ausgeführt werden musste; für alles andere waren die annurischen Legionen, die Marine oder die Infanterie zuständig.
In Valyns Ausbildungsgruppe befanden sich sechsundzwanzig Personen, von denen sieben gemeinsam mit Fane zu dem aufgegebenen Schiff geflogen waren. Es war eine seltsame Mannschaft: Annick Frencha, dürr wie ein Junge, schneebleich und still wie ein Stein; Balendin mit seinem grausamen Grinsen und dem Falken, der stets auf seiner Schulter hockte; Talal, groß, ernst und mit hellen Augen, die in einem kohlschwarzen Gesicht steckten; Sami Yurl, der anmaßende blonde Sohn eines der mächtigsten Atrepen des Reiches, bronzehäutig wie ein Gott und aufgrund seiner Klingen so gefährlich wie eine Viper. Sie alle hatten nicht viel gemeinsam außer dem Umstand, dass jemand im Oberkommando der Ansicht war, sie könnten eines Tages sehr, sehr gut im Töten von Menschen werden. Vorausgesetzt, dass sie nicht vorher selbst starben.
Alle Ausbildung, alle Lektionen, die acht Jahre des Sprachstudiums, all die Zerstörungsarbeit, die Navigationsübungen, die Ausbildung an den Waffen, die schlaflosen Nachtwachen, die nie endenden körperlichen Züchtigungen, die sowohl den Körper als auch den Geist abhärten sollten – all das diente nur einem einzigen Ziel: Hulls Prüfung. Valyn erinnerte sich an seinen ersten Tag auf den Inseln, als ob er in sein Hirn eingebrannt worden wäre. Die neuen Rekruten waren vom Schiff unmittelbar in ein Sperrfeuer aus Flüchen und Beleidigungen gestolpert und hatten in die wütenden, aufgeregten Gesichter der Veteranen geblickt, die diesen fernen Archipel ihre Heimat nannten und jedes Eindringen von Fremden abzulehnen schienen, auch wenn es sich um Personen handelte, die in ihre Fußstapfen treten wollten. Noch bevor er zwei Schritte gemacht hatte, hatte ihm jemand eine Ohrfeige versetzt und das Gesicht in den feuchten, salzigen Sand gedrückt, bis er kaum mehr Luft bekam.
»Ihr sollt eines wissen«, brüllte jemand – war es einer der Kommandanten? »Nur weil irgendein unfähiger Bürokrat der Meinung war, er müsse euch hierher auf unsere kostbaren Quirin-Inseln verschiffen, bedeutet das noch lange nicht, dass ihr jemals zu Kettral werdet. Einige von euch mögen um Gnade winseln, noch bevor diese Woche vorbei ist. Andere werden in der Ausbildung zusammenbrechen. Viele von euch werden sterben, werden von den Vögeln fallen, in den Frühlingsstürmen ertrinken oder endlos jammern, weil sie sich in irgendeinem elenden hannischen Provinznest die Fleischfäule eingefangen haben. Und das alles ist noch der einfache Teil! Der Teil, der Spaß macht! Diejenigen von euch, die stur genug sind oder einfach nur das unverschämte Glück haben, die Ausbildung zu überleben, müssen sich danach noch immer Hulls Prüfung stellen.«
Hulls Prüfung. Trotz achtjähriger geflüsterter Spekulationen wussten weder Valyn noch die anderen Kadetten heute mehr darüber als bei ihrer Ankunft in Qarsh. Dieses Ereignis schien so fern zu sein und unsichtbar wie ein Schiff hinter dem Horizont. Niemand vergaß es je, doch es war möglich, es für eine Weile zu ignorieren. Schließlich erreichte niemand Hulls Prüfung, wenn er die Zeit der Ausbildung davor nicht überlebte. Doch nach all den Jahren war es nun bald so weit – wie eine Schuld, die vor langer Zeit entstanden war und jetzt beglichen werden musste. In etwas mehr als einem Monat würden Valyn und die anderen in die Reihen der Kettral aufgenommen werden – oder sterben.
»Vielleicht können wir die Parade der Unfähigkeiten dieses Morgens mit Ha Lins Einschätzung der Lage beginnen«, sagte Fane und lenkte Valyns Aufmerksamkeit wieder auf die Gegenwart. Er deutete mit seiner großen Hand auf die junge Frau. Das war lediglich eine Standardübung. Die Kettral leiteten ihre Kadetten immer zu den frischen Schlachtfeldern, deren Untersuchung sie abhärtete und ihnen taktisches Verständnis nahebrachte.
»Es war ein nächtlicher Angriff«, erwiderte Lin mit fester und überzeugter Stimme. »Ansonsten hätten die Seeleute an Deck ihre Angreifer auch gesehen. Das Überfallkommando kam von Steuerbord – man kann die Löcher deutlich erkennen, die von den Enterhaken herrühren. Als die …«
»Heiliger Ananschael am Stiel«, unterbrach Fane sie und hob die Hand, damit sie verstummte. »Eine Kadettin im ersten Jahr hätte mir all das verraten können. Wird mir vielleicht mal jemand etwas sagen, das nicht so klar und deutlich zu sehen ist?« Er schaute sich um und richtete den Blick schließlich auf Valyn. »Wie wäre es mit Seiner Glänzendsten Hoheit?«
Valyn hasste diesen Titel. Er war nicht einmal korrekt, denn zum einen würde er niemals auf dem Unbehauenen Thron sitzen, obwohl sein Vater der Kaiser war, und zum anderen war seine edle Abstammung hier ohne jede Bedeutung. Auf den Inseln gab es keine Rangunterschiede und auch keine besonderen Vorrechte. Valyn arbeitete vielleicht sogar härter als die anderen. Aber er hatte schon vor langer Zeit gelernt, dass man sich umso tiefer in den Schlamassel brachte, je mehr man sich beschwerte, und so holte er nur tief Luft und begann:
»Die Mannschaft wusste nicht einmal, dass sie sich in Schwierigkeiten befunden hat …«
Bevor er den Satz beenden konnte, schnitt Fane ihm das Wort mit einem Schnauben und einer kurzen Handbewegung ab.
»Du hattest zehn Minuten Zeit, dir diese gottverdammte Ziegenscheiße anzusehen, und daraus ziehst du jetzt bloß den Schluss, dass es sich um einen Überraschungsangriff gehandelt hat? Was hast du denn die ganze Zeit gemacht? Ringe von den Fingern gezogen und die Taschen der Toten durchwühlt?«
»Ich wollte gerade …«
»Und jetzt bist du schon fertig. Wie wäre es mit dir, Yurl?«, fragte Fane und deutete auf den großen blonden Jungen. »Vielleicht kannst du der erschöpfenden Analyse Seiner Glänzendsten Hoheit etwas hinzufügen?«
»Es gibt wirklich noch eine ganze Menge zu sagen«, meinte Sami Yurl und schenkte Valyn ein zufriedenes Grinsen.
»Dieser speichelleckerische Hurensohn«, zischte Lin so leise, dass nur Valyn es hören konnte.
Obwohl alle Kadetten die gleichen Entbehrungen erdulden mussten und das gleiche Ziel hatten, gab es doch Unterschiede in der Gruppe. Die meisten jungen Soldaten waren in dem wahnsinnigen Verlangen eingerückt, das Reich zu verteidigen, die Welt zu sehen und auf jenen gewaltigen Vögeln zu fliegen, zu denen nur die Kettral Zugang hatten. Für einen Bauernsohn aus der Ebene von Sia boten die Kettral schier unglaubliche Möglichkeiten. Doch andere waren aus anderen Gründen auf die Inseln gekommen. Hier erhielten sie die Gelegenheit zum Kämpfen, konnten Schmerzen zufügen, Leben nehmen … All das zog manche Menschen an wie Aas die Geier. Trotz Sami Yurls gutem Aussehen war er ein brutaler und unangenehmer Kämpfer. Im Gegensatz zu den meisten anderen Kadetten schien er seine Vergangenheit nie hinter sich gelassen zu haben. Er schritt über die Inseln, als erwartete er, dass sich jedermann vor ihm verneigte. Es lag nahe, ihn als den verzogenen, aufgeblasenen Adelssohn abzutun – als einen Narren, der sich durch Geld oder die Verbindungen seiner Familie in die Reihe der Kadetten eingeschlichen hatte. Doch die Wahrheit war noch ärgerlicher. Yurl war ein guter und gefährlicher Kämpfer und konnte seine Klingen besser führen als die meisten anderen Kettral. Während der letzten Jahre hatte er Valyn Dutzende Male blutig geschlagen, und wenn es etwas gab, das er noch mehr schätzte als den Sieg, dann war es die Erniedrigung der von ihm Besiegten.
»Der Angriff«, fuhr Yurl fort, »ereignete sich vor drei Tagen, wenn man die Lufttemperatur, die Anzahl der Fliegen und die Verwesung der Leichen in Betracht zieht. Wie Lin schon sagte« – er warf ihr einen verschlagenen Blick zu –, »wird es ein nächtlicher Angriff gewesen sein, denn sonst wären weit mehr Mitglieder der Mannschaft bewaffnet gewesen. Als die Piraten zugeschlagen haben …«
»Piraten?«, fragte der Ausbilder scharf.
Yurl zuckte die Achseln, wandte sich dem nächsten Leichnam zu, trat ihm beiläufig gegen den Kopf und enthüllte dadurch eine Wunde, die vom Schlüsselbein bis zur Brust verlief. »Solche Wunden passen zu den Waffen, die dieser Abschaum bevorzugt. Das Schiff wurde geplündert. Sie haben es gerammt und ausgeraubt. Rammle die Hure und verschwinde – wie üblich.«
Balendin kicherte über diese Bemerkung. Lin wurde wütend, und Valyn legte ihr beruhigend die Hand auf den Arm.
»Die Angreifer hatten Glück, weil keine professionellen Kämpfer an Bord waren.« Sein Tonfall deutete an, dass die Piraten einen anderen Empfang erhalten hätten, wenn er sich an Bord befunden hätte.
Valyn war sich all dessen nicht so sicher.
»Das haben keine Piraten getan.«
Fane hob eine buschige Braue. »Der Glanz des Reiches spricht wieder zu uns! Du willst dich also nicht auf deinen Lorbeeren ausruhen, nachdem du so scharfsinnig geschlossen hast, dass es sich um einen ›Überraschungsangriff‹ gehandelt habe. Bitte erleuchte uns.«
Valyn beachtete die Häme in diesen Worten nicht weiter. Die Ausbilder der Kettral konnten einem schneller unter die Haut kriechen als eine Sandfliege. Das war auch einer der Gründe, warum sie so gute Ausbilder waren. Ein Kadett, der nicht die Ruhe bewahren konnte, würde keinen guten Soldaten abgeben, wenn die Pfeile flogen, und Fane war ein Meister, wenn es darum ging, die Kadetten aus der Ruhe zu bringen.
»Diese Mannschaft bestand nicht aus der üblichen Mischung aus Seeleuten und einigen Söldnern, die zur Bewachung der Ladung angeheuert wurden«, begann Valyn. »Diese Männer waren professionelle Kämpfer.«
Yurl grinste. »Professionelle Kämpfer. Richtig. Und das erklärt auch, warum sie wie Abschaum auf dem Deck verstreut liegen.«
»Du hattest die Gelegenheit, deinen Mist von dir zu geben, Yurl«, sagte Fane. »Jetzt hältst du den Mund und versuchst zusammen mit mir herauszufinden, ob dieser goldene Junge mehr kann, als sich bloß selbst in Verlegenheit zu bringen.«
Valyn unterdrückte ein Grinsen und nickte dem Ausbilder zu, bevor er fortfuhr. »Die Mannschaft sieht ziemlich überall durchschnittlich aus. Ein Dutzend Männer von der Art, wie sie zwischen Anthera und dem Hüftland auf den Schaluppen anzutreffen sind. Aber nur zwei der Kojen sind benutzt worden. Das bedeutet, dass stets zehn Männer an Deck gewesen sein müssen. Sie waren auf einen Angriff vorbereitet.« Er wartete, bis die Worte eingesunken waren.
»Und dann ihre Waffen – sie wirken nicht besonders gefährlich.« Er nahm dem nächsten Leichnam eine der üblichen Klingen aus der Hand und hielt sie gegen das Licht. »Aber sie sind aus Liran-Stahl. Welches Kaufmannsschiff segelt mit zehn Mann an Deck und einer Bewaffnung aus Liran-Stahl?«
»Ich bin mir sicher«, sagte Fane gedehnt, »dass du vorhast, noch vor Sonnenuntergang zum eigentlichen Punkt zu kommen.« Der Mann klang gelangweilt, aber Valyn sah ein Glitzern in seinen Augen. Er musste auf etwas gestoßen sein.
»Wenn also diese Leute gut ausgebildete Kämpfer waren, dann können diejenigen, die dieses Schiff geentert haben, keineswegs durchschnittliche Piraten gewesen sein.«
»Gut und schön«, erwiderte der Ausbilder und sah jeden einzelnen der Kadetten in der Hoffnung an, dass sie der Argumentation hatten folgen können. »Auch ein blindes Huhn findet manchmal ein Korn.«
Nach dem Standard des Horstes zählte eine solche abfällige Bemerkung als großes Lob. Valyn nickte und verbarg seine Zufriedenheit. Sami Yurl kniff verärgert die Lippen zusammen.
»Jetzt seid ihr alle schon zehn Minuten an Deck«, fuhr Fane mit finsterem Blick fort, »und bloß unser kaiserliches Maskottchen ist in der Lage, mir etwas Bedeutsames über dieses verdammte Schiff zu erzählen. Ich habe doch nicht zwei Vögel nach hier draußen fliegen lassen, nur damit ihr den Morgen damit verbringen könnt, Maulaffen feilzuhalten. Versucht es erneut. Benutzt eure Augen. Sucht nach den wirklich wichtigen Dingen.«
Vor acht Jahren hätte diese Ermahnung Valyn zutiefst beschämt. Aber solche verbalen Peitschenhiebe waren auf den Inseln üblich. Er nickte Fane kurz zu und wandte sich dann an Lin.
»Sollen wir uns aufteilen?«, fragte er. »Es wäre wohl das Beste, wenn du hier oben bleibst und ich mir das Unterdeck ansehe.«
»Was immer du sagst, o göttliches Licht des Reiches«, erwiderte sie mit einem Grinsen.
»Ich möchte dich hiermit daran erinnern«, sagte Valyn und kniff die Augen zusammen, »dass du nicht annähernd so groß und stark bist wie Fane.«
Sie hielt die Hand ans Ohr. »Was war das? Das hat geklungen wie … wie eine Warnung?«
»Außerdem bist du nur ein Mädchen.«