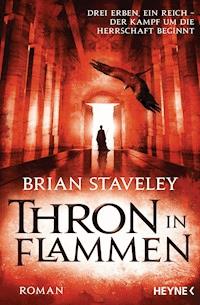7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Thron-Serie
- Sprache: Deutsch
Kaiser Sanlitun ist tot, und sein Reich liegt in Trümmern: Die mächtigen Csestriim, seit jeher die tödlichsten Feinde der Menschen, sind nach Annur zurückgekehrt. Magier, die bisher nur im Verborgenen lebten, treten offen ans Tageslicht, um ihre dunklen Künste zu praktizieren, und die Alten Götter, launenhaft und tückisch, wandeln erneut auf der Erde. Während ihre Welt im Chaos zu versinken droht, versuchen Kaden, Adare und Valyn, die drei Erben Sanlituns, den Thron ihres Vaters und ihre Untertanen zu retten ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1558
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Das Buch
Seit Kaiser Sanlitun Malkeenian heimtückisch ermordet wurde, ist ein erbitterter Kampf um die Herrschaft über das Reich Annur entbrannt. Sanlitun hinterließ drei Erben, doch nur einer von ihnen wird den Unbehauenen Thron besteigen können. Sie alle verfolgen ihre eigenen Interessen, und sie alle schmieden ihre eigenen Ränke.
Adare versucht verzweifelt ihren ehemaligen Geliebten, den Verräter il Tornja, davon abzuhalten, seine eigene Armee gegen das Herrscherhaus Malkeenian zu führen, doch Adare wurde all ihrer Macht beraubt, ihr eigenes Volk hasst sie und il Tornja selbst hat sie in der Hand. Ihr Bruder Valyn, der legendäre Kettral-Kämpfer, ist verschollen, und nur Adare weiß, welch schreckliches Geheimnis sein Verschwinden umgibt. Doch damit nicht genug: Kaden, der dritte im Bunde der kaiserlichen Geschwister, hat sich selbst zu einem Gefäß für die Götter gemacht und kommt dabei einer schrecklichen Wahrheit auf die Spur – einer Wahrheit, die das Schicksal Annurs für immer besiegeln könnte …
Spannung, Magie und Abenteuer pur – Thron der Götter ist der atemberaubende Höhepunkt von Brian Staveleys großem Fantasy-Epos.
Der Autor
Brian Staveley studierte kreatives Schreiben an der University of Boston und unterrichtete Literatur, Geschichte und Religion – Themengebiete, die sein eigenes Schreiben nachhaltig beeinflussen. Mittlerweile arbeitet er als Lektor und Autor. Brian Staveley lebt mit seiner Familie in Vermont.
Mehr über Autor und Werk erfahren Sie auf: www.bstaveley.wordpress.com
www.twitter.com/HeyneFantasySF@HeyneFantasySF
Brian Staveley
Thron der Götter
Roman
Aus dem Amerikanischen übersetzt
von Michael Siefener
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.
Titel der amerikanischen OriginalausgabeTHE LAST MORTAL BOND –
CHRONICLE OF THE UNHEWN THRONE BOOK 3Deutsche Übersetzung von Michael Siefener
Deutsche Erstausgabe 09/2016
Redaktion: Joern Rauser
Copyright © 2016 by Brian StaveleyCopyright © 2016 der deutschsprachigen Ausgabe und der Übersetzung
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 MünchenUmschlaggestaltung: DAS ILLUSTRAT, München,
unter Verwendung mehrerer Motive von ShutterstockUmsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-641-18429-2V001
www.heyne.de
Für meine Freunde:Langsamer als die Kettral, lauter als die Schin,nachlässiger als die Csestriim und doch irgendwie eine Inspiration für sie alle.
Die Hunde waren näher gekommen.
Axta schloss die Augen und entwirrte den immer fester werdenden Klangknoten in die einzelnen Fäden der bellenden Hunde. Es waren drei Dutzend Tiere, und sie waren etwa eine Viertelmeile entfernt. Mit ihrem Geist fuhr sie an etwa einem halben Hundert Fäden entlang und verglich das Gebiet in ihrer Erinnerung mit den alten Mustern, die der Verbreitung aller Geräusche zugrunde lagen.
»Sie haben den Köder geschluckt«, sagte sie. »Vier Gruppen.« Sie deutete den Weg zurück, auf dem sie hergekommen waren – durch die verstreuten Felsbrocken, die schenkelhohen Farne und die bemoosten Stämme der großen, verfaulenden Kiefern. »Da und da. Da und da.«
Sos sah nicht hin. Sein Blick war auf eine Bresche zwischen den Bäumen gerichtet, wo der schimmernde Turm den Himmel teilte. Wenn Axta ihre Falle richtig aufgestellt hatte, würden weniger als vierzig Menschen zur Bewachung der Grundmauern dieses Turmes übrig bleiben – vierzig sterbliche Frauen und Männer, und hinter ihnen, irgendwo im Innern des unerklärlichen Artefaktes, befanden sich ihre Götter, gefangen in sterblichem Fleisch.
In den Zweigen über ihnen stieß ein Eichelhäher vier durchdringende Töne in den Himmel, dann verstummte er wieder.
Axta bereitete ihren Bogen und die wenigen verbliebenen Pfeile vor.
Hätte sie früher gewusst, was hier geschah – hätte sie gewusst, dass die Götter der Menschen zu dieser Zeit an diesem Ort zusammenkämen –, dann hätte sie eine bessere, sicherere Falle aufstellen können. Aber natürlich hatte sie es nicht gewusst. Sie und Sos waren auf einer vollkommen anderen Mission gewesen und rein zufällig über den Geleitzug gestolpert. Es blieb keine Zeit zurückzugehen und die schwache Streitmacht der Csestriim zu holen, die noch verblieben war. Es blieb nicht einmal Zeit, mehr Pfeile zu schnitzen.
»Ich werde dir bei deinem Angriff Deckung geben«, sagte sie. »Aber sie verfügen über eigene Bögen.«
Sos nickte. »Ich werde dort sein, wo die Pfeile nicht sind.«
Das klang zwar recht rätselhaft, aber Axta hatte schon einmal beobachtet, wie er das tat. Sie war die bessere Spurenleserin, die bessere Generalin und auch die bessere Steinspielerin. Doch niemand konnte sich geschickter durch das Labyrinth einer Schlacht schlängeln als Sos. Ganz allein hatte er die Menschen in der Festung bei Palian Quar getötet. In den dunklen Wäldern der winterlangen Schlacht bei den Ersten Kiefern hatte er die gesamte westliche Flanke der Csestriim-Streitmacht abgesichert, war zwischen den Stämmen und in den Schatten hin und her gehuscht, hatte seine menschlichen Feinde Tag für Tag und Woche für Woche abgeschlachtet, bis ihre Front zerfallen und sie geflüchtet waren. Sos kämpfte wie ein Kartograph, der seinen eigenen vollkommenen Landkarten folgte – in einer Welt der Blinden, der Verblüfften und der Verirrten.
Er zog seine Zwillingsschwerter aus den Scheiden.
Axta betrachtete die mondhellen Halbbögen.
Als Einziger unter den Csestriim hatte Sos seinen Waffen Namen gegeben: Klarheit nannte er das eine Schwert und Zweifel das andere. Sie hatte einmal gesehen, wie er mit genau diesen Schwertern vor Tausenden von Jahren gegen drei Nevariim gekämpft und gesiegt hatte.
»Wie kannst du sie auseinanderhalten?«, fragte sie. Die Waffen sahen vollkommen gleich aus.
»Eine ist schwerer, eine ist schärfer.«
Wenige Fuß entfernt landete ein Schmetterling auf dem gezahnten Blatt eines Farns und breitete seine indigoblauen Flügel aus. Vor Tausenden von Jahren hatte Axta ein ganzes Jahrhundert mit der Erforschung von Schmetterlingen verbracht. Aber ein solches Exemplar hatte sie noch nie gesehen.
»Welche Klinge ist welche?«, fragte sie und richtete ihre Aufmerksamkeit wieder auf den Krieger.
»Das habe ich noch nicht entschieden.«
»Seltsam, die Namen so unverbunden mit der Welt sein zu lassen.«
Sos zuckte die Schultern. »So ist das mit der Sprache nun einmal.«
Axta trennte einen Teil ihres Geistes ab und dachte damit über seine Behauptung nach. Hätten sie mehr Zeit gehabt, wäre es ihr eine Freude gewesen, eingehender mit Sos zu sprechen, aber sie hatten nun einmal keine. Hinter dem Gebell der Hunde hörte sie die Menschen mit ihren Schwertern – und wandte sich wieder dem Turm zu.
»Wenn wir die Götter heute töten, gewinnen wir. Das glaubt zumindest Tan’is. Wenn wir sie aus dieser Welt herausschneiden, dann schneiden wir damit auch die Fäulnis heraus, die unsere Kinder erstickt.«
Sos nickte.
Der Schmetterling erhob sich zuckend in die Luft.
»Was wirst du tun, wenn es keinen Krieg mehr gibt?«, fragte sie.
In den langen Jahren seines Lebens hatte der Schwertkämpfer keine Schmetterlingssammlung angelegt.
»Mich vorbereiten.«
»Auf was?«
»Auf den nächsten Krieg.«
Axta hielt den Kopf schräg und fragte sich, wie ihm eine so einfache und klare Tatsache entgehen konnte. »Aber wenn wir sie hier und jetzt besiegen, wird es keine Menschen mehr geben.«
Sos betrachtete seine uralten Klingen, als fühlten sie sich in seinen Händen seltsam an – als wären sie Gegenstände unbekannter Herkunft, bäuerliche Gerätschaften vielleicht oder Musikinstrumente.
»Es gibt immer einen nächsten Krieg.«
Innerhalb weniger Augenblicke hackte er sich durch die Ansammlung entsetzter menschlicher Wächter und huschte dabei von einem sicheren Platz zum nächsten, als hätte er die Schlacht im Voraus studiert – als hätte er eine ganze Woche damit verbracht, seinen Weg durch das blutige Gemetzel zu planen. Axta folgte ihm, schnitt hier einer Frau die Kehle und dort einem bärtigen Mann die Kniesehne durch, und dann waren sie im Inneren.
Natürlich hatten die Csestriim den Turm schon eingehend untersucht. In den langen Jahren vor dem Krieg war er wie eine leere, leuchtende, unzerstörbare Schale gewesen, aus einer Zeit, die allen Aufzeichnungen und Überlieferungen vorausging. Doch nun war er nicht mehr leer. Die Menschen hatten in seinem Innern ein massives hölzernes Gerüst gebaut, indem sie gewaltige Kiefern aufeinander gepflockt und dazwischen eine grobe Treppe errichtet hatten, die sich höher und höher bis ins Licht drehte.
Hinter Axta strömten kreischend und brüllend Soldaten durch die Tür. Sos tötete sie wie ein sorgfältiger Handwerker, der an seinem Meisterstück arbeitet. Axta machte sich an den Aufstieg. Irgendwo dort oben im blendenden Licht waren die Götter: Heqet und Kaveraa, Eira und Maat, Orella und Orilon, deren Berührung ihr Volk vergiftet hatte und deren Verderbtheit die Csestriim in Bestien ähnlich den gebrochenen Kreaturen verwandelt hatte, die sich dort unten gegen Sos warfen und ihre weichen Hälse von seinen Klingen spalten ließen.
Wie ein Insekt, das im Bernstein der Sonne gefangen war, kletterte Axta empor; ihre unentwegte Bewegung war eine andere Art von Reglosigkeit. Sie hatte keine Ahnung, warum die Götter hierhergekommen sein mochten, und sie wusste auch nicht, warum die Menschen so viel Zeit damit verbracht hatten, das Gerüst und die Treppe zu bauen. Während ihr heißes Herz Blut durch die Adern pumpte, versuchte sie die Wahrscheinlichkeiten zu berechnen. Die Vernunft lehnte sich auf und brach in sich zusammen. Schlussfolgerungen und Ableitungen führten zu nichts. Am Ende verlangte jedes Wissen nach Beweisen, und so kletterte sie weiter.
Als Axta die Spitze des Turms erreichte und vom einen Licht ins andere trat, war Sos nur einen Schritt hinter ihr. Wolken trieben durch die blaue Bronze des Himmels und polierten sie glatt. Auf der breiten Spitze des Turms lagen die Götter still und mit geschlossenen Augen da. Es waren alle sechs: Heqet mit bullenbreiten Schultern und von Narben übersät, der hauchdünne Maat, Orella und Orilon, die eine knochenweiß, der andere so dunkel wie ein Sturm, Kaveraa mit ihren langen Fingernägeln, und Eira mit dem wilden Haarschopf – sie hätte auch ein einfaches menschliches Mädchen sein können.
Der Wind zerschnitt sich das unsichtbare Fleisch an Sos’ nackten Klingen.
Axta bewegte sich nicht.
Schließlich steckte der Kämpfer eines seiner Schwerter in die Scheide, kniete nieder, hielt die Finger zunächst gegen Hequets Hals, dann verfuhr er mit den anderen auf gleiche Weise.
»Tot«, sagte er schließlich und richtete sich auf.
Tot. Axta drehte diese Aussage in ihren Gedanken hin und her und betastete sie so vorsichtig, als wäre es das Eis des späten Winters. Viele Jahrzehnte lang waren diese Götter in ihrer freiwillig angenommenen menschlichen Gestalt durch die Welt gewandert. Tan’is war es gelungen, zwei von ihnen gefangen zu nehmen und zu töten, aber die anderen hatten überlebt und waren allen Versuchen ausgewichen, sie festzusetzen. Die Existenz der Menschen gründete sich auf diesem Überleben.
»Nein«, sagte sie.
Sos hob eine Braue.
»Das sind menschliche Körper«, fuhr Axta fort, »aber die Götter, die in ihnen gelebt haben, sind fortgegangen.«
Der Schwertkämpfer ließ auch die andere Klinge in die Scheide gleiten.
»Wohin?«
»An den Ort, von dem sie hergekommen waren.« Sie betrachtete das gezeichnete, leblose Fleisch. »Seltsam. Gerade jetzt, da ihr Sieg nahe war.«
Sos schüttelte den Kopf. »Er war nicht nahe.«
Axta drehte sich zu ihm um. »Sie haben jede wichtige Festung eingenommen und jede Straße beherrscht. Von uns sind kaum mehr als einige Hundert übrig. Ein paar Menschen haben sogar schon gelernt, die Kenta zu benutzen.«
»Ihr Sieg war keineswegs nahe«, sagte Sos noch einmal. »Sie hatten bereits gewonnen. Das ist der Grund, warum ihre Götter gegangen sind.«
Sie hatten bereits gewonnen.
Axta suchte diese Behauptung nach einem Fehler ab, aber sie fand keinen.
Zu ihren Füßen verwandelten sich die zerschmetterten Leichname, die jene gebrochenen Götter beherbergt hatten, unter der Nachmittagssonne bereits in Fäulnis. Sie hatten aus nichts als Fleisch bestanden.
Menschen, so groß wie Berge, pflügten sich hüfttief durch die Meere der Welt. Polierte Klingen – jede lang genug, um eine ganze Stadt dem Erdboden gleichzumachen – spiegelten das Sonnenlicht wider. Stiefel zertraten zarte Küstenlinien zu Staub, löschten Fischerdörfer aus, bohrten Krater in die sanften, grünen Felder von Sia und Kresch.
So endet die Welt. Das war Kadens erster Gedanke, als er von oben auf die Zerstörungen hinabsah.
Eine Stadt bestand schließlich nur aus Stein, und ein Wald war nicht mehr als harzfeuchtes Holz. Was war ein Flusslauf anderes als ein Hieb durch das Land? Wandte man genug Kraft an, würde die ganze Welt eine andere Gestalt annehmen. Mit genügend Kraft konnte man Klippen spalten, Berge zum Einsturz bringen, den Meeresboden zerreißen und in den Wellen verteilen. Fügte man Feuer hinzu, würde die Welt verbrennen. Brachte man Wasser, ginge sie in einer Sintflut unter. Die alten Gestalten von Meer und Stein konnten durch Flut und Verbrennen neu geformt werden, und jene anderen Umrisse, die kleinen, verzweifelten Linien, die sich die Männer und Frauen in den Staub geträumt hatten, damit sie die Grenzen ihrer kleinen Königreiche anzeigten, würden innerhalb eines einzigen Herzschlages zusammen mit dem ganzen Rest ausgelöscht werden.
Nein. Das war Kadens zweiter Gedanke. Das ist nicht die Welt. Das ist nur eine Landkarte.
Zugegeben, es war eine gewaltige Landkarte von der Größe eines kleinen Paradeplatzes – die kostbarste Karte der Welt, in Auftrag gegeben von einer anmaßenden annurischen Republik für ihren Rat. Aber dennoch blieb es eine Landkarte, sonst nichts. Legionen von Kunsthandwerkern hatten monatelang Tag und Nacht daran gearbeitet. Steinmetze hatten die Berge und Meeresklippen geformt, Gärtner hatten die unzähligen Pflanzen und die vollkommenen Miniaturbäume angelegt, Hydraulikfachleute hatten sich um den Lauf der Flüsse gekümmert, und Juweliere hatten die Saphire für die kleinen Bergseen geschnitten sowie die Gletscher aus Glas und Diamanten geschaffen.
All das erstreckte sich über die gesamte Länge der Halle, etwa zweihundert Fuß vom einen Ende bis zum anderen. Der Granit für die plastische Darstellung der Knochenberge kam von den Knochenbergen, der rote Stein des Ancaz stammte aus dem Ancaz. Pumpen, die unter der Oberfläche versteckt waren, speisten die großen Flüsse von Vasch und Eridroa: den Schirvian, den Vena, den Agavani und den Schwarzen sowie noch Dutzende anderer Flüsse, deren Namen Kaden nicht kannte und die zwischen hohen Ufern und um Biegungen herumflossen, winzige Wasserfälle bildeten und durch Sumpfgebiete aus weichem, grünem Moos strömten, bis sie sich schließlich in die Seen und Meere der kleinen Welt ergossen – in Meere, in denen durch irgendeinen geschickten Mechanismus gemäß dem Mondumlauf Ebbe und Flut herrschten.
Man konnte über Stege spazieren und auf die erstaunlichen Nachbildungen der großen Städte schauen: auf Olon und Sia, Dombâng und Boogen. Annur selbst breitete sich in einer Länge aus, die der von Adens Arm gleichkam. Er erkannte die glitzernden Facetten von Intarras Tempel, die große Straße, die der Gottesweg genannt wurde, mitsamt der kleinen, ihn säumenden Statuen, sowie die winzigen Kanalboote, die im Bassin, einem breiten künstlichen See, vor Anker lagen, die roten Mauern des Palastes der Dämmerung und Intarras Speer, der wie eine Lanze über den Steg hinausragte und so hoch war, dass man sich nicht bücken musste, um die Spitze zu berühren.
Wie die Männer und Frauen, die Tag für Tag über dieser Reliefkarte saßen und sich um die Einzelheiten stritten, war sie sowohl großartig als auch unwesentlich. Bis zu diesem Augenblick hatte sie eigentlich nur dazu gedient, denjenigen, die über ihr saßen, das Gefühl einzugeben, sie seien Götter. Dazu war es lediglich nötig, eine Traumwelt zu zeigen, die nicht durch Fehler oder Niederlagen verunstaltet war.
Keine Feuer loderten unaufhaltsam durch die nördlichen Wälder. Keine Orte brannten im Süden. Niemand hatte die Wiesen von Ghan versengt oder den Hafen von Keoh-Kâng blockiert. Kleine, bemalte Soldaten deuteten die Stellungen von Feldarmeen an. Winzige Männer stellten Adares verräterische Legionen dar, und die zahlreichere Republikanische Garde des Rates sprenkelte das Terrain in reglosen Posen der Herausforderung oder des Triumphes. Stets standen sie aufrecht, diese falschen Männer. Sie bluteten nie. Die Karte zeigte weder die Spuren der Verwüstungen noch die Zerstörungen des Krieges. Anscheinend gab es in Annur keine Künstler, die Hunger, Schrecken und Tod darstellen konnten.
Wir haben keine Künstler benötigt, dachte Kaden. Wir brauchten Soldaten mit schweren Stiefeln, um uns an das zu erinnern, was wir getan haben, und um diese unsere kleine Welt in den Staub zu treten.
Die plötzliche, unerwartete und unleugbare Gewalt ließ die Karte genauer und zutreffender erscheinen, aber diese Männer mit ihrem Stahl waren nicht gekommen, um die großartigste Darstellung der Welt zutreffender werden zu lassen. Kaden wandte den Blick von der Vernichtung ab, die sich dort unten abspielte, und betrachtete eine weitere Gruppe bewaffneter Männer, die über den Steg strömte. Aedolianer. Das waren jene Männer, deren Aufgabe es war, die Herrscher Annurs zu beschützen.
Trotz seiner eigenen Ausbildung spürte Kaden, wie sich ihm der Magen umdrehte. Offensichtlich war etwas misslungen. Maut Amut, der Erste Schild der Garde, hätte seinen Männern sonst niemals befohlen, eine nicht öffentliche Zusammenkunft des Rates zu stören. Das hier war keine Übung. Jeder Soldat trug die Hälfte seines Gewichts an schimmernder Rüstung, und alle hatten ihre Breitschwerter gezogen, während sie sich in der Halle ausbreiteten, Befehle brüllten, am Rande Stellung bezogen und die Türen bewachten, damit niemand hereingelangen konnte – oder auch, damit niemand entwich.
Die Hälfte der Ratsmitglieder kämpfte sich auf die Beine, stolperte dabei über die langen Gewänder, verschüttete Wein über sorgfältig geschnittene Seide, rief Fragen oder schrie vor Entsetzen. Der Rest saß wie angewachsen auf den Stühlen, mit weit geöffneten Augen und heruntergeklappten Kiefern, und versuchte in all dem sich ausbreitenden Wahnsinn einen Sinn zu erkennen. Kaden beachtete sie nicht, sondern hielt den Blick starr auf die Aedolianer gerichtet.
Hinter diesen Männern in Stahl erfüllte nun eine Erinnerung an andere Soldaten seine Gedanken. Ihm fielen die Aedolianer ein, die sich durch Aschk’lan gekämpft, die Mönche ermordet und Kaden durch die Berge gejagt hatten. Nach seiner Rückkehr in den Palast der Dämmerung hatte er Monate damit verbracht, die Berichte der übrig gebliebenen Gardisten zu lesen und in ihren persönlichen Geschichten nach einem Anzeichen von Verrat oder einer Ergebenheit an Adare oder Ran il Tornja zu suchen. Die gesamte Garde war vorläufig vom Dienst suspendiert worden, während Hunderte Schreiber Tausende von Geschichten aufzeichneten, und am Ende entließ der Rat mehr als hundert Leute, während der Rest wieder zurückkehren durfte. Kaden erinnerte sich zwar an diese Maßnahmen, spürte aber dennoch die Anspannung in seinen Schultern.
Sieh die Welt, sagte er zu sich selbst, holte tief Luft und stieß sie wieder aus, und verwechsle sie nicht mit deinem Traum von der Welt.
Zwei Dutzend Aedolianer stürmten über den hohen Steg und umkreisten den Ratstisch.
Kaden erhob sich und schüttelte dabei seine Angst ab.
»Was ist hier los?« Trotz der Befürchtungen war seine Stimme fest.
Maut Amut trat vor. Der wilde Aufruhr, den das Eindringen der Aedolianer verursacht hatte, war vorbei. Wellen schwappten wie winzige Tsunamis an den Strand der Karte. Das Sonnenlicht fiel warm und still durch die Oberlichter, spielte über die Rüstungen der Soldaten und schimmerte auf den gezogenen Klingen. Plötzlich verstummten und erstarrten die Mitglieder des Rates wie Statuen, die die Stege säumten und in den verschiedenen Gesten ihrer eigenen Überraschung gefangen waren.
»Ein Angriff, Erster Sprecher«, antwortete Amut grimmig, während seine Blicke die Wände und Türen absuchten, »innerhalb des Palastes.«
Kaden sah sich im Raum um.
»Wann?«
Amut schüttelte den Kopf. »Wir sind uns nicht sicher.«
»Wer?«
Der Erste Schild zog eine Grimasse. »Jemand, der schnell ist. Und gefährlich.«
»Wie gefährlich?«
»Gefährlich genug, um in den Palast zu gelangen, unbemerkt Intarras Speer zu betreten, drei meiner Männer zu überwältigen – drei Aedolianer – und dann wieder zu verschwinden.«
Die Nacht war ein fremdes Reich.
So hatte es Adare hui’Malkeenian schon immer gesehen – als verändere sich die Welt nach dem Untergang der Sonne. Die Schatten glätteten alle harten Ecken und Kanten und machten die Zimmer, die im Sonnenlicht vertraut wirkten, zu etwas Seltsamem und Unbekanntem. Die Dunkelheit zog die Farbe selbst noch aus der hellsten Seide. Das Mondlicht versilberte Wasser und Glas und ließ die gewöhnlichsten Dinge des Tages funkelnd und kalt erscheinen. Lampen wie die beiden, die nun auf dem Tisch vor ihr standen, brachten die Welt mit der Bewegung ihrer gefangenen Flammen zum Zucken und Winden. Die Nacht verwandelte sogar die vertrautesten Orte, und diese kalten Zimmer hoch oben in der steinernen Festung am Rande von Aergad waren ihr keineswegs vertraut. Adare lebte nun schon fast ein Jahr in ihnen, ohne sich hier willkommen oder auch nur sicher zu fühlen – selbst nicht bei Tage. Die Nacht aber entführte sie stets an einen Ort, der grausam, fremd und barbarisch war.
Auch die Geräusche der Nacht bedurften einer Übersetzung und Deutung. Die morgendlichen Schritte draußen im Korridor waren etwas Gewohntes; Diener und andere Arbeiter der Festung gingen ihren Beschäftigungen nach. Doch nach Mitternacht klangen die gleichen Schritte plötzlich verstohlen. Ein Ruf zur Mittagszeit war einfach nur ein Ruf, aber in der Nacht konnte er Gefahr und Katastrophe ankündigen. Der Hof unter Adares Fenster bot tagsüber ein Chaos aus Betriebsamkeit, aber so spät in der Nacht, wenn die Tore geschlossen waren, herrschte dort für gewöhnlich Stille. Als sie nun Hufgetrappel auf den Pflastersteinen und knappe Kommandos hörte, die vom Wind davongetrieben wurden, setzte sie ihr Amtssiegel ruckartig ab, wobei sie aber sorgsam darauf achtete, dass die Tinte nicht auf den Blättern verlief. Dann ging sie mit hämmerndem Herzen zu den geschlossenen Fenstern hinüber.
Ein Bote, der zur Mitternacht kam, war nicht dasselbe wie ein Bote am Mittag.
Sie bezwang ihre Angst, während sie den Laden und das Fenster öffnete. Die Nordluft fuhr ihr kühl über die verschwitzte Haut. Ein Reiter zu dieser Stunde konnte alles bedeuten: Die Urghul durchquerten den Schwarzen Fluss, oder sie hatten ihn schon durchquert, die Wilden von Langfaust brannten einen weiteren Grenzort nieder, oder sein verrückter Auszehrer Balendin zog aus der Angst, die in Adares Volk wohnte, wieder einmal eine neue, bösartige Magie. Ein Reiter konnte bedeuten, sie werde verlieren. Oder dass sie bereits verloren hatte.
Reflexartig schaute sie zuerst in Richtung des Flusses. Der Haag wand sich dicht unter den hohen Stadtmauern nach Süden. Sie erkannte die steinernen Bögen der einzigen Brücke, die ihn überspannte, aber die Nacht verbarg alle Wächter vor ihr, die dort postiert sein mochten. Sie holte tief Luft und entspannte ihre Hände, die sich in den Fensterrahmen verkrallt hatten. Fast hatte sie erwartet, die Urghul in einer Entfernung von nur einer Viertelmeile zu sehen, wie sie die Brücke erstürmten und sich anschickten, die Stadt zu belagern.
Weil du eine Närrin bist, sagte sie grimmig zu sich selbst. Hätten Balendin und die Urghul Ran il Tornjas Legionen überwunden, dann würde sie nun mehr als nur ein paar Pferde auf dem Pflaster hören. Sie richtete ihre Aufmerksamkeit auf den Hof unter ihr.
Aergad war eine alte Stadt, so alt wie Annur selbst, und die Burg, die sie für sich beansprucht hatte, war der Stammsitz der Könige gewesen, die lange vor der Errichtung von Adares Reich über die südlichen Romsdal-Berge geherrscht hatten. Sowohl die Burg als auch die Stadtmauer zeigten ihr Alter allzu deutlich. Obwohl die Erbauer gute Arbeit geleistet hatten, war es seit mehr als einem Jahrhundert nicht mehr nötig gewesen, Aergad zu verteidigen, und Adare konnte Risse und Spalten in den Brustwehren erkennen, wo das Eis den Mörtel weggefressen hatte. Große Steinblöcke waren bereits nach unten in den Fluss gestürzt. Sie hatte befohlen, die Mauern instand zu setzen, aber Steinmetze waren Mangelware, und il Tornja brauchte sie überdies im Osten, wo er schon seit Monaten gegen die Urghul kämpfte.
Das Mondlicht warf die zerklüfteten Umrisse der südlichen Mauer auf den rauen Pflasterstein des Hofes. Der Bote stieg im Schatten ab; Adare konnte seine Gestalt und auch die des Pferdes erkennen, nicht aber das Gesicht oder die Uniform. Sie versuchte etwas in seine Haltung und in die Art hineinzulesen, wie er die Schultern reckte – irgendetwas, das sie auf die Botschaft, die er brachte, vorbereiten mochte.
Ein Wimmern durchbrach die Stille der Nacht; es war das Weinen eines Kindes aus dem Raum hinter ihr. Adare zog eine Grimasse, wandte sich von dem Hof ab und drehte sich zu Sanlitun hui’Malkeenian um, dem zweiten dieses Namens. Das Kind wand sich unbehaglich in seiner hölzernen Wiege, war von dem Hufgetrappel auf dem Kopfsteinpflaster geweckt worden oder aber von der kalten Luft aus dem Norden, die durch das offene Fenster drang. Adare ging rasch zu ihm und hoffte, er möge noch nicht ganz wach sein und sie könne ihn mit sanfter Hand und ein paar Worten beruhigen, sodass sie wieder in den Schlaf fallen durfte, bevor sie sich dem stellen musste, was nun auf sie zukommen mochte.
»Psst«, flüsterte sie. »Alles ist in Ordnung, mein kleiner Junge. Psst …«
Manchmal war es einfach, ihn zu besänftigen. Wenn Adare in den besseren Nächten ihr sich windendes Kind beruhigte, fühlte sie sich, als spräche jemand anders – eine Frau, die älter, gelassener und sicherer war; eine andere Mutter, die nichts von Politik oder Finanzwesen verstand und selbst bei den einfachsten Zahlen Schwierigkeiten hatte, die aber instinktiv wusste, wie man ein Kind mit einer Kolik beruhigte. Doch die meiste Zeit hindurch fühlte sie sich verloren, war von ihrer Mutterschaft verblüfft, verzweifelte an der Liebe zu ihrem winzigen Kind und war entsetzt von ihrer Unfähigkeit, es zu beruhigen. Dann drückte sie es an sich, flüsterte ihm immer wieder ins Ohr, und sein Körper bebte noch eine Weile und wurde still. Wenn sie glaubte, dass der Kummer vorübergegangen war und sie es wagte, sich zurückzulehnen, um sein Gesicht zu betrachten, hob sich seine Brust, die Schluchzer zwangen seinen kleinen Mund auseinander, und die Tränen quollen wieder auf.
Er hatte ihre Augen. Wenn sie in diese Augen sah, während er weinte, war es, als schaue sie in einen Gebirgsteich und sehe unter der Wasseroberfläche rot-goldene, beständig glühende Kohlen. Adare fragte sich, ob ihre eigenen Augen hinter den Tränen genauso aussahen. Es schien ihr lange her zu sein, seit sie zum letzten Mal geweint hatte.
»Psst, mein kleiner Junge«, flüsterte sie und fuhr ihm mit den Fingerknöcheln sanft über die Wange. »Es ist alles in Ordnung.«
Sanlitun hob das kleine Gesicht, lehnte sich gegen die Liebkosungen auf, weinte erneut, und dann sackte er in sich zusammen.
»Alles ist gut«, flüsterte sie noch einmal.
Erst als sie zum Fenster zurückkehrte, wieder hinaussah und bemerkte, dass sich der Reiter ins Mondlicht bewegt hatte, erkannte sie, dass sie falsch lag. Nichts war in Ordnung. Vielleicht hatte das Kind sogar vor ihr gewusst, wer da gekommen war. Vielleicht war es gar nicht die Kälte oder der Wind gewesen, die es aufgeweckt hatten, sondern das Wissen dieses Kindes, dass sein Vater in der Nähe war, der Csestriim, der Kenarang, der General von Adares schrumpfendem Reich und – der Mörder ihres eigenen Vaters. Möglicherweise war er ihr Todfeind und gleichzeitig einer ihrer wenigen Verbündeten. Ran il Tornja war hier; er schlenderte über den Hof, überließ es einem Stallburschen, sein Pferd wegzuführen, das halb tot wirkte. Er schaute zu ihrem Fenster hoch, fing ihren Blick auf und salutierte. Es war eine beiläufige, beinahe zurückweisende Geste.
Sein unerwartetes Eintreffen wäre schon bei Tage seltsam genug gewesen, aber es war nicht einmal Tag, sondern weit nach Mitternacht. Adare zog das Fenster zu und versuchte ein plötzliches Frösteln zu unterdrücken. Sie richtete sich auf, drehte sich zur Tür ihres Gemachs um und machte eine gefasste Miene, bevor er eintrat.
»Du solltest die Männer am Tor auspeitschen lassen«, sagte il Tornja, sobald er die Tür hinter sich geschlossen hatte. »Oder lass sie besser gleich töten. Sie haben sich vergewissert, dass ich es tatsächlich bin, aber meine Wächter haben sie ohne einen weiteren Blick durchgewinkt.«
Er sank auf einen hölzernen Stuhl, schob einen weiteren mit dem Absatz seines Stiefels so zurecht, dass er seine Füße darauf legen konnte, und lehnte sich zurück. Der scharfe nächtliche Ritt, der sein Pferd beinahe umgebracht hatte, schien den Kenarang selbst nicht im Geringsten ermüdet zu haben. Ein wenig Schlamm fleckte seine Stiefel. Der Wind hatte ihm die dunklen Haare zerzaust, doch sein grüner Reitermantel und die maßgeschneiderte Uniform waren makellos. Der polierte Schwertgürtel glitzerte. Die Edelsteine im Griff seiner Waffe schimmerten mit der Helligkeit einer Lüge. Adare sah ihm in die Augen.
»Haben wir so viele Soldaten, dass wir sie wegen kleiner Vergehen umbringen können?«
Il Tornja hob die Brauen. »Wenn es darum geht, die Kaiserin zu beschützen, würde ich einen Fehler nicht als kleines Vergehen bezeichnen.« Er schüttelte den Kopf. »Du solltest nicht die Söhne der Flamme, sondern meine eigenen Soldaten am Tor postieren.«
»Du brauchst deine Männer im Kampf gegen die Urghul«, betonte Adare, »es sei denn, du willst diesen Krieg ganz allein führen. Die Söhne sind fähige Wächter. Sie haben deine Männer passieren lassen, weil sie dich erkannt haben. Sie vertrauen dir.«
»Auch Sanlitun hat mir vertraut«, bemerkte er. »Und ich habe ihm ein Messer in den Rücken gestoßen.«
Adares Atem blieb ihr im Halse stecken. Ihre Haut geriet in Brand.
Mein Vater, rief sie sich in Erinnerung. Er redet über meinen Vater, nicht über meinen Sohn. Il Tornja hatte den Kaiser ermordet, aber er hatte doch keinen Grund, auch dem Kind etwas anzutun – seinem eigenen Sohn. Dennoch war der Drang, sich auf dem Stuhl umzudrehen und nach ihrem schlafenden Sohn zu sehen, für Adare so stark, als hätten kräftige Hände sie gepackt. Doch sie bezwang den Drang.
»Deine Leine ist kürzer als damals bei der Ermordung meines Vaters«, erwiderte sie und sah ihm tief in die Augen.
Er lächelte und hob die Hand an sein Schlüsselbein, als wollte er nach dem unsichtbaren Band aus Flammen tasten, das Nira ihm um den Hals gelegt hatte. Adare wäre wesentlich beruhigter gewesen, wenn sie dieses kentverdammte Ding sehen könnte, aber eine zuckende Schlinge aus Feuer würde viele Blicke auf sich ziehen, und sie hatte schon genug Schwierigkeiten, da musste sie nicht auch noch zugeben, dass ihre mizranische Ratgeberin eine Auszehrerin und ihr Kenarang ein nicht gerade vertrauenswürdiger Mörder und überdies ein Csestriim war. Nira beharrte darauf, dass der Zauber noch immer an Ort und Stelle geblieben war, und eigentlich sollte ihr das reichen.
»So ein leichter Kragen«, sagte il Tornja. »Manchmal vergesse ich, dass er überhaupt da ist.«
»Du vergisst gar nichts. Warum bist du hier?«
»Abgesehen davon, dass ich meine Kaiserin und meinen Sohn sehen will – und auch die Mutter meines Kindes?«
»Ja. Abgesehen davon.«
»Du bist weniger gefühlvoll, als ich es in Erinnerung hatte.«
»Sobald Gefühle dazu in der Lage sind, meine Truppen zu ernähren, werde ich mich um sie kümmern. Also – warum bist du hier?«
Hinter ihr regte sich Sanlitun unbehaglich und wimmerte, als er ihre erhobene Stimme hörte. Il Tornja warf einen Blick über die Schulter und betrachtete das Kind mit einem Blick, in dem Interesse oder auch Belustigung liegen mochten.
»Ist er gesund?«
Adare nickte. »Vor zwei Wochen hatte er einen Husten – dieser schaelverdammte Wind von den Romsdal-Bergen –, aber jetzt ist er fast weg.«
»Und du behältst ihn immer bei dir, auch wenn du arbeitest?«
Erneut nickte sie. Sie war bereit, sich zu verteidigen. Abermals. Es war neun Monate her, seit sie in Aergad eingetroffen war – in diesem Exil innerhalb ihres eigenen Reiches. Vor sechs Monaten war Sanlitun geboren worden. Erst sechs Monate war das her, und doch fühlte sie sich schon, als hätte sie ein ganzes Jahr, nein, ein ganzes Leben nicht mehr geschlafen. Trotz seines Namens hatte Sanlitun nicht die Gelassenheit seines Großvaters und auch nicht seine Stille geerbt. Er war entweder hungrig oder nass, er erbrach sich oder war mürrisch, er packte sie, wenn er wach war, oder er trat nach ihr, wenn er schlief.
»Eine Amme …«, begann il Tornja.
»Ich brauche keine.«
»Es hilft dir nicht, wenn du dich zugrunde richtest«, sagte er langsam. »Nicht dir, nicht unserem Kind und ganz sicher nicht unserem Reich.«
»Meinem Reich.«
Er nickte; sein Lächeln stach. »Deinem Reich.«
»Überall ziehen Frauen ihre eigenen Kinder selbst groß. Manchmal sind es sechs. Manchmal sogar zehn. Ich glaube, ich komme mit einem einzelnen Jungen ganz gut zurecht.«
»Schäferinnen ziehen sechs Kinder groß. Fischerfrauen ziehen ihre Kinder groß. Es sind Frauen, deren Sorgen sich nicht über den brennenden Herd und die Ernährung der Schafe hinaus erstrecken. Du aber bist die Kaiserin von Annur, Adare. Du bist eine Prophetin. Wir führen Krieg an zwei Fronten, und wir verlieren. Fischerfrauen haben das Privileg, sich um ihre eigenen Kinder kümmern zu dürfen. Wir haben es nicht.« Er machte irgendetwas mit seiner Stimme; es war eine Veränderung im Tonfall, die ein sanftes Einlenken angedeutet hätte, wäre der Sprecher jemand anders gewesen. »Er ist auch mein Kind …«
»Sprich zu mir nicht von deinen Kindern«, knurrte sie, lehnte sich auf ihrem Stuhl zurück und brachte so ein wenig mehr Raum zwischen sich und ihn. »Ich weiß nur zu gut, wie du dich in der Vergangenheit um sie gekümmert hast.«
Wenn sie gehofft hätte, damit einen Spalt in seine Rüstung getrieben oder ihm die Maske abgerissen zu haben, wäre sie enttäuscht worden. Il Tornja ordnete die Linien seines Gesichts zu einem Lächeln des Bedauerns und schüttelte wieder den Kopf.
»Das war vor langer Zeit, Adare. Vor vielen tausend Jahren. Es war ein Fehler, und ich habe hart daran gearbeitet, ihn zu berichtigen.« Er deutete auf Sanlitun und streckte die Hand aus; es war eine väterliche und zugleich unpersönliche Geste. »Er wird nicht stärker oder weiser werden, wenn du ihn bemutterst. Vielleicht wird er gar nicht aufwachsen, wenn du alles andere vernachlässigst.«
»Ich vernachlässige überhaupt nicht alles andere«, fuhr sie ihn an. »Siehst du mich etwa schlafen? Oder endlosen Unsinn plappern? Ich sitze jeden Morgen vor Sonnenaufgang an meinem Schreibtisch, und wie du erkennen kannst, bin ich noch immer hier.« Sie wies auf die Papiere. »Wenn ich mein Siegel unter diese Verträge setze, werden unsere Männer wieder für einige Monate zu essen haben. Und wenn ich damit fertig bin, wartet noch ein ganzer Stapel von Bittgesuchen aus Raalte auf mich. Ich lebe in diesem Zimmer, und wenn ich nicht hier bin, überarbeite ich zusammen mit Lehav unsere Strategie für den Süden, oder ich besuche die Truppen, oder ich setze Briefe auf.«
»Und zum Glück für uns alle«, fügte il Tornja sanft hinzu, »hast du das Hirn deines Vaters. Selbst wenn du schlaftrunken bist oder ein Kind an deine Brust drückst, kannst du besser denken als die meisten annurischen Kaiser, die ich gekannt habe.«
Sie beachtete dieses Kompliment nicht weiter. Il Tornjas Lob schien so aufrichtig zu sein wie alles andere an ihm, aber wie alles andere an ihm war es auch falsch. Es war bis in die kleinste Einzelheit abgemessen und ausgewogen und wurde nur dann gespendet, wenn er glaubte, dass es nützlich sein könnte. Doch eines war sicher: Sie tat ihre Arbeit.
»Na bitte. Ich werde Sanlitun aufziehen und …«
Der Kenarang schnitt ihr das Wort ab.
»Es ist nicht nötig, dass du besser als die meisten deiner Vorfahren bist, Adare.« Er hielt inne und betrachtete sie mit seinem Generalsblick. Es war nicht sein echter durchdringender Blick, Intarra sei Dank – nicht das bodenlose schwarze Starren des Csestriim, das sie erst ein einziges Mal oberhalb des Schlachtfeldes von Andt-Kyl gesehen hatte, sondern das andere, das er zweifellos mehrere Generationen lang eingeübt hatte: ein harter, aber menschlicher Blick. »Es ist nötig, dass du besser bist als alle. Und deswegen brauchst du Ruhe. Du musst das Kind abgeben – zumindest zeitweise.«
»Ich werde das tun, was getan werden muss«, knurrte sie, während die kranke Blume des Zweifels in ihr erblühte.
Tatsächlich waren die letzten sechs Monate die grausamsten ihres Lebens gewesen. Die Tage waren angefüllt mit unmöglich zu treffenden Entscheidungen, die Nächte waren eine endlose Qual, gespeist aus dem Schreien Sanlituns und aus ihrem eigenen Zerren an den Laken, wenn sie das Kind zu sich ins Bett holte, ihm beruhigend zumurmelte und zu Intarra und Bedisa betete, es möge wieder einschlafen. Manchmal nahm es die Brust und saugte gierig ein paar Herzschläge lang, dann schob es sie wieder weg und schrie weiter.
Natürlich hatte sie Dienerinnen. Ein ganzes Dutzend Frauen saßen vor ihrem Gemach und würden hereinkommen, sobald Adare sie rief, die Arme voller frischer Windeln oder neuem Bettzeug. Diese Hilfe konnte sie annehmen, aber das Kind wegzuschicken, damit es an der Brust einer anderen Frau saugte … Das durfte sie ihm nicht antun. Und sich selbst auch nicht. Auch wenn sie aus Erschöpfung am liebsten geweint hätte oder die schläfrige Verwirrung in ihr wütete, schaute sie auf ihr Kind hinunter, auf seine dicke Wange, die sich gegen Adares geschwollene Brust drückte, und sie wusste, so wie sie um jede große Wahrheit über die Welt wusste, dass sie ihn niemals würde weggeben können.
Sie hatte ihre Mutter sterben sehen, sie hatte gesehen, wie sie ihre zerfetzte Lunge auf die feinste Seide ausgehustet hatte. Adare hatte neben ihrem Vater gestanden, als er in seine Gruft gebettet wurde, während die kaiserlichen Gewänder seine Wunden verdeckten. Sie hatte ihren einen Bruder getötet und war mit dem anderen in einen verzweifelten, bösen Kampf verwickelt. Ihre Familie war jetzt zu diesem einen kleinen Kind zusammengeschrumpft. Sie schaute hinüber zu der Wiege, in der es schlief, und beobachtete das Heben und Senken der winzigen Brust, dann wandte sie sich wieder an il Tornja.
»Warum bist du hier?«, fragte sie zum dritten Mal mit einer Stimme, die vor Müdigkeit zu kippen drohte. »Ich bezweifle, dass du die Front und den Kampf verlassen hast, nur um mit mir über die Feinheiten meiner Elternschaft zu sprechen.«
Il Tornja nickte, legte die Finger zu einem Dach zusammen, betrachtete sie einen Moment lang und nickte dann abermals.
»Wir haben eine Gelegenheit erhalten«, sagte er schließlich.
Adare breitete die Hände aus. »Wenn ich schon keine Zeit habe, meinen Sohn anständig aufzuziehen, dann habe ich erst recht keine Zeit für deine verdammten Rätselsprüche.«
»Die Republik hat angeboten, mit dir zu verhandeln.«
Adare starrte ihn an.
»Meine Männer haben den Boten abgefangen – der Mann wartet unten. Ich wollte mit dir reden, bevor du ihn siehst.«
Langsam, sagte Adare zu sich selbst. Langsam. Sie betrachtete il Tornjas Gesicht eingehend, konnte aber nichts aus ihm herauslesen.
»Zu wem wurde der Bote geschickt?«
»Zu dir.«
»Und deine Männer haben ihn abgefangen. Das kann man wohl kaum eine vertrauenswürdige Zusammenarbeit nennen.«
Il Tornja machte eine abwehrende Handbewegung. »Abgefangen haben sie ihn. Über ihn gestolpert sind sie. Hierher geleitet haben sie ihn. Sie haben ihn gefunden …«
»… und zu dir gebracht«, sagte Adare und versuchte, ihren Ärger im Zaum zu halten, »statt zu mir. Was machen deine Männer überhaupt im Süden? Die Söhne haben diese Front doch gesichert.«
»Angestrengt in nur eine Richtung zu schauen bringt den sicheren Tod, Adare. Auch wenn ich die Hingabe der Söhne an ihre Göttin und deren Prophetin nicht bezweifle« – ein wenig neigte er ihr den Kopf zu –, »habe ich doch schon vor langer Zeit gelernt, mich nicht auf Einheiten zu verlassen, die nicht unter meinem Kommando stehen. Meine Männer haben den Boten gefunden, sie sind zu mir gekommen, und als ich die Nachricht erfahren habe, bin ich unverzüglich zu dir gekommen.« Er schüttelte den Kopf. »Nicht alles ist eine Verschwörung, Adare.«
»Du wirst mir vergeben müssen, wenn ich sage, dass das nicht ganz aufrichtig klingt.« Sie lehnte sich auf ihrem Stuhl zurück, fuhr sich mit der Hand durch die Haare und zwang sich, ihre Aufmerksamkeit ganz auf den Kern der Angelegenheit zu richten. »Also gut. Ein Bote. Aus der Republik.«
»Mit einem Angebot für Verhandlungen. Und für einen Friedensschluss. So, wie es klingt, begreifen sie allmählich, dass ihre Regierung des Volkes nicht funktioniert.«
»Wie scharfsichtig von ihnen. Es hat nur neun Monate sowie den Verlust von zwei Atrepien und den Tod von Zehntausenden sowie das Gespenst einer allgemeinen Hungersnot gebraucht, um ihnen ihr Versagen klarzumachen.«
»Sie wollen dich zurückbekommen. Es soll wieder eine Kaiserin auf dem Unbehauenen Thron sitzen. Sie wollen den Riss heilen.«
Adare kniff die Augen zusammen und zwang sich, gleichmäßig zu atmen und die Lage zu überdenken, bevor sie eine Antwort gab. Es war verführerisch – so ungemein verführerisch. Und es war unmöglich.
»Das geht nicht«, sagte sie und schüttelte den Kopf. »Es ist undenkbar, dass fünfundvierzig von Annurs reichsten und gemeinsten Adligen ihre neue Macht einfach so abgeben. Selbst wenn die Stadt um sie herum abbrennt und sogar der Palast in Flammen steht, sie würden ihren Kurs nicht ändern. Dafür hassen sie mich zu sehr.«
»Nun …« Il Tornja dehnte das Wort und zuckte entschuldigend mit den Schultern. »Sie wollen ihre Macht nicht aufgeben. Jedenfalls nicht ernsthaft. Sie wollen dich als eine Art Galionsfigur haben, aber sie wollen weiterhin selbst die Gesetze machen und über ihre Politik entscheiden. Sie sagen dir, dass du bellen sollst, und du machst gehorsam ›wuff‹. So soll es sein …«
Adare hieb heftiger mit der flachen Hand auf den Tisch, als sie es beabsichtigt hatte.
Sanlitun wand sich in seiner Wiege, und sie hielt inne und wartete auf sein langsames, flaches Atmen, bis sie wieder sprach.
»Ihre verdammte Politik«, zischte sie, »zerstört Annur und frisst das Reich von innen auf. Ihre Politik tötet die Menschen. Und jetzt wollen sie, dass ich diesem Mist zustimme?«
»Soweit ich es verstehe, wollen sie, dass du mehr als nur zustimmst. Sie wollen, dass du ganz oben auf dem Misthaufen hockst und zu allem grinst.«
»Das werde ich aber nicht tun«, sagte sie und schüttelte den Kopf.
Er hob eine Braue. »Vor noch nicht allzu vielen Monaten bist du einmal der Meinung gewesen, es könnte möglich sein, mit den Mitgliedern des Rates zu verhandeln, und du hast Boten zu ihnen geschickt.«
»Boten, die sie gefangen genommen haben. Gute Männer, die inzwischen vermutlich tot sind. Ich war der Meinung, der Riss zwischen uns könnte geheilt werden. Aber jetzt glaube ich das nicht mehr. Es ist zu spät.«
Il Tornja runzelte die Stirn, als koste er von einer Speise, die schlecht geworden war. »Zu spät ist ein Ausdruck, der niemals über die Lippen eines Kaisers oder einer Kaiserin kommen sollte.«
»Ich dachte, es diene einer Kaiserin, wenn sie sich der Wahrheit stellt, statt vor ihr davonzulaufen.«
»Auf alle Fälle! Stell dich den harten Wahrheiten! Aber tu es für dich allein. Du möchtest doch keine Angst in die Herzen derer pflanzen, die dir folgen.«
»In dein Herz kann ich keine Angst pflanzen – nicht einmal, wenn ich sie mit einer Schaufel säe.«
»Ich rede nicht von mir.«
»Du bist hier der einzige Anwesende.«
»Du musst deine Züge unter Kontrolle haben, Adare«, sagte er. »Jederzeit.«
Sie öffnete den Mund und wollte etwas entgegnen, aber er hob die Hände und kam ihr zuvor. »Ich bin nicht hier, um mit dir zu streiten. Ich bin hergekommen, weil sich eine Möglichkeit eröffnet hat.«
»Eine Möglichkeit für was? Sollen wir etwa alles aufgeben, wofür wir in den letzten neun Monaten gekämpft haben? Sollen diese Idioten etwa alles vernichten, was noch von Annur übrig ist?«
»Es ist Annur, das ich zu retten versuche«, sagte il Tornja und wirkte plötzlich sehr ernst. »Ich wünsche, dass du zurückgehst. Heile den Riss zwischen dem Reich und der Republik. Ich würde dich nicht darum bitten, wenn es nicht unbedingt nötig wäre.«
Adare runzelte die Stirn. »Du verlierst«, sagte sie schließlich.
Der Kenarang nickte, dann zuckte er die Achseln. »Sogar ein Genie hat seine Grenzen. Meine Armeen sind so dünn wie der Rauch des gestrigen Tages. Die Urghul sind uns zahlenmäßig überlegen, sie kämpfen an der Seite eines Gefühls-Auszehrers, und dabei werden sie von einem Gott angeführt.«
»Du bist noch immer der Ansicht, dass Langfaust Meschkent ist«, sagte Adare und versuchte zum hundertsten Mal, es zu glauben. Und zum hundertsten Mal gelang es ihr nicht.
»Ich bin mehr denn je davon überzeugt.«
»Woher willst du das wissen? Erklär es mir.«
»Du würdest es nicht verstehen.«
Adare machte diese Bemerkung wütend. »Versuch es.«
Der Kenarang breitete die Hände aus. »Die Art des Angriffs. Und dessen Rhythmus.« Er stand auf und ging zur Landkarte hinüber. »Er hat uns hier und hier exakt zur gleichen Zeit getroffen. Und einen halben Tag später hier und hier und hier. Und stets ist eine weitere Gruppe nach Westen marschiert und immer dann bei Irfeths Furt eingetroffen, als sich die vorige zurückgezogen hat.«
Adare schaute auf die Karte und die weit verstreuten Positionen, auf die il Tornja gezeigt hatte. Die Ereignisse waren zwar deutlich nachvollziehbar, aber das Muster – wenn es überhaupt eines gab – bedeutete ihr nichts. Er machte eine beschwichtigende Geste. »Der menschliche Geist ist für so etwas nicht eingerichtet.«
Sie betrachtete die Flüsse und Berge, die Wälder, die kleinen Linien, die Armeen und Stellungen andeuteten, und bemühte sich, in den Angriffen einen eindeutigen Plan zu erkennen. »Hat er etwas Kluges getan?«, fragte sie schließlich.
Der General zuckte die Achseln. »Nichts besonders Kluges.«
Adare unterdrückte ein Knurren. »Was ist es dann?«
»Er hat etwas … Nichtmenschliches getan.«
»Alle Menschen sind unterschiedlich«, sagte Adare und schüttelte den Kopf. »Es gibt doch nicht so etwas wie eine ›menschliche‹ Art des Angriffs. Hundert Generäle würden hundert verschiedene Pläne schmieden.«
»Nein, das würden sie nicht.« Er zeigte ihr ein breites, helles Lächeln. »Manchmal vergisst du, Adare, dass ich schon gegen Tausende menschlicher Generäle gekämpft habe. Es waren zweitausendundacht, wenn du die genaue Zahl wissen möchtest. Ihr denkt gern, dass jeder von euch einzigartig ist, dass jeder Mann und jede Frau anders ist als alle, die vor ihnen kamen, aber das stimmt nicht. In all jenen Schlachten, in all jenen Kriegen habe ich stets dieselben Dinge gesehen, wieder und wieder, dieselben kleinen Kniffe, dieselben unbeholfenen Spielchen und Taktiken, die immer wieder mit winzigen, unbedeutenden Änderungen vorgeführt wurden. Ich kenne die Grundzüge menschlicher Angriffe, und dieser hier gehört nicht dazu. Langfaust ist Meschkent. Darauf kann ich dir mein Wort geben. Er beabsichtigt seine blutige Verehrung in ganz Vasch und Eridroa zu verbreiten, und auch wenn es mich zutiefst ärgert, ich muss doch zugeben, dass er gerade dabei ist zu gewinnen.«
»Ich dachte, du meintest, er sei nicht brillant.«
»Das muss er auch nicht sein, wenn seine Armee der meinen zahlenmäßig im Verhältnis von zwanzig zu eins überlegen ist. Ich brauche mehr Männer, Adare. Ich brauche die Söhne der Flamme. Und ich brauche eine sichere südliche Front. Zumindest so lange, bis der Krieg vorbei ist.« Er lächelte wölfisch.
Adare betrachtete ihren General. Der Kenarang sah hungrig aus. Sein Blick war auf sie gerichtet, und er hatte die Lippen nur so weit geöffnet, dass sie den Schatten der Zähne zeigten. Er wirkte bereit zum Lächeln oder zum Knurren – bereit zum Zubeißen. Von all seinen sorgfältig kultivierten menschlichen Verhaltensweisen war diese die glaubwürdigste. Hinter dem beiläufigen Geplauder und den schimmernden Spangen und Schnallen war Ran il Tornja ein Jäger, ein Mörder und der größte General, den Annur je gesehen hatte. Und das Mördergesicht, das er nun aufgesetzt hatte, wirkte echt und richtig.
Nichts, was er zeigt, ist echt, rief sie sich jedoch in Erinnerung.
Er hatte eine seiner Masken abgenommen, das war alles. Dieser Hunger und diese Wildheit waren bloß ein weiteres Gesicht unter all den anderen Gesichtern, allerdings ein besseres und subtileres Schauspiel – eines, das sie als wahr anerkennen wollte. Sie konnte das brutale Wüten und Beißen nach der Macht durchaus verstehen. Sie konnte es beherrschen. Doch die Wahrheit hinter il Tornja war kein einfaches tierisches Knurren. Sie war etwas anderes, etwas Älteres und Schrecklicheres, das hinter all den Gesichtern lauerte – etwas Unheimliches und Unmenschliches, so unergründlich wie der Raum zwischen dem Licht der Sterne.
Angst kroch über ihre Haut, und die feinen Haare an ihrem Arm stellten sich auf. Mit Mühe unterdrückte sie ein Schaudern und zwang sich, ihm in die Augen zu sehen.
»Und wann ist er vorbei?«, fragte sie.
»Sobald Meschkent besiegt und die Urghul zurückgetrieben sind …« Er lächelte noch breiter und lehnte sich zurück, bis sein Stuhl nur noch auf zwei Beinen balancierte, in der Schwebe zwischen dem Umkippen nach vorn und dem nach hinten. »Nun, dann kümmern wir uns um … wie sollen wir es nennen? Um die langfristige Lebensfähigkeit des republikanischen Experiments …«
»Und mit kümmern meinst du, dass du jeden tötest, der mich nicht zurückhaben will«, sagte Adare offen heraus.
»Nun …« Er spreizte die Hände. »Wir könnten ein paar von ihnen töten, bis sich die anderen an die goldene Pracht der malkeenischen Herrschaft erinnern.«
Adare schüttelte den Kopf. »Es fühlt sich falsch an. Die großen Kaiser von Annur – diejenigen, die über ein friedliches Reich geherrscht haben – haben den Verrat bestraft und all jene belohnt, die loyal geblieben sind. Ich habe die Chroniken gelesen. Und du erwartest, dass ich über den Verrat und die Idiotie dieses kentverdammten Rates hinwegsehe?«
Der Kenarang lächelte. »Ich bin die Chroniken, Adare. Zwei von ihnen habe ich selbst geschrieben. Die Kaiser von Annur waren groß, weil sie genau das getan haben, was sie tun mussten. Was immer es gewesen sein mag, das sie haben tun müssen. Natürlich wirst du dein eigenes Leben aufs Spiel setzen …«
Adare machte eine abweisende Handbewegung. Er hatte recht, was die Risiken betraf. Wenn sie nach Annur ging und sich dem Rat präsentierte, würde sie unverzüglich zu ihrer eigenen Hinrichtung abgeführt werden. Dieser Gedanke trieb ihr den Schweiß auf die Handflächen, aber es hatte keinen Sinn, allzu lange bei ihm zu verweilen. Sie hatte die Front besucht, war zu den Dörfern gereist, die gerade von den Urghul überfallen worden waren. Sie hatte die aufgeschlitzten Körper gesehen und all die Leichen, die an Pfählen steckten, die verkohlten Überreste von Männern, Frauen und Kindern, einige davon über behelfsmäßige Altäre ausgebreitet, andere unachtsam auf Haufen geworfen – die entsetzlichen Überreste dessen, was die Urghul Anbetung nannten.
Annur – ob kaiserlich oder republikanisch, spielte dabei keine Rolle – befand sich am Rande eines blutigen Abgrundes, und sie war die Kaiserin. Sie hatte diesen Titel angenommen, hatte ihn eingefordert, und zwar nicht um sich auf einem unbequemen Thron an den Schmeicheleien der Höflinge zu ergötzen, sondern einfach, weil sie geglaubt hatte, dass sie gute Arbeit leisten konnte – jedenfalls bessere Arbeit als der Mann, der ihren Vater getötet hatte. Sie hatte den Titel angenommen, weil sie geglaubt hatte, das Leben für die Millionen Einwohner des Reiches besser gestalten, sie beschützen und ihnen Frieden und Wohlstand bringen zu können.
Und bisher hatte sie versagt.
Es spielte keine Rolle, dass Kaden ein noch größerer Versager war. Es spielte ebenso wenig eine Rolle, dass sie die erste Kaiserin seit Jahrhunderten war, die sich einer Invasion von Barbaren gegenübersah. Es spielte auch keine Rolle, dass nicht einmal ihr Vater das Chaos vorhergesehen hatte, das sie nun allesamt einhüllte. Sie hatte den Titel angenommen, und es war ihre Aufgabe, die Dinge zurechtzurücken und die Risse zu heilen, die Annur spalteten. Vielleicht wäre ihr ein Glied nach dem anderen aus dem Leib gerissen worden, wenn sie Kadens Rat gefolgt wäre, vielleicht aber auch nicht. Wenn sie zurückkehrte, gab es die Möglichkeit, Annur zu retten – das Volk von Annur zu retten, die Barbaren zurückzutreiben und ein gewisses Maß an Frieden und Ordnung wiederherzustellen. Allein diese Möglichkeit war das Risiko schon wert, dass ihr eigener blutleerer Kopf bald einen Pfahl zierte.
»Da ist noch etwas«, fügte il Tornja hinzu. »Etwas, das du herausfinden wirst, wenn du die Stadt erreicht hast.« Er hielt inne. »Dein Bruder hat einen Freund gefunden.«
»So ist das nun einmal bei uns Menschen«, erwiderte Adare. »Wir empfinden Zuneigung, entwickeln Gefühle für andere Menschen und dergleichen mehr.«
»Wenn Kaden sich mit einem Menschen angefreundet hätte, würde mir das keine Sorge machen. Das dritte annurische Mitglied des Rates, der Mann, der unter dem Namen Kiel bekannt ist – ist aber kein Mensch. Er ist von meiner eigenen Art.«
Adare starrte ihn an. »Kaden hält sich einen Csestriim?«
Il Tornja kicherte. »Kiel ist kein Pferd und auch kein Jagdhund, Adare. Ich kenne ihn seit Jahrtausenden, und ich kann dir versichern: Wenn sich jemand hier jemand anderen hält, dann ist es Kiel, der sich deinen Bruder hält, seinen Geist beherrscht und seinen Willen vergiftet.«
»Warum sagst du mir das erst jetzt?«, wollte Adare wissen.
»Ich habe die Wahrheit selbst erst vor Kurzem erkannt. Da mir der Name des dritten annurischen Abgesandten nichts gesagt hat, habe ich um sein Bild und seine Beschreibung gebeten. Aber leider hat der Narr, der beides abliefern sollte, eine wunderbare Tintenzeichnung von der falschen Person gemacht: von jemandem aus der kreschkanischen Delegation. Ich habe den Fehler erst kürzlich herausgefunden.«
Adare bemühte sich, diese Enthüllung zu begreifen. Il Tornja war eine Waffe, ein Instrument der Vernichtung. Sie hatte ihm einen Kragen anlegen lassen und ihn gefügig gemacht, und dennoch fürchtete sie, sie könnte etwas übersehen haben und eines Tages an seiner Leine zerren, nur um feststellen zu müssen, dass sie inzwischen schrecklich schlaff saß. Bei der Erkenntnis, dass es noch einen weiteren Csestriim auf der Welt gab, der sich ausgerechnet mit ihrem Bruder verbündet und über den sie keinerlei Kontrolle hatte, drehte sich ihr der Magen um.
»Kiel war derjenige, der die republikanische Verfassung entworfen hat«, bemerkte sie.
Il Tornja nickte. »Er war nie ein Freund deines Reiches. Schon seit Hunderten von Jahren bemüht er sich, es zu vernichten. Jeder wichtige Staatsstreich, jede Verschwörung gegen die malkeenische Herrschaft – immer steckt er dahinter.«
»Außer hinter deinen Verschwörungen natürlich. Außer hinter dem Staatsstreich, in dem du meinen Vater getötet hast.«
Er lächelte. »Ja.«
Adare betrachtete ihn eingehend und hoffte, etwas in diesen undeutbaren Augen lesen zu können, das Schillern der Lüge vielleicht oder das harte Licht der Wahrheit. Wie gewöhnlich gab es vieles zu sehen. Und wie gewöhnlich konnte sie auf nichts von alldem vertrauen.
»Du machst dir Sorgen, Kaden könnte wissen, wer du bist«, sagte sie.
»Ich bin mir sicher, dass Kaden weiß, wer ich bin. Kiel hat es ihm gesagt.«
Hinter ihr wand sich Sanlitun in seiner Wiege und schrie. Einen Augenblick lang hatte Adare die schreckliche Vision, dass die Urghul über die Brücke strömten, dass die hellhäutigen Reiter die Burgmauern zum Einsturz brachten, in ihr Gemach eindrangen, das Kind packten …
Sofort stand sie auf und drehte sich so, dass il Tornja ihr Gesicht nicht sehen konnte. Sie ging zu der Wiege hinüber, beobachtete ihren Sohn einen Moment lang, sah ihm beim Atmen zu und hob ihn dann sanft in ihre Arme. Als sie sicher war, dass sie ihr Mienenspiel wieder unter Kontrolle hatte, wandte sie sich dem Kenarang zu.
»Ich werde gehen«, sagte sie müde. »Ich werde versuchen, den Riss zu flicken. Mehr kann ich nicht versprechen.«
Il Tornja lächelte; seine Zähne schimmerten hell im Lampenschein. »Zuerst musst du ihn flicken, aber später können wir uns vielleicht um … dauerhaftere Lösungen bemühen.«
»Sie wollten Euch haben«, sagte Maut Amut. »Die Angreifer hatten es auf Euch abgesehen.«
Kaden hielt beim Aufstieg inne, lehnte sich gegen das Geländer, holte tief Luft und schüttelte den Kopf. »Dessen kannst du dir nicht sicher sein.«
Amut stieg weiter hoch, nahm je zwei Stufen gleichzeitig und schenkte dem Gewicht seines schimmernden aedolianischen Stahls keinerlei Beachtung. Er hatte den nächsten Treppenabsatz erreicht, bevor er bemerkte, dass Kaden zurückgefallen war.
»Ich bitte um Entschuldigung, Erster Sprecher«, sagte er und neigte den Kopf. »Meine Scham macht mich ungeduldig.«
Der Gardist richtete den Blick auf die Treppe, legte die Hand auf den Knauf seines Breitschwertes und wartete. Selbst in seinen lebhaftesten Momenten war der Erste Schild der aedolianischen Garde ein steifer Mann, wie aus Marmor gehauen, scharfkantig und voller Anstand. Als er reglos dastand und darauf wartete, dass Kaden seine Kraft wiederfand, wirkte er wie eine Statue oder ein Stück Stahl, das auf einem Amboss geschmiedet worden war.
Erneut schüttelte Kaden den Kopf. »Du musst dich nicht für die Tatsache entschuldigen, dass ich schwächlich geworden bin.«
Amut regte sich nicht. »Intarras Speer hochzuklettern ist sogar für einen geübten Mann eine einschüchternde Aufgabe.«
»Es sind nur dreißig Stockwerke bis zu meinem Arbeitszimmer«, erwiderte Kaden und zwang seine Beine wieder zur Bewegung. Er unternahm diesen Aufstieg beinahe jeden Tag, doch stets in einem gemächlicheren Tempo. In einem immer gemächlicheren Tempo, erkannte er nun, nachdem einige Monate vergangen waren. Amut hingegen hatte sich beeilt, seit sie den Ratssaal verlassen hatten, und schon im zehnten Stock hatten Kadens Beine gebrannt. Er schob den Gedanken beiseite, dass er heute geplant hatte, viel höher als bis zum dreißigsten Stock zu klettern.