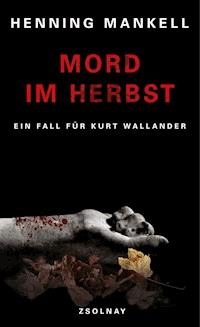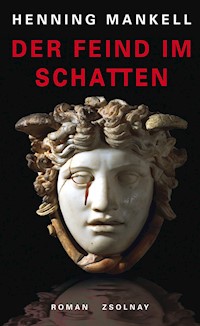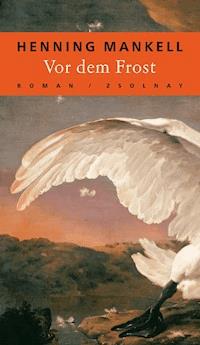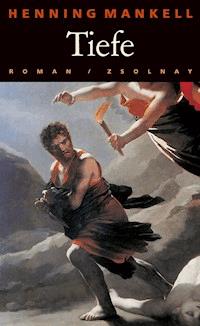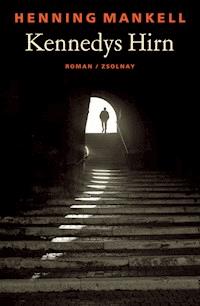Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Entdeckung: Henning Mankells erster Spannungsroman. Von Ausgrenzung, politischer Verfolgung und der Notwendigkeit, sich mit Geschichte auseinanderzusetzen.
Ein kleiner Ort in Norrland nach dem Krieg. Bertil Kras kommt aus Stockholm, um hier sein Glück zu machen. Er findet Arbeit im Sägewerk. In einem Lager in der Nähe waren in den letzten Kriegsjahren Kommunisten und andere politische Oppositionelle interniert. Bertil, selbst überzeugter Kommunist, und eine Gruppe Gleichgesinnter wollen diese Vergangenheit an die Öffentlichkeit bringen. In einer kalten Januarnacht brennt das Sägewerk ab, und man verdächtigt Bertil, den Brand gelegt zu haben. Er droht alles zu verlieren und läuft auf dem Rangierbahnhof Amok. „Der Verrückte“ erzählt die Geschichte eines Arbeiters, der in der aufstrebenden Nachkriegsgesellschaft zum Opfer wird. Ein früher Roman von Henning Mankell über ein dunkles Kapitel der schwedischen Geschichte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 641
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Über das Buch
Eine Entdeckung: Henning Mankells erster Spannungsroman. Von Ausgrenzung, politischer Verfolgung und der Notwendigkeit, sich mit Geschichte auseinanderzusetzen.Ein kleiner Ort in Norrland nach dem Krieg. Bertil Kras kommt aus Stockholm, um hier sein Glück zu machen. Er findet Arbeit im Sägewerk. In einem Lager in der Nähe waren in den letzten Kriegsjahren Kommunisten und andere politische Oppositionelle interniert. Bertil, selbst überzeugter Kommunist, und eine Gruppe Gleichgesinnter wollen diese Vergangenheit an die Öffentlichkeit bringen. In einer kalten Januarnacht brennt das Sägewerk ab, und man verdächtigt Bertil, den Brand gelegt zu haben. Er droht alles zu verlieren und läuft auf dem Rangierbahnhof Amok. »Der Verrückte« erzählt die Geschichte eines Arbeiters, der in der aufstrebenden Nachkriegsgesellschaft zum Opfer wird. Ein früher Roman von Henning Mankell über ein dunkles Kapitel der schwedischen Geschichte.
Henning Mankell
Der Verrückte
Roman
Aus dem Schwedischen von Andrea Fredriksson-Zederbauer
Paul Zsolnay Verlag
Für
Knut Heljar
und
Gustav
Die Zeit des Huflattichs
1.
Im Traum wirkt Bertil Kras wie ein Verrückter.
In einem rosa Licht kommt er auf mich zu, ich vermag seine Schritte nicht zu erkennen, und hält wenige Meter vor mir an. Ich empfinde sein Erscheinen als still, beinahe rücksichtsvoll. In seinen Augen liegt etwas Scheues, und er ist sehr müde. Er bleibt stehen, vollkommen reglos, als sei er die ganze Zeit da gewesen. Er steht einfach vor mir, umfangen und beschützt vom Traum, dennoch ruhelos und unschlüssig.
Im Traum, habe ich gesagt; gleichwohl sah ich ihn seinen nächtlichen Befreiungsschlag in der Wirklichkeit ausführen, mittlerweile ist es neunzehn Jahre her. Zu jenem Zeitpunkt, als es sich tatsächlich zutrug, war der Ausdruck ein anderer. Damals sah ich ihn auf einem Rangierbahnhof, ein Verrückter zwischen rotfarbenen Güterwaggons. Der Bahnhof war in zähflüssige Dunkelheit gehüllt. Die blassgelben Lampen oben auf den rostigen Eisenpfählen vermochten allenfalls dünne, scharfe Lichtpunkte zu bilden, die sachte auf die Gleise und Bahnschwellen fielen. Und dort sah ich ihn herumlaufen. Obwohl die Nacht dunkel war und ich mich in einiger Entfernung befand, beinahe hundertfünfzig Meter, konnte ich ihn deutlich sehen. Seine Bewegungen waren ruckartig und wirkten, als mangle es ihm an Koordination. Die Arme strebten in eine Richtung, während die Füße wie in einer Fehlstellung nach hinten gedreht schienen. Der Kopf pendelte, von den Nackenwirbeln scheinbar losgelöst, wie ein Punchingball hin und her. Auch ohne dass Laute zu mir drangen, war ich fest überzeugt, dass er schwer keuchte und hin und wieder von erstickenden Hustenanfällen erfasst wurde.
Und doch möchte ich ihn lieber als eine Traumgestalt zeigen, einen in keinem Geburtsregister verzeichneten Schatten, der einst alle, die vom Lärm losgelassener Güterwaggons aufgewacht waren, in Angst versetzte. Ich ziehe den Traum vor, weil darin die Ereignisse an Schärfe gewinnen. Eine Sequenz mit verblasstem, nacktem Licht. Ich ziehe den Traum auch deshalb vor, weil er jetzt, nach so langer Zeit, auf eigenartige Weise wahrhaftiger wird. Das Unwichtige hat sich verflüchtigt, übrig bleibt eine schwarzweiße Gestalt, die verzweifelt versucht, Eisenbahnwaggons entgleisen zu lassen und die Schraubenbolzen aus den geteerten Holzschwellen zu reißen.
Damals wohnten wir in der Nähe der Bahn. Vaters Schnarchen dröhnte durch das weiße zweistöckige Holzhaus. Es rumorte wie Darmwinde, ruckweise und unregelmäßig. Ich war aufgewacht, weil ich pinkeln musste. Der Wecker auf dem Porzellanteller mit den blauen Blumen zeigte halb zwei. Die eigenartigen Geräusche, die von außen durch die Holzwände drangen, hörte ich, als ich mit vor Müdigkeit klebrigen Augen vor der Toilette stand. Ich richtete meinen Strahl aus, den leicht zaudernden Harnstrahl eines Kindes, und fand es seltsam, dass sie dort mitten in der Nacht mit dem Rangieren der Waggons beschäftigt waren. Das hatte es doch nur im Krieg gegeben, der zu Ende gegangen war, kurz bevor ich geboren wurde. Und es konnte doch nicht schon wieder Krieg sein, davon hatte mir keiner etwas gesagt.
Als ich mich im Dunkeln auf den Flur hinaus tastete, stieß ich mit dem Knie an den Sofatisch. Es war kein harter Stoß, nur ein leichter Schlag genau in die weichen Teile unter der Kniescheibe. Da die Muskeln vor Müdigkeit schlaff waren, tat es nicht weh.
Es war kaum möglich, durch das Fenster etwas zu sehen. Die Scheibe war von groben Eiskristallen überwuchert, in jener Nacht hatte es sicher dreißig Grad minus. Aber kurz darauf hatte ich in einem der kleinen Hohlräume, die es auf einer zugefrorenen Fensterfläche immer gibt, ein Blickfeld gefunden.
Jetzt im Nachhinein, im Traum, ist all das weggeschält. Vom Harndrang bleibt nichts übrig. Im Traum gibt es nur den Verrückten in einem stark vergrößerten und stilisierten Panoramabild.
Ein Traum, in all seiner verblüffenden Fähigkeit zu überraschen und Geheimnis und Unsicherheit zu erzeugen.
Doch nichts ist rätselhaft. Alles lässt sich beschreiben und wird fassbar. Es ist möglich, die Geschichte des Verrückten nachzuzeichnen.
Sein Name war Kras, so hieß der, den wir auf dem nächtlichen Rangierbahnhof vorfinden. Woher dieser eigenartige Name stammte, wusste niemand. Vielmehr sah man es mit einer gewissen Genugtuung, dass der Auswärtige einen so komischen Namen trug. Dass sein Vorname ganz normal Bertil war, blieb unberücksichtigt. Er musste schlicht und einfach unter dem Spitznamen Krach durchgehen, bis er später seine unheilvolleren Beinamen bekam.
In die kleine norrländische Marktgemeinde war er im Herbst 1947 gekommen. Leute, die Bescheid wussten, behaupteten, dass er das erste Mal an einem Sonntagvormittag aufgetaucht war. Dies hatte seiner Ankunft auf spezielle Weise Kontur verliehen. An Sonntagen kam der erste Zug nicht vor halb zwei, und dass er nicht mit dem Auto gekommen war, stand außer Zweifel. Plötzlich war er einfach da gewesen, auf der Straße zwischen der Post und dem Möbelgeschäft. Auf dem Bürgersteig drehte er sich langsam um, ein Mal, zwei Mal, als hielte er Ausschau nach etwas. Es war halb neun, und der sonntäglichen Gemeinde stand ihre Ödnis bis zum Hals. Die Zeit für den Kirchgang war noch fern, niemand hatte etwas im Freien zu verrichten.
Bertil Kras störte die Ruhe. Er war nicht nur zu einer unpassenden Zeit eingetroffen, weil daraus nicht hervorging, wie er angekommen war. Auch die Geste, mit der er sich zu Beginn präsentierte, war ein Rätsel. Wie er da auf dem Bürgersteig steht und sich umdreht, bringt er die Ortsbewohner, die ihn sehen, gegen sich auf. An diesem Sonntagvormittag, an dem die Sonne die obere Kante der Waldrücken rings um die Talgemeinde in herbstliches Licht taucht, dringt er krachend in ihren geschlossenen Organismus ein wie eine rasch um sich greifende Infektion. Der Auswärtige, der unwillkommene Gast, wird zu einem Fleck auf der Oberfläche des Bildes, das man so oft poliert hat. Seine Anwesenheit saugt sich ins Bewusstsein der Häuser. Die geschlossenen Sonntagstüren können es nicht verhindern.
Viel später, irgendwann Anfang der fünfziger Jahre, erzählt er selbst vom Erlebnis seiner Ankunft. Er sagt, er hätte sich »so verflucht schwergetan, die Kirche zu finden. Ich wollte wissen, wie spät es war. Als ich dann die Kirche gefunden hatte, stellte sich ja heraus, dass es gar kein Zifferblatt gab. Nur ein paar verschlossene Luken ganz oben auf dem Turm.« Er erzählt weiter, dass er ungeheuer hungrig gewesen sei und nach einer offenen Gaststätte Ausschau hielt, obwohl er die Unmöglichkeit erkannte. Fast zwei Stunden lang sei er herumgelaufen. Danach habe er sich auf den Weg hinunter an den Fluss gemacht und sich dort unter eine Kiefer gesetzt, die schief über der Sandbank hing. Dort sei er »bestimmt ein Weilchen eingenickt«.
Er sitzt in der Kneipe und erzählt. Das Sägewerk ist bereits abgebrannt, und er wurde beschuldigt, den Brand verursacht zu haben. Wie immer sitzt er ganz hinten in der Ecke, den Rücken an der Wand. Im Nacken fühlt er den scharfkantigen Rahmen des Bildes mit den beiden Mönchen, die ein Bierfass tragen. Seine Hände mit den dünnen Fingern und dem schwarzen Messingring liegen auf dem Tisch wie sonnenbadende Körper auf einem Sandstrand. Den Aschenbecher hat er zur Seite geschoben, zu jener Zeit hat er das Rauchen bereits aufgegeben. Zwischen den Händen stehen das Bierglas und die braune Glasflasche.
Er sitzt wie gesagt mit dem Rücken zur Wand, und zugleich sitzt er mit abgewandtem Rücken. Eine kurze Seitenwand trennt seinen Einzeltisch vom restlichen Lokal, das nach Tabak und dem feuchten Lehm auf den Gummistiefeln riecht. Einst gab es in der Kneipe eine Hintertür. Man hat sie zugemauert und einen Tisch an die leere Stelle gestellt, der nach und nach Krachs Tisch wurde.
Genau genommen kann man nicht sagen, dass er erzählt; er ist allein an seinem Tisch. Er murmelt mit einem eigentümlichen Ausdruck von Schwermut und Angst vor sich hin. Die Wörter purzeln aus seinem Mund, der nur ganz leicht geöffnet ist. Seine Zunge schnappt nach Luft, während die Wörter aus seinem Inneren hervorquellen. An Krachs Tisch herrscht eine verheerende Ruhe. Er wird von fernen Stimmen umfangen, vom Klirren der Gläser und Flaschen. Im Rauch, der zu ihm hinzieht, hängen Rückstände jener Gerüchte, von denen er sich umgeben weiß.
Doch niemand sagt etwas. Die Stimmen sind gedämpft. Die Brutalität ist eine andere, verschluckte Taschenmesser, die sich in den Magenhöhlen plötzlich öffnen.
Aber bereits auf dem einsamen und hungrigen sonntäglichen Gang durch die Gemeinde zog er verstohlene Blicke auf sich. Kleinmütige Augen hinter weißen Gardinen, durchlässig genug, um die Sicht nach außen zu erlauben, dicht genug, um die Sicht nach innen zu verhindern.
Die Geschichte ist einfach. Sie handelt von denen, die ihn zusammengeschlagen und zerstört haben.
Bertil Kras, ein Stein, der mitten in die Erzählung fällt, der Grund für sich immer weiter ziehende Kreise. Doch der Verrückte, der Pyromane, die Glasscherbe und wie immer er auch genannt wird, ist allenfalls ein Zugang, die erste Tür zu dem, was beschrieben werden soll. Sein Schicksal ist nur ein Maßstab, ein Stück Fleisch, das zu einer dünnen und geschmacklosen Tragödie zerkocht wird, ein Selbstmord, von dem ich nicht sagen kann, ob er noch begangen worden ist.
Als Bertil in seiner hungrigen Einsamkeit auf der sonntäglichen Straße der Gemeinde steht, eines Tages im September 1947, ist bereits viel geschehen. Nur ein Beispiel: Fünf Jahre zuvor haben mehrere seiner künftigen Henker blankpolierte Rentiergeweihe an die deutsche Botschaft geschickt, mit guten Wünschen für die Zukunft.
Doch Bertil sucht nach einem Kirchturm mit einem Zifferblatt. Noch ist das Ende samt Katastrophe am Rangierbahnhof fern. Noch ahnt er nichts von der kalten Winternacht, als ich pinkeln muss und ihn durch die verzerrende Eisschicht einer Fensterscheibe sehe.
Er findet also keine Gaststätte. Schließlich bleibt er beim Automaten vor dem Bahnhof stehen, wirft eine Fünfundzwanzig-Öre-Münze ein und zieht einen Schokoriegel mit Nüssen heraus. Er öffnet ihn und verzehrt ihn noch am Automaten. Dann steckt er das Papier in die Tasche und macht sich auf den Weg hinunter an den Fluss. Um ihn herum döst die Gemeinde in ihrem trügerischen Idyll, seine Schritte werden von denen, die ihn sehen können, genau beobachtet.
Sie registrieren seine langsame Art zu gehen, das etwas ruckartige Abrollen, mit dem er zu jedem Schritt ansetzt. Sie sehen seine Magerkeit, die leicht vorstehenden grauen Augen, die dünnen hellen Haare, die wie Federn auf seinem Schädel auf und ab wippen.
Unten am Fluss hält er sich an einem struppigen Gebüsch fest und beugt sich zu dem kalten und klaren Gewässer hinab. Er taucht seine Fingerspitzen ein und streicht sich über die Stirn. Er lehnt sich an die schief gewachsene, von Wurzelfäule befallene Kiefer und wird eine Weile später vom Schlaf übermannt.
Kurz bevor er einschläft, fühlt er die raue Rinde durch sein Sakko.
Er sitzt dort wie ein undeutlicher und trüber Fleck, in jener Zeit, in der das schwedische Volksheim einmal tief Luft holt, ehe das große Projekt des Wohlfahrtsstaats in den fünfziger Jahren Fahrt aufnimmt.
Die Idylle ist trügerisch. Bertil ist von einer Stille umfangen, die sich grellfarben verkleidet.
Seine Identität blieb unbekannt, bis er am selben Tag gegen drei Uhr die Pension Gustafsson betrat und fragte, ob er eine Zeit lang ein Zimmer mieten könne. Helmer Gustafsson, seit 1939 Witwer, schöpfte bereits bei den Worten »eine Zeit lang« Verdacht. Das klang viel zu unbestimmt. Als er dann sah, dass sich diese verdächtige Figur als Herr Bertil Kras einschrieb und überdies kein Gepäck zu haben schien, sondern lediglich den Schlüssel mit dem schweren Eisenklumpen nahm und hinauf in das Zimmer im ersten Stock ging, wurde dieser Verdacht noch bestärkt. Er ging auf den Hof hinaus, um nachzusehen, ob er sich auch nicht täuschte; dort stand, ganz wie vermutet, kein Wagen. Dann setzte er sich in die Küche und rief Strömgren an, der am Bahnhof arbeitete, und fragte, ob sich an diesem Nachmittag ein Fremder im Zug befunden hätte. Strömgren verneinte, es wären nur Einheimische angekommen. Als Helmer Gustafsson das Gespräch beendet und den Hörer aufgelegt hatte, beschloss er, eine Vorauszahlung zu verlangen, sobald dieser Kras sich wieder blicken ließ.
Dies geschah erst am Montagmorgen, kurz nach sieben. Gustafsson, der Schlafprobleme hatte und bereits um fünf aufstand, hörte, wie jemand im ersten Stock umherschlich. Da Bertil der einzige Gast war, ging er rasch in die enge kleine Portiersloge hinaus und wartete.
Bertil kam die Treppe herunter. Er nickte freundlich, brummelte wohl einen guten Morgen und legte den Schlüssel auf die Theke. Seine Bewegungen waren einfach und offen, und Gustafsson ließ von seinem Plan ab.
Bertil trat durch die Tür nach draußen. Ein schwacher Nieselregen schwebte unter dem wolkenverhangenen Himmel. Er stand einen Augenblick still, lächelte flüchtig vor sich hin und verschwand aus dem Bild.
Er geht zum Sägewerk und findet umgehend Arbeit am Stapelplatz.
Er arbeitet dort, bis das Werk einige Jahre später vollständig abbrennt.
2.
Ein Stück von der Gemeinde entfernt hatte es im Wald ein Lager gegeben.
Es war eingezäunt gewesen. Vor allem aber war es von einer Geheimsprache umschlossen. Diese Sprache ging äußerst bewusst zu Werke: eine Sprache, um Einsicht zu verhindern. So wenigen wie möglich sollte die Existenz des Lagers bekannt werden. Es war Krieg, das Volk brauchte Führer, Führer mussten Freiheiten haben. Auch um eine Geheimsprache zu schaffen.
Nun, im Nachhinein, hat diese Geheimsprache eine andere Definition: eine »notwendige Vorsichtsmaßnahme«.
Nun, da das Lager nicht mehr existiert.
Das Lager — oder die Arbeitskompanie, wie man es auch nannte — hatte drinnen im Wald gelegen. Wo zuvor ein Holzweg an einem Kahlschlag endete, wurde ein neuer Weg einige Kilometer in den Wald hinein verlängert. Der neue Wegabschnitt war eng, alles deutete darauf hin, dass er in großer Eile geschlagen worden war. Tatsächlich bestand er nur aus zwei schmalen Erdstreifen für die Räder der Fahrzeuge, notdürftig eingeebnet und festgestampft. In der Mitte der beiden Spurrillen lagen Reste der oberflächlich entfernten Kiefernstümpfe. Dazwischen wuchs spärlich blassgrünes Gras.
Seitlich des Weges: der hartnäckige Kiefernwald mit seinen geraden und dünnen Silhouetten. Auf dem Boden eine knisternde Reisigdecke, Preiselbeerpflanzen und vereinzelt Pilze.
Der Standort des Lagers ging auf einen Blitz zurück. Einige Jahre vor Kriegsausbruch hatte er eingeschlagen, und durch den Brand war ein Quadratkilometer Wald vernichtet worden. Die schwarze Erde hatte man ruhen lassen, bis die Errichtung eines Lagers zur Debatte stand. Wem dafür die Brandstätte in den Sinn kam, lässt sich nicht feststellen. Plötzlich ist der Vorschlag da, ein guter Vorschlag, der eine Reihe diskreter Vorbereitungen in Gang setzt. Offiziere, Polizisten und unbekannte Amtsträger in dunklen Mänteln tauchen in dem kleinen Marktflecken auf, um rasch wieder zu verschwinden, nachdem sie gerüchteweise die Stelle des alten Waldbrandes besichtigt hatten.
Welche Argumente den Ausschlag gaben, das Lager auf dem Brandplatz zu errichten, ist nicht mehr herauszufinden. Die Geheimsprache gibt es nach wie vor. Einige von denen, die die Beschlüsse fassten, sind tot, andere senil, müde und weinerlich. Und die Übrigen verdrehen die Wahrheit.
Dass der Platz geeignet war, ist offensichtlich.
Wie gesagt hatte das Lager im Wald gelegen. Das tut es immer noch. Der Wald hat die hundert Hektar große Wunde wieder geheilt, wo Kommunisten, Syndikalisten, Anarchisten und andere »politische Elemente, die aus Gründen der Sicherheit des Staates zu internieren sind«, in Baracken lebten. Fichten haben sich auf der Brandstätte ausgebreitet. Nur wer Bescheid weiß, kann Spuren entdecken.
Vom Lager ist nur der Müllhaufen neben ein paar großen Feldsteinblöcken geblieben. Die Feldsteine waren in der Hitze zersprungen, und in die Felsspalten hatte man damals den Müll geworfen. Konservendosen, Leerflaschen, Ölfässer, kaputte Öfen, kaputte Spaten, Schuhe, Stiefel. Davon gibt es immer noch sichtbare Überreste. Was bereits verrottet und in der Erde versunken ist, muss man sich hinzudenken.
Während ich mich hinunterbeuge und mit der Hand im Dreck stochere, denke ich, dass man unsere Geschichte in Lagern messen kann. Unterschiedliche Arten, unterschiedliche Mengen, unterschiedlicher Inhalt.
Einige Meter hinter mir steht Svante Eriksson, der mich hierhergefahren und mir den Weg gezeigt hat. Einen Stiefel hat er auf einen Stein gesetzt. Als ich versuche, seinen Blick zu fixieren, wendet er ihn ab.
Er ist schwer zu fassen, der gute Svante. Als ich einige Wochen zuvor über den eingezäunten Sandplatz ging, auf dem die Schneeräumungsfahrzeuge der Straßenmeisterei wie gelbe Schmetterlinge wirkten, hockte er bei einer der großen Planierraupen. Er sei ein alter Kommunist, einfach im Umgang, hieß es. Einer von jenen, die »immer noch am Glauben festhielten«. Ich ging also direkt auf ihn zu, meine Schritte waren für ihn schon aus einer Distanz von dreißig, vierzig Metern zu hören. Er drehte sich um, konnte vielleicht noch sehen, dass ich nickte. Ich blieb stehen und grüßte zu seinem gebückten Rücken hin.
»Hallo, Genosse.«
Dieser internationale Gruß ist wunderbar, solange er lebendig ist und das künftige Ziel einer ganzen Welt einschließt. Er wird aber katastrophal, wenn er nicht ankommt, unfruchtbar wie eine leblose Wüste.
Als Svante Eriksson sich umdreht und wissen will, was zum Teufel ich denn meine, denke ich, dass das, was man sich über ihn erzählt, falsch sein muss. Was ich meine? Ja, weißt du, ich würde gerne ein wenig mit dir reden. Falls du Zeit hast?
Schiefer hätte es nicht laufen können. Er starrt mich misstrauisch an. In einer Hand hält er einen Schraubenschlüssel, wie ich ihn größer kaum gesehen habe.
Es läuft in der Tat schief, wirklich verdammt schief.
Dabei lag ich doch eigentlich ganz richtig. Svante war Kommunist gewesen, hatte schon mit fünfzehn, seit 1935, der Partei angehört. Alle, die ich über ihn sprechen hörte, meinten, man möge über ihn und seine Ansichten denken, was man wolle, aber er sei immer konsequent und aufrichtig gewesen. Keiner konnte sich erinnern, dass er mit seiner Parteizugehörigkeit und seinen Überzeugungen je hinter dem Berg gehalten hätte, auch dann nicht, als es am schwierigsten war. Von denen, die im Lager saßen, war er der Jüngste gewesen. Er war erst etwas über zwanzig gewesen, trotzdem holten sie ihn als einen der Ersten.
Mein Irrtum war also nicht, dass ich das Gehörte falsch verstanden hätte. Mein Fehler war, nicht zu bedenken, was in der Zeit dazwischen geschehen war. Dazwischen: fast dreißig Jahre. Svante Eriksson war nun bald sechzig.
Was soll ich sagen? Gut wurde die Beziehung zwischen Svante und mir jedenfalls nie. Er betrachtete mich mit konstanter Skepsis, ohne je unhöflich oder arrogant zu werden. Es gelang mir zu keiner Zeit, ihn zu überzeugen, dass ich lediglich wollte, was ich sagte, und nichts vor ihm verbarg. Mit einer Art widerwilliger Neugier half er mir trotzdem, vor allem, wenn es um Details zum Lager ging. Alles in allem trafen wir uns drei Mal. Zuerst an jenem missglückten Freitagnachmittag und danach an zwei Sonntagen im September 1973. Die erste Begegnung am Freitag auf dem Sandplatz der Straßenmeisterei, inmitten der schmetterlingsgleichen Schneepflüge, endete damit, dass er mir erlaubte, ihn am Sonntag zu besuchen. Anschließend kehrte er mir wieder den Rücken und hämmerte mit dem riesigen Schraubenschlüssel gegen eine verrostete Radmutter, dass die Rostsplitter mehrere Meter hoch flogen.
3.
Er fuhr einen Peugeot, Jahrgang 57. Das Einzige, was darin noch ganz schien, war der Fahrersitz. Ich hingegen musste auf einem umgedrehten Bierkasten Platz nehmen. Wo einst die Rückbank gewesen war, lagen eine alte Schrotsäge, einige Arbeitshandschuhe und ein Reserverad.
»Ich stehl hin und wieder Holz«, sagte er und grinste, als er bemerkte, dass ich nach hinten blickte.
Wir sind von der Hauptstraße abgebogen und holpern im ersten Gang dahin, als er unvermittelt von seinem Hund zu sprechen beginnt. Mit den Händen umgreift er kraftvoll das hellgraue Lenkrad und sieht starr durch die Scheibe nach vorn. Der Himmel ist bewölkt, und sein Gesicht nimmt im Inneren des Autos einen seltsam blassen Ton an. Ich sitze auf dem Bierkasten und halte mich an Handbremse und Armaturengriff fest. Wir sind schon seit einer halben Stunde unterwegs, ohne ein Wort zu wechseln. Plötzlich bricht der Rückspiegel aus seiner Befestigung und fällt runter. Genau in dem Moment, als wir von der Hauptstraße abbiegen und das linke Hinterrad über eine knorrige Fichtenwurzel rumpelt, die hier über den Weg kriecht. Die Federung des Peugeots ist ausgeleiert, es gibt einen harten und dumpfen Schlag. Der Rückspiegel löst sich, Svante und ich versuchen instinktiv, ihn aufzufangen. Unsere Hände stoßen aneinander, und der Spiegel fällt zwischen Kupplung und Bremspedal. Im selben Augenblick tritt Svante kräftig auf die Bremse und ist nicht mehr in der Lage, diese schnelle, impulsive Bewegung zu stoppen. Unter dem Bremspedal, das bis zum rostigen Boden durchgedrückt ist, geht der Spiegel zu Bruch.
Svante steigt aus dem Auto, bückt sich und kratzt die Spiegelreste zusammen. Dann wirft er die Scherben hinaus in den Wald.
Wir setzen unsere Fahrt fort, und da beginnt er unvermittelt von seinem Hund zu reden. Ich habe den Eindruck, dass er gründlich vorbereitet hat, was er sagt.
Der Peugeot hüpft langsam vorwärts, und plötzlich sagt er, der Hund habe Rapp geheißen.
»Wahnsinnig schnell war er zwar nicht«, sagt er. »Aber er konnte mithalten, wenn es drauf ankam.«
Wir kommen an einem offenen Platz vorbei, auf dem Holz gestapelt liegt. Das Erdreich ist von den schweren Lastwagen aufgewühlt, der Peugeot bekommt Probleme und fängt an, mit den Rädern durchzudrehen. Svante schaltet erneut in den ersten Gang, und es gelingt ihm, den Wagen auf festen Grund zu manövrieren. Doch statt weiterzufahren, bremst er ab, hält an und schaltet den Motor aus. Die Zündung muss falsch eingestellt sein, denn der Motor ruckt noch einige Male, obwohl Svante den Schlüssel herausgezogen hat. Er sitzt und starrt auf den zitternden Schaltknüppel, bis der Motor ganz ruhig ist. Dann erst wendet er sich zu mir und schlägt vor, dass wir aussteigen.
Als wir vor einem der Holzstöße stehen, sagt er plötzlich:
»Hier war der Weg zu Ende, bevor das Lager gebaut wurde.«
Nach einer langen Pause fügt er hinzu:
»Hier haben sie auch den Hund erwischt.«
Wir stehen da, Svante Eriksson und ich, die Herbstgerüche streifen langsam vorbei. Es ist ein stiller Sonntag, und die Farben sind nach wie vor leuchtend und klar. Noch hat es keinen Frost gegeben.
Svante streicht sich mit der Hand über die Wange und kratzt sich im Ohr.
»Hat sich einfach losgerissen, der Hund. Manche sind verdammt gut darin, sich zu befreien und ihren Besitzern nachzulaufen, wenn man sie richtig aufgezogen hat. Es ist keine Übertreibung, dass es Hunde gibt, die über tausend Kilometer zurückgelegt haben und richtig bei ihren Besitzern angekommen sind.«
Er schweigt einen Augenblick. In der Ferne kann man das Geräusch eines Autos hören, das auf der Hauptstraße vorüberfährt. Es klingt in Richtung Süden aus.
»Bin ja nicht mehr dazugekommen, ihn zu versorgen. Man hat mich ja in der Nacht abgeholt. Er hat geheult wie am Spieß, als ich wegmusste. Dieses entsetzliche, durchdringend hohe Jaulen, ich weiß nicht, ob du es schon einmal gehört hast.«
Er sieht mich fragend an. Ich schüttle den Kopf.
»Na ja. Später bekam ich irgendwie mit, dass es ihm gelungen war, sich von der Kette zu reißen und mir zu folgen. Irgendwo hier haben sie ihn erschossen. Weil sie glaubten, es wäre ein Fuchs, sagten sie. Er liegt wohl irgendwo hier auch begraben.«
Und dann, wieder im Auto, mit der Hand am Zündschlüssel:
»Das hatten sie mit uns wohl auch vor.«
Auf dem Rückweg vom Lager überfahren wir fast einen Hasen. Das Gegenlicht blendet, und Svante hat gerade noch Zeit für eine Notbremsung. Die Kupplung kann er nicht mehr durchtreten, und der Motor stirbt ab. Danach will er nicht mehr anspringen.
Wir sitzen schweigend da. Svante versucht es erneut, erfolglos. Eine kurze Pause, neuer Versuch. Wir werden wohl eine halbe Stunde so gestanden haben, bis plötzlich ein Ruck durch den Motor fährt und er wieder ruhig und gleichmäßig läuft.
4.
Ich bin also in den Marktflecken zurückgekehrt. Es ist viele Jahre her, seit ich zuletzt hier war, und noch einige mehr, seit ich von hier weggezogen bin. Der Schienenbus ist allerdings nach wie vor derselbe, nur riecht es nicht mehr so sehr nach Diesel, denn mittlerweile habe ich zu rauchen begonnen. Auch die Distanz scheint größer. Eigentlich sollte es umgekehrt sein, wenn man größer wird, wird alles andere kleiner. Aber hier, wo sich die Eisenbahn durchschlängelt, wirken die Wälder noch unendlicher als damals. Nach wie vor also dieser Schienenbus, eine feuergelbe ovale Wespe. Wir sind wenige Passagiere, vier Personen im Nichtraucherabteil und zwei bei den Rauchern: ich und ein alter Kerl, der mit einer Schnapsflasche in einem Schuhbeutel kämpft. Er scheint einen steifen Rücken zu haben, sicher ist er Waldarbeiter gewesen. Neben ihm auf dem Sitz steht eine abgetragene Tasche, die Flasche will nicht so recht, und er grinst scherzhaft in meine Richtung. Alles verläuft auf merkwürdige Weise ruhig, der Alte scheint schon seit tausend Jahren mit seiner Schnapsflasche beschäftigt. Wir fahren an Stationsgebäuden vorbei, leer wie ausgehöhlte Käfer. Die Schilder mit den Ortsbezeichnungen sind abmontiert, vermutlich als Souvenir und nicht als Protesttafel, und ich erinnere mich an überhaupt nichts mehr. Wie zum Teufel haben diese Stationen geheißen? Das ist ja nicht zu fassen, du bist hier sicher zwanzig Mal gefahren und warst damals kein Kind mehr. Nicht ein einziger Name fällt dir ein. Erst als der Schienenbus den ersten Halt bei einem braun gestrichenen Stationsgebäude einlegt, dessen Schild noch hängt, erinnere ich mich. Aber die toten Stationen, die man in den vergangenen vierzehn Jahren aufgegeben hat, sind aus meiner Erinnerung gelöscht. Doch als die Konturen der kleinen Marktgemeinde sichtbar werden, entsteht zwischen den beiden, vierzehn Jahre auseinanderliegenden Polen ein magnetisches Feld der Gemeinsamkeit. Die Brücke über den Fluss ist noch dieselbe, der Kirchturm und die grauweißen Wolken fließen ineinander. Die Fahrt verlangsamt sich, wir kommen am Rangierbahnhof vorbei, und kurz blitzt Bertils Gestalt auf. Es ist spät am Nachmittag, und wir treffen planmäßig ein.
Dieser Besuch dauert gut drei Wochen. Als ich hinterher, an einem Sonntagnachmittag, wieder in den Zug steige, habe ich viel Neues gelernt. Nicht nur über ein Lager, nicht nur über eine schreiende Geschichtsfälschung, sondern vor allem über das, was ich den Palast nenne.
Ein Palast, ein blauer Palast. Die Farbe ist politisch, der Bau ist politisch. Dieser Palast wird Volksheim genannt, seine blaue Farbe kam erst langsam hinter der roten Tarnfarbe zum Vorschein.
Ein blauer Palast. Bertil Kras schlummert an eine seiner Kiefern gelehnt.
Mit dem Rücken zu einer Entwicklung, die sich selbst das Rückgrat brechen wird. Das Knacken hört man nicht, es ist dumpf und langgezogen.
Kinderspiele oder Kindermärchen kommen mir in den Sinn. Robuste, knorpelige Baumstämme, deren Äste und Wurzellöcher menschliche Züge annahmen, die aber ebenso gut Tarnung, Spione, Ganoven und Banditen werden konnten.
So etwa war es mit Bertil und diesen ganzen ungeheuren fünfziger Jahren, eingebettet in Kaugummi und Filmstars, heruntergebrannte Sägewerke und Hass auf Kommunisten.
Auf der Rückfahrt mit demselben Schienenbus geschieht etwas Unerwartetes; ich sehe eine Gestalt aus der Vergangenheit wieder, eine Klassenkameradin aus den frühen Jahren der Volksschule, ein Mädchen, das einst mit mir in der Schulbank saß, rechts von dem erhöhten Katheder aus hellem Holz. Damals hieß sie Britt, jetzt scheint es unmöglich, sie mit diesem Namen anzureden. Sie sitzt mir gegenüber, diesmal sind mehr Leute da; viele, die Richtung Süden zur Arbeit fahren. Sie hockt hinter einer Ausgabe der Zeitschrift Femina, hat einen Ehering und raucht ununterbrochen. Wenn sie umblättert oder die Asche abstreift, wirft sie mir einen raschen Blick zu. Ich bin mir sicher, dass sie mich nicht erkennt. Gewiss habe ich mich verändert, mehr als sie, doch sie erkennt mich vor allem deshalb nicht wieder, weil sie hier nicht mit einem fremden Gesicht rechnet. Sie ist an ihrem Ursprungsort, ich komme von auswärts.
Während der Reise sprechen wir kein Wort miteinander. Ich bücke mich nur nach einem Handschuh, der ihr auf den Boden fällt. Sie lächelt ein wenig und schiebt ihn in ihre braune Handtasche.
Unsere Knie streifen einige Male aneinander, ein leidenschaftsloses Reiben, nichts anderes. Der Schienenbus ruckelt und wankt durch die Ödnis. Ich sehe ein paar ältere Fahrgäste instinktiv den Blick heben, wenn wir an den aufgelassenen Bahnstationen vorüberfahren. Hier haben sie die Köpfe seit jeher gehoben. Sie werden von der Zeit hinters Licht geführt, gleich kommt jetzt diese oder jene Station.
Ich sitze also meiner alten Klassenkameradin gegenüber, mit dem Rücken zur Fahrtrichtung. Ich denke daran, wie sie damals war. Am deutlichsten erinnere ich mich an ihre erstaunliche Schnelligkeit. In den Turnstunden rannte sie wie ein Windhund, niemand konnte mit ihr mithalten. Sie lief mit federnden Beinen und hatte den Hals dabei etwas nach vorn geschoben, wie eine Steuerflosse. Wir jagten sie manchmal einfach aus Freude, sie wie einen Pfeil davonschießen zu sehen. Unser Turnlehrer, der Kantor, der viel von körperlicher Ertüchtigung hielt, lobte ihr enormes Sprintertalent. Wir standen da und sahen, wie er ihr seine rechte Hand auf das helle Haar legte und sagte, sie »läuft wie eine kleine Göttin«. Mit einer zähen Mischung aus Neid und Stolz machten wir uns darüber lustig, indem wir einander zuflüsterten, dass »der Alte schon wieder seine Psalmen auf ihren Schädel klimpert«.
Jetzt, da sie mir auf dem dunkelroten Plüsch gegenübersitzt, sind ihre Haare kurz und braun. Damals waren sie blond und so lang, dass man sie flechten konnte.
In der Schule war sie nicht besonders gut. Oft konnte ich ihr mit diskreten kleinen Spickzetteln aushelfen, die über die Knie und in die Hände hin und her wanderten. Ich erinnere mich daran, dass ihre Handflächen warm und verschwitzt waren. Jetzt sehe ich zwei kühle, gutsituierte Hände, die eine Ausgabe der Femina halten.
Ich sitze ihr, dem Sprinter-Ass, gegenüber und erkenne mit bebender Klarheit, wonach ich eigentlich auf der Suche bin: eine Tür zu den fünfziger Jahren. Ich blicke zu ihr hinüber, sie blättert Seite um Seite um, und ich weiß absolut nichts von ihr, weigere mich sogar zu glauben, dass sie nach wie vor Britt heißen kann. Aber ich erlebe auf eigentümliche Weise, dass sie dennoch mein Interesse teilen könnte.
Eines der letzten Bilder auf dieser Rückreise ist ein Farbflimmern, bei dem im Hintergrund mit schrillen Kinderstimmen von der kommenden Blütezeit gesungen wird, ruckartig und falsch vor Eifer. Doch mitten hinein in dieses Flimmern trampelt ein Saufbold, groß wie ein Ochse, schlägt mit seinen enormen Fäusten die Kirchentüren ein, macht zwei Schritte auf die Altarschranke zu und ergreift das Altarbild. Hinter dieser Szene ertönt schnatternd das Lied, unbeeinträchtigt und ahnungslos. Der Saufbold reißt das Gemälde herab, auf dem Jesus im Licht seiner Auferstehung steht, am unteren Bildrand von dunklen römischen Schatten umgeben; alles in diesem dumpfen rotbraunen Ton, der vom spärlichen Licht unter dem Kirchengewölbe herrührt. Nachdem das Altarbild mit Gewalt entfernt worden ist, gähnt ein weißes Loch in der Wand. Der Saufbold setzt sich in die erste Reihe, sturzbetrunken. Allmählich beginnt er wild und heftig zu schnarchen, und erst dann verstummen die hellen Kinderstimmen.
Stille macht sich breit. Zuerst weiß ich nicht, wo sie herkommt, doch dann merke ich, dass der Schienenbus angehalten hat. Wir warten auf das letzte Fahrtsignal, bevor diese Rückreise endet.
Die Ausgabe der Femina hat sie in ihre Tasche gepackt. Mich überkommt plötzlich der Impuls, nach ihrer Hand zu greifen, um zu fühlen, ob sie vom nervösen Schummeln immer noch feucht und warm ist.
Aber alles bleibt still, der Impuls ist mir beinahe peinlich. Ich habe ihr jetzt nichts zu sagen.
Aber im Hintergrund von Bertil Kras gab es uns beide.
5.
Spätnachmittags, an einem der ersten Oktobertage 1940, erhielt Polizeikommissar Lönngren einen überraschenden Befehl vom Militärkommando. Schon als er die Ordonnanz sah, war ihm klar, dass etwas Besonderes vorging, etwas, das wichtiger war als die üblichen Reparaturen und Instandhaltungsarbeiten an Wachtürmen oder die Verstärkung der örtlichen Feuerwehr. Lönngren war gerade im Begriff, seinen Mantel anzuziehen, als er draußen auf der Straße ein Auto vorfahren hörte. Er stand in seinem Arbeitszimmer mit dem riesigen braunen Schreibtisch und ging rasch zum Fenster. Ein graues Militärfahrzeug verstellte den gesamten Zugang zur Polizeidienststelle. Hinten stieg ein großer, magerer Offizier aus. Lönngren sah sofort, dass es sich um einen hochrangigen Offizier handelte, was bestätigte, dass eine außergewöhnliche Mitteilung bevorstand. Rasch zog Lönngren den Mantel wieder aus. Er setzte sich auf den braunen Armlehnstuhl hinter dem Schreibtisch, machte die Lampe mit dem gelben Porzellanschirm an und konnte gerade noch ein Informationsschreiben zur Neuregelung der Zusammenarbeit zwischen der Heimwehrmiliz und der örtlichen Polizeibehörde hervorholen, als er heftige Schritte und ein Klopfen an der Tür hörte.
Etwas Vergleichbares hatte Lönngren zuvor noch nicht erlebt. Der Befehl, der vor ihm auf dem Schreibtisch lag, war etwas gänzlich Neues. Lönngrens Gesicht erstarrte, und er konnte den Blick nicht von dem maschinenschriftlichen Text heben, der die Hälfte des Bogens beanspruchte; darunter befanden sich eine krakelige Unterschrift und ein Stempel, der das Dokument zur Geheimsache erklärte.
Lönngren ist im Stuhl zusammengesunken. Vor der Tür hört er Stimmen, die laut werden und dann wieder verschwinden. Er ist völlig allein mit einem Kriegsbefehl, der ausgeführt werden muss. Noch bezweifelt er dessen Richtigkeit, noch ist ihm unklar, welche Konsequenzen diese kurzen und straffen Sätze auf dem Papier der Militärbehörde tatsächlich nach sich ziehen.
Er erinnert sich plötzlich an den Sommer 1939, als er zum ersten und bisher einzigen Mal in seinem Leben in Stockholm war und in der drückenden Wärme umherstreunte. Er wollte selbst den Weg zu jenen staatlichen Organen einschlagen, mit denen er beruflich in Kontakt stand. Er geht also den vorgezeichneten Spuren in der Stadt nach und nimmt dabei nur ganz vage die zunehmende Stille wahr; den Augenblick, als das Unvermeidliche Wirklichkeit wird. Lönngrens Heimreise mit dem Frühzug ist für den nächsten Tag geplant. Doch als er im Hotel von einem nervösen Zimmermädchen geweckt wird und erste Andeutungen bekommt, dass der Krieg ausgebrochen ist, macht er sich augenblicklich auf. Er bahnt sich einen Weg durch das ängstliche Chaos am Hauptbahnhof und sinkt im Nachmittagszug auf eine Bank in einem Abteil zweiter Klasse. Die Reise dauert elf Stunden, und erst im Zug nimmt er sich die Zeit, die Zeitungen zu lesen, die er neben sich auf den Sitz gestapelt hat.
Er ist allein im Abteil. Er raucht, und die Zigarettenasche fällt zu Boden.
Jetzt, fast genau ein Jahr später, liegt vor ihm der Befehl. Eine kurze Mitteilung, die Festnahmen hätten schnell zu erfolgen, mit größtmöglicher Diskretion. Die Liste, die dem knappen Befehl beigefügt ist, enthält die wichtigsten zehn Namen.
Lönngren beugt sich nach vorn. Er zieht die Liste zu sich und geht noch einmal die Namen durch. Er kennt sie alle. Er sieht die Gesichter dieser Menschen vor sich, die Situationen, in denen sie sich im Moment, an diesem Nachmittag im Oktober, befinden könnten.
Abrupt steht er auf und geht zu seinem Mantel hinüber, den er über den Besuchersessel geworfen hat. Aus einer der Taschen fischt er eine Schachtel Streichhölzer und kehrt zum Schreibtisch zurück. Er wirft einen raschen Blick aus dem Fenster, die Straße liegt verlassen. Er greift sich den Befehl und verbrennt ihn. Die Überreste sammelt er in dem grünen Aschenbecher, der aussieht wie ein Schwan mit gespreizten Flügeln. Zigarrenstummel und Papierasche verrührt er zu einem Brei. Er zieht den Mantel an und verlässt das grün gestrichene Polizeigebäude. An der Ecke biegt er ab und folgt der Straße zum Krankenhaus. Zu seiner Wohnung im ersten Stock des Hauses, das dem Farbenhändler gehört, ist es ein Spaziergang von etwa fünf Minuten.
In der Nacht liegt er wach im Bett. Er blickt in die Dunkelheit hinaus und reibt langsam den Ellenbogen am blankpolierten Kopfende.
Er plant die Festnahmen. Sein ganzes Bestreben zielt darauf, die Aktion so zuverlässig wie möglich vorzubereiten.
Alles andere versteht sich von selbst. Die Bedrohung aus dem Osten, die Beamtenpflicht, die Nation gegen ihre Feinde im Inneren zu verteidigen. Ein Schwede schweigt, damit der Feind nicht mithören kann, so wie Lönngren, der still daliegt und plant.
6.
Der Erste, der festgenommen wird, ist Svante Eriksson. Der entsprechende Beschluss wird in einem der Zimmer im Obergeschoß des Hotels gefasst. Die Beleuchtung ist gedämpft, drei Militärangehörige, ein unbekannter Beamter aus Stockholm und Polizeikommissar Lönngren werden sich um einen großen ovalen Tisch versammeln. Es ist kurz nach neun, als der tarnfarbene Volvo sich in die abendlich verlassene Gemeinde schleicht und neben dem Eingang zum Hotel auf dem umzäunten Grundstück parkt. Die drei Militärs und der dunkel gekleidete Mann steigen aus. Chauffeur haben sie keinen. Einer der vier hat selbst den Wagen gefahren. Sie betreten das Hotel und gehen hintereinander die Treppe hinauf. Im Speisesaal sitzt eine Kellnerin und strickt. Im Raum befinden sich zwei, vielleicht drei Gäste.
Lönngren ist bereits da. Er hat im dunklen Zimmer ein paar Runden gedreht und nach Schritten auf der Treppe gelauscht. Hören konnte er allerdings nur das schwache Klirren von Gläsern, die auf etwas anstoßen, und das entfernte Scheppern aus der Küche. Er trägt einen dunklen Anzug. Seinen Platz am Tisch hat er bereits gewählt und einen Notizblock auf den Stuhl gelegt, als Zeichen, dass er besetzt ist.
Sie grüßen leise murmelnd. Die Offiziere deuten Ehrbezeugungen an, und Lönngren schafft es nicht, den Namen des Beamten zu verstehen. Er fühlt lediglich einen harten, hektischen Händedruck. Die Leitung der Besprechung übernimmt der Beamte. Mit einer ruckartigen Bewegung zieht er den Mantel aus und wirft ihn aufs Sofa. Er scheint es eilig zu haben. Lönngren hat noch kaum Platz genommen, als der Beamte mit unerwartet lauter und schneidender Stimme die Anwesenden willkommen heißt. Im selben Moment bemerkt Lönngren, dass jemand, wohl einer der Offiziere, die Türen geschlossen hat. Die dunkle Stimme fährt scharf durch den Raum. Lönngren kann nicht umhin, dem Redner in die Augen zu sehen. Die Haltung der Offiziere ist entspannter, einer von ihnen zeichnet mit dem hinteren Ende eines Bleistifts etwas auf seine Handfläche.
Im Verlauf dieses Treffens, das eine gute Stunde dauert, muss Polizeikommissar Lönngren sich drei Mal äußern, ein Mal macht er es freiwillig. Er beantwortet die Frage, ob auf der Liste Namen stehen sollten, die darauf bisher nicht erfasst sind, ob die Liste vervollständigt werden müsste. Er verneint ohne zu zögern. Außerdem wird er gefragt, ob sich sämtliche Personen auf der Liste in der Gegend aufhalten, ob alle gefasst werden können. Bei dieser Frage denkt er einen Augenblick nach, ganz sicher kann er sich ja nicht sein. Schließlich antwortet er:
»Ich glaube, ja. Ich würde davon ausgehen.«
»Das liegt in Ihrer Verantwortung als Polizeikommissar.«
Die schwarze, eindringliche Stimme schlägt zurück. Lönngren nickt.
Die letzte Frage wird ihm von einem der schweigsamen Militärangehörigen gestellt, der bisher zu schlafen schien. Es handelt sich um einen jungen Mann, der etwas Scharfes und Gefährliches ausstrahlt. Mit zusammengekniffenen Augen blickt er ins Dunkel, das Kinn auf den gefalteten Händen. Er fixiert Lönngren plötzlich mit starrem Blick.
»Wie schätzen wir die Möglichkeit von Schwierigkeiten bei den Festnahmen ein?«, fragt er.
Lönngren sitzt da, ohne sich zu bewegen, den Blick zum Tisch gesenkt. Wie wir das einschätzen? Ja, wie, zum Teufel, denn? Die Gedanken in seinem Kopf frieren plötzlich ein.
»Es kann sein, dass es zu Problemen kommt. Wir reden ja hier nicht von Schwächlingen.«
Lönngren ist verwundert, wie ruhig seine Stimme klingt, er fühlt eine wachsende Unsicherheit aufsteigen, eine nagende Unruhe angesichts der gespenstischen Unwirklichkeit dieses Treffens. Es ist ja nicht Krieg, denkt er. Hier bei uns ist doch kein Krieg.
»Sämtliche Festnahmen haben während ein und derselben Nacht zu erfolgen. Der Transport sollte bei Tagesanbruch erledigt sein.«
Der junge Offizier mit den zusammengekniffenen Augen reißt plötzlich das Kinn von den Händen und fährt aus seiner gebeugten Haltung hoch. Wie ein aufspringendes Taschenmesser. Seine Aussage ist spitz und trifft Lönngrens Ohren wie ein Nadelstich.
Die Lage braut sich zusammen, und auf einem Baum lauert der Geier. Lönngrens Kopfschmerzen werden stärker, und er fragt sich, was in aller Welt das eigentlich soll. Warum sollen diese Leute gefasst und in diesen Militärbaracken auf der Brandstelle im Wald untergebracht werden? Unzuverlässige Elemente? Sind sie Kommunisten? Russenfreunde? Bolschewiken?
Lönngren ist mit einem Mal klar, dass man ihn in etwas hineinzieht, das er in seiner Gesamtheit niemals überblicken wird und von dem auch nicht vorgesehen ist, dass er die Kontrolle darüber hat. Die Grenzen der Beamtenpflicht, seine Verantwortlichkeit als Polizeikommissar und Staatsdiener mit begrenzter Zuständigkeit werden plötzlich undeutlich. Die Pflicht ist größer, sie beinhaltet offenkundig auch eine andere Verantwortung, der zufolge man handeln muss, ohne Fragen oder klare Gründe. Befehlen schweigend Folge leisten.
Rundum tobt ein Krieg. Das letzte Mal lag man im Kampf um Kolonien, dieses Mal führt man wieder einen kapitalistischen Krieg. Und unvermittelt bekommt Lönngren den Befehl, soundso viele Einwohner des kleinen Marktfleckens festzunehmen.
Sie sind ihm allesamt bekannt.
Das Treffen endet, eine braune Aktentasche wird zugeschlagen. Rasches Händeschütteln, angedeutete Ehrbezeugungen und Lönngren, der als Letzter die Treppe hinabsteigt.
Als er vors Hotel tritt, haben sie ihre Meinung plötzlich geändert. Es ist spät, warum also nicht gleich hier übernachten?
»Wen, zum Teufel, müssen wir dazu denn wecken?«, fragt der Major.
»Engberg, der Besitzer, wohnt dort drüben«, sagt Lönngren. Er zeigt auf das weiße Einfamilienhaus neben dem Hotel.
Noch einmal werden kurz Hände geschüttelt, und Lönngren bricht auf. Er verlässt die Herren über den Kiesweg, durch die eiserne Pforte in der niedrigen Steinmauer und geht dann dicht an den Hauswänden entlang nach Hause. Die Nacht ist frostig, und der Atem tritt ihm als herbstlicher Rauch aus dem Mund. Seine Schritte sind lautlos, er trägt Schuhe mit dicken Gummisohlen. In einer Diagonale überquert er den Friedhof, schneidet eine Grimasse, als er an einem neu ausgehobenen Grab vorbeikommt, biegt anschließend um die nördlich gelegene Friedhofsecke, lässt Utbergs Kuhstall hinter sich und beschleunigt sein Tempo, je näher er seiner Wohnung im ersten Stock der Farbenhandlung kommt.
7.
Kurz nach zehn sind alle in Lönngrens Büro versammelt. Neben Lönngren selbst gibt es zwei weitere Polizisten in der Gemeinde. Ekblad ist der älteste. Er ist Vater von sieben Kindern, überzeugter Abstinenzler. Groß und lautstark, abwechselnd aufgeregt und ruhig. Der andere ist Jan-Erik Olsson, knapp über dreißig, unverheiratet und vor einigen Jahren zugezogen. Er hat einen mittelschwedischen Dialekt, ist Kettenraucher und wohnt seit drei Jahren in einer Pension. Er ist schwer zu fassen, ausweichend und glatt.
Diese drei sind jetzt in Lönngrens Büro. Diese drei werden auch die Festnahmen durchführen.
Lönngren sitzt hinter seinem großen Schreibtisch. Er weiß nicht, was er sagen, wo er beginnen soll. Er weiß, was er nicht sagen soll, was er nicht sagen darf, doch jetzt geht es schließlich darum, diesen unliebsamen nächtlichen Auftrag begreiflich zu machen. Es irritiert ihn, dass sich sein Kopf so leer anfühlt. Während der durchwachten Nachtstunden hat er genau einstudiert, wie er Ekblad und Olsson den Auftrag unterbreiten wird. Doch nun ist er sich seiner Worte plötzlich nicht mehr sicher. Was bedeuten sie? Was wolltest du eigentlich sagen? Olsson blickt aus dem Fenster, wie immer wirkt er abwesend. Auf seine etwas eigentümliche Weise hält er eine Zigarette in der Hand, eingeklemmt zwischen kleinem Finger und Daumen. Die Asche fällt auf den Boden, und Ekblad starrt finster zu ihm hinüber. Ekblad hat sich breit in den Besuchersessel gesetzt, den Kopf an Lönngrens schwarzen Mantel gelehnt, der direkt hinter der Rückenlehne hängt.
Die Oktobersonne fällt durchs Fenster herein. Ein kalter und starker Lichtstrahl, der sich wie der Kegel eines Scheinwerfers über den Schreibtisch und eine der Längswände zieht. Das weiße Streifenmuster der Tapete leuchtet in seiner ganzen Tristesse.
In diesem Augenblick, in dem er etwas sagen, die Situation anpacken und ihr Kontur und Kraft geben sollte, hat Lönngren das seltsame Gefühl, all das zuvor schon einmal erlebt zu haben, in exakt der gleichen Stille, dem gleichen Sonnenlicht, mit der gleichen Zigarettenasche auf dem Linoleum. Seine Brust wird eng, er setzt sich in seinem Stuhl zurecht. Er wirft einen unsicheren Blick auf Ekblad, der damit beschäftigt ist, einen Anilinfleck auf Höhe der Brust von seinem Hemd zu entfernen. Und Olsson steht rauchend da und befindet sich in einer anderen Welt. Seine Zigarette ist erst zur Hälfte abgebrannt, noch ist die Glut nicht in der Nähe seines kleinen Fingers.
Polizeikommissar Lönngren hat in seinem Leben eine immer wiederkehrende Erfahrung gemacht, er nennt sie die erstarrte Uhr. Bisweilen hat er ein fast panisches Bedürfnis, die Zeit anzuhalten und eine noch so unbedeutende Situation dazu zu bringen, stehenzubleiben und ihm eine Atempause zu gewähren, eine Möglichkeit, zu leben, ohne dass eine Sekunde später alles vorbei ist. Am häufigsten und intensivsten erlebt er diesen Zustand in der Früh. Er erwacht und hat große Angst, dass der Tag, der eben beginnt, schon vorbei ist, vollendet in einem Nichts. Wenn er die Möglichkeit dazu hätte, würde er gern eine dieser Situationen einfrieren und sich darin einschließen, um Zeit zu gewinnen, eine Pause, in der die Uhr wirklich stillsteht. Er träumt nicht, dass der statische Zustand ewig anhalten möge. Er wünscht sich nur, dass er möglich wäre.
Er sieht es vor sich: Er kommt vielleicht mit seinem wöchentlichen Einkauf eben aus dem Lebensmittelgeschäft. Er steht auf der Treppe, die zum Bürgersteig hinabführt. In einiger Entfernung fährt ein Wagen die Hauptstraße entlang. Eine ältere Dame ist gerade auf dem Weg ins Uhrengeschäft. Sie hat die Hand auf dem Türgriff und sieht auf ihre Galoschen hinab, um nicht zu stolpern.
Und an dieser Stelle friert das Bild ein. In diesem Augenblick möchte Lönngren seine Pause finden, im Augenblick der erstarrten Uhr, in dem eine meditative Zwanglosigkeit entstehen kann, das Gefühl, vielleicht trotz allem hinterherkommen zu können. Das Gefühl, zumindest ein Mal Seite an Seite mit dem Leben zu laufen, nicht immer hoffnungslos hinterher.
Olsson drückt die Zigarette aus, und Ekblad belässt den Fleck, wo er ist. Plötzlich findet Lönngren den Faden wieder.
»Das hier wird jetzt ein wenig ungewohnt«, beginnt er. »Nicht nur eine Nachtaktion, sondern ein geheimer Militärbefehl. Der erste Kriegseinsatz, könnte man vielleicht sagen.«
Ekblads starrer Blick ist misstrauisch. Olsson zündet sich eine neue Zigarette an.
»Bevor ich genauer werde, will ich euch an euren Eid und eure Verschwiegenheitspflicht erinnern. Es geht jetzt um mehr als ein paar Worte.«
Ekblad verharrt in seiner behäbigen Skepsis. Auf seinem großen, feucht glänzenden Gesicht liegt ein argwöhnisches Grinsen. Olsson hingegen horcht auf, er entdeckt mit einem Mal an dem sonst so ruhigen Lönngren eine neue Unsicherheit.
»Wir haben den Befehl bekommen, ein paar Leute einzusammeln, die in diesen Kriegszeiten gefährlich sind. Wir sollen sie abholen und in die Baracken bringen, dort, wo vor einigen Jahren dieser Waldbrand war, ihr wisst schon.«
»Was haben sie denn getan?«, fragt Ekblad. »Bei uns in diesem Loch hier?«
»Nichts«, antwortet Lönngren. »Aber sie sind von höherer Instanz als … unzuverlässig eingestuft worden. Wir müssen uns einfach an die Befehle halten.«
»Verdammt komische Befehle«, unterbricht plötzlich der hagere Olsson. »Hast du eine Kopie davon?«
»Nein.« Lönngren schüttelt den Kopf. »Ist verbrannt.«
»Verbrannt? Was in aller Welt soll das bedeuten?« Ekblad richtet sich in seinem Sessel mühevoll auf.
»Es hieß in aller Deutlichkeit, dass der Befehl nach dem Lesen verbrannt werden muss. Ich sage euch, was drinstand. Wir müssen in der Nacht raus und die Leute abholen.«
Die Frage liegt auf der Hand. Olsson ist schneller.
»Wie viele und wer genau?«
Lönngren schiebt ihnen die Liste hin, die er vor sich auf dem Schreibtisch liegen hat. Olsson nimmt das Papier in die Hand. Die Asche rieselt auf die Stiftablage. Er nimmt das Blatt mit hinüber zu Ekblad, und gemeinsam gehen sie die Namen durch.
Einmal, ein zweites Mal. Unterschiedliche Schweigephasen: erst Konzentration, dann Überraschung, dann zunehmende Unwirklichkeit; sie richten den Blick auf Lönngren hinter seinem Schreibtisch.
»Ja«, sagt der. »Wir sollen sie diese Nacht abholen. Wir müssen eine praktikable Reihenfolge wählen.«
»Was ist das für eine verdammte Scheiße?«, unterbricht Ekblad und reißt sich mit einem schweren Schnaufen aus dem Sessel. Er findet einen sicheren Stand, zieht sich die Hose hoch und geht auf Lönngren zu.
»Es muss wohl noch einen anderen Grund geben als den, dass Krieg ist. Unzuverlässig? Von denen hat doch keiner je etwas Unrechtes getan. Alles erstklassige Arbeiter. Bessere lassen sich in diesem Loch hier ja kaum finden. Oder etwa nicht? Also warum?«
Lönngren antwortet nicht. Er weiß, dass Ekblad die Namen bald selbst zuordnen wird und herausfindet, was sie verbindet und einen hinreichenden Grund für die nächtliche Festnahme darstellt.
Doch es ist Olsson, der das Schweigen beendet.
»Kommunisten«, sagt er und verzieht das ausdruckslose blasse Gesicht zu einem kurzen Grinsen. »Jetzt geht es also los.«
Lönngren bemerkt den Unterton. Er spürt das beunruhigende Schwingen einer kalten Saite in Olssons wenigen Worten. Lönngren merkt, wie hinter seiner Stirn die Gedanken stotternd in Gang kommen. Aus dem dumpfen Schattenreich, das sich den ganzen Vormittag in seinem Kopf ausgebreitet hat, treten plötzlich ein paar klare Bilder hervor.
Olssons neutrales Gesicht, denkt er plötzlich. Schwedens Neutralität. Mit einem Mal hat diese zurechtpolierte Neutralität einen bedrohlichen, schlecht verborgenen Beiklang. Olssons einziges Wort: Kommunisten.
In Lönngrens Ohren hört es sich wie ein »endlich« an.
Die Gedanken blitzen vorbei. Ekblad macht drei Schritte zum Fenster und zurück.
»Zum Teufel noch mal, das ist doch nicht in Ordnung, Einar«, sagt er. Lönngrens Vornamen verwendet er nur in Extremsituationen. Er macht dabei eine ablehnende Geste zu der Liste hinüber, die Olsson in der Hand hält und mit forschendem Blick betrachtet.
»Wie soll das denn gehen, dass wir zu Sven Wiklund nach Hause fahren und sagen, du, hallo übrigens, jetzt musst du ins Gefängnis, weil du bist Kommunist, und das geht im Moment gar nicht? Was, denkst du, wird seine Frau dazu sagen? Sie bekommen jetzt ja bald wieder ein Kind. Das siebte, vielleicht auch das achte? Nein, Einar, also was soll das? Die Sache stinkt doch zum Himmel. Wer hat das denn entschieden?«
»Die Not«, fährt Olsson dazwischen. »Meinungen sind wirklich Waffen. Gefährliche Meinungen sind gefährliche Waffen. Die müssen unschädlich gemacht werden.«
Misstrauisch bemerkt Ekblad, wie plump Olsson sich ausdrückt. Lönngren widerstrebt der gefühllose Klang in Olssons Stimme, und er glaubt, sich an genau dieselben Worte Olssons zu erinnern, irgendwann früher. Doch es fällt ihm nicht mehr ein, wann das war, nicht in diesem Moment.
»Für dich ist das alles also einfach in Ordnung«, sagt Ekblad zu Olsson.
»Ja«, antwortet dieser. Das Wort kommt hastig, betont hart.
Lönngren erhebt sich. Er merkt, wie sich zwischen dem Riesenkerl und dem Schmächtling mit der plötzlich metallischen Stimme Irritation breitmacht.
»Es ist schließlich nicht das erste Mal, dass wir als Polizisten etwas tun müssen, das wir lieber lassen würden. Klar ist uns das unangenehm, aber es muss einfach sein. Ich habe mir gedacht, dass wir mit Svante anfangen, Svante Eriksson also. Nicht Svante Sturesson, der kommt später …«
Lönngren skizziert mit einfachen Worten die Strategie. Ekblad kehrt zu seinem Sessel zurück. Olsson steht mit dem Rücken am Fenster. Lönngren spürt, wie die Kälte allmählich nachlässt, wie der Plan sich konkretisiert.
Kurz vor vier trennen sie sich.
Sie sehen einander um halb elf am Abend wieder. Die Ortschaft ist leer, die meisten Fenster sind schwarz. Sie treffen sich auf dem Hof des Polizeigebäudes, gleich neben der Garage. Dort stehen sie im Schutz der Brandmauer und der nächtlichen Finsternis.
Ekblad klimpert mit den Autoschlüsseln, er soll den großen Volvo lenken.
In den Taschen haben sie Handschellen und ihre Dienstrevolver. Vermutlich hat zumindest Lönngren scharf geladen.
8.
Der Erste, der festgenommen wird, ist also Svante Eriksson. Er ist Kommunist und wohnt mit seiner Mutter in einem der Mietshäuser an der Bahn. Sein Vater ist vor einigen Jahren gestorben, er war Eisenbahner und Vorsitzender der örtlichen Parteigruppe. Die Mietwohnung, in der sie leben, verdanken sie der Arbeit des Vaters. Die vier roten, dreistöckigen Gebäude gehören der Eisenbahn. Als der Vater starb, hätte die Familie eigentlich dort ausziehen müssen. Doch da Svantes Mutter, knapp über sechzig, ein bis zwei Mal die Woche bei der Reinigung der Züge und des Wartesaals im Stationsgebäude hilft, konnten sie bleiben. Viele in der Gemeinde glauben, dass die Bahnverantwortlichen sich vor Svante langsam genauso fürchten wie vor seinem Vater. Das gleiche schlagfertige Maul, genauso belesen, bekommt ebenso oft Bücherpakete und seltsame Zeitungen. Man hat begonnen, Svante zu sehen wie seinen Vater, mit einer Mischung aus Respekt und Irritation. Ihre Ansichten finden die meisten abstoßend, doch abgesehen davon sind sie oft tüchtige Burschen, diese Kommunisten. Zugleich jedoch unfassbare Störenfriede und dabei ziemlich vorlaut.
Ekblad fährt mit dem schwarzen Volvo dicht an den Eingang des roten, dreistöckigen Hauses. Er stellt den Motor ab und lässt den Wagen die letzten Meter ausrollen. Der Kies knirscht. Die Scheinwerfer sind ausgeschaltet, lediglich Olssons Zigarette glimmt auf dem Rücksitz. Einen Augenblick sitzen sie still da, ehe Lönngren an den Türgriff fasst: Der Auftrag beginnt. Lönngren ist es auch, der an die Tür im zweiten Stock schlägt, links von der Treppe. Er klopft drei Mal, nicht allzu fest. Es hallt im Stiegenhaus wider, und Ekblad verzieht bei jedem Schlag das Gesicht. Olsson steht weit hinten, er starrt ungerührt auf die geschlossene Tür. Es ist kurz nach elf.
Was geschieht als Nächstes? Svante Eriksson erinnert sich nur, dass er es war, der öffnete. Er glaubt, dass er sich gerade waschen wollte, dass er im weißen Unterhemd dastand und eben den Wasserhahn aufgedreht hatte. Seine Mutter, Brita, bleibt irgendwo im Hintergrund. Sie sitzt im Zimmer, in ihrem Sessel am Fenster, das zur Eisenbahn, zum Rangierbahnhof und dem Stationsgebäude hinausgeht. Wie oft hatte sie hier ihren Mann, Svantes Vater, in den Dienst gehen und zurückkommen gesehen. Vermutlich liest sie oder flickt ein paar Klamotten. Es herrscht Ruhe, das Licht ist gedämpft, und im Zimmer ist es warm und gemütlich.
Doch was geschieht? Svante lässt das Wasser rinnen, ruft ins Zimmer hinein, »was, zum Teufel ist jetzt schon wieder los«, reißt dann die Wohnungstür auf und hat noch Zeit, in der hereinströmenden Kälte zu erschauern, ehe er begreift, dass das vor ihm im Dunkel des Treppenhauses Polizeikommissar Lönngren ist.
»Svante Eriksson?«, fragt Lönngren. Ekblad und Olsson scheuen in der lautlosen Dunkelheit zurück.
»Ja klar, was, zum Teufel … Hallo …«
Svante runzelt die Stirn und streicht die hellbraunen Haare zur Seite. Auf den nackten Schultern hat er Gänsehaut.
»Es ist am besten, wenn du dich gleich anziehst und mit uns kommst. Wir müssen dich mitnehmen.«
»Und warum?«
Etwa zur gleichen Zeit tritt Brita heraus auf den Flur. Sie sieht zum Wohnungseingang hin, erkennt aber nur den Rücken ihres Sohnes und hört Stimmen. Sie steht in der Zimmertür, als Svante sich plötzlich zu ihr umdreht und mit ihr redet.
»Mutter. Die sollen mich festnehmen. Komm her.«
Sie kommt nach vorn und stellt sich neben ihren Sohn, der viel größer ist als sie. Er rückt zur Seite, um ihr Platz zu machen. Da fällt ihr Blick auf Lönngren und die Schatten der anderen beiden im Treppenhaus.
»Ich kann in Gegenwart anderer nichts dazu sagen«, antwortet Lönngren. »Erst wenn wir allein sind.«
Brita starrt ihn an. Eine senkrechte Falte steht auf ihrer Stirn.
»Was können Sie nicht sagen?«
»Sie können nicht darüber sprechen, warum ich festgenommen werde.«
»Festnehmen? Was soll das denn?« Sie sieht ihn an und greift nach seinem Arm.
Doch im Grunde stellt keiner von ihnen den Befehl in Frage. Svante zieht sich an, Lönngren bewacht die Tür, und Brita weiß nicht, was sie sagen soll. Sie steht nur da und sieht ihrem Sohn dabei zu, wie er die gerade ausgezogenen Klamotten wieder anzieht. Die ganze Sache ist viel zu wenig greifbar, als dass sie zu heftigen Reaktionen führen könnte. Svante kleidet sich einfach fertig an, steht einige Sekunden lang still seiner Mutter gegenüber und flüstert ihr dann ein paar Worte ins Ohr.
»Das ist sicher bloß ein Irrtum. Weil ich Kommunist bin.«
Er sitzt zwischen Ekblad und Olsson auf dem Rücksitz. Lönngren hat das Steuer übernommen. Olsson raucht, und der Wagen ruckelt die nackten, ausgestorbenen nächtlichen Straßen der Gemeinde entlang. Von quietschenden Geräuschen begleitet nimmt der Volvo die Brücke über den Fluss, die spärlichen Straßenlaternen bleiben jäh zurück, und der Wald umfängt sie.
9.
Keiner im Wagen sagt etwas. Olsson raucht, Ekblad lehnt die Stirn an die kalte Fensterscheibe. Lönngren hält das Lenkrad mit beiden Händen. Der Wald und die Nacht liegen schwer um das schwarze Auto.
Als sie sich der Schranke nähern, etwa fünfzig Meter vor den Toren, bremst Lönngren den Wagen ab. Im Schritttempo fährt er bis zu der uniformierten Wache, die im kalten Scheinwerferlicht merkwürdig bleich wirkt. Lönngren kurbelt das Fenster herunter und nickt dem Wachposten zu, der einen Moment zögert, ehe er die Schranke hebt. Der Volvo springt mit einem Ruck an, und fast gleichzeitig werden von einigen dunklen Schatten die Tore geöffnet. Der Untergrund ist auf einmal eben. Am Rand des Scheinwerferlichts tauchen die Konturen der Baracken auf, in einer gleichmäßigen Reihe an den Wald gedrängt. Lönngren biegt zur nächstgelegenen Baracke ein und stellt dort den Motor ab.
Svante Erikssons Gesicht ist blass, der Blick ganz ruhig. Abwartend, mit einem leichten Anflug von Sorge.
Lönngren öffnet die Wagentür und steigt aus. Es ist zwanzig Minuten nach Mitternacht, und die Temperatur muss gefallen sein.
Der erste Lagerinsasse ist eingetroffen.
10.
Oktober 1940.
Wie bei den meisten Gerüchten ließ sich nicht mehr bis zum Ursprung zurückverfolgen, warum das Waldlager im Krieg von den Insassen Paradies genannt wurde. Der Spitzname ist als Ausdruck bitterer Ironie zwar begreiflich, aber es lässt sich unmöglich herausfinden, wer ihn das erste Mal verwendet hat. Es gab noch weitere: Verbrannter Grund zum Beispiel. Doch keine der Bezeichnungen schlug ein wie Paradies. In fast hundert Prozent der Fälle benutzten die Eingesperrten diesen Namen, wenn sie während ihrer Gefangenschaft über ihre Situation sprachen. Doch der Klang und der Widerhall des lichten Wortes Paradies hatte sich während der zwei Jahre verändert. Die nackte Ironie der Anfangszeit wurde langsam, aber unwiderruflich von dunkleren Untertönen abgelöst, einem bedrohlichen Nachklingen der Angst vor einer immer ungewisseren Zukunft.
Natürlich begriffen sie, was sie zu erwarten hatten, falls das Schlimmste eintraf. Natürlich lebten sie, offen oder verborgen, in einer ständigen Unsicherheit, von Wachträumen und nächtlichen Angstausbrüchen heimgesucht; Erschießungen, Hinrichtungen durch den Strang. Ihre Träume wiesen häufig eine verblüffende Ähnlichkeit auf. Ein wichtiger Bestandteil war das Moment der Plötzlichkeit, des Überfalls von hinten, nackt und ungeschützt. Doch ihre Gedanken stimmten nicht nur in den Träumen überein. Die Gefangenen strichen über den Vorplatz, bahnten sich ihren Weg, waren mit Holzhacken beschäftigt, verbrannten den Abfall; meist hielten sie ihre Sorge im Zaum, aber allen war klar, wo die Hinrichtungen gegebenenfalls stattfinden würden. Es würde hinter der, von den Eisentoren aus gerechnet, dritten Baracke geschehen. Ein gut verborgener Platz. Der Wald war überall dicht, und vier große Steinblöcke bildeten eine Mauer, vor der man die Gefangenen erschießen konnte. Sollte man sie erhängen, würde man einen oder mehrere Galgen direkt an den Eisentoren errichten, zwischen dem Zaun und dem Geräteschuppen. Dort eignete sich der Untergrund am besten, keine Reste von Baumstümpfen oder andere Unebenheiten. Dort würde der Holzsockel eines Galgens am stabilsten stehen.
So sahen sie ihre düsterste, aber nicht unvorstellbare Zukunft. Und die ganze Zeit benutzten sie das Wort Paradies als Spottnamen für ihr Lager.
11.
Der Herbstsonntag im Wald. Einen Moment lang gestatte ich mir, daran zu zweifeln, ob der Wirklichkeit noch zu trauen ist. Als ich über den Boden des ehemaligen Lagers gehe und mit dem Fuß gegen eine rostige Konservendose trete, kann ich mir nicht erklären, wohin die großen Steinblöcke, die bei den Erschießungen eine Mauer bilden sollten, verschwunden sind. Nirgends gab es auch nur eine Spur irgendwelcher Steinblöcke. Der Wald verbirgt nichts, die Erde ist nicht weich genug, um diese vier Riesen schlucken zu können. Doch es gibt sie nicht mehr, sie haben sich in Luft aufgelöst.
Als der Krieg sich wendet, lässt man die Gefangenen frei und reißt das Lager nieder. Dies geschieht im Frühling, es ist die Zeit des Huflattichs. Die Baracken werden in nur wenigen Wochen demontiert. Man fackelt sie ab und transportiert die Reste weg. Nach einem Monat ist nichts als plattgewalzte Erde und der Müllhaufen übrig. Der Zaun ist verschwunden, der Kiesweg endet in einem verwirrenden Nirgendwo. Doch in den Ort kommt ein knappes Dutzend ehemaliger Gefangener zurück. Sie tauchen plötzlich wieder auf den Straßen auf, lebendige Gestalten ungeachtet aller Geheimsprachen und undurchsichtigen Entscheidungsprozesse. Sie stehen vor uns, Kinder bekommen ihre Väter wieder zu Gesicht, in den Schlafzimmern werden flüsternd Gespräche geführt, in denen Bitterkeit und Hass abermals aufflammen.
Die sichtbaren Attribute sind entfernt. Übrig bleibt nur eine provozierend nackte Fläche, ein leerer Bühnenraum.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: